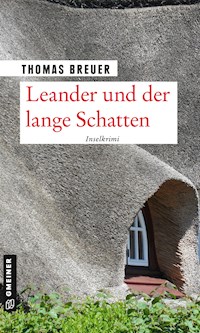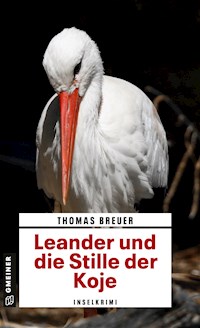7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Lassen Sie sich diesen spannungsgeladenen, historisch angehauchten Kriminalroman von Thomas Breuer auf keinen Fall entgehen und lüften Sie das Geheimnis um die grausamen Wewelsburg-Morde! Klappentext: Nachdem die gewalttätig zugerichtete Leiche eines alten Mannes in der Nähe der Wewelsburg aufgefunden wurde, begeben sich Hauptkommissar Lenz und Journalist Heller auf die Suche nach dem erbarmungslosen Täter. Doch nichts ist so, wie es scheint: Weitere Morde werden im Bürener Altersheim verübt und eine immer populärer werdende rechtsextreme Partei breitet sich in der Stadt aus. So kommt es, dass Lenz auf einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Gräueltaten, der Vergangenheit der ermordeten Senioren und der Wewelsburg zu Zeiten des Dritten Reiches stößt. Es beginnt ein brisanter Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Grenzen von Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen … Bekannt durch seine Henning-Leander-Krimireihe, beweist Autor Thomas Breuer auch mit „Der letzte Prozess“ wieder einmal, wie spannende Krimis mit historischem Twist für ein nervenzerreißendes Erlebnis sorgen. Was hat es also mit der Burg auf sich? Was steckt hinter den Morden? Und am allerwichtigsten: Wer ist der Mörder? Seien Sie bereit und tauchen Sie gemeinsam mit Kommissar Stefan Lenz und Journalist Fabian Heller in die dunkle Vergangenheit der Wewelsburg zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein. Lüften Sie das Geheimnis um die ermordeten Senioren Bürens. Worauf warten Sie also noch? Tauchen Sie jetzt in diesen hochspannenden Kriminalfall des beliebten Krimiautors Thomas Breuer ein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Thomas Breuer
Der letzte Prozess
Die langen Schatten des Dritten Reiches
EK-2 Publishing
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Moni & Jill von EK-2 Publishing
Der letzte Prozess
Die langen Schatten des Dritten Reiches –
Ein Fall für Fabian Heller und Stefan Lenz
von Thomas Breuer
„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch!“
(Bertolt Brecht: „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“, 1941)
Dies ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden. Abgesehen von einzelnen historischen Personen sind die Figuren fiktiv. Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1
„Schöne Schweinerei“, stellte Kriminalkommissarin Gina Gladow lapidar fest.
Sie stand vor der Burgmauer in Wewelsburg direkt gegenüber dem Kreismuseum neben Kriminalhauptkommissar Schröder und dem Rechtsmediziner Hermann-Josef Stukenberg und ließ das Szenario auf sich wirken.
„Grießpudding mit Himbeersoße“, sagte Stukenberg und grinste, als Schröder zu würgen begann.
„Ist es das, von dem ich glaube, dass es das ist?“ Gina Gladow hoffte inständig, dass Schröder ihr nicht auf die hohen Lederstiefel oder, schlimmer noch, auf die Leiche kotzte, und beugte sich etwas vor, als müsse sie die Bescherung aus nächster Nähe unter die Lupe nehmen.
Der Rechtsmediziner nickte. „Gehirnmasse, Knochensplitter und Blut.“ Er deutete auf einen Felsbrocken, der nur dreißig Zentimeter entfernt auf dem Pflaster lag und deutliche schwarzrote Flecken aufwies. „Der Klöpper da hat ihm die Schädeldecke zermatscht.“
Das war zuviel für Schröder. Er drehte sich um und hastete laut würgend in Richtung der Rasenfläche vor der gegenüber liegenden Kirche davon.
Kopfschüttelnd blickte Stukenberg ihm nach. „Dein Kollege hat wohl heute einen schwachen Magen.“
Gina Gladow antwortete nicht und trat noch etwas näher an die Matsche heran, die von den Kriminaltechnikern unter dem Felsbrocken freigelegt worden war. Unglaublich, dass das Geschlabber einmal ein menschliches Gehirn gewesen war. Der Geruch war nicht eindeutig zu identifizieren: Das Metallische des Blutes war bestimmend, aber auch eine süßliche Note und ein etwas fauliger Unterton waberten in der Luft. Die Masse hatte eine stückige Konsistenz, die nicht nur von den zahllosen Knochensplittern ausging, und ein Farbdurcheinander von käsigen Gelb- und glänzenden Rottönen. An den Rändern war das Blut braunschwarz verkrustet.
Wie nicht dazugehörig lag ein dürrer Männerkörper in einem zerrissenen, blutdurchtränkten Hemd ausgestreckt daneben. Das Opfer musste sehr alt sein, das erkannte Gina Gladow nicht nur an den spärlichen Resten grauer Haare in der Gehirn-Blut-Matsche, sondern auch an der dürren Gestalt, die wie hingegossen auf dem Kopfsteinpflaster lag, und an der geradezu durchsichtigen faltigen Pergamenthaut.
Ein Kriminaltechniker machte Fotos mit seiner Digitalkamera aus allen Positionen um den Toten herum und überprüfte die Ergebnisse auf dem Display. Er nickte zufrieden und entfernte sich dann wortlos zu seinem Einsatzfahrzeug.
„Schon gesehen?“, fragte Hermann-Josef Stukenberg. Der Rechtsmediziner deutete auf die völlig zermalmten Hände des Toten.
Gina Gladow hockte sich so dicht wie möglich neben die Leiche und sezierte die zermalmten Knöchelchen mit den Augen. Da war wirklich kein Glied mehr an dem anderen und kein Gelenk in funktionstüchtigem Zustand. „Auch von dem Steinklotz?“, erkundigte sie sich über die Schulter hinweg.
„Nee, sieht eher danach aus, als habe sich jemand mit seinem Stiefel ausgetobt.“ Der Rechtsmediziner hockte sich neben sie und deutete auf etwas neben der Leiche. „Hier im Blut ist ein Teilabdruck der Sohle zu erkennen. Treckingschuh oder Bergstiefel, schätze ich. Vielleicht auch ein Bundeswehrstiefel. Dürfte ein Leichtes gewesen sein, die morschen Knochen damit zu zermalmen.“
„Übertötung?“
„Eher Folter.“
Gina Gladow nickte. So etwas hatte sie sich schon gedacht, als sie die Striemen unter dem zerfetzten Hemd des alten Mannes gesehen hatte. „Passt zu der Neunschwänzigen Katze, mit der sich der Täter offenbar vergnügt hat“, stellte sie fest. „Daran, dass hier der Tatort ist, besteht ja wohl kein Zweifel, oder?“
„Ja und nein.“ Stukenberg richtete sich aus der gebückten Haltung auf und deutete mit dem Kopf an der Mauer entlang. „Was man so Tatort nennt. Zumindest den Todesstoß hat er hier bekommen. Allerdings gibt es Blutspuren bis da hinten am Berghang und dann auch noch den ganzen Pfad runter zum Fluss. Irgendwie erinnert mich das an den Kreuzweg.“ Er lachte trocken auf. „Komm mal mit.“
Gina Gladow folgte ihm an der Mauer entlang bis zu einer Bank, die für Wanderer direkt am Berghang aufgestellt worden war und einen weiten Ausblick über das Almetal mit seinen Flussschlingen, einer Bruchsteinbrücke und einem alten Bruchsteinhaus direkt am Wasserlauf bot. Diese Idylle stand in einem krassen Gegensatz zu dem Blut und der Tat, die hier oben verübt worden war.
Stukenberg deutete auf eine angetrocknete Lache direkt neben der Bank. „Der alte Mann hat den Waldweg den ganzen Berg herauf bis hierher vollgetropft. Dann hat er offenbar längere Zeit hier gelegen oder gehockt und viel Blut verloren. Die Spur führt weiter an der Mauer entlang bis zum Platz vor dem Wachgebäude. Irgendwie muss er es auf allen Vieren dorthin geschafft haben.“
„Und dort wurde er dann ermordet“, schloss Gina Gladow.
„So sieht´s aus.“
Die junge Kriminalkommissarin blickte den Waldweg entlang, auf dem Kriminaltechniker gerade die Spuren sicherten. „Und du meinst tatsächlich, dass der alte Mann sich mit den Verletzungen den ganzen Berg hochgeschleppt hat?“ Ihr Kopfschütteln machte deutlich, dass sie das für unmöglich hielt.
„Komm, ich zeige es dir.“ Stukenberg deutete mit dem Kopf den Hang hinab und machte sich auch schon auf den Weg.
Gina blickte zu Schröder zurück und überlegte, ob sie ihm Bescheid geben sollte. Der Kriminalhauptkommissar lehnte vornübergebeugt an ihrem Dienstfahrzeug und hatte offenbar Mühe, sich nicht die Seele aus dem Leib zu kotzen. Der war momentan zu nichts zu gebrauchen. Kurzentschlossen wandte sie sich um und folgte dem Rechtsmediziner den Hang hinunter.
Es ging in Serpentinen über einen rutschigen Waldweg, der vor Nässe glänzte und streckenweise sogar von einer Eisschicht überzogen war. An einer Stelle mussten sie über einen kleinen Bach springen, der den Weg kreuzte. Gina rutschte mit ihren Lederstiefeln fast aus, als sie am Rand auf der Eiskruste landete. Stukenberg grinste hämisch, hielt sich aber mit einer Bemerkung zurück, die die Aufmachung der Kriminalbeamtin betroffen hätte.
„Der alte Mann ist auf dem Weg hinauf immer wieder gestürzt“, erklärte er stattdessen. „Und immer da, wo er ausgerutscht ist, findet sich auch ein deutlicher Einschlag.“ Er deutete auf eine Stelle, an der sich irgendetwas scharfkantig in den Untergrund eingedrückt hatte.
„Heißt das etwa, er hat den Felsbrocken, mit dem er erschlagen wurde, selber hier hochgeschleppt?“ Ginas Stimme verriet, dass sie das für unvorstellbar hielt.
„Das müssen wir noch abgleichen. Wahrscheinlich war der Täter hinter ihm und hat ihn mit der Peitsche angetrieben. Deshalb die vielen Striemen und das zerfetzte Hemd.“
Nach mehreren Kehren traten sie unten auf eine schmale Straße, die den Berghang entlang und über eine Brücke hinaus in die Almeauen führte.
„Von hier könnte der Felsbrocken stammen“, stellte Stukenberg fest und zeigte auf locker verteilte Steine überall im Unterholz.
„Was ist denn das da drüben?“ Gina deutete über den Fluss hinweg auf das Natursteingebäude mit seinen Nebengelassen, das sie schon von oben gesehen hatte.
„Die alte Mühle“, antwortete der Rechtsmediziner. „Da war bis vor Kurzem ein Ausflugslokal drin. Sehr romantisch, direkt am Fluss mit großer Terrasse. Als die Betreiber aus Altersgründen nicht mehr weitermachen wollten, gab es keine Nachfolger. Heute ist sie unbewohnt.“
Gina nickte. „Seht euch da auch mal um“, sagte sie.
Stukenberg nickte wortlos. Dann machten sie sich wieder an den Aufstieg.
Als sie bei der Leiche oben vor der Burgmauer ankamen, sah Gina sich noch einmal den blutigen Felsbrocken an, den die Techniker inzwischen in eine Kunststoffkiste gehoben hatten. Auch die Peitschenstriemen betrachtete sie tief hinuntergebeugt mit auf dem Rücken verschränkten Armen.
„Sado-Maso scheidet in dem Alter wohl aus“, versuchte sie sich in einem unbeschwerten Tonfall, aber sie merkte selbst, dass der misslang. Der Anblick des blutigen Steinklotzes und des jämmerlichen Restes dessen, was einmal ein Mensch gewesen war, machte es selbst ihr schwer, eine professionelle Distanz zu halten.
Ein Kriminaltechniker trat zu ihnen und fragte: „Sind Sie fertig, Doc? Können wir den Leichnam wegschaffen?“
Der Rechtsmediziner nickte. Der Kriminaltechniker wollte sich schon wieder entfernen, als Gina fragte: „Hatte der Tote irgendwelche Papiere bei sich?“
„Wir haben keine gefunden.“
Stukenberg stupste sie an den Oberarm und deutete mit dem Kopf in Richtung ihres Dienstfahrzeuges. Ihr Vorgesetzter, Kriminalhauptkommissar Schröder, lehnte immer noch mit bleichem Gesicht am Wagen, hatte aber inzwischen eine Zigarette zwischen den Lippen und versuchte, irgendwohin zu sehen, nur nicht herüber zu den Spuren des nächtlichen Gemetzels. „Und das Weichei soll der Nachfolger von Schulte werden?“, fragte er verächtlich.
„Zumindest ist das zu befürchten“, antwortete die Kommissarin. „Beworben hat er sich auf den Posten. Aber vielleicht passiert ja noch ein Wunder.“
Sie nickte Stukenberg kurz zu und schlenderte zu Schröder hinüber. „Geht´s wieder?“, fragte sie in einem Tonfall, der selbst ihr zu wenig Mitgefühl und zu viel Häme ausdrückte.
Aber Schröder war offenbar so angeschlagen, dass er kein Gehör für unangemessene Zwischentöne hatte. Er nickte nur schwach und antwortete wenig überzeugend: „War wohl etwas viel gestern Abend. Mein Ältester ist Achtzehn geworden, da haben wir gefeiert.“
Gina ging nicht weiter darauf ein. „Keine Papiere. Hoffen wir mal, dass eine Vermisstenmeldung vorliegt, sonst wird es schwer, die Identität festzustellen. Ein Foto sollten wir jedenfalls besser nicht veröffentlichen. – Wer hat den Toten eigentlich gefunden?“
Schröder zog seinen Notizblock aus der Tasche und schlug ihn auf. „Ein Dr. Elling. Historiker drüben im Kreismuseum.“ Er deutete mit dem Kopf auf das Museumsgebäude. „War sehr früh dran heute Morgen, weil er irgend so ein Jugendcamp durchführt. Ausgrabungen ganz in der Nähe im Wald. Er parkt sein Auto immer direkt vor dem Museum. Fast hätte er die Leiche übersehen und wäre drübergerollt.“
„Das hätte auch nichts mehr kaputt gemacht“, warf Gina Gladow ein.
„War völlig fertig, der Knabe“, fuhr Schröder fort. „Ich habe ihm gesagt, er soll erst mal einen Kaffee trinken und sich später bei uns melden.“
Gina nickte. „Als Täter kommt er dann ja wohl nicht in Frage.“ Sie öffnete die Fahrertür und blickte ihren Vorgesetzten herausfordernd an. „Ich bin jetzt hier fertig.“ Letzteres begleitete sie mit einem ironischen Lächeln, das Schröder unmöglich missverstehen konnte.
Der musste sich erkennbar eine Zurechtweisung hinsichtlich ihrer Respektlosigkeit verkneifen und nickte ihr stattdessen zu. „Dann lass uns zurück ins Büro fahren.“ Er steckte sein Notizbuch wieder in die Jackentasche, öffnete die Beifahrertür und stieg ein.
Gina Gladow winkte noch kurz zu Hermann-Josef Stukenberg hinüber, der immer noch hämisch grinste, und stieg dann hinter das Steuer. Sie startete den Wagen und gab Gas. Die Reifen drehten auf dem vereisten Kopfsteinpflaster durch. Als sie schließlich packten, schoss der Passat über den Platz und zwischen Museum und Kirche hindurch auf den Burgwall.
2
Stefan Lenz´ erster Eindruck von Paderborn lautete: irgendwie unübersichtlich.
Er hatte die Autobahnabfahrt Paderborn Zentrum genommen und war so auf der B1 gelandet. Hier ging es zu wie am Kamener Kreuz, nur erkannte er auf die Schnelle keine Struktur: Die Abfahrt von der A33 und Auf- und Abfahrten von Bundesstraßen aus und in alle Richtungen folgten dicht aufeinander. Lenz vermisste einen Dauerstau wie auf der A2, der es ihm ermöglicht hätte, sich in Ruhe zu orientieren. Hinzu kam, dass der zweispurige Zubringer unter Brücken hindurchführte und eine dritte, rechte Spur häufig gleichzeitig dem Ein- und Ausfädeln zu- und abströmender Fahrzeuge diente, was die Sache für Ortsunkundige wie ihn nicht gerade übersichtlicher machte.
Von links und rechts schossen die Fahrzeuge durcheinander. Lenz hatte Mühe, seinen Opel Astra Kombi heile auf die Fahrspur zu manövrieren, die geradeaus in die Paderborner Innenstadt führte. Kaum hatte er sich aber richtig eingefädelt, zog ein schwarzer Porsche Cayenne links an ihm vorbei und scherte dann direkt vor ihm auf seine Spur, nur um sofort scharf zu bremsen. Lenz wich im letzten Moment nach links aus und gab Gas. Das könnte dem Mistbock so passen. Wofür hatte sein Diesel schließlich 136 PS? Wenn der glaubte, dass er einen Stefan Lenz ausbremsen konnte, nur weil er Porsche fuhr, hatte er sich aber geschnitten.
Lenz zog direkt vor der Brücke an ihm vorbei, zeigte ihm den Mittelfinger und wunderte sich noch über das hämische Grinsen des geschniegelten Rüpels, als es auch schon blitzte. Deshalb also hatte der Drecksack so scharf gebremst! Lenz spürte das Adrenalin in sich aufkochen. Am liebsten hätte er gleich hier angehalten und den Porschearsch aus seiner Karre geprügelt. Diese Schnösel hatte er ohnehin schon gefressen, aber so etwas schlug dem Fass ja wohl den Boden aus. Rüpel wie der hatten eine gehörige Abreibung verdient.
Im Rückspiegel sah Lenz, dass der Cayenne sich nun nach rechts in Richtung Bad Driburg einordnete. Der Fahrer winkte noch lachend, bevor er aus dem Blickfeld des Spiegels verschwand. Wütend donnerte Lenz beide Handflächen auf das Lenkrad und erblickte erst jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70. Seit wann galt die denn? Wie schnell war er eben eigentlich gewesen? 100? 120? Er konnte es nicht sagen. Auf jeden Fall viel zu schnell. Scheiß Porsche!
3
Fabian Heller war spät dran. Er hatte mit Mühe einen Abstellplatz für sein Auto im Detmolder Industriegebiet gefunden und hastete nun durch die Nebenstraßen, wo – Heller traute seinen Augen nicht – die Reiterstaffel der nordrhein-westfälischen Polizei patrouillierte. Sein Ziel war das Gebäude der Industrie- und Handelskammer. Dorthin war der Prozess gegen den ehemaligen SS-Mann Reinhold Hanning vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Detmold verlegt worden, da mit großem öffentlichen Interesse zu rechnen war und die Säle des Landgerichts nicht genügend Platz boten. Schließlich handelte es sich nicht nur um einen der seltenen Auschwitz-Prozesse in der deutschen Nachkriegsgeschichte, sondern angesichts des hohen Alters von Opfern und Tätern und der notwendigen Vorlaufzeit möglicherweise sogar um einen der letzten seiner Art – sicher aber um den letzten Prozess in Nordrhein-Westfalen.
Als Chefredakteur Brenner vom Westfälischen Anzeiger in Hamm ihm diesen Auftrag zugeschanzt hatte, hatte Heller sich erst einmal einlesen müssen. Was Nazi-Prozesse anging, hatte er überhaupt keine Ahnung gehabt. Das hatte er Brenner natürlich nicht verraten. Der hätte es fertiggebracht und den Auftrag Rogalski zugeschoben. Und bevor Rogalski einen Auftrag bekam … Jedenfalls hatte Heller eine Woche lang seine Wohnung und das Internet nicht mehr verlassen und war auf faszinierende Informationen gestoßen.
Dieser Prozess war überhaupt erst möglich geworden, weil sich in der deutschen Rechtsprechung ein Paradigmenwechsel ereignet hatte. Nach den großen Auschwitz-Prozessen in Frankfurt in den Jahren 1963 bis 1965 hatten einem ehemaligen SS-Mann konkrete einzelne Mordfälle nachgewiesen werden müssen, was in der Konsequenz bedeutete, dass eine Verurteilung wegen Massenmordes in Auschwitz nahezu unmöglich war und es schon deshalb gar nicht erst zur Anklage kam. Tausende alter Nazis hatten so jahrzehntelang unbehelligt überall in Deutschland leben und arbeiten können. Seit Kurzem reichte jedoch der Nachweis, dass ein Täter durch seine Arbeit im Konzentrationslager das System des Massenmordes in Auschwitz ermöglicht und unterstützt hatte. Man musste also nur noch beweisen, dass ein SS-Mann zu einer bestimmten Zeit im Konzentrationslager tätig gewesen war, und konnte ihn so mit den zu dieser Zeit begangenen Morden in Verbindung bringen.
Diese Neuausrichtung der deutschen Justiz war mit dem Fall John Demjanjuk im Mai 2011 eingeleitet worden. Der KZ-Wachmann war wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen im Lager Sobibor zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Skandalös wenig, wie Heller fand. Aber es war immerhin ein Anfang gewesen, denn im Zuge der Ermittlungen nach diesem Urteil hatte die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Dortmund fünf weitere ehemalige SS-Männer aufgespürt und Anklage erhoben. Im Sommer 2015 war dann der SS-Unterscharführer Oskar Gröning, ‚der Buchhalter von Auschwitz‘, in Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord an 320.000 Juden im Konzentrationslager Auschwitz zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das waren knappe sieben Minuten Strafe pro ermordetem Juden, wie Heller fassungslos nachgerechnet hatte.
Und nun lief in Detmold das Verfahren gegen den SS-Mann Hanning. Entsprechend groß war das Interesse der internationalen Medien. Zum Glück konnte sich Fabian Heller als akkreditierter Journalist in die Presseschlange einreihen, in die bereits Bewegung gekommen war, als er um die letzte Ecke hastete. Die um einiges längere Besucherschlange musste noch warten. In Fünfergruppen wurden die Medienvertreter, die aus ganz Europa kamen, eingelassen. Alle bedeutenden Fernsehsender und Polit-Magazine waren hier vertreten. Heller erblickte Kolleginnen und Kollegen, die er bislang nur aus dem Fernsehen kannte, und einige der regionalen Presseorgane. Der Kollege vom Westfälischen Volksblatt nickte ihm zu. Sie hatten sich vor einiger Zeit beim Landesparteitag der Linkspartei kennengelernt und, wie Heller sich erinnerte, und anschließend höchst unterschiedlich darüber berichtet. Der Konkurrent von der Neuen Westfälischen tippte hinter dem Mann vom Volksblatt auf seinem Handy herum. Die beiden standen so weit vorne, dass sie das Gebäude mit dem nächsten Schub betreten durften.
Heller rückte fünf Schritte vor und blickte sich um. Eine Gruppe uniformierter Polizisten stand etwas abseits und beobachtete das Geschehen. Sie wirkten geradezu unbeteiligt, als fühlten sie sich überflüssig. Allerdings schien man hier auf alles vorbereitet zu sein: Feuerwehr war vor Ort, Notarzt- und Rettungswagen standen am Straßenrand. Und die stolze Kavallerie aus Düsseldorf präsentierte hochherrschaftlich die Entschlossenheit des Rechtsstaates. Wozu so eine Reiterstaffel doch gut sein konnte!
Während die Journalisten sich nur verhalten austauschten und allenfalls etwas zu erfahren versuchten, ohne selbst ein Quäntchen preiszugeben, wurde in der Besucherschlange rege diskutiert. Ein älterer Mann und eine junge Frau stritten über den Sinn des Prozesses „so viele Jahre nach dem Krieg“, wie der Mann meinte. Die Frau argumentierte, Mord verjähre nun einmal grundsätzlich nicht und außerdem verstehe sie überhaupt nicht, was die Judenverfolgung mit dem Krieg zu tun haben sollte. Der Mann verwahrte sich gegen die Wortklauberei, was wiederum den Protest der jungen Frau hervorrief: Den industriellen Massenmord mit dem Zweiten Weltkrieg in einen Topf zu werfen, reduziere Auschwitz auf ein Kriegsgeschehen, für das man möglicherweise noch Verständnis aufbringen sollte. Derartige Verharmlosungen seien völlig unangemessen und würden den Opfern nicht gerecht.
„Im Krieg hat es auch Opfer gegeben“, murrte der Alte, „auch auf deutscher Seite. Und von den Millionen Vertriebenen will ich gar nicht erst reden.“
„Der ist doch unbelehrbar“, presste die junge Frau zwischen wütend zusammengebissenen Zähnen hervor und wandte sich kopfschüttelnd ihrer Begleiterin zu.
Heller rückte fünf Schritte vor. Hinter ihm hatten sich inzwischen weitere Journalisten angestellt.
Am Ende der Besucherschlange wurde es laut. Eine alte Frau versuchte, ihren Platz in der Reihe zu behaupten, während zwei junge Männer sie unnachgiebig hinausdrängten. Auch die junge Diskutantin bemerkte das Geschehen, gab ihren Platz in der Schlange auf und lief dorthin, um die Männer zu unterstützen.
„Das ist doch unerhört!“, wütete die alte Dame. „Wo ist denn die Polizei?“
Zwei Beamte eilten hinzu und erkundigten sich, was los sei. In dem Moment skandierten einige der Wartenden „Nazis raus!“, so dass Heller nicht verstehen konnte, was dort gesprochen wurde. Nur dass die Aufregung in der Besucherschlange zunahm und die alte Frau schließlich schimpfend davonging, bekam er mit.
Mit einem Siegerlächeln kehrte die streitbare junge Frau wieder zurück an ihren Platz in der Schlange. „Das war Ursula Haverbeck“, sagte sie, „die Holocaust-Leugnerin.“
Ihre Begleiterin klopfte ihr auf die Schulter und auch die anderen Umstehenden fanden, dass „dieses Nazipack“ im Gerichtssaal nichts verloren habe. Nur der alte Mann fragte grimmig, wie ein derartiges Verhalten sich mit der Meinungsfreiheit vertrage.
Heller rückte inzwischen weiter vor und durfte schließlich in einer Fünfergruppe das Gebäude betreten. Uniformierte Beamte forderten ihn auf, seine Taschen in eine Kunststoffbox zu leeren, seinen Presseausweis abzugeben und durch die Sicherheitsschleuse zu gehen. Auf der anderen Seite wurde er gründlich auf versteckte Waffen abgetastet. Dann bekam er seine Sachen zurück und durfte zusammen mit den anderen vier Journalisten den Sitzungssaal betreten.
Für die Pressevertreter waren Plätze reserviert worden. Dorthin wandte sich Fabian Heller und setzte sich neben eine junge Kollegin, die eifrig etwas in ihr Tablet tippte und von ihm keinerlei Notiz nahm. Heller fand, dass die Bezeichnung Kollege im Journalismus ein reiner Euphemismus sei. Immer ging es nur um die schnellste Nachricht und die beste Schlagzeile – darum also, dass man der Konkurrenz den entscheidenden Schritt voraus war. Seufzend zog er sein Tablet mit angedockter Tastatur aus der Tasche und öffnete das Notizbuch in OneNote, das er zu Hause schon eingerichtet hatte. Unter dem Reiter 11.02.2016 hatte er die Seite rund um den Prozess angelegt und nun notierte er in Stichworten die Beobachtungen, die er in der Warteschlange gemacht hatte.
Als die Pressebänke gefüllt waren, strömten auch die anderen Besucher gruppenweise in den Saal. Niemals würden die sechzig Zuschauerplätze für alle Menschen reichen, die draußen standen. Auf der gegenüberliegenden Seite setzten sich die beiden streitbaren jungen Frauen in die vorletzte Reihe. Heller nahm sich vor, nach der Sitzung zu ihnen zu gehen und sich die Vorkommnisse von draußen erklären zu lassen.
Dann betraten der Staatsanwalt, die Vertreter der vierzig Nebenkläger und die beiden Verteidiger den Saal, postierten sich vor ihren Tischen und schaufelten Unterlagen aus ihren Aktentaschen. Heller grinste über das Ritual, das etwas von psychologischer Kriegführung hatte: Man präsentierte sich zunächst einmal gegenseitig das Waffenarsenal, ohne dass ersichtlich wurde, wie viele Blindgänger und Rohrkrepierer darunter waren, was nur als Kulisse diente und wie viel Schlagkräftiges sich wirklich dazwischen verbarg. Bedrohlich wirkten die Aktenstapel allemal. So zeigten sich Juristen vor Gericht, wer den Längsten hatte.
Ein Raunen ging durch den Saal, als der Angeklagte hereingeführt wurde – ein vierundneunzigjähriger Greis mit gebeugtem Kopf und schleppendem Gang. Harmlos wirkte er, ein bisschen gebrechlich; der nette Opa von nebenan mit grauem Haar, grauem Anzug, gelbem Pullunder über einem weißen Hemd, und modischer Brille. So also sieht eine Bestie aus, dachte Heller, einer, der an den Morden in Auschwitz beteiligt gewesen ist. Kein Wunder, dass die fast alle nach 1945 so leicht hatten untertauchen und unbehelligt weiterleben können.
Die Vorsitzende Richterin betrat den Saal. Alle erhoben sich. Sie eröffnete die Verhandlung und forderte den Oberstaatsanwalt auf, die Anklageschrift zu verlesen. Sie wollte keine Zeit verlieren, das war eindeutig, denn angesichts des Gesundheitszustandes des Angeklagten waren die Prozesstage auf maximal zwei Stunden Dauer festgesetzt worden.
Oberstaatsanwalt Brendel von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für NS-Verbrechen in Dortmund referierte, was dem Angeklagten zur Last gelegt wurde: Beihilfe zum Mord in mindestens 170.000 Fällen in der Zeit von Januar 1943 bis Juni 1944 in Auschwitz / Polen. Er berichtete von den Vergasungen im Lager Birkenau, von den Erschießungen an der ‚schwarzen Wand‘, von Leichengruben, Hunger und Kältetod und von den Selektionen an der Rampe, die in den meisten Fällen direkt in die Gaskammern geführt hatten.
Im Januar 1942 sei der Angeklagte in das Konzentrationslager Auschwitz versetzt worden, wo er der 5. und später der 3. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbanns angehört habe und unter anderem für die Bewachung des Stammlagers Auschwitz I zuständig gewesen sei. Außerdem habe er als Wachmann an der Ausladung und Selektion der Gefangenentransporte für das Lager Auschwitz II Birkenau teilgenommen.
Unglaublich, dachte Heller und betrachtete den harmlosen Greis auf der Anklagebank.
Der Staatsanwalt führte aus, dass dieser Prozess einen begrenzten Rahmen setze, einen, in dem die Taten des Angeklagten eindeutig nachweisbar seien. Es handele sich um die sogenannte Ungarn-Aktion in der Zeit von Mai bis Juni 1944, in deren Rahmen 92 Transporte Juden nach Auschwitz gebracht hätten. Innerhalb von fünf Stunden seien diese abgefertigt worden – von der Rampe über die Gaskammern und Krematorien bis ins Massengrab.
Heller erinnerte sich, dass für genau diese Aktion bereits Oskar Gröning verurteilt worden war. Das ließ auf einen erfolgreichen Ausgang auch dieses Prozesses in Detmold hoffen.
Der Staatsanwalt betonte, dass der Angeklagte Beihilfe zu den Massenerschießungen in Block 11 des Lagers Auschwitz I und zur Selektion Kranker und Schwacher innerhalb des Lagers geleistet habe. Zudem sei Hanning daran beteiligt gewesen, die schlechten Lebensverhältnisse zu schaffen, unter denen die Häftlinge möglichst schnell sterben sollten. Insgesamt kamen also vier Tatbereiche zur Anklage.
Immer wieder ging ein leises Raunen durch die Reihen der Besucher, während das leise Klappern der Laptoptastaturen im Raum hing. Fabian Heller hatte Mühe, auf seinem Tablet mitzukommen. Außerdem versuchte er zwischendurch immer wieder, irgendeine Regung im Gesicht des Angeklagten zu erkennen. Reinhold Hanning aber zeigte keine Regung. Mit gebeugtem Kopf blickte er auf den Tisch, die Hände im Schoß gefaltet. Das alles hier schien nichts mit ihm zu tun zu haben. Dabei hatte er doch, wie Heller gelesen hatte, bei seiner Vernehmung im vergangenen Jahr zugegeben, dass er als Wachmann in Auschwitz gearbeitet hatte.
Der Oberstaatsanwalt kam nun zu der Karriere Reinhold Hannings innerhalb des NS-Apparates. Nach der Volksschule habe er zunächst in einer Fahrradfabrik gearbeitet und sich im Juni 1940 zur Waffen-SS gemeldet. Als Angehöriger der SS-Division Das Reich habe er auf dem Balkan und später in Russland gekämpft, bis er Anfang 1942 als Sturmmann nach Auschwitz gekommen sei. Dort habe seine Karriere Fahrt aufgenommen: im Februar 1942 Beförderung zum SS-Rottenführer, im September zum SS-Unterscharführer. Dass ihm nur die Verbrechen ab 1943 zum Vorwurf gemacht wurden, begründete der Staatsanwalt damit, dass Hanning kurz vorher einundzwanzig Jahre alt geworden sei und damit volljährig. Zu der Zeit müsse er zudem gewusst haben, woran er sich da beteiligte.
„Reinhold Hanning waren sämtliche Tötungsarten und -methoden bekannt“, schloss der Oberstaatsanwalt. „Ihm war bewusst, dass sämtliche Tötungsmethoden ständig bei einer hohen Zahl von Menschen angewandt wurden und dass auf diese Art und Weise und mit der geschehenen Regelmäßigkeit nur getötet werden konnte, wenn die Opfer durch Gehilfen wie ihn bewacht wurden. Er wollte mit seiner Wachdiensttätigkeit die vieltausendfach geschehenen Tötungen der Lagerinsassen durch die Haupttäter fördern oder zumindest erleichtern.“ Mit diesen Worten zog sich der Oberstaatsanwalt hinter seinen Aktenstapel zurück.
Nun hatte die Verteidigung das Wort. Hannings Rechtsanwalt verschränkte seine Arme vor der Robe und verkündete: „Unser Mandant wird sich derzeit nicht zur Sache äußern.“ Stattdessen stellte er zunächst den Antrag auf Widerspruch der Verwertbarkeit der Aussagen seines Mandanten bei dem Verhör im Jahre 2014. Reinhold Hanning sei von den Ermittlern überrascht worden. Der alte Mann sei dieser überfallartigen Situation nicht gewachsen gewesen und sei Opfer einer „kognitiven Schwäche“ geworden. Entsprechend sei sein Geständnis, in Auschwitz tätig gewesen zu sein, nicht gerichtsverwertbar. Eine Beteiligung an den Morden bestreite er ohnehin grundsätzlich. Weitere Aussagen werde er zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht machen.
Stattdessen referierte der Verteidiger nun seinerseits den Lebenslauf des Angeklagten. Danach war Hanning seit 1940 beim Militär gewesen und 1944 in englische Kriegsgefangenschaft geraten. Am 20. Mai 1948 sei er daraus wieder entlassen worden, habe ein Jahr lang als Koch bei der Standortverwaltung gearbeitet, anschließend als Verkäufer und Ausfahrer in einer Molkerei, die er 1969 übernommen und bis 1984 geführt habe. In diesem Vortrag fiel nicht ein einziges Mal das Wort Auschwitz und auch von der SS-Mitgliedschaft seines Mandanten sprach der Rechtsanwalt nicht.
Fabian Heller konnte das Unwohlsein, das sich angesichts dieser technischen Abarbeitung eines Bereichs des wohl umfassendsten Massenmordes aller Zeiten im Gerichtssaal ausgebreitet hatte, geradezu mit Händen greifen. Wie musste den Opfern wohl zumute sein, deren individuelles Leid derart technokratisch auf ein juristisches Taktieren zu Gunsten des Täters reduziert wurde?
Das schien auch die Richterin zu spüren und so verkündete sie eine Anmerkung, bevor die Beweisaufnahme eröffnet würde. Sie stellte fest, dass dieser Prozess ein ganz besonderer sei, weil er eine politische Dimension habe. Und sie machte klar, dass es vor allem um die individuelle Schuld des Angeklagten gehe. „Der geschichtliche Kontext, das Grauen von Auschwitz, ist hinreichend geklärt“, stellte sie klar und ließ ihren Blick durch den Saal gleiten, bis er sich an dem Verteidiger Hannings verfing. „Darum wird es hier in Detmold nicht mehr gehen!“
Heller verstand das als Warnung an die Adresse der Verteidigung, nicht zu versuchen, unnötige Nebenkriegsschauplätze aufzumachen und Nebelkerzen zu werfen.
Hier werde es nun vielmehr um das Anliegen der Opfer gehen, die Geschichte ihres Leidens vor einem deutschen Gericht vorzutragen. „Und dem wollen wir nachkommen“, sagte die Richterin in einem Tonfall, der keinerlei Zweifel zuließ.
Nachdem das geklärt war, eröffnete sie die Beweisaufnahme, rief den Zeugen Leon Schwarzbaum in den Zeugenstand und forderte ihn auf, zunächst seine biografischen Daten zu Protokoll zu geben. Der vierundneunzig Jahre alte Mann wirkte gefasst, aber seinem Gesicht glaubte Heller das Leid ansehen zu können, das er seit über siebzig Jahren mit sich herumtrug. In seinem schwarzen Anzug und mit dem schütteren Haar wirkte er älter und gebrechlicher als Reinhold Hanning.
Schwarzbaum entfaltete einen Zettel, blickte kurz darauf und berichtete dann, dass er in Hamburg geboren worden und im Alter von drei Jahren mit seiner Familie in die Heimat seiner Mutter, nach Bedzin in Polen, vierzig Kilometer von Auschwitz entfernt, übergesiedelt sei. Dort habe er ein gutes Leben gehabt, mit Musik und Sport.
„Dann brach das Grauen über uns herein“, sagte er tonlos. 1943 sei das gewesen, als seine Eltern abgeholt und nach Auschwitz-Birkenau verschleppt worden seien, am 22. Juni. In den folgenden drei Tagen seien viele Bedziner Juden, unter ihnen seine Eltern, vergast worden. Vier Wochen später hätten die Nazis dann ihn abgeholt. „Fünfunddreißig Mitglieder meiner Familie wurden ermordet“, las Leon Schwarzbaum von seinem Zettel ab und Heller bewunderte den alten Mann für die Haltung, die er hier im Gerichtssaal angesichts dieser fürchterlichen Erlebnisse bewahrte. „Man ahnte, was in Auschwitz geschah. Die Maurer, die dort Gaskammern bauten, erzählten davon. Eltern warfen daraufhin ihre Kinder aus den Zügen in der Hoffnung, dass wenigstens diese überlebten.“ Bei der Beschreibung der Geschehnisse auf der Rampe versagte Leon Schwarzbaums Stimme kurz, aber er zwang sich, weiterzuerzählen: „Ich stand daneben, als ein siebzehnjähriges Mädchen erschossen wurde. Sie hatte rote Haare. Ich sah, wie der SS-Sturmführer Schwarzhuber auf dem Motorrad vor einem Lastwagen herfuhr, auf dem nackte Menschen zusammengepfercht waren. Sie weinten, sie schrien, sie reckten die Hände zum Himmel. Dantes Inferno. Ich träume noch heute davon. Jeden Tag verfolgen mich die Bilder aus Auschwitz. Die SS war grausam und sadistisch.“
Im Gerichtssaal war es nun totenstill. Mit der Aussage Leon Schwarzbaums hatte sich die Atmosphäre vollständig geändert. Nichts mehr war zu spüren von der kalten juristischen Technokratie. Nur Reinhold Hanning schien von der Leidensgeschichte vollkommen unberührt.
Der Zeuge blickte von seinem Zettel auf und fragte in nachdenklichem Tonfall ohne bestimmtes Ziel: „Warum haben sie das getan? Warum haben sie alle diese Menschen umgebracht? Was war die Motivation? Das möchte ich gerne wissen.“ Und direkt an den Angeklagten gewandt, fuhr er fort: „Herr Hanning, wir sind fast gleich alt und bald stehen wir vor dem höchsten Richter. Ich möchte Sie auffordern: Sprechen Sie darüber, was Sie und Ihre Kameraden getan und erlebt haben.“
Der Angeklagte blickte vor sich auf die Tischplatte und schwieg. Keine Regung war seinem Gesicht anzusehen, kein Zucken um die Mundwinkel, nichts, das auch nur ansatzweise so etwas wie Gefühl verraten hätte.
Stattdessen meldete sich sein Verteidiger zu Wort: „Die Verhandlungszeit für meinen Mandanten ist abgelaufen. Laut medizinischem Gutachten sind ihm nur zwei Stunden zuzumuten. Davon müssen die Fahrt zum Gericht und fünfzehn Minuten vor Verhandlungsbeginn abgezogen werden. Folglich sind wir schon fünf Minuten drüber.“
Heller hätte den Mann erwürgen können.
Vor dem Gebäude hielt er nach der jungen Frau Ausschau, die vor der Verhandlung an der Aktion gegen die alte Dame beteiligt gewesen war. Sie befand sich in einer erregten Diskussion mit anderen Prozessbeobachtern und ereiferte sich gerade über die Schlussbemerkung des Verteidigers.
„Das ist doch unerträglich“, wütete sie. „Der arme Massenmörder kann nicht mehr als zwei Stunden am Tag behelligt werden, aber den Opfern mutet man zu, aus Israel und Kanada anzureisen, um hier ihre Aussagen zu machen. Der Rechtsstaat macht sich lächerlich und wir lassen das zu!“
„Immerhin findet der Prozess nun statt“, wandte ein Mann ein, den Heller auf etwa fünfzig Jahre schätzte. „Der Staat duldet keine Beteiligung am Massenmord. Das ist doch ein wichtiges Signal.“
„Ja, siebzig Jahre nach der Tat! Aber lassen wir das.“ Die junge Frau winkte ab und wandte sich zum Gehen.
Heller trat ihr in den Weg und machte, als sie ihn grimmig anfunkelte, eine beschwichtigende Geste. „Fabian Heller, freier Journalist“, stellte er sich vor. „Ich würde Sie gerne einen Moment sprechen.“
„Worum geht´s?“
„Um die Situation vorhin hier vor dem Gebäude. Wer war die alte Frau, mit der Sie in Streit geraten sind?“
„Ich bin nicht mit ihr in Streit geraten, ich habe dafür gesorgt, dass sie verschwindet.“
„Das habe ich gesehen. Aber warum?“
„Weil das eine vorbestrafte Holocaust-Leugnerin ist. Ursula Haverbeck hat schon bei dem Gröning-Prozess in Lüneburg behauptet, dass Auschwitz gar kein Vernichtungslager gewesen sei, sondern lediglich ein Arbeitslager. Die Alte ist deshalb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, aber das hält sie nicht davon ab, ihre rechte Hetze weiterhin zu verbreiten. Wenn wir sie nicht daran gehindert hätten, dann hätte diese Nazi-Tante eben im Gerichtssaal gesessen. Das wäre eine Verhöhnung der Opfer gewesen und die Polizei hätte nichts dagegen unternommen. Die wussten ja nicht mal, wer das war.“
Heller machte sich Notizen auf einem kleinen Spiralblock und sagte dann: „Frau …“
„Hesse.“
„Frau Hesse, Sie sind offenbar eine sehr engagierte Bürgerin. Ich habe Ihre Wut eben mitbekommen. Können Sie mir sagen, warum Sie so wütend auf die Justiz sind?“
„Weil sie sich vorführen lässt. Gucken Sie sich den Prozess gegen Beate Zschäpe in München an. Seit über drei Jahren führt die Nazisse die Justiz an der Nase herum. Die hat drei Verteidiger und wenn es eng wird, stellt sie einen Antrag auf Mandats-Entbindung. Diese Verbrecher bekommen jede Unterstützung und wie ist man mit den Opfern umgegangen? Kriminalisiert hat man die. Die Nachfahren und Überlebenden müssen mit ansehen, wie die Ehre ihrer Väter mit Füßen getreten wird, während die Ehre der Mörderin – mutmaßlichen Tatbeteiligten, da muss man ja sehr gut aufpassen – stets gewahrt werden muss. Und hier läuft wieder genau dieselbe Scheiße. Zwei Stunden sind dem Herrn Massenmörder zumutbar. Zwei Stunden! Das hat seit siebzig Jahren Methode in Deutschland. Wissen Sie, wie ich das finde? Zum Kotzen finde ich das!“
Sie drehte sich abrupt um und rauschte ohne Gruß in Richtung Parkplatz davon. Heller sah ihr nach und fragte sich, warum er selbst so ruhig bleiben konnte, obwohl er doch all dem zustimmte, was die junge Frau gesagt hatte. Und auch sonst regte sich niemand in seinem Umfeld dermaßen auf. Woher kam dieser Mangel an Empathie, diese Gleichgültigkeit?
Er steckte seinen Spiralblock in die Tasche und machte sich sehr nachdenklich auf den Rückweg zu seinem Wagen.
4
Die Paderborner Kreispolizeibehörde war in der Riemeckestraße untergebracht, in einem dreistöckigen Klinkerbau mit Flachdach. Das Gebäude machte einen hellen und freundlichen Eindruck, ganz anders als der schmutzigrote Ziegelbau der Hammer Polizeidirektion, der noch aus der Kaiserzeit stammte. Aber irgendwie wirkt das hier auch verschlafen, dachte Lenz. Hier also, in Paderborn, dem schwärzesten Loch der ostwestfälischen Provinz, würde er von nun an sein berufliches Leben fristen.
Na ja, wenigstens war das heute nur sein Antrittsbesuch. Gleich nachher würde er zu seiner neuen Wohnung in der Kisau fahren, sich ein, zwei Stunden aufs Ohr hauen und dann die Kneipen-Szene der Domstadt erforschen. Mit Bedacht hatte er sich inmitten von Studentenkneipen direkt am Paderquellgebiet eingemietet. Solche Viertel versprachen Abwechslung. Das bevorstehende Wochenende würde schon dafür sorgen, dass er den einen oder anderen Zufluchtsort für die langen Abende nach dem eintönigen Dienst fand. Seufzend schloss er die Zentralverriegelung seines Wagens.
In der funktionalen Halle suchte er sich auf dem Raumplan den Weg zur Direktion Kriminalität und zum Büro von Kriminaldirektor Heitkamp im 2. Stock. Dort angekommen, klopfte er an die Tür des Vorzimmers. Als er nichts hörte, drückte er die Klinke und trat ein. Der Schreibtisch der Sekretärin war leer, die Tür zum Büro nebenan stand offen. Also wandte er sich direkt dorthin.
Ein verhärmter Mittfünfziger in dunklem Anzug und mit glatten schwarzen Haaren saß hinter seinem Schreibtisch und blickte durch seine schwarzgerahmte Brille erstaunt auf, als Lenz an den Türrahmen klopfte und sich räusperte. Der Mann schien nicht gewohnt zu sein, von sich aus auf Leute zugehen zu müssen, und wartete mit missbilligendem Blick auf eine Erklärung für das unangemeldete Eindringen. So stellte man sich einen verknöcherten Verwaltungsbeamten vor.
„Kriminalhauptkommissar Stefan Lenz. Ich soll mich heute hier melden.“
„Herr Lenz!“ Kriminaldirektor Heitkamp schnellte hoch und knöpfte sein Jackett zu. Dabei entwickelte er eine Lebendigkeit, die der Hauptkommissar ihm gar nicht zugetraut hätte. „Schön, Sie zu sehen. Bitte, nehmen Sie Platz.“ Er deutete auf den Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch. „Haben Sie uns gut gefunden?“
„Bisschen komische Verkehrsführung an der Autobahnabfahrt, aber sonst kein Problem.“
„Schön, dass Sie es schon heute einrichten konnten“, freute sich Heitkamp. „Das gibt uns die Gelegenheit, offene Fragen vorab zu klären. Dann können Sie am Montag gleich durchstarten.“ Erwartungsvoll strahlte er seinen neuen Mitarbeiter an.
Lenz hatte keine offenen Fragen. Er würde die Leitung des Kriminalkommissariats 1 der Paderborner Kreispolizeibehörde übernehmen, das für Todesermittlungen, Sexualdelikte, Qualifizierte Körperverletzungen, Brandermittlungen und Umweltdelikte zuständig war. Die Bewerbung war glatt durchgegangen. In Hamm war er längst abgemeldet, heute war der letzte Tag seines Resturlaubs, ab Montag stand er den Paderbornern zur Verfügung. Was sollte es da noch für offene Fragen geben? Also wartete er ab, was von dem Kriminaldirektor kam.
Aber auch der schien von sich aus das Gespräch nicht vorantreiben zu wollen. Schließlich räusperte er sich verlegen und griff nach einer Mappe, die oben auf einem Stapel zu seiner Rechten lag. „Ihre Personalakte ist eingetroffen. Sie haben eine beeindruckende Aufklärungsquote. Ich bin sicher, dass Ihre Vorgesetzten in Hamm Sie ungerne ziehen lassen.“ Er lachte trocken auf und blickte Lenz auffordernd an.
Der hütete sich, das Gegenteil zu gestehen. Heitkamp würde ihn früh genug selbst kennenlernen. Stattdessen nickte er zweideutig lächelnd.
„Nun ja“, fuhr der Kriminaldirektor fort und schloss die Personalakte wieder. „Von meiner Seite aus ist alles klar. Wenn Sie keine Fragen haben, schlage ich vor, dass ich Ihnen Ihre neuen Kollegen vorstelle.“
„Gerne.“ Lenz schob den Stuhl zurück und stand auf.
Kriminaldirektor Heitkamp umrundete seinen Schreibtisch und ging vorweg zur Tür. „Sie werden sicher gut mit Ihrem Kollegen Schröder auskommen. Ein umgänglicher Typ, immer korrekt, wenn Sie verstehen, was ich meine.“
Lenz hoffte, dass er den Kriminaldirektor nicht richtig verstand. Korrekte Typen hatte er gefressen. Die machten Cops wie ihm immer nur das Leben schwer. Aber er verkniff sich eine entsprechende Replik.
„Frau Gladow ist erst seit Kurzem bei uns“, fuhr Heitkamp fort, während sie zügig den Flur entlanggingen. „Sie kennt sich mit den modernen Medien hervorragend aus und ist schon allein dadurch eine Bereicherung für unsere Dienststelle.“ Wodurch sonst noch, ließ er offen.
Am Ende stieß er ohne anzuklopfen eine Tür auf, neben der ein Wandschild darauf hinwies, dass sich KHK Schröder und KK Gladow das Büro teilten. „Niemand da“, stellte er nach einem etwas zu langen Rundumblick enttäuscht fest.
Er eilte durch eine Verbindungstür nach links in das Vorzimmer, Lenz immer hinter ihm her. Eine dunkelhaarige Frau saß an einem Schreibtisch und tippte etwas in ihre Computertastatur.
„Frau Gellert, darf ich Ihnen Ihren neuen Chef vorstellen? Das ist Kriminalhauptkommissar Lenz. Er wird ab Montag diese Dienststelle leiten.“
Frau Gellert blickte zunächst erstaunt, setzte aber dann ein professionelles Lächeln auf und reichte ihrem neuen Chef die Hand. „Freut mich.“
Lenz wunderte sich über den frostig distanzierten Unterton. Im Widerspruch dazu fühlte er die zarte Haut der Hand und verfing sich für einen Moment in den blauen Augen. Mitte bis Ende Dreißig, schulterlange Haare, hübsches Gesicht, nicht zu püppchenhaft, ganz ansehnliche Oberweite – genau sein Beuteschema.
Nicht schon wieder, dachte er erschrocken und ließ die Hand los. Sex am Arbeitsplatz bringt nur Ärger. Ein paar Wochen Spaß, dann wird man die Weiber nicht mehr los und am Ende zicken sie nur noch rum und stören den Betriebsfrieden. Nach dem letzten Fiasko mit einer Kommissar-Anwärterin in Hamm, mit dem er nur haarscharf an einem Disziplinarverfahren vorbeigeschrammt war, hatte er sich selbst ein Gelübde auferlegt: In Zukunft waren Kolleginnen und Mitarbeiterinnen grundsätzlich tabu. Schade eigentlich, dachte Lenz nun und löste sich mühsam aus Frau Gellerts blauen Augen.
„Wo sind Schröder und Gladow?“, fragte Heitkamp.
„Im Besprechungsraum. Wir haben heute Morgen eine Leichensache reinbekommen.“
„Eine Leichensache?“, fuhr Heitkamp auf. „Und warum weiß ich davon nichts?“
Frau Gellert schwieg, während der Kriminaldirektor sich wieder Lenz zuwandte.
„Hm, das ist natürlich dumm jetzt.“ Heitkamp dachte sichtbar angestrengt nach. „Ach was“, sagte er schließlich. „Kommen Sie, Herr Lenz. Das ist eine gute Gelegenheit, sich sofort ein Bild von Ihrer neuen Mannschaft zu machen.“ Er stürmte durch die Bürotür und bog schnellen Schrittes nach links ab.
„Herzlich willkommen“, sagte Frau Gellert nun lächelnd und zwinkerte Lenz zu.
Der zog die Stirn hoch und folgte dem Kriminaldirektor.
„Sieht nach unglaublichem Hass aus“, stellte Kriminalhauptkommissar Schröder gerade fest, als Heitkamp und Lenz den Raum betraten.
Auf einem Smartboard lief eine Diashow mit Tatortfotos ab, bei der viel Blut und wenig Mensch zu erkennen waren. Um einen u-förmigen Tisch saßen drei Männer und kritzelten Notizen auf ihre Blöcke, eine junge Frau tippte flink auf einem Tablet herum.
Schröder ignorierte die Neuankömmlinge und fuhr fort: „Der Täter hat gezielt den Kopf des Opfers zerstört und die Hände. Man darf annehmen, dass er dadurch eine Identifizierung zumindest erschweren wollte. Außerdem gibt es frische Verletzungen auf dem Rücken, die auf Folter hinweisen und offenbar von einer Peitsche herrühren. Genaueres wird die Obduktion ergeben.“
Lenz betrachtete das aktuelle Foto und war sofort wie elektrisiert, als er den völlig zermalmten Schädel sah, beziehungsweise das, was einmal ein Schädel gewesen sein musste. Das war mal was anderes als die Schuss- und Stichverletzungen, mit denen er es in den letzten Jahren im Hammer Südstraßen-Milieu überwiegend zu tun gehabt hatte.
„Dürfen wir kurz stören?“, unterbrach Kriminaldirektor Heitkamp ungeduldig, wobei sein Tonfall schon voraussetzte, dass ein Nein undenkbar war. Entsprechend wartete er nicht auf eine Antwort. „Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen den neuen Leiter des Kriminalkommissariats 1 vorstellen. Kriminalhauptkommissar Lenz wechselt von der Polizeidirektion Hamm nach Paderborn und wird am Montag seinen Dienst bei uns antreten. – Herr Lenz, das hier ist also Ihre neue Mannschaft.“
Als wäre gerade eben eine Handgranate explodiert und hätte nichts als Vernichtung hinterlassen, herrschte augenblicklich absolute Stille im Raum. Alle Augen richteten sich distanziert auf Lenz. Dann machte sich Gemurmel breit und die Kollegin und Kollegen blickten KHK Schröder an, als erwarteten sie von ihm nun eine eindeutige Reaktion. Der stand jedoch wie versteinert vor dem Smartboard und war offenbar zu keiner Regung in der Lage.
Oha, dachte Lenz, der hat bis eben geglaubt, dass er den Job kriegt. Er deutete Heitkamp mit dem Kopf an, dass er ihn auf dem Flur zu sprechen wünsche. Irritiert wanderten die Augen des Kriminaldirektors zwischen Lenz und Schröder hin und her, dann nickte er kurz und trat hinaus. Lenz folgte und zog die Tür hinter sich zu.
„Auf ein Wort, Herr Kriminaldirektor“, begann Lenz und blickte seinem Vorgesetzten direkt in die Augen. „Ich bin es von meinen bisherigen Dienststellen in Dortmund und Hamm so gewohnt, dass nichts hinter dem Rücken der Kollegen geschieht. Und ich bin ein Verfechter des offenen Wortes. Deshalb muss ich Ihnen sagen, dass ich Ihre Vorgehensweise nicht in Ordnung finde.“
Kriminaldirektor Heitkamp fixierte Lenz mit hochgezogenen Brauen. „Wie darf ich das verstehen?“, fragte er mit lauerndem Unterton.
„Ich hatte eben den Eindruck“, fuhr Lenz unbeirrt fort, „dass kein Mensch in meiner neuen Abteilung darauf vorbereitet worden ist, jemanden von außen vor die Nase gesetzt zu bekommen. Das geht nicht. Es erschwert meine Arbeit hier, bevor ich noch richtig angefangen habe. Und ich kann es noch nicht einmal jemandem verübeln, wenn er mich im Regen stehen lässt, denn Ihr Vorgehen ist in höchstem Maße unkollegial den anderen Anwärtern gegenüber. In Zukunft erwarte ich von Ihnen, dass Sie mir und meinen Mitarbeitern mit offenem Visier begegnen. Schließlich erwarten auch Sie Loyalität von uns.“
Kriminaldirektor Heitkamps Augen hatten sich während der letzten Sekunden zu Schlitzen verengt. Sein Gesichtsausdruck war kalt und versteinert. „Herr Lenz“, entgegnete er mit drohend leiser Stimme, „Sie sind neu hier und kennen mich noch nicht, deshalb werde ich Ihnen diese Unverschämtheit nicht nachtragen. Aber lassen Sie sich für die Zukunft eines gesagt sein: Hier bei uns gilt der Richtspruch ,Man beißt nicht die Hand, die einen füttertʻ. Bedenken Sie das bitte, bevor Sie noch einmal derart subordinär werden.“
Damit wollte er sich grußlos entfernen, doch das ließ Lenz nicht zu. „Kann es sein, Herr Kriminaldirektor, dass Sie einem Irrtum unterliegen?“
Heitkamp drehte sich halb herum und schaute ihn erstaunt an. „Welcher Art sollte der sein?“
„Sie scheinen zu glauben, dass ich Ihnen Dank schulde, weil Sie mir die Leitung des Kommissariats anvertraut haben.“
Nun drückten Heitkamps groß aufgefahrene Augen so etwas wie Erstaunen darüber aus, dass jemand das anders sehen könnte als er.
„Dem ist aber nicht so“, fuhr Lenz standhaft fort. „Sie haben mich auf den Posten geholt, weil ich ein sehr guter Bewerber war und über erstklassige Beurteilungen verfüge. Das Einzige, das ich Ihnen dafür schulde, ist sehr gute Arbeit. Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie mir für meine Dienstausübung ebenfalls nichts weiter schuldig sind, als dafür zu sorgen, dass ich die nötigen Kapazitäten zur Verfügung habe und dass das Land mir mein Gehalt pünktlich überweist. Ich denke, auf der Basis lässt sich wunderbar zusammenarbeiten, solange ich nicht ständig das Gefühl haben muss, dass Sie noch etwas in petto haben.“
„Dann strengen Sie sich mal an, damit Sie auch Erfolge liefern, Herr Lenz, sonst sehe ich auf mittlere Sicht Schwarz für eine gute Zusammenarbeit. Der aktuelle Fall bietet Ihnen eine gute Gelegenheit dazu. Ich schlage vor, Sie fangen sofort an. Für mich sahen die Tatortfotos so aus, als würde die Bildung einer Mordkommission notwendig. Ich erwarte dann zeitnah Ihren Bericht. Guten Tag!“
Super Einstand, fluchte Lenz innerlich und blickte dem davoneilenden Kriminaldirektor nach. Dann zuckte er die Achseln und ging zurück in den Besprechungsraum.
Schröder hatte sich inzwischen offenbar gefangen und den Bericht fortgesetzt. Nun schaute er fragend auf. Lenz gab ihm per Handzeichen zu verstehen, dass er sich nicht unterbrechen lassen solle, und setzte sich auf einen freien Stuhl. Die anderen Beamten fixierten betont angestrengt ihre Schreibblöcke, nur die junge Kollegin sah ungeniert neugierig zu Lenz herüber.
Schröder räusperte sich und fuhr mit heiserer Stimme fort: „Der Tote konnte noch nicht identifiziert werden, weil er keine Ausweispapiere bei sich trug. Eine Anfrage bezüglich vermisster Personen bei den Kollegen läuft und bringt uns hoffentlich bald weiter. Solange wir noch keinen Anhaltspunkt haben, werden wir nach ähnlichen Fällen suchen, zunächst rückwirkend für die letzten zehn Jahre. Hier im Kreis Paderborn ist mir kein vergleichbarer Fall bekannt, deshalb beziehen wir die Nachbarkreise mit ein und zapfen auch die Datenbank des LKA an.“
Lenz ahnte, was in den Köpfen der Kollegen vor sich ging. Niemand vergrub sich gerne in alten Akten und stocherte im Ungewissen. Umso erstaunter war er über die Disziplin, die in dieser Dienststelle an den Tag gelegt wurde: Alle nickten zustimmend, niemand stöhnte oder verzog auch nur das Gesicht. Da war er aus Hamm Anderes gewohnt.
Schröder wechselte zu dem nächsten Foto, das einen blutigen Felsbrocken auf Kopfsteinpflaster zeigte. „Die Kriminaltechnik konnte inzwischen anhand eindeutiger Spuren nachweisen, dass der Stein, mit dem das Opfer erschlagen wurde, von dem bewaldeten Hang unterhalb der Burg stammt. Vielleicht lassen sich Fingerabdrücke darauf sichern, aber ich fürchte, die Chance, dass der Täter sich auf dem Stein verewigt hat, ist denkbar gering. Tja, Kollegen, mehr haben wir momentan leider noch nicht. Hat jemand eine Frage?“
„Wenn ich die Örtlichkeiten richtig vor Augen habe“, meldete sich einer der jungen Beamten zu Wort, „dann befindet sich der Tatort doch in der Nähe von Wohnhäusern.“
„Das ist richtig“, antwortete Schröder. „Gegenüber der Burgmauer befinden sich einige wenige Häuser, allerdings mit ihrer Rückseite. Von den Anwohnern hat niemand etwas gehört oder gesehen.“
„Was auf einen Tatzeitpunkt hindeutet, der irgendwann zwischen zwei Uhr nachts und fünf Uhr morgens liegen dürfte“, stellte der junge Kollege fest. „Also in einem Korridor, in dem der Täter nahezu sicher sein konnte, dass niemand mehr wach ist und noch keiner für die Frühschicht aufgestanden ist.“
„Davon ist auszugehen, ja.“ Schröder nickte. „Allerdings ist die Umgebung der Burg auch nicht gerade das Zentrum des Dorfes. Wer nicht im Kreismuseum oder in der Jugendherberge arbeitet, benutzt die Zufahrtstraße nicht.“ Er blickte in die Runde und wartete auf weitere Fragen. Als niemand Anstalten machte, sich zu Wort zu melden, sah er Lenz herausfordernd an.
Der nickte, stand auf und ging nach vorne. Er stellte sich neben Schröder und nahm der Reihe nach Blickkontakt zu jedem der Anwesenden auf.
„Liebe Kolleginnen und Kollegen“, begann er dann, „mir ist natürlich nicht entgangen, dass Sie von meinem Erscheinen überrascht worden sind. Ich war davon ausgegangen, dass Kriminaldirektor Heitkamp Sie vorher informiert hat. Nun gut … Dass das nicht geschehen ist, ändert nichts an der Tatsache, dass wir ab sofort zusammenarbeiten werden. Über die Struktur unseres Kommissariats mache ich mir Gedanken, wenn ich mir einen Überblick verschafft habe. So lange bleibt der Kollege Schröder übergangsweise mein Stellvertreter.“
„Was soll das heißen: übergangsweise?“ Schröder drehte sich Lenz mit schräggelegtem Kopf halb zu und stemmte die Fäuste in die Seiten. Die leichte Röte seiner Wangen verriet, dass seine anfängliche Versteinerung sich in einen gesunden Zorn verwandelt hatte. „Ich bin der dienstälteste Beamte hier und habe das Kommissariat bisher stellvertretend und seit der Pensionierung Kriminalrat Schultes kommissarisch geleitet.“
„Das heißt genau das, was ich gesagt habe. Ich werde eine Neuordnung des Kommissariats vornehmen, sobald ich einen hinreichenden Überblick habe. – Und nun, Herr Kollege, stellen Sie mir bitte alle Anwesenden vor.“
Schröder hatte Mühe, die Fassung zu bewahren. Er biss sich auf die Unterlippe und atmete schwer. Lenz ließ ihm die Zeit, die er brauchte, um sich wieder zu fangen, und sah sich derweil um. Dabei entging ihm nicht, dass die junge Beamtin, die Mitte oder höchstens Ende Zwanzig sein konnte, auffallend hübsch war mit ihren dunklen, nach hinten zum Pferdeschwanz zurückgebundenen Haaren und rehbraunen Augen. Sie hatte ein schlankes Gesicht mit deutlich strukturierenden Wangenknochen, aber nicht hager, sondern sehr schön proportioniert. Ihre fast schon provokativ körperbetonte Kleidung wirkte so sportlich wie leger: Zu einer dunklen Bluse, deren obere Knöpfe nicht geschlossen waren, trug sie knallenge Jeans und knöchelhohe dunkelrote Lederstiefel. Außerdem begegnete sie Lenz´ Blick mit einem spöttischen Grinsen, wie der nun peinlich berührt feststellen musste.
Schröder, der sich inzwischen wieder gesammelt hatte, stellte sie ihm als Kriminalkommissarin Gina Gladow vor. Die männlichen Beamten waren Kriminalkommissar Gisbert Henke und die Oberkommissare Jochen Steinkämper und Franz-Georg Jakobsmeier. Gemessen an ihrer Kollegin sahen sie durchschnittlich aus und wären Lenz auf der Straße sicher nicht näher aufgefallen. Allerdings schienen alle Beamten sich in einem Alterskorridor zwischen Mitte Dreißig und Vierzig zu bewegen, von Gladow und Schröder einmal abgesehen. Ein junges Team, dachte Lenz, da würde es ihm nicht schwerfallen, sich von Anfang an Respekt zu verschaffen. Nur mit Hauptkommissar Schröder musste er angesichts seines Dienstalters umsichtig sein, das war ihm klar.
„Danke, Herr Schröder.“ Er wandte sich den jungen Kollegen zu. „Wir werden genau so verfahren, wie der Kollege Schröder vorgeschlagen hat, und erst einmal klären, wer das Opfer ist. Die Mordkommission wird vorerst von unserem Kommissariat gebildet. Die Arbeitseinteilung nimmt Herr Schröder vor, da er Ihre individuellen Kompetenzen besser einschätzen kann als ich. Sollte sich herausstellen, dass wir weitere Expertise aus anderen Abteilungen oder eventuell sogar aus benachbarten Kreisen benötigen, werden wir die Moko ausweiten. Sie, Kollege Schröder, leiten das gegebenenfalls unbürokratisch in die Wege. Ich möchte allerdings vorab informiert werden.“
Er sah zuerst Schröder und dann einem nach dem anderen kurz in die Augen, stellte aber keinen Widerspruch fest. „Gut. Sie, Frau Gladow, zeigen mir mein Büro und machen uns eine Verbindung mit der Rechtsmedizin. Meiner Erfahrung nach kann es nicht schaden, den Brüdern da etwas Druck zu machen. Alles klar soweit? – Keine weiteren Fragen? – Prima. Dann, Kollegen, an die Arbeit!“
„Entschuldigung, aber hat Kriminaldirektor Heitkamp nicht gesagt, dass Sie erst am Montag anfangen?“, wandte Schröder angriffslustig ein.
„Der Kriminaldirektor und ich haben es uns eben auf dem Flur anders überlegt.“ Lenz‘ Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass er keinen weiteren Widerspruch duldete und auch nicht bereit war, die Veränderung näher zu erläutern. „Kommen Sie, Frau Gladow?“
Er ließ der Kollegin den Vortritt und folgte ihr, ohne sich weiter um Schröder zu kümmern. Wenn von Anfang an klar war, wer das Sagen hatte, würde die Zusammenarbeit in Zukunft umso besser klappen. Die Zügel lockern konnte er später immer noch. Das jedenfalls war Lenz‘ Erfahrung. Und warum sollte, was überall gültig war, in Paderborn nicht funktionieren?
5
Die A 44 war dicht. Auf der ganzen Strecke vom Kreuz Wünnenberg-Haaren bis hinter Soest hatten Lkw die rechte Spur blockiert und jetzt, in der Baustelle vor dem Kreuz Werl, ging auch links absolut nichts mehr. Fabian Heller fluchte. Wäre er doch über Bielefeld und die A 2 in Richtung Dortmund gefahren. Aber davor hatte ihn der Verkehrslagebericht auf WDR 2 gewarnt. Von dem Stau auf der 44 war nicht die Rede gewesen. Auf nichts war mehr Verlass.
Da er also zum Stillstand verurteilt war, während in der Gegenrichtung jenseits der Mittelleitplanke der Verkehr reibungslos floss, nutzte er die Zeit, um den Prozessverlauf noch einmal zu rekapitulieren. Das würde ihm nachher beim Schreiben des Berichtes Zeit sparen.
Dieser Reinhold Hanning war also – mutmaßlich – an 170.000 Morden beteiligt gewesen. Er hatte gewusst, was passierte, und das Verbrechen aus eigener Entscheidung unterstützt. Zum ersten Mal hatte Heller jemanden live erlebt, der zu den Rädchen im Getriebe des Holocausts zählte. Und dann wirkte ausgerechnet dieser Mann so harmlos und überhaupt nicht wie eine Bestie. Offenbar war das Bild, das Heller aus dem Geschichtsunterricht und all den Hollywood-Filmen von den Naziverbrechern hatte, nicht so realitätsnah, wie es ihm bislang erschienen war. Vielleicht waren diese Massenmörder ja im Wesentlichen gar keine teuflischen Monster, sondern tatsächlich Menschen wie du und ich – genauso simpel, genauso armselig, genauso feige und hinterhältig, überhaupt nichts Besonderes.
Hanning war Jahrgang 1921. In den Anfangsjahren des Dritten Reichs war er im HJ-Alter gewesen und mit der braunen Milch gesäugt worden. Aber war das Erklärung genug? Andere junge Leute waren unter demselben Einfluss aufgewachsen und nicht zu Massenmördern geworden, auch nicht zu Hilfswillis der Henker. Hellers Eltern zum Beispiel. Was war bei denen anders gelaufen als bei Hanning?
Auf diese Frage konnten seine Eltern ihm nicht mehr antworten. Sein Vater war seit Langem tot und seine Mutter vor sechs Wochen gestorben. Er hatte die Chance verstreichen lassen, sie über ihre Kindheit auszufragen. Das war das Schicksal heute: Die Zeitzeugen starben langsam aus. Nach ihnen würde es keine Möglichkeit mehr geben, Fragen zu stellen und Antworten aus erster Hand zu bekommen. Genau deshalb waren Prozesse wie der gegen Reinhold Hanning ja so wichtig, weil sie eine letzte Chance darstellten und quasi in letzter Sekunde stattfanden.
Bei Heller zu Hause hatten sie früher nur sehr selten über die Kindheit der Eltern gesprochen, allenfalls wenn die Großmutter zu Besuch gekommen war. Die hatte oft von den Bombennächten erzählt, von der Flucht in den Hochbunker mit dem kleinsten Kind, Fabinas Mutter, an der einen und dem Koffer mit den wichtigsten Papieren in der anderen Hand, während die größeren Kinder schon vorwegliefen und einen Platz im dicht besetzten Bunker sicherten. Und von den Verwandten in Medebach im Sauerland hatte die Großmutter geschwärmt, weil da keine Bomben gefallen und die Kinder dort im letzten Kriegsjahr sicherer gewesen waren.
Heller erinnerte sich an Fotos aus den Kindertagen seiner Mutter. Sie hatte wie ein unbeschwertes, glückliches Mädchen darauf ausgesehen. Während um sie herum die Nazis ihr mörderisches System errichtet und einen Vernichtungskrieg geführt hatten, hatte sie mit ihren Freundinnen genauso unschuldig gespielt, wie Kinder es heute taten. Das Bild eines kleinen Mädchens mit langen blonden Zöpfen tauchte vor Heller auf – in Schwarz-Weiß. Die Fotos gab es noch. Sie mussten sich in Alben irgendwo in den Schränken seiner Mutter befinden. Im Stau vor dem Kreuz Werl beschloss Fabian Heller, nicht in seine Wohnung, sondern zum Haus seiner Mutter zu fahren, um das er seit sechs Wochen einen großen Bogen gemacht hatte, und danach zu suchen.
6
Für den Landgerichtsbezirk Paderborn war das Institut für Rechtsmedizin in Münster zuständig. Allerdings musste der Leichnam nicht dorthin transportiert werden, sondern die Obduktion wurde, wie in solchen Fällen üblich, im Sektionssaal des Johannis-Stifts in Paderborn durchgeführt. Die Rechtsmediziner aus Münster reisten normalerweise extra zu diesem Zweck an. Da Hermann-Josef Stukenberg aber bereits zum Tatort gerufen worden war, war er gleich vor Ort geblieben und hatte umgehend mit der Obduktion begonnen, wie Gina Gladow telefonisch erfahren hatte.
Als Lenz und seine junge Kollegin den Sektionssaal des Johannisstifts betraten, hatten Stukenberg und sein Gehilfe den Leichnam bereits der Länge nach aufgeschnitten und beugten sich gerade über das Innenleben des menschlichen Körpers. Der Rechtsmediziner blickte nur kurz auf und nickte den Kriminalbeamten zu.
Lenz stellte sich als neuer Leiter des Kommissariats vor, worauf Stukenberg schmunzelte und, ohne den Blick von ihm zu nehmen, sagte: „Sieh an, das Wunder ist tatsächlich geschehen?“
Was meint er?, bedeutete Lenz‘ Blick an seine Kollegin, die aber nur mit den Schultern zuckte und die Lippen zusammenkniff. Mit dem Gefühl, dass hier etwas hinter seinem Rücken stattfand, das nicht unbedingt freundlich sein musste, erkundigte sich Lenz kurz angebunden nach ersten Untersuchungsergebnissen. „Oder seid ihr noch nicht so weit?“, schob er angriffslustig nach.
„Oh doch“, entgegnete Stukenberg, in dessen Gesicht dieses süffisante Schmunzeln eingemeißelt zu sein schien. „Wir haben sogar schon eine ganze Menge, sofern Sie mit äußeren Tatmerkmalen zufrieden sind. Die Sektion der Organe dauert noch etwas. Ich schicke euch dann den Bericht. Allerdings glaube ich nicht, dass wir da eine Überraschung erleben werden. – Kommen Sie mal einen Schritt näher, dann wird das alles für Sie deutlich plastischer.“
Stukenberg schob seinen Mitarbeiter sanft zur Seite. Nun wurde für Lenz das ganze eklige Ausmaß der Arbeit eines Rechtsmediziners sichtbar. Nicht nur, dass der Leichnam keinen Kopf mehr hatte – der bunte Mischmasch in einer schmalen Stahlwanne an dessen Stelle musste das sein, was Stukenbergs Männer vom Kopfsteinpflaster gekratzt hatten –, auch der Rest des Körpers sah einfach nur blutig, rissig und teilweise blau-schwarz verfärbt aus. Zudem hatten die Rechtsmediziner dem Körper bereits einige Organe entnommen, so dass der Brustraum einer blutigen Schüssel aus organischem Material glich.
„Lecker“, murmelte der Hauptkommissar.
„Nicht wahr?“, freute sich Stukenberg. „Wäre das hier ein Fernsehkrimi, hätte ich auch noch eine deftige Leberwurststulle in der Hand, aber das bleibt euch in der Realität zum Glück erspart. Also: Die Todesursache ist eindeutig, nämlich grobe Gewalteinwirkung mittels eines Felsbrockens auf den Schädel des Opfers, das zweifellos sofort tot war. Vorher wurden ihm aber noch beide Hände mit schweren Stiefeln zerquetscht und zwar, indem die Sohlen mehrfach auf dem Handrücken und den Fingern hin und her gedreht wurden. Spätestens der damit verbundene Schmerz dürfte dem Opfer gnädig die Sinne geraubt haben.“
Lenz hatte den Eindruck, dass der Rechtsmediziner einen ganz eigenen Spaß an seinem Beruf hatte.
„Anschließend ist der Täter auf den Rücken des Opfers gesprungen. Wirbelsäule mehrfach gebrochen, sämtliche Rippen zerborsten und in die inneren Organe gebohrt.“ Er deutete auf unzählige weiß-gelbe Splitter, die in der blutigen Brühe schwammen. „Da hat sich einer so richtig ausgetobt. – Wie Sie unschwer erkennen können, handelt es sich übrigens um eine männliche Leiche.“ Stukenbergs behandschuhter Zeigefinger wies auf die schrumpeligen Genitalien. „Der Mann dürfte etwa neunzig Jahre alt gewesen sein, eher noch etwas älter. Wir haben uns die äußerlichen Verletzungen genauer angesehen. Es gibt mehrere Altersstufen. Die jüngsten sind diese Risse hier, die vermutlich von einer mehrsträngigen Lederpeitsche herrühren.“ Stukenberg drehte den Oberkörper etwas auf die Seite, ohne auf die Sauerei zu achten, die er damit auf dem Stahltisch anrichtete, und deutete auf Striemen, die aussahen, als wäre die Haut regelrecht aufgeplatzt. „Stofffetzen in den Wunden belegen, dass das Opfer sein Oberhemd trug, als es ausgepeitscht wurde. Dann haben wir aufgeplatzte Hautstellen, die von Stockschlägen herrühren, wobei das Opfer dabei offensichtlich nackt war. Unterschiedlich verkrustete Wunden dieser Art befinden sich auf dem Gesäß des Toten und im Bereich des unteren Rückens. Der Mann dürfte über einen Zeitraum von etwa drei Tagen immer wieder diesen Schlägen ausgesetzt gewesen sein, wobei die Haut auf unnatürliche Weise gespannt gewesen sein muss, denn sie ist über eine größere Länge regelrecht aufgeplatzt.“