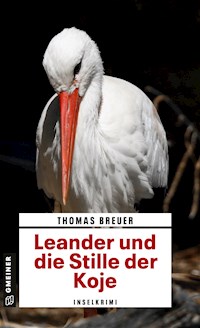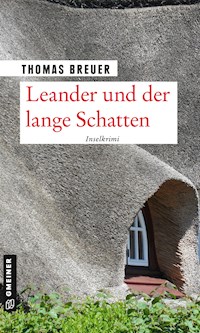
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Leander
- Sprache: Deutsch
1999: Falk Riewerts, der Feuerteufel von Föhr, wird beschuldigt, Wencke Olsen getötet und in der Scheune ihres Vaters verbrannt haben, und flieht nach Amerika. 2016: Falk Riewerts ist zurück auf der Insel und wieder brennt eine Scheune auch diesmal mit einem Toten. Als sich mehrere Bauern zusammenschließen und die Jagd auf ihn eröffnen, bittet er Henning Leander, seine Unschuld zu beweisen. Die Ermittlungen führen Leander weit in die Auswanderer-Geschichte der Inseln Föhr und Amrum zurück: bis zum großen Goldrausch in Alaska um 1900. Alte Fotos und ein verschwundenes Tagebuch führen auf eine gefährliche Spur. Es beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Breuer
Leander und der lange Schatten
Inselkrimi
Zum Autor
Thomas Breuer, geboren 1962 in Hamm/Westf., hat in Münster Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und arbeitet seit 1993 als Lehrer für Deutsch, Sozialwissenschaften und Zeitgeschichte an einem privaten Gymnasium im Kreis Paderborn. Seit 1994 lebt er mit seiner Frau Susanne, seinen Kindern Patrick und Sina, Streifenhörnchen Fridolin und Katze Lisa im ostwestfälischen Büren. Er liebt die Fotografie, die Nordseeinseln und den Darß. Seine zweite Heimat ist Föhr, wo er regelmäßig im Auftrag seiner Hauptfigur Henning Leander neue Kriminalfälle recherchiert, in denen dieser dann ermitteln darf.
Mit »Leander und der tiefe Frieden« legte er 2012 seinen Debüt-Roman im Leda-Verlag vor, 2013 folgte »Leander und die Stille der Koje«, 2014 »Leander und die alten Meister«, 2015 »Leander und der Lummensprung« sowie 2016 »Leander und der lange Schatten«. 2018 erschien der Kriminalroman »Der letzte Prozess«.Weitere Projekte sind in Arbeit und in Planung.
www.Breuer-Krimi.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Originalausgabe erschienen 2016 im Leda-Verlag
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Roland Hulin / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6452-2
Zitat
»Nicht Hochmuth hat uns fortgetrieben
Aus dem bedrückten Vaterland,
Auch nicht von Habsucht angetrieben
Verliessen wir das theure Pfand;
Bloß weil man in die Zukunft sah,
Drum ging es nach Amerika.«
(Strophe 39 des Auswandererliedes »Heil dir Columbus, sey gepriesen« aus dem Jahr 1833)
Widmung
für die vielen Menschen,
die in der sogenannten »Flüchtlingskrise«
selbstlos helfen
und sich dem Hass und der Menschenverachtung
in unserem Land
entgegenstellen
Alkersum, 11. August 1999
Zuerst hörte er nur ein unheimliches Zischen, als zöge ein riesiger Drache aus seiner ganzen Umgebung die Luft ab, um dann fauchend und unvermittelt alles wieder auszuspeien. In einer gewaltigen Explosion brachen die Flammen durch das Reetdach von Olsens Scheune und spuckten glühende Strohfäden in den Abendhimmel. Sie sanken in verglimmender Pracht um ihn herum zu Boden, wie Sternschnuppen die großen, tanzenden Glühwürmchen gleich die kleinen. Die Luft schien zu brennen, alles war rot und gelb und flackerte wild. Fasziniert betrachtete er das Inferno, das sich da vor ihm entwickelte und dessen Phasen er im Einzelnen vorhersagen konnte. Wie immer stieg ein Kribbeln in seinem Bauch auf wie Funken an der Zündschnur einer Feuerwerksrakete.
Obwohl er in sicherem Abstand hinter einem Anhänger stand, brannte die Hitze auf seinem Gesicht und trieb den Schweiß in Strömen an seinem Körper hinab. Einige Glutfäden landeten auf seinem weißen Hemd, auf seiner Ringreiter-Mütze, doch er achtete nicht darauf. Zu großartig war das Schauspiel, das sich ihm da bot, der Feuersturm, der keine zwanzig Meter entfernt seinen zerstörerischen Lauf nahm. Die Flammen leckten nun gleichmäßig aus dem Dachstuhl hoch in die Luft, züngelten und schienen sich nie wieder zurückziehen zu wollen. Die Kühe im benachbarten Stall brüllten gegen das Rauschen an. Sie spürten die Gefahr, die Hitze, die von der brennenden Scheune ausging, und gerieten in Panik.
Falk sah auf die Uhr: zwölf nach neun. Vor nicht einmal zwei Minuten hatte das Feuer das Scheunendach durchstoßen und schon begann die unaufhaltsame Phase – das wusste er aus der Erfahrung zahlreicher Versuche, die er in den letzten Jahren mit kleinen und mittelgroßen Feldscheunen angestellt hatte. Von der Feuerwehr war weit und breit noch nichts zu sehen. Sie würde zu spät kommen. Der Brandmeister würde nur noch den Befehl geben können, das alte Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen und dafür zu sorgen, dass die Flammen nicht auf das Wohnhaus und die Ställe übergriffen.
Falks Blick folgte dem Funkenregen am Himmel, der um diese Jahreszeit noch hell war und doch den Wettkampf gegen den grellen Schein des Feuers verlieren musste. Föhr on fire, dachte er. Ach was, das alljährliche Feuerwerk am Hafen war ein Dreck gegen dieses Fanal! Und wie als Auftakt eines grandiosen Finales bogen sich nun die Dachbalken in den Flammen auf, knackten wie unter einer schweren Last, als die alles verzehrende Feuerhölle sie wie Zunderstäbchen in flutender Lava binnen Minuten auffraß. Das Gebälk schien schwerelos zu werden. Die aufströmende Hitze trug es hoch, ließ es dann krachend und mit einem höllischen Getöse in sich zusammenstürzen, während das Feuer rauschte und fauchte und Funken spie.
Auf diesen Moment hatte Falk gewartet. Das war für ihn immer der schönste Teil des Infernos. Die Rakete unter seinem Solarplexus explodierte, ein Funkenregen verteilte sich in seinem ganzen Körper und steigerte sich zu einem Gefühl höchster Lust. Und wie in einer Art Trance fing er leise zu singen an, keinen Text, Töne nur gab er von sich, auf- und abschwellende Tonfolgen. Immer lauter drängten sie aus ihm heraus, während er den Oberkörper wiegte. Immer melodischer verbanden sie sich mit dem Heulen des Flammenmeeres, das sich jetzt, da auch die Holzwände in sich zusammenstürzten, ausbreitete, wogte und wallte wie die Wellen bei Sturmflut vor dem Grevelinger Deich.
Sirenen zerrissen plötzlich von rechts die Harmonie. Falk hörte sie erst, als der erste Löschzug schon vom Zufahrtsweg auf den Hof fuhr und in sicherem Abstand zwischen Scheune und Bauernhaus zum Stehen kam. Feuerwehrleute in schweren Uniformen sprangen heraus, rissen die Schlauchrollen aus den Klappen, koppelten C-Strahlrohre an die Druckschläuche und drangen so weit wie möglich gegen die Hitze vor. Die Flammen schienen nach ihnen zu greifen, so nah kamen die Männer dem Feuer. Kommandos wurden gebrüllt, der Brandmeister stand wie ein General inmitten seiner Truppen, die Mühe hatten, nach dem Befehl »Wasser marsch!« die Schläuche festzuhalten und die Strahlrohre zielsicher in die aufstiebenden Flammen zu richten. Leif Olsen, der Besitzer des Hofes, sprang panisch zwischen ihnen herum, bis der Brandmeister ihn schließlich von einem seiner Männer wegführen ließ. Die Mannschaften dreier Löschzüge waren bald im Einsatz – alles, was Föhr aufzubieten hatte. Eine war allein damit beschäftigt, das Wohnhaus und die angrenzenden Stallungen mit Wasser zu kühlen, damit das Feuer nicht übergriff. Die anderen beiden hegten das Inferno ein und ließen die Scheune, wie Falk schon vermutet hatte, nur noch kontrolliert herunterbrennen. Inzwischen hatten Männer aus dem Dorf die Stalltore aufgerissen und trieben das brüllende Vieh, das immer wieder versuchte, panisch vor dem Feuer auszubrechen, auf die angrenzende Weide.
Jetzt erst bemerkte Falk die vielen Menschen, die sich in seiner Nähe versammelt hatten. Sie mussten von der Festwiese aus herübergerannt sein, um nichts zu verpassen. Jan sah er unter ihnen stehen, seinen jüngeren Bruder. Unkontrolliert mit den Armen durch die Luft wedelnd brüllte der auf Meret ein, seine Freundin, die heftig den Kopf schüttelte. Und auch der Vater war da, stand am Zaun der Koppel und starrte fassungslos auf das zerstörerische Werk des Feuers. Die Mutter war nicht dabei. Falk zog sich weiter in den Schutz des Anhängers zurück. Sie mussten ihn hier nicht sehen. Sein schlechter Ruf als Feuerteufel war legendär. Sie würden ihn sofort in Verdacht haben, niemand würde ihm glauben, dass er nur ein Schaulustiger war wie sie selbst.
Nach zwanzig Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Die Anspannung des Brandmeisters ließ merklich nach und auch Falk spürte, dass die Faszination verschwunden war. Der Reiz war weg, hier konnte nichts mehr passieren. Das Feuerwerk in seinen Eingeweiden war nur noch eine Erinnerung, nichts als Schall und Rauch.
Die Flammen waren immer noch heiß und gewaltig, aber sie konzentrierten sich auf den Grundriss der Scheune und würden schon bald keine Nahrung mehr finden. Irgendwann hatte Falk auch zu singen aufgehört – wann, hätte er selbst nicht sagen können. Nun begann die Phase der Ernüchterung. Als ließe sich doch noch etwas von dem Wunderbaren festhalten, suchte er in den flackernden Zungen nach der verheerenden, alles vernichtenden Urgewalt, die ihn eben noch fest im Griff gehabt hatte, aber da war nichts mehr, was ihn nun noch in seinen Bann zu ziehen vermochte. Enttäuscht richtete er sich auf, atmete tief durch, spürte dem brandigen Geschmack der Luft nach und löste seinen Blick von dem knackenden Gluthaufen.
Die Leute hatten sich beruhigt, standen nun schweigend da, als seien sie sich gerade erst bewusst geworden, was geschehen war. Falks Vater aber sah nicht dorthin, wohin alle schauten. Seine Augen waren schreckgeweitet auf ihn, auf Falk, gerichtet. Die Flammen spiegelten sich in diesen Augen, schienen von ihnen geradezu auszugehen und ihn, den älteren Sohn, wie ein Flammenwerfer versengen zu wollen. Auch Jan schwieg nun und hatte sein Gestikulieren eingestellt. Seine Augen folgten dem Blick des Vaters und verwandelten sich in einen Quell des Hasses, als er den Bruder erkannte. Im Bruchteil einer Sekunde wurde Falk klar, was das bedeutete: dass es nun kein Entrinnen mehr gab. Panik ergriff ihn, ließ ihn regelrecht vom Anhänger zurückprallen, ließ ihn stolpern, straucheln, sich auffangen und losrennen, um Zuflucht in der Marsch zu suchen. Weg hier, nur weg von all den Menschen, die sofort zu wissen glaubten, was an der Scheune geschehen war, sobald sie ihn sahen.
Falk rannte kopflos, als ginge es um sein Leben. Zuerst lief er zwischen Feldern und Weiden in die aufziehende Nacht und die Weiten der Marsch hinaus. Schließlich hielt er keuchend inne, mit dem Rücken an einen morschen Zaunpfahl gelehnt, schnappte nach Luft und begann nachzudenken. Wo sollte er hin? Wo konnte er jetzt noch hin, nachdem sie ihn gesehen hatten – Jan und der Vater? Nach Hause, dachte Falk, wohin denn sonst? Sie waren sich sicher, in ihm den Brandstifter erkannt zu haben. Er hatte es in ihren Blicken gelesen. Aber sie würden ihn nicht verraten. Wenn niemand sonst auf ihn aufmerksam geworden war, würden sie schweigen. Zu gewaltig wären die Folgen für sie alle!
Also atmete er durch und orientierte sich mit Hilfe eines entfernt liegenden Aussiedlerhofes, um dann den kürzesten Weg über die Weiden einzuschlagen.
Als Falk den elterlichen Hof betrat, stand die Tür zum Stall offen. Licht brannte drinnen bei den Kühen, er hörte die Forke über den Betonboden kratzen: Seine Mutter war kurz vom Fest nach Hause gegangen, um die Kühe zu füttern. Das erklärte, warum er sie nicht beim Brand auf dem Olsen-Hof gesehen hatte. Gleich anschließend würde sie wieder zurückkehren zu den Alkersumer Landfrauen und erst spät in der Nacht heimkehren. Und dann würde auch sie zu wissen glauben, was geschehen war: Falk, der Brandstifter, ihr Sohn, der Feuerteufel, hatte wieder zugeschlagen. – Würde er sie überzeugen können, dass er nichts damit zu tun hatte? Einmal noch? Nur dieses eine Mal?
Falk lief an der Scheune vorbei direkt ins Haus und zog die Tür hinter sich zu. Hier in der dämmerigen Kühle des Flures atmete er auf, stützte sich auf die Kommode und fühlte dem Zittern nach, das ganz entgegen seiner Gewohnheit Besitz von ihm ergriffen hatte. Als er den Kopf hob, fing er im Spiegel einen Blick aus einem rauchgeschwärzten Gesicht auf, das er nur mühsam als sein eigenes erkennen konnte. Auch das ehemals weiße Uniformhemd der Ringreiter war dunkelgrau mit schwarzen Flecken und durchsiebt von kleinen Brandlöchern. Erst jetzt nahm er den Brandgestank wahr, der von ihm ausging, als wären seine Sinne bisher ausgeschaltet gewesen.
Er musste raus aus den Klamotten und unter die Dusche. Also lief er die Treppe hinauf, riss sich die schmutzigen Kleidungsstücke vom Leib, warf sie achtlos auf einen Haufen und schlüpfte in die Duschkabine. Die Hitze des Wassers kroch langsam durch die Haut. Er spürte ihr nach und merkte, wie er allmählich ganz ruhig wurde. Winzige Brandwunden stachen überall an Oberkörper und Armen, aber das kannte er schon, er hatte sich daran gewöhnt. Sie waren gleichsam eine wohlige Erinnerung an die fantastischen Momente, wenn die Flammen hoch in den Himmel schossen. Falk schloss die Augen und sofort tauchte das Bild der brennenden Scheune vor ihm auf und ergriff von ihm Besitz. Seufzend seifte er sich ein, schwarz floss der Schaum zu seinen Füßen in den Abfluss.
Als er schließlich aus der Dusche trat, standen völlig unerwartet seine Eltern vor ihm. Falk wich zurück, weil er den Hass in den Augen des Vaters, den Schmerz in denen der Mutter erkannte. Vor allem Letzteres traf ihn wie ein Faustschlag.
»Ich war das nicht«, sagte Falk und seine Stimme klang für ihn selbst fremd und hohl.
»Zieh dich an«, befahl der Vater hart und die Mutter schluchzte auf.
»Ehrlich, Vater, ich habe damit nichts zu tun. Diesmal nicht.«
»Pack seine Sachen zusammen«, befahl der Vater seiner Frau und drehte sich um. »Nur das Nötigste. Ich warte unten. Und beeilt euch. Sie werden gleich hier sein.«
Die Mutter warf einen letzten verzweifelten Blick auf Falk, dann drehte sie sich um und eilte in den Flur hinaus, als fliehe sie vor dem eigenen Sohn. Der Junge trocknete sich notdürftig ab und folgte ihr schließlich. Als er sein Zimmer betrat, war sie dabei, sämtliche Kleidung aus dem Schrank zu reißen und in den Seesack zu stopfen, den er vor Jahren für das Ferienlager der Landjugend in Preetz bekommen hatte.
»Was soll das?«, fragte Falk. »Was tust du da?«
»Hilf mir, Junge. Vater wartet.« Die Stimme der Mutter klang dünn und resigniert.
»Nun sag schon«, fuhr Falk sie an. »Was soll das alles? Ich sage doch: Ich habe mit dem Feuer nichts zu tun. Diesmal nicht. Warum glaubt ihr mir denn nicht?«
»Das hast du immer gesagt«, entgegnete die Mutter schwach. »Jedes Mal. Und am Ende bist du es dann doch gewesen.«
Sie warf Jeans und ein langärmeliges Hemd auf sein Bett. Dann verschnürte sie den Seesack und wuchtete ihn mit beiden Händen vor sich her, in den Flur hinaus und die Treppe hinunter.
Falk ließ sein Handtuch fallen und zog sich an. Sie glaubten ihm nicht mehr. Bei diesem Brand würde er sich nicht herausreden können, das wurde ihm schlagartig klar. Nicht einmal von seiner Mutter hatte er noch Hilfe zu erwarten, sie hatte dazu keine Kraft mehr. Und dabei war sie es gewesen, die sich immer bis zuletzt auf seine Seite geschlagen hatte. Bis auch sie der Wahrheit nicht mehr hatte ausweichen können. Nach dem Brand bei Olsen würde seine eigene Mutter ihn der Polizei ausliefern. Wütend riss Falk ein Paar Socken aus der Schublade, zog sie über, schlüpfte in seine Turnschuhe. Bevor er das Zimmer verließ, hielt er im Türrahmen noch einmal inne, drehte sich um und speicherte, was er sah. Er hatte das unzweifelhafte Gefühl, für lange Zeit nicht mehr hierher zurückkehren zu können. Vielleicht nie wieder.
Dann lief er die Treppe hinunter und hörte, wie sein Vater sagte: »Sie werden ihn einsperren! Er ist volljährig, verstehst du denn nicht?« Entschlossen stand er in der Haustür, den Seesack neben sich. Die Mutter drehte sich weg, als Falks Augen die ihren suchten. Sie schlich in die Küche wie ein gepeitschter Hund und zog die Tür leise hinter sich zu.
»Komm jetzt, Klaas wartet.« Der Vater hob den Seesack an, hielt ihn Falk hin und ließ ihn sofort los, als der zögernd danach griff. Dann lief er voraus auf den Hof und auf den rostigen weißen Nissan zu. Der Motor lief schon, als Falk den Seesack auf die Ladefläche warf. Kaum saß er auf dem Beifahrersitz, fuhr der Vater los, hinüber zur Hauptstraße und dann nach links in Richtung Wyk.
Den ganzen Weg zum Hafen legten sie schweigend zurück. Schließlich hielt der Wagen direkt am Anleger vor einem Fischkutter. Falk erkannte Klaas Rickmers im Führerhaus. Der Dieselmotor tuckerte schon, alles war offensichtlich zum Auslaufen bereit. Und da war auch Jan und machte die Leinen los, mit denen der Kutter an den Pollern festgemacht war. Der Vater griff auf die Ladefläche, zog den Seesack herunter und warf ihn an Deck.
Falk konnte nicht fassen, was hier geschah. Es ging um ihn, und doch hatte er nichts mehr unter Kontrolle. Sie schickten ihn weg, ohne vorher mit ihm darüber zu sprechen; ohne ihm eine Chance zu geben, alles zu erklären. »Verdammt noch mal, was habt ihr vor?«
»Klaas bringt dich rüber nach Dagebüll. Da nimmst du gleich morgen früh den ersten Zug nach Hamburg. Ich habe telefoniert. Um dreizehn Uhr geht ein Flug nach New York. Den nimmst du. Hier hast du Geld. Das sollte bis drüben reichen.«
»Sag mal, spinnst du jetzt?«, brüllte Falk den Vater an. »Ich fahre nirgendwo hin. Ich habe mit dem Feuer nichts zu tun. Wie oft soll ich das denn noch sagen?«
»Onkel Gerrit wird dich am Flughafen abholen«, sagte der Vater, als habe er den Wutausbruch gar nicht gehört, und konterte kalt den irren Blick des Sohnes. »Er kümmert sich um dich, bis hier Gras über die Sache gewachsen ist. Ein paar Jahre wird das dauern, schätze ich. Ausliefern werden sie dich nicht. Ich werde mich erkundigen, wann Brandstiftung verjährt. Dann kannst du zurückkommen.«
»Ich gehe nirgendwo hin, verdammt«, brüllte Falk noch einmal. »Ich war das nicht!«
Jan, der inzwischen neben den Vater getreten war, räusperte sich und mied jeden Blickkontakt mit seinem Bruder. »Du weißt es noch nicht, oder?«
»Was meinst du?«, fuhr sein Vater ihn ungeduldig an.
»Sie haben jemanden gefunden. Eine Leiche in der Scheune. Völlig verbrannt, deshalb können sie noch nicht sagen, wer es ist. Aber die Wencke wird vermisst.«
Der Vater strauchelte wie unter einem Schlag und musste sich auf der Schulter seines jüngeren Sohnes abstützen, um nicht ins Hafenbecken zu fallen. Mit einem Mal war er kreidebleich, sein Blick irrte zwischen Jan, Falk und Klaas Rickmers hin und her. Doch dann straffte er sich und ließ die Schulter seines Sohnes los. Ohne Falk noch einmal anzusehen, drehte er sich zu seinem Auto um.
»Ich will dich nie wiedersehen, Falk«, sagte er über die Schulter hinweg mit fester Stimme. »Solange ich lebe, wirst du diese Insel nicht mehr betreten.«
»Knut«, ertönte plötzlich die Stimme des Fischers. »Das kannst du von mir nicht verlangen. Ich verhelfe keinem Mörder zur Flucht.«
Knut Riewerts drehte sich langsam um und blickte den Fischer fest an. »Du würdest heute nicht hier stehen, wenn mein Vater genauso feige gewesen wär.«
Klaas Rickmers senkte den Blick und kämpfte sichtlich mit sich selbst. »Also gut«, sagte er schließlich und schob mit fester Stimme nach: »Aber dann sind wir quitt, ein für alle Mal.«
Der Vater gab Jan ein Zeichen. Sie stiegen in den Nissan, stießen zurück auf die Hafenstraße und fuhren davon. Falk stand am Kai und blickte ihnen fassungslos nach.
»Komm jetzt, Junge«, fuhr Klaas Rickmers ihn an. »Ich habe keine Lust, mir für einen Dreckskerl wie dich die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen.«
»Ich komme zurück«, sagte Falk leise und blickte den roten Rücklichtern nach, die in der Dunkelheit verschwanden. »Das werdet ihr mir büßen.« Dann sprang er an Bord des Kutters und schlich resigniert hinüber zum Bug, wo er sich auf eine Taurolle fallen ließ, während brennender Hass unaufhaltsam in ihm aufstieg. »Alle werdet ihr das büßen, das schwöre ich euch!«
1 Mittwoch
Ein beständiges Azorenhoch sorgte für sommerliches Wetter und so war die Insel Föhr bereits im Mai außergewöhnlich gut besucht gewesen. Der Touristenstrom hatte sich seitdem stetig gesteigert. Seit April hatte es keine nennenswerten Regenschauer mehr gegeben und was die Bauern sorgenvoll auf ihre Ernteerträge schauen ließ, erfreute die Urlauber, die ohne Bedenken Tagesausflüge mit den Fahrrädern unternehmen konnten. Gerade hatten die bevölkerungsreichen Bundesländer Schulferien bekommen, wodurch die Insel bei gleichzeitiger Verdoppelung der Preise bis auf das letzte Bett ausgebucht war. Den Anfang machten diesmal die Nordrhein-Vandalen, gefolgt von den Ländern des Wilden Ostens, und am Schluss drohten die Bergvölker aus Bayern und Baden-Württemberg die Insel zu fluten. Von Mitte Juni bis Mitte September ging die Hauptsaison – drei Monate, in denen so etwas wie ein logistischer Ausnahmezustand auf der Nordfriesischen Insel und an der ganzen Nordseeküste herrschte. Erst im Winter würde man, die Weihnachtszeit ausgenommen, wieder unter sich sein und Ruhe finden.
Mephistos Biergarten in Oevenum war für den sommerlichen Ansturm gerüstet. Zwar pflegte der Inhaber und Namensgeber sich nicht unbedingt auffällig in die Tagesarbeiten einzubringen, wenn man von seinem täglichen Brotbacken einmal absah, aber dafür war Mephistos Lebensgefährtin Diana umso geschäftstüchtiger. Seit diesem Frühjahr hatte sie zudem zwei Mädchen aus dem Dorf an ihrer Seite, die sich als flinke Bedienungen erwiesen und sich von Diana zu einem zuverlässigen Team hatten formen lassen. Auf Mephistos Einmischung konnten die drei dabei gut verzichten und das wiederum verstand der weidlich auszunutzen.
Auch heute Abend war der Biergarten wieder ein begehrtes Ziel Fahrrad fahrender Urlauber. Als Leander gegen 19 Uhreintraf, waren die Tische bis auf den letzten Platz besetzt. Wegen des anhaltend schönen Wetters konnten Diana und Mephisto ihr Scheunencafé, das sie im vergangenen Winter eingeweiht hatten, seit Anfang Mai geschlossen lassen und alle Aktivitäten nach draußen verlagern. Die Bedienungen hatten gut zu tun und wieselten routiniert zwischen den Gästen und der Küche im Haupthaus, einem langgestreckten alten Friesenhof mit Reetdach, hin und her.
An einem Tisch in der Nähe der Scheune saßen bereits der Lehrer Tom Brodersen und der Kunstmaler Götz Hindelang, Henning Leanders Skatbrüder. Während Leander sich dorthin wandte, kam Mephisto aus der Küche und balancierte vier randvolle Bierkrüge auf einem Tablett in ihre Richtung, wobei die Schaumkronen gefährlich hin und her schwappten. Der kleine Mann hatte bis zu seiner Strafversetzung und anschließendem freiwilligen Ausscheiden aus dem Amt als Priester die übersichtliche katholische Gemeinde auf Föhr geleitet, was man angesichts seines Hangs zu ketzerischen Reden und einer gleichsam diabolischen Freude an Gemeinheiten und Tricksereien kaum glauben mochte. Übrig geblieben war sein Spitzname Mephisto, unter dem er auf der ganzen Insel so bekannt wie berüchtigt war. Den bürgerlichen Namen Dirk Wittkamp jedenfalls benutzte im Umgang mit ihm nur noch die Verwaltung und auch das nur in amtlichen Schreiben.
»Na bitte«, rief Mephisto, als er Leanders ansichtig wurde, »kaum läuft das Bier in die Tränke, ist die Herde vollzählig. Selbst unser kaltgestellter Kriminalist bequemt sich in unsere bescheidene Mitte. Mit Sprit fängt man Bullen, oder wie heißt das alte Sprichwort?«
»Dir auch einen schönen guten Abend«, entgegnete Leander und verkniff sich ein ›mein Hirte‹, weil er wusste, dass der ehemalige Priester geradezu darauf wartete, wenn er seine Herden-Metapher verwendete. Den Gefallen würde er ihm heute nicht tun. Auch den Seitenhieb auf seinen früheren Beruf als Kriminalhauptkommissar beim LKA Schleswig-Holstein in Kiel nahm Leander angesichts eines hohen Gewöhnungsgrades nur noch nebenbei wahr und pflegte ihn vernünftigerweise schlicht zu ignorieren. Er ließ sich neben Tom und gegenüber Götz auf die Bank fallen. Damit war die Sitzordnung für den heutigen Skatabend festgelegt.
Mephisto setzte das Tablett hart auf den Tisch und prustete wie eine Dampflok, die gerade Unmögliches in die Tat umgesetzt und eine schier unüberwindliche Steigung mit nach menschlichem Ermessen nicht zu stemmender Last doch noch überwunden hatte. Dann griff er ungeachtet seiner Gastgeberfunktion als Erster nach einem Krug, ließ sich neben Götz auf die Bank sinken und begann gleich, mit geschlossenen Augen, das erfrischende Nass in seine Kehle laufen zu lassen. Niemanden hätte es bei dem Anblick gewundert, wenn er auch noch zischend Dampf ausgestoßen hätte.
»Ah«, seufzte er schließlich mit Inbrunst. »Es gibt doch nichts Schöneres als ein frisches Gezapftes nach der Müh und Plage eines arbeitsreichen Tages. Aber jetzt ist Feierabend, Freunde! Ab jetzt lassen wir uns bedienen. Außerdem: Wofür habe ich denn Personal?«
»Lass das nicht deine zweifellos bessere Hälfte hören«, warnte Tom. »Dann sitzen wir den Rest des Abends auf dem Trockenen und müssen auch noch hungern.«
»Da sei Gott vor!«, brummte Mephisto und wischte sich mit dem Handrücken den Bierschaum vom Mund.
»Oder der Teufel«, ergänzte Götz, »aber der spielt ja heute Abend mit uns Skat.«
»Genau so ist das!« Mephisto schien nur auf das Stichwort gewartet zu haben. Er zog ein Kartenspiel aus der Tasche und fächerte es vor den anderen drei Männern auf. »Voilà, frisch gezinkt. In diesem Sinne: Euch allen ein gutes, mir ein besseres Blatt!«
Jeder zog nun eine Karte und warf sie offen auf den Tisch. Götz hatte den höchsten Wert gezogen und damit die Pflicht, als Erster zu geben. Geschickt strich er die herumliegenden Karten wieder zusammen und mischte mit so flinken Fingern den Stapel durch, dass Mephisto skeptisch die Augenbrauen zusammenzog.
»Oha, der Anstreicher hat heimlich geübt. Aber wenn er glaubt, dass ihm das etwas nützt, dann hat er die Rechnung ohne uns gemacht, was, Jungs?«
Tom blickte Leander an und zog die Augenbrauen hoch, woraufhin der grinsend den Kopf schüttelte. Mephisto suchte gleich zu Beginn Verbündete, da musste man auf der Hut sein. So ging das zwischen den vier Freunden immer zu: Sie waren so etwas wie eine verbal schlagende Verbindung, die sich regelmäßig einmal in der Woche zum Skatspielen traf. War auch das Glück dabei eine stets wechselnde Braut, so hatten diese Skatabende doch etwas Beständiges: dass niemand auf die Gnade der anderen hoffen durfte. Auch dauerhafte Bündnisse gab es zwischen ihnen nicht. Jeder konnte jederzeit allein das Opfer wortreicher Attacken und fieser Spielzüge werden und sich im Gegenzug sicher sein, dass er Sekunden später zwei Sekundanten fand, wenn er den Spieß umdrehte und gegen den Vierten richtete. Die daraus erwachsende Unsicherheit war das einzig Sichere an diesen Abenden und genau diese Dialektik machte den Reiz der Skatrunde aus.
Götz legte den gemischten Stapel vor Mephisto auf den Tisch. Der hob umständlich ab und zog dabei ein Gesicht, als hätten seine Freunde die Ehre, einem ungemein wichtigen Ereignis beizuwohnen, das besonders fachmännisch ausgeführt werden musste. Dementsprechend aufmerksam verfolgte er das nachfolgende Austeilen, während Leander und Tom bereits ihre Blätter aufhoben. Zufrieden nickend nahm er schließlich seine zehn Karten auf einmal auf und sortierte sie umständlich durch, wobei er kopfschüttelnd irgendein unverständliches Zeug vor sich hinmurmelte.
»Sag mal, Mephisto«, fragte Tom vorsichtig. »Müssen wir uns Sorgen machen, dass allmählich die seit Jahren latent vorhandene Demenz vollkommen von dir Besitz ergreift, oder hat dir deine Hexe beigebracht, wie man seine Karten bespricht?« Damit spielte er auf den Umstand an, dass Mephistos Freundin Diana als Heilerin arbeitete und tagsüber eine Praxis für Energiearbeit in dem alten Friesenhof betrieb, den Mephisto zum Café umgebaut hatte.
Der tat so, als hätte er die Stichelei gar nicht bemerkt, und wandte sich an Leander: »Du sagst!«
»Achtzehn?«, reizte Leander.
»Achtzehn hab ich immer«, behauptete Mephisto und blickte – empört darüber, dass dies überhaupt in Frage gestellt wurde – über seine Brille hinweg.
»Zwanzig.«
»Bei Zwanzig fange ich erst an.«
»Zwo?«
»Zweiundzwanzig ist mein Spiel!«
»Null!«
»Null ist meine leichteste Übung.«
»Aber vier nicht mehr!«
»Will da etwa jemand Kreuz spielen?« Mephisto grinste schelmisch und kniff Leander ein Auge zu. »Na gut, mein Lieber, dann verlier du das Spiel.«
»Tom?«
Als der sich nicht rührte, stieß Leander seinen Nebenmann leicht an.
»Wie bitte?« Der Lehrer blickte auf, als sei er gerade aus tiefgründigen Gedanken aufgeschreckt worden.
»Hast du mehr als vier?«
»Nee, weg.«
Götz Hindelang, der als Geber und vierter Mann in diesem Spiel aussetzen musste, blickte in Mephistos Karten und fragte: »Sag mal, was wolltest du mit dem Schrott eigentlich spielen?«
Mephisto zuckte mit den Schultern. »Kommt auf den Stock an. Ein kaputter Null ist schließlich immer drin.«
»Der wäre aber sehr kaputt gewesen.«
»Mein lieber Freund«, Mephisto legte die Karten verdeckt vor sich auf den Tisch und drehte seinen mächtigen Oberkörper dem Kunstmaler zu, »gewinnen kann schließlich jeder. Mit Anstand verlieren: Das hat Größe!« Dabei hob er den rechten Zeigefinger, als verkünde er wie früher von der Kanzel die absolute Wahrheit oder zumindest eine nur philosophisch nachvollziehbare Weisheit.
»Dann hättest du ja automatisch gewonnen«, stellte Leander fest, während er den Skat in seine Karten einsortierte.
»Weshalb? Weil ich ein so begnadeter Spieler bin, dem noch dazu durch seine Verbindung zu allen höheren Mächten das Glück des Universums hold ist?«
»Nein, weil du alles besitzt, nur keinen Anstand.« Leander zog zwei Karten aus seinem Blatt, überlegte kurz und steckte sie wieder zurück.
»Jetzt tust du mir aber unrecht«, beschwerte sich Mephisto mit beleidigter Miene. »Ich wollte dir doch nur einen Freundschaftsdienst erweisen.«
»Indem du sein Spiel kaputt machst?« Götz verengte die Augen zu einem schmalen Schlitz.
»Das bleibt ja nun erst noch abzuwarten, ob der Mann überhaupt ein Spiel hat.«
»Hat er«, antwortete Leander leichthin. »Und zwar einen todsicheren Kreuz.«
Mephisto zog die Stirn kraus und donnerte mit der Faust seine erste Karte auf den Tisch: das Herz-As. Leander stach es mit dem Kreuz-As und bekam von Tom die Herz-Sieben dazugeworfen.
»Noch zwei solche Stiche und ich habe gewonnen«, kommentierte er das, ohne eine Miene zu verziehen. Dann spielte er die Trumpf-Sieben auf. »Die Kleinen holen die Großen.«
Tom stach mit den Worten »Den kann ich, vielleicht hast du ja was zum Reinbuttern« mit dem Herz-Buben, aber Mephisto übernahm den Stich mit dem Kreuz-Buben.
»Nichts da, Kollege. Ich will weiterkommen. Das Spiel gehört in Mittelhand.« Dann spielte er die Herz-Zehn nach. »Stechen sollst du!«
Leander überlegte einen Moment, aber da seine Gegner keinen Buben mehr haben konnten, übernahm er mit der Trumpf-Zehn, was Tom zu einem ungehaltenen Stöhnen veranlasste.
»Verflucht!«, rief der Lehrer an Mephisto gewandt und warf die Karo-Sieben ab. »Ich wollte den eigentlich gewinnen.«
»Dann hast du dir den falschen Mitspieler ausgesucht«, beschied Götz leichthin.
Mephisto zuckte mit den Schultern, als könne man gegen sein unvermeidliches Schicksal ohnehin nichts machen. Leander hatte nun leichtes Spiel. Er zog, angefangen mit den beiden verbliebenen Buben, seinen Gegnern die letzten Trümpfe weg und sicherte sich bis auf den letzten Stich den Rest mit seiner Stehfarbe Karo.
»Schneider sind auch Leute«, verkündete er. »Oder wollt ihr erst nachzählen?«
»Wer hat da doch eben noch erklärt, Henning würde das Spiel verlieren?«, presste Tom zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Ach was.« Mephisto wischte jede Kritik mit der rechten Hand beiseite. »Die ersten Pflaumen sind madig.«
»Wohl wahr«, entgegnete Leander. »Aber wahr ist auch: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und damit ihr aus euren Fehlern auch etwas lernt, dürft ihr jetzt bezahlen. Das war ein einfacher Kreuz-Schneider, macht sechsunddreißig, also vier Mark, die Damen.« Berechnet wurde nämlich jeder Punkt mit einem Zehntelcent, immer auf den nächsten Cent aufgerundet.
Alle, auch Götz, schoben Leander vier Cent hinüber und Mephisto kratzte die Karten zusammen, um nun seinerseits zu mischen und auszuteilen. In diesem Moment kam Diana mit zwei großen Holzplatten an den Tisch. Auf der einen türmten sich Scheiben von Mephistos selbstgebackenem Brot mit Käse belegt, auf der anderen mit Schinken. Während sich Tom bei dem Anblick die Hände rieb und Leander ein anerkennendes »Jawoll!« vernehmen ließ, teilte Mephisto die Karten aus und stellte lapidar fest: »Zu etwas müssen Frauen ja nütze sein.«
Dafür fing er sich von Diana einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf ein. »Das erhöht das Denkvermögen«, sagte sie. »Und genau das scheinst du nötig zu haben.«
»Kannst du das noch mal machen?«, fragte Götz Diana. »Ich höre so gerne diesen dumpfen Klang, gerade so, als trommelte man auf einen hohlen Baumstamm.«
»Unsinn!«, beschied Mephisto. »Diana hat mich bloß mit der hohlen Hand geschlagen. Was heißt geschlagen? Angestupst. Gestreichelt gar.«
Diana lachte und entfernte sich kopfschüttelnd in Richtung Haus. Mephisto rief ihr noch schnell die Bestellung vierer Krüge Bier hinterher, die sie mit einem Winken über die Schulter bestätigte.
»Sag mal, Mephisto«, meldete sich Tom zu Wort, während der Angesprochene die Karten zusammensuchte und gründlich zu mischen begann. »Ich hatte da jüngst eine Erscheinung, die du mir vielleicht erklären kannst.«
»Erscheinungen sind mein Spezialgebiet! Nur frei heraus damit.«
»Gestern Abend sah ich einen kleinen, dicken und hässlichen älteren Mann auf einem nicht minder abscheulich klapprigen Fahrrad. Beide wirkten wie frisch vom Sperrmüll. Das wäre nicht weiter auffällig gewesen, wenn dieser hässliche Gnom nicht einen abgewetzten Talar getragen und wie dein Zwillingsbruder ausgesehen hätte, werter Mephisto.«
»Wo soll das gewesen sein?«, erkundigte sich der Angeredete mit einer Miene, die an sich schon ausdrückte, dass das gänzlich unmöglich sei.
»Auf dem Radweg von Wrixum nach Oevenum. Genauer gesagt, in Höhe der Wrixumer Mühle.«
Mephisto wiegte angestrengt nachdenkend den Kopf, schüttelte ihn dann heftig verneinend und sagte: »Oh ja, oh ja, das kann wohl sein.«
»Und was habt ihr da gemacht? Du, dein Fahrrad und dein Talar?«
»Wir waren gemeinsam auf dem Weg vom Kurgartensaal nach Hause.«
»Hast du da eine schwarze Messe gefeiert, oder was?«, zeigte sich Tom ungeduldig.
»In der Tat, so kann man das nennen. Da hat nämlich ein Skatturnier für Touristen stattgefunden.«
»Und daran hast du teilgenommen, obwohl du gar kein Tourist bist? Im Talar, den du überhaupt nicht mehr tragen darfst? Angereist mit einem Fahrrad, das seit einem halben Jahrhundert nicht mehr verkehrstauglich ist?«
»Zu Frage Eins: ja. Zu Frage Zwei: ebenfalls ja. Zu Frage Drei: jawoll!«
»Und das findest du nicht weiter erläuterungsbedürftig?«
»Lieber Tom. Auf diese Frage könnte ich dir nun mit einem entschiedenen Nein antworten, aber mich deucht, das würde dich in deiner unermesslichen Anmaßung nicht wirklich zufriedenstellen.«
»Nicht wirklich, stimmt«, bestätigte der Lehrer, während Leander und Götz dem sich anbahnenden Scharmützel belustigt folgten und sich erwartungsvoll zurücklehnten.
»Nun denn also: Dann will ich dich mal einweihen. Der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Und einem armen alten Gottesmann, einem ehemaligen noch dazu, dessen Leben in Zucht und Aufopferung die drohenden Höllenqualen gleichsam vorwegnimmt, verwehrt man nicht den Zugang zu seiner einzigen irdischen Erquickung: dem Kartenspiel – Tourist hin oder her. Zudem spielen die Menschen mit einem Priester unter angemessener Zurückhaltung, was meine Chancen auf einen Rangplatz ungemein erhöht. In der ersten Serie hat das auch auf wunderbare Weise funktioniert. Ich hatte zwei Süddeutsche an meinem Tisch, einen Württemberger und einen Bayern. Gottesfürchtige Bergbewohner, die noch wissen, was man einem Geistlichen schuldig ist, zumal sie mich mit einem zünftigen ›Grüß Gott‹ begrüßt haben. Ich habe mich angemessen bedankt, indem ich sie vernichtend geschlagen habe. Haha! In der zweiten Runde dann wurde ich einem Sachsen und einem Ostwestfalen zugelost. Gottlose Ostvölker, das alles! Die hatten keinerlei Respekt vor meinem Camouflage.«
»Dann haben sie es dir blasphemischem Zwerg hoffentlich so richtig gegeben.«
»Mitnichten. Ich musste zwar mein ganzes spielerisches Genie in die Waagschale werfen, wovon ich bekanntlich nicht unerhebliche Mengen besitze, aber am Ende habe ich obsiegt. Und so wird deinem Adlerauge ja wohl nicht entgangen sein, dass mein armes altes Fahrrad einen großen, schweren Karton auf seinem schwächlichen Gepäckträger nach Hause bugsieren musste.«
»In der Tat: Du hast verdächtig geschwankt. Lass mich raten: die siebenunddreißigste Schlagbohrmaschine?«
»Oh nein! Mein erster Dampfreiniger«, triumphierte Mephisto. »Ein Kärcher noch dazu! Und das alles dank meines Talents und, ich gebe es durchaus zu, meiner Furcht einflößenden Kleidung.«
»Hast du nicht vor einiger Zeit in diesem Kreise gelobt, derartige Tricks nie wieder einzusetzen?«, beschwerte sich Tom.
»Ach, weißt du, mit Gelöbnissen ist das so eine Sache. Meine früheren Amtsbrüder hätten nicht mehr viel zu tun, wenn die Beichte bei ihren Schäfchen tatsächlich die offiziell vorgesehene Wirkung hätte. Machen wir uns nichts vor: Die Kirche lebt von der Sünde. Und wer bin ich, dass ich meinem früheren Arbeitgeber das Recht auf Leben verweigere?«
»Oh, du gütiger Mensch«, vollführte Tom eine verbale Verneigung vor Mephisto. »Dir gebührt wahrlich ein Orden.«
»Ich weiß. Aber diese Ansicht wird höheren Ortes zu meinem Leidwesen nicht geteilt.«
»Musst du eigentlich immer das letzte Wort haben?«, beschwerte sich Götz und deutete Leander an, die Karten endlich auszuteilen.
»Verzeih mir, lieber Freund«, lenkte Mephisto ein. »Trotz all meiner Gaben fehlt mir eine entscheidende: Ich bin kein Hellseher. Wie also soll ich in meiner Unvollkommenheit bereits vor meinen unzweifelhaft beachtenswerten Beiträgen schon wissen, dass Tom nach denselben nichts mehr sagen kann?«
»Der Witz ist auch schon so alt, dass er den bekannten langen weißen Bart trägt«, zeigte sich Leander unbeeindruckt und teilte die Karten aus.
Aber Mephisto winkte ab und verkündete: »Das gilt auch für Moses und die zehn Gebote. Trotzdem werden sie bis heute und bestimmt in alle Zukunft tausendfach zitiert.«
»Dir ist auch kein Sakrileg so groß, dass du es nicht begehen würdest, was?«, beschwerte sich Tom und sortierte seine Karten.
»A propos Sakrileg«, wechselte Götz das Thema, bevor Mephisto noch einmal weit ausholen konnte. »Wie lange will Diana uns eigentlich noch auf dem Trockenen sitzen lassen?«
»Vielleicht ist es ja doch besser, wenn ich mich mal selber darum kümmere«, schloss Mephisto, erhob sich schwerfällig und marschierte in Richtung Haus. Direkt vor der Tür traf er auf seine Lebensgefährtin und entwand ihren Händen ein Tablett mit vollen Bierkrügen, die nicht für die Skatrunde gedacht waren. Aber statt zu protestieren, gab sie sich achselzuckend geschlagen und drehte um, während Mephisto an den Tisch zurückeilte.
Im weiteren Verlauf des Abends wechselte das Geld in alle Richtungen seine Besitzer. Keiner der Skatbrüder konnte sich über eine stabile Glückssträhne freuen. Angesichts einer geradezu ereignisarmen Stunde erwischte sich Leander schließlich dabei, dass er in Gedanken abschweifte und ein Spiel verlor, das eigentlich absolut sicher gewesen war.
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht«, kommentierte Tom die Fehler, die Leander gemacht hatte. »Irgendwie bist du auch nicht mehr der Alte.«
»Kunststück«, meinte Mephisto.
»Willst du damit sagen, du hast eine Erklärung für Hennings geistige Abwesenheit?«, zeigte sich Tom so betont interessiert, dass Leander hellhörig wurde.
»Aber sicher.«
»Da bin ich aber mal gespannt«, stimmte nun auch Götz ein und beugte sich erwartungsvoll vor.
»Seht ihn euch doch an«, begann Mephisto in besorgtem Ton. »Wer ihn nicht kennt, könnte denken, er ruhe in sich selbst. Aber ich, sein bester Freund« – jetzt war es an Leander, missbilligend die Augenbrauen hochzuziehen – »ich sehe doch, dass er im Begriff ist, der Lethargie zu verfallen. Und das bereitet mir Sorgen.«
Götz nickte, als habe er genau das schon seit Langem gedacht.
»Ja, das musst du zugeben, Henning«, schwenkte Tom auf Mephistos Linie ein. »Seit du im letzten Jahr auf Helgoland warst*, bist du nicht mehr du selbst.«
»Kunststück«, wiederholte Mephisto. »Lena hat ihn abserviert, Eiken will auch nichts mehr von ihm wissen: Da muss der Mann doch von Selbstzweifeln zerfressen werden und der Depression verfallen.«
»Depression? Ich?« Leander, der eigentlich mischen und austeilen musste, legte den Kartenstapel auf den Tisch. Als sein Blick die unschuldigen Augen Mephistos traf, dämmerte ihm, was hier gerade gespielt wurde. Grimmig sah er seine beiden anderen Freunde an und sagte vorwurfsvoll: »Das glaube ich jetzt nicht.«
Götz wich ihm aus und blickte leicht verlegen auf die Tischplatte. Tom hingegen hatte Mühe, sein Grinsen im Zaum zu halten.
»Sagt mal, liebe Freunde«, Leander beugte sich zu Mephisto und Götz vor, »was hat euch dieser durchtriebene Schulmeister versprochen, wenn ihr mich heute Abend weichklopft?«
»Ich? Versprochen?« Tom hob abwehrend die Hände.
»Was heißt denn hier weichklopfen?«, beschwerte sich Götz.
»Du verstehst das völlig miss«, beschied Mephisto in dem beschwichtigenden Tonfall eines Psychiaters, der einem besonders schweren Fall von Paranoia gegenübersaß. »Wir machen uns lediglich Sorgen um dich. Du musst wieder auf die Beine gestellt werden; brauchst eine Aufgabe; etwas, das dich fordert.«
»Ein Kriminalist, dessen Instinkte einschlafen, kann sich beerdigen lassen«, setzte Tom noch einen drauf. »Du lebst da in deiner Fischerkate vor dich hin und verkümmerst, mein Lieber.«
»Das ist wie mit dem berühmten Taucher, der nicht taucht«, quasselte Mephisto. »Der taucht auch nix!«
Leander lehnte sich zurück und grinste in die Runde, weil seine Skatbrüder es heute Abend doch etwas zu plump anstellten. »Jetzt mal Butter bei die Fische, Tom: Was soll ich für dich tun?«
»Das hat aber lange gedauert«, murmelte Götz, »bis du das geschnallt hast.«
»Quod erat demonstrandum!« Mephisto nickte selbstgerecht. »Sämtliche Instinkte sind eingeschlafen, wenn nicht gar verkümmert.«
»Tja«, gab sich Tom gönnerhaft. »Wenn du unbedingt etwas tun musst, will ich dich nicht hängen lassen. Dafür sind Freunde schließlich da. Du weißt, dass Carola und ich eine Auswandererausstellung planen, die 2020 ein Jubiläumsfest krönen soll. Natürlich ist bis dahin noch viel Zeit, aber du sagst ja selbst immer, dass man nicht früh genug anfangen kann.«
»Das sage ich immer?«, zweifelte Leander.
»Lenk jetzt nicht ab«, fuhr Tom ihn an. »Ich versuche, dir zu helfen, mein Lieber! Da könntest du ruhig etwas dankbarer sein. Also: Du darfst mich morgen auf meiner Tour durch die Dörfer begleiten. Ich möchte da Interviews mit ehemaligen Auswanderern führen, bevor die demnächst aussterben. Und wer weiß, vielleicht fällt da ja auch etwas für ein kleines Büchlein ab.«
Leander lehnte sich grinsend zurück. Er hatte sich schon gewundert, dass Tom ihn noch nicht darauf angesprochen hatte. Als führender Heimatforscher Föhrs war der Geschichtslehrer intensiv in die Vorbereitung der Jubiläumsausstellung des Carl-Häberlin-Museums eingebunden. Außerdem suchte er seit Jahren nach einem Thema, dem er sich in Form eines Buches widmen konnte. Sein anfänglicher Spleen, die Geschichte Nordfrieslands im Ganzen neu zu schreiben, hatte sich als so überambitioniert wie nicht leistbar erwiesen. Inzwischen war er bescheidener geworden und hatte sich auf den einen oder anderen Fachartikel für die Fering-Stiftung und das Carl-Häberlin-Museum beschränkt. Die Amerika-Auswanderer schienen Leander ein solch überschaubares Thema zu sein, das auch er selbst nicht ganz uninteressant fand.
»Also gut, mein Lieber«, sagte Leander schließlich. »Ich bin dabei. Wann soll es losgehen?«
»Das ging jetzt aber schnell«, kommentierte Götz.
»Wenn du mich fragst, zu schnell«, beschied Mephisto. »Ich hätte den Burschen gerne noch ein wenig in die Mangel genommen.«
»Ich hole dich um elf mit dem Fahrrad ab«, ignorierte Tom seine Skatbrüder, allerdings in einem Tonfall, der verriet, dass auch er über den schnellen Erfolg erstaunt war. »Alles Weitere erkläre ich dir auf dem Weg.«
Leander nickte, nahm die Karten hoch und fragte in die Runde: »Wer gibt?«
»Immer die Sau, die grunzt!«, antwortete Mephisto.
* siehe »Leander und der Lummensprung«
2 Donnerstag
»Der Ball kommt an«, brüllte der Kommentator. »Jetzt müsste er ihn machen. Und er macht ihn! Wahnsinn! Henning Leander schießt das alles entscheidende Tor in der 113. Minute!«
Leander riss die Arme hoch, die Mannschaftskameraden stürmten auf ihn ein, Mario Götze sprang ihm um den Hals, während um ihn herum das Stadion tobte. Es war der 13. Juli 2014, Leander und seine Jungs befanden sich in Rio und hatten gerade Lionel Messi und dessen Argentinier geschlagen, Deutschland war Weltmeister! Leander drehte sich im Freudentaumel, die Fernsehkameras verfolgten seinen Jubel im Close-up, die ganze Welt schaute nur auf ihn, Henning Leander, den Helden von Rio.
Bella räkelte sich geräuschvoll gähnend und schob sich wieder an Leanders Rücken heran. Er hatte es gewagt, sich im Siegestaumel umzudrehen, und so hatte sie den Körperkontakt verloren. Automatisch griff Leander hinüber und kraulte sie am Ohransatz. Nur mühsam fand er in die Realität zurück, der Sprung aus dem jubelumtosten Stadion in sein kleines Schlafzimmer und damit vom durchtrainierten Jungstar zum schlaffen Endvierziger kam einfach zu plötzlich. Während sich bei ihm mit der Erkenntnis auch die Enttäuschung breitmachte, begann Bella, tief und ausdauernd zu schnurren. Mit geschlossenen Augen hielt sie ihren Kopf unbeweglich in der Position und drückte ihn gegen die kraulenden Finger. Leander musste bei dem Anblick lachen: Bella verstand es zu genießen.
Der Wecker klingelte. 8 Uhr: Zeit, Poirot hereinzulassen. Seufzend rollte sich Leander auf die Bettkante, was bei Bella ein unwilliges »Mann, ey!« in Katzensprache zur Folge hatte.
»Mecker nicht, Bella«, sagte Leander. »Du kannst ja noch liegen bleiben.«
Aber die kleine schwarz-weiße Katze war schon auf ihren Pfoten und sprang mit einem Satz über seine Beine hinweg aus dem Bett. Im Flur wartete sie vor der Treppe und sah mit großen Augen zu ihm auf, als er nun steifbeinig und laut gähnend aus dem Schlafzimmer stakste. Sie empfing ihn mit einem langgezogenen »Miau« und nahm dann immer drei Stufen auf einmal, um vor Leander an der Hintertür zum Garten zu sein. Durch die verschlossene Holztür hindurch unterhielt sie sich angeregt mit ihrem Bruder Poirot, der draußen darauf wartete, dass Leander ihn hereinließ.
Während Bella nur tagsüber in der Umgebung des kleinen Fischerhäuschens herumstromerte und nachts grundsätzlich bei Leander im Haus schlief, war Poirot ein Nachtschwärmer. Gemäß dem Motto, dass das Böse grundsätzlich im Dunkeln sein Unwesen trieb, ermittelte er höchst erfolgreich in der Nacht in Mäusekreisen und verbrachte seine Tage im Wohnzimmer in dem komatösen Schlaf dessen, der von der Nachtschicht seiner gesamten Energie beraubt war. Für den sicheren Unterschlupf bedankte er sich regelmäßig bei Leander, und so lag auch heute wieder eine tote und reichlich angematschte Maus als Präsent auf der Türschwelle, als der Hausherr die Gartentür aufschloss.
Bella beschnupperte den kleinen Nager sofort mit größtem Interesse, bekam dafür aber einen Tatzenschlag von ihrem Bruder direkt auf die Nase. Die Maus war für Leander bestimmt!
»Danke, Poirot«, sagte der ernst und streichelte dem kleinen schwarzen Kater über den Kopf.
Im Unterschied zu der Schwester, die weiße Tatzen und ein weißes Lätzchen hatte, war Poirot komplett schwarz und hatte einen dickeren Schädel. Leander hatte die jungen Katzen im letzten Sommer nach seiner Rückkehr von Helgoland in seinem Garten gefunden. Die halbwilde Mutter, die täglich zum Fressen bei ihm aufgetaucht und von ihm auf den Namen Gitane getauft worden war, hatte ihm ihre vier Jungen anvertraut und war dann, von einem erbitterten Kampf unter Katzenclans gezeichnet, zum Sterben irgendwo in den Wyker Grünstreifen verschwunden. Nachdem er die Jungtiere aufgezogen und kastrieren lassen hatte, hatte er zwei von ihnen zu seinem Freund Mephisto gebracht, in dessen Bauernhof-Café und Biergarten sie nun für die Dezimierung des Nagerbestandes sorgten. Bella und Poirot hatte er selbst behalten, weil ihm die kleinen quirligen Biester ans Herz gewachsen waren. Nur wenn sie mit Vögeln ankamen, manchmal sogar mit jungen, die gerade erst aus dem Nest gesprungen waren, zweifelte er manchmal an seiner Katzenliebe. Im letzten Sommer aber, nach seiner Rückkehr von Helgoland, hatte ihm die kuschelige Nähe des Kätzchens gutgetan, und der kleine Kater erinnerte in seiner streunenden Lebensweise so sehr an Gitane, dass Leander ihm die Rechtsnachfolge in ihrem Revier nicht vorenthalten wollte.
Einträchtig zogen die beiden Katzen nun an dem Herrn des Hauses vorbei in die Küche und setzten sich nebeneinander vor die leeren Katzentröge. Erwartungsvoll beobachteten sie, wie Leander nach der Blechdose mit dem Trockenfutter griff und beide Näpfe füllte. Dann legten sie sich davor und begannen mit geschlossenen Augen laut schmatzend und knackend zu fressen.
Das war der Moment, in dem Leander an sich selbst denken konnte. Er bereitete die Kaffeemaschine vor und stellte sie an, um nach dem Duschen und Brötchenholen direkt mit dem Frühstück beginnen zu können. Bella und Poirot schnurrten beim Fressen und ließen sich nicht stören, als er nun die Küche verließ und den Aufstieg ins Bad in Angriff nahm.
Das Ritual sah immer gleich aus: Nach der Morgentoilette ging Leander die wenigen Meter von seinem Häuschen in der Wilhelmstraße hinüber in die Mittelstraße und kaufte bei Bäcker Hansen seine Brötchen. Dann folgte ein kurzer Abstecher auf die Mittelbrücke, um einen ersten Blick auf das Meer und den Sandwall zu werfen.
Der blanke Hans lag ruhig vor ihm, die Halligwarften wirkten zum Greifen nah. Auch der Sandwall hatte noch nichts von der belebten Promenade, in die er sich in Kürze verwandeln würde. Das laute Tuten einer Fähre, die gerade auf den Hafen zusteuerte, kündigte bereits die erste Ladung an Tagesgästen an. Kurz entschlossen verließ Leander die Mittelbrücke und wandte sich dem Rathausplatz und dem Flutschutztor zu, das die Innenstadt im Falle einer Sturmflut vom Hafen abschottete. Dann lenkte er seine Schritte nach rechts in Richtung Anleger, wo er das Manöver beobachtete, mit dem die Nordfriesland gerade festmachte. Die Bordwand senkte sich ab und verwandelte sich in eine Rampe, über die zunächst die Passagiere ohne Autos das Schiff verließen. Familien mit kleinen Kindern waren darunter und Paare mittleren Alters mit Tagesrucksäcken.
Ein Mann jedoch fiel aus dem Rahmen: Er war großgewachsen und schlank und trug trotz der bereits hohen Temperaturen abgewetzte Jeans und hohe Lederstiefel. Dazu hatte er einen breitkrempigen Cowboy-Hut auf, unter dem schulterlange blonde Haare hervorquollen, und trug eine hellbraune Wildlederjacke mit Fransen an den Ärmeln. Der Mann wirkte, als wäre Old Shatterhand just den Kulissen in Bad Segeberg entstiegen und hätte sich direkt auf den Weg nach Föhr gemacht. Es fehlten nur das Pferd und der Bärentöter. Stattdessen trug er einen prall gefüllten Seesack auf der Schulter.
Leander beobachtete, wie er mit langen Schritten zielstrebig und ohne sich weiter umzusehen quer über die Wartereihen der Autoabfertigung lief und bei der ersten Gelegenheit durch eine Lücke in der Betonmauer den Strand betrat. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn er dort unten auf ein bereitstehendes Pferd gestiegen und einfach davongaloppiert wäre. Dieser Gedanke erinnerte Leander an die Amerika-Auswanderer und daran, dass Tom demnächst vor der Tür stehen würde – überpünktlich, wie er befürchtete. Also riss er sich von dem Anblick los und machte sich auf den Weg nach Hause.
Eine Viertelstunde später saß er mit einem Kornkracher, zwei Dünenkrustis, selbst hergestelltem Holunderblütengelee und einer Kanne Kaffee im Garten unter dem Apfelbaum und lauschte dem Zwitschern der Vögel. So begannen bei gutem Wetter alle seine Tage und er war sich in Momenten wie diesen sicher, dass man das wohl Glück nennen konnte.
Poirot hatte sich inzwischen in Seitenlage in seinem Katzenbett im Wohnzimmer zusammengerollt und war mit ausgestreckten Vorderpfoten in einen tiefen Schlaf abgetaucht, während Bella irgendwo in der Nähe durch die Gärten streifte. Wahrscheinlich verscharrte sie gerade in einem der fein geharkten Blumenbeete von Johanna Husen ihre Exkremente, was die alte Dame wieder zur Weißglut bringen würde. Leander lachte, als er sich das wutverzerrte Warangesicht seiner Nachbarin vorstellte, und griff nach Kornkracher und Brötchenmesser.
Was zwischen Johanna Husen und ihm seit Jahren stattfand, konnte man nicht als offenen Nachbarschaftsstreit bezeichnen. Beide verachteten die Lebensweise des anderen so entschieden, dass sie einfach nicht mehr miteinander sprachen, seit Leander sich jede Einmischung in seine Haushaltsführung verbeten hatte. Folgerichtig war der Kontakt inzwischen so gut wie vollkommen abgebrochen. Allenfalls über die Hecke hinweg laut geäußerte Gedanken trafen gelegentlich ihr Ziel und führten hin und wieder zu einer Replik. Die alte Dame konnte sich einfach nicht damit anfreunden, dass ein noch nicht einmal fünfzig Jahre alter Mann keinem Beruf nachging und stattdessen faul vom Erbe seines Großvaters schmarotzte, der schließlich sein Leben lang als Fischer hart gearbeitet hatte. In ihren Augen besaß Leander nicht ansatzweise so etwas wie friesische Tugenden. Und dass er noch dazu seinen Garten in einer Art und Weise verwildern ließ, die ihre eigene unkrautfreie Zone gefährdete, war für sie der Gipfel der Unverschämtheit. Leander seinerseits hielt Johanna Husen schlicht für eine bornierte Dörflerin, deren Horizont bereits am Wyker Spülsaum endete.
Plötzlich ertönte ein aufgeregtes Katzenkreischen aus dem Nachbargarten. Leander vermutete, dass die alte Hexe wieder mit irgendetwas nach dem Tier geworfen hatte. Dann schoss ein kleiner schwarz-weißer Blitz raschelnd durch die Ligusterhecke und stoppte direkt vor Leanders Füßen. Aufgeregt blickte Bella zu ihm auf und berichtete in hohen Tönen von der bösen alten Frau. Leander beugte sich zu ihr hinunter und streichelte sie beruhigend. »Du sollst auch nicht immer zu dem alten Drachen gehen«, sagte er so laut, dass Johanna Husen es hinter der Hecke hören musste. »Such dir Gärten von Menschen aus, die ein Herz in der Brust haben und keinen Eisklumpen.«
Die kleine Katze drückte ihm das Köpfchen in die Hand und schloss die Augen, als gelobe sie Besserung.
»Das habe ich gehört«, drang Johanna Husens schrille Stimme durch die Ligusterhecke.
Leander grinste zufrieden, antwortete aber nicht.
»Dabei habe ich gar nichts gemacht«, fuhr seine Nachbarin unbeirrt fort. »Das Kätzchen hat mich gesehen und sofort gekreischt.«
Das konnte Leander sehr gut nachvollziehen und so nickte er Bella verständnisvoll zu. Die sprang auf einen der Gartenstühle, rollte sich auf dem Polster zusammen, legte den Kopf auf ihre Vorderpfoten und schloss nach einem letzten blinzelnden Blick auf Leander die Augen, um der feindlichen Welt in einem Traum heldenhaft zu begegnen.
Leander lächelte und freute sich über das Vertrauen des Tieres. Dann griff er nach dem Inselboten und wollte sich gerade in die Nachrichten aus dem kleinen, geschlossenen Universum der Nordfriesischen Inseln versenken, als erneut die Stimme seiner Nachbarin ertönte: »Herr Leander? Sind Sie da?«
»Ja, Frau Husen, ich bin hier«, reagierte Leander genervt, verkniff sich aber ein »Wo sollte ich denn sonst sein?«
»Das ist gut. Ich möchte nämlich mal mit Ihnen reden. So geht das doch nicht weiter!«
Leander erhob sich seufzend von seinem Stuhl und ging zur Hecke hinüber, gefasst darauf, dass er nun einen Schwall an Vorwürfen über seinen Lebenswandel, den Zustand seines Gartens und die Zumutung zweier schwarz befellter Kotverbuddeler über sich ergehen lassen musste.
Schon wollte er vorsorglich zum Angriff übergehen, als Frau Husens Stimme versöhnlich verkündete: »Ich finde, wir sollten noch einmal ganz von vorne anfangen. Schließlich werden wir ja wohl für viele Jahre nebeneinander leben. Und da finde ich, dass wir versuchen sollten, friedlich miteinander auszukommen.«
»Äh, ja, das ist ja jetzt … Das kommt aber …«
»Etwas unverhofft, ich weiß. Nichtsdestotrotz wird es Zeit, dass wir uns vertragen. Schließlich war ich, wie Sie wissen, Ihrem Herrn Großvater lange Zeit eng verbunden.«
Oh ja, das wusste Leander, denn genau daraus hatte sie schließlich ihr Recht abgeleitet, ihm zu Anfang in alles, was Haus und Garten betraf, hineinreden zu wollen.
»Herr Leander?«
»Ja, Entschuldigung, ich war nur gerade … Also, das sehe ich im Grunde genau wie Sie, Frau Husen. Ich bin nur etwas in Eile, weil ich gleich weg muss.«
»Natürlich. Ich wollte ja auch nur … So als ersten Schritt, nicht wahr?«
Jetzt passierte etwas, das Leander bis zu diesem Moment für unmöglich gehalten hatte: Die alte Frau tat ihm tatsächlich etwas leid. »Was halten Sie davon, wenn Sie heute Abend zu mir rüberkommen und wir zusammen ein Glas Rotwein trinken?«, hörte er sich unvermittelt sagen.
»Oh, schade, heute Abend kann ich nicht.«
»Dann eben morgen«, schlug Leander vor.
»Großartig, das ist eine sehr gute Idee. Aber den Wein bringe ich mit.«
Leander war sich nicht sicher, ob seine Nachbarin ihm nur den Aufwand ersparen oder sichergehen wollte, dass sie keinen billigen Fusel vorgesetzt bekam. »Alles klar. Dann bis morgen Abend also«, antwortete er.
»Ich freue mich«, setzte Frau Husen noch einen drauf und ließ, als sie nun in Richtung ihres Hauses schlurfte, einen Mann zurück, der nicht glauben konnte, wozu er sich da gerade hatte hinreißen lassen.
»Boring small pond«, murmelte Falk Riewerts und verglich den ›langweiligen Tümpel‹ vor sich in Gedanken mit dem Atlantik. Dass er jemals wieder Wyker Sand unter den Füßen haben würde, hätte er bis vor wenigen Monaten selbst nicht gedacht. Doch dann war der entscheidende Brief des Vaters gekommen, ein langer Brief, der so versöhnlich wie verzweifelt geklungen hatte. Falk hatte lange überlegt, wie er darauf reagieren sollte. Zu tief waren die Wunden, zu schmerzvoll der Verrat, den er immer noch fühlte. Weitere Briefe waren gefolgt und so hatte er am Ende alles Notwendige geregelt und sich von New York aus auf den Weg gemacht. Schließlich gab es auch für ihn auf Föhr noch offene Rechnungen zu begleichen. Und dann war da die Idee, die man nicht allein in Amerika umsetzen konnte. Föhr war dazu genauso gut geeignet wie jeder andere Ort auf der Welt – angesichts der überschaubaren Insellage vielleicht sogar besser, wenn er es recht bedachte.
Nun stand er am Spülsaum neben der Mittelbrücke und blickte über die glatte Wasserfläche hinweg auf die Hallig Langeneß. Die Warften schwammen so unverändert auf dem Glanz der Nordsee, als hätte es die vielen Jahre seiner Abwesenheit gar nicht gegeben. Linkerhand glitt die Nordfriesland, mit der er gekommen war, hinter der Plattform der Mittelbrücke hervor und nahm nun Kurs auf Amrum. Falk atmete den Duft des Wattenmeeres, der vertraut und fremd zugleich war und so ganz anders als der Geruch des Pazifiks. Er war sich nicht sicher, ob ihm gefiel, was er da roch: diese Mischung aus Heimat und Vertreibung.
Falk drehte sich um und ließ seinen Blick den Sandwall entlanggleiten, von der Persil-Uhr rechts über die kleinen Geschäfte – Bu-Bus Bunter Buchladen, ein Teegeschäft, das Café Steigleder – bis zur Konzertmuschel. Die großen, alten Platanen, die früher die Promenade abgeschattet hatten, gab es nicht mehr. Schwindsüchtige Bäumchen gaben nun an ihrer Stelle ein ärmliches Bild vor aufgeräumten Rasenflächen ab, Café-Tischchen drängten sich auf kleinen gepflasterten Kreisen. Auch der Gezeitenbrunnen rechts, vor dem Zugang zur Mittelbrücke, war 1999 noch nicht da gewesen. Die frühere Natürlichkeit drohte einer touristisch opportunen Spießigkeit zu weichen. Urlauber im schlabberigen Öko-Look, wie sie früher für Föhr typisch gewesen waren, suchte Falk vergeblich.
Er bemerkte, dass er automatisch nickte, als resigniere er vor der Erkenntnis, dass nichts ewig währte. Dann setzte er seinen Stetson auf, den er in der Hand gehalten hatte, und griff nach dem Seesack, der neben ihm im Sand lag. Schwungvoll warf er ihn sich über die Schulter und stapfte durch den lockeren Sand zwischen Volleyballnetz und Strandkörben hindurch auf die Promenade zu.
Falk wählte den Weg durch die Mittelstraße, die vom Sandwall aus vertraut wirkte. Links betrieb King immer noch seine Pizzaschmiede für den schnellen Hunger zwischendurch, dann folgte die Bäckerei Hansen, in der sich Touristen drängten und fünf Verkäuferinnen alle Hände voll zu tun hatten. Auf der rechten Seite allerdings hatte die kleine Straße ihr Gesicht verändert. Das Immobilienbüro hatte es vor zwanzig Jahren noch nicht gegeben – solche Mondpreise schon gar nicht – und auch der Weinladen mit seinen Holztischen in der Einbuchtung kam Falk unbekannt vor. Er passierte die Buchhandlung Bücher und Me(e)hr, die sich treu geblieben war und erfreulich viele Bücher über die Inselgeschichte in der Auslage zeigte. Das schnellimbissartige Fischrestaurant links an der Einmündung der Museumstraße fand er befremdlich, hingegen freute er sich, dass die Fleischerei Friedrichs immer noch den Mittagstisch anbot, der schon früher aus selbstgemachten Eintöpfen bestanden hatte. No American fastfood – ehrliche deutsche Hausmannskost.
Es war schon ein merkwürdiges Gefühl, nach so langer Zeit wieder nach Hause zurückzukehren, zumal er wohl kaum willkommen sein würde. Auf einmal fand Falk selbst die bekannte Ansicht der Fußgängerzone befremdlich, fast bedrohlich, als würde er von allen Seiten beobachtet. Ein Liedtext aus den achtziger Jahren tauchte in seinem Kopf auf, ein Hit von Klaus Lage:
Ich bin wieder zu Haus.
Die Kirche ist nicht mehr so groß.
Ich bin wieder zu Haus.
Und doch es geht wieder los.
Ich spür die Blicke hinter den Gardinen,
Die ham mir nicht verzieh’n.
A little paranoid, dachte Falk, schüttelte sich und setzte seinen Weg fort. Niemand stand hier hinter zugezogenen Gardinen und verfolgte den Ankömmling mit feindlichen Blicken! Kein Mensch wusste schließlich, dass er wieder da war. Außerdem war viel Zeit vergangen seit damals, sehr viel Zeit.
Als Falk die Wyker Buchhandlung erreichte, bemerkte er, dass er belustigte Blicke der Urlauber vor den Postkartenständern auf sich zog. Ein Cowboy in Wyk, das sah man nicht alle Tage. Allmählich fand Falk Gefallen an dem Aufsehen, das er erregte. Er zog seinen Stetson, erfüllte ihre Erwartungen, indem er ein beherztes »Howdy!« rief und setzte seinen Weg in Richtung Glockenturm fort, ohne sich weiter für die Reaktion der Urlauber zu interessieren. Dort, an der Einmündung zur Großen Straße, blieb er erschrocken stehen und konnte nicht glauben, was er da sah: Das altehrwürdige Hotel Kolosseum, in dem er eigentlich übergangsweise Quartier hatte nehmen wollen, gab es nicht mehr. In Falks Erinnerung hatte es das Gesicht der Großen Straße geprägt. An seine Stelle war eine hässliche backsteinrote Ladenzeile getreten, wie es sie heute in jeder großen Stadt auf dem Festland gab. Und das Haus der Landwirte an der Ecke zur Badestraße, früher ein gutbürgerliches Restaurant mit Thekenbetrieb und Magnet für die Marktbesucher am Samstag, hatte eine moderne Verwendung als Cocktailbar gefunden und wirkte gar nicht mehr einladend. Holy shit!
Falk überlegte, ob er beim Inselboten nachsehen sollte, ob Nelly noch dort arbeitete. Sie würde ihm sicher eine Unterkunft empfehlen können. Einen Moment lang erwog er, sogar ein Gästezimmer bei ihr anzunehmen, falls Nelly es ihm anbieten würde. Aber sie arbeitete nicht zufällig bei der Zeitung. Wenn sie von seiner Rückkehr erfuhr, würde diese auch im Handumdrehen auf der ganzen Insel bekannt und gerade das wollte er nicht. Die Zimmervermittlung am Hafen schied aus denselben Gründen aus. So eine Nordseeinsel war ein überschaubarer Kosmos, in dem jeder jeden kannte. Nur, wo sollte er hin? Er hatte keine Freunde auf Föhr, niemanden, zu dem er Kontakt gehalten hatte.
Doch, einen gab es: Cord fiel ihm ein, Cord Nickelsen in Süderende. Mit dem hatte er sich früher gut verstanden. Und der hatte immer schon schweigen können. Also wandte Falk sich kurzentschlossen der Bushaltestelle an der Boldixumer Straße zu.
Pünktlich um elf Uhr stand Tom vor der Tür. »Ich hoffe, du bist fertig«, begrüßte er den Freund mit krausgezogener Stirn und einem Unterton, der deutlich machte, dass er fest mit dem Gegenteil rechnete.
»Dir auch einen schönen guten Morgen, lieber Tom«, entgegnete Leander schmunzelnd. »Sekunde. Ich muss nur noch eben den Frühstückstisch abräumen.«