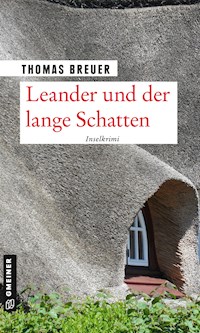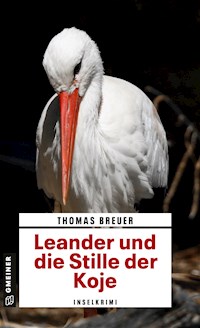
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Leander
- Sprache: Deutsch
Nahmen Rickmers wird in der Boldixumer Vogelkoje tot aufgefunden. Der Leiter der Inselpolizei will vor allem den guten Ruf des Toten schützen. Also verwischt er Spuren, die darauf hindeuten, dass sich Rickmers wegen eines außerehelichen Verhältnisses im Kojenwärterhäuschen aufgehalten haben könnte. Über seine Kontakte erreicht der Bürgermeister, dass Lena Gesthuysen vom LKA die Leitung der Ermittlungen übertragen wird. Sie stürzt sich in die Ermittlungen und beißt sich innerhalb kürzester Zeit in den Intrigen und Wirrnissen der Inselverhältnisse fest. Doch dann greift ihr Freund Henning Leander, trotz ihres Verbotes, in die Ermittlungen ein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Breuer
Leander und die Stille der Koje
Inselkrimi
Zum Autor
Thomas Breuer, geboren 1962 in Hamm/Westf., hat in Münster Germanistik und Sozialwissenschaften studiert und arbeitet seit 1993 als Lehrer für Deutsch, Sozialwissenschaften und Zeitgeschichte an einem privaten Gymnasium im Kreis Paderborn. Seit 1994 lebt er mit seiner Frau Susanne, seinen Kindern Patrick und Sina, Streifenhörnchen Fridolin und Katze Lisa im ostwestfälischen Büren. Er liebt die Fotografie, die Nordseeinseln und den Darß. Seine zweite Heimat ist Föhr, wo er regelmäßig im Auftrag seiner Hauptfigur Henning Leander neue Kriminalfälle recherchiert, in denen dieser dann ermitteln darf.
Mit »Leander und der tiefe Frieden« legte er 2012 seinen Debüt-Roman im Leda-Verlag vor, 2013 folgte »Leander und die Stille der Koje«, 2014 »Leander und die alten Meister«, 2015 »Leander und der Lummensprung« sowie 2016 »Leander und der lange Schatten«. 2018 erschien der Kriminalroman »Der letzte Prozess«.Weitere Projekte sind in Arbeit und in Planung.
www.Breuer-Krimi.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
(Originalausgabe erschienen 2016 im Leda-Verlag)
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer
unter Verwendung eines Fotos von: © Gerhart G./pixabay.com
ISBN 978-3-8392-6458-4
Widmung
Für meine Eltern.
Zitat
Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.
Charles Darwin
*
Wir müssen nicht glauben, dass alle Wunder der Natur nur in anderen Ländern und Weltteilen seien. Sie sind überall. Aber diejenigen, die uns umgeben, achten wir nicht, weil wir sie von Kindheit an täglich sehen.
Johann Peter Hebel
1
Hein Frerich lachte wie jemand, der in seinem Leben noch nichts Lustigeres gesehen hatte, während Günter Wiese tobte und vor dem Gatter zu seiner Weide auf und ab rannte, immer mit Blick auf die Katastrophe, die sich da draußen anbahnte. Und je mehr Wiese tobte, desto ausgelassener lachte Frerich. Der Bauer mit seinem langen grauen Kittel, den er offen über der verdreckten blauen Latzhose und den mistverkrusteten schwarzen Gummistiefeln trug, stützte sich auf eine verbogene Mistgabel und fand daran gerade so viel Halt, dass er nicht vor lauter Lachen umkippte.
Das war aber auch zu komisch, wie Frerichs bester Zuchtbulle laut brüllend über Wieses nasse Weide stürmte, dicht gefolgt, ja geradezu angetrieben von Frerichs Hofhund. Bei der Bestie handelte es sich um einen wie tollwütig geifernden Mischling aus Rottweiler und Pitbull und sicher noch einem halben Dutzend räudiger Straßenköter. Die wilde Jagd ging mal nach links, mal nach rechts, aber in der Summe immer tiefer in die Fläche hinein, die direkt neben Wieses Naturerlebnisstation Andelhof lag und geradezu das Prunkstück seiner Renaturierungsbemühungen darstellte. Die Viecher hatten das erste, einigermaßen feste Wiesenstück längst hinter sich gelassen und galoppierten nun durch den renaturierten Teil, in dem Gras, Schilf und Binsen von Wasserflächen durchbrochen wurden. Normalerweise dümpelten, gründelten und nisteten hier friedliche Seevögel. Jetzt aber flatterten sie in der Luft durcheinander, aufgescheucht von Rind und Hund und panisch kreischend, weil die tollwütigen Bestien ihren Rast- und Brutplätzen inzwischen bedrohlich nahe kamen.
So wie sich die Wasserflächen leerten, füllte sich der Himmel darüber von Sekunde zu Sekunde mehr mit schreiendem und wild flatterndem Federvieh, das immer größere Kreise zog und schließlich die Flucht in Richtung Watt antrat. Denn Bulle und Hund stürmten nun auf den sumpfigen Teil der Fläche zu, unermüdlich brüllend und bellend, wobei beide Stimmen schon deutlich heiserer wurden. Und auch bei ihren Besitzern drohte die Lava langsam überzulaufen und der Vulkan zu explodieren.
»Pfeif deinen scheiß Köter zurück, Frerich!«, brüllte Günter Wiese mit hochrotem Kopf und deutete wild fuchtelnd auf die Kampftöle, die an der ganzen Aktion sichtlich ebenso viel Freude hatte wie ihr Besitzer.
»Ruf du ihn doch zurück, Wiese«, konterte Frerich so unlogisch wie lachend. »Du bist doch hier der große Naturfreund, der Möwenflüsterer. Auf dich hören die Tiere doch!«
Bevor Günter Wiese handgreiflich werden konnte, raste ein Streifenwagen der Inselpolizei mit Blaulicht und Martinshorn auf der Zufahrtstraße heran und trieb zu allem Überfluss mit seinem Lärm auch noch die Möwen und Limikolen von den Nachbarwiesen vor sich her. Als Günter Wiese das sah, lenkte er seinen Zorn auf die beiden Polizeibeamten, die nun ihren Wagen direkt neben den Streithähnen mit einer Vollbremsung zum Stehen brachten und sich im Aussteigen ihre Dienstmützen aufsetzten.
»Seid ihr bescheuert?«, brüllte Wiese die beiden an. »Was macht ihr denn hier für einen Lärm?«
»Nanana«, entgegnete Polizeimeister Dennis Groth mit drohend erhobenem Zeigefinger und ebensolchen Augenbrauen. »Keine Beamtenbeleidigung, ja? Sehen Sie sich vor!«
»Was ist denn hier schon wieder los, Hein?«, erkundigte sich Polizeiobermeister Jörn Vedder bei dem Landwirt, der zufrieden auf das Chaos blickte, das sein Hund und sein Bulle da draußen in der Fläche anrichteten. »Ist das dein Rindvieh da hinten?«
»Jo!«, antwortete Frerich mit Nachdruck nickend, während sich Hund und Bulle jetzt in derart sumpfiges Gelände begaben, dass sie augenblicklich bis zu den Knien einsanken und nur noch mühsam vorwärts stapfen konnten, ohne dabei jedoch in ihrem Lärm nachzulassen.
»Und wie kommt der dahin, dein Bulle?«
»Das war so, Jörn«, begann Frerich seinen Bericht. »Wie alle vernünftigen Landwirte, die ihren Hof noch mit ehrlicher Arbeit bewirtschaften und nicht alles absaufen lassen« – sein Blick streifte abschätzig Günter Wiese – »war ich heute Morgen schon früh im Stall und habe ausgemistet. Dabei ist mein Bulle, der Zorro, ausgebüxt. Ich habe natürlich gleich Killer hinterhergeschickt, damit er Zorro zurücktreibt. Aber der Wiese hat ja derart verkommene Weiden, dass die armen Tiere gar nicht mehr herausgefunden haben aus den hohen Binsen.«
»Eigentlich sollte dein Bulle sich in diesem Gelände inzwischen auskennen, so oft, wie wir ihn da schon rausholen mussten«, warf Jörn Vedder ein.
Aber Hein Frerich ließ sich nicht aus dem Konzept bringen: »Und dann der Matsch! Guckt euch doch an, wie die da festsitzen!«
Tatsächlich kamen die brüllenden Biester jetzt keinen Zentimeter mehr voran und befanden sich zu allem Überfluss unter einer Wolke kreischender Seevögel.
»Und was sagen Sie zu der Sache, Herr Wiese?«, wechselte Vedder den Gesprächspartner, während Polizeimeister Groth sich auf das Gatter lehnte und mit gerunzelter Stirn und kopfschüttelnd die ausweglose Situation da draußen in der Fläche begutachtete.
»Quatsch!«, donnerte Günter Wiese. »Bullshit! Das ist doch der totale Blödsinn. Der Frerich hat seinen Bullen gezielt auf meine Fläche getrieben, damit der die Vögel aufscheucht. Und den Köter hat er zu demselben Zweck hinterhergejagt. Das macht der doch ständig, weil er weiß, dass er mein Projekt damit zunichte macht.«
»Projekt …!«, kommentierte Frerich abschätzig.
»Ja, Hein«, ergriff Obermeister Vedder Partei gegen ihn, »das musst du zugeben, dass dein Bulle ziemlich oft ausbüchst. Und immer auf diese Weide!«
»Hat eben einen ausgeprägten Freiheitsdrang, der Zorro«, meinte Frerich achselzuckend.
»Gehabt!«, brüllte Günter Wiese. »Ich lasse mich nicht mehr länger verarschen!«
»Was soll das heißen?«, donnerte Frerich zurück und reckte seinem Kontrahenten die geballte Faust entgegen.
»Ganz einfach, Frerich: Beim letzten Mal hat dir das Ordnungsamt angedroht, deinen Bullen abschießen zu lassen, wenn er noch einmal auf meine geschützte Fläche eindringt und nachhaltigen Schaden anrichtet. Und genau das werden wir jetzt machen. Wachtmeister, schießen Sie das Vieh ab!«
Während sich die beiden Polizisten noch erschrocken anblickten, hob Hein Frerich wütend beide Fäuste gegen Günter Wiese und sah aus, als würde er sich jeden Moment auf ihn stürzen. »Du spinnst ja wohl, du Ökokasper! Meinen teuren Zuchtbullen abschießen?! Für deine vermilbten Möwen?!«
»Nun mal langsam«, schob sich Jörn Vedder vorsorglich zwischen die Kontrahenten. »Soll das heißen, es gibt eine amtliche Androhung, Hein?«
»Nun ja … nein … so kann man das nicht sagen …«
»Genauso ist das«, bestätigte Günter Wiese stattdessen. »Und die besagt, dass der Bulle jetzt abgeschossen wird. Und den Köter erledigen Sie gleich mit!«
»Momentchen, das lässt sich ja klären«, meinte Polizeimeister Dennis Groth und schlenderte zu seinem Dienstfahrzeug.
Hein Frerich ging nun dazu über, unruhig von einem Bein aufs andere zu wechseln, während er, Wiese und Jörn Vedder gespannt beobachteten, wie Groth zum Funkgerät griff. Der Beamte wechselte ein paar Worte mit der Gegenstelle, steckte dann achselzuckend das Mikrophon weg und kam wieder auf sie zu.
»Herr Wiese hat recht. Wenn der Bulle nicht ohne größeren Aufwand aus der Fläche zu entfernen ist – und das heißt: ohne Einsatz eines Treckers – dann muss er abgeschossen werden. Die renaturierte Fläche steht unter besonderem Schutz. Jede Störung der Ruhezone ist zu vermeiden.«
»Also, Hein«, wandte sich Jörn Vedder an den Landwirt, »du hast es gehört. Kannst du deinen Bullen da rausholen?«
»Wie denn?«, heulte Frerich jetzt auf. »Das ist doch der reinste Sumpf. Da reinzugehen, ist Selbstmord. Da komme ich ja selber nicht mehr raus, wenn ich das versuche.«
»Dann wirst du eben auch abgeschossen«, triumphierte Günter Wiese. »Was ist jetzt, ihr Freunde und Helfer, schießt ihr jetzt oder nicht?«
Polizeiobermeister Jörn Vedder nahm seine Dienstmütze ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn, der sich seit einigen Minuten unaufhaltsam bildete. »Meinen Sie nicht, Herr Wiese, Sie könnten vielleicht doch mit einem Trecker …?«, versuchte er ein letztes Mal, die Lage zu entspannen.
»Unmöglich«, lehnte Wiese ab.
Vedder zog resignierend die Schultern hoch, ging nun seinerseits zu seinem Dienstfahrzeug und griff nach dem Funkgerät, um kurz darauf wieder zurückzukommen.
»Ich habe die Jäger gerufen«, erklärte er. »Rickmers und Paulsen kommen persönlich. Sie sind schon auf dem Weg.«
»Ihr seid doch wohl total bekloppt«, schimpfte Hein Frerich. »Das könnt ihr doch nicht machen.« Verzweifelt schaute er die beiden Polizeibeamten an, die nur hilflos die Schultern hochzogen und wieder sinken ließen. In einem letzten verzweifelten Aufbegehren kletterte Frerich über das Gatter, lief mit wild fuchtelnden Armen auf seine beiden Tiere zu und rief: »Zorro! Killer! Kommt hierher!«
Aber die Tiere hätten selbst dann nicht auf ihn hören können, wenn sie es gewollt hätten, denn sie steckten inzwischen bis zu ihren Bäuchen im Matsch. Auch Frerich musste kurz darauf aufgeben und mühsam auf einem Bein stehend seinen rechten Stiefel, der in vollem Lauf glatt stecken geblieben war, aus dem Morast ziehen. Fluchend kehrte er zu den drei Männern zurück, die ihn lachend hinter dem Gatter empfingen.
Zerknirscht trollte er sich einige Meter zur Seite und beobachtete die beiden Polizisten und Günter Wiese, wie sie schweigend auf dem Gatter lehnten und auf die Ankunft der Jäger warteten. Nach einer knappen Viertelstunde näherte sich langsam ein Geländewagen und kam hinter dem Streifenwagen zum Stehen. Zwei Männer in jagdgrüner Kleidung stiegen aus, holten ihre Gewehre vom Rücksitz und legten sie sich aufgeklappt über ihre linken Unterarme, um so gerüstet auf die Wartenden zuzugehen. Es handelte sich um Nahmen Rickmers, den Ersten Vorsitzenden der Föhrer Jägerschaft, und seinen Stellvertreter Ole Paulsen. Die beiden nickten den Anwesenden zu und ließen sich von Polizeiobermeister Vedder ins Bild setzen, während sie den demonstrativ gelassenen Günter Wiese hasserfüllt beobachteten.
»Hein«, knurrte Nahmen Rickmers dann und winkte den Landwirt zu sich, um ungehört von den anderen etwas abseits mit ihm reden zu können. »Was soll der Scheiß? Du weißt doch, was du da riskierst.«
»Der Wiese glaubt, er kann sich alles rausnehmen«, erklärte Frerich kleinlaut. »Ich wollte ihm einen Denkzettel verpassen.«
»Tja, dumm gelaufen. Kannst du den Bullen da rausholen oder nicht?«
Frerich schüttelte resignierend den Kopf und erklärte: »Ohne Traktor nicht. Aber den darf ich ja nicht einsetzen.«
»Scheiße, Hein. Du weißt, wie mir das stinkt, aber da kann ich leider nichts machen.«
Rickmers ging zurück ans Gatter, lud sein Gewehr mit Patronen, die er aus der Jackentasche zog, und ließ es zuschnacken. Dann legte er langsam und ruhig auf den Bullen an.
»Nein!«, schrie Hein Frerich. »Das wagst du nicht! Du gehörst doch zu uns!«
Rickmers legte den rechten Zeigefinger auf den Abzug und zog ihn langsam durch. Der Knall war ohrenbetäubend und das Ergebnis durchschlagend. Der Bulle steckte zu tief im Matsch, um umzufallen, aber er ließ den Kopf sinken und war offensichtlich auf der Stelle tot. Killer aber schien durch den Schuss seine Lebensgeister zurückgewonnen zu haben. Er warf sich mit aller Kraft zurück, befreite sich mühsam aus dem Morast und schlich mit eingeklemmtem Schwanz auf das Gatter zu. Als er festen Boden gewonnen hatte, schüttelte er sich kräftig und zottelte dann mit gesenktem Kopf an seinem Herrchen vorbei und auf den eigenen Bauernhof auf der anderen Straßenseite zu. So sah ein Verlierer aus!
»Rickmers!«, sagte Hein Frerich leise, aber so, dass nicht nur der Adressat ihn gut verstehen konnte. »Das wirst du mir büßen!«
Dann trollte er sich ebenso wie Killer in Richtung seines Hofes.
»Ich schicke dir die Rechnung für die Bergung des Bullen«, rief Günter Wiese dem Landwirt noch nach, bevor der hinter seiner Scheune verschwunden war.
Nahmen Rickmers nickte den Polizeibeamten zu, Wiese ignorierte er, und ging zusammen mit Ole Paulsen zurück zu seinem Wagen.
»Verdammt, Nahmen«, schimpfte Paulsen. »Wenn du nicht bald dafür sorgst, dass dieser Wiese mit seinem Verein eins auf den Deckel kriegt, dann bist du die längste Zeit unser Vorsitzender gewesen. Glaubst du, die Kollegen sehen sich seelenruhig mit an, wie du ihre Tiere abknallst?«
Rickmers blieb stehen, blickte Paulsen mit gerunzelter Stirn an und antwortete schließlich: »Und du trittst dann meinen Posten an, was?«
Ole Paulsen zog bedauernd die Schultern hoch, machte dabei aber ein zufriedenes Gesicht.
»Sei unbesorgt, Ole«, erklärte Rickmers mit gefährlichem Unterton, »heute Abend mache ich Nägel mit Köpfen. Ich sorge dafür, dass auf der Insel wieder Ruhe einkehrt. Und danach pinkelt mir keiner von euch mehr ans Bein, das schwöre ich dir.«
Die Polizeibeamten und Günter Wiese sahen zu, wie die Jäger wieder abfuhren. Dann deutete Jörn Vedder auf den toten Bullen. »Wie kriegen Sie den jetzt da raus, Herr Wiese?«
»Ich arbeite mich mit Brettern vor und lege dem Tier ein Seil um«, antwortete Wiese.
»Und dann?«, hakte der Polizeibeamte nach.
»Mit dem Trecker, wie denn sonst? Jetzt sind die Vögel ohnehin einmal aufgescheucht«, erklärte Wiese, steckte seine Hände in die Hosentaschen und schlenderte grinsend auf den Andelhof zu.
2
Heinz Baginski, Hobbyfotograf und Hobbyornithologe aus Bottrop, strampelte gegen einen steifen Nordwest durch die Föhrer Marsch in Richtung Boldixumer Vogelkoje. Um den Hals und die linke Schulter hatte er seine digitale Spiegelreflexkamera geschlungen – sein ganzer Stolz, eine Canon EOS 7D, die er erst kürzlich zusammen mit ein paar sündhaft teuren Objektiven erstanden hatte. Ebenfalls um seinen Hals, aber zusätzlich um die rechte Schulter hatte er sich das mehrere Kilo schwere Manfrotto-Stativ gehängt. So diente es als Gegengewicht zu der Kamera, auf der bereits das gewichtige Teleobjektiv steckte.
Derart professionell ausgerüstet wollte er heute Enten fotografieren, aber nicht irgendwelche Enten, nein, Föhrer Krickenten sollten es sein, und die gab es in der Vogelkoje zu sehen. So hoffte er jedenfalls. Genau wusste er es auch nicht, aber er hatte gelesen, dass früher in diesen Entenfanganlagen Wildenten gefangen und in einer extra dafür auf der Insel aufgebauten Konservenfabrik in die Büchse verfrachtet worden waren. Bis nach Amerika sollte diese Spezialität exportiert worden sein. Sogar beim Captain’s-Dinner auf der Titanic, so heißt es, habe es Föhrer Krickente gegeben – die Folgen sind hinlänglich bekannt. Heute freilich wurden keine Föhrer Krickenten mehr erzeugt, sprich: gefangen, getötet, was bei Enten und Gänsen ringeln heißt, und eingedost. Die Fanganlagen, die sogenannten Vogelkojen – oder Entenkojen, wenn man es genau nahm –, gab es noch. Einige waren sogar noch in Betrieb, und die Boldixumer Vogelkoje war obendrein zu besichtigen, täglich von zehn bis zwölf Uhr.
Heinz Baginski war spät dran. Er war nicht zu seinem Vergnügen auf der Insel, jedenfalls nicht vordergründig, sondern in erster Linie seiner Gesundheit wegen. Als Angestellter der Bottroper Agentur für Arbeit war er chronisch überlastet. Zwar arbeitete er nur in der Abteilung für den sogenannten Winterbau, wo die eigentliche Stressphase eher in der kalten Jahreszeit lag, wenn viele Unternehmen Kurzarbeit anmeldeten oder ihre Mitarbeiter vorübergehend entließen, um sie dann im Frühjahr bei besserer Witterung und Auftragslage wieder einzustellen und in der Zwischenzeit den Lohn von der Allgemeinheit der Sozialabgabenzahler entrichten zu lassen. Aber auch das Sommerhalbjahr forderte Heinz Baginski bis an seine physischen und psychischen Grenzen. Dann gab es täglich nämlich nur für etwa zwei Stunden Arbeit, und für den Rest der Zeit mussten er und seine vier Kollegen überzeugend Beschäftigung vortäuschen, damit die Abteilung nicht personell verkleinert wurde. Das war echter Stress, zumal Heinz Baginski unablässig von der Angst geplagt wurde, etwas Unvorhergesehenes könnte in seinen Ruhealltag platzen und eben diese Ruhe für ein oder zwei zusätzliche Stunden gefährden.
So war er nach fast zwanzig Jahren Arbeitsagentur inzwischen regelrecht ausgebrannt, was zuletzt sogar zu Herzrhythmusstörungen geführt hatte. Sein Arzt hatte ihn dringend gewarnt, er müsse im Urlaub zur Ruhe kommen und jede Überanstrengung oder gar negative emotionale Belastung vermeiden, sonst bestehe unweigerlich die Gefahr eines ›Herzkaspers‹. Dabei hatte der Mann schallend gelacht, wofür Baginski wiederum jedes Verständnis gefehlt hatte. Aber immerhin hatte sein Arzt ihm Seeluft verordnet und bei der Gelegenheit gleich auch Rezepte für Fango, Massagen, Krankengymnastik und manuelle Therapie mitgeliefert.
Kur-Urlaub nannte man das, was Heinz Baginski hier machte. Morgens ließ er sich zuerst von Ronny Lange in der Mühlenstraße in der Schlickpackung weichkochen, dann kräftig durchkneten und anschließend auch noch craniosacral therapieren. Das war die Kur und dauerte in der Regel eine Stunde. Danach hatte Heinz Baginski für den Rest des Tages frei, also Urlaub. Der Behandlungstermin heute war erst um halb zehn gewesen, und deshalb musste er jetzt ordentlich in die Pedale treten, wenn er die Vogelkoje noch geöffnet vorfinden wollte.
Der Wind fand dank der Körperfülle des Bottropers reichlich Angriffsfläche und drückte die Geschwindigkeit, zu der Heinz Baginski in der Lage war, hart in den einstelligen Stundenkilometerbereich. Überall an der alten Klapperkiste, die er sich heute Morgen gemietet hatte, quietschte es, aber zum Glück dämpfte das Rauschen des Windes an Baginskis Ohren die nervigen Geräusche etwas. Die Fahrradkette rasselte, als hätte sie schon einige zehntausend Kilometer auf den Gliedern.
Jetzt bloß nicht abspringen!, dachte Heinz Baginski. Bloß nicht reißen jetzt!
Außerdem musste er seine ganze Kraft und Energie aufbringen, um mit der alten Mühle voranzukommen, denn die hatte nur drei Gänge, von denen die ersten beiden kaputt waren, also nicht reingingen. Und so strampelte Heinz Baginski mit reichlich Ballast behängt im dritten Gang gegen den Wind und schwor sich, den stoffeligen Fahrradverleiher umzubringen, oder wenigstens zu teeren und zu federn, wenn er heute Nachmittag wieder in Wyk war.
Doch Heinz Baginski wollte sich seine gute Laune nicht nehmen lassen, denn schließlich standen ihm spektakuläre Entenfotos bevor. Außerdem geisterte seit heute Morgen ein Schlager seiner Namensvetterin – oder sagte man Namenscousine? – in seinem Kopf herum, die zwar nicht Heinz hieß, sondern Gaby, aber immerhin Baginsky. Und das verband schließlich, wie Heinz fand, und verpflichtete zu besonderem Interesse und zur Wahrung des Kulturgutes, das sie überwiegend vor dreißig Jahren erfolgreich und vielfältig produziert hatte. Den Schönheitsfehler mit dem Y am Ende ihres Namens verzieh er ihr großmütig.
Je anstrengender es wurde – der Wind schien kontinuierlich zuzunehmen –, desto schwerer fiel es Heinz, sich auf den Schlager zu konzentrieren, und so begann er nun damit, ihn zunächst nur zu summen, schließlich aber laut gegen das Rauschen an seinen Ohren vor sich hin zu schmettern: »Fahr zur Hölle, komm nie wieder zurück!« Dabei bemühte er sich um eine möglichst originalgetreue Quietschstimme, denn Heinz war nicht nur kulturbeflissen, er hielt auch auf Authentizität: Wenn er schon einen Schlager von seiner Lieblingssängerin Gaby Baginsky schmetterte, dann wollte er auch klingen wie Gaby Baginsky. Dummerweise waren der Wind und die Fahrradkette so laut, dass er sein eigenes Wort kaum verstehen konnte, obwohl er aus voller Kehle sang. Seine Stimme war nämlich nicht gerade tragend, was er selber für einen Fluch, seine Freunde und Verwandten aber für einen Segen hielten.
Derart seiner knappen Atemluft beraubt, näherte sich Heinz Baginski mit hochrotem, fast bläulichem Kopf der Boldixumer Vogelkoje. Es war zwanzig Minuten nach elf, also immer noch Zeit genug, um sich einen Überblick zu verschaffen, sein Stativ aufzubauen und ein paar original Föhrer Krickenten im Großformat abzulichten.
Er sprang vom Fahrrad, allerdings nicht, ohne sich mit dem Stativgurt am Sattel zu verheddern und vom Gewicht des alten Rostesels zu Boden geworfen zu werden. Derartige Seitenhiebe aus der Mitte des Lebens war Heinz Baginski gewohnt, und sie waren nicht dazu angetan, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen – zumindest nicht seelisch. Er rappelte sich wieder hoch, überlegte kurz, ob er die Zeit investieren sollte, um mit dem verrotteten Fahrradschloss zu kämpfen, verwarf dies aber nach einem erneuten Blick auf die Uhr und machte sich auf den Weg über die Klappbrücke ins Innere der Vogelkoje.
Zunächst musste er durch einen Tunnel aus Büschen und Bäumen, der direkt auf das Kojenwärterhaus zu führte. Dort stand ein älterer Mann mit einer Bauchtasche und harrte der Dinge, die da kamen. Nun kam Heinz.
»Einmal?«, fragte der Mann, und Heinz Baginski nickte, denn zu einer Antwort reichte sein Atem noch nicht aus.
»Das Geld kommt in den Topf da vorne«, fuhr der Kojenwärter fort und deutete auf eine Edelstahlschale, die an einem Pfosten angebracht war.
»Wie viel?«, keuchte Heinz.
»So viel Sie wollen. Was es Ihnen wert ist. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Nur Scheine sind schlecht, die schwimmen beim nächsten Regen weg …«, und als Heinz Baginski keine Anstalten machte, nachzufragen: »Wir warten nämlich immer, bis es geregnet hat, bevor wir die Schale leeren. Geldwäsche, Sie verstehen?«
Diesen Spruch musste wohl jeder Besucher über sich ergehen lassen, genauso wie das nun folgende schallende Lachen.
»Dann passen Sie mal gut auf, dass angesichts der aktuellen Finanzkrise heute Nacht kein Grieche in Ihrer Schale taucht«, kam es von hinten, was wiederum schallendes Gelächter auslöste.
Heinz drehte sich um und blickte in das Strahlen eines Familienvaters, dem seine Frau und drei Kinder wie eine Entenfamilie folgten. Derart angetrieben, warf Heinz Baginski schnell zwei Euro in die Schale und setzte seinen Weg fort.
»Moment«, rief der Kojenwärter hinter ihm her. »Nehmen Sie die Beschreibung mit, sonst wissen Sie doch gar nicht, wo Sie hin müssen, und am Ende verlaufen Sie sich noch.«
Er reichte Heinz ein in Klarsichtfolie verpacktes Blatt Papier, das auf der einen Seite die Geschichte des Entenfangs wiedergab, auf der anderen Seite eine Grafik mit der gesamten Boldixumer Vogelkoje und dem rot eingezeichneten Weg. In der Mitte der Anlage befand sich der quadratische Kojenteich, da wollte Heinz hin. Zuerst musste er links an einer sogenannten Pfeife vorbeigehen. Das war ein drahtummantelter geschwungener Wasserarm, der vom Hauptteich abzweigte und an dessen Ende ein Käfig angebracht war. Hier hinein sollten die von zahmen Artgenossen angelockten Wildenten schwimmen, um dann geringelt zu werden. Abgeschirmt wurde die Pfeife vom Weg durch schräggestellte Strohwände, hinter denen sich der Entenjäger verstecken konnte, bis die Wildenten weit genug geschwommen waren und durch sein plötzliches Auftauchen in den Käfig gescheucht wurden. All das entnahm Heinz Baginski der Beschreibung auf dem Zettel.
Am Ende der Pfeife, respektive an ihrem Anfang, befand sich also der Teich, den Heinz erreichen wollte. Dazu musste er ein paar Holzstufen erklimmen, um sich nun an einem Aussichtsplatz vom Niveau her leicht über dem Wasserniveau wiederzufinden. Links stand eine Bank, und dorthin verfrachtete er seine Kamera, froh, das Gewicht endlich nicht mehr am Hals zu haben. Nach so einem Ausflug war die ganze Massage vom Morgen gleich wieder beim Teufel; der leicht stechende Kopfschmerz, der seinen Ursprung im Nacken hatte, bestätigte das.
Aber für wehleidige Selbstbeobachtung war jetzt keine Zeit. Heinz Baginski klappte das Stativ auf, fuhr die Beine aus und zog die Mittelsäule hoch. Dann stellte er es an das Geländer vor dem Teich, nahm seine Kamera, schraubte die Stativklemme darunter und setzte sie auf das Manfrotto. Jetzt den Objektivdeckel ab, die Kamera einschalten und los geht’s. Dachte Heinz. Aber ganz so einfach war das nicht, denn zunächst einmal mussten Enten da sein, und die waren eben nicht da.
Hinter sich, am Fuße der Treppe und damit noch im Bereich der Pfeife, tönten laut die Stimmen der Familienmitglieder, die hinter Heinz in die Koje gekommen waren.
»Da sind Enten!«, schrie eines der Kinder und rannte offenbar mit seinen Geschwistern hinter ein paar Tieren her, die sich in der Pfeife versteckt zu haben schienen und jetzt von den kreischenden Stimmen aufgescheucht wurden. Denn nun hob ein vielstimmiges Geschnatter an, und mit heftigen Flügelschlägen liefen ein paar Enten regelrecht aus der Pfeife über das Wasser auf den offenen Teich.
Gute Kinder, dachte Heinz und legte mit dem Objektiv auf das Federvieh an, revidierte sein Urteil aber sofort wieder, als die schreienden Bälger, gefolgt von den ebenfalls begeisterten Eltern, die Treppe hinaufstürmten und sich an das Geländer warfen, um direkt vor Heinz’ Linse herumzuspringen. Die Enten quittierten das erneut mit heftigem Geschnatter, Flügelschlagen und übereilter Flucht in eine gegenüberliegende Pfeife, die den Blicken der Besucher verborgen und auch nicht öffentlich zugänglich war.
»Oh, schade!«, rief die Mutter der ungezogenen Blagen. »Jetzt sind sie weg.«
»Komisch«, knurrte Heinz leise. »Wie das wohl kommt.«
Nun hieß es warten – darauf, dass die Kinder verschwanden, und darauf, dass die Enten zurückkehrten. Heinz Baginski ließ sich seufzend auf der Bank nieder. Er übte sich in Geduld und in der Bauchatmung, die Ronny Lange ihm beigebracht hatte, um sich im Extremfall selber wieder zur Ruhe bringen und Herzanfälle vermeiden zu können. Die Familie trat den Rückzug an, enttäuscht, dass es auf dem Teich nichts mehr zu sehen gab, und die Enten blieben da, wo sie sicher waren. Heinz Baginski wartete …
Als er schon kurz davor war aufzugeben, tauchten die Tiere wieder auf. Einträchtig schwammen sie ins offene Wasser hinaus und versenkten ihre Köpfe abwechselnd, um auf dem Boden des Teiches nach Algen zu gründeln. Heinz erkannte überwiegend Stockenten, nichts Besonderes also, denn die gab es auch in Bottrop in rauen Mengen. Aber ein Vogel war anders: pechschwarz mit weißer Brust. Eine Krickente, da war Heinz sich sicher. Sorgfältig richtete er seine Kamera aus, visierte das begehrte Objekt an und wollte gerade auslösen, als ihm jemand auf die Schulter klopfte.
»Feierabend, junger Mann«, sagte der Kojenwärter. »Zwölf Uhr. Ich mache jetzt dicht.«
Es war zum Verzweifeln.
»Kann ich nicht noch eben …«, begann Heinz, aber der Kojenwärter winkte bestimmt ab und begleitete dies mit einem heftigen Kopfschütteln.
»Neenee, da müssen Sie morgen wiederkommen. Ich habe hier jetzt noch eine Menge zu tun.«
Was es angesichts der Handvoll Enten hier zu tun gab und inwiefern ein Besucher dabei störte, erschloss sich Heinz Baginski zwar nicht, aber da war wohl jeder Widerstand zwecklos, zumal das Federvieh dank der lauten Stimme des Kojenwärters bereits wieder in einer der Pfeifen verschwunden war. Also baute der Erfolglose seine Ausrüstung ab und hängte sich seine Geräte nach bewährter Art um den Hals.
»Gucken Sie doch mal am Vorland«, riet der Wärter noch, als Heinz durch den Buschtunnel zurück zu seinem Fahrrad trottete. »Da sind auch immer viele Möwen.«
Möwen, dachte Heinz, ich will keine Möwen, ich will Enten, und die kriege ich auch – und zwar heute, verlass dich drauf, du Kojen-Schimanski!
Er war selbst erstaunt, denn ihm hatte sich eine Idee eingeschlichen, ein Plan gar, und der sah so aus: Heinz Baginski würde nicht zurück nach Wyk radeln. Er würde, wie ihm der Kojenwärter geraten hatte, am Deich entlang zum Midlumer Vorland fahren und dort abwarten. Später, wenn der Kojenwärter sicher verschwunden war, würde er dann zur Vogelkoje zurückkehren und die Enten fotografieren. Das würde ihm morgen einen ganzen Vormittag sparen und dazu den erneuten Eintritt.
Henning Leander saß in der Küche seines kleinen Fischerhäuschens in der Wilhelmstraße mit einer Kaffeetasse in der Hand am Küchentisch und schaute in den Garten hinaus. Das heißt, eigentlich schaute er in die Wildnis hinaus, die sein Großvater dereinst als Garten angelegt hatte. Leander wohnte nun ein gutes halbes Jahr in diesem Häuschen, das seit dem Tod des alten Heinrich ihm gehörte, und in der ersten Zeit war der Winter sein Freund gewesen, wenn es darum ging, einen Grund zur Vermeidung der Gartenarbeit zu finden. Aber dieser Winter war, so unerbittlich und unwirtlich er sich diesmal auch in die Länge gezogen hatte, seit einiger Zeit vorbei. Der Frühling hatte für ein üppiges Pflanzenwachstum gesorgt. Dabei hatte Leander sich gezielt an den Blüten der Obstbäume erfreut, wenn er morgens durch das Küchenfenster geschaut hatte, und die Wiese, die Woche für Woche höher wurde, einfach ignoriert. Doch das ging nun nicht mehr: Der Sommer war gekommen, die Bäume hatten ihre Blüten gegen Fruchtknoten getauscht, die langsam zu ganzen Früchten heranwuchsen, und nichts mehr lenkte das an Ästhetik gewöhnte Auge von der Wildnis ab, die den Garten zu verschlingen drohte. Sogar die Holzhütte im hinteren Teil, zu der Leander im Schnee noch mühelos vorgedrungen war, wenn er Brennholznachschub geholt hatte, entschwand allmählich ganz dem Blick des Betrachters. So ging das nicht weiter.
Leander seufzte, schenkte sich aber zunächst noch einmal Kaffee nach, bevor er sich zu der unvermeidlichen Erkenntnis durchrang, dass die Ruhe nun ein Ende haben musste. Die Bürden des Haus- und Gartenbesitzers harrten seiner, und sie taten dies mit einer Unerbittlichkeit, derer er sich nicht länger erwehren konnte. Kurz und gut: An diesem Sommermorgen fasste der frühere Hauptkommissar des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, der einst für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität zuständig gewesen war, den Entschluss, ab sofort die Rekonvaleszenz seines Burn-out-Syndroms zu beenden und in eigener Sache therapeutisch-produktiv tätig zu werden. Er würde jetzt und hier der auf natürliche Weise organisierten Wildnis des Gartens und der Wirrnis seiner Psyche den Kampf ansagen; er würde mit Sichel und Sense zu Werke gehen – für die Astschere war es zum Glück zu spät im Jahr. Und er wollte auch den Umgang mit dem Spaten nicht scheuen, wenn es denn unbedingt nötig würde.
Er trank den letzten Schluck Kaffee. Das Ausspülen der Tasse bot noch eine kurze Galgenfrist, und auch die Suche nach seinen alten Klamotten in den Untiefen des Kleiderschrankes hatten etwas derart Herauszögerndes, dass sich bereits das schlechte Gewissen zu rühren begann. Doch einige Minuten später stand Henning Leander in Jeans, T-Shirt und Turnschuhen in seiner Wildnis, die zum Glück noch einigermaßen im Schatten lag.
Er genoss in der Wärme des Sommermorgens einen Moment lang das Vogelgezwitscher in den Obstbäumen, bevor er sich endgültig einen Ruck gab. Zunächst einmal musste er sich einen Weg durch das hohe Gras zum Schuppen bahnen, ohne die Halme über Gebühr plattzutreten, denn schließlich wollte er sie ja mit der Sense abschneiden, und das ging nur in aufgerichtetem Zustand. Im Kampf mit dem rostigen Schloss der Holztür blieb er Sieger, und auch in der Finsternis des Schuppens, der für einen großgewachsenen Mann wie Leander reichlich niedrig war, wurde er nach einigem Suchen fündig. Natürlich hing die Sense in der hintersten Ecke an der Wand, und einsatzbereit sah sie eigentlich auch nicht aus. Das Blatt war rostig, die Schnittkante schartig, und so suchte Leander nach dem Amboss und dem Dengelhämmerchen, die er dank der Ordnung seines Großvaters auf einem Arbeitstisch rechts neben der Tür fand. Die Drahtbürste entfernte den gröbsten Rost, der Hammer glättete die Schneide einigermaßen. Mit dem Schleifstein zog Leander sie nach und hoffte, dass er das gute Stück am Ende nicht ganz zuschanden gemacht hatte. Schließlich sah sie wieder genauso schartig aus wie vorher, nur schärfer und ein wenig blanker schien sie zu sein.
Ein erster Test direkt vor der Tür war denn auch so erfolgreich, dass sich Leander mit neuem Schwung und frischer Hoffnung ans Werk machte. Zunächst schnitt er einen Weg vom Schuppen zum Haus frei und nutzte diesen dann als Basislinie für die Expedition in den Dschungel zwischen den Obstbäumen. Leander hatte noch nie mit einer Sense gearbeitet, sein ganzes Wissen stammte aus Heimatfilmen im Fernsehen und einem einigermaßen ausgeprägten Verständnis für Physik und Technik. Und dennoch wirkte der Schwung, den er nach und nach ausfeilte, auf ihn fast schon fachmännisch. Das hohe Gras wich einer holperig geschnittenen Wiese, die gelegentlich eher gerupft aussah, aber immerhin war das Gras nach seinem Einsatz deutlich kürzer als vorher.
»Das wurde aber auch Zeit!«, hörte er die schneidend eisige Stimme seiner Nachbarin Johanna Husen, die augenblicklich die Vögel zum Schweigen brachte und die Wärme aus dem Garten vertrieb.
Als er sich umdrehte, erblickte er ihren dürren Hals und ihr Warangesicht direkt über der Ligusterhecke zum Nachbargarten. Johanna Husen war seinem Großvater in treuer und unerbittlicher Nachbarschaft verbunden gewesen und hatte ihm den Haushalt geführt, was allein deshalb viele Jahre gut gegangen war, weil sie den alten Hinnerk vergöttert und er dies zu nutzen gewusst hatte. Nach seinem Tod hatte sie dann keine Mühen gescheut, Leander unmissverständlich klarzumachen, wie er sich in seinem neuen Heim zu verhalten habe, wenn er sich des Andenkens an seinen Großvater würdig erweisen wollte. Dies drohte aber zu scheitern, denn Leander war weder ein alter Mann noch ein kleiner Junge, der sich dies gefallen lassen musste.
»Guten Morgen, Frau Husen«, antwortete Leander und konnte einen gereizten Unterton nicht unterdrücken.
»Ich will ja nichts sagen«, strafte sich Frau Husen selbst Lügen, »aber Ihr Herr Großvater ist jetzt gerade einmal ein halbes Jahr tot, und eigentlich geht es mich ja auch gar nichts an …«
»Richtig«, warf Leander dazwischen, ohne jedoch für Frau Husen eindeutig auf die erste oder die zweite Aussage abzuzielen.
»… und im Grunde ist es ja jetzt auch Ihr Garten …«
»Im Grunde?«, startete Leander einen erneuten Versuch, das Schlimmste abzuwenden.
»… aber das hat Ihr Großvater nicht verdient«, ließ sich Frau Husen nicht beirren, »dass Sie seinen Garten derart verwildern lassen!«
»Ich verstehe Ihren Unmut, Frau Husen«, gab sich Leander kleinlaut. »Und wie Sie sehen, bin ich dabei, Abhilfe zu schaffen.«
»Das wurde aber auch Zeit!«, wiederholte die alte Dame. »Seit einem halben Jahr stehlen Sie dem lieben Gott den Tag, anstatt dafür zu sorgen, dass Ihr Großvater ein ehrendes Angedenken erhält.«
»Jetzt reicht es aber, Frau Husen«, begehrte Leander nun auf, der wieder einmal erkannte, dass er dem alten Drachen viel zu viel Raum für seinen Angriff gelassen hatte. »Wie Sie richtig bemerkt haben, ist mein Großvater tot. Und dies hier ist nun mein Garten. Entsprechend pflege ich ihn so, wie ich es für richtig halte. Und was das Andenken an meinen Großvater betrifft, steht Ihnen überhaupt kein Urteil zu.«
Einen Moment lang schien Johanna Husen sprachlos angesichts der Respektlosigkeit dieses jungen Hüpfers ihrem Alter gegenüber. Aber Johanna Husen wäre nicht Johanna Husen gewesen, hätte sie sich lange aus dem Konzept bringen lassen.
»Das ist ja wohl die Höhe«, rief sie und brachte tatsächlich noch einmal einige zusätzliche Zentimeter an Halslänge zustande. »Eigentum verpflichtet! Haben Sie davon schon einmal etwas gehört? Ihr Unkraut streut seine Samen bis in meinen Garten. Niemals habe ich so viel Löwenzahn in meinem Rasen gehabt wie in diesem Jahr. Was glauben Sie wohl, woher das kommt? Soll ich in meinem Alter noch jeden Tag auf den Knien durch den Garten rutschen und den Löwenzahn ausstechen, der immer wieder von Ihnen herüberweht?«
»Vielleicht solltest du einfach mal etwas Farbe in deinem Leben zulassen, du graues Gespenst«, murmelte Leander, hütete sich aber, es so laut zu sagen, dass Frau Husen es mitbekam.
»Was haben Sie gesagt?« Offenbar hatte sie seine Lippenbewegungen gesehen.
»Ich habe gesagt, dass der Löwenzahn in Ihrem Garten nicht in diesem Jahr gesät worden sein kann. Aber ich werde ab sofort dem lieben Gott nicht nur den Tag, sondern auch die Farben seiner Blumen stehlen, indem ich dem Löwenzahn zu Leibe rücke. Damit das auch von Erfolg gekrönt wird, bitte ich Sie nun, mich weiterarbeiten zu lassen. Einen schönen Tag noch, Frau Husen.«
Einen Moment lang sah es so aus, als wollte die Frau sich nicht geschlagen geben, aber dann sah sie offenbar ein, dass sie für den Moment das Äußerste erreicht hatte, und zog ihren Kopf langsam wieder ein, was ihrem Hals das Aussehen einer Ziehharmonika gab.
Kaum war Frau Husens Antlitz hinter der Hecke verschwunden, atmete Leander erleichtert auf und machte sich wieder mit der Sense an die Arbeit. Trotz seiner inneren Bewegung beschloss er, sich den Tag nicht von so einer alten Schreckschraube vermiesen zu lassen. Dafür war die Sonne heute viel zu herrlich, die Wärme kehrte in den Garten zurück, und auch das Vogelgezwitscher hob allmählich wieder an.
Die Mäharbeit ging Leander erstaunlich flott von der Hand. Bald waren sogar die Baumstämme wieder zu sehen und einige stachelige Himbeersträucher an den Grundstücksseiten wurden sichtbar. Lena würde sich freuen, denn sie war ein Fan selbstgemachter Marmeladen.
Mein Gott, Lena!, seufzte Leander in Gedanken. Wie lange hatte er seine Freundin schon nicht mehr gesehen! Sie hatten gemeinsam die Umstände des Todes seines Großvaters aufgeklärt. Dann war Lena nach Kiel aufgebrochen und hatte ihren Dienst beim LKA wieder aufgenommen, der noch umfangreicher geworden war, weil der Abteilungsleiter Henning Leander von Bord gegangen war. Nun hatte sie Aussicht auf seine Position, aber dafür kannte sie auch keinen Feierabend und keinen Urlaub mehr, und Leander verstand seine frühere Frau mit einem Mal viel besser. Inka hatte sich nicht zuletzt von ihm getrennt, weil er sie schlicht allein gelassen und nur noch für seinen Beruf gelebt hatte.
Die Sonne stand inzwischen im Zenit und Leander inmitten der eigenen Schweißströme – Zeit, eine Pause einzulegen und die gute Sitte der Siesta auch im Norden Europas einzuführen. Leander brachte die Sense zurück in den Schuppen und kramte stattdessen ein paar klapperige Gartenstühle und einen Holztisch hervor, die er mitten auf dem Rasen unter einem Apfelbaum platzierte. Dann holte er sich eine Flasche Wasser aus dem Haus und ließ sich in seinem kleinen Paradies nieder. Unter den Bäumen konnte man es aushalten, und auch der Blick in den Garten um sich herum gestaltete sich nun viel erfreulicher als noch am Morgen. Wenn erst einmal das abgeschnittene Gras zu Heu getrocknet und zusammengeharkt war, konnte Leander den Rasen mit dem alten Handmäher kurz halten, den er im Schuppen entdeckt hatte. Er beschloss, von nun an so viel Zeit wie möglich in der windgeschützten Ruhe seines Gartens zu verbringen. Leander lehnte sich zurück, dachte noch, dass er sich vielleicht um einige bequemere Stühle und Liegen kümmern sollte, und war schon eingeschlafen, bevor er deren Kauf planen konnte.
Heinz Baginski strampelte mit seiner Rostlaube bei heftigem Seitenwind schlingernd den Deich entlang, stieg vor jedem Gatter ab, um sein Rad durch die federbewehrten selbstschließenden Holztore zu schieben – wobei er einmal fast erschlagen worden wäre –, und erreichte nach einiger Zeit das Vorland. Lahnungen erstreckten sich rechter Hand in den Schlick des Wattbodens, um ebendiesen bei jeder Flut aufzustauen, bis neues Land gewonnen war. Hier würde sich zunächst der Queller ansiedeln, um erneut Sand abzufangen, und dann der Strandhafer und der Strandflieder, der die Salzwiesen lila einfärbte. Von Seevögeln war jedoch weit und breit nichts zu sehen – die waren weit draußen im Watt, denn es war Niedrigwasser, und damit war dort die Tafel für sie reich gedeckt.
Heinz Baginski fuhr weiter bis zum Infowagen der Schutzstation Wattenmeer und informierte sich dort an Bildertafeln über die verschiedenen Limikolen, die hier heimisch waren – das war der Fachbegriff für alle Watvögel, die so hießen, weil sie durch den Schlick des Watts wateten und Würmer und sonstiges Getier darin suchten. Hin und wieder flogen Austernfischer in Kleingruppen laut pfeifend über den Deich, so dass Heinz Baginski wenigstens ein paar Fotos schießen konnte und nicht vergeblich hierher geradelt war. Dergestalt vertrieb er sich die Zeit bis gegen sechzehn Uhr und ignorierte den aufsteigenden Hunger und vor allem den Durst, denn er hatte nichts zu trinken dabei. Schließlich hatte er ja nicht ahnen können, dass aus einem vormittäglichen Kojenbesuch ein Ganztagesausflug würde. Dann machte er sich auf den Rückweg, in der Hoffnung, die Fanganlage nun verlassen vorzufinden.
Zunächst hatte er jedoch wieder gegen den Wind zu kämpfen, denn der hatte sich gedreht. Das war Heinz Baginski gewohnt: An der See kam der Wind merkwürdigerweise immer von vorn, egal, in welche Richtung man radelte.
Gegen siebzehn Uhr dreißig war er wieder an der Boldixumer Vogelkoje, die jetzt friedlich und verlassen hinter dem Deich in der Marsch lag. Heinz schob sein Fahrrad auf die Weide an der Seite der Koje – es musste schließlich niemand, der vorbeiradelte, sehen, dass dort jemand widerrechtlich eingedrungen war. Dann huschte er über die Straße zurück zum Eingang, um dort entsetzt festzustellen, dass die Klappbrücke ihrer Funktion gemäß hochgeklappt war. Als wäre das noch nicht genug, ragte auf der anderen Seite des Grabens, der die Vogelkoje umgab, ein seitlich mit Stacheldraht bewehrtes Tor fest verschlossen vor ihm auf.
»Mist«, fluchte Heinz, denn daran hatte er nicht gedacht.
Was sollte er nun tun? Unverrichteter Dinge nach Wyk zurückradeln? Morgen wiederkommen und noch einmal Eintritt zahlen, nur um erneut von nervigen Blagen am Fotografieren gehindert zu werden? Nichts da! Er würde einen Zugang finden, und dann hätte er Stunden Zeit, um die Föhrer Krickente dahin zu bekommen, wo sie hingehörte: auf den CCD-Chip seiner Spiegelreflex.
Also ging Heinz Baginski zurück und umrundete die Vogelkoje bis zu ihrer Rückseite. Wenn bloß niemand auf dem Deich vorbeikam und ihn entdeckte! Aber da war weit und breit kein Mensch zu sehen. Und jetzt tat sich vor ihm die große Chance auf: Hinter dem Stacheldraht öffnete sich eine Schneise im Gebüsch, die aussah, als würde sie dem ansässigen Wild regelmäßig als Zugang dienen. Heinz pfiff in verwegener Vorfreude Gabys Hit »Es kann mit vierzig wie mit zwanzig sein« leise vor sich hin, schob sein Stativ auf den Rücken, damit es ihn nicht störte, und setzte zum Sprung über den Graben an. Er kam auch an der gegenüberliegenden Seite sauber auf. Sein Oberkörper wurde aber vom Gewicht seiner Ausrüstung so weit zurückgezogen, dass er abglitt und langsam rückwärts mit seinen Schuhen in den Graben rutschte. Kalter, nasser Schlick quoll an seinen Knöcheln durch die Strümpfe, schwappte an seinen Waden hinauf bis zum Hintern und erzeugte ein Gefühl, als sei Heinz Opfer einer unangekündigten Durchfallattacke geworden.
›Es kann mit vierzig wie mit achtzig sein‹, wäre jetzt passender gewesen, aber den Frevel verkniff sich Heinz zugunsten eines saftigen Fluches, um dann mühsam und auf allen vieren den glitschigen Hang hinauf zurück zum Zaun zu klettern. Nun befand er sich auf der richtigen Seite des Grabens und brauchte nur noch dem Trampelpfad durch das ansonsten dichte Gebüsch zu folgen. Kurz darauf gelangte er seitlich an das Wärterhäuschen, das einsam und offensichtlich verschlossen dalag. Von hier aus folgte er dem offiziellen Weg an der Pfeife vorbei zum Teich, erklomm die Stufen und fand sich auf dem Aussichtsplateau wieder. Und da waren sie: Die Enten schwammen im Pulk über die schwarzgrüne Wasserfläche. Nur die schwarze Ente war nicht dabei. Alles bloß Stockenten. Das durfte doch nicht wahr sein! Da hatte Heinz Baginski den ganzen Tag vertrödelt, seine Schuhe und seine Hose ruiniert, seine teure Ausrüstung dabei aufs Spiel gesetzt, und nun das! Wahrscheinlich war die einzige Wildente aus der Vogelkoje inzwischen schon wieder zu ihren Artgenossen irgendwo da draußen im Watt oder in der Marsch aufgebrochen. Oder der Kojenschimanski hatte sie geringelt und zum Abendessen mit nach Hause genommen.
Aber da hörte Heinz Baginski aus dem Gestrüpp an der Seite des Teiches ein Pfeifen, das nicht von einer Stockente kommen konnte. Das musste eine Krickente sein, und wenn er ganz großes Glück hatte, war es vielleicht sogar eine Pfeif- oder eine Knäkente. Er schlang Kamera und Stativ von den Schultern und baute alles wieder so auf, wie er es am Vormittag bereits vergeblich getan hatte. Dann brachte er sein Jagdgerät in eine günstige Schussposition und legte sich auf der Bank im Sichtschutz des Geländers auf die Lauer.
Die Stockenten glitten langsam über den Teich, keine Welle bewegte das schwarzgrüne Tümpelwasser, die Sonne senkte sich langsam hinter die hohen Baumkronen, im Schatten der Bäume war es windstill und warm. Er spürte die Schwere seiner abgestrampelten Glieder und den Krampf, der sich gerade in seiner rechten Wade bildete, erinnerte sich an die progressive Entspannungstechnik nach Jacobsen, schloss die Augen, atmete tief in seinen Bauch ein, spannte zuerst seine Füße an, entspannte sie dann wieder, ging zu den Waden über, fühlte sich in seine Muskulatur hinein, die Insekten summten eintönig um ihn herum, der Krampf verschwand, die Lider wurden ihm schwer … und Heinz Baginski schlummerte ein.
Ein Schrei riss ihn aus dem Traum, in dem er in den Weiten der Salzwiesen Dutzende von Pfeif-, Knäk- und Krickenten fotografiert hatte, und Heinz brauchte einen Augenblick, bis er wusste, wo er sich befand. Vor ihm lag der Teich im Dunkel der heraufziehenden Nacht. Im Mondlicht hatten die Enten ihre Köpfe unter das Gefieder gesteckt, und Heinz erkannte, dass er seine Chance erneut verpasst hatte. Jetzt musste er unverrichteter Dinge seine Ausrüstung wieder abbauen und durch den nächtlichen Forst der Vogelkoje zurück zum Zaun und zu seinem Fahrrad finden, möglichst ohne erneut in den Graben zu rutschen. Als er sich mit schmerzenden Gliedern von der harten Bank erhob, merkte er, dass der Schlick in seinen Socken inzwischen hart geworden war und die Gelenke an einer glatten und runden Bewegung hinderte. Er zog die Schuhe und die Socken aus und klopfte zunächst die harte Kruste aus der Baumwolle, bevor er die widerspenstigen Dinger wieder anzog.
Da ertönte zum zweiten Mal ein gellender Schrei, der Heinz daran erinnerte, warum er überhaupt aufgewacht war, und ihm einen Schauer über den Rücken jagte, so dass er trotz der lauen Sommernacht unvermittelt fröstelte. Das war aus der Richtung des Kojenwärterhäuschens gekommen. Er brauchte noch einige Augenblicke, um Mut zu fassen, dann stand er leise auf und stolperte durch die Dunkelheit die Treppe hinab und an der Pfeife vorbei bis zum Haus. Vorsichtig glitt er an der Seite entlang nach vorne, versuchte durch das Fenster, das so verschmutzt war, dass es gerade noch einen matten Lichtschimmer von innen durchließ, vergeblich einen Blick in die Hütte zu erhaschen, und erreichte die Tür in dem Moment, in dem sie von innen aufgestoßen und ihm mit voller Wucht vor den Kopf geknallt wurde. Heinz Baginski strauchelte und wurde von einer schwarzen Gestalt, die aus dem Haus stürzte, zu Boden gerissen. Es dauerte einige Schrecksekunden, bis er sich wieder gesammelt hatte. Er versuchte sich mühsam aufzurappeln, und da – im Bruchteil einer Sekunde – glaubte er gar, aus den Augenwinkeln noch einen zweiten Schatten wahrzunehmen, der dem ersten folgte. Aber das konnte auch die Folge des Kopfstoßes sein, der ihn quasi ein Echo sehen ließ. Ehe er wieder einen klaren Gedanken fassen und sich aus dem Gestrüpp erheben konnte, waren die Gestalten in der Dunkelheit des Hohlwegs verschwunden, der zur Klappbrücke am Haupteingang führte.
Heinz Baginski rappelte sich mit schmerzendem Schädel auf, bemerkte nun, da er sich im Gebüsch einen Dorn in den rechten Fuß jagte, dass er noch immer keine Schuhe trug, und humpelte auf einem Bein zur Tür des Kojenwärterhäuschens. Ein kalter, weißer Lichtstreifen fiel auf den Weg davor. Vorsichtig näherte er sich der Türöffnung, immer darauf gefasst, dass noch weitere Gestalten herausstürzen und ihn umrempeln könnten. Aber da kam niemand mehr.
Als Heinz Baginski nun durch die offene Tür in das beleuchtete Kojenwärterhäuschen spähte, bot sich ihm ein Bild, das genau die Gefühle in ihm auslöste, vor denen sein Arzt ihn so dringend gewarnt hatte. Und so kam es, dass an diesem Abend zum dritten Mal ein Schrei die Stille der Boldixumer Vogelkoje zerriss.
3
»Scheiße!«, fluchte Polizeioberkommissar Hinrichs und knallte den Hörer auf die Gabel. »Wenn uns da einer verarscht, dann kann er sich warm anziehen.«
»Was ist denn los?«, fragte Polizeihauptmeister Jens Olufs gelassen, der derartige Ausbrüche seines Chefs schon gewohnt war.
»Eine Leiche in der Boldixumer Vogelkoje«, antwortete Hinrichs knapp.
»Ja, klar. Warum nicht gleich ein Amoklauf mit fünfzehn Toten in der Lembecksburg?«
»Vorsicht, Jens. Treib’s nicht zu weit«, knirschte Hinrichs mit einem gefährlichen Unterton, so dass Olufs schlagartig den Ernst der Lage erkannte.
In diesem Moment klingelte die Mikrowelle. Hinrichs öffnete die Tür und zog einen Teller mit dem Backfisch heraus, den er sich gerade aufgewärmt hatte. Er bugsierte das heiße Fischfilet direkt vom Teller zurück zwischen die beiden Baguettehälften auf dem Tisch, zupfte das Salatblatt zurecht und wickelte die Serviette drum herum. Jetzt sah das Backfischbrötchen wieder aus wie vor zwei Stunden, als er es im Fischerhus in der Mühlenstraße gekauft hatte. Und es war wieder exakt genauso heiß, denn auch da war es aus der Auslage zuerst in die Mikrowelle gewandert.
Hinrichs angelte den Autoschlüssel vom Schreibtisch, warf ihn Olufs zu und setzte sich die Dienstmütze auf. »Du fährst«, bestimmte er. »Sonst wird mein Abendessen wieder kalt.«
Während der Fahrt im blau-silbernen Passat durch die Marsch biss Hinrichs herzhaft in sein Backfischbrötchen und störte sich nicht im Mindesten daran, dass sich die Remoulade auf seinen Wangen, dem Doppelkinn und im Schnauzbart verteilte. Erst als sie fett auf sein Hemd tropfte, quetschte er ein »Scheiße, Mann!« zwischen Fisch- und Brötchenstücken heraus, wodurch sich das Tropfen beschleunigte und die Sauce auf dem Hemd eine stückige Konsistenz annahm. An der Boldixumer Vogelkoje angekommen, stieg er aus dem Auto und wischte mit der fettigen Serviette an seinem Hemd herum. Das machte alles noch schlimmer, so dass Hinrichs das Papiertuch zerknüllte und wütend in den Graben warf.
»Vorsicht, Chef«, sagte Olufs. »Das ist ein Tatort. Nachher findet die Spusi die Serviette, und die Spuren auf Ihrem Hemd führen dann direkt zu Ihnen.«
Er fing sich einen vernichtenden Blick seines Vorgesetzten ein, der nun in die Knie ging und die Serviette schnaufend wieder aus dem Graben angelte. Dann schritt Hinrichs gefolgt von Olufs über die Brücke und betrat als Erster das in tiefem Dunkel gelegene Gelände der Vogelkoje. Vor den Beamten erstrahlte das Kojenwärterhaus hell erleuchtet unter den nächtlich schwarzen Bäumen. Sie erkannten eine zitternde Gestalt, die ohne Schuhe neben der offenen Tür auf der Erde kauerte und sich nun erhob.
»Na endlich!«, rief der Mann und machte humpelnd ein paar Schritte auf sie zu. »Wissen Sie eigentlich, was es heißt, neben einer Leiche hier in der Dunkelheit zu warten?«
»Sie haben uns angerufen?«, überhörte Hinrichs routiniert die Kritik.
»Baginski«, stellte der Mann sich vor. »Heinz Baginski aus Bottrop. Da drin liegt ein Toter.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich habe ihn gesehen!«
»Nein, ich meine, woher wissen Sie, dass er tot ist?«
Heinz Baginski stutzte. Die Frage war berechtigt. Er hatte der Leiche wirklich nicht den Puls gefühlt. Aber dann sah er das scheußliche Bild im Geiste wieder vor sich. »Das Blut«, stammelte er. »Überall ist Blut.«
»Na gut, Sie warten hier, wir sehen uns das mal an.«
Hinrichs machte ein paar vorsichtige Schritte auf die offene Tür zu, Jens Olufs folgte ihm. Und dann sahen auch sie, dass es da keinen Zweifel gab. Der Tote musste ein geradezu klaffendes Loch im Hinterkopf haben, denn er lag in einer Blutlache, die mit gelbweißen Stücken vermischt war. Hinrichs hatte zwar noch nie Gehirnmasse gesehen, aber so hatte er sie sich immer vorgestellt. Und dann erkannte er etwas, das ihm den Schweiß auf die Stirn trieb, und er wusste, dass er handeln musste. Schließlich hatte er als Chef der Inselpolizei eine Verantwortung für das große Ganze.
Auch Jens Olufs trat nun einen Schritt näher heran, da sein Vorgesetzter ihm mit seiner Leibesfülle den Blick versperrte.
»Pass auf das Blut auf«, ranzte Hinrichs. »Latsch da bloß nicht rein!«
Olufs achtete genau darauf, wo er hintrat, und versuchte, das zur Seite gedrehte Gesicht des Toten zu erkennen.
»Mann«, entfuhr es ihm dann. »Das ist ja der Rickmers. Was macht der denn nachts in der Vogelkoje?«
»Genau die Frage stellt sich«, brummte Hinrichs und fügte wie nur für sich selbst bestimmt hinzu: »Und deshalb müssen wir jetzt handeln. Der Mann hat einen Ruf zu verlieren. Nahmen Rickmers ist nicht irgendwer!«
»Ich glaube, sein guter Ruf ist im Moment seine geringste Sorge«, wandte Olufs ein.
»Und Hilke?«, brüllte Hinrichs.
»Welche Hilke?«
»Hilke Rickmers, verdammt noch mal! Was glaubst du wohl, was das hier für sie bedeutet?«
In einem musste Jens Olufs seinem Vorgesetzten recht geben: Die Familie Rickmers hatte einen Namen auf der Insel. Wie man den allerdings schützen sollte, nachdem der Mann nun einmal unwiderruflich tot war, leuchtete ihm nicht so ganz ein. »Was haben Sie vor, Chef?«, erkundigte er sich unsicher.
»Lass das meine Sorge sein«, erwiderte Hinrichs abweisend. »Bring diesen … wie heißt der doch gleich?«
»Baginski«, antwortete Olufs.
»Bring diesen Baginski zum Auto und warte da auf mich.«
Olufs sah seinen Vorgesetzten fragend an, folgte dann aber dem Befehl und ging hinaus. »Kommen Sie, Herr Baginski«, forderte er den zitternden Zeugen auf. »Setzen Sie sich in unseren Dienstwagen, bis wir hier einen ersten Überblick haben.«
Heinz Baginski wankte hinter dem Polizisten her. Jeder Meter, den er zwischen sich und die Leiche brachte, konnte für sein seelisches Gleichgewicht nur gut sein. Aber dann fiel ihm etwas ein. »Meine Schuhe«, rief er, »und meine Ausrüstung.«
»Wie bitte? Welche Ausrüstung?«
»Meine Kamera ist noch am Teich. Deshalb bin ich doch hier. Ich wollte Enten fotografieren. Und die Kamera lasse ich nicht einfach so zurück.«
Olufs überlegte kurz. »Gut«, bestimmte er dann. »Holen Sie den Krempel. Ich warte am Auto.«
Heinz Baginski lief zum Kojenteich, zog sich seine Schuhe an und baute seine Kamera und sein Stativ ab. Dann schulterte er alles und stolperte den Weg zurück. Als er an der offenen Tür des Kojenwärterhäuschens vorbeikam und einen vorsichtigen Blick hinein warf, sah er den anderen Polizisten vor der Leiche knien. Schnell setzte er seinen Weg fort, um nicht noch einmal länger als nötig mit dem schrecklichen Anblick des Toten konfrontiert zu werden. Olufs stand neben der offenen Beifahrertür und half dem verstörten Zeugen auf den Sitz. Dann drückte er sanft die Tür zu und wartete, wie sein Vorgesetzter es angeordnet hatte.
Der kam einige Minuten später und steuerte diensteifrig auf den Wagen zu. Schon aus einigen Metern Entfernung wedelte er heftig mit den Armen. »Wo ist die Kamera?«, fragte er. »Ich mache ein paar Tatortfotos. Dann verständigen wir die Kollegen aus Flensburg. Das ist eine Sache für die Mordkommission.«
»Chef«, druckste Olufs herum. »Die Kamera …«
»Was ist damit?«
»Der Akku ist leer.«
»Woher willst du das wissen?«
»Die Geburtstagsfeier gestern.«
»Mann, kannst du nicht einmal in ganzen Sätzen reden? Welche Geburtstagsfeier?«
»Von meiner Schwiegermutter«, erklärte Olufs verlegen, wurde aber dann deutlicher, als er das gefährliche Glimmen in Polizeioberkommissar Hinrichs’ Augen sah. »Die hatte gestern Geburtstag, und da habe ich ein paar Fotos … und, na ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, den Akku wieder …« Er machte einen Schritt zurück, weil Hinrichs’ Gesicht jetzt die Züge Frankensteins annahm.
»Das ist eine Dienstkamera, verdammt noch mal! Wie kannst du es wagen …?«
»Baginski«, fiel Olufs ihm ins Wort und wurde mit einem Mal sehr diensteifrig.
»Wie, Baginski?« Hinrichs platzte fast der Kragen.
»Unser Zeuge!«, erklärte Olufs und deutete auf die kauernde Gestalt auf dem Beifahrersitz.
»Was ist mit dem?«, brüllte Hinrichs.
»Der hat doch eine Kamera. Die borge ich mir aus.«
Bevor Hinrichs nachfragen konnte, hatte Olufs schon die Tür aufgerissen und sprach leise auf den Zeugen ein, der immer noch am ganzen Körper zitterte. Als Olufs ihn bat, noch einmal mit in die Vogelkoje zu kommen, schüttelte er entgeistert den Kopf. Nur mühsam konnte der Polizeibeamte ihn dazu bewegen, den Schutz des Fahrzeugs wieder zu verlassen.
»Was gibt das denn jetzt?«, erkundigte sich Oberkommissar Hinrichs aufgebracht.
»Chef«, erklärte Olufs, »am besten macht der Mann die Fotos selbst. Ich kenne mich mit diesen technischen Spitzenteilen nicht aus. Oder wollen Sie …?«
Hinrichs spießte Olufs mit seinen Blicken auf, entgegnete aber nichts.
»Warte hier, wir kommen, wenn wir fertig sind«, ordnete er an und begleitete den bebenden Zeugen zurück in die Vogelkoje. »Machen Sie ein paar Bilder vom Tatort und von dem Toten«, befahl er. »Aber passen Sie auf, dass Sie keine Spuren zertrampeln.«
Heinz Baginski war sichtlich schockiert, dass er der Leiche nun so nah kommen sollte, aber da der Polizist offenbar kurz vor einer Explosion stand, ging aus seiner Sicht von dem Toten die geringere Gefahr aus. Er schoss ein paar Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln, ohne sich die Leiche dabei wirklich anzusehen – quasi aus professioneller Distanz im Vorbeigucken –, vergaß auch den übrigen Innenraum der Hütte nicht und war froh, als er schließlich wieder draußen in der frischen Nachtluft stand.
Hinrichs klopfte ihm auf die Schulter und deutete mit dem Kopf an, ihm zu folgen. Gemeinsam gingen sie durch den dunklen Tunnel unter den Bäumen auf den Ausgang zu, wo Jens Olufs immer noch an den Wagen gelehnt auf sie wartete.
»Du fährst jetzt mit dem Mann aufs Revier«, befahl Hinrichs, wobei Stimme und Mimik Entschlossenheit ausdrückten. »Ich bleibe hier und verständige Dr. Hecht, damit er den Tod von Rickmers feststellt. Die Kollegen in Flensburg rufst du an. Die können nicht vor morgen Vormittag hier sein, und so lange wird die Leiche ja wohl nicht vor sich hinmodern müssen.«
Olufs wollte etwas einwenden, aber Hinrichs brüllte: »Lass gehen! Ich weiß, was ich mache.«
Der Polizeihauptmeister half seinem Zeugen wieder auf den Beifahrersitz, stieg dann selber auf der Fahrerseite ein, wendete den Wagen vor dem Tiergatter am Deich und raste so schnell, wie es die Dunkelheit zuließ, auf der Straße durch die Marsch in Richtung Wyk davon.
Polizeioberkommissar Hinrichs zog sein Handy aus der Tasche und rief den Arzt Dr. Hecht an. »Uli? Torben hier. Du musst sofort zur Boldixumer Vogelkoje kommen. Hier ist die Kacke am Dampfen, aber so richtig. … Wie? … Nein, alles Weitere erkläre ich dir hier. Ich sage nur eins: Es geht um Mord!«
4
Heinz Baginski saß auf der Kante des Stuhles, auf dem er bereits die halbe Nacht zugebracht hatte, die Hände zusammengekrampft im Schoß, und zitterte am ganzen Körper. Vor ihm stand der Tisch, der ihn von dem zornbebenden Oberkommissar Hinrichs trennte. In der Ecke des Raumes neben der Tür zur Wachstube stand Polizeihauptmeister Jens Olufs mit verschränkten Armen und kämpfte gegen die Müdigkeit an, die ihm mit Bleigewichten an den Augenlidern zu hängen schien.
»Noch mal von vorne«, befahl Hinrichs, wie er es seinerzeit auf der Polizeischule im Seminar »Psychologie des polizeilichen Verhörs« gelernt hatte. »Sie sind also verbotenerweise über den Zaun an der Rückseite der Vogelkoje geklettert.«
»Genau«, bestätigte Baginski, der nicht hätte sagen können, wie oft er seine Geschichte schon erzählt hatte, mit matter Stimme. »Ich bin den Weg zum Kojenwärterhäuschen gegangen und von da zum Teich.«
»Sie sind also nicht zuerst in das Häuschen gegangen?«
»Nein, das habe ich doch schon gesagt.«
»Warum nicht? War das Häuschen abgeschlossen?« Hinrichs begriff in dem Moment, in dem er die Frage stellte, wie genial sie war, denn wenn Baginski sie mit ja oder nein beantworten würde, dann hätte er ihn überführt.
»Woher soll ich das wissen?«, entgegnete Baginski stattdessen gereizt.
»Sie haben doch an der Türklinke gerüttelt«, wagte sich Hinrichs vor.
»Nein, das habe ich nicht. Ich habe das Haus gar nicht beachtet, sondern bin sofort weiter zum Teich gegangen.«
»Nachdem Sie an der Türklinke gerüttelt haben?« Mit mir nicht, Freundchen, dachte Hinrichs. Typen wie dich knacke ich mit links.
Aber dieser Baginski war hartnäckig. »Ich habe nicht an der Türklinke gerüttelt, verdammt noch mal. Ich wollte Enten fotografieren, warum sollte ich da ins Häuschen gehen?«
»Sagen Sie mir das. Warum sind Sie in das Häuschen gegangen? Haben Sie Licht gesehen? Haben Sie Geräusche gehört? Warum haben Sie Herrn Rickmers erschlagen? Hat er Sie erwischt, als Sie unerlaubt in die Vogelkoje eingebrochen sind?«
»Ich habe den Mann nicht erschlagen«, wimmerte Baginski jetzt. Das war ein Albtraum. Er machte Kur-Urlaub auf Föhr, um sich zu erholen und einen drohenden Herzinfarkt abzuwenden, und stattdessen war er nun der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Und all das nur, weil er sich auf nicht ganz vorschriftsmäßige Weise Zugang zu einer Vogelkoje verschafft hatte.
»Wie ist es dann passiert?«, fuhr Hinrichs fort, der offenbar ein Geständnis erzwingen wollte. »Haben Sie Rickmers gestoßen? Ist er unglücklich gefallen? War alles nur ein Unfall? Nun, Herr Baginski, kann es nicht sein, dass alles nur ein Unfall war und Sie gar nicht wollten, dass Rickmers stirbt?« Genial. Bau ihm eine Brücke und warte ab, ob er hinübergeht. Und dann fasse nach. Hatte Baginski erst einmal den Unfall zugegeben, war es nur noch ein kleiner Schritt, um ihm den Mord nachzuweisen.
»Neinneinnein! Ich habe den Mann doch gar nicht gesehen. Als ich in die Vogelkoje gekommen bin, war da noch gar keiner. Ich bin direkt zum Teich gegangen, und da bin ich eingeschlafen, und dann habe ich einen Schrei gehört und bin zum Häuschen gelaufen. Da haben mich zwei Leute umgerannt, und dann habe ich die Leiche gefunden. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Ich bin einfach nur ein Zeuge!«