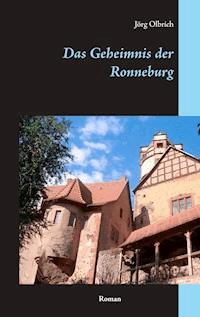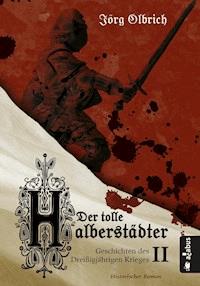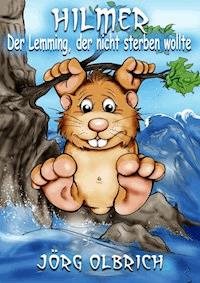Jörg Olbrich
Der Löwe aus
Mitternacht
Geschichten des Dreißigjährigen Krieges
Band 5
Historischer Roman
Inhaltsverzeichnis
Der Löwe aus Mitternacht
Usedom, 6. Juli 1630
Preußen, 31. Oktober 1630
Pommern, 8. November 1630
Friedland, 12. Januar 1631
Wien, 16. Januar 1631
Preußen, 18. März 1631
Frankfurt an der Oder, 13. April 1631
Wien, 16. April 1631
Halberstadt, 27. Mai 1631
Wien, 29. Mai 1631
Prag, 10. Juni 1631
Halberstadt, 2. Juli 1631
Preußen, 11. Juli 1631
Werben an der Elbe, 27. Juli 1631
Preußen, 31. August 1631
Leipzig, 14. September 1631
Prag, 23. September 1631
Preußen, 27. September 1631
Wien, 2. Oktober 1631
Hessen, 14. Oktober 1631
Würzburg, 14. Oktober 1631
Prag, 18. Oktober 1631
Rothenburg, 29. Oktober 1631
Prag, 15. November 1631
Böhmen, 24. November 1631
Bayern, 25. November 1631
Mähren, 11. Dezember 1631
Mainz, 14. Dezember 1631
Wien, 20. Dezember 1631
Frankfurt, 15. Januar 1632
Bamberg, 7. Februar 1632
Frankfurt, 20. Februar 1632
Bamberg, 3. März 1632
Donauwörth, 6. April 1632
Mähren, 12. April 1632
Bayern, 24. April 1632
Böhmen, 4. Mai 1632
Wien, 12. Mai 1632
München, 14. Mai 1632
Prag, 25. Mai 1632
Eger, 23. Juni 1632
Wien, 3. August 1632
Nürnberg, 28. August 1632
Bamberg, 11. September 1632
Nürnberg, 16. September 1632
Nürnberg, 9. Oktober 1632
Bayern, 11. Oktober 1632
Nürnberg, 17. Oktober 1632
Wien, 20. Oktober 1632
Lützen, 14. November 1632
Historische Anmerkung
Personenregister
Historische Eckdaten
Impressum
Orientierungsmarken
Inhaltsverzeichnis
Usedom, 6. Juli 1630
Stolz stand König Gustav Adolf von Schweden auf der Planke, die von seinem Beiboot zum Peenemünder Sandstrand ausgelegt war. Die Feder auf seinem Hut flatterte im Sommerwind. Er nahm sich einen kurzen Moment Zeit, beschattete die Augen mit der Hand und schaute ins Landesinnere. Dann schritt er weiter und ging auf die Knie, kaum dass er festen Boden unter den Füßen erreicht hatte.
»Lieber Herrgott im Himmel«, rief er so laut, dass es auch die Männer in den anderen Booten hören konnten. »Gib uns die Kraft, unsere Mission in deinem Namen zu erfüllen. Du bist mein Zeuge, dass ich diesen Zug nicht zu meiner, sondern einzig und allein zu deiner Ehre und zum Trost und Beistand deiner bedrängten Kirche unternommen habe.«
Sir John Hepburn saß in einem der vorderen Boote und brannte darauf, den Strand ebenfalls endlich betreten zu dürfen. Der Schotte beobachtete, wie der König etwa hundert Meter vom Wasser wegging, von einem Gehilfen einen Spaten entgegennahm und ihn fest in den sandigen Boden stach. Dann schaufelte Gustav Adolf eine kleine Grube und wandte sich um zu seinen Männern, die inzwischen an Land gekommen waren.
»Hier werden wir unser Lager aufschlagen.«
Mit einem Lächeln verließ jetzt auch Sir Hepburn das Boot. Er diente dem König von Schweden bereits seit vier Jahren und hatte Gustav Adolf schon auf seinem Feldzug in Polen begleitet. Gleiches würde der schottische Oberst nun auf deutschem Boden tun. Das Heer war gekommen, um der Schreckensherrschaft von Kaiser Ferdinand II. ein Ende zu bereiten.
Mit etwa zweihundert kleineren Schiffen war die Hauptstreitmacht des Königs von Elfsnaben in Schweden aufgebrochen und an die deutsche Küste gesegelt. An Bord waren rund tausend Offiziere und zwölftausend Söldner. Vor zwei Tagen waren sie an der Insel Usedom angekommen und hatten das Land nun endlich bei Peenemünde betreten.
»Ich hatte damit gerechnet, dass uns die Kaiserlichen hier mit einem Heer empfangen«, sagte Sir Hepburn später, als er mit Seiner Majestät alleine im Hauptzelt des Königs stand und die Karten betrachtete.
»Sie werden nicht weit entfernt sein«, antwortete der König. »Wir haben einen günstigen Zeitpunkt für die Landung im Heiligen Römischen Reich gewählt. Axel Oxenstierna hat mir berichtet, dass sich der Kaiser auf dem Kurfürstentag in Regensburg aufhält.«
»Befindet sich der Reichskanzler noch in Preußen?«, fragte Sir Hepburn.
»Er verweilt noch in Elbing, ja. Trotzdem ist er über die Geschehnisse im Reich bestens informiert. Er schrieb mir auch, dass die Stimmen gegen General Albrecht von Wallenstein immer lauter werden. Die Fürsten fürchten ihn und lehnen sich dagegen auf, dass der Feldherr mit zu viel Macht ausgestattet wurde. Es kann uns zum Vorteil gereichen, wenn das kaiserliche Heer gespalten wird.«
»Unterschätzt den Grafen von Tilly nicht, Eure Majestät«, warnte der Oberst. »Er mag alt geworden sein, ist aber immer noch ein ernst zu nehmender Gegner, der über große Erfahrungen verfügt.«
»Wir werden das Land überrennen«, entgegnete Gustav Adolf und wischte Sir Hepburns Einwand mit einer Handbewegung weg. Dann schlug er mit der Faust auf den Tisch. »Es wird nicht lange dauern, bis wir die protestantischen Kurfürsten für die gemeinsame Sache gewonnen haben. Dann werden wir das Volk befreien und den Kaiser vom Thron stoßen.«
Sir Hepburn konnte die Sorglosigkeit seines Dienstgebers nicht teilen, behielt die Einwände aber für sich. Es war nicht ratsam, dem König zu widersprechen, wenn er sich erst einmal in Rage geredet hatte.
»Wie gehen wir weiter vor?«, fragte der Oberst stattdessen.
»Ihr werdet dafür Sorge tragen, dass unsere Truppen schnell an Land gebracht werden«, befahl Gustav Adolf. »In der Zwischenzeit werde ich den Ausbau der Schanze überwachen. Wir brauchen den Stützpunkt an der Küste. Von hier aus werden wir unseren Siegeszug beginnen.«
Direkt an der Mündung der Ostsee in den Peenestrom hatte Albrecht von Wallenstein zwei Jahre zuvor eine Schanze auswerfen lassen, die inzwischen von den Kaiserlichen verlassen worden war. Nun plante Gustav Adolf, diese in eine Festung zu verwandeln.
Der schottische Oberst wusste, dass der König diesen Worten Taten folgen lassen würde. Zunächst galt es aber, das Heer zu sammeln. Es waren noch weitere Truppen auf dem Weg zur Küste. Sir Hepburn dachte an Oberst Mackay und seinen Freund Oberstleutnant Robert Monro, die mit ihrem Regiment ebenfalls vor Peenemünde ankommen sollten. Es würden vor allem die schottischen Truppen sein, die dem Schwedenkönig den Sieg brachten.
***
Es dauerte fast zwei Tage, bis die kompletten Streitmächte Gustav Adolfs an Land gegangen waren. Eines der Boote wurde von einer Welle getroffen, lief voller Wasser und schlug um. Zwei Soldaten ertranken. Die anderen schafften es mit letzter Kraft, an das rettende Ufer zu schwimmen.
In der Zwischenzeit wurden die Bauern aus Peenemünde herangezogen, um die Schanze auszubauen. Zunächst zeigten sie sich störrisch. Als sie aber merkten, dass sie von den Schweden nichts zu befürchten hatten und von ihnen gut behandelt wurden, legten sie sich ins Zeug, um die Arbeiten schnell abzuschließen. Der König wollte die Festung uneinnehmbar machen und ließ Kasematten und feste Ziegelsteinbauten errichten.
Während die Arbeiten noch in vollem Gange waren, kommandierte Gustav Adolf eine Kompanie ab, die den Feind in Wolgast beobachten sollte. Er selbst zog den Strand entlang nach Wollin und nahm die Stadt ohne größere Gegenwehr ein.
Die schwedischen Soldaten erweiterten das vom König gesicherte Gebiet ständig. Abgesehen von kleineren Scharmützeln ergab sich das Landvolk seinem Willen. Gustav Adolf zahlte den Bauern einen angemessenen Preis für die Verpflegung seiner Truppen, und es sprach sich schnell herum, dass der Eroberer aus dem Norden nichts Böses gegen die Bevölkerung im Schilde führte.
Gustav Adolf brauchte Bündnisse mit den protestantischen Fürsten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Ohne diese hätte er das ganze Land gegen sich, und sein Heer wäre schnell aufgerieben. Als Erstes wollte er einen Vertrag mit Herzog Bogislaw XIV. von Pommern-Stettin schließen. Wenn es sein musste, auch gegen dessen Willen.
»Ihr habt nichts zu befürchten«, rief König Gustav Adolf den Bürgern zu, als er zwei Wochen nach seiner Landung auf Usedom, begleitet von Sir John Hepburn, durch die Tore Stettins ritt. »Ich bin als Freund, keineswegs als Feind in diese Länder gekommen, um zu helfen, die heilige reine Religion Augsburgischer Konfession zu erhalten.«
Die Menschen in Stettin jubelten dem Schwedenkönig zu. Erst verhalten, dann immer lautstärker. Sir Hepburn beobachtete den König und sah, wie sehr Gustav Adolf den Einmarsch in die Stadt genoss. Dabei half es, dass er die Bürger in ihrer Landessprache anredete, um das Vertrauen des Volkes zu gewinnen.
Bereits zu Beginn des Krieges vor zwölf Jahren war Gustav Adolf gemeinsam mit seinem Vertrauten Johann Casimir ins Heilige Römische Reich gekommen. Dort hatte er sich einen Überblick über die politische Lage im Reich nach dem Aufstand der böhmischen Stände verschafft. Der Hauptgrund seiner Reise aber war ein völlig anderer gewesen: Er hatte beim Kurfürsten von Brandenburg um die Hand von dessen Tochter Maria Eleonore angehalten und sie zwei Jahre später in Stockholm geheiratet.
Gustav Adolf führte seine Truppen auf das Stettiner Schloss zu, wo er Herzog Bogislaw XIV. seine Bündnisvorstellungen unterbreiten wollte. In der Vergangenheit hatte der Mann immer versucht, sich neutral zu verhalten, um weder bei seinen protestantischen Glaubensgenossen noch bei Kaiser Ferdinand II. in Ungnade zu fallen. Dabei nahm er in Kauf, dass der Habsburger sein Restitutionsedikt auch in seinem Herzogtum durchsetzte. Das schwedische Heer vor den Mauern seiner Stadt sollte ihn nun davon überzeugen, für die gemeinsame Sache Partei zu ergreifen.
Preußen, 31. Oktober 1630
… versichere ich Seiner Majestät, dass ich mein Möglichstes geben werde, meine Pflicht zu erfüllen und alles irgendwie Denkbare zu vollbringen.
Der schwedische Reichskanzler Axel Oxenstierna ließ den Brief an Gustav Adolf von Schweden sinken, den er gerade ein letztes Mal gelesen hatte, um sich von der Richtigkeit seiner Angaben zu überzeugen. Er war fest entschlossen, das Versprechen, das er seinem König am Ende seiner Zeilen gegeben hatte, auch in die Tat umzusetzen.
Bisher hatte sich Gustav Adolf immer auf seinen Reichskanzler verlassen können. Der hatte nicht die Absicht zuzulassen, dass sich das jetzt änderte. Leider hatte er im Augenblick keine Ideen, wie er dies bewerkstelligen sollte. Egal was er auch anpackte: Überall fehlten die nötigen Mittel.
Oxenstierna wischte sich den Schweiß von der Stirn. Obwohl draußen bereits die ersten Schneeflocken des Winters gefallen waren und er den Kamin in seinem Amtszimmer im Rathaus von Elbing nicht angefacht hatte, dachte er, innerlich zu glühen. Die stetig ansteigenden Sorgen schienen sich in seinem ganzen Körper einzubrennen.
Es verging kaum ein Tag, an dem der Reichskanzler nicht mindestens einen Brief an Gustav Adolf schrieb. Genauso oft brachten die Boten die Antworten des Königs. Oxenstierna grämte sich, dass er nicht persönlich bei Seiner Majestät verweilen konnte, sah aber ein, dass er Elbing nicht so einfach verlassen durfte.
Während des Kriegs mit dem polnischen König Sigismund hatten die Schweden vor etwa vier Jahren die Stadt in der Nähe der preußischen Ostseeküste eingenommen und besetzt. Der Reichskanzler war von Gustav Adolf zum Generalgouverneur der schwedischen Besitztümer in Preußen ernannt worden und seitdem bis auf wenige kürzere Reisen in Elbing geblieben. Von dort aus stand er im ständigen Briefwechsel mit seinem König und beriet ihn in allen politischen Fragen, so wie er es bereits seit Jahrzehnten getan hatte.
Die Probleme, die Oxenstierna aus dem Weg schaffen musste, waren seit der Landung des schwedischen Königs auf deutschem Boden immer größer geworden. Bereits vor einem Jahr hatte die schwedische Reichskammer ermittelt, dass ein Feldzug im Heiligen Römischen Reich fast zwei Millionen Reichstaler im Jahr verschlingen würde und ausdrücklich davor gewarnt.
Auch Oxenstierna selbst hatte damals einen ähnlich hohen Betrag ermittelt und vorausgesagt, dass für einen solchen Feldzug mindestens fünfundsiebzigtausend gut bewaffnete Söldner nötig wären. Weiterhin wurde noch mal ein Drittel dieser Männer zur Sicherung Schwedens und Finnlands benötigt. Oxenstierna hatte außerdem darauf bestanden, auch Preußen von einem Heer aus vierzehntausend Söldnern schützen zu lassen, damit die Polen davor abgeschreckt wurden, den sechsjährigen Waffenstillstand zu brechen.
Die jetzigen Berechnungen des Reichskanzlers bestätigten diese Zahl, und er wusste nicht, woher die nötigen Mittel kommen sollten. Ohne Bündnispartner waren die notwendigen Truppenstärken nicht zu erreichen. Dennoch war er nach wie vor der Ansicht, dass der Feldzug im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation sein musste, um Schwedens Machtposition in der Ostsee zu erhalten und zu stärken.
Nach dem Frieden mit Polen und Russland war der Kaiser nun der stärkste Widersacher der Schweden. Noch war der Habsburger damit beschäftigt, sein eigenes Reich unter Kontrolle zu bringen. Sobald ihm dies aber gelang, bestand die Gefahr, dass er sein Refugium der Macht ausdehnen würde. Um zu verhindern, dass Ferdinand II. den Krieg nach Schweden brachte, wollten König und Reichskanzler den Feind auf dessen eigenem Boden bekämpfen. Mit dieser Forderung konnten sie sich schließlich beim schwedischen Reichsrat durchsetzen.
Gustav Adolf und Oxenstierna hatten geplant, den Großteil der Kosten von den protestantischen Verbündeten im Reich decken zu lassen. Diese erwiesen sich aber als knauserig und stur. Die Fürsten verzögerten das Bündnis mit Schweden mit fadenscheinigen Ausreden und mussten zu ihrem Glück gezwungen werden. Gleichzeitig musste ihr Volk unter den kaiserlichen Armeen leiden, die marodierend durch ihre Gebiete zogen.
Dabei hatte Gustav Adolf den Fürsten auf Anraten Oxenstiernas unmissverständlich mitgeteilt, dass er das Land nicht erobern wolle, sondern einen Pakt mit ihnen anstrebe. Aus diesem Grund war den Söldnern im Dienste der Schweden das Plündern und Ausbeuten des Landes auch ausdrücklich und unter Androhung von Strafe verboten worden.
Besonders beeindruckt zeigten sich die Fürsten bisher nicht. Der schwedische Feldzug im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war ins Stocken geraten, bevor er richtig begonnen hatte. Aus eigener Kraft konnte Gustav Adolf die benötigten Truppen weder beschaffen noch bezahlen.
Ein Klopfen an der Tür riss Oxenstierna aus seinen sorgenvollen Gedanken.
Der Reichskanzler murrte ein abwesendes »Herein« und schaute überrascht auf, als Agneta den Raum betrat. »Ich habe dich nicht gerufen«, sagte er zu der etwa dreißigjährigen blonden Frau, die für sein persönliches Wohlergehen verantwortlich war. In der Zeit in Elbing war ihm Agneta ans Herz gewachsen. Nichts schien die leicht stämmige Person aus der Ruhe bringen zu können. Sie hatte stets ein Lächeln im Gesicht, und wenn sie sprach, konnte man die Güte in ihrer Stimme nicht überhören. Dennoch mochte es Oxenstierna nicht, wenn er grundlos gestört wurde. Agneta wusste das.
»Ihr habt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Es ist bald Abend.«
Oxenstierna wollte seine Bedienstete gerade anschreien, dass dies ja wohl seine Entscheidung war, wann er etwas zu sich nahm, als ein Blick auf die Standuhr ihm zeigte, dass der Nachmittag bereits weit fortgeschritten war. In einer Stunde würde es dunkel werden. Der Reichskanzler war so auf seine Arbeit konzentriert gewesen, dass er die Zeit vergessen hatte. Ein Ziehen im Magen bestätigte ihm, dass er tatsächlich etwas essen sollte.
»Du hast recht«, sagte Oxenstierna nun deutlich freundlicher. »Bring mir eine Suppe.«
Agneta nickte erleichtert, verschwand kurz aus dem Raum und kehrte dann mit einem dampfenden Teller und einem Viertel Laib Brot zurück.
Oxenstierna nickte seiner Bediensteten dankbar zu, als sie alles auf dem Tisch vor ihm abstellte und dabei darauf achtete, keines der Papiere zu berühren oder gar mit der Suppe zu beschmutzen.
Agneta verließ den Raum und Oxenstierna dachte daran, wie wenig er über sie wusste. Und das, obwohl sie bereits seit vier Jahren in seinem Dienst stand. In dieser Zeit hatte sie dem Reichskanzler jeden Wunsch erfüllt. Oft, ohne dass er ihn aussprechen musste.
Agneta war eine unscheinbare Person, die kaum auffiel, wenn sie durch Elbing schritt. Sie hatte ihre Haare stets unter einer Haube bedeckt, sodass kaum eine Strähne hervorschaute. Ihre Gewänder waren weit geschnitten und zeigten keinen Zentimeter Haut an Armen und Beinen. Die Falten in ihrem Gesicht zeigten, dass sie es in ihrem Leben nicht immer leicht gehabt hatte. Dennoch war sie eine der fürsorglichsten und gutmütigsten Frauen, die Oxenstierna je getroffen hatte.
Der Reichskanzler konnte nicht sagen, was genau ihn an dem Weib anzog. Als Dirne in einem Heerlager wäre sie sicher verhungert. Dennoch strömte sie eine unerklärliche Anziehungskraft auf Oxenstierna aus. Dieser würde er aber niemals nachgeben. So sehr er es auch tief in seinem Innern vielleicht wollte.
Während er die Suppe aß und hin und wieder ein Stück Brot abbiss, dachte der inzwischen fast Fünfzigjährige an seine Familie, die in Schweden auf ihn wartete. Sein Weib Anna hatte ihm zwei Söhne und zwei Töchter geschenkt. Erik, das Jüngste seiner Kinder, war gerade einmal sechs Jahre alt. Oxenstierna hatte ihn seit Jahren nicht mehr gesehen.
Immer öfter sehnte sich der schwedische Adelige nach Frau und Kindern. Besonders im Winter. Er durfte und wollte aber nicht zulassen, dass diese Gedanken seinen Geist zu sehr betrübten. Schon in jungen Jahren hatte Oxenstierna sein Leben dem Wohlergehen seines Landes verschrieben. Daran würde sich niemals etwas ändern.
Wieder war es Agneta, die den Reichskanzler aus den Gedanken riss. Dieses Mal kam sie zu ihm, um den leeren Teller abzuholen und ihrem Herrn eine Karaffe Wein zu bringen. Sie zündete zwei Kerzen an, damit er die Zahlen auf seinen Blättern besser erkennen konnte, und verließ lächelnd den Raum.
Als er wieder alleine war, lenkte Oxenstierna seine Gedanken zurück zu Gustav Adolf, dem Feldzug und den protestantischen Fürsten, die einfach nicht einsehen wollten, dass der schwedische König die einzige Hoffnung auf eine friedliche Zukunft war.
***
Auf den Befehl Oxenstiernas hin waren im Reich Flugblätter verteilt worden, durch die beim Volk dafür geworben wurde, bei den gemeinsamen Zielen mit den schwedischen Befreiern mitzuwirken. Gerade die Landbevölkerung hatte freudig und erleichtert auf die Landung Gustav Adolfs auf Usedom reagiert und jubelte dem König zu. Lediglich der Adel, und auf den kam es an, zeigte sich oft störrisch.
Nachdem Gustav Adolf bereits Mitte August einen entscheidenden Sieg über Wolgast errungen hatte und die Stadt besetzen konnte, hatte er seinem Reichskanzler in einem Schreiben versichert, nunmehr ein sicheres Fundament der pommerschen Expedition zu haben. Was brachte dies aber ein, wenn sie ihre Position im Reich nicht ausdehnen konnten?
Erste Verhandlungserfolge gab es dennoch zu vermelden: Magdeburg hatte sich bereits Anfang August dem schwedischen König angeschlossen und auch Hessen-Kassel stand kurz vor einem Bündnis mit Gustav Adolf.
Herzog Bogislaw XIV. hatte Anfang September ebenfalls einen Vertrag mit dem Befreier unterschrieben, nachdem er ihn unter sanfter Androhung von Gewalt dazu getrieben hatte. Dieser wurde als Defensivbündnis bezeichnet. Der Herzog behielt die zivile Verwaltung, das Land wurde aber von den Schweden besetzt.
Oxenstierna hatte darauf bestanden, dass ein Passus aufgenommen wurde, in dem die bereits vor einhundert Jahren in Grimnitz vertraglich festgelegte Erbfolgeregelung für das Herzogtum Pommern ausgesetzt worden war. Somit war den Schweden die Regierungsgewalt auch im Falle des Todes von Bogislaw XIV. sicher.
Schwierig gestalteten sich die Verhandlungen mit dem Rat der Stadt Stralsund. Und das, obwohl die Stadt bereits seit zwei Jahren unter schwedischer Besatzung stand. Der Reichskanzler erinnerte sich noch sehr gut an ellenlange Diskussionen, die er damals hatte führen müssen, als er persönlich in die Stadt gereist war. Stralsund hatte die hohen Geldforderungen des schwedischen Königs zurückgewiesen und nur einen geringen Anteil gezahlt. In seiner Not war Gustav Adolf selbst nach Stralsund gefahren und hatte dem Rat Güter in Pommern im Wert von einhunderttausend Reichstalern verkauft. Güter, die dem König von Schweden nicht gehörten.
Aus der Finanznot heraus hatte Gustav Adolf befohlen, nach Mecklenburg vorzurücken, wo man sich in feindlichem Gebiet die dortigen Besitztümer aneignen konnte. Dies brachte Erleichterung, reichte aber bei Weitem nicht aus.
Man konnte es drehen, wie man wollte: Ohne die Unterstützung der Kurfürsten aus Brandenburg und Sachsen würde Gustav Adolf seinen Feldzug nicht ausdehnen können. Die zeigten sich jedoch weiterhin zögerlich. Da half es auch nicht, dass Gustav Adolf seinem Schwager Georg Wilhelm in einem persönlichen Brief versichert hatte, nicht als Feind gelandet zu sein sondern als Freund, der die Räuber und Verderber des Reiches vertreiben wollte. Dem Kurfürsten von Brandenburg hatte dies aber nicht ausgereicht, um sich zu einem Bündnis zu bekennen.
Seine Verbindung nach Wien und zum Kaiser war trotz der gegensätzlichen Glaubensrichtung so stark, dass es Georg Wilhelm nicht wagte, sich auf die Seite des Schwagers zu schlagen. Aus ähnlichen Gründen zögerte auch Johann Georg von Sachsen. Der beschäftigte sich lieber mit der Jagd und dem Genuss von Bier, anstatt zu beobachten, wie dicht ihm der Habsburger bereits auf die Pelle gerückt war.
Ein Blick zum Mond, den er durch das Fenster sehen konnte, zeigte Oxenstierna, dass es inzwischen nach Mitternacht sein musste. Er verspürte leichten Hunger und das dringende Bedürfnis, sich zu erleichtern. Weil Agneta längst nach Hause zu ihrem Gemahl gegangen war, würde er sich wohl oder übel selbst etwas zu Essen besorgen müssen.
Pommern, 8. November 1630
»Irgendetwas stimmt in dieser Stadt nicht!«
»Was meinst du, Willow?«, fragte Major Monro zurück und schaute in die Straßen von Schivelbein, durch deren Stadttor sie gerade geritten waren. »Außer unserer Vorhut ist doch niemand hier.«
»Genau das ist es, was mich stört«, antwortete der Bursche. »Wo sind die Bürger? Wo die feindlichen Landsknechte? Niemand hat uns gehindert, die Stadt zu betreten.«
»Vermutlich haben sie Angst«, sagte Monro und lachte leise auf. »Es wird sich in Pommern herumgesprochen haben, dass mit dem schottischen Regiment nicht zu spaßen ist.« Der Major wusste selbst, dass die Bürger Schivelbeins vermutlich noch nie einen Schotten gesehen hatten, fand aber die Vorstellung erheiternd, dass ihm und seinen Kompanien der Ruf vorausgeeilt sein sollte.
Für den Major war es nicht das erste Mal, dass er sich auf einem Feldzug im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation befand. Bereits vor vier Jahren war er als Leutnant im schottischen Regiment von Oberst Mackay in Holstein gelandet. Damals hatten die Schotten im Dienste von König Christian IV. von Dänemark gekämpft. Trotz kleinerer Siege war es ihnen nie gelungen, im Reich von Kaiser Ferdinand II. Fuß zu fassen.
Nachdem der dänische König mit dem Habsburger drei Jahre später Frieden geschlossen hatte, war auch das schottische Regiment aufgelöst worden. Jetzt würde Monro seine Männer wieder auf deutschem Boden in die Schlacht führen. Der Feind war derselbe geblieben.
Im Februar dieses Jahres war Monro mit Oberst Mackay nach Schweden gereist, um König Gustav Adolf seine Dienste anzubieten. Da der gerade einen Feldzug gegen Ferdinand II. geplant hatte, hatte er das Angebot gerne angenommen und die schottischen Soldaten in mehreren Regimentern zusammengefasst.
Während Oberst Mackay den schwedischen König mit seinem Regiment bereits vor vier Monaten nach Usedom begleitet hatte, war Major Monro nach Preußen in die Stadt Pillau geschickt worden. Dort hatte er sechs Kompanien übernommen und sich vor einer Woche mit seinen Soldaten eingeschifft, um nach Pommern zu segeln.
Am dritten Tag war die Flotte, zu der neben den beiden Hauptschiffen noch zwei kleinere gehörten, auf denen die Pferde und das Gepäck untergebracht worden waren, in einen Sturm geraten. Die »Lilly Nichol« war leckgeschlagen und hatte es eben noch geschafft, zur Insel Bornholm in Dänemark zu gelangen. Nach einer notdürftigen Reparatur hatten sie frische Lebensmittel aufgenommen und waren in Richtung Wolgast in See gestochen. In einem erneuten Sturm hatte es das Schiff nicht geschafft, sich im heftigen Gegenwind von der Küste zu entfernen.
Monro und seine Truppen waren in der Nähe von Rügenwalde gestrandet und hatten die Stadt mithilfe eines Adeligen und des Hauptmannes der Schlosswache eingenommen, der sie heimlich in den Ort gebracht hatte.
Nachdem der schottische Offizier mit seinen Kompanien Rügenwalde sechs Wochen lang gehalten hatte, war ihm vom schwedischen Reichskanzler Axel Oxenstierna Hilfe durch Sir John Hepburn geschickt worden. Der schottische Oberst im Dienste Seiner Majestät Gustav Adolf von Schweden war mit seinem Regiment aus Preußen gekommen, um seine Landsleute zu befreien.
Von Sir Hepburn hatte Monro zunächst den Befehl bekommen, mit seinen Truppen nach Kolberg zu ziehen, um sich dem Geheiß des Generalmajors Dodo Freiherr zu Innhausen und Knyphausen zu unterstellen, der die dortige Festung der Kaiserlichen belagerte. Von ihm war er dann mit dem Auftrag nach Schivelbein geschickt worden, die Stadt zu besetzen und zumindest das Schloss um jeden Preis gegen einmarschierende kaiserliche Truppen zu verteidigen und zu halten.
»Wenn sie Angst haben, dann nicht vor uns«, sagte Willow und deutete auf eines der Häuser. »Seht Ihr das schwarze X neben der Tür? Hinter diesen Mauern lauert der Tod.«
»Du sprichst von der Pest?«
»Ja. Die Zeichen sind eindeutig. Ich bin überzeugt, dass wir überall in der Stadt Tote finden werden. Wir sollten so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden.«
»Das kommt nicht infrage.« Monro sah den Burschen, der ihm in den vergangenen Jahren zu einem treuen Freund geworden war, kopfschüttelnd an. Der junge Mann hatte ihn bereits bei seinem Feldzug unter Christian IV. von Dänemark begleitet. Nachdem der Bursche damals seinen Freund Bryan in einer Schlacht verloren hatte, hatte sich Monro seiner angenommen, dafür gesorgt, dass er Lesen und Schreiben lernte und ihn zu seinem persönlichen Gehilfen gemacht. Im vergangenen Winter hatte Willow die Zeit in Kopenhagen genutzt und viel gelesen. Wenn er sagte, dass das Zeichen auf die Pest hindeutete, gab es keinen Grund, daran zu zweifeln. Dennoch wollte sich der Major davon nicht aufhalten lassen. »Ein schottischer Soldat flieht vor keiner Gefahr«, sagte er deshalb.
»Auch nicht vor der Pest?«
»Nein«, antwortete Monro entschlossen. »Wir haben den Auftrag, die Stadt einzunehmen und zu halten. Und genau das werden wir auch tun.«
Mittlerweile hatten auch die untergeordneten Offiziere das Stadttor passiert und scharten sich um den Major. Monro las den Gesichtern der Männer ab, dass es auch ihnen seltsam vorkam, wie ruhig es in Schivelbein war.
»Schickt eure Männer in jeden Winkel der Stadt und lasst alle Häuser durchsuchen«, befahl Monro mit fester Stimme. »Den Bürgern darf kein Leid geschehen. Sorgt dafür, dass unsere Männer in der Stadt Quartier finden.«
Die Offiziere nickten dem Major zu und machten sich daran, seinen Befehl in die Tat umzusetzen. Monro selbst ritt gemeinsam mit Willow und einem Dutzend Söldner weiter zum Schloss.
»Die Stadt wirkt wie ausgestorben«, wiederholte der Bursche seine Bedenken. »Ich sehe auch keine Kaiserlichen. Irgendetwas ist hier geschehen.«
»Die Bürger könnten geflohen sein«, vermutete Monro, der nicht glauben wollte, dass ganz Schivelbein von der Pest ausgerottet worden war. Auch innerhalb seiner Kompanie war es durch die Seuche schon zu einzelnen Todesfällen gekommen. Auf die leichte Schulter nahm er den Schwarzen Tod daher nicht. Es hätten aber viel mehr Tote in den Straßen liegen müssen, wenn es nur auf die Pest zurückzuführen war, dass sie keine Menschen sahen.
»Vielleicht finden wir die Antworten im Schloss«, sagte Willow, als sie sich dem prächtigen Gemäuer näherten, das allerdings von ihrem Standpunkt aus ebenfalls einen verlassenen Eindruck erweckte.
Je näher sie dem Ziel kamen, umso bedrückender wirkten die hohen Mauern auf Willow, der angespannt neben seinem Herrn ritt und stur nach vorne schaute. Die Häuser der Stadt hatten sie inzwischen passiert und immer noch keinen Menschen gesehen. Die Schreie aus den schmalen Gassen bewiesen aber, dass nicht alle Bürger tot oder geflohen waren.
Willow hoffte, dass sich die Söldner an seinen Befehl hielten und es nicht zu einem Blutbad kommen würde. Die allgegenwärtige Gefahr, sich an der todbringenden Seuche anzustecken, würde die Männer den Einheimischen gegenüber extrem vorsichtig agieren lassen. Da konnte schon ein falscher Blick dafür sorgen, dass die Schwerter oder Musketen zum Einsatz kamen.
***
Das Schloss fanden Monro und seine Männer bis auf ein paar wenige Bedienstete, die sofort Reißaus nahmen, als sie die Söldner sahen, leer vor. Die Offiziere meldeten dem Major später, dass auch die Stadt fast vollständig verlassen war. Lediglich ein paar Alte und Kranke hielten sich in den Häusern auf. Diese berichteten, dass etwa fünfzig Bürger Schivelbeins an der Pest gestorben waren. Die Restlichen seien geflohen.
Monro befahl seinen Männern, die Kompanien in der Stadt zu verteilen und dort Quartier zu nehmen. Dann legte er die Wacheinteilung fest und ließ Schloss und Stadtmauer besetzen. Erst als er sicher war, dass alles den von ihm gewünschten Gang nahm, machte er sich mit Willow auf den Weg, Schivelbein weiter zu inspizieren. Er wollte sich später nicht vorwerfen lassen, nicht alles für die Verteidigung der Stadt getan zu haben.
Die Schäden an der Stadtmauer stellten sich als deutlich größer heraus, als es der Major zunächst vermutet hatte. Steine waren herausgebrochen, und es gab vier größere Löcher, durch die man mühelos nach Schivelbein gelangen konnte. Einige Balken an den Wehrgängen waren zerbrochen, sodass die Bohlen wahrscheinlich herunterkrachen würden, wenn man sie betrat.
Monro wies Willow an, alle Schäden, die es zu beseitigen galt, schriftlich festzuhalten. Bereits nach wenigen Minuten war ihm klar, dass er diese Arbeiten nicht von seinen Soldaten verrichten lassen konnte. Daher schickte er Boten zu den Bauern der Umgebung und befahl ihnen, am nächsten Tag mit Schaufeln und Spaten in die Stadt zu kommen, um die Befestigungsanlagen instand zu setzen.
Als der Major ins Schloss zurückkehrte, wurde ihm der Amtmann, der sich bei der Ankunft der Schotten versteckt gehalten hatte, vorgeführt. Von ihm erfuhr Monro, dass die Stadt bis vor wenigen Stunden noch von zwei schwedischen Reiterabteilungen besetzt gewesen war. Als diese aber gehört hatten, dass sich der Feind bereits auf dem Weg nach Schivelbein befand, waren sie geflohen, um sich mit ihrem Generalleutnant Wolf Heinrich von Baudissin zu vereinigen.
»Wir werden das Schloss halten«, versicherte Monro dem Amtmann. »Wir dienen demselben Herrn wie die Schweden, sind aber nicht so feige wie sie. Holt die Dienerschaft zurück an die Arbeit und kümmert Euch um alle anfallenden Tätigkeiten im Schloss.«
Als am Abend die ersten Späher zurückkehrten und berichteten, dass die feindlichen Truppen nur noch drei Tage entfernt waren, wusste er, dass ihn Sir John Hepburn vor eine fast unlösbare Aufgabe gestellt hatte. Wer aber sollte dem kaiserlichen Angriff trotzen, wenn nicht seine schottischen Söldner?
***
»Feuer!«, schrie Monro und hielt sich die Ohren zu, um dem bevorstehenden Lärm zu entgehen.
Keine Sekunde später krachten die beiden Geschütze los und schickten ihre tödliche Ladung den kaiserlichen Truppen entgegen, die mit einem ganzen Heer auf Schivelbein zuströmten. Monro schätzte die Zahl der Angreifer auf etwa achttausend, was bedeutete, dass ihnen der Feind sechzehn zu eins überlegen war. Ein Kampf gegen diese Übermacht schien aussichtslos. Dennoch würde der Major ihn bis zum letzten Mann führen.
Während seine Männer die Geschütze nachluden, schaute Monro durch die sich langsam lichtenden Rauchschwaden zu der feindlichen Reiterei. Die Geschütze hatten zwei der Kaiserlichen von ihren Pferden gerissen. Der Rest des Heeres brachte sich hastig außer Reichweite und stellte sich in Schlachtordnung auf. Der gegnerische Kommandant wusste nun, dass er die Stadt nicht kampflos würde einnehmen können.
»Egal, was passiert, wir werden dem Feind standhalten«, rief der Major und bekam bestätigende Schreie zur Antwort. Er wusste, dass er sich voll auf seine Männer verlassen konnte. Jeder von ihnen würde bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.
Als sich die Kaiserlichen gesammelt hatten, schickten sie einen Trompeter auf die Mauern der Stadt zu.
»Nicht schießen«, befahl Monro.
»Wollt Ihr etwa verhandeln?«
»Nein, Willow. Ich will aber hören, was er zu sagen hat.« Innerlich war der Major keinesfalls so ruhig, wie er sich seinen Männern gegenüber gab. Der Angriff der Kaiserlichen hätte keine Stunde früher erfolgen dürfen. Die nötigsten Arbeiten waren getan. Dennoch war die Befestigung der Stadt nach wie vor in einem erbärmlichen Zustand.
Die Bauern aus der Umgebung waren seinem Aufruf gefolgt und nach Schivelbein gekommen. Als sie sahen, wie grausam die Pest dort gewütet hatte, wollten sie sofort umkehren. Erst als Monro ihnen gedroht hatte, jeden Flüchtenden auf der Stelle erschießen zu lassen, hatten sie mit der Arbeit begonnen.
In den vergangenen drei Tagen hatten sie Erdwälle ausgehoben, brusthohe Palisadenwälle errichtet und die Tore Schivelbeins mit Gerümpel blockiert. Eine längere Belagerung würde die Stadt kaum aushalten können. Sie war nun aber zumindest so weit gesichert, dass sie den Feind eine Zeit lang aufhalten konnten.
Monro dachte an den Befehl, den er vom Freiherr von Knyphausen erhalten hatte, und den er um jeden Preis befolgen wollte. Behauptet die Stadt, bis Ihr den Feind nicht mehr zurückdrängen könnt, aber gebt nicht das Schloss auf, solange auch nur ein einzelner Mann mit Euch ist.
»Der Graf von Montecuccoli bietet Euch ein Abkommen an«, rief der Trompeter dem Major auf der Brüstung zu. »Legt Eure Waffen nieder und übergebt uns die Stadt. Dann werden wir Euch in Frieden abziehen lassen.«
»Das Wort Abkommen kommt in meinen Befehlen nicht vor«, rief Monro zurück. »Richtet Eurem Grafen aus, dass wir genug Pulver und Blei haben, um ihm damit aufzuwarten.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, nahm der Major von Willow eine Muskete entgegen und schoss dem Trompeter eine Kugel vor die Füße, sodass der erschrocken zurückwich.
»Ihr werdet diese Entscheidung noch bitter bereuen und den Grafen um Gnade anflehen wie ein winselnder Hund. Ich denke nicht, dass er sie Euch dann noch gewähren wird.«
»Noch ein Wort und Ihr werdet keine Gelegenheit mehr haben, mit ihm zu sprechen.« Wieder legte der Major die Muskete auf den Trompeter an. Dieses Mal wartete er allerdings noch mit dem Schuss.
Der Bote drehte sich hastig um und rannte zurück zu seinem Befehlshaber. Die Männer um Monro herum brachen in schallendes Gelächter aus, und auch der Major konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Damit war das Vorgeplänkel beendet. Schon bald würde es zu einem Angriff der Kaiserlichen kommen.
Etwa einhundertfünfzig Musketiere rückten nun auf das Tor zu. Während Monro den Feuerbefehl an die Geschütze gab, beobachtete er aus den Augenwinkeln, dass der Feind weitere Angriffe an verschiedenen Punkten der Stadtbefestigung vorbereitete. Er selbst musste sich auf wenige Verteidigungspunkte konzentrieren und konnte den Feind nicht an allen Stellen abwehren. Die Entscheidung dieses Gefechts würde am Schloss fallen.
»Schießt die Kerle über den Haufen«, rief Monro, als das Getöse der Geschütze abgeklungen war, und richtete seine eigene Muskete gegen die Angreifer.
Der ersten Salve der Verteidiger hatten die Kaiserlichen nichts entgegenzusetzen. Mehr als dreißig von ihnen gingen getroffen zu Boden. Während die Schotten nun aber nachladen mussten, richteten sie ihre eigenen Waffen gegen die Tore der Stadt.
Inzwischen waren Monros Männern wieder schussbereit. Es gelang ihnen, aus der Deckung heraus weitere Feinde zur Strecke zu bringen. Dennoch konnten sie nicht verhindern, dass ein Großteil der Kaiserlichen das Tor stürmte und es regelrecht aus den Angeln riss.
»Zieht Euch in die Straßen zurück«, befahl Monro, dem bereits zu Beginn des Angriffs klar gewesen war, dass die Stadtmauer schnell fallen würde. Er hatte etwa die Hälfte seiner Männer in den Häusern verteilt, damit sie den Feind unter Beschuss nehmen konnten, wenn er das Tor passierte.
Die Schreie der Verwundeten mischten sich in das Getöse aus den Musketen. Überall roch es nach Rauch, Schwefel und Blut. Monro hatte den Männern in den Häusern befohlen, sich zum Schloss zurückzuziehen, sobald sie die erste Salve auf den Feind abgefeuert hatten. Der Rauch aus den Musketen sollte sie vor den Schüssen der Kaiserlichen schützen. Er selbst rannte mit den Söldnern, welche die Stadtmauer verteidigt hatten, nun ebenfalls in Richtung Schloss. Dort angekommen, bestieg er den Turm und musste mitansehen, wie die Kaiserlichen ihre Geschütze nach Schivelbein fuhren. Viele der Angreifer fielen unter den Schüssen der Verteidiger. Für jeden Soldaten, der von einer Kugel getroffen wurde, rückte aber ein neuer nach. Die Schotten konnten nicht verhindern, dass die Kanonen auf dem Markplatz in Stellung gebracht wurden.
Bevor Graf von Montecuccoli den Befehl gab, die Kanonen abzufeuern, schickte er erneut einen Trommler, um mit Monro zu verhandeln.
»Wir geben Euch noch einmal die Möglichkeit, das Schloss zu übergeben. Tut Ihr dies nicht, haben Eure Männer keine Gnade mehr zu erwarten.«
»Ich habe Euch bereits gesagt, dass es nicht meinem Befehl entspricht, mit dem Feind zu verhandeln«, antwortete Monro spöttisch. »Daran hat sich nichts geändert.«
»Dann ist Euer Schicksal hiermit besiegelt.«
»Das werden wir noch sehen«, sagte Monro zu seinen Männern, nachdem sich der Trompeter abgewandt hatte. »Setzt die Stadt in Flammen.«
Der Amtmann, der dem schottischen Offizier nachgeeilt war, als dieser den Turm hinaufgestürmt war, sah Monro entgeistert an, wagte es aber nicht zu widersprechen. Das Entsetzen in seinem Gesicht machte allerdings jedes Wort überflüssig.
Die Soldaten warfen gefüllte Töpfe mit brennendem Öl auf die Straße, schafften es aber nicht, diese bis zu den Häusern zu schleudern. Obwohl es seit Tagen nicht geregnet hatte, richteten sie damit keinen nennenswerten Schaden an. Ärgerlich musste Monro miterleben, wie die Flammen immer kleiner wurden und schließlich erloschen.
»Wenn uns nicht bald etwas einfällt, wird uns der Feind überrennen«, stellte Willow mit entsetztem Blick fest.
»Das wird nicht geschehen«, entgegnete Monro. Er rief einen der kräftigsten Söldner zu sich und gab ihm ein mit Stroh gefülltes Drahtgestell, das an einer Kette befestigt war, und entzündete es. Der Mann wartete, bis das Feuer die komplette Kugel umfasste, schleuderte sie ein paarmal durch die Luft und ließ sie auf eines der Dächer zufliegen.
Gebannt beobachteten die Schotten den Flug des Geschosses und schrien begeistert auf, als es auf dem Reetdach landete und sofort Feuer fing.
Durch den Herbstwind angefacht, breitete sich das Feuer schnell aus, und es dauerte nur wenige Augenblicke, bis auch das Nachbarhaus in Flammen stand.
Noch bevor die Kaiserlichen die erste Salve aus den Geschützen abgeben konnten, wurde ihnen die Lage im wahrsten Sinne des Wortes zu brenzlig. Zudem eröffneten die Schotten nun das Feuer aus ihren Musketen und töteten die Soldaten an den Kanonen.
Graf von Montecuccoli erkannte schnell, dass er den Verteidigern so nicht beikommen konnte und befahl seinen Männern den Rückzug.
Monro beobachtete zufrieden, wie die Kaiserlichen vom Schloss abrückten und sich in sicherer Entfernung zwischen den Häusern verschanzten. Ihm und seinen Männern war das unmöglich Erscheinende gelungen.
***
»Ihr wollt tatsächlich einen Ausfall wagen?« Willow sah seinen Major an, als hätte der ihm gerade gesagt, er wolle zur Küste laufen und nach Schottland zurückschwimmen.
»Damit wird dieser Graf am wenigsten rechnen«, antwortete Monro lächelnd. »Die Überraschung liegt auf unserer Seite. Wir müssen die Kaiserlichen aus Schivelbein vertreiben. Nur so können wir einen erneuten Angriff auf das Schloss verhindern.«
»Muss es aber unbedingt sein, dass Ihr den Ausfall selbst anführt?«
»Ja, Willow, wie könnte ich dies von meinen Männern verlangen, während ich mich feige in der Sicherheit des Schlosses versteckt halte. Ich verstehe deine Zweifel, junger Freund. Sei aber unbesorgt. Noch bevor die Sonne aufgeht, werde ich zurück sein.«
»Und wenn nicht?«
»Dann bleibt euch nur noch das Gebet.«
Major Monro baute darauf, dass zu dieser frühen Morgenstunde die meisten der Kaiserlichen noch schliefen. Immerhin hatten sie nicht nur die Gefechte des Vortages in den Knochen, sondern auch den langen Marsch, der sie nach Schivelbein geführt hatte. Der Feind würde immer stärker werden, je länger die Belagerung andauerte.
Für seine Mission hatte der Major achtzig Musketiere ausgewählt und ihnen eingebläut, dass sie sich so lange wie möglich ruhig verhalten mussten. Erst wenn die Kaiserlichen auf sie aufmerksam wurden, wollte er das Feuer eröffnen.
Monro führte seine Truppe zwischen den noch immer schwelenden Trümmern der Häuser in der Nähe des Schlosses vorbei. Von der Ruhe, die sich wie eine Glocke über die Stadt gelegt hatte, ließ er sich nicht täuschen. Auch wenn der Feind müde war, hatten die Soldaten sicher Wachen aufgestellt, die das Schloss beobachteten.
Im Schatten der noch stehenden Häuser gelangten die Schotten schließlich in die Nähe der Stadtmauer. Plötzlich kam ein Kaiserlicher um die Ecke und starrte die Söldner überrascht an. Monro reagierte augenblicklich und stieß dem Mann seinen Dolch in den Hals. Der Warnschrei des Feindes ging in einem Gurgeln unter. Der Major fing den Toten auf und legte ihn langsam auf dem Boden ab.
»Leise«, wies Monro seine Männer an und lauschte auf Geräusche aus dem gegnerischen Lager. Als es nach fünfzehn Minuten noch immer ruhig blieb, erlaubte er es sich, kurz durchzuatmen. Dann führte er seine Einheit weiter.
Sie erreichten den Platz vor dem Stadttor und sahen die feindlichen Soldaten, die um mehrere Feuer herum auf dem Boden lagen. Plötzlich blies ein Trompeter ein Warnsignal.
»Schießt auf alles, was sich bewegt«, befahl Monro, ohne zu zögern. »Sobald die Musketen leer sind, ziehen wir uns zurück.«
Sekunden später krachten die Waffen und spien ihre tödliche Ladung gegen den Feind. Schreie erklangen, und diejenigen, die nicht von den Kugeln getroffen worden waren, liefen aufgeregt durcheinander.
»Zurück«, schrie Monro, nachdem die Söldner einen zweiten Schuss abgefeuert hatten.
Die Männer eilten in Richtung Schloss und liefen in eine Gruppe Kroaten hinein, die sich hinter ihrem Rücken in den Häusern verschanzt hatte. Weil die Männer ihre Musketen nicht hatten nachladen können, mussten sie den Kampf mit Messern und Schwertern führen. Ihre Übermacht war aber groß genug, um den Feind schnell zu überwinden und gefangen zu nehmen. Monro sprach im Geist ein kurzes Dankgebet, als er seine Einheit zurück hinter die Mauern des Schlosses führte, wo sie in Sicherheit waren. Der Ausfall hatte nicht länger als eine halbe Stunde gedauert und keinem schottischen Söldner das Leben gekostet.
Monros Hoffnung, Graf von Montecuccoli würde Schivelbein nun verlassen, erfüllte sich etwa zwei Stunden später. Der Offizier im Dienst des Kaisers schien eingesehen zu haben, dass ihn die Einnahme der Stadt zu hohe Verluste einbringen würde und zog sich mit seinen Truppen zurück. Monro bestimmte achtzehn seiner besten Dragoner und befahl ihnen, den Feind zu verfolgen und ihm Kunde darüber zu bringen, welchen Weg sie verfolgten.
***
»Bleibt dicht zusammen und schützt Euch gegenseitig«, zischte Sir John Hepburn seinen Männern zu. Er richtete seine Muskete in die neblige Nacht, konnte aber keinen der Feinde ausmachen. Dennoch war sich der Oberst sicher, dass sie in der Nähe lauerten und nur darauf warteten, seine Einheit zusammenzuschießen.
Kundschafter hatten dem Freiherr zu Knyphausen berichtet, dass ein Heer von etwa siebentausend Kaiserlichen in das noch immer belagerte Kolberg unterwegs war, um die dort Eingeschlossenen zu unterstützen. Die Zusammenkunft der beiden feindlichen Einheiten wollte der Heerführer unbedingt verhindern. Aus diesem Grund hatte er Sir Hepburn von Rügenwalde abkommandiert und ihm befohlen, den Feind aufzuhalten.
Neben den schottischen Kompanien hatte sich auch Graf von Thurn mit rund viertausend schwedischen Söldnern den Kaiserlichen entgegengestellt. Zum Ärger des schottischen Obersts hatte der Böhme aber die Flucht ergriffen, noch bevor der erste Schuss gefallen war. In einer kleinen Ortschaft, deren Namen Sir Hepburn nicht kannte, war es nun zum Gefecht mit den Kaiserlichen gekommen.
Die fünfte Stunde des Tages war gerade angebrochen, als die ersten Feinde aufeinandertrafen. Wegen der schlechten Sicht bestand die Gefahr, dass die schottischen Musketiere ihre eigenen Kameraden trafen, die ähnliche Waffen und Rüstungen trugen wie die Kaiserlichen. Viele erhoben ihre Musketen deshalb als Keulen und prügelten damit auf die Feinde ein, die sich mit waagerecht gehaltenen Piken verteidigten.
Plötzlich tauchte einer der Kaiserlichen direkt vor Sir Hepburn auf. Zum Glück des Obersts war sein Feind genauso überrascht wie er selbst und schaffte es nicht mehr, mit seiner Waffe nach dem Schotten zu schlagen. Der feuerte blitzschnell seine Pistole ab. Die Kugel traf den Kaiserlichen oberhalb der Nase und schleuderte ihn nach hinten. Während der Körper langsam zu Boden ging, zog sich Sir Hepburn ein paar Schritte zurück. Wo einer dieser Kerle auftauchte, konnten genauso gut mehrere von ihnen lauern.
Der Oberst suchte nach einem seiner Männer, der bis vor wenigen Augenblicken noch neben ihm gestanden hatte, konnte aber im immer stärker werdenden Dunst nichts erkennen. In diesem Moment krachte es hinter ihm auf. Sekunden später hörte Sir Hepburn den Einschlag des Geschosses in eine Mauer. Er schaffte es gerade noch rechtzeitig, sich abzuducken, bevor die Trümmerteile über ihn hinwegflogen.
»Rückzug!«, schrie Sir Hepburn in die Dunkelheit und richtete alle seine Sinne darauf, seinen genauen Standort festzustellen. Es würde seinen sicheren Tod bedeuten, wenn er sich jetzt in die falsche Richtung bewegte. Endlich sah der Oberst vor sich drei seiner Männer, die ihn mit vorgestreckten Musketen erwarteten und erleichtert ihre Waffen senkten, als sie ihn erkannten.
»Wo ist der Trommler?« Die Söldner schüttelten nur den Kopf, und Sir Hepburn befahl ihnen, ihm zu folgen. Sie erreichten die Trümmer eines zerschossenen Hauses, dessen Ruine fest in schottischer Hand war. Der Oberst erlaubte sich aber keine Sekunde der Unsicherheit, bis er mit seiner Einheit die Straße nach Kolberg erreichte. Mittlerweile hatte sich der Großteil seines Regimentes dort versammelt. Er befahl ihnen, Stellung zu beziehen, und keinen einzigen ihrer Feinde durchzulassen.
Auch die kaiserlichen Offiziere schienen nun eingesehen zu haben, dass ein weiterer Versuch, Kolberg zu erreichen, bei diesen Sichtverhältnissen nicht gelingen konnte. Es wurde ruhiger und als am Morgen die Sonne aufging und der Nebel die Sicht auf die Leichen freigab, hatte sich der Feind aus dem Staub gemacht.
Sir Hepburn war geschockt, als er sah, wie viele seiner Männer gefallen waren. Der Rückzug des Grafen von Thurn hatte das Kräfteverhältnis zugunsten der Kaiserlichen verändert. Er nahm sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt ein ernstes Wort mit dem Offizier zu wechseln.
***
Als die Dragoner zu Monro nach Schivelbein zurückkehrten, führten sie zwei Gefangene mit sich, denen die Hände auf dem Rücken gefesselt waren. Im Schloss wurden die Späher vom Major bereits sehnsüchtig erwartet. Die Schotten hatten in der Nacht die Schüsse aus Musketen und Kanonen gehört und dafür gebetet, dass es ihre eigenen Kameraden sein würden, die siegreich aus der Schlacht hervorgingen.
»Was ist mit den beiden?«, fragte Monro und deutete auf die Gefangenen.
»Sie stammen aus dem Regiment von Graf von Baudissin und wurden vom Grafen von Thurn befehligt«, erklärte der führende Offizier der Dragoner. »Wir haben sie unterwegs aufgegriffen. Sie behaupten, dass das schwedische Heer geschlagen und aufgerieben worden sei.«
»Könnt Ihr das bestätigen?«, fragte Monro.
»Nein«, entgegnete der Offizier. »Die Schlacht fand kurz vor Kolberg statt. Als der Feind plötzlich auf uns zukam, sind wir im Galopp hierher zurückgekehrt, um Euch zu warnen.«
»Ich verstehe«, sagte Monro und runzelte nachdenklich die Stirn. »Sperrt die beiden ein. Wir kümmern uns später um sie.« Der Major vermutete, dass die Männer fahnenflüchtig waren und sich nun mit einer Lüge vor dem Galgen bewahren wollten. Jetzt war aber nicht der richtige Zeitpunkt, um über das weitere Schicksal der beiden Söldner zu befinden.
Wenn Graf von Montecuccoli und seine Truppen tatsächlich nach einem Sieg gegen die Schweden auf dem Rückweg nach Schivelbein waren, um den Feind endgültig zu vertreiben, würde er dieses Mal nicht eher aufgeben, bis er die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatte.
Zu Monros Überraschung berichteten die Späher aber kurze Zeit später, dass die Kaiserlichen mehr als einen Kilometer von ihnen entfernt an der Stadt vorbeigezogen und keinerlei Anzeichen für einen Angriff zu erkennen waren.
Am nächsten Tag kam ein Bote von Feldmarschall Horn, der Monro mitteilte, dass König Gustav Adolf seine Truppen in Stettin sammelte.
Als der Major den schottischen Söldnern berichtete, dass sie sich nun mit den anderen Einheiten sammeln und ins Winterquartier ziehen würden, war die Erleichterung groß. Monro ließ die beiden Fahnenflüchtigen in Ketten legen und führte seine Truppen in Richtung Greifenhagen, wo er sich mit Feldmarschall Horn treffen sollte.
Friedland, 12. Januar 1631
»Da bist du ja.«
Albrecht von Wallenstein fuhr hoch, rammte mit dem Knie die Unterseite seiner Schreibtischplatte und stieß einen schmerzerfüllten Fluch aus. Er drehte sich um und sah seine Gemahlin direkt neben dem Stuhl stehen. Er hatte nicht bemerkt, wie sie in den Raum gekommen war.
»Was soll das?«, schrie er auf, schaffte es aber im letzten Moment, sich einen zornigen Fluch zu verkneifen. »Warum erschreckst du mich so?«
»Ich habe dich überall gesucht. Hast du mich nicht gehört?«
»Das habe ich tatsächlich nicht«, gab von Wallenstein zu. Er stand auf und umarmte Isabella liebevoll. »Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht anschreien. Ich habe mich nur erschreckt.«
»Was hast du denn hier drin gemacht?« Isabella schaute sich neugierig im Raum um. Es kam nicht oft vor, dass sie ihren Gemahl hier aufsuchte.
»Im Grunde genommen gar nichts.« Von Wallenstein wollte nicht zugeben, dass er tatsächlich nicht sagen konnte, womit er gerade beschäftigt gewesen war. In den vergangenen Tagen hatte er sich immer wieder dabei ertappt, dass er einfach nur dasaß und ins Leere starrte. Isabella sollte sich nicht unnötig um ihn sorgen. Deshalb wich er dem Thema aus, indem er seine Gemahlin fragte, warum sie überhaupt zu ihm gekommen war.
»Wir wollten den sonnigen Wintertag nutzen und gemeinsam einen Spaziergang machen. Das hast du hoffentlich nicht vergessen.«
»Natürlich habe ich das nicht«, sagte von Wallenstein schnell, als er den vorwurfsvollen Unterton in Isabellas Stimme erkannte. Er wollte sie nicht verärgern und griff nach seinem Mantel. »Du kommst gerade zur rechten Zeit. Etwas frische Luft kann jetzt nicht schaden.«
Isabella schaute ihren Gemahl verwundert an, sagte aber nichts. Die beiden verließen das Arbeitszimmer, gingen durch den breiten Flur und die Treppe nach unten und verließen das Schloss.
»Es ist wirklich ein sehr schöner Tag«, sagte Isabella glücklich und schirmte mit der Hand die Augen gegen die Sonnenstrahlen ab. »Es wäre eine Schande, hättest du ihn komplett an deinem Schreibtisch verbracht.«
»Da hast du recht, meine Liebe.«
Tatsächlich merkte von Wallenstein, wie gut ihm die kalte Luft tat. Der Anblick, der sich ihm bot, war überwältigend. Vor ihnen lagen die schneebedeckten Felder, und in der Ferne konnte er die Wälder sehen. Auch die Pferde auf der Weide schienen die Sonne zu genießen. Er nahm sich vor, ab jetzt täglich Spaziergänge mit Isabella zu unternehmen, wusste aber im selben Moment, dass er dies nicht tun würde. Auch heute hatte ihn seine Gemahlin lange dazu überreden müssen.
»Du solltest dir wirklich mehr Ruhe gönnen«, sagte Isabella vorwurfsvoll und hakte sich mit dem Arm am Ellenbogen ihres Gemahls ein. »Was treibst du denn den ganzen Tag in deiner Kammer?«
»Ich habe viel mit der Verwaltung der Güter zu tun«, sagte von Wallenstein ausweichend. Isabella hatte sich bisher nie um seine Geschäfte gekümmert, und dem Herzog von Friedland war es mehr als recht, wenn das auch so blieb. Sie sollte sich um das Personal kümmern und die wichtigen Dinge ihm überlassen.
In Wahrheit hatte der ehemalige Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee im Augenblick mehr Zeit, als er es sich gewünscht hätte. Er war es gewohnt, immer alle Hände voll zu tun zu haben, und der Müßiggang machte ihm zu schaffen. Es fiel ihm schwer, sich mit der für ihn neuen Situation abzufinden, die seine Entlassung aus der kaiserlichen Armee ihm gebracht hatte.
Als der Krieg vor einer gefühlten Ewigkeit damit begonnen hatte, dass die Protestanten in Prag zwei kaiserliche Statthalter und ihren Sekretär aus dem Fenster geworfen hatten, war von Wallenstein bereits in Diensten des Kaisers tätig gewesen.
Im Laufe der Jahre hatte er seinen Einfluss stetig erhöht und sich für Ferdinand II. zu einem unverzichtbaren Partner gemacht. Nachdem die Revolte mit der Schlacht am Weißen Berg niedergeschlagen worden war, hatte von Wallenstein weiter gegen die Feinde des Habsburgers gekämpft und sie besiegt. Weder Graf von Mansfeld noch dem tollen Halberstädter war es gelungen, sich gegen die übermächtige kaiserliche Armee unter von Wallenstein durchzusetzen. Auch der dänische König Christian IV. hatte klein beigeben müssen.
Ferdinand II. hatte schließlich tief in der Schuld von Albrecht von Wallenstein gestanden und ihn zum Ausgleich zum Herzog von Friedland ernannt. Später war er vom Kaiser sogar mit Mecklenburg belehnt worden. Seine Ansprüche auf dieses Gebiet konnte er jetzt aber nicht mehr durchsetzen.
In den Tagen und Wochen nach seiner Entlassung hatte er sich mit der Frage das Hirn zermartert, woran er gescheitert sein könnte. Schließlich war er zu der Erkenntnis gelangt, dass nicht er einen Fehler begangen hatte. Er war seinen Neidern zu mächtig geworden, und ihre Missgunst war in Hass umgeschlagen. Daraufhin forderten sie vom Kaiser seine Entlassung. Ferdinand II. hatte nicht die Macht besessen, sich gegen dieses Begehren aufzulehnen und letztlich nachgegeben.
»Du siehst krank aus«, bohrte Isabella weiter. »Du solltest die Zeit nutzen, um dich zu erholen. Seit du nach Gitschin zurückgekehrt bist, sehe ich dich kaum. Du bist bei mir und doch wieder nicht. Selbst als du noch im Dienst des Kaisers warst, hast du mir mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wenn wir uns am gleichen Ort befanden.«
»Jetzt übertreibst du, meine Liebe.« Von Wallenstein merkte, dass es ihm nicht gelingen würde, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Wenn Isabella etwas loswerden wollte, konnte sie nichts und niemand davon abbringen. Wenn er sich selbst gegenüber ehrlich war, hatte sie noch nicht einmal Unrecht. Zugeben wollte er das aber nicht.
»Nein. Das tue ich nicht.«
»Was quält dich so sehr? Ist es der Zorn auf den Kaiser?«
»Warum sollte ich zornig auf Ferdinand II. sein?«, fragte von Wallenstein ehrlich verblüfft.
»Vielleicht, weil er dich entlassen hat.«
»Nein, Isabella. Natürlich hat der Kaiser das Schreiben unterzeichnet. Ich weiß aber sehr wohl, wem ich die Absetzung zu verdanken habe. Es waren die katholischen Kurfürsten, die Ferdinand II. zu diesem Schritt zwangen. Sie haben schon immer ihr eigenes Süppchen gekocht und versuchen, ihre Stellung im Reich zu festigen. Herzog Maximilian von Bayern ist der Schlimmste von Ihnen. Er versucht insgeheim, die deutschen Fürsten zu einen und sich von den Habsburgern abzuspalten. Die katholische Liga will die alleinige Befehlsgewalt über die Truppen. Nachdem Ferdinand II. Johann von Tilly jetzt zum General über sein Heer erklärt hat, ist es Maximilian von Bayern gelungen, dieses Ziel zu erreichen.«
»Das verstehe ich nicht«, warf Isabella ein. »Es sind doch immer noch die Truppen des Kaisers.«
»Das mag sein«, gab von Wallenstein zu. »General von Tilly wird aber nichts unternehmen, was seinem eigentlichen Herrn, dem Herzog von Bayern, schaden könnte. Schon gar nicht, ohne ihn vorher zu informieren.«
»Haben die Fürsten denn solch eine Macht?«
»Glaub mir, meine Liebe. Ferdinand II. trifft keine Schuld. Er wurde zu dieser Entscheidung gedrängt. Und genau wie alle anderen wird er sie noch bereuen.«
Für einen Moment war von Wallenstein erstaunt über seine eigenen Worte. Er war es nicht gewohnt, seine Gedanken so frei aussprechen zu können. Jetzt war er mit Isabella alleine. Seine Gemahlin verstand zwar nicht viel von Politik, sie würde ihn aber niemals verraten. Ganz egal, was er auch zu tun gedachte. Plötzlich fand es von Wallenstein mehr als befreiend, so ungezwungen mit Isabella reden zu können und er dachte wieder daran, in Zukunft möglichst oft Spaziergänge mit ihr zu unternehmen.
»Also denkst du doch an Rache?« Isabella blieb stehen und schaute ihren Gemahl herausfordernd an. Der begann schallend zu lachen.
»Ich habe nicht die Absicht, mich am Kaiser für irgendetwas zu rächen. Ich werfe ihm nichts vor. Und selbst wenn, müsste ich nichts weiter tun, als abzuwarten. Glaube mir, meine Liebe, Gustav Adolf von Schweden wird Ferdinand II. und den katholischen Fürsten mehr zusetzen, als ich es je könnte.«
»Hat er denn eine so große Armee?«
»Noch nicht, er wird sie aber bekommen. Wenn Ferdinand II. sich nicht bald zu einem Frieden mit den protestantischen Fürsten entschließt – und das kann er nicht – werden sie sich früher oder später mit dem schwedischen König verbünden. Es wird ein Heer entstehen, gegen das selbst der große Graf Johann von Tilly machtlos ist. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Kaiser bei mir angekrochen kommt und mich um meine Hilfe anfleht.«
»Glaubst du wirklich, dass dies alles geschehen wird?« Isabella sah ihn unsicher an.
»Ich bin felsenfest davon überzeugt.«
Wien, 16. Januar 1631
Eintrag in die kaiserliche Chronik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation:
Nach den Ereignissen beim Kurfürstentag in Regensburg zeigte sich Kaiser Ferdinand II. nicht bereit, gegenüber den katholischen Kurfürsten Zugeständnisse zu machen, die über die bisherigen hinausgehen und lehnte weitere Treffen ab. Den Jahreswechsel verbrachte er zurückgezogen mit seiner Familie und derJagd.
Die Befürchtungen, dass Albrecht von Wallenstein nach seiner Entlassung einen Rachefeldzug gegen den Kaiser und vor allem Maximilian von Bayern führen würde, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Der Herzog von Friedland hat sich auf seine Güter in Gitschin zurückgezogen und scheint sich dort von den vergangenen Schlachten und der erlittenen Schmach zu erholen.
Unterdessen setzt König Gustav Adolf von Schweden seinen Eroberungszug in Mecklenburg fort und bringt dabei großes Leid über das Land. Die mächtigen Fürsten aus Sachsen und Brandenburg lehnen ein Bündnis mit dem selbsternannten Befreier der Protestanten ab und halten dem Kaiser ihreTreue.
Herzog Franz Karl von Sachsen-Lauenburg hat seine Truppen an der Elbe versammelt, um sich mit den Schweden zu verbünden, konnte aber von Feldmarschall Gottfried Heinrich zu Pappenheim besiegt und gefangen genommenwerden.
Anton Serger legte die Feder zur Seite und gönnte sich zufrieden einen Schluck Wein. Er saß am Schreibtisch in seiner geliebten Bibliothek und hoffte, dass er den Kaiserhof in Wien nicht so schnell wieder würde verlassen müssen. Es war erst wenige Wochen her, dass er mit Ferdinand II. und dessen Gefolge vom Kurfürstentag in Regensburg zurückgekehrt war. In der Ruhe dieser Räume fühlte er sich wesentlich wohler als in dem Trubel, dem er in Bayern ausgesetzt gewesen war.
Während seiner mehrmonatigen Abwesenheit hatte sich in der Bibliothek einiges an Schriftrollen und Büchern angesammelt, die nun sortiert und katalogisiert werden mussten. Anton freute sich auf diese Arbeit und hoffte, dass er sie ohne große Störungen erledigen konnte.
Kaiser Ferdinand II. hatte in Regensburg ein Debakel erlebt und keines seiner Ziele verwirklichen können. Er war von den Reichsfürsten gezwungen worden, seinen obersten Heerführer General Albrecht von Wallenstein des Amtes zu entheben. Gleichzeitig hatte er auf seine Ansprüche in der Erbfolge für das Herzogtum Mantua in Italien verzichten müssen. Auch der Plan, seinen Sohn Ferdinand III. zum römischen König krönen zu lassen und ihn damit praktisch vorzeitig zu seinem Nachfolger zu machen, war fehlgeschlagen.
Die Bedrohung aus Schweden war von den Fürsten in Regensburg noch unterschätzt worden. Sie hatten die Landung Gustav Adolfs auf Usedom zwar zur Kenntnis genommen, sich aber nicht weiter damit befasst. Anton befürchtete, dass sie diesen Fehler noch bitter bereuen würden. Auch nach der Rückkehr nach Wien hatte Ferdinand II. nichts von der Gefahr in Pommern hören wollen. Sollten sich doch die Fürsten selbst darum kümmern.
Der Kaiser erledigte nur die allernotwendigsten Regierungsgeschäfte und ging ansonsten viel auf die Jagd oder unternahm kurze Reisen mit seiner Gemahlin. Seinem Schreiber war das mehr als recht.
Plötzlich stieß Prinz, der wie immer, wenn er mit Anton alleine in der Bibliothek war, unter dem Schreibtisch seines Herrn lag, ein freudiges Bellen aus. Dann sprang er auf und rannte auf die Tür zu, die in diesem Moment geöffnet wurde. Der kaiserliche Schreiber brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, wer gekommen war. Dies hatte er bereits an der Reaktion des Schäferhundes erkannt.
»Ich habe hier etwas, dass du dir unbedingt ansehen musst«, rief Peter Heinlein seinem Meister und Freund bereits von der Tür aus zu. »Die Schweden behaupten von sich selbst, dass sie ihre protestantischen Freunde vom Einfluss des Kaisers befreien wollen. Sie haben Flugschriften gedruckt, die sie überall im Reich verteilen.«
»Zieh erst einmal den nassen Mantel aus und setz dich hin«, antwortete Anton, als sein Helfer triefend nass vor ihm stand und mit zusammengebundenen Blättern vor dem Gesicht herumfuchtelte. »Und gib mir das.«
Der kaiserliche Schreiber konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Peter war zwar nicht mehr der unbekümmerte junge Mann, den Anton in der Wiener Universität kennengelernt hatte; wenn er aber in Rage war, erinnerte er ihn doch wieder an diese Zeit.
Damals hatte Anton an der Universität unterrichtet. Peter war einer seiner Studenten gewesen und hatte ihn angefleht, ihm eine Arbeit in der Bibliothek zu geben. Nach langem Hin und Her hatte Anton schließlich zugestimmt und dies seither nicht bereut. Er war seinem Helfer dankbar, dass er ihm mit Prinz einen treuen Begleiter gebracht hatte, auch wenn er den Hund zunächst nicht hatte haben wollte.
Für den jungen Heinlein war es dagegen nicht immer nach dessen Vorstellungen gelaufen. Im Auftrag des Kaisers hatte Anton Peter zu General von Wallenstein geschickt, damit der den Feldherrn als Berichterstatter begleitete. Diese Zeit hatte den jungen Studenten aus Wien geprägt. Mehr als einmal war er selbst nur knapp mit dem Leben davongekommen. Nach der Entlassung Wallensteins war Peter dann mit seiner Frau nach Regensburg und später mit Anton zurück nach Wien gereist.
»Woher hast du das?«, fragte Anton und schaute sich die Flugschrift neugierig an.
»Ein Bote Tillys brachte es aus Mecklenburg mit.«
»Schwedisches Kriegsmanifest«, las Anton laut und schüttelte den Kopf. »Der Wasserkönig rechtfertigt also seinen Überfall auf das Reich. Behauptet er, dass er lediglich seinen Glaubensbrüdern zu Hilfe kommt?«
»Nicht nur«, antwortete Peter lachend. »Aber lies selbst. So wie Gustav Adolf es ausdrückt, wurde er vom Kaiser zu seinem Handeln gezwungen.«
»Wer soll ihm das glauben?«
»Ein Großteil der protestantischen Bevölkerung im Reich.«
»Unsinn.« Neugierig schlug Anton die Schrift auf und begann, darin zu lesen.
Es ist ein altes Sprichwort, dass niemand länger Frieden haben könne, als seinem Nachbar es beliebe oder gefalle: Wie wahrhaftig ein solches Sprichwort ist, hat die Königliche Majestät in Schweden in vergangenen Jahren erfahren und erfährt es noch täglich. Denn obwohl sie sich emsig und beflissen bemüht hat, während ihrer königlichen Regierung mit ihren Nachbarn Freundschaft und Frieden zu erhalten, hat sie doch nicht verhindern können, dass entsetzlich gemeine Friedenshasser ihr nachstellten, nachdem dieselben fast das ganze Heilige Römische Reich mit Mord und Brand verwüstethaben.