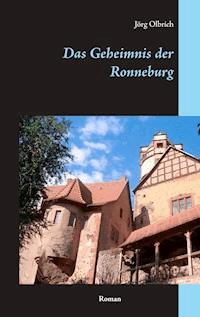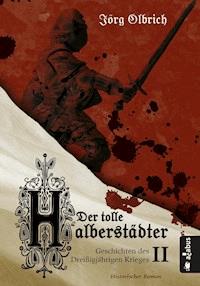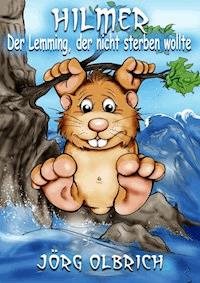Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geschichten des Dreißigjährigen Krieges
- Sprache: Deutsch
Der Dreißigjährige Krieg wütet in Europa. Nach Jahren des Kampfes sehnt sich Albrecht von Wallenstein nach Frieden. Doch während er Verhandlungen mit den Protestanten führt, entspinnt sich am Kaiserhof in Wien ein gefährliches Komplott gegen ihn. In Schweden bilden sich neue Allianzen und Intrigen nach dem Tod König Gustav Adolfs. Während sich die Heere neu formieren, versucht der Söldner Peter Hagendorf der schwedischen Gefangenschaft zu entkommen. Kann es ihm gelingen zu seiner Einheit zurückzukehren oder muss er für immer an der Seite des Feindes kämpfen? Verwüstung, Hungersnöte, Armut und Pest kosteten zwischen 1618 und 1648 rund sechs Millionen Menschen das Leben. Die Romanreihe "Geschichten des Dreißigjährigen Krieges" überzeugt mit historischen Fakten und einer spannungsgeladenen Entwicklung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Olbrich
Das Schicksal Wallensteins
Geschichten des Dreißigjährigen Krieges
Band 6
Roman
Inhalt
Mainz, 22. November 1632
Prag, 03. Dezember 1632
Ammersee, 9. Dezember 1632
Wien, 10. Dezember 1632
Ammersee, 30. Januar 1633
Prag, 14. Februar 1633
Mainz, 16. Februar 1633
Heilbronn, 18. März 1633
Ammersee, 31. März 1633
Regensburg, 10. April 1633
Prag, 14. April 1633
Ammersee, 14. April 1633
Landsberg, 19. April 1633
Bayern, 25. April 1633
Bodensee, 28. April 1633
Wien, 30. April 1633
Bodensee, 3. Mai 1633
Gitschin, 16. Mai 1633
Bayern, 17. Mai 1633
Bodensee, 24. Mai 1633
Ammersee, 13. Juni 1633
Bodensee, 17. Juni 1633
Frankfurt, 23. Juni 1633
Schlesien, 28. Juni 1633
Wien, 29. Juli 1633
Ammersee, 1. August 1633
Schlesien, 16. August 1633
Bodensee, 12. September 1633
Mainz, 18. September 1633
Schlesien, 24. September 1633
Bayern, 3. Oktober 1633
Bodensee, 5. Oktober 1633
Schlesien, 11. Oktober 1633
Bayern, 25. Oktober 1633
Wien, 28. Oktober 1633
Regensburg, 8. November 1633
Bayern, 3. Dezember 1633
Bayern, 5. Dezember 1633
Wien, 9. Dezember 1633
Pilsen, 15. Dezember 1633
Prag, 17. Dezember 1633
Ammersee, 20. Dezember 1633
Bodensee, 11. Januar 1634
Pilsen, 11. Januar 1634
Ammersee, 12. Januar 1634
Wien, 24. Januar 1634
Pilsen, 18. Februar 1634
Frankfurt, 19. Februar 1634
Böhmen, 20. Februar 1634
Regensburg, 25. Februar 1634
Böhmen, 27. Februar 1634
Wien, 3. März 1634
Niederösterreich, 18.03.1634
Ammersee, 4. Mai 1634
Franken, 14. Mai 1634
Wien, 17. Juni 1634
Ammersee, 28. Juni 1634
Landshut, 22. Juli 1634
Ammersee, 2. August 1634
Wien, 3. August 1634
Frankfurt, 8. August 1634
Ammersee, 17. August 1634
Nördlingen, 25. August 1634
Ammersee, 6. September 1634
Württemberg, 19. November 1634
Wien, 2. März 1635
Frankfurt, 2. April 1635
Wien, 5. Juni 1635
Historische Anmerkung
Historische Eckdaten
Personenregister
Der Autor
Olbrich, Jörg: Das Schicksal Wallensteins. Geschichten des Dreißigjährigen Krieges 6. Hamburg, acabus Verlag 2023
1. Auflage
ISBN: 978-3-86282-864-7
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich und kann über den
Handel oder den Verlag bezogen werden.
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-846-3
Lektorat: Angellika Bünzel
Korrektorat: Amandara M. Schulzke, acabus Verlag
Satz: Enrico Frehse, Phantasmal-Image
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: Soldat: © tin soldier crusader isolated on white, vitaly tiagunov, adobe-stock.com; Leinentuch: © https://pixabay.com/de/weiß-stoff-vorhang-transparenz-2130332/
Karte: © Annelie Lamers
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2023
Alle Rechte vorbehalten.
www.acabus-verlag.de
Gedruckt in Deutschland
Mainz, 22. November 1632
Axel Oxenstierna riss das Fenster auf, streckte den Kopf ins Freie und zog die eiskalte Winterluft gierig in seine Lungen. Das Gefühl zu ersticken blieb. Er öffnete den Kragen seines Hemdes. Dann zwang er sich ruhig durchzuatmen.
Der Regen hatte seine wenigen Haare mittlerweile durchnässt. Dicke Wassertropfen liefen durch sein Gesicht. Der Reichskanzler bemerkte es nicht.
Die Kälte zwang ihn schließlich, das Fenster in seinem Amtszimmer im Rathaus von Mainz zu schließen. Er setzte sich an seinem Schreibtisch und nahm einen Weinkrug zur Hand. Beim Auffüllen seines Bechers lief mehr als die Hälfte daneben.
Die rote Flüssigkeit ließ auf den Brief, den Oxenstierna vor einigen Augenblicken gelesen hatte und vermischte sich dort mit dem Wasser, das von seiner Stirn tropfte.
Zitternd starrte der Reichskanzler auf das Schreiben des Herzogs von Sachsen-Weimar, das ihn überhaupt erst in diesen Zustand versetzt hatte.
Es erfüllt mich mit allergrößter Traurigkeit und tut mir in der Seele weh, Euch mitteilen zu müssen, dass Gott der Allmächtige unseren großen König und heldenmutigen Anführer Gustav Adolf von Schweden in einer Schlacht in der Nähe von Leipzig zu sich gerufen hat.
Seine Majestät geriet im dichten Nebel in ein Scharmützel und wurde feige von einem Gottlosen erschossen, der aus dem Nichts vor unserem König und seinem Gefolge auftauchte. Nach dieser schändlichen Tat haben unsere tapferen Soldaten nicht eher geruht, bis sie den Feind vom Schlachtfeld in Lützen vertrieben und in die Flucht geschlagen haben.
Jetzt sind die Männer vor größter Bekümmernis und Schmerz erstarrt. Die Trauer ist grenzenlos und lähmt unsere Gedanken.
Der Leichnam seiner geliebten Majestät wird für seine letzte Reise in die Heimat vorbereitet. Das Heer ist in guter Ordnung und sammelt seine Kraft. Ich ersuche Euch jedoch dringend, in größter Eile zu uns zu kommen und uns beizustehen.
Euer untertänigster Diener
Bernhard von Sachsen-Weimar
Ein Klopfen an der Tür riss den Reichskanzler aus seiner Lethargie.
»Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will?«, fragte er ärgerlich, als eine Magd vorsichtig eintrat.
»Der König von Böhmen muss Euch dringend sprechen.«
»Der König von Böhmen sitzt in Wien«, entgegnete der Reichskanzler zornig.
»Ich verstehe nicht.«
»Schon gut. Richtet ihm aus, dass ich gleich bei ihm bin.« Oxenstierna rief sich zur Vernunft. Die Magd konnte nichts dafür, dass er den Winterkönig nicht sprechen wollte. Allein schon der Gedanke an den verweichlichten Adeligen, der nur Forderungen stellte und bisher keinen nennenswerten Beitrag zum Krieg leistete, sorgte für Magenschmerzen. Friedrich V. sah sich als König von Böhmen an. Außer ihm tat dies vermutlich niemand mehr. Doch dieser Titel gehörte immer noch Kaiser Ferdinand II. Nur ein Sieg der Schweden konnte daran etwas ändern, und der war in weite Ferne gerückt.
Auf dem Weg zu dem Pfälzer zwang sich der Reichskanzler zur Ruhe. Er musste einen klaren Kopf bewahren und durfte sich nicht reizen lassen. Die Wünsche des ehemaligen Kurfürsten der Pfalz waren noch bedeutungsloser als vor der Schlacht in Lützen. Das musste ihm Oxenstierna nun schonend beibringen.
Seit Monaten behelligte Friedrich V. ihn: ›Wann lenkt seine Majestät die Truppen endlich in die Pfalz? Wann gelangt die Kurwürde zurück in meine Hände?‹
Oxenstierna und Gustav Adolf waren sich einig gewesen, dass dies geschehen sollte. Eilig gehabt hatten sie es aber beide nicht. Nach dem Tod seiner Majestät betrachtete der Reichskanzler die Pfalz als seine kleinste Sorge.
Oxenstierna ging nur zum Winterkönigs, weil er ihm leidtat. Bereits seit über einer Woche plagte ein starkes Fieber Friedrich V. und er war kaum noch in der Lage, etwas zu essen.
Der Reichskanzler hatte eigens Peter de Spina III. aus Darmstadt nach Mainz kommen lassen. Aber bisher half auch die Weisheit des berühmten Arztes nicht.
›Den Winterkönig plagt der Kummer. Er löscht den Lebenswillen, tötet aber nicht‹, hieß es im Vertrauen. Oxenstierna konnte sich aber nicht vorstellen, dass ein Mann aus diesem Grund sterben könnte.
Als der Reichskanzler die Gemächer Friedrichs V. betrat, die sich ebenfalls im Rathaus befanden, und in das Gesicht des Pfälzers schaute, schrak er zusammen. Es ging ihm deutlich schlechter als vor drei Tagen.
»Ich muss Euch bitten, meinen Patienten nicht zu sehr aufzuregen«, sagte Peter Spina III. spitz.
»Das habe ich nicht vor.« Oxenstierna verzichtete auf den Hinweis, dass der Winterkönig ihn hergebeten hatte. Er trat näher mit dem Gefühl, ins Gesicht eines Greises zu sehen. Dabei zählte Friedrich V. die Dreißig noch nicht lange. »Ihr wolltet mich sprechen?«
»Ist es wahr, dass Gustav Adolf auf dem Schlachtfeld gefallen ist?« Die Stimme des Pfälzers klang brüchig.
»Das ist es.«
»Dann habe ich die Pfalz wohl endgültig verloren.«
»Es hat den Anschein«, gab Oxenstierna bissig zurück und musste sich beherrschen, den Kranken nicht härter anzugehen. Ohne ein Wort des Beileids sofort zu jammern, passte zu ihm. Dabei war längst nicht klar, wie es mit der Pfalz weitergehen würde. Solange der schwedische Feldzug im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation fortschritt, bestand auch für Friedrich V. Hoffnung. Oxenstierna wollte aber jetzt nicht mit dem Winterkönig diskutieren. Sollte er denken, was er wollte, und sich dem Elend hingeben.
»Ich muss Euch wirklich bitten zu gehen«, sagte Peter Spina III. »Mein Patient braucht Ruhe.«
»Ich hatte nicht vor, länger zu bleiben.«
***
Auf dem Weg ins Amtszimmer ärgerte sich Oxenstierna weiter über den Winterkönig. Was bildete sich der Pfälzer ein? Er selbst trug nicht einen Taler zur Finanzierung des schwedischen Krieges auf deutschem Boden bei und auch aus England war keine nennenswerte Hilfe gekommen. Bisher stellte Friedrich V. nur Forderungen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen.
Oxenstierna hatte durchaus Mitleid mit ihm. Gerade jetzt, wo das Fieber einfach nicht zurückging, hätte es einer erfreulicheren Nachricht bedurft. Daran konnte aber der Reichskanzler nichts ändern. Er musste sich um die Ordnung der schwedischen Armee kümmern, die zu zerbrechen drohte.
Er setzte sich an den Schreibtisch, entzündete eine frische Kerze und nahm eine Schreibfeder zur Hand. Es lag eine lange Nacht vor ihm. Für den Fortbestand des schwedischen Feldzugs im Heiligen Römischen Reich war schnelles Handeln unabdingbar. Jeder verlorene Tag konnte verheerende Auswirkungen haben.
Bei ihrem letzten Treffen in Nürnberg hatte Gustav Adolf ihn zum wiederholten Male beschworen, dass ihr bisheriger gemeinsamer Weg auch dann fortzuführen sei, wenn seiner Majestät etwas zustoßen sollte. Beiden Männern war immer bewusst gewesen, dass der König seinen Kampf mit dem Leben bezahlen könnte. Und doch war der Schock kaum zu bewältigen.
An seinen Schwur fühlte Oxenstierna sich gebunden. Die Fortsetzung des Krieges auf deutschem Boden war wichtig. Schweden konnte nur so vor den Feinden in Europa geschützt werden.
Zunächst brauchte die Armee feste Strukturen, damit die Heerführer schnell auf feindliche Handlungen reagieren konnten. Daher schrieb der Reichskanzler jedem einen Brief mit klaren Vorgaben. Sie sollten sich auf ihn berufen, falls ein untergeordneter Offizier ihren Führungsanspruch infrage stellte.
Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar sollte Sachsen endgültig von den Kaiserlichen befreien und seine Truppen von dort aus nach Franken führen. General Johann Baner krankte noch an einer Verletzung, die er sich bei der Schlacht an der alten Veste vor Nürnberg zugezogen hatte. Dennoch sollte er die Streitkräfte von Schwaben aus in den Norden Deutschlands führen und dort die Stellung der Schweden verteidigen.
Seinen Schwiegersohn Gustav Horn, der sich im Elsass aufhielt, schickte Axel Oxenstierna zum Bodensee. Dort sollte er Herzog Maximilian von Bayern zurückschlagen und später gemeinsam mit Herzog Bernhard weiter in den Süden vordringen.
Der Reichskanzler unterdrückte ein Gähnen, stand auf und streckte den Rücken durch. Ein Blick zum Mond zeigte, dass die Tageswende kurz bevorstand. Noch durfte er sich aber keine Ruhe gönnen, wenn er die Boten gleich nach Sonnenaufgang mit den Briefen losschicken wollte.
Die schwierigste Aufgabe hob sich Oxenstierna bis zum Schluss auf. Er musste den schwedischen Rat umfassend über die Ereignisse informieren und den Männern gleichzeitig unmissverständlich klarmachen, wie sie zu entscheiden hatten.
Es war keine zehn Tage her, dass der Reichskanzler dem schwedischen Rat voller Stolz berichtet hatte, wie Gustav Adolf dem Feind bei der Belagerung von Nürnberg standgehalten und sich der Gegner unverrichteter Sache wieder zurückgezogen hatte. Der Vormarsch im Heiligen Römischen Reich wurde nur unterbrochen, um dem Bundesgenossen Johann Georg von Sachsen zu Hilfe zu eilen.
Die jetzige Lage zwang den Reichskanzler, einen deutlich bescheideneren Ton anzuschlagen, gleichzeitig wollte er den Rat bedingungslos auf seine Seite ziehen. Kurz dachte er darüber nach, selbst nach Schweden zu reisen und alles in seinem Sinne zu regeln. Damit würde er seine Heerführer im Heiligen Römischen Reich aber zu lange alleine lassen. Außerdem galt es, die Bündnisse mit den protestantischen Fürsten zu stärken. Oxenstiernas Anwesenheit in Deutschland war noch unerlässlicher geworden als schon vor dem Tod Gustav Adolfs.
Der Reichskanzler atmete tief durch und nahm die Feder zur Hand.
Mit gebrochenen Herzen muss ich vermelden, dass seine Majestät Gustav Adolf von Schweden von Gott abgerufen und in Sachsen gefallen ist. In einer ruhmlosen Schlacht in der Nähe von Leipzig geriet unser König in einen Hinterhalt und wurde feige erschossen. Sein Mut und seine beispiellose Tapferkeit, mit der seine Majestät für unser Vaterland focht, hat ihm letztlich den Tod gebracht.
Oxenstierna war durch den schrecklichen Verlust wie gelähmt. Eine Träne tropfte direkt neben dem Schreiben auf die Tischplatte. Er durfte sich jetzt seiner Trauer nicht hingeben. Dafür lagen zu viele Aufgaben vor ihm, die keinen Aufschub duldeten. Niedergeschlagen wischte er den Tropfen zur Seite und konzentrierte sich wieder auf den Brief. Das Unfassbare war formuliert. Jetzt musste das Unvermeidbare folgen.
Nach dem Tod des wohl größten Königs auf der Welt ist es die heilige Pflicht seines Landes, den begonnenen Weg fortzusetzen. Die Unterstützung der Armee, die sich fern der Heimat für den Schutz Schwedens einsetzt, darf nicht nachlassen.
Ich appelliere an den Rat, an alle Statthalter Schwedens, den Hochadel und die Bischöfe alles Nötige zu tun, um die Soldaten mit den benötigten Mitteln auszustatten. Hier ist höchste Eile geboten. Schweden muss die Interessen des Landes und die aller Protestanten wahren.
Ich selbst fühle mich von der furchtbaren Tatsache wie gelähmt, will aber das Meinige dazu beitragen, diesen furchtbaren Krieg siegreich zu beenden. Aus diesem Grund erbitte ich vom schwedischen Rat alle Vollmachten, die es braucht, dieses Vorhaben zu einem Erfolg zu führen.
Obwohl inzwischen so müde, dass es ihm kaum noch gelang, die Augen offenzuhalten und sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, las er den Bericht mehrere Male durch und korrigierte ihn an einigen Stellen.
Als er endlich zufrieden war, schien bereits die Sonne. Er versiegelte alle Briefe und übergab sie an Boten, die sich noch in der gleichen Stunde auf den Weg machten. Jetzt kam der Zeitpunkt, an dem sich auch der Reichskanzler endlich ein paar Stunden Ruhe gönnte.
***
Sieben Tage später kam am frühen Morgen ein Bediensteter zu Axel Oxenstierna und berichtete vom Tod Friedrichs V. von der Pfalz.
Obwohl der ehemalige böhmische König in den Augen des Reichskanzlers viele Fehler begangen hatte, tat er ihm leid. Der Winterkönig war zu einer der traurigen Personen dieses Krieges geworden.
Prag, 03. Dezember 1632
Albrecht von Wallenstein erwachte und fühlte sich weitaus müder und ausgelaugter als am Abend. Trotz der ersten Nacht in seinem Bett im Prager Palast blieb die erhoffte Erholung aus. Sein Körper schrie vor Schmerz. Hände und Füße brannten wie nach einem Lauf auf allen Vieren über glühende Kohlen. Hinzu kamen Kopfschmerzen. Immerfort klopfte etwas von Innen gegen seine Stirn. Jedes Geräusch, das durch das geöffnete Fenster in sein Schlafgemach drang, fachte die Pein erneut an. Er wollte Ruhe. Wollte schlafen und nichts von den vielen Sorgen hören, die auf ihn einprasselten, sobald er sich vom Bett erhob.
Wallenstein war gestern mit seinem Gefolge in Prag angekommen. Nach den vergangenen Strapazen, die den Herzog von Friedland deutlich über seine Grenzen gebracht hatten, wollte er sich in seinem Palast erholen. Nun mutete er sich auch hier zu viel zu.
Der Herzog von Friedland stand kurz vor seinem fünfzigsten Geburtstag. Er wusste, dass sich sein Leben langsam dem Ende zuneigte. Sein Körper zeigte ihm jeden Tag, wie schmerzhaft sich seine letzten Jahre gestalten würden. Er war des Kämpfens müde, wollte die Freuden des Lebens genießen, solange er es noch konnte. Dennoch durfte er sich nicht mehr als einen Tag Ruhe gönnen. Es gab zu viel zu tun. Er war ein Gefangener innerhalb eines Geflechts von Intrigen und Kriegswirren, die er selbst schuf. Früher oder später würden ihn die Folgen umbringen.
Nach der verheerenden Schlacht in Lützen forderten die obersten Offiziere Wallensteins, nicht nachzulassen und die Schweden zu verfolgen. Gerade jetzt, wo sie ihren König verloren hatten.
Von Wallenstein stimmte nicht mit der Meinung überein, weil er befürchtete, dass dann Generalfeldmarschall Hans Georg von Arnim mit den sächsischen Truppen aus Schlesien anrückte. Das würde die Kaiserlichen in starke Bedrängnis bringen und erneut viele Soldaten kosten, die von Wallenstein nicht opfern wollte.
Der Herzog von Friedland sah außerdem keinen Sinn in weiteren Gefechten. Es konnte kaum gelingen, die Schweden aus dem Reich zu vertreiben, solange die protestantischen Fürsten ihr Bündnis mit dem Feind aus dem Norden aufrechterhielten. Der Schock über den Verlust ihres Königs würde nicht lange anhalten.
In Lützen war vieles nicht im Sinne des Friedländers verlaufen. Kurz vor der Schlacht hatte es mit einer selbst verschuldeten Teilung der Truppen begonnen, dadurch war er nicht in der Lage gewesen, dem Angriff des Feindes mit geballter Macht entgegenzutreten. Wie hätte er wissen sollen, was der Wasserkönig plante? Zuvor hatte der in Naumburg gesessen und den Eindruck erweckt, dass er dort überwintern wollte. Nichts hatte auf eine Schlacht noch in diesem Jahr hingewiesen.
Nach den Kämpfen in Lützen kam von Wallenstein zur Erkenntnis, dass niemand diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen konnte. Es musste eine politische Lösung her. Am besten ein Teilfrieden, der die deutschen Fürsten einschloss, aber die Mächte von außerhalb nicht berücksichtigte. Die Schweden mussten das Reich verlassen.
Aus all diesen Gründen hatte Wallenstein seine Armee in die Winterquartiere geschickt. Die nächsten Monate mussten nun zeigen, ob die Fürsten im Gegensatz zum letzten Winter bereit waren, über einen Frieden zu verhandeln. Gleichzeitig sollte das Heer zur Sicherheit die alte Stärke wiederfinden.
Der Tod des Feldmarschalls Gottfried Heinrich zu Pappenheim wog schwerer, als von Wallenstein zugeben wollte. Obwohl er sich mehr als einmal über die forsche und draufgängerische Art des Feldherrn geärgert hatte, vermisste er in nun schmerzlich.
Sein Zorn galt auch den nachgeordneten Offizieren, die nach dem Tod zu Pappenheims nicht in der Lage waren, ihre Truppen zu ordnen, und stattdessen die Flucht ergriffen hatten. Die Strafe dafür stand noch aus. Mit den Pappenheimern wäre ihnen der Sieg gewiss gewesen. Das hätte die Position Ferdinands II. bei den notwendigen Verhandlungen gestärkt.
Von Wallenstein lag auf dem Rücken im Bett und grübelte über die Lage nach. Nach einer Weile spürte er den Druck seiner Blase und entschloss sich, den Raum zu verlassen. So schwer es ihm auch fiel, er wollte sich nicht die Blöße geben, beim Wasserlassen die Hilfe seiner Bediensteten in Anspruch zu nehmen. Später plante er ein Gespräch mit seinem Verwalter Philipp Fabricius.
***
»Werdet Ihr den Winter über in Prag bleiben?«, fragte Philipp etwa drei Stunden später.
»Zumindest für die nächsten drei Monate«, antwortete von Wallenstein.
»Und Eure Gemahlin?«
»Isabella ist mit unserer Tochter Maria Elisabeth auf dem Weg hierher.«
»Gut. Ich werde Magdalena sagen, dass sie alles für ihre Ankunft vorbereiten soll.«
Gemeinsam mit seiner Frau stand Philipp nun schon seit etwa zehn Jahren im Dienste Albrecht von Wallensteins. Während er die Güter des Friedländers in Prag verwaltete, stand Magdalena den Bediensteten vor und hielt den Palast in Ordnung.
»Sie soll drei weitere Zimmer herrichten. Ich erwarte mehrere Gäste, von denen ein paar auch über Nacht bleiben werden.«
»Natürlich. Ist der König von Schweden wirklich tot?«
»Er ist auf dem Schlachtfeld in Lützen gefallen.«
»Also konntet Ihr den Feind bezwingen?«
»Nein, dieser Gedanke ist töricht. Ein Mann macht keine Armee. Nicht einmal ein König.«
»Warum habt Ihr die Truppen dann aus Sachsen abgezogen?«
»Weil es dort nichts mehr zu gewinnen gab. Die Truppen sind am Ende ihrer Kräfte. Ein Winter in Sachsen hätte bedeutet, früher oder später in ein Gefecht verwickelt zu werden. Tausende wären gestorben.«
»Sind die Schweden denn nicht genauso geschwächt?«, fragte Philipp. Er sah seinem Herrn an, wie sehr er ein paar Tage Ruhe brauchte. Gerade für von Wallenstein wäre es einer Tortur gleichgekommen, die kalten Monate im feindlichen Gebiet zu verbringen.
»Für den Moment mag das zutreffen«, gab der Friedländer zu. »Wir müssen aber vorausschauen. Der Feldzug nach Sachsen war ein Fehler. Genau wie der komplette Krieg auf deutschem Boden ein Fehler ist. Mehr als drei Viertel des Volkes ist evangelisch. Solange die protestantischen Fürsten aufseiten Schwedens stehen, können die Nordmänner nicht dauerhaft besiegt werden. Im besten Falle halten wir ihnen Stand.«
»Warum führt Ihr diesen Krieg dann?«
»Weil es irgendjemand tun muss. Der Kaiser kann nicht gewinnen. Die Protestanten dürfen es nicht.«
»Weil sie das katholische Volk unterdrücken werden?«
»Ja, wir würden alles verlieren.«
»Gibt es überhaupt noch einen Ausweg?«
»Der Kaiser muss mit den deutschen Fürsten Frieden schließen«, erklärte von Wallenstein bestimmt. »Danach müssen die Feinde aus dem Reich vertrieben werden.«
»Ihr meint die Schweden.«
»Ich meine alle. Schweden, Franzosen und Spanier. Gleichgültig, auf welcher Seite sie stehen. Kein Land darf seinen Streit auf deutschem Boden führen.«
Philipp sah seinen Herrn schweigend an. Von Wallenstein setzte großes Vertrauen in ihn, in dem er so offen mit ihm über diese Dinge sprach. Am Kaiserhof hätte so mancher die Worte durchaus als Verrat ausgelegt.
»Gehe nun und sorge dafür, dass ich heute nicht mehr gestört werde«, sagte von Wallenstein. »Wenn Gesandte im Palast erscheinen, woher auch immer sie kommen mögen, vertröste sie auf morgen.«
»Natürlich.« Philipp tat, wie ihm geheißen, und verließ das Amtszimmer seines Herrn. Er musste Magdalena von dem Gespräch berichten. Sie würde sich sicher über Isabellas Rückkehr nach Prag freuen. Auf dem Weg zu ihr dachte er über seinen Herrn nach. Er sah ihn zum ersten Mal so geschwächt. Selbst vor zwei Jahren, als von Wallenstein vom Generalat abdankte, war es ihm nicht so schlecht ergangen. Er durfte nicht so weitermachen. Sonst würde er es bald sein, dessen Nachruf die Flugblätter der Stadt füllte.
***
»Ich mache mir große Sorgen um meinen Gemahl«, sagte Isabella von Wallenstein drei Tage später, als sie mit Magdalena bei einer Tasse Tee zusammensaß. »Die Gicht frisst seinen Körper und der Krieg zerstört seine Seele.«
»Ich habe ihn auch noch nie in einem so schlechten Zustand erlebt. Man sieht ihm seine Krankheit deutlich an.«
»Das will er aber nicht zugeben. Als ich heute Morgen mit Maria Elisabeth im Palast ankam, erwartete ich, dass er nach der langen Zeit außer sich vor Freude sein würde, uns zu sehen.«
»War er das denn nicht?«
»Er hat versucht, uns das Gefühl zu geben, es sei so. Ich kenne ihn aber lange genug. Es hat nicht einmal eine Viertelstunde gedauert, bis er ins Amtszimmer ging, um dringende Geschäfte zu erledigen. So abweisend hat er mich noch nie behandelt.«
»Warum tut er sich das an?«, fragte Magdalena. »Warum legt er das Mandat nicht nieder und tritt als Generalissimus des Kaisers zurück?«
»Weil er es nicht kann.«
»Das verstehe ich nicht. Er hat alles, was er braucht. Viel mehr sogar. Er könnte sich aus der Politik und dem Krieg zurückziehen.«
»Nein, Magdalena. Er wird das Schicksal des Reiches niemals in andere Hände legen, wenn er es nicht muss. Er glaubt, nur so seine Güter zu schützen.«
»Vielleicht braucht er ein paar Tage Ruhe. Er hat eine schlimme Zeit hinter sich. Philipp hat berichtet, dass unser Herr einen abwesenden Eindruck auf ihn macht. Sobald er sich erholt hat, geht es ihm sicher besser.«
»Er bekommt aber keine Ruhe. In der kurzen Zeit, in der ich in Prag verweile, haben sich die Gesandten und Offiziere die Türklinke in die Hand gegeben. Wie soll er sich erholen? Er ist nicht eine Minute für sich.«
»Ich weiß es nicht. Philipp versucht, die Besucher nicht zu rasch zu ihm vorzulassen. Er selbst verlangt aber, die Leute zu sprechen, die in den Palast kommen.«
»Das ist es ja gerade. Er mutet sich zu viel zu und erkennt nicht, wie krank er ist.«
Als Magdalena in den Augen ihrer Freundin einen feuchten Schimmer sah, nahm sie Isabella tröstend in den Arm. Der Kummer und die monatelange Trennung von ihrem Mann setzten Isabella stark zu. Trost fand sie nur bei ihrer inzwischen sechsjährigen Tochter.
Magdalena hatte Isabella bei der Geburt beigestanden. Seitdem verstanden sie sich immer besser und genossen die gemeinsame Zeit in Prag. Die Herzogin bot Magdalena auch stets an, sie mit nach Gitschin zu nehmen, wo sie den Großteil des Jahres im Schloss lebte, doch Magdalena wollte nicht fort.
»Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll«, sagte Isabella.
»Du musst für deinen Gemahl da sein. Er braucht dich.«
»Das will ich. Was mache ich aber, wenn er mich fortschickt?«
»Machte er das?«
»Es würde mich nicht wundern.«
»Falls er das tun sollte, sagst du ihm, dass du nicht gehen wirst«, antwortete Magdalena. »In Gitschin kannst du nichts für ihn tun.«
»Ich soll mich gegen ihn stellen?«
»Nein, Isabella. Du sollst dich nur nicht fortschicken lassen. Sag ihm, dass du an seiner Seite sein willst. Ich bin mir sicher, er wird einlenken.«
»Es geht mir auch um Maria Elisabeth. Sie kennt ihren Vater kaum.«
»Dann musst du das ändern.«
***
»Die Offiziere zu Pappenheim, die vom Schlachtfeld in Lützen geflohen sind, müssen auf das allerhärteste bestraft werden«, sagte General von Wallenstein zum Oberstleutnant Graf Matthias von Gallas, der ihn zu einer Unterredung im Prager Palast besuchte.
»Ihr wollt sie hinrichten lassen?«
»Zunächst ist ihnen der Prozess zu machen. Mit ihrem Verhalten nach dem Tod des Feldmarschalls haben sie unsere Flanke in Gefahr gebracht. Ohne das tapfere Eingreifen Piccolominis wären noch weit mehr unserer Soldaten gefallen. Das darf nicht ungestraft bleiben.«
»Es sind gute Männer, die Euch und dem Kaiser schon lange treu dienen. Als zu Pappenheim fiel, haben sie den Überblick verloren«, erklärte von Gallas. »Wäre es nicht gerecht, ihnen gegenüber gnädig zu sein?«
»Vielleicht wäre es das. Wenn wir aber zulassen, dass Fahnenflucht straffrei bleibt, nur weil es sich um hohe Offiziere handelt, bricht die Kriegsmaschinerie zusammen. Gerade die Heerführer müssen mit gutem Beispiel vorangehen und sich dem Feind stellen.«
»Wenn Ihr es so seht, müsst Ihr jeden einzelnen Soldaten von zu Pappenheims Kavallerie bestrafen.«
»Nein, hätten die Offiziere standgehalten, wären auch die Reiter nicht gewichen. Das Unheil begann mit Oberst Hagens Flucht vom Schlachtfeld. Ich erwarte, dass Ihr die Fahnenflüchtigen ergreift und nach Prag bringt.«
»Ihr wollt ein Blutgericht über sie halten?«
»Ich werde tun, was vonnöten ist.«
Ammersee, 9. Dezember 1632
»Ihr wolltet mich sprechen?«, fragte Pater Maurus Friesenegger, als er das Zimmer des Abtes des Benediktinerklosters Andechs betrat. Er hielt den Blick respektvoll auf den Boden gerichtet.
»Setze dich, Bruder«, antwortete Pater Michael Einslin mit gütiger Stimme. »Ich habe frohe Kunde zu vermelden.«
Friesenegger folgte der Aufforderung dankbar. Nachdem ihm ein Novize die Nachricht überbracht hatte, der Abt wünsche ihn zu sprechen, war er mit schnellen Schritten den heiligen Berg hinaufgegangen und außer Atem dort angekommen. Trotz der klirrenden Kälte standen dem zweiundvierzigjährigen Geistlichen die Schweißperlen auf der Stirn.
»Dank Gottes Gnade geht dieser furchtbare Krieg endlich dem Ende entgegen«, berichtete der Abt.
»Was ist geschehen?«
»Gustav Adolf von Schweden ist auf dem Schlachtfeld gefallen.« Pater Michael Einslin faltete die Hände. »Der Feind hat sich nach Landshut zurückgezogen. Wir haben das Schlimmste überstanden. Das Rauben und Morden wird bald vorbei sein.«
Pater Maurus hob zweifelnd eine Augenbraue, dachte aber gründlich über seine nächsten Worte nach, bevor er diese aussprach. Es wäre ungehorsam, dem Abt ungestüm zu widersprechen. Wie alle Menschen rund um den Ammersee wünschte sich der Benediktiner nichts sehnlicher, als dass endlich Frieden herrschen möge. Daran glauben konnte er aber nicht.
Pater Maurus standen die furchtbaren Ereignisse der letzten Jahre deutlich vor Augen. Sie verlangten dem Volk und dem Kloster noch jetzt mehr ab, als sie leisten konnten. Als Pfarrvikar von Erling versuchte er, den Menschen Mut zuzusprechen. Auch als viele den Ort verlassen und es so an Arbeitskräften gefehlt hatte, spornte er sie an, nicht aufzugeben.
Nach dem Eindringen der Schweden in Bayern gab es immer wieder Überfälle. Vom Heiligen Berg aus konnte man dann jedes Mal die dunklen Rauchwolken über den verbrannten Dörfern sehen. Die Söldner nahmen den Menschen unaufhörlich alles. Sie schlugen und vergewaltigten sie, und auch vor dem Kloster machten die Räuber nicht immer halt. Sie raubten es aus und zerstörten die Heiligtümer. Einmal mussten die Mönche sogar fliehen und sich verstecken. Sollte das mit dem Tod von Gustav Adolf von Schweden wirklich alles vorbei sein?
»Es wäre schön, an den Frieden glauben zu können«, sagte Pater Maurus schließlich.
»Was lässt dich zweifeln?«
»So weit ist Landshut nicht entfernt. Die Schweden werden weiter ihre Raubzüge zu uns unternehmen. Es wird erst aufhören, wenn die Nordmänner sich auf die Ostsee zurückziehen.«
»Die Kaiserlichen werden eine Garnison zu unserem Schutz schicken.«
»Auch diese Männer müssen Essen und brauchen eine Unterkunft«, gab Pater Maurus zu bedenken. »Wir haben nicht mehr viel, was wir geben können, und die Menschen in Erling auch nicht.«
»Unsere Krieger werden den Feind aus dem Land treiben und uns den Frieden bringen.«
Pater Maurus nickte stumm. Er hatte seine Bedenken zum Ausdruck gebracht. Es stand ihm nicht zu, die Worte des Abtes infrage zu stellen, die er aus voller Überzeugung und Vertrauen in Gott sprach.
»Geh nun, Maurus. Sage unseren Brüdern, dass sie für das Volk und den Sieg der Soldaten des Kaisers beten sollen.«
»Das werde ich tun.« Friesenegger verbeugte sich leicht und verließ den Raum. Er glaubte nicht, dass das lange Leiden vorüber war, erlaubte seinem Geist aber eine schützende Hand über die kleine Flamme der Hoffnung zu legen, die in ihm aufkeimte.
»Ich bitte Euch um Erbarmen«, sagte Maurus und sah den Abt des Kloster Andechs flehend an. »Wir dürfen die Frauen nicht diesen Barbaren überlassen. Ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird.«
Maurus machte eine kurze Pause. Er rang um Fassung. Seine Angst vor einem erneuten Angriff marodierender Söldner stieg stetig.
»Ich kann deine Sorge gut verstehen, dennoch ist Frauen der Zugang zum Kloster nicht gestattet.«
»Auch nicht in diesen Zeiten? Denkt an die nordischen Barbaren. Was kann ein Weib Schlimmeres tun?«
»Du vergisst dich«, mahnte der Abt mit erhobener Stimme. »Die Ketzer werden die Strafe Gottes erhalten.«
»Dafür bete ich.« Maurus senkte den Kopf. Mehr als ein gutes Wort einlegen, konnte er nicht.
»Ihr glaubt also, dass die Schweden die Gegend erneut heimsuchen werden?« Die Stimme des Abtes nahm den gewohnten gütigen Ton an.
»Die Flüchtlinge aus Landshut berichten davon.«
»Haben unsere Soldaten den Sieg errungen und den protestantischen Feind aus der Stadt vertrieben?«
»Leider haben sie das nicht. Obwohl die schwedische Besatzung geschwächt und bereit war, die Stadt zu übergeben, sind die Kaiserlichen auf den Befehl von General von Aldringen weitergezogen. Also fallen die Ketzer erneut über die naheliegenden Dörfer her und bringen großes Leid unter das Volk.«
Einslin atmete tief durch. »Wir werden also wieder um unser Leben und das der Menschen in Erling beten müssen!«
»Wir müssen ihnen helfen.«
»Du glaubst, dass sie in den Mauern des Klosters sicher sind?«, fragte der Abt zweifelnd. »Auch wir konnten uns nicht gegen die Räuber wehren.«
»Vielleicht schaffen wir es gemeinsam. In Elbing werden viele Menschen sterben, wenn sie das Dorf nicht verlassen. In den Wäldern und am See würden sie keinen Unterschlupf finden und erfrieren.«
»Damit magst du recht haben.« Der Abt stand auf, trat zum Fenster und schaute nachdenklich hinaus.
Maurus wartete geduldig, bis Einslin ihn erneut ansprach. Er hatte den Weg zum Kloster auf sich genommen, um den Abt um Hilfe für die Dörfler zu bitten. Jetzt spürte er, dass der Abt kurz davorstand, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
»Also gut, hole die Menschen aus dem Dorf ins Kloster. Sie sollen ihr Vieh und Nahrungsmittel mitbringen. Ich werde einen Boten nach Weilheim schicken und den obersten Kriegskommissar von Haslag bitten, uns Hilfe zu schicken.«
»Ich danke Euch!«
***
Maurus schaute auf den Kreuzgang des Klosters herunter, indem die Bewohner von Erling ihre verbliebenen Pferde und das Vieh unterbrachten. Es waren weit weniger Tiere als erwartet. Auch das Getreide der Dörfler, das die Mönche in der Kirchenkapelle einschlossen, würde kaum reichen, um die Menschen durch den Winter zu bringen. Nicht auszumalen, was geschehen würde, sollten sie erneut alles verlieren.
Er wandte sich ab, weil die Glocke zum Essen läutete, und ging in den großen Speisesaal. Dort verteilten seine Brüder bereits Suppe und Brot an die Menschen, die in einer langen Reihe auf ihre kleine Ration warteten. Er schaute in die Gesichter der Frauen und Kinder. Blanke Angst zeichnete sie.
Es dauerte bis zum Abend, bis das befürchtete Hufgetrappel erklang. Ein Blick aus dem Fenster verriet, dass es sich um kroatische Reiter handelte, trotzdem blieb die Sorge. Die Männer standen zwar aufseiten der Kaiserlichen, sie würden das Landvolk aber nicht schonen, wenn es um ihr eigenes Überleben ging.
Die Kroaten klopften gegen das Tor und begehrten Einlass. Kurz darauf öffnete der Abt eine Luke und schaute hinaus.
»Öffnet die Tür«, befahl der Kroate mit befehlsgewohnter Stimme. »Meine Männer sind hungrig.«
»Wir haben selbst nicht mehr genug zum Überleben. Mehr als einen Sack Hafer können wir nicht entbehren.«
»Lasst uns ein, wir werden uns selbst davon überzeugen.«
»Wollt Ihr einen Mann Gottes der Lüge bezichtigen? Ich werde mich bei General von Aldringen über Euer Verhalten beschweren. Er wird nicht zulassen, dass die Klöster und Kirchen des Kaisers von den eigenen Soldaten geschändet werden.«
Friesenegger stand hinter dem Abt. Die Beine des alten Mannes zitterten. Vermutlich befürchtete auch er, der Offizier würde seinen Männern befehlen, anzugreifen.
Eine Weile herrschte Schweigen, bis der Kroate endlich einlenkte: »Gebt mir den Hafer, dann ziehen wir ab.«
Kurze Zeit später zogen die Reiter tatsächlich ab. Einen Grund zum Aufatmen gab es dennoch nicht. Aus Erling erklangen die Schreie der Dorfbewohner, die im Ort geblieben waren, und der Wind trug den Lärm zum heiligen Berg. Die Menschen verloren erneut alles, was sie nicht in den Mauern des Klosters in Sicherheit gebracht hatten.
***
Am nächsten Morgen begleitete Maurus die Bürger von Elbing zurück in ihr Dorf. Als ihr Pfarrvikar kannte er jeden von ihnen beim Namen und fühlte sich für die Menschen verantwortlich. Als er den von den Kroaten verwüsteten Ort betrat, schloss er die Augen und sprach ein kurzes Gebet.
Viele Häuser lagen in Schutt und Asche. Es gab kein Gebäude, an dem er keine Schäden feststellte. Türen standen offen oder hingen zerschlagen in den Angeln. Er schaute durch einen Eingang und erschrak erneut. Die kroatischen Räuber hatten keinen Winkel ausgelassen und alles gründlich nach Beute abgesucht. Es gab sogar herausgerissene Bodendielen und zerschlagene Fensterscheiben.
»Wird das denn niemals aufhören?«, fragte eine Dorfbewohnerin mit Tränen in den Augen.
»Gott hält seine schützende Hand über uns.« Maurus bemühte sich um eine feste Stimme.
»Warum lässt er dann zu, dass diese Barbaren immer wieder in unser Dorf einfallen?«
»Zweifle nicht, Alma. Noch leben wir. Wir werden die Prüfungen bestehen, die uns der Allmächtige auferlegt.«
»Was sollen wir jetzt tun, Pater?«
»Wir versammeln uns in der Kirche und sprechen ein Gebet.« Mittlerweile fiel es den Menschen schwer, ihren Glauben zu bewahren. Daher war Maurus umso entschlossener, ihnen Mut zuzusprechen und die Liebe Gottes zu verkünden. Dankbar, dass die Kroaten zumindest die Kirche verschont hatten, führte er seine Schäfchen zum einzig verbliebenen Ort, in den sie sich gemeinsam zurückziehen konnten.
***
Wenige Tage später gelang es den Kaiserlichen endlich, Landshut zu erobern. Der Feind zog sich zurück und die Soldaten des Kaisers und des Herzogs von Bayern nahmen die Verfolgung auf. Damit konnten die Menschen in Erling und die Mönche auf dem heiligen Berg durchatmen. Der Ammersee blieb verschont. Ihnen stand zwar ein harter Winter bevor, gemeinsam würden sie es aber auch dieses Mal schaffen, Hunger und Kälte zu trotzen.
Wien, 10. Dezember 1632
Eintrag in die kaiserliche Chronik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation:
In der Mitte des Monats November erlebte General Albrecht von Wallenstein seinen bisher größten Triumph. Im sächsischen Lützen gelang es seinen Truppen, dem Feind eine empfindliche Niederlage beizubringen, die im Tod des schwedischen Königs Gustav Adolf seinen Höhepunkt fand. Ganz Europa feierte diesen Sieg gegen den Usurpator aus dem Norden.
General von Wallenstein führte seine Armee nach Böhmen und Schlesien ins Winterquartier. Im Frühjahr werden die Truppen erneut gegen den Feind vorgehen und die schwedischen Eindringlinge endgültig aus dem Reich vertreiben.
Auch die Soldaten der kaiserlichen Armee trauern um einen ihrer größten Heerführer. Nach kurzem Todeskampf ist Feldmarschall Gottfried Heinrich zu Pappenheim auf dem Schlachtfeld in Lützen gefallen.
Nach zwei Wochen Krankheit, die den Körper des Winterkönigs stark geschwächt hat, ist Friedrich V. in Mainz verstorben. Sein großer Wunsch, die Kurwürde über die Pfalz zurückzubekommen, erfüllte sich dem ehemaligen König von Böhmen nicht.
In vielen Gebieten wütet nach wie vor die Pest, die in diesem Jahr bereits mehrere tausend Menschen das Leben kostete.
Anton hörte das Knurren seines Hundes, der wie immer unter dem Schreibtisch lag. Anton sah auf. »Bleib liegen«, beruhigte er ihn und strich ihm sanft über den Kopf.
Der kaiserliche Chronist konnte sich auf Prinz verlassen. Wenn er sich meldete, gab es auch einen Grund. Bevor Anton aber aufstehen und nachsehen konnte, hörte er eine Stimme vor der Tür: »Anton, bist du da?«
Isabella? Anton hoffte, dass er sich irrte, aber die Stimme war unverkennbar. Was tat sie hier?
»Ja«, antwortete er, und seine Gemahlin trat langsam, fast ängstlich ein.
Hier stimmte etwas nicht.
»Ist etwas passiert?«
Isabella trat an seinen Schreibtisch. Es war das erste Mal, dass sie einen Fuß in die Bibliothek des Kaiserhofs setzte. Anton lehnte sich gespannt zurück und wartete auf eine Erklärung ihrerseits.
»Nein, ich wollte lediglich sehen, wo du deine Zeit verbringst.«
»Einfach so?« Anton spürte, wie sich seine Nackenhärchen aufstellten. Die Aussage passte nicht zu seiner Gemahlin. Sie interessierte sich nie dafür, was er tat. Beide gingen ihre eigenen Wege. Bisher kam der Chronist damit auch hervorragend aus.
Ferdinand III. hatte Anton überredet, die Spanierin zu heiraten, damit diese als Hofdame seine Gemahlin Maria Anna an den Kaiserhof begleitete. Zum Dank ernannte der Sohn des Kaisers den Bibliothekar zum Grafen von Rezi. Es stellte sich schnell heraus, dass Anton und Isabella nicht die kleinsten Gemeinsamkeiten teilten. Sie vollzogen die Ehe nie und sprachen seither kaum ein Wort miteinander.
Als vor drei Monaten hohes Fieber die Spanierin plagte, hatte Anton seine Gemahlin gegen deren Willen gepflegt. Damals merkte er Isabella an, wie dankbar sie ihm dafür war, auch wenn sie das nie aussprach. Nach ihrer Krankheit ging Isabella schnell wieder auf die gewohnte Distanz und Anton nahm erneut die Position des notwendigen Übels an. Mehr war Anton für sie nie gewesen. Das wusste er nur zu gut und hatte diese Tatsache längst akzeptiert.
»Obwohl wir schon vor fast zwei Jahren geheiratet haben, kennen wir einander kaum.«
»Du willst daran etwas ändern?«, fragte Anton und ärgerte sich im selben Moment über den vorwurfsvollen Ton in seiner Stimme. Falls Isabella wirklich etwas daran lag, das Verhältnis zwischen ihren zu verbessern, wollte er dem nicht im Wege stehen. Lehnte er sie jetzt ab, würde Isabella ihn in den nächsten Wochen mit noch größerer Ignoranz strafen. »Wenn du magst, zeige ich dir die Bibliothek.«
»Gerne.«
Anton wusste nicht so recht, wie er Isabellas Besuch einordnen sollte. Er nahm sich aber vor, das Beste daraus zu machen. Tatsächlich zeigte sich die Hofdame beeindruckt, als er sie durch die Gänge zwischen den bis an die Decke reichenden Regalen führte.
»Wie ist es möglich, hier einen Überblick zu erhalten?«
»Gar nicht. Peter und ich geben unser Bestes, um Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Es wird uns dennoch viel Zeit kosten, gerade den älteren Teil der Bibliothek zu sortieren.«
»Woher kommen all diese Schriften?«
»Von überall auf der Welt. Wir würden hier auch viel über deine Heimat finden.«
»Meine Heimat ist da, wo sich die Prinzessin von Spanien aufhält«, sagte Isabella spitz.
»Ich wollte dir nicht zu nahetreten.« Anton fiel auf, dass er über seine Gemahlin genauso wenig wusste wie sie über ihn. Isabella schien aber offensichtlich nicht über ihre Vergangenheit reden zu wollen.
»So beeindruckend diese Räume sind. Ich finde die Vorstellung beängstigend, mein ganzes Leben hier zu verbringen. Die Luft ist muffig und voller Staub. Außerdem wäre es mir hier auf Dauer zu dunkel.«
»Dennoch bist du jederzeit eingeladen, die Bibliothek zu besuchen.« Anton wollte mit seiner Gemahlin nicht über die Vorzüge seiner Arbeit diskutieren. Es reichte ihm, dass er sich zwischen den Regalen wohlfühlte. Obwohl Isabella vorgab, sich für die Räume zu interessieren, schien etwas völlig anderes hinter dem Besuch zu stecken.
»Außerdem verströmt dieses Vieh einen unerträglichen Geruch.«
»Prinz ist ein Hund! Er ist mir ein treuer Freund und gehört genauso in diese Räume wie ich.«
»Trotzdem stinkt er. Solange du ihn aber nicht in meine Gemächer bringst, soll mir das recht sein.«
Es sind gemeinsame Gemächer. »Natürlich nicht.«
»Anna Maria erwartet mich«, sagte Isabella plötzlich. »Ich wollte nur kurz nach dir sehen und kann nicht länger bleiben.«
Als sie durch die Tür trat, setzte Anton sich nachdenklich an den Schreibtisch. Der überhastete Aufbruch seiner Gemahlin glich einer Flucht. Warum war sie überhaupt gekommen, wenn sie von der Erzherzogin erwartet wurde und keine Zeit hatte?
***
Lange befasste sich Anton nicht mit Isabellas ungewöhnlichem Verhalten. Es gab wichtigere Dinge, die seine Aufmerksamkeit erforderten. Nach einem Jahr voller Kriegswirren und steigender Angst hatte sich der Bibliothekar auf den Winter gefreut, in dem es erfahrungsgemäß ruhiger zuging. Von dieser Vorstellung hatte er sich verabschiedet. Zahlreiche Empfänge, Schreiben nahmen ihn ein. Für die geplante Arbeit in der Bibliothek blieb da nicht mehr viel Zeit.
Gustav Adolfs Tod sorgte nicht nur am Kaiserhof für große Freude. Aus ganz Europa trafen Briefe ein, die Ferdinand II. zum Sieg beglückwünschten. Selbst der Papst hatte dem Kaiser geschrieben und sich wohlwollend über diesen Erfolg geäußert. In Wahrheit zeigte man aber in Rom wohl alles andere als Freude über die Kriegswendung. Ganz Europa wusste, dass die Macht der Habsburger Urban XIII. ein Dorn im Auge war.
Den Verlust des Feldmarschalls zu Pappenheim bedauerten der Kaiser und seine Berater. Sein Tod wog in Wien aber bei Weitem nicht so schwer, wie der des Usurpators aus dem Norden. In seiner Euphorie sah es Ferdinand II. nun nur noch als Frage der Zeit, bis die Schweden endgültig aus dem Reich verjagt werden konnten.
Anton selbst konnte den Optimismus des Kaisers und seiner Berater nicht teilen, so sehr er sich auch wünschte, dass bald ein umfassender Frieden geschlossen wurde und das Reich endlich zur Ruhe kam. An einen endgültigen Sieg Ferdinands II. über die Protestanten glaubte der Bibliothekar gar nicht.
Sicher, Wallenstein hatte mit dem Tod Gustav Adolfs einen Vorteil erzwungen, den er allerdings sofort wieder verspielte, als er sich mit dem Heer ins Winterquartier zurückzog. Die Schweden würden bis zum Frühjahr ihre alte Stärke zurückgewinnen und auch Johann Georg von Sachsen durfte man nicht unterschätzen. Mittlerweile besaß er eine große Anzahl von Soldaten und mit Hans Georg von Arnim einen erfahrenen Heerführer.
Wallensteins Rückzug ins Winterquartier gab den Kritikern des Herzogs von Friedland frischen Wind. Sie beschwerten sich, weil er die einmalige Möglichkeit verpasste, entschlossen gegen den angeschlagenen Feind vorzugehen. Bisher wollte der Kaiser hiervon nichts wissen und er stellte sich ganz und gar hinter seinen Generalissimus. Sogar Gesandte schickte er nach Prag, die von Wallenstein in seinem Namen zum Erfolg gratulierten.
Aus all diesen Gründen versprachen die nächsten Wochen und Monate interessant zu werden. Anton beobachtete die politische Lage mit Spannung. Wie würden sich die Schweden aufstellen? Hielten die protestantischen Fürsten am Bündnis mit der Seemacht fest oder gab es tatsächlich die Möglichkeit, mit ihnen über einen Frieden zu verhandeln? Offen war auch, ob sich der französische König weiterhin zurückhielt oder ob er nun die Chance sah, seine Macht auf deutschem Boden zu festigen.
Ammersee, 30. Januar 1633
»So lasset uns zum Abschluss gemeinsam das Vaterunser sprechen«, beendete Pater Maurus Friesenegger seine Predigt in der Dorfkirche von Erling. »Auf dass unser geliebter Herr uns auch weiterhin schützen möge.«
Bevor Friesenegger die ersten Worte des Gebets sprechen konnte, erfüllte ein donnernder Knall die Kirche. Der Boden vibrierte, und der Pater zwang sich, sich nicht am Rand der Kanzel festzuhalten. Er musste Stärke zeigen und seinen Schützlingen Mut zusprechen. Einen Blick nach oben konnte sich Maurus aber nicht verkneifen. Staub und kleinere Steine fielen von der Decke.
»Wir sind verloren!«, rief ein Mann und hielt sich vor Schrecken die Hände vor das Gesicht.
Von draußen ertönte das polternde Gewirr von herabfallenden Steinen und umgestürzten Bäumen. Eine Fensterscheibe über dem Altar der Kirche zersprang in tausende Teile.
Die Menschen der Gemeinde sahen sich voller Furcht an. Einige bekreuzigten sich, andere riefen wild durcheinander und prophezeiten, dass sie dem Untergang geweiht seien.
»Das sind wir nicht. Der Allmächtige hält seine schützenden Hände über uns.«
»Gott hat sich von uns abgewandt!«
»Nein, die Mauern dieses Hauses werden standhalten. Wenn unser Glauben genauso unerschütterlich ist, werden wir auch diese Prüfung unbeschadet überstehen.«
Als wollte der Sturm, der die Gegend bereits seit drei Tagen heimsuchte, die Worte des Paters Lügen strafen, nahm er noch einmal an Stärke zu. Die dicken Eichenbalken knackten und die Menschen richteten ihre Blicke ängstlich nach oben.
Pater Maurus hob beschwichtigend beide Hände. »Behaltet die Ruhe. Nirgendwo sind wir sicherer als im Haus Gottes.«
Tatsächlich glaubte Friesenegger, dass der Allmächtige sie auch an diesem Tag beschützen würde. Er hatte ihnen die Kraft gegeben, die vergangenen Gefahren zu überstehen. Auch heute würde er sie nicht im Stich lassen.
In den vergangenen Monaten mussten die Menschen großes Leid ertragen und ihr Glaube war auf eine harte Probe gestellt worden. Dennoch, obwohl sie nicht viel besaßen und in großer Armut täglich ums Überleben kämpften, trotzten sie ihrem Schicksal mit Gottes Hilfe und den Almosen der Mönche vom Heiligenberg.
Nach dem Jahreswechsel waren die Erlinger vor weiteren Übergriffen verschont geblieben. Allerdings gab es auch nichts mehr, was die Schweden oder Kroaten hätten rauben können. Nur spärlich trafen Nahrungsmittel aus Gebieten ein, in denen es bisher keine Überfälle gegeben hatte. Vielen Menschen blieb nicht mehr als ein kleines Stück Brot, um den Tag zu überstehen. Davon abgesehen konnte die Landbevölkerung die hohe Kriegssteuer nicht aufbringen. Die Mönche im Kloster Andechs sollten vier gute Pferde abgeben. Sie besaßen aber nur noch zwei klapprige Gäule.
Das halbe Dorf lag in Asche und so einige verschonte Häuser besaßen keine Dächer. Was die feindlichen Soldaten nicht zerstört hatten, fiel nun dem Unwetter zum Opfer.
Maurus musste den Menschen Trost und Zuversicht geben, obwohl er selbst bei jedem Schlag innerlich zusammenzuckte. Wenn etwas zu Boden stürzte oder ein Ast gegen die dicken Mauern des Gotteshauses schlug, zeigte er entschlossen Stärke. Er blieb auf der Kanzel und las den Menschen aus der Bibel vor. Dabei erhob er oft seine Stimme, um gegen das Getöse außerhalb der Kirche anzukommen.
Die ganze Nacht harrten die Menschen in der kleinen Kirche aus. Es gab nichts zu essen und auch das wenige Wasser war inzwischen verbraucht. Einige Dörfler machten es sich auf dem Boden und den Bänken bequem und versuchten, etwas Schlaf zu finden; andere liefen ruhelos umher.
In den Morgenstunden ließ der Sturm endlich nach. Pater Maurus sprach ein Gebet des Dankes und führte seine Schützlinge nach draußen. Der Kirchturm war eingestürzt. Die Trümmer säumten das Gotteshaus. Es glich einem Wunder, dass das Gebäude und die Menschen darin verschont geblieben waren.
***
»Diese Barbaren sind noch schlimmer als die feindlichen Soldaten aus dem Norden«, sagte der Abt und schaute verzweifelt zur Mühle des Klosters, wo die kroatischen Reiter leere Säcke durcheinanderwarfen und alles an Getreide raubten, was sie in die Finger bekamen. »Dabei stehen sie auf unserer Seite.«
Maurus nickte. »Wenn nicht bald Hilfe kommt, werden sie versuchen, ins Kloster einzudringen.«
Vor wenigen Tagen nach dem furchtbaren Sturm, der die Menschen rund um den Ammersee in Angst und Schrecken versetzt hatte, kam die Kunde, dass erneut eine Einheit Kaiserlicher in Weilheim weilte. Die Bürger von Erling sorgten sich erneut um das wenige, was sie noch besaßen. Es war ihnen gerade so gelungen, die letzten Nahrungsmittel im Kloster unterzubringen, als die kroatische Plage über Erling hereinfiel. Zum Plündern fanden die Kroaten nichts und so zogen sie auf den heiligen Berg. Wieder einmal beraubten sie die Menschen, die sie eigentlich gegen den Feind schützen sollten.
»Die Menschen werden verhungern, wenn nicht bald ein Wunder geschieht«, sagte Maurus traurig. »Es war schon im Herbst nicht genug übrig, um die Saat auszubringen. Wie sollen wir das Jahr überstehen, wenn die Bauern ihre Felder nicht bestellen können?«
»Gott lässt uns nicht im Stich. Seine Güte wird uns auch dieses Mal retten.«
»Das weiß ich.« Maurus’ Glaube blieb ungebrochen und er dachte nicht ans Aufgeben. Und doch fragte er sich in stillen Momenten, was den Allmächtigen bewog, seine Schützlinge am Ammersee vor solch eine Probe zu stellen.
Plötzlich erklangen Schreie am Fuße des heiligen Bergs. Eine kaiserliche Kompanie stürmte den Hang hinauf, um den marodierenden Söldnern Paroli zu bieten.
»Habe ich es dir nicht gesagt, der Allmächtige wird uns retten?« Der Abt lächelte hoffnungsvoll.
»Natürlich habt Ihr das.«
Die Kaiserlichen schafften es, die kroatischen Verbündeten zu verdrängen. Die Mühle war aber nicht mehr zu retten.
»General von Aldringen sollte die Kroaten in ihr eigenes Land zurückschicken«, sagte Maurus. »Sie sind der schlimmste Feind des Volks.«
»Er braucht die Kämpfer, und weil er sie nicht bezahlen kann, holen sie sich vom Volk, was sie brauchen.«
»Der Kaiser muss ihnen Einhalt gebieten.«
»Wir sind nicht in der Position zu richten. Der Kaiser wird wissen, was nötig ist, um den Feind aus dem Reich zu vertreiben.«
»Es gibt Tage, an denen frage ich mich, wer unser Feind ist.«
***
Zwei Tage später traf eine kaiserliche Einheit mit zweihundert Reitern am heiligen Berg ein und verlangte ein Quartier in der Umgebung.
»Wir können die Soldaten unmöglich versorgen«, erklärte Friesenegger einem Hauptmann, der mit dreißig Mann in Erling ankam. »In den Häusern gibt es kaum noch ein Stück Brot. Die Menschen verhungern.«
Der Hauptmann verzog missmutig die Lippen. »Ihr kommt immer mit den gleichen Ausreden. Das Landvolk wurde bereits von der Kriegssteuer verschont. Jetzt müsst ihr einen Beitrag zu eurem Schutz leisten.«
»Zum Schutz? Den hatten wir nicht. Andernfalls wären wir vielleicht nicht mehrfach von den Kroaten ausgeraubt worden und müssten nicht von der Hand in den Mund leben.«
»Es sind eben harte Zeiten. Die Soldaten müssen essen, wenn sie gegen den Feind bestehen sollen.«
»Das mag ja alles richtig sein. Der Feind ist aber fern. Warum bringt Ihr Eure Männer nicht in Gebieten unter, die nicht von Räubern und marodierenden Söldnern heimgesucht wurden?«
Der Hauptmann lachte spöttisch. »Weil es diese Gebiete nicht gibt. Zumindest nicht in Bayern.«
Maurus starrte ihn einen Moment lang stur an.
Der Hauptmann ergriff als erster wieder das Wort: »Ich werde ein paar Männer zum See schicken. Sie sollen sehen, was es dort an Fisch zu holen gibt. Die Dörfler werden die Soldaten unterbringen und für sie kochen. Wir sorgen dafür, dass auch etwas für ihre eigenen Mäuler übrigbleibt.«
»Ich danke Euch.«
Die Soldaten würden bei den Fischern nicht viel erreichen. Maurus selbst hatte versucht, am See Nahrung für die Dorfbewohner zu beschaffen, und war abgewiesen worden. Dennoch teilte er den Dörflern die Vereinbarung mit dem Hauptmann mit und begab sich zum heiligen Berg. Weil ihm nicht einmal mehr ein alter Packesel blieb, musste er den Weg zu Fuß zurücklegen. Als er sein Ziel erreichte, ruhten vor den Mauern mehr als fünfzig Pferde. Sicher befanden sich ihre Reiter im Innern des Klosters und stellten die gleichen Forderungen wie die Soldaten in Erling. Hier gab es für die Dörfler keine Nahrungsmittel.
Maurus warf einen wehmütigen Blick zur Mühle, wo zwei Arbeiter die von den Kroaten angerichteten Schäden reparierten, dann trat er erst ein.
Im Kreuzgang sprach der Abt mit zwei Offizieren, die wild auf den Geistlichen einredeten. Vermutlich hätten sie Pater Michael geschlagen, wäre er kein Benediktiner.
Maurus wartete ungeduldig, bis der Abt den Disput mit den Offizieren beendete, und trat zu ihm.
»Die Forderungen der Söldner werden immer absurder«, erklärte Michael Enslin noch immer verärgert. »Wir sind gerne bereit, anderen zu helfen. Wir können aber nichts verteilen, was wir nicht haben.«
»In Erling sieht es genauso aus. Es gibt kaum noch etwas, was die Menschen in ihre Kochtöpfe werfen können, um dem Wasser ein bisschen Geschmack zu geben.«
Der Abt überging die Worte. »Wir sollen fünfzig Männer bewirten und die Pferde müssen auch versorgt werden. Vor den Klostermauern wächst kaum Gras, um den Hunger der Tiere zu stillen.«
»Wie ist es um die Schätze des Klosters bestellt?«, fragte Maurus besorgt. Bevor der Krieg nach Bayern kam, verzeichneten die Mönche hohe Einnahmen dank der vielen Pilger, die zum heiligen Berg marschierten. Weiteres Geld erwirtschafteten die Mönche damals durch den Verkauf von Bier und selbst hergestellten Kerzen. Die Münzen lagen sicher verwahrt in einem Versteck unter der Kapelle und waren bisher weder von den Schweden noch von den Kroaten entdeckt worden.
»Ein großer Teil der Münzen ist noch da«, antwortete der Abt leise. »Wohin aber soll ich unsere Brüder schicken? Es gibt im ganzen Land kein Getreide zu kaufen. Selbst wenn es uns gelänge, ein paar Wagenladungen zu bekommen, würden sie sicher auf dem Weg hierher Räubern und Plünderern in die Hände fallen.«
»Also müssen wir das Wenige solange strecken, bis die Reiter abziehen.«
»Ich sehe keine andere Möglichkeit.«
Prag, 14. Februar 1633
»Ich möchte mir das nicht ansehen«, sagte Isabella von Wallenstein und wandte den Blick von dem Platz vor dem Prager Rathaus ab.
»Es ist nicht richtig, dass dein Gemahl dich dazu zwingt, obwohl er selbst nicht hier ist«, antwortete Magdalena.
»Wenigstens muss unsere Tochter die Hinrichtungen nicht erleben.«
»So herzlos ist nicht einmal dein Gemahl.«
»Er ist nicht herzlos.«
»Ich weiß. Manchmal macht es aber den Eindruck.«
Die beiden Frauen standen gemeinsam mit Philipp an einem Fenster im Rathaus und schaute nach draußen, wo sich bereits die halbe Stadt versammelt hatte. Heute statuierte General von Wallenstein ein Exempel an den Fahnenflüchtigen von Lützen. Insgesamt dreizehn Offiziere und fünf Reiter sollten für ihr Verhalten enthauptet werden.
Isabella nahm stellvertretend für ihren Gemahl an der Hinrichtung teil. Philipp und Magdalena hatte er befohlen, sie zu begleiten. Von Wallenstein selbst erging es in den letzten Tagen immer schlechter. Er konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen, so war es ihm zu seinem großen Verdruss nicht möglich, persönlich im Rathaus zu erscheinen.
Aus der ganzen Stadt strömten Bürger herbei, um dem Schauspiel beizuwohnen. Philipp hatte bereits vor über zehn Jahren nach der Schlacht am weißen Berg hier ein Blutgericht gegeben. Damals wurden die protestantischen Verräter unter dem Jubel des Volks hingerichtet. Heute zeigten die Gesichter der meisten Bürger eher Erschrecken. Immerhin handelte es sich um die eigenen Offiziere, die hier den Tod finden sollten.
Nach dem damaligen Blutgericht hatte Kaiser Ferdinand II. die Köpfe von zwölf Hingerichteten an den Brückenturm nageln lassen als Warnung für alle, die sich gegen den Habsburger stellten. Erst vor einem Jahr ließ Hans Georg von Armin die Schädel entfernen, nachdem er mit dem sächsischen Heer Prag besetzt hatte.
Auch den höchsten Heerführern in von Wallensteins Armee war es nicht gelungen, den General zu überzeugen, Gnade walten zu lassen. Allen voran die Grafen Matthias von Gallas und Heinrich von Holk sprachen sich für die vermeidlichen Verräter aus. Von Wallenstein ließ sich nicht umstimmen.
Im Gegensatz zu Isabella und Magdalena fand Philipp das Handeln seines Herrn richtig. Wie sollte er den Krieg weiterführen, wenn er sich auf seine eigenen Führungsoffiziere nicht verlassen konnte? Es war üblich, mit aller Härte gegen Verräter vorzugehen. Auch öffentliche Hinrichtungen stellten keine Seltenheit dar. Ungewöhnlich erschien Philipp lediglich, dass so viele Männer gleichzeitig ihre Strafe finden sollten.
Im Gegensatz zu von Gallas und von Holk waren Philipp die Fahnenflüchtigen unbekannt. Er konnte nicht beurteilen, wie sehr sie sich vor dem Verrat für die kaiserliche Sache verdient hatten. Genauso wenig wusste er, wie folgenreich ihre Taten in der Schlacht von Lützen gewesen waren.
Unter dem Kommando von Heinrich von Holk wurden unter dem Raunen der Menge die Verurteilten auf den Platz geführt. Der Generalwachtmeister verlas die Anklagepunkte und stellte die Feigheit vor dem Feind in den Vordergrund, die beinahe zum Verlust der Schlacht geführt hätte.
Ein Schafrichter führte den ersten Verurteilten vor und zwang ihn, sich vor dem Richtklotz niederzuknien, dann schwang der Henker sein Beil. Ein Aufschrei des Entsetzens ging durch die Menge, als der Kopf des Mannes auf den Boden fiel.
»Das ist so furchtbar«, sagte Isabella und sah kreidebleich zu, wie zwei weitere Männer gerichtet wurden.
»Das ist der Krieg.« Philipp fing sich für den Einwurf einen bitterbösen Blick seiner Frau ein.
Als der Schafrichter den gerade einmal achtzehn Jahre alten Rittmeister Staitz von Wobersnau zum Richtklotz führte, erklangen unter den Bürgern auf dem Platz laute Protestschreie.
»Lasst Gnade walten.«
»Das ist unmenschlich.«
Immer mehr Menschen forderten, dass man den jungen Offizier verschonte. Feldmarschall von Holk sah Matthias von Gallas unsicher an.
»Das können sie doch nicht tun.« Magdalena schlug entsetzt eine Hand vor den Mund. »Er ist fast noch ein Knabe.«
»Er hat sich genauso schuldig gemacht wie die anderen«, entgegnete Philipp.
»Weil er es nicht besser wusste. Hast du kein Mitleid mit ihm?«
»Habt Erbarmen!«, schrie nun auch Isabella.
Heinrich von Holk drehte sich mit Schrecken in den Augen zur Gemahlin seines Herrn um. Ihm fiel es offensichtlich schwer, den Verurteilten dem Henker zu übergeben.
Schließlich hob der Feldmarschall die Hand. »Haltet ein«, befahl von Holk und wandte sich an die Menge auf dem Platz. »Ich werde dem General euer Gnadengesuch vortragen.«
Der Feldmarschall stieg auf sein Pferd und bahnte sich einen Weg durch die Massen, dann ritt er über die alte Steinbrücke auf den Palast des Generalissimus zu.
***
Von Wallenstein saß im Amtszimmer und wartete auf die Vollstreckung der Urteile. Dabei schmerzten seine Hände so stark, dass er nicht einmal eine Feder halten, geschweige denn schreiben konnte. Das Auftauchen des Generalwachtmeisters machte seine ohnehin schon schlechte Stimmung nicht gerade besser.
»Habt Ihr bereits alle Verräter hingerichtet?«, fragte von Wallenstein überrascht.
»Nein.«
»Was tut Ihr dann hier?«
»Es geht um Rittmeister Staitz von Wobersnau.«
»Was ist mit ihm?«
»Die Menge auf dem Platz fordert Gnade für den Mann. Er ist gerade einmal achtzehn Jahre alt und noch grün hinter den Ohren.«
»Als Rittmeister hat er sich genauso zu verantworten wie die anderen«, sagte von Wallenstein erbarmungslos.
»Ich rate Euch dringend, den jungen Offizier zu verschonen. Das Volk wird Euch seine Hinrichtung nur schwerlich verzeihen. Die Adeligen erst recht nicht.«
»Das mag sein.« Von Wallenstein wusste, dass es einigen hochrangigen Personen in Prag nicht gefallen würde, wenn er jetzt hart blieb. Trotzdem war er nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. »Es wird allerdings auch Offiziere geben, die es mir als Schwäche ankreiden werden, wenn ich jetzt Gnade gewähre.«
»Ihr wollt Staitz von Wobersnau also tatsächlich hinrichten lassen?«
»Ich habe nie etwas anderes gesagt.«
***
Als Generalwachtmeister von Holk über die alte Steinbrücke auf den Marktplatz einritt und den Kopf schüttelte, wussten die Menschen, dass sein Gnadengesuch für Staitz von Wobersnau bei Albrecht von Wallenstein erfolglos geblieben war.
Wieder schrien die Menschen, man möge Erbarmen mit dem jungen Offizier zeigen. Jetzt konnte dem Rittmeister aber niemand helfen.
»Ich werde mit meinem Gemahl sprechen.« Isabella klang entschlossen. »So darf er mit seinen Leuten nicht umgehen.«
Magdalena schüttelte traurig den Kopf. »Staitz von Wobersnau wird das nicht mehr helfen.«
»Vollstreckt das Urteil«, befahl von Holk, als er auf den Richtplatz zurückkehrte.
Begleitet von den wütenden Schreien der Massen schwang der Henker sein Beil und schlug Staitz von Wobersnau das Haupt vom Körper. Der Rittmeister zeigte nicht die kleinste Spur von Gegenwehr und ertrug sein Schicksal mutig, das ließ die Tat in den Augen der Anwesenden noch ungerechter erscheinen.
Phillip schaute in Magdalenas und Isabellas Gesichter. Tränen liefen deren Wangen hinab. Auch er befürchtete jetzt, dass sein Herr einen Fehler begangen hatte. Er hätte Großmut beweisen und wenigstens Staitz von Wobersnau verschonen sollen.
Nach und nach erfuhren auch die anderen Verurteilten ihre Strafe. Mit jedem Kopf, der auf dem Boden des Platzes aufschlug, wurden die entrüsteten Schreie lauter. Als das grausame Schauspiel endlich ein Ende fand, dauerte es noch Stunden, bis sich die Menge zerstreute.
Am nächsten Tag nagelten Herolde die Namen von fünfzig weiteren fahnenflüchtigen Offizieren an einen Galgen. Auch sie galten damit als verurteilt und sollten mit dem Tod bestraft werden, sobald es gelang, ihrer habhaft zu werden.
Mainz, 16. Februar 1633
Mit gemischten Gefühlen ließ Axel Oxenstierna den Brief seines Bruders Gabriel sinken, der seine Interessen beim schwedischen Rat in Stockholm vertrat. Die Nachrichten aus der Heimat sorgten für Erleichterung, aber auch für Sorge.
Seinem wichtigsten Anliegen hatte der Rat entsprochen und Oxenstierna zum Oberbefehlshaber auf deutschem Boden und des Verbunds der protestantischen Kräfte unter schwedischer Führung ernannt. Obwohl der Pakt mit den protestantischen Fürsten noch zu schließen war, erhielt der Reichskanzler mit diesem Brief die Vollmacht, im Namen seines Landes zu agieren. Dank dieses Freibriefs konnte er den Feldzug im Sinne seiner Majestät fortsetzen. Dies gedachte er mit aller Entschlossenheit zu tun. Der Tod des Königs von Schweden sollte nicht umsonst gewesen sein.
Mit den Bemühungen des Rates zur Nachfolgeregelung der Königswürde zeigte sich Oxenstierna unzufrieden. Die Männer gingen zu sorglos mit der Frage um. Es war unstrittig, dass Christina, die Tochter seiner Majestät, zur Königin gekrönt werden sollte. Allerdings bedurfte es hier einer Vormundregelung, weil das Mädchen gerade einmal sechs Jahre zählte. Ihre Mutter Maria Eleonora von Brandenburg sollte nicht in die Regierungsgeschäfte integriert werden. Der Reichskanzler hielt sie für zu labil, um diese Aufgabe zu übernehmen.
Direkt nach dem Tod des Königs hatte Oxenstierna an den Reichsrat geschrieben. Die Stände sollten der künftigen Königin gegenüber Treue und Beständigkeit schwören. Gleichzeitig mussten sie geloben, der Regierung zu gehorchen, welche die Vormundschaft über die junge Christina innehatte. Diese Aufgabe sollte ein fünfköpfiges Gremium übernehmen, dem auch der Reichskanzler angehörte.