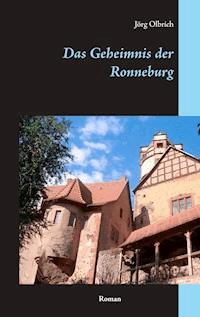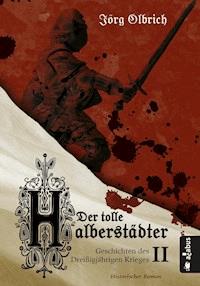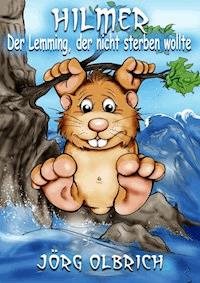Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Während einer ganz normalen Klassenfahrt nach Athen passiert es. Der Abiturient Ralf hat einen Blackout, und als er wieder zu sich kommt, traut er seinen Augen nicht: Vor ihm erhebt sich das, was wir heute als die Pyramiden von Giseh kennen. Doch wie kann das sein? Warum sperrt man ihn ins Gefängnis und bezichtigt ihn der Sabotage? Er hat doch nichts getan, war bis vor Kurzem noch nicht einmal hier. Und was hat dieser Antipatros mit all dem zu tun? Wenn er überleben und in seine Zeit zurückkehren will, muss Ralf der Sache auf den Grund gehen und herausfinden, was gespielt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Akropolis
Giganten aus Stein
Stadt der Sünden
Das verborgene Wunder
Der Tempel der Artemis
Ein Denkmal für die Ewigkeit
Die Belagerung von Rhodos
Pharos
Die Akropolis
Die Akropolis
»Wenn du es dir nicht endgültig mit der wilden Hilde verderben willst, komm jetzt endlich!«, sagte Tim.
Ich grinste meinen Freund an. Unsere Klassenlehrerin Hilde Kern war in etwa so wild wie eine Schildkröte voller Valium. Dennoch benutzte Tim diese Bezeichnung gerne, wenn wir über sie sprachen.
»Kannst du ihr nicht sagen, dass ich krank bin?«
»Wieso? Willst du den ganzen Tag im Hotel sitzen?«
»Besser, als zwischen alten Steinen herumzurennen«, antwortete ich. »Ich möchte gern den Zehnkampf sehen.«
»Du verstehst doch sowieso nicht viel«, sagte Tim und deutete auf den Fernseher. Es lief eine Liveberichterstattung von den Olympischen Spielen und der Sprecher redete englisch, was nicht zu meinen Stärken gehörte.
»Ich muss nicht verstehen, was gesprochen wird. Ich sehe ja die Ergebnisse.«
»Die kannst du auch später in den Nachrichten sehen.«
»Du weißt, dass das nicht dasselbe ist.«
»Trotzdem musst du jetzt zum Frühstück kommen. Die anderen sitzen schon alle unten.«
»Ist ja schon gut«, sagte ich mürrisch und schaltete den Fernseher ab. Die Leichtathletikwettbewerbe hätte ich gerne verfolgt. Warum musste unsere Klassenfahrt auch ausgerechnet in die Zeit der Olympischen Spiele fallen? Mein größter Traum war es, irgendwann einmal selbst daran teilzunehmen. Als Zehnkämpfer hatte ich bereits zwei Mal die Kreismeisterschaften gewonnen, war aber beim Landesentscheid nie unter die besten fünf gekommen.
Tim und ich gingen in den Speisesaal, wo unsere Klassenkameraden bereits beim Frühstück saßen. Es war unser dritter Tag in Athen. Heute sollten wir die Akropolis besichtigen. Ich war nicht der Einzige, der dazu keine Lust hatte.
»Hast du endlich ausgeschlafen Ralf?«, begrüßte mich Anna.
»Ich bin schon lange wach«, antwortete ich.
»Unser Athlet konnte sich nicht vom Fernseher trennen«, lachte Tim.
»Der Bus fährt in fünfzehn Minuten«, sagte Anna.
»Sandra und Mike stehen schon davor.«
»Das war so klar«, antwortet ich zwischen zwei Bissen in mein Schokoladenbrötchen. Mike Grenzer war unser Klassenstreber und ließ keine Chance aus, sich bei der wilden Hilde oder den anderen Lehrern einzuschmeicheln. Sandra Wagner war für mich das hübscheste Mädchen der ganzen Schule. Ich verstand nicht, warum sie sich so an Mike heranwarf. Viele Jungs in unserer Klasse schwärmten für Sandra, die sich jedoch unnahbar zeigte und sich ständig an Grenzer hielt.
Ich schnappte mir noch schnell ein Brötchen, damit ich den Tag nicht mit fast leerem Magen beginnen musste. Dann folgten wir den anderen nach draußen und stellten uns hinten an die Schlange vor dem Bus.
»Müssen wir wirklich bei dieser Hitze auf den Berg laufen, nur um uns ein paar alte Steine anzusehen?«, fragte ich und fing mir dafür einen bitterbösen Blick von Hilde Kern ein.
»Du solltest die Zeit nutzen und dir die Akropolis sehr genau anschauen Ralf«, antwortete meine Lehrerin.
»Sie wird das Thema unserer nächsten Klausur sein.«
»Auch das noch«, fluchte Tim neben mir.
»Beeilt euch ein bisschen«, sagte Frau Kern. »Unser Führer wird uns in einer halben Stunde am Parthenon treffen.«
»Ich dachte, wir gehen zur Akropolis«, sagte ich verwundert.
»Es ist erschreckend, wie wenig du weißt«, antwortete sie. »Der Parthenon ist Teil der Anlage.«
Ich setze gerade zu einer Erwiderung an, als mich Tim am Arm zog und den Kopf schüttelte. »Lass es lieber«, zischte er mir zu.
Die Kern beschleunigte ihre Schritte und ich blieb mit meinem Freund hinter ihr zurück. Es sah schon lustig aus, wie sich die wilde Hilde den Hang hochkämpfte. Sie war etwa einen Kopf kleiner als ich, wog dafür aber das Doppelte. Ich fand es nur gerecht, dass es ihr am meisten Probleme bereitete, in dieser Hitze über die Steine zu steigen. Schließlich war sie es gewesen, die unbedingt hierher wollte.
»Übertreibe es nicht«, sagte Tim.
»Was habe ich denn Schlimmes gesagt?«
»Wenn du dir keine Fünf im Abschlusszeugnis einfangen willst, ärgere die wilde Hilde nicht. Du weißt, wie nachtragend sie sein kann.«
»Lass uns einen Zahn zulegen«, sagte ich und deutete auf die anderen. Die Ersten aus unserer Klasse hatten die Plattform bereits erreicht und blieben zwischen den mächtigen Säulen des Tempels stehen. Tim und ich waren die Letzten, die bei der Ruine ankamen.
»Das ist absolut sinnlos«, sagte ich so leise, dass nur mein Freund mich hören konnte.
»Ja. Trotzdem müssen wir da jetzt durch. Lass uns die Sache hinter uns bringen. So schlimm wird es schon nicht werden.«
»Du hast recht. Aber heute Abend spülen wir uns dann den Staub aus der Kehle.« Ich grinste meinen Freund an, der nur nickte und den ausgestreckten Daumen nach oben hob. Die Vorbereitungen für die Party waren längst abgeschlossen und wir alle freuten uns darauf. Da konnte uns selbst der Ausflug zur Akropolis die Laune nicht verderben, so beschwerlich er auch sein mochte.
Bereits in der Schule hatte Hilde Kern uns eindringlich darauf hingewiesen, dass wir die Fahrt nach Athen nicht nur zu unserem Vergnügen unternehmen würden, sondern dabei auch etwas lernen sollten. Sie hatte es sich danach nicht nehmen lassen, uns von den vielen Sehenswürdigkeiten vorzuschwärmen, welche die Stadt zu bieten habe.
Tim und ich setzten uns zu den anderen und nutzten die Zeit, etwas zu trinken. Es musste bereits jetzt mindestens 40 Grad warm sein, obwohl wir noch nicht einmal Mittag hatten. Frau Kern war es gelungen, sich den heißesten Tag in dieser Woche auszusuchen, um uns auf den Berg im Zentrum der Stadt zu hetzen. Ihre Androhung, die Akropolis zum Thema der nächsten Klausur zu machen, mussten wir ernst nehmen. In neun Monaten wollten wir unser Abitur machen. Dafür brauchten wir jede gute Note.
»Wann kommt denn unser Führer endlich?« Lars Krämer stellte die Frage, die uns allen auf der Zunge brannte. Es machte keinen Spaß, in der Sonne zu sitzen und zu warten.
»Ich bin bereits hier«, antwortete plötzlich eine fremde Stimme. Ein Grieche trat zwischen den Steinsäulen hervor und blieb lächelnd in unserer Mitte stehen. »Ihr könnt mich Dimitri nennen.«
Nachdem er jedem von uns freudestrahlend die Hand geschüttelt hatte, drehte sich Dimitri zu den Resten des Tempels um. »Der Parthenon ist der zentrale Tempel der Akropolis und wurde unserer Stadtgöttin geweiht. Von ihr hat die Stadt ihren Namen bekommen.«
»Weiß jemand von euch, um welche Göttin es sich handelt?«, fragte Hilde Kern in die Runde.
»Das war Pallas Athene«, antwortete Mike Grenzer.
»Sie wurde auch Athene Parthenos genannt. Daher stammt der Name für den Tempel.«
»Das ist richtig«, sagte Dimitri und schaute Mike anerkennend an.
»Ich glaube, mir wird schlecht«, sagte Tim neben mir.
»So ein Streber«, stimmte ihm Anna zu, die sich zwischen meinen Freund und mich gedrängt hatte. Ich wusste, dass das Mädchen mich anhimmelte, wollte aber nichts davon wissen. Meine große Liebe war Sandra, die sich aber wiederum nur für Mike interessierte. Keiner verstand, warum dies so war. Grenzer war ein arroganter Kerl, der sich nicht um seine Klassenkameraden scherte und sie eher verpfiff, als sie bei sich abschreiben zu lassen. Niemand mochte ihn. Doch ausgerechnet Sandra fiel auf Mikes Masche herein und strahlte ihn auch jetzt an.
»Weißt du auch, wie Athene zur Stadtgöttin wurde?«, fragte Dimitri.
»Nein«, entgegnete mein Klassenkamerad kleinlaut.
»Ist es zu glauben, dass der große Mike Grenzer einmal nicht alles weiß?«
»Sei still, Tim!«, sagte Frau Kern.
Ich musste mir das Lachen verkneifen und sah zu Sandra, die Tim böse anschaute. Sie war die Einzige, die den Spruch meines Freundes nicht lustig fand.
»Der Legende nach buhlten Poseidon und Athene um die Schirmherrschaft einer Stadt«, fuhr Dimitri fort, ohne sich von den Zwischenrufen stören zu lassen. »Es kam zu einem Wettstreit. Wer den Menschen der Stadt das nützlichere Geschenk machte, sollte der neue Schutzpatron sein.«
»Worum ging es dabei?«, fragte Mike und trat einen Schritt dichter an unseren Führer heran.
»Das wollte uns Dimitri gerade sagen«, sagte ich und schüttelte verärgert den Kopf. Es war wirklich widerlich, wie Mike den Mann vollschleimte. Das Schlimmste daran war, dass er dafür vermutlich bei Frau Kern weitere Pluspunkte sammeln würde. Meine Chancen bei Sandra waren dagegen durch meine Bemerkung wohl weiter gesunken.
»Poseidon gab der Stadt einen Brunnen, der jedoch nur Salzwasser spendete und damit unbrauchbar war«, sagte Dimitri. »Von Athene bekamen die Menschen einen Olivenbaum, dessen Holz und Früchte sie nutzen konnten. Damit wurde sie die Schutzgöttin der Stadt, die seither ihren Namen trägt.«
»So ein Unsinn!«, brach es aus mir hervor. »Das ist doch alles nur Aberglaube.«
»Der Glaube der Menschen war in der Antike die Grundlage ihrer Existenz«, sagte Dimitri leicht verärgert.
»Die mächtigen Tempel beweisen, welchen Ruhm die Götter damals genossen.«
»Wer glaubt denn heute noch, dass diese Götter tatsächlich existierten?«, legte ich nach.
»Es reicht jetzt, Ralf«, sagte Frau Kern mit schneidender Stimme.
Ich verstand in diesem Moment selbst nicht, was mich dazu bewog, eine Diskussion mit dem griechischen Führer anzufangen, der einfach nur seinen Job tat. Ich ärgerte mich über Mike und vor allem darüber, wie sehr Sandra diesen schmierigen Typen anhimmelte. Die anderen aus meiner Klasse grinsten mich an. Ich wusste, dass sie alle auf meiner Seite standen, wenngleich das auch keiner offen zugeben würde.
»Man sollte diesen Berg einfach wegsprengen und etwas bauen, mit dem die Menschen auch etwas anfangen können«, sagte ich kurze Zeit später. Dimitri führte uns durch den Parthenon und ich hatte es längst aufgegeben, seinen Worten zu folgen. Der Grieche schien sprechen zu können, ohne Luft holen zu müssen. Er redete und redete und redete.
Gemeinsam mit Tim und Anna war ich ein Stück zurückgeblieben. Die Worte des Führers rieselten an mir herab. Ich hörte nicht zu, was der Mann sonst noch über sein Heiligtum erzählte. Es war mir egal.
»Was würdest du denn bauen?«
»Ein Einkaufszentrum«, beantwortete ich Annas Frage grinsend.
Wir mussten alle drei lachen und fingen uns erneut einen bösen Blick von der wilden Hilde ein.
»Mal im Ernst«, sagte ich. »Ich wäre lieber zu den alten Sportstätten von Olympia gefahren, als hier herumzulaufen.«
»Dort gib es auch nicht mehr als alte Steine«, entgegnete Tim.
»Das ist etwas anderes«, sagte ich voller Überzeugung. Inzwischen hatten wir die Ausgangsposition unseres Rundgangs wieder erreicht und ich hatte das Gefühl, dass es noch heißer geworden war. Vor lauter Sonne und überflüssigem Gerede wurde mir schon leicht schummrig.
»Wir werden nun zum Dionysos-Theater gehen«, sagte Dimitri und zerstörte damit meine Hoffnung, schnell wieder im Bus zu sitzen. Dicht gefolgt von Mike, der während des gesamten Rundganges nicht von seiner Seite gewichen war, schritt er über einen steinigen Weg zum Südhang der Akropolis.
»Du bist ein Idiot!«, sagte Sandra, als sie an mir vorbeiging.
Selbst ich musste zugeben, dass der Anblick vom oberen Ring des Amphitheaters überwältigend war. Wir blickten hinunter zur Bühne. Über dreißig Sitzreihen zogen sich halbrund über den Hang. In der Mitte war ein breiterer Gang. Auf der gegenüberliegenden Seite war, wie Dimitri erklärte, der verbliebene Rest des Bühnenbaus zu sehen, eine Mauer mit vielen Fenstern und Durchgängen.
Durch einen der Wege zwischen den Sitzreihen gingen wir nach unten zur Bühne. Dort angekommen versammelten wir uns um unseren griechischen Führer und warteten auf seine Ausführungen. Ich hoffte, dass diese schnell beendet sein würden und wir dann zu einem schattigeren Ort gehen konnten. Gnadenlos brannte die Sonne auf uns herab und trieb uns den Schweiß aus allen Poren. Obwohl es noch nicht lang her war, dass ich etwas getrunken hatte, war mein Mund ausgetrocknet.
»Das Theater fasste in seiner Glanzzeit etwa 17.000 Zuschauer«, erklärte Dimitri. »Es verfügte über 78 Sitzreihen. Die Vorderste bestand aus Marmorsitzen, die besonderen Würdenträgern vorbehalten waren.«
»Wurden den Göttern hier auch Opfer dargebracht?«, fragte Mike.
»Am liebsten würde ich ihn opfern«, flüsterte ich Tim zu. Wieder musste ich mir den Schweiß von der Stirn wischen. Was war denn heute los mit mir? Auch wenn ich die enorme Hitze von zu Hause nicht gewohnt war, hatte sie mir bisher nichts ausgemacht. Am Morgen hatte ich mich noch fit gefühlt. Jetzt spürte ich ein flaues Gefühl im Magen, das ich mir nicht erklären konnte.
»Ja«, antwortete Dimitri. »Hauptsächlich war es aber das Schauspiel, von dem sich die Athener hier im Theater erfreuen ließen.«
»Was ist mit dir?«, hörte ich Tims Stimme.
»Es ist nichts«, antwortete ich. »Mir ist es einfach nur zu warm.«
Plötzlich spürte ich einen leichten Schwindel. Ich bekam nur noch die Hälfte von dem mit, was um mich herum gesprochen wurde, und ich erkannte die Menschen um mich herum nur schemenhaft. Das flaue Gefühl in meinem Bauch weitete sich aus. Ich spürte den Druck, der von meinem Magen ausging, und hatte Angst, mich mitten zwischen meinen Klassenkameraden übergeben zu müssen.
»Du bist kreidebleich im Gesicht.«
Ich konnte meinem Freund, dessen Gestalt langsam vor meinen Augen verschwamm, nicht antworten und versuchte, mich mit den Händen irgendwo festzuhalten. Es kam mir vor, als liefe ich auf einem Schwamm und meine Beine drohten unter meinem Gewicht einzubrechen. Ich merkte noch, wie mich jemand an der Schulter festhielt. Dann ging ich zu Boden.
Giganten aus Stein
Die Stimme drang zu mir wie durch dichten Nebel und ich konnte nicht verstehen, was gesprochen wurde. Es interessierte mich auch nicht. Ich hielt die Augen fest geschlossen, aber der plötzliche Schwindel in meinem Kopf wollte nicht verschwinden. Jemand rüttelte mich an der Schulter.
»Geh zu deiner Gruppe, oder du bekommst meine Peitsche zu spüren.«
Ich öffnete langsam die Augen. Es dauerte einen Moment, bis sich der Schleier lüftete und ich erkennen konnte, wer mit mir sprach. Ausdruckslos starrte ich den fremden Mann vor mir an. Er trug nur eine Art Hemd, das ihm bis zu den Knien reichte, und keine Schuhe. Wer war der Kerl und was wollte er von mir?
»Du hältst alle Arbeiter auf. Es ist schon schlimm genug, dass du zu Arbeitsbeginn nicht hier warst. Die Strafe des Chafre wird dich treffen, wenn du meinen Anweisungen nicht sofort folgst.«
Was war mit dem Kerl los? Ich hatte immer noch das Gefühl Spinnenweben in meinem Kopf zu haben. Wo waren Tim und die anderen? Verwirrt blickte ich an dem Fremden vorbei und traute meinen Augen nicht. Von weit oben sah ich auf eine riesige Wüstenkulisse herab. Es gab keine Häuser und keine Straßen. Nur Sand, so weit das Auge reichte. Die Umgebung war mir völlig fremd und ich hatte nicht die geringste Vorstellung, wo ich mich befand.
»Ich warne dich kein weiteres Mal!«
Ein kurzer Blick in das Gesicht des Fremden reichte mir, um zu erkennen, dass er es ernst meinte. Also stand ich mühsam auf und ging mit unsicheren Schritten zu den anderen Männern, die mich bereits erwarteten und böse anschauten. Wo war ich? Und wie kam ich hierher?
Meine Gedanken überschlugen sich, ohne dabei zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn sich jemand einen Scherz mit mir erlaubte, hatte er sich größte Mühe damit gegeben. Jedes Detail wirkte echt. Was war hier los?
Erst einmal versuchte ich, mich in der ungewohnten Umgebung zu orientieren. Ich befand mich auf einer riesigen Rampe, die steil nach oben führte. Links von mir stand eine Mauer und auf der anderen Seite ging es senkrecht in die Tiefe.
Die Gruppe, zu der ich geschickt worden war, bestand mit mir aus vierzehn Männern, die in zwei Siebenerreihen hintereinander aufgestellt waren und an unterarmdicken Tauen zogen. Ratlos nahm ich meinen Platz am Ende der linken Reihe ein.
Die Seile waren an einem Steinblock befestigt, der fast die Größe eines Kleinwagens hatte. Ich schätzte sein Gewicht auf über eine Tonne. Die Rampe, auf der wir den Stein hochzogen, war mit Schlamm ausgegossen, den die Hitze aber ausgetrocknet und ihm somit seine Gleitwirkung entzogen hatte.
Meine innere Stimme sagte mir, dass es das Beste wäre, mich zunächst einfach ruhig zu verhalten und abzuwarten, was passierte.
Die anderen Männer waren mindestens einen Kopf kleiner als ich, hatten schwarze Haare und waren sonnengebräunt. Sie trugen keine Schuhe und nur weiße Schürzen oder Hemden. Verblüfft stellte ich fest, dass ich die gleiche Kleidung anhatte. Wie war das möglich?
Wir kamen nur sehr langsam voran. Die Taue rieben über meine Handflächen, die entsetzlich schmerzten. Die Sonnenstrahlen taten ein Übriges und trieben mir den Schweiß auf die Stirn. Das Atmen fiel mir zunehmend schwerer. Die keuchenden Laute meiner Leidensgenossen verrieten mir, dass es ihnen nicht besser ging. Um Luft ringend, zogen wir den Felsbrocken Zentimeter für Zentimeter vorwärts.
Jeder kleine Stein, auf den ich mit meinen nackten Füßen trat, ließ die Schmerzen bis zu meinen Oberschenkeln emporschießen. Hinzu kam die Angst, auf dem unebenen Boden den Halt zu verlieren und in die Tiefe zu stürzen. Was sollte das alles?
Zum Glück konnte ich fünf Meter vor mir eine Biegung erkennen und hoffte, mehr zu sehen, wenn wir sie erst einmal passiert hatten. Lange würde ich diese Strapaze nicht mehr aushalten.
Was ich dann sah, konnte mir nicht gefallen. Der Weg ging etwa hundert Meter weiter, bevor er erneut hinter einer Biegung verschwand. Meine letzte Hoffnung war, dass die Rampe die Höhe der Mauer neben uns an der nächsten Ecke fast erreicht hatte. Es konnte also nicht mehr viele Kurven geben, bis wir endlich am Ziel waren. Im letzten Drittel der Steigung konnte ich vor mir eine weitere Gruppe erkennen, die ebenfalls einen an Taue gebundenen Stein in die Höhe zog. Hinter dem Block gingen zwei Männer, die ihn mit langen Holzstangen abstützten. Im selben Moment sah ich, wie von oben ein weiterer Arbeitstrupp herunterkam. Voller Neid blickte ich auf die Männer, die ihre Last bereits losgeworden waren. Da sie auf der schmalen Rampe an uns vorbei mussten, durften wir kurz stehen bleiben.
»Was war denn eben mit dir los?«, fragte der Mann neben mir.
»Ich hatte plötzlich keine Kraft mehr und bin umgefallen«, antwortete ich ihm. Damit hatte ich noch nicht einmal gelogen, wenn es auch nur die halbe Wahrheit war.
Endlich passierten uns die Männer des anderen Arbeitertrupps. Während der Aufseher uns schon wieder antrieb, blickte ich mich erneut kurz um. Auf der rechten Seite konnte ich einen breiten Strom erkennen, auf dem einige Schiffe unterwegs waren, die weitere Steine brachten. Viel Material konnten sie nicht aufnehmen. Ich sah, dass die vollen Schiffe sehr viel tiefer im Wasser lagen, als die entladenen. Die Kähne waren nicht größer als ein Reisebus und hatten nur ein Segel. Aus der Seite schauten Ruder heraus.
Wieder schleppten wir uns Zentimeter für Zentimeter voran. Am liebsten hätte ich mich einfach fallen lassen und wäre liegen geblieben. Egal was dieser nervende Aufseher dann auch mit mir gemacht hätte. Aber die Angst, dass die ganze Gruppe bestraft werden würde, trieb mich weiter. Die Strecke zur nächsten Biegung zog sich länger hin als erwartet. Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren und es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis wir die Ecke erreichten und ich wieder einen Blick in die Tiefe werfen konnte.
Am Ufer war eine stattliche Ansammlung Hütten aufgebaut, die bestimmt über zehntausend Bewohner aufnehmen konnten. Aber ich konnte keine Menschen in dieser Siedlung entdecken. Auch sonst sah ich, außer am Ufer, wo weitere Steine von einem Schiff entladen wurden, niemanden. Anscheinend gab es keinen, der nicht bei den Bauarbeiten half. Die ganze Szene um mich herum gab mir das Gefühl, mich weit, weit in der Vergangenheit zu befinden. Aber konnte das möglich sein?
»Du darfst den Aufseher nicht weiter verärgern«, sprach mich mein Nebenmann erneut an. »Wenn er dich dem Pharao meldet, hast du eine grausame Strafe zu erwarten.«
»Ja, natürlich.«
»Wie heißt du eigentlich?«, fragte ich ihn.
»Ich bin Sevas.«
»Ich heiße Ralf.«
»Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, dessen Haare die Farbe des Sandes haben. Woher kommst du?«
»Aus Köln«, antwortete ich. Wenn mir meine Situation in diesem Moment nicht so ausweglos erschienen wäre, hätte ich wahrscheinlich über Sevas gelacht. Es war schon komisch, dass ich derjenige sein sollte, der sich auffällig benahm.
»Ich habe noch nie etwas von dem Land gehört.«
»Es liegt sehr weit entfernt«, sagte ich.
Du hast ja keine Ahnung, wie weit, dachte ich. Es war völlig verrückt, aber offensichtlich war ich fast fünftausend Jahre in der Zeit zurückgereist und half beim Bau einer Pyramide. Aber warum konnte ich die Ägypter dann verstehen? Auch Sevas schien mit der deutschen Sprache kein Problem zu haben, sah man einmal davon ab, dass er einige Wörter nicht kannte.
Die Hoffnung, dass dies alles nur ein schlimmer Traum war, hatte ich aufgegeben. Dafür waren die Schmerzen zu real. Mit blutverschmierten Händen zog ich weiter am Seil und war sicher, meine Finger nie wieder normal bewegen zu können.
Mittlerweile hatte die andere Gruppe uns passiert und wir konnten weiter gehen.
Der Schmerz schoss wie ein glühender Strahl durch meine Schulter, als sich das Tau spannte und wir die Last weiter vorwärts ziehen mussten. Während wir uns die Rampe hochkämpften, hing ich weiter meinen Gedanken nach.
Sollte ich mich wirklich im alten Ägypten befinden? Und wenn ja, wie kam ich hierher? Ich erinnerte mich daran, dass ich mit meinen Klassenkameraden die Akropolis in Athen besucht hatte. Plötzlich war mir schwindelig geworden. Erwacht war ich hier, direkt vor diesem Aufseher. Aber wie war das möglich? Es musste doch eine logische Erklärung für all das geben. Nur, wer konnte sie mir nennen?
Endlich hatten wir auch die nächste Biegung und damit das Ende der Rampe erreicht. Mir bot sich ein überwältigendes Bild. Als ich die gesamte Wahrheit erkannte, überkam mich das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Fassungslos starrte ich den Giganten aus Stein an, der sich direkt vor uns auftürmte. Das gewaltige Bauwerk erinnerte mich an einen Berg und musste rund einhundertfünfzig Meter hoch sein. Die Ausmaße waren so gewaltig, dass man den Kölner Dom bestimmt fünfmal darin hätte unterbringen können. Die schneeweißen Außenwände waren absolut glatt. Es sah aus, als würde sich die Spitze in die langsam untergehende Sonne bohren. Nie in meinem Leben hatte ich etwas derartig Schönes gesehen. Der mächtige Bau zog mich völlig in seinen Bann.
Ich fragte mich, für welchen Pharao das Grabmal wohl gebaut wurde, an dem wir jetzt arbeiteten. Ich erinnerte mich an Bilder von drei mächtigen Pyramiden, die wir im Unterricht gesehen hatten, und wusste, dass die älteste die des Cheops war. Der Geschichtsunterricht der wilden Hilde war also nicht völlig umsonst gewesen. Wer aber nach Cheops über die Ägypter geherrscht hatte, wusste ich nicht. Ich konnte auch schlecht Sevas fragen, der mich endgültig für verrückt erklären würde.
»Träumst du wieder?«, knurrte eine verärgerte Stimme neben mir.
Als ich aufblickte, sah ich, dass wir eine Plattform erreicht hatten, auf der insgesamt sechs Arbeitertrupps dabei waren, ihre Last an die richtige Position zu bringen. Mir kam es so vor, als würde die Sonne hier noch heißer auf uns herabbrennen. Meine Haut glühte und wenn ich nicht bald in den Schatten käme, würde ich dieses unfreiwillige Abenteuer sicher nicht überleben. Der Untergrund bestand an dieser Stelle aus Stein und machte das Vorwärtskommen noch schwieriger als auf der Rampe, die sich rund um die Pyramide zog. Mit vereinten Kräften schafften wir es schließlich, den Koloss an die richtige Position zu bringen, die uns einer der Ägypter zuwies. Er war als Einziger mit einem Turban bekleidet, der seinen Kopf vor der glühenden Sonne schützte. Ich vermutete in ihm einen Aufseher oder eine Art Architekt.
»Für heute haben wir es geschafft«, sagte Sevas. »Wir werden jetzt zum Essen gehen, und dann bis morgen ausruhen.«
Entsetzt sah ich ihn an. »Sollen wir etwa morgen wieder so einen Brocken hier hochziehen?« Mein ganzer Körper schmerzte und der Gedanke, die gleiche Tortur am nächsten Tag noch einmal über mich ergehen lassen zu müssen, gab mir den Rest. Der Ägypter sah mich kurz irritiert an, sagte aber nichts. Gemeinsam mit den anderen Arbeitern machte ich mich an den Abstieg. Nun bekam ich auch die vierte Seite der Pyramide zu sehen. Hunderte von Arbeitern waren am Ufer des Nils damit beschäftigt, mit Hammer und Meißel einen Felsen zu bearbeiten. Konnte es sein, dass hier die berühmte Sphinx entstand? In diesem Moment interessierte mich die Antwort auf diese Frage jedoch nicht sonderlich. Ich hatte nur noch den Wunsch, mich endlich ausruhen zu können. Hinzu kam der Hunger. Ich wusste nicht genau, wann ich das letzte Mal etwas gegessen hatte. Mir blieb nichts anderes übrig, als Sevas zu folgen. Er würde schon wissen, was als Nächstes zu tun war.
Sevas und ich reihten uns in die lange Schlange von Arbeitern ein, die geduldig auf ihr Essen warteten. Über einem Feuer hing ein Topf, aus dem sicherlich einige hundert Menschen satt werden sollten. Neugierig schaute ich auf die weiße Pampe, die uns serviert wurde. Ich hätte mir jetzt lieber ein saftiges Steak gewünscht, als diesen eigenartigen Reisbrei zu essen. Trotzdem nahm ich meine Portion dankbar entgegen. Die anderen schaufelten das Zeug begeistert in sich hinein. So schlecht konnte es also nicht schmecken.
»Chafre dankt dir für deine Arbeit«, sagte der Ägypter, der mir die Schale überreichte.
»Danke!«, antwortete ich schlicht.
Da Sevas der Einzige war, den ich bisher kennengelernt hatte, setzte ich mich zu ihm. Wer ist dieser Chafre?, dachte ich, während ich zögernd das Essen probierte. War er vielleicht der Pharao, für den wir die Pyramide bauten?
Auch wenn der Brei nach gar nichts schmeckte und mir zwischen den Zähnen klebte, leerte ich die Schale gierig bis auf den letzten Rest.
»Wo sind eigentlich die Wachen?«, fragte ich Sevas, als ich sah, dass auch er mit dem Essen fertig war.
»Welche Wachen?«
»Wir werden doch sicherlich bewacht, damit wir nicht fliehen können.«
»Warum fliehen?« Sevas schaute mich verblüfft an.
»Wir sind doch keine Gefangenen.«
»Also ist noch nie jemand abgehauen?«
»Nein, warum denn? Es ist doch eine Ehre und unsere Pflicht, am Bau des Grabmals des göttlichen Chafre mitzuarbeiten. Er versorgt uns mit Essen und Kleidung und wir haben einen Platz zum Schlafen.«
»So ist das also. Ich habe immer angenommen, die Pyramiden würden von Sklaven gebaut werden.«
»Was hast du für seltsame Ideen. Arbeitest du nicht gerne für den mächtigen Pharao?«
»Doch, natürlich«, sagte ich schnell, um Sevas nicht noch misstrauischer zu machen. Auf keinen Fall durfte er mich den Aufpassern melden, die es sicherlich gab. Jemand musste schließlich für den zügigen Fortgang der Bauarbeiten verantwortlich sein.
»Jedes Jahr, wenn der Nil unsere Felder mit Schlamm überschwemmt, kommen wir für vier Monate her, um beim Bau der Pyramide zu helfen«, erzählte Sevas weiter. »Woher kommst du, dass du nichts von alledem weißt, obwohl du doch hier arbeitest?«
Jetzt hatte ich ein Problem. Wie sollte ich Sevas erklären, dass ich eigentlich erst fünftausend Jahre später lebte, wo die Pharaonen und ihre Pyramiden längst Geschichte waren? Ich musste mir schnell eine glaubwürdige Ausrede einfallen lassen.
»Ich bin als Sklave aus meinem Land verschleppt worden«, sagte ich. »Wir waren eine große Gruppe, zu der auch Frauen und Kinder gehörten. Unsere Peiniger haben uns geschlagen und gedemütigt. Vor einigen Wochen jedoch gelang es mir, zu fliehen. Ich habe mich bei euch versteckt, weil ich Angst hatte, meine Häscher würden mich töten, wenn es ihnen gelänge, mich wieder zu fangen. Auch mir ist es eine Ehre, an diesem Bauwerk mitzuarbeiten, das für die Ewigkeit geschaffen wird.«
Jetzt konnte ich nur hoffen, dass mir Sevas die Geschichte abkaufte und nicht auf die Idee kam, dass ägyptischen Häscher mich suchten, denen er mich vielleicht ausliefern könnte. Ich musste sein Mitleid erwecken, ihm gleichzeitig aber auch meine Treue zu seinem Pharao glaubhaft machen. Natürlich hatte ich nicht vor, länger als unbedingt notwendig hier zu bleiben. Solange ich aber keine Möglichkeit fand, nach Hause zu kommen, war ich bei Sevas sicher am besten aufgehoben.
Einen Moment sah er mich unsicher an. Schließlich nickte er und stand auf. Unser »Mahl« hatten wir mittlerweile beendet, und ich war gespannt, wie es weitergehen würde.
»Hast du eine Unterkunft?«
»Nein, leider nicht.«
»Folge mir«, sagte Sevas.
Gemeinsam schritten wir durch eine schmale Gasse, die sich durch die Barackenstadt zog. Obwohl ich beim Essen auch einen Becher Wasser getrunken hatte, fühlte sich mein Körper völlig ausgetrocknet an. Ich schwitzte nicht einmal mehr in der immer noch stickigen Hitze. Meine Füße schienen nur noch aus rohem Fleisch zu bestehen, jeder Schritt schmerzte.
Die meisten Unterkünfte, an denen wir vorbeikamen, bestanden aus gewebten Planen, die von dünnen Holzstangen gestützt wurden. Jetzt sah ich auch zum ersten Mal Frauen. Sie trugen Wasserkrüge oder waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Schließlich blieb Sevas vor einer der Hütten stehen. Sie bestand aus Stein und gehörte eindeutig zu den besseren Behausungen. Allein würde ich den Weg durch die engen Gassen nicht wiederfinden. Es war beeindruckend, wie sich Sevas und die Anderen in diesem Getümmel zurechtfanden. Obwohl ich in einer Großstadt wohnte, hatte ich selten so viele Menschen auf so engem Raum gesehen. Von überall her drang lautes Geschrei und Stimmengewirr zu mir. Der Geruch nach Schweiß und Exkrementen machte das Atmen zur Qual. Der Druck in meinem Magen setzte sich im Hals fort und ich hatte das Gefühl, mich jeden Moment übergeben zu müssen.
»Hier kannst Du heute Nacht schlafen«, sagte Sevas und wies auf eine Ecke, in der zwei Decken lagen. »Morgen werden wir dann wieder gemeinsam zur Arbeit gehen.«
Ich bedankte mich bei meinem neuen Freund und war froh, mich endlich ausstrecken und ein wenig erholen zu können. Selten zuvor war ich auch nur annähernd so kaputt und müde gewesen. Meine Haut brannte wie Feuer und ich war sicher, dass sich am nächsten Tag die ersten Fetzen daraus lösen würden.
Ich breitete eine Decke auf dem trockenen Gras aus, legte mich auf das Lager und nahm die Zweite, um mich zuzudecken. Das provisorische Bett war bequemer, als ich erwartet hatte. Obwohl jeder Muskel nach Erholung und Schlaf schrie, ließen mir Gedanken keine Ruhe. Wie und warum war ich in diese Gegend gekommen? Was hatten die Kern und meine Klassenkameraden unternommen, als ich plötzlich verschwunden war? Vermisste mich außer meinem besten Freund Tim und Anna überhaupt jemand aus der Gruppe? Sandra wäre es sicher egal, wenn sie mich niemals wieder sehen musste. Mit diesen traurigen Gedanken schlief ich irgendwann ein.
Als mich Sevas am nächsten Morgen weckte, hatte ich das Gefühl, sterben zu müssen. Es gab keine Stelle an meinem Körper, die mir nicht wehtat. Besonders schlimm war es an den Handgelenken, die von einer dicken Blutkruste umgeben waren. Meine Hoffnung, dass alles nur ein Traum war und ich wieder in meiner gewohnten Umgebung aufwachen würde, erfüllte sich leider nicht. Die brütende Hitze und der Sand in der Luft bewiesen mir, dass ich mich noch immer in Ägypten befand.
Am liebsten wäre ich einfach auf meinem Lager liegen geblieben, doch Sevas kannte keine Gnade.
»Wir werden bestraft, wenn wir nicht pünktlich bei der Fähre sind«, sagte er.
»Bei welcher Fähre?«, fragte ich müde.
»Wir müssen auf die andere Seite des Nils in den Steinbruch. Oder denkst du, die Steine kommen über den Nil geschwommen?«
Verblüfft schaute ich Sevas an. Es war das erste Mal, dass der drahtige Ägypter einen Ansatz von Humor zeigte. Bisher hatte ich mir wenig Gedanken darüber gemacht, warum ich die Sprache der Arbeiter verstand, und es einfach hingenommen. Ich hätte eine altertümlichere Wortwahl erwartet, aber mit Sevas konnte ich mich genauso locker unterhalten wie mit Tim oder Anna.
Nach einem einfachen Frühstück mit Wasser und einem dunklen Fladenbrot, das überraschend gut schmeckte, machten wir uns auf den Weg zum Flussufer. Wir gingen an einer mit Bohlen ausgelegten Straße vorbei, die von der Pyramide zum Fluss führte. Sicher war sie angelegt worden, um auf ihr die schweren Steinbrocken zum Grabmal zu transportieren.
Vor einer Holzfähre, die aussah wie ein übergroßer Holzkasten und Platz für zweihundert Arbeiter bot, hatten sich die Bauern in Gruppen zu jeweils acht Männern aufgestellt. Sevas und ich reihten uns in eine der Gruppen ein und warteten darauf die Fähre zu besteigen. So richtig überzeugt war ich von dieser Art der Flussüberquerung nicht. Die starke Strömung ließ mich zweifeln, ob wir das andere Ufer erreichen konnten, ohne abgetrieben zu werden.
Ich hatte gehofft, während der Überfahrt noch etwas ausruhen zu können, aber daraus wurde nichts. Je eine Arbeitergruppe setzte sich an eines der sechzehn Ruder, die gleichmäßig auf beide Seiten der Fähre aufgeteilt waren. Wir saßen in einer Reihe nebeneinander und hielten die langen Stangen mit beiden Händen fest.
Jetzt fehlt nur noch der Trommler, dachte ich und erinnerte mich an die Filme, in denen ich Galeeren mit Sklaven gesehen hatte, die immer von kräftigen Schlägen auf einer großen Trommel angetrieben wurden. Aber auch ohne einen solchen Sklavenschänder steuerten die Ägypter die Fähre mit gleichmäßigen Zügen an das andere Ufer. Die Ausdauer und Disziplin der Männer konnte ich nur bewundern. Für mich wurde die Überfahrt zur reinsten Tortur. Stechende Schmerzen durchzogen meinen gesamten Körper, der sich auf diese Weise über die Behandlung des letzten Tages beschwerte. Mein Kopf stand kurz davor unter der Hitze zu platzen und meine Haut brannte wie die Hölle.
Als wir endlich auf der anderen Seite des Flusses angekommen waren, verließen wir die Fähre und schritten, wiederum nach Arbeitergruppen geordnet, einen sandigen Weg entlang in Richtung Steinbruch. Mit jedem Schritt gewöhnten sich meine Muskeln ein bisschen mehr an die Strapazen. Die Neugierde auf die kommenden Ereignisse drängte nun die Gedanken an die Schmerzen zurück und verlieh mir frischen Tatendrang. Ich war gespannt, wie wir es anstellen wollten, die mächtigen Steinblöcke aus dem Fels zu hauen.
Im Steinbruch wurden wir von einem Vorarbeiter eingewiesen. Wir sollten einen Steinblock aus dem oberen Drittel des Hanges, der schätzungsweise zwanzig Meter hoch war, heraustrennen. Auf dem Fels war bereits eine schwarze Linie eingezeichnet, die die Maße des Steines markierte.
»Kannst du überhaupt mit Hammer und Meißel umgehen?« Sevas drückte mir das Werkzeug in die Hand und sah mich zweifelnd an.
»So schwer wird das wohl nicht sein«, antwortete ich.
Sevas grinste nur und begann dann, den Stein entlang der Trennlinie abzustemmen.
Hammerkopf und Meißel bestanden aus Kupfer, der Griff aus Holz. Ich folgte dem Beispiel meines Freundes und begann ebenfalls, den Fels zu bearbeiten. Da ich meinem Vater oft beim Hausbau geholfen hatte, fiel mir die Handhabung dieser einfachen Werkzeuge leicht.
»Du steckst wirklich voller Überraschungen.« Sevas warf mir einen anerkennenden Blick zu. »So wie du dich bisher angestellt hast, habe ich schon befürchtet, du würdest dir mit dem Hammer deine eigene Hand kaputtschlagen.«
»Mach dir keine Sorgen um mich«, sagte ich und wechselte dann das Thema. »Glaubst du wirklich, dass wir es schaffen, den Stein so aus dem Fels zu lösen?«
»Ja. Was glaubst du, wie wir das mit den anderen gemacht haben.«
Ich betrachtete den Block zweifelnd. Seine Außenwände waren erstaunlich glatt. Er war etwa einen Meter hoch und breit und zwei Meter lang. Sevas und ich arbeiteten an der Kopfseite des Steines. An der Rückseite waren vier weitere Männer damit beschäftigt, den Block aus dem Fels zu lösen. Die anderen beiden Mitglieder unseres Trupps trieben mit einem Bohrer aus Kupfer an der unteren Begrenzungslinie des Blocks am Boden Löcher in den Stein. Unermüdlich drehten sie die Kurbel, welche die Spirale Millimeter für Millimeter in den Fels drückte.
Überall im Steinbruch waren Männer damit beschäftigt, die Steinbrocken aus dem Fels zu lösen. Die weiterhin unerträgliche Hitze erschwerte die Arbeit zusätzlich.
»Warum haben wir keine Wasserflaschen mitgenommen?«, fragte ich Sevas und wischte mir den Schweiß von der Stirn.
»Es wird gleich etwas zu trinken geben«, sagte der Ägypter.
Wir hatten ungefähr die Hälfte der Trennung in den Fels geschlagen, als endlich ein Horn ertönte, das uns zu einer ersten Pause rief. Das Wasser war sehr warm und schmeckte abgestanden. Froh darüber, meinen Durst löschen zu können, leerte ich den Becher trotzdem bis auf den letzten Tropfen.
Viel zu schnell ertönte das Signal erneut, um das Ende der Pause anzuzeigen.
Mit schmerzenden Gliedern begab ich mich zurück an meinen Arbeitsplatz. Wieder und wieder schlug ich mit dem Hammer auf den Meißel und freute mich über jeden Splitter, den ich aus dem Fels heraustrennen konnte. Endlich gebot uns der Vorarbeiter, unsere Werkzeuge niederzulegen, da wir die notwendige Tiefe erreicht hatten. Neben mir hatten meine Kollegen inzwischen rund ein Dutzend Löcher in den Fels gebohrt.
Ich sah, wie die Männer Taue durch drei durchgehende Öffnungen schoben und sie an der Oberfläche des Blockes verknoteten. Wir befestigten Zugseile, die den schweren Stein später halten sollten. Sevas und ein weiterer Arbeiter nahmen Holzstücke, die sie in Wasserbottichen tränkten und in die restlichen Löcher unter den Fels schoben.
»Jetzt müssen wir warten«, sagte Sevas.
Das ist der beste Satz, den ich heute gehört habe, dachte ich. Gemeinsam gingen wir wieder nach unten, um unsere Essensration abzuholen. Zu meiner Enttäuschung gab es wieder nur diesen Reisbrei. Heute schmeckte mir die Pampe aber schon viel besser, was sicher an meinem riesigen Hunger lag.
Die knackenden Geräusche am Stein ließen mich herumfahren. Das Holz war inzwischen so weit aufgequollen, dass es den Fels an der Seite aufsprengte und den Block freilegte. Lediglich von den Zugseilen gehalten, hing er freischwebend über unseren Köpfen am Berg. Wir mussten den Stein nur noch langsam herunterlassen und konnten mit dem Transport zur Pyramide beginnen.
Eilig kletterte ich mit meiner Gruppe zu der Stelle, an der die Halteseile festgebunden worden waren, um den Block so schnell wie möglich auf den Boden zu bringen. Wir hatten ihn fast erreicht, als das Unglück geschah.
Wie von Geisterhand zerschnitten, riss das linke Zugseil plötzlich ab. Ich sah den Stein wie in Zeitlupe fallen, gab Sevas einen Stoß und sprang ebenfalls zur Seite. Dabei fiel ich hart auf den steinigen Boden und schrie auf. Durch den aufgewirbelten Staub konnte ich nicht erkennen, was um mich herum geschah. Aus dem Nebel heraus hörte ich die gellenden Schreie der Männer, die von den Steinbrocken getroffen wurden. Endlich klärte sich meine Sicht und ich blickte in das entsetzte Gesicht von Sevas, der den Steinschlag zum Glück genauso unverletzt überstanden hatte wie ich.
Einen Moment lang lag eine gespenstische Stille über dem Steinbruch. Dann brach das Chaos los. Schreiend stürzten alle Arbeiter zur Unglücksstelle. Den Vorarbeitern gelang es nicht, Ruhe in die aufgeregte Menge zu bekommen. Alle rannten kreuz und quer durcheinander und entgingen dabei nur knapp einem weiteren Block, der zwischen ihnen zu Boden stürzte. Einer der Aufseher blies in sein Horn. In ihrer Panik reagierten die Männer aber nicht auf das Signal. Erst als sich der Staubnebel gelichtet hatte und keine weiteren Felsbrocken mehr in die Tiefe stürzten, kamen sie wieder zur Besinnung.
Die Arbeiter versammelten sich um einen der Aufseher, der ein Tau in der Hand hielt, mit dem einer der Blöcke gesichert gewesen war. »Das Seil ist angeschnitten«, sagte er und hielt das durchtrennte Ende in die Höhe, damit alle es sehen konnten. »Wir haben einen Verräter unter uns.«
Ein Raunen ging durch die Menge. Für die meisten Männer war es unvorstellbar, dass jemand gegen das Werk des großen Chafre handeln könnte. Die Anschuldigung des Aufsehers hing wie ein schwerer Klotz zwischen den Arbeitern.
»Er ist der Verräter«, schrie Sevas plötzlich und deutete mit dem Zeigefinger auf mich.
Entsetzt starrte ich Sevas an. Wie konnte er nur so etwas behaupten? Er musste doch gesehen haben, dass ich wie alle anderen am Stein gearbeitet hatte und dabei allen Anweisungen gefolgt war.
»Warum vermutest du dies?«, fragte der Aufseher.
»Er ist gestern zum ersten Mal aufgetaucht und hat sehr ungewöhnliche Fragen über den Pyramidenbau gestellt. Zunächst habe ich ihm vertraut und ihm sogar Unterkunft gewährt. Jetzt weiß ich, dass das falsch war, denn er bringt Unheil über uns. Der Pharao möge mir verzeihen.«
Fassungslos hörte ich die Worte. Sevas konnte doch unmöglich glauben, dass ich die Arbeit hier sabotieren wollte. Dabei war ich es gewesen, der ihm vor wenigen Minuten das Leben gerettet hatte. Ich starrte ungläubig auf den Mann herab, der vor dem Aufseher auf die Knie gegangen war.
»Ergreift ihn!«, riss mich dessen Stimme aus meinen Gedanken.
Alle Arbeiter in meiner Nähe stürzten sich auf mich. Sie schlugen, traten und einer holte sogar einen Knüppel hervor und prügelte brutal auf mich ein. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, mich gegen so viele Angreifer zu wehren und krümmte mich vor Schmerzen, als die Hiebe meinen lädierten Körper trafen.
»Chafre, der mächtige Pharao, wird entscheiden, auf welche Art du deinen Tod finden wirst«, zischte Sevas in mein Ohr. Ich verspürte einen heftigen Schlag an meinem Hinterkopf und merkte, wie mir langsam schwarz vor Augen wurde.
Ich fühlte mich, als würde mir jemand ständig mit einem Hammer gegen die Schädeldecke schlagen. Es kam mir vor, als würde mir jeden Moment der Kopf platzen. Ich versuchte, mich aufzusetzen, ließ es dann aber bleiben, weil der plötzliche Schwindel alles vor meinen Augen in tausend Farben zerspringen ließ. Stöhnend wälzte ich mich auf dem Steinboden und presste die Hände gegen die Ohren, als könne ich damit den Schmerz lindern. Es gab keine Stelle, die mir nicht weh tat, und ich fror entsetzlich. Noch immer war ich nur mit einem kurzen Rock bekleidet, doch die Hitze der Sonne war verschwunden. Mein Arm lag in einer schmierigen Lache, aus der mir ein beißender, saurer Geruch in die Nase stach. Der Geschmack in meinem ausgetrockneten Mund war einfach nur ekelhaft und ich hatte Mühe, den Brechreiz zu unterdrücken.
Langsam setzte die Erinnerung wieder ein. Ich dachte an den Pyramidenbau und daran, wie mich die anderen Arbeiter als Verräter beschimpft und zusammengeschlagen hatten. Wo ich mich jetzt befand, wusste ich nicht. Der Raum, in dem ich lag, war fast völlig dunkel. Nur durch eine kleine Maueröffnung, durch die ich nicht einmal die Hand hätte stecken können, schimmerte etwas Mondlicht.
Meine Hoffnung, dieses Verlies schnell wieder verlassen zu können, war verschwindend gering. Und wenn, wohin sollte ich mich wenden? Ich erinnerte mich an die letzten Worte von Sevas, der von meiner Hinrichtung gesprochen hatte. Ich konnte immer noch nicht fassen, wie er mir so etwas Schändliches zutrauen konnte. Würde ich jemals wieder aus dieser Situation herauskommen und den Weg zurück in meine Zeit finden?
Die Kopfschmerzen hatten ein wenig nachgelassen und ich versuchte ein zweites Mal, mich aufzusetzen. Dabei stützte ich mich vorsichtig auf den Händen ab. Ich sah nun, worin ich die ganze Zeit über gelegen hatte. Die Lache neben mir entpuppte sich als mein eigenes Erbrochenes. Weil ich nichts anderes hatte, versuchte ich, meinen Arm wenigstens notdürftig an dem dünnen Rock, den ich trug, abzuwischen, damit mir der Geruch nicht so extrem in die Nase strömte.
Die Kälte kam mir immer beißender vor. Mit zittrigen Beinen stand ich auf, um mir mein Gefängnis näher anzusehen. Ich ging die Wände ab, um nach einem Ausgang zu suchen. Meine Muskeln schmerzten bei jedem Schritt. Leider waren die Mauern aus riesigen Felsquadern fest wie Beton. Wie es aussah, gab es nur einen Weg aus meiner Zelle. Verzweifelt rüttelte ich an der schweren Holztür. Es war zwecklos. Ohne fremde Hilfe würde es mir niemals gelingen, aus diesem Verlies zu entkommen.
In einer Ecke des Raumes fand ich eine zerrissene Decke auf einem Haufen Stroh. Dankbar wickelte ich mich, so gut es ging ein, und ließ mich auf dem Lager nieder. Ich war noch immer so erschöpft, dass ich unter Schmerzen einschlief.
Ein scharrendes Geräusch schreckte mich auf. Ich öffnete die Augen und sah zur Zellentür, die sich langsam nach innen öffnete. Eine gebückt gehende Gestalt betrat das Verlies. Der Mann trug eine völlig verschmutzte Tunika. Seine wenigen weißen Haare hingen ihm in verklumpten Strähnen auf die Schulter. Wahrscheinlich war es nur Einbildung, aber es kam mir in diesem Moment so vor, als wäre der Geruch in meinem Verlies noch schlechter geworden.
»Ich bringe dir Wasser und Essen«, sagte der Alte. Als er den Mund öffnete, blickte ich auf zwei Reihen schwarzer Zähne.
»Ich habe keinen Hunger«, sagte ich. Allein bei dem Gedanken, dass der Kerl das Essen mit seinen schmutzigen Fingern berührt hatte, wurde mir schlecht. Meine ausgetrocknete Kehle lechzte dagegen nach einem Schluck Wasser. Den würde ich nicht ablehnen. Meine Lebenserwartung schien im Moment ohnehin nicht besonders hoch zu sein, sodass ich mir keine Gedanken über die Qualität der Brühe machen musste.
»Du musst etwas essen, Fremder.«
»Wozu?«
»Wenn du nicht bei Kräften bleibst, wirst du ein schlechtes Bild abgeben, wenn du öffentlich hingerichtet wirst.«
»Glaubst du wirklich, dass mich das noch stört, wenn ich ohnehin sterben muss.«
Der Alte hob nur die Schulter. Es schien ihn nicht sonderlich zu interessieren, was ich tat. Er stellte den Becher und eine Tonschale auf den Boden, drehte mir den Rücken zu und ging zum Ausgang. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich ihm folgen und fliehen sollte, ließ es dann aber bleiben. Selbst wenn es mir gelingen würde, den Alten zu überwältigen, würde ich nicht an der Wache vorbeikommen, die die ganze Zeit über an der Zellentür gestanden hatte.
Ich wartete, bis ich wieder alleine in dem Raum war, und kroch dann zu dem Becher mit Wasser. Vorsichtig probierte ich einen Schluck und hätte die Flüssigkeit beinahe wieder ausgespuckt. Es schmeckte furchtbar und ich wollte nicht wissen, wie lange es her war, dass das Wasser aus einem Brunnen geschöpft worden war.
Das Essen rührte ich nicht an. Ich war sicher, dass ich es ohnehin nicht im Magen behalten würde, und gab mich damit zufrieden, endlich etwas trinken zu können.
Ich kroch zurück zu meinem erbärmlichen Lager und wollte mich gerade darauf niederlassen, als sich die Zellentür erneut öffnete. Ich vermutete, dass der Alte wieder kam, um das Geschirr abzuholen. Tatsächlich war es der zerlumpte Kerl von vorhin, der den Raum betrat. Aus den Augenwinkeln registrierte ich, dass diesmal keine Wache an der Tür stand. Der Mann schloss die Tür und kam zwei Schritte auf mich zu.
»Du kannst die Schüssel wieder mitnehmen.«
»Ich bin nicht wegen des Geschirrs hier.«
»Weswegen dann?« Neugierig blickte ich den Alten an. Irgendetwas an dem Kerl war anders geworden.
»Ich bin hier, um dir zu helfen, Ralf.«
»Woher kennst du meinen Namen?«
»Ich weiß noch viel mehr über dich und dein Leben.«
»Rede nicht um den heißen Brei herum. Sag mir, was du von mir willst«, forderte ich den Alten auf, der mir noch immer zutiefst unsympathisch war.
»Ich beobachte dich nun schon seit einigen Wochen.«
»Was soll das heißen?«, fragte ich verärgert. »Willst du damit sagen, dass du mich schon kanntest, als ich noch in meiner eigenen Welt war?«
»Du hast es erfasst«, sagte der Alte mit einem dämlichen Grinsen.
Ich brauchte einen Moment, um zu erfassen, was der Kerl mir damit gesagt hatte. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. »Dann bist du verantwortlich für diesen ganzen Irrsinn? Du hast mich aus dem Kreis meiner Freunde gezogen, die sich jetzt mit Sicherheit genau wie meine Eltern furchtbare Sorgen um mich machen. Du bist schuld, dass ich zusammengeschlagen wurde und hier im Kerker sitze.« Wütend starrte ich den Fremden an.
»So könnte man es formulieren«, antwortete er, noch immer mit diesem dämlichen Grinsen im Gesicht.
Das war wirklich nicht zu fassen. Der Typ hatte mir diese ganze Scheiße eingebrockt und stand nun vor mir, als wäre nichts passiert. »Wer bist du und was willst du von mir?«
»Ich hatte wichtige Gründe, dich hier herzubringen. Beruhige dich! Ohne meine Hilfe wird es dir niemals gelingen, wieder in deine Welt zurückzukehren.« Schweigend starrte der Greis mich an und setzte schließlich hinzu: »Mein Name ist Antipatros!«
»Was hat das alles für einen Sinn?« Jetzt war ich wirklich auf die Erklärungen des Alten gespannt. Er tat so, als müsste die ganze Welt seinen Namen kennen.
»Fast zweitausendfünfhundert Jahre vor deiner Zeit habe ich einen Reiseführer über die größten Meisterleistungen der Baukunst geschrieben. Viele Menschen machten sich auf, um diese Wunder zu besichtigen. So erlangten sie Ruhm und Ansehen in der ganzen bekannten Welt. Doch mit dem Verfall dieser Kunstwerke gerieten im Laufe der Jahrhunderte auch meine Aufzeichnungen immer mehr in Vergessenheit.«
»Was zum Teufel hat das alles mit mir zu tun?«
»Genau das versuche ich dir gerade zu erklären. Nach vielen Jahren begannen die Menschen, sich wieder für ihre Vergangenheit zu interessieren, und wurden auf die großen Bauwerke der Antike aufmerksam, die über zweitausend Jahre zuvor errichtet worden waren. Meine Aufzeichnungen und damit auch mein Name gewannen erneut an Ansehen. In deiner Generation sind diese Dinge aber immer bedeutungsloser geworden. Leuten wie dir, die im Geschichtsunterricht einschlafen und ihre menschenverachtenden Computerspiele jedem historischen Buch vorziehen, ist es zu verdanken, wenn die großen Meisterwerke der Menschheit wieder in Vergessenheit geraten.«
»Und zur Strafe sorgst du dafür, dass ich fünftausend Jahre vor meiner Zeit in einen dunklen und kalten Kerker gesperrt werde, und erwartest dafür auch noch Verständnis? Das kann unmöglich dein Ernst sein!« Langsam aber sicher wurde ich wütend. Was mir der Alte hier erzählte, war absoluter Unsinn. Meine Schmerzen aber waren Realität und zwangen mich zur Ruhe, so gern ich mich auch auf den Kerl gestürzt hätte.
»Ich habe dich unter vielen ausgesucht, die sich genauso wenig für die Geschichte der Antike interessieren wie du.«
»Warum mich?«
»Wer wäre besser geeignet als du, um die Menschen wieder von den alten Werten zu überzeugen.«
»Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst«, regte ich mich auf. Der Kerl hatte ganz offensichtlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Leider befand er sich im Moment in der deutlich besseren Position und ich konnte nichts gegen ihn unternehmen.
»Dein Vater gehört zu den Menschen, die sich der sogenannten modernen Baukunst verschrieben haben. Du eiferst ihm nach und willst ebenfalls einer dieser neumodischen Betonarchitekten werden. Beide würdet ihr am liebsten alle alten Gemäuer abreißen lassen, um Platz für noch mehr Hochhäuser zu gewinnen.«
»Was ist daran falsch. Niemand braucht diese Ruinen.«
»Du wirst deine Meinung noch ändern«, sagte Antipatros. Irgendetwas in seiner Stimme gefiel mir nicht. Er schien sich seiner Sache sehr sicher zu sein und keine Sekunde daran zu zweifeln, dass alles so ablief, wie er es plante.
»Ich habe die Götter auf den Knien angefleht, mir die Macht zu geben, dich auf die Reise zu schicken.«
»Und wozu das alles?«, schrie ich ihn an.
»Ich will, dass du der Menschheit von deinen Erlebnissen erzählst und die Wunder meiner Zeit wieder in ihr Gedächtnis zurückrufst.«
»Das ist doch Unsinn«, regte ich mich auf. »Kein Mensch wird mir glauben, dass ich eine Zeitreise gemacht habe, um alte Ruinen zu besichtigen.«
»Du sollst deine Erlebnisse als Geschichte erzählen, die sich auf tatsächliche Schauplätze stützt. Ich möchte nicht, dass die antike Baukunst wieder in Vergessenheit gerät und sich dann vielleicht nie wieder ein Mensch an mich und meine Zeit erinnert.«
»Wenn das alles ist, warum hast du mir dann nicht einfach ein Buch geschenkt?«
»Hättest du es gelesen?«
»Wahrscheinlich nicht«, gab ich zu. »Trotzdem habe ich keine Lust mehr auf deine Spielchen. Ich will, dass du mich sofort wieder zurückbringst.«
»Das geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Die Götter werden mir keine zweite Chance geben. Wenn du die Reise nicht beendest, wird sie keiner unternehmen und mein Name endgültig in Vergessenheit geraten.«
»Und was, wenn ich nicht will?« Immer mehr wuchs in mir der Verdacht, dass es dem Alten gar nicht nur um die Gebäude ging, sondern er vielmehr Angst hatte, dass sein eigener Name vergessen würde. Mir war auch nicht klar, was irgendwelche Götter für eine Rolle spielen sollten. Bei all den offenen Fragen entschloss ich mich aber, deren Existenz zunächst hinzunehmen. Irgendeine Macht musste schließlich dafür gesorgt haben, dass ich aus meiner Welt gerissen und in die Vergangenheit geschleudert worden war.
»Du hast keine andere Wahl.«
»Wie willst du mich zwingen? Was, wenn ich einfach nur abwarte, bis der ganze Spuk vorbei ist? Ich könnte einfach hier sitzen bleiben und darauf warten, dass ich in meine Zeit zurückkehre«, versuchte ich zu bluffen.
»Das wird nicht geschehen. Wenn du nicht tust, was ich von dir verlange, wirst du für immer in der Vergangenheit verschollen bleiben und sicher nicht lange überleben.«
»Also gut. Mal angenommen ich glaube dir und gehe auf deine Wünsche ein. Wie soll ich bitte schön von den Pyramiden berichten, wenn ich hier in diesem Verlies auf meine Hinrichtung warte? Dein Plan ist offensichtlich gescheitert.«
»Es reicht nicht aus, sie einfach nur zu sehen. Du sollst wissen, wie sie entstanden sind. Und welch eine Meisterleistung es in der damaligen Zeit war, sie zu erbauen. Eine Geschichte kannst du nur erzählen, wenn du auch wirklich etwas erlebt hast, das du mit den Schauplätzen der Vergangenheit verbinden kannst. Mit einem hast du aber recht. Dein Tod hilft mir nicht weiter. Deshalb werde ich dafür sorgen, dass du aus dem Kerker freikommst.«
»Das wäre ein Anfang«, murrte ich. »Und was ist dann? Wie geht es weiter? Gibt es noch weitere Stationen auf meiner Reise?«
»Es sind insgesamt sieben.«
Geschockt sah ich Antipatros an. Wenn ich gleich bei der ersten Station dicht vor dem Tod stand, was würde dann bei den anderen sechs passieren? Das durfte alles nicht wahr sein. Warum nur hatte sich der Alte ausgerechnet mich für seinen wahnsinnigen Plan ausgesucht? Für ihn war es ein Leichtes, diesen Ort zu verlassen, ich aber konnte nun mal nicht durch die Zeit reisen, wie es mir beliebte. »Warum schickst du mich nicht einfach zum nächsten Ziel?«, fragte ich ihn in der Hoffnung, so schnell wie möglich aus diesem Kerker herauszukommen.
»Das kann ich nicht. Auch meine Kräfte sind begrenzt und ich muss sie einteilen. Du wirst deinen Weg aus eigener Kraft gehen müssen. Ich kann dich nicht immer beschützen.«
»Du ziehst mich in die Vergangenheit und erzählst mir, dass du mich nicht retten kannst, wenn ich in Gefahr gerate?«
»So ist es. Du musst herausfinden, wer hinter dem Anschlag im Steinbruch steckt, um das Problem zu lösen.«
»Warum ich?«
»Weil du der Einzige bist, der weiß, dass ein anderer das Seil durchgeschnitten haben muss. Alle anderen denken, der Täter sitzt bereits im Kerker.«
»Wirklich ganz toll. Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen?«
»Es wird dir schon eine Lösung einfallen«, antwortete Antipatros und ging zum Ausgang.
»Warte!«, schrie ich ihm nach. »Du kannst mich doch hier nicht zurücklassen.« Aber es war zu spät. Genauso schnell, wie er erschienen war, machte sich Antipatros wieder aus dem Staub und ließ mich mit meinem Elend allein.
Ich lag auf meinem Lager und dachte über die Worte des Alten nach. Mir war immer noch nicht so richtig klar, von welchen Bauwerken er dauernd gefaselt hatte. Die Cheopspyramide, ja, aber ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, welche weiteren vergleichbaren Werke die Antike noch zu bieten haben sollte. Vielleicht war mein Geist durch die Strapazen der letzten Stunden einfach noch zu verwirrt, um einen klaren Gedanken zu fassen. Der Alte hatte von einer Liste gesprochen, die man in meiner Zeit noch kannte. Sicher hatte auch ich schon davon gehört, konnte mich aber im Moment einfach nicht daran erinnern. Mitten in meinen Gedanken hörte ich erneut ein scharrendes Geräusch. Hatte es sich Antipatros etwa anders überlegt und war zurückgekehrt?
Ich suchte mein Gefängnis nach der Ursache des Geräusches ab, konnte aber nichts entdecken. Das Scharren wiederholte sich. Kleine Steine bröckelten aus der Wand neben mir. Gespannt starrte ich die Stelle an. Plötzlich schob sich einer der großen Felsquader, aus denen der Kerker gemauert war, ein kleines Stück vor. Ein leichter Schauer lief über meinen Rücken. Kam mir etwa wirklich jemand zu Hilfe? Antipatros hatte gesagt, dass er für meine Befreiung sorgen wolle, aber so schnell hatte ich nicht damit gerechnet, dass sich dieses Versprechen auch erfüllte.
Wieder schob sich der Stein ein Stück aus der Wand. Ich sah mit gemischten Gefühlen zu, wie er immer weiter in den Raum hineinragte. Krachend fiel er schließlich zu Boden und wirbelte eine Staubschicht auf, die es mir unmöglich machte, irgendetwas zu erkennen. Ich traute mich aber auch nicht, aufzustehen, um einen Blick in das Loch in der Wand zu werfen.
Plötzlich tauchte ein verschmutztes Gesicht in der Öffnung auf. Zu meinem großen Erstaunen war es eine junge Frau, die sich hustend den Weg in mein Gefängnis bahnte. Sie trug eine eng anliegende Tunika, die so verdreckt war, dass ich die Farbe nicht mehr genau erkennen konnte. Das lange, gelockte Haar war voller Staub und hing ihr ins Gesicht.
Ohne Notiz von mir zu nehmen, stand sie auf und klopfte sich den gröbsten Dreck vom Körper. Erst dann drehte sie sich zu mir um. »Es wird Zeit, dass du dieses Loch verlässt«, sagte sie und lächelte mich an.
»Wer bist du?«, stammelte ich.
»Ich bin Mara. Antipatros schickt mich.«
Noch immer überrascht starrte ich das Mädchen an.
»Alles Weitere erkläre ich dir später. Lass uns von hier verschwinden. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Wachen kommen, um dich dem Pharao vorzuführen.«
Sicher hatte sie recht. Ich biss die Zähne zusammen und folgte meiner Helferin in den Tunnel. Schon nach einem halben Meter ging es steil bergab. Es war schwer, an den glatten Wänden Halt zu finden und nicht abzurutschen. Ich konnte nicht einmal die eigene Hand vor Augen erkennen. Am liebsten hätte ich mich an Maras Fuß festgehalten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Endlich wurde der Tunnel etwas flacher und auch höher. Wir konnten jetzt kriechen und mussten nicht mehr auf dem Bauch über den Stein robben.
Plötzlich hielt die Fremde an und ich stieß mit dem Kopf gegen ihre Füße. Sofort spürte ich, wie die Schmerzen in meinem Schädel wieder zunahmen. Es fühlte sich an, als hätte ich Spinnenweben in meinem Kopf, die meinen Blick verschleierten.
»Ruhig«, hörte ich Maras Stimme vor mir. »Wir müssen jetzt ganz leise sein.«
Ich presste die Lippen fest zusammen und konnte einen leichten Windhauch spüren. Offensichtlich hatten wir den Ausgang fast erreicht. Neugierig versuchte ich, an Mara vorbei einen Blick ins Freie zu werfen. Außer ein paar Schatten war aber nichts zu sehen.
Leise Stimmen drangen zu unserem Versteck und ich hielt gespannt den Atem an. Suchte man mich etwa schon? Oder ging nur jemand zufällig an der Öffnung vorbei? Die Spannung wurde unerträglich. Falls man uns erwischte, würden sich die Ägypter sicher nicht mehr die Mühe machen, mich in den Kerker zu sperren, sondern mich gleich töten.
Endlich entfernten sich die Stimmen von uns. Hinter Mara trat ich ins Freie und wir schlichen leise über eine Straße vor dem Palast. Ich drehte mich um und sah den prächtigen Bau direkt vor meinen Augen. Die mit Gold verzierten Türme glänzten im Mondlicht. Staunend sah ich zu den hohen Mauern, die den Wohnsitz des Pharaos umragten.
»Dafür haben wir jetzt keine Zeit«, sagte meine Gefährtin und zog mich weiter.
»Ergreift sie!«, hallte eine Stimme über den Platz.
Erschrocken drehte ich mich um. Eine Truppe der Palastwache lief mit langen Schritten auf uns zu. Mein Verschwinden war also bemerkt worden.
So schnell ich konnte, rannte ich hinter Mara her, die in eine schmale Seitengasse abbog. Zielsicher fand sie den Weg und stockte an keiner der vielen Kreuzungen, an denen wir mal links und mal rechts abbogen. Die lauten Schreie hinter uns verrieten mir, dass uns die Verfolger dicht auf den Fersen waren.
Plötzlich blieb Mara stehen und zog einen Vorhang zur Seite, den ich in der Eile gar nicht gesehen hätte. Schnell huschten wir hindurch und gerieten in ein Labyrinth aus Kellerräumen. Meine Begleiterin schien sich hier gut auszukennen und eilte immer tiefer in die Katakomben hinein.
Endlich blieb sie stehen. Ich stützte mich erleichtert an der Wand ab. Meine Lungen brannten wie Feuer und ich schmeckte saure Magenflüssigkeit auf der Zunge.
»Hier werden sie uns nicht finden«, sagte Mara. Und ehe ich überhaupt realisieren konnte, wo wir uns befanden, breitete sie eine Decke aus, die sie aus einer Nische geholt hatte, und ließ sich auf dem Boden nieder. Froh, einen Moment verschnaufen zu können, setzte ich mich neben sie auf den überraschend weichen Boden. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass er auf den letzten Metern immer sandiger geworden war.
»Wo sind wir hier?«, fragte ich nach einer Weile.