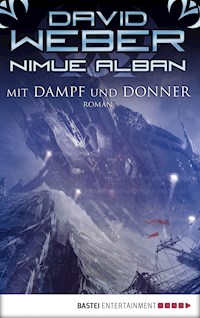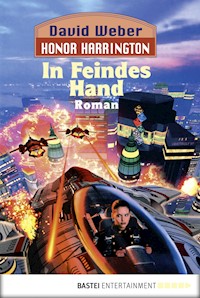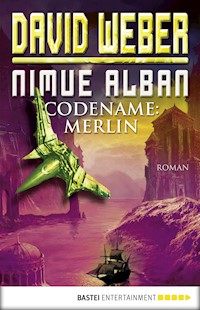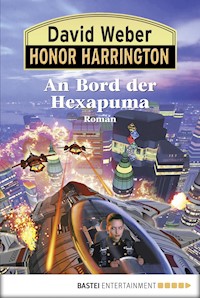7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Marduk-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt einer grandiosen Saga um epische Schlachten und Intrigen!
Roger Ramius Sergei Chiang MacClintock versteht die Welt nicht mehr. Er ist jung, athletisch, der dritte in der Thronfolge ... Aber warum traut ihm bloß niemand am kaiserlichen Hof? Wieso verrät ihm nicht einmal seine Mutter, die Kaiserin, den Grund dafür? Und warum schickt sie ihn auf einen Provinzplaneten, wo er sie auf einer politischen Veranstaltung vertreten soll, zu der man eher den dritten stellvertretenden Staatssekretär schicken würde?
Noch ehe Roger die Antworten auf diese Fragen herausfinden kann, überschlagen sich die Ereignisse, und zum ersten Mal im Leben muss er auf eigenen Füßen stehen - auf einem Planeten, auf dem jeder Schritt den Tod bedeuten kann ...
Der Auftakt des Marduk-Zyklus‘ - ein großartiges Weltraum-Abenteuer von zwei Meistern der Military-SF! Packende Gefechtsszenen und faszinierende Charaktere! Jetzt endlich wieder erhältlich als eBook von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 927
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Marduk-Zyklus
Über dieses Buch
Über die Autoren
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Im nächsten Band
Der Marduk-Zyklus
Marduk: ein höllischer Dschungelplanet, auf dem es bis zu sechs Stunden täglich regnet … in der Trockenzeit. Bewohnt von riesigen Ungeheuern und feindlich gesinnten Eingeborenen …
Hier muss der selbstverliebte Adelsspross Roger MacClintock notlanden, der von seiner kaiserlichen Familie aus fadenscheinigen Gründen auf eine seltsame diplomatische Mission geschickt wurde. Zusammen mit einer Leibgarde, die ihn hasst, muss er einen Ausweg von Marduk finden. Erst im Angesicht dieser Aufgabe erweist er sich seiner Abstammung als würdig - und erfährt schließlich den wahren Grund für seine Mission …
Ein großartiges Weltraum-Abenteuer von zwei Meistern der Military-SF!
Über dieses Buch
Roger Ramius Sergei Chiang MacClintock versteht die Welt nicht mehr. Er ist jung, athletisch, der dritte in der Thronfolge … Aber warum traut ihm bloß niemand am kaiserlichen Hof? Wieso verrät ihm nicht einmal seine Mutter, die Kaiserin, den Grund dafür? Und warum schickt sie ihn auf einen Provinzplaneten, wo er sie auf einer politischen Veranstaltung vertreten soll, zu der man eher den dritten stellvertretenden Staatssekretär schicken würde?
Noch ehe Roger die Antworten auf diese Fragen herausfinden kann, überschlagen sich die Ereignisse, und zum ersten Mal im Leben muss er auf eigenen Füßen stehen – auf einem Planeten, auf dem jeder Schritt den Tod bedeuten kann …
Über die Autoren
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der Honor-Harrington-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
John Ringo hat über 50 Romane geschrieben, die meisten davon im Bereich militärischer Science-Fiction. Nach einer von vielen Umzügen geprägten Kindheit diente er längere Zeit im US-Militär, bevor er seinen ersten Roman veröffentlichte. Der Erfolg seiner Bücher erlaubte ihm bald, vom Schreiben zu leben. Viele seiner Romane entstanden in Zusammenarbeit mit anderen Autoren. Er lebt heute in Tennessee.
David WeberJohn Ringo
DAS BRONZE-BATAILLON
Band 1
Aus dem Englischen vonUlf und Beke Ritgen
beBEYOND
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 bei Bastei Lübbe Taschenbücher in der Verlagsgruppe Lübbe. Die amerikanische Originalausgabe trägt den Titel »March Upcountry«.
Copyright © 2001 by David Weber and John Ringo
Published by Arrangement with BAEN BOOKS, Wake Forest, NC 27588 USA.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Beate Ritgen-Brandenburg / Ulf Ritgen / Stefan Bauer
Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von © shutterstock: Triff | © DeviantArt: ocd1c-stock
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4575-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Dieses Buch ist unseren Müttern gewidmet.
Für Alice Louise Godard Weber,
die es mit mir ausgehalten und mich vieles gelehrt hat,
die mich angeleitet und an mich geglaubt hat,
die mich ermutigt hat, daran zu glauben,
ich könne Schriftsteller werden …
obwohl alles dagegen sprach.
Ich liebe dich. So. Jetzt ist es ’raus.
Für Jane M. Ringo,
dafür, dass sie mich an Orte geschleppt hat,
an die ich nicht wollte,
und versucht hat, mich dazu zu bringen,
Dinge zu essen, die sogar einem Affen den Magen
umgedreht hätten.
Danke, Mom.
Du hattest doch Recht.
Kapitel 1
»Seine Königliche Hoheit, Prinz Roger Ramius Sergei Alexander Chiang MacClintock!«
Prinz Roger lächelte sein gewohntes, leicht gelangweiltes Lächeln, als er durch die Tür trat. Dann blieb er stehen und blickte sich im Raum um, während er an den Ärmelaufschlägen seines Hemdes zupfte und sein Halstuch zurechtzog. Beides bestand aus Diablo-Spinnenseide, dem geschmeidigsten und zartesten Tuch der Galaxis. Da diese Seide von riesigen, Säure speienden Spinnen bewacht wurde, war es zugleich auch das teuerste Tuch.
Was Amos Stephens betraf, so schenkte er diesem jungen Geck, dessen Eintreten er selbst gerade eben so pompös angekündigt hatte, so wenig Beachtung wie nur möglich. Dieses Kind brachte Schande über den ehrbaren Namen der Familie seiner Mutter. Das Halstuch allein sah ja schon verboten aus, doch das bunt gemusterte Brokat-Jackett, gewiss das angemessene Kleidungsstück für einen Bordellbesuch, aber nicht für ein Zusammentreffen mit der Kaiserin des Kaiserreiches der Menschheit, war die Krönung. Nein, die Krönung war die Frisur! Stephens hatte zwanzig Jahre in der Navy Ihrer Majestät gedient, ehe er ein weiteres Rädchen im Getriebe des palasteigenen Service Corps geworden war. Der einzige Unterschied zwischen seinen Jahren bei der Navy und seinen Jahren im Palast war, dass seine kurzgeschnittenen Locken, einst pechschwarz, inzwischen silbergrau geworden waren. Der bloße Anblick der bis zum Hintern reichenden goldblonden Haare dieses possenhaften Stutzers, zu dem sich der jüngere Sohn Kaiserin Alexandras entwickelt hatte, reichte aus, um in dem alten Butler Zorn aufwallen zu lassen.
Das Büro der Kaiserin war bemerkenswert klein und schlicht; ihr breiter Schreibtisch war nicht größer als der eines Managers der mittleren Führungsebene in einer beliebigen interstellaren Firma auf der Erde. Die Einrichtung war schlicht, aber elegant; die Stühle waren zweckmäßig, aber kunstvoll von Hand gearbeitet, die Polster mit feinsten Stickereien verziert. Bei den meisten der Bilder an den Wänden handelte es sich um Originale alter Meister. Die einzige Ausnahme stellte zugleich auch das berühmteste Werk das. ›Die zukünftige Kaiserin‹ war ein nach dem Leben gemaltes Portrait von Miranda MacClintock während der ›Dolch-Jahre‹, und Trachsler, der Meister, hatte sein Motiv perfekt getroffen. Ihre großen, den Betrachter anblickenden Augen lächelten und vermittelten das Bild einer klugen Bürgerin Terras, einer loyalen Anhängerin der Dolch-Lords. Mit anderen Worten: einer gemeinen Kollaborateurin. Doch wenn man das Gemälde lang genug betrachtete, dann wurde man von einem kalten Schauer erfasst: Die Augen der Frau veränderten sich, sie wurden zu den Augen eines Raubtiers.
Roger streifte das Gemälde nur mit einem flüchtigen Blick, ließ seine Augen weiter schweifen. Alle MacClintocks lebten unter dem Schatten dieses alten Mütterchens, obwohl Miranda MacClintock schon lange tot war. Und als der unbedeutendste – und in den Augen aller anderen am wenigsten geratene – Spross dieses Geschlechts fielen auf ihn, Prinz Roger, schon mehr als genug Schatten.
Alexandra VII., die Kaiserin der Menschheit, betrachtete mit halb geschlossenen Augen ihr jüngstes Kind. Die vorsichtigst bemessene Schärfe in Stephens ironischer Ankündigung schien dem Prinzen vollständig entgangen zu sein. Auf jeden Fall schien die deutliche spürbare Abneigung des alten Raumfahrers den jungen Mann vor ihr nicht im Geringsten zu stören.
Im Gegensatz zu ihrem auffallend gekleideten Sohn trug Kaiserin Alexandra ein blaues Kostüm derart zurückhaltender Eleganz, dass es etwa so viel gekostet haben musste wie ein kleineres Raumschiff. Nun lehnte sie sich in ihrem Schwebesessel zurück, das Kinn in die Hand gestützt; und zum hundertsten Mal fragte sie sich, ob die Entscheidung, die sie getroffen hatte, wirklich die richtige war. Doch noch tausend weitere Entscheidungen warteten auf sie, alle davon lebenswichtig, und sie hatte auf diese eine Frage hier bereits sämtliche Zeit aufgewendet, die sie aufzuwenden beabsichtigte.
»Mutter«, begann Roger leichthin, deutete eine minimale Verbeugung an und blickte dann zu seinem Bruder hinüber, der in dem daneben schwebenden Sessel saß. »Was verschafft mir die Ehre, vor zwei derart erlauchte Persönlichkeiten gerufen zu werden?«, fuhr er dann mit einem leichten, wissenden Lächeln fort.
John MacClintock schenkte seinem jüngeren Bruder ein dünnes Lächeln und ein Nicken. Der interstellar angesehene Diplomat trug einen konservativ geschnittenen, blauen Kammgarn-Anzug; aus einem Ärmel lugte ein schlichtes Damasttaschentuch hervor. Sein Äußeres ließ ihn wie einen dieser spießigen Bankiers wirken, seine Pokermiene und sein stets schläfriger Blick täuschten aber über einen scharfsinnigen Verstand hinweg, der es mit jedem anderen auf allen bekannten Welten aufzunehmen vermochte. Und obwohl John langsam einen altersbedingten Bauch entwickelte, hätte er immer noch Golfprofi werden können … hätte sein Job als Thronerbe ihm die Zeit dazu gelassen.
Abrupt beugte die Kaiserin sich vor und bedachte ihren Jüngsten mit einem laserstrahlscharfen Blick. »Roger, wir schicken dich auf einen anderen Planeten – auf eine Mission, auf der du deinen Repräsentationspflichten nachkommen wirst.«
Roger blinzelte einige Male und strich sich über das Haar.
»Ja?«, entgegnete er dann vorsichtig.
»Auf dem Planeten Leviathan wird in zwei Monaten ›Das Einholen der Netze‹ gefeiert …«
»Oh Gott, Mutter!« Rogers erschrockener Ausruf unterbrach die Kaiserin mitten im Satz. »Du beliebst doch wohl zu scherzen!«
»Wir scherzen nicht, Roger«, entgegnete Alexandra ernst. »Es mag ja sein, dass der Hauptexportartikel Leviathans Nörgelöl ist, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es einer der wichtigsten Planeten im Sagittarius-Sektor ist. Und seit zwei Jahrzehnten hat niemand die Familie beim ›Einholen der Netze‹ repräsentiert.« Sie machte sich nicht die Mühe Nicht mehr, seit ich deinen Vater verstoßen habe hinzuzufügen.
»Aber Mutter! Dieser Gestank!«, protestierte der Prinz und versuchte, durch hektische Kopfbewegungen eine Haarsträhne aus dem Auge zu bekommen. Roger wusste, dass er weinerlich klang, und er verabscheute es; doch die Alternative bestand darin, auf diesem Planeten mehrere Wochen lang den Gestank von Nörgelöl ertragen zu müssen. Und selbst, wenn er danach dann Leviathan entkommen war, würde Kostas mehrere Wochen brauchen, seine Kleidung von diesem Geruch zu befreien. Dieses Öl war die bemerkenswerteste Grundlage für Moschus-Duftstoffe, ja, es war sogar Bestandteil des Parfums, das Roger selbst am heutigen Tag aufgelegt hatte. Doch in seiner Rohform war Nörgelöl die widerlichste Substanz der Galaxis.
»Uns interessiert nicht, das es stinkt, Roger!«, entgegnete die Kaiserin schneidend. »Und dich sollte es auch nicht interessieren! Du wirst die Dynastie repräsentieren, und du wirst Unseren Untertanen zeigen, dass Wir an der Bekräftigung ihres Bündnisses mit dem kaiserlichen Reich so sehr interessiert sind, dass wir eines Unserer Kinder zu dieser Zeremonie schicken. Hast du das verstanden?«
Der junge Prinz richtete sich zu seiner vollen Körpergröße von immerhin einhundertfünfundneunzig Zentimetern auf und sammelte die Überreste seiner Würde wieder ein.
»Sehr wohl, Eure Kaiserliche Majestät! Ich werde selbstverständlich meine Pflichten so erfüllen, wie Ihr das für richtig erachtet. Es ist schließlich meine Pflicht, nicht wahr, Eure Kaiserliche Majestät? Noblesse oblige und so.« Die Flügel seiner Aristokratennase bebten vor unterdrücktem Zorn. »Ich nehme an, dass ich jetzt das Packen überwachen sollte. Ihr gestattet?«
Alexandras stählerner Blick blieb noch einige Augenblicke auf ihn gerichtet, dann gestikulierte sie mit den Fingerspitzen in Richtung Tür.
»Geh! Geh! Und leiste gute Arbeit!« Das ›ausnahmsweise‹ blieb unausgesprochen.
Erneut deutete Prinz Roger eine minimale Verbeugung an, drehte der Kaiserin dann sehr bewusst den Rücken zu und marschierte mit großen Schritten aus dem Raum.
»Das hättest du durchaus noch eleganter zu bewerkstelligen gewusst, Mutter«, merkte John mit ruhiger Stimme an, nachdem die Tür sich hinter dem zornigen jungen Mann geschlossen hatte.
»Ja, durchaus.« Sie seufzte und stützte wieder das Kinn in die Hand. »Und ich hätte es auch wirklich besser machen sollen, verdammt noch mal! Aber er sieht seinem Vater einfach zu ähnlich.«
»Aber er ist nicht sein Vater«, gab John ruhig zurück. »Es sei denn, du erschaffst seinen Vater in ihm! Oder du treibst ihn direkt ins Lager von New Madrid.«
»Natürlich, du weißt mal wieder alles besser!«, fauchte sie, holte dann tief Luft und schüttelte den Kopf. »Es tut mir Leid, John! Du hast Recht. Du hast ja immer Recht.« Reumütig lächelte sie ihren erstgeborenen Sohn an. »Ich bin einfach nicht gut darin, mit persönlichen Dingen umzugehen, nicht wahr?«
»Bei Alex und mir hast du alles richtig gemacht«, erwiderte John. »Aber Roger trägt wirklich eine schwere Last auf seinen Schultern. Vielleicht wird es Zeit, ein wenig Nachsicht mit ihm zu üben.«
»Da gibt es nichts, wo man Nachsicht üben könnte! Nicht im Augenblick!«
»Doch, da gibt es schon etwas. Und sicher mehr an Nachsicht, als man ihm in den vergangenen Jahren zugestanden hat. Alex und ich, wir haben immer gewusst, dass du uns wirklich liebst«, erklärte er mit ruhiger Stimme. »Roger ist sich da nie wirklich sicher gewesen.«
Alexandra schüttelte den Kopf.
»Nicht im Augenblick«, wiederholte sie dann ruhiger. »Wenn er wieder zurück ist, wenn diese Krise sich gelegt hat, dann werde ich …«
»… einen Teil des angerichteten Schadens wieder gutmachen?« John sprach mit gleichförmiger, ruhiger Stimme, in seinem sanften Blick lag keinerlei Herausforderung, er war einfach nur offen. Doch denselben Gesichtsausdruck stellte er auch im Angesicht des Krieges zur Schau.
»Es ihm erklären«, erwiderte sie scharf. »Ihm die ganze Geschichte erzählen – aus allererster Hand. Vielleicht versteht er alles besser, wenn ich es ihm erst erklärt habe.« Sie machte eine Pause, und ihre Miene versteinerte. »Und wenn er immer noch das Lager von New Madrid bevorzugt – nun ja, dann werden wir uns zu gegebener Zeit damit befassen müssen!«
»Und bis dahin?« Ungerührt hielt John ihrem halb wütenden, halb traurigen Blick stand. »Bis dahin halten wir den festgelegten Kurs. Und wir schaffen ihn so weit wie möglich aus der Schusslinie.«
Und so weit wie möglich weg vom Zentrum der Macht, dachte sie.
Kapitel 2
Naja, wenigstens ein guter Sportler ist er. Company Sergeant Major Eva Kosutic, die dem Prinzen dabei zuschaute, wir er im freien Fall einen Überschlag vollführte und dann geschmeidig auf dem Landepolster aufkam, musste sich eingestehen, dass sie schon erfahrenere Raumfahrer dieses Manöver deutlich weniger elegant hatte durchführen sehen. Jetzt müsste er nur noch Rückgrat entwickeln …
Der Erste Zug der Bravo Company des Bronze-Bataillons der Kaiserlichen Garde hatte in dicht geschlossenen Reihen am vorderen Ende des Shuttle-Hangars Haltung angenommen. Das Erscheinungsbild dieses Zuges war besser als das des Rests der Flotte – was nicht anders zu erwarten war. Auch wenn das Bronze-Bataillon die ›unterste Stufe‹ in der Hierarchie der Kaiserlichen Garde darstellte, gehörten ihm doch handverlesen die besten Leibwachen des gesamten bekannten Universums an. Und das bedeutete, dass diese Leibwachen die gefährlichsten und die gutaussehendsten waren.
Eva Kosutics Aufgabe war es, das sicherzustellen. Der dreißigminütige Formaldienst war, wie immer, präzise und gewissenhaft durchgeführt worden. Jeder Zentimeter der Uniform, der Ausrüstung und auch der Körperpflege jedes einzelnen Marines war auf das Genaueste in Augenschein genommen worden. Innerhalb der fünf Monate, die Kosutic jetzt Sergeant Major der Bravo Company war und die Truppe inspizierte, hatte Captain Pahner niemals auch nur den kleinsten Fehler entdeckt. Und wenn es nach Eva Kosutic ging, würde das auch niemals der Fall sein.
Zugegebenermaßen war es recht unwahrscheinlich, dass sie viele Fehler hätte finden können. Bevor ein Kandidat zur ›Garde‹ abkommandiert wurde, musste er einen in jeder Hinsicht erschöpfenden Kurs durchlaufen. Dieser fünfwöchige Kurs, ›Regiment im Probedienst‹ oder kurz ›RIP‹ genannt, diente dazu, alle ungeeigneten Möchtegern-Gardisten auszusieben; darin wurden die schlimmsten Aspekte der Kampfausbildung mit strengsten Inspektionen von Uniform und Ausrüstung kombiniert. Jeder Marine, der für unzureichend befunden wurde – und das war bei den meisten der Fall – wurde zu seiner ursprünglichen Einheit zurückversetzt, und das war gut so. Es war allgemein bekannt, dass die ›Garde‹ nur die Besten der Besten unter den Besten aufnahm.
Hatte ein Rekrut erst einmal das RIP überlebt, dann musste er sich mit einer neuen Form der Hierarchie abfinden. Fast alle der frischen ›Ripper‹ wurden zum Bronze-Bataillon abkommandiert, wo ihnen dann die unsägliche Freude zuteil wurde, einen degenerierten Weichling bewachen zu dürfen, der sie eher anspucken würde, als ihnen auch nur die Uhrzeit zu nennen. Wenn sie das mit aller zu Gebote stehenden Ernsthaftigkeit achtzehn Monate durchhielten, konnten sie sich entweder dafür entscheiden, nach einer Beförderung im Bronze-Bataillon zu verbleiben oder sich um einen Posten im Stahl-Bataillon zu bemühen, das Prinzessin Alexandra zu schützen die Aufgabe hatte.
Im Geiste zählte Eva Kosutic bereits die ihr noch verbleibenden Tage. Noch einhundertdreiundfünfzig Tage, und dann noch einmal aufwachen, ging es ihr durch den Kopf, während der Prinz die Sprungmatte verließ.
Die letzten Töne der Kaiserlichen Hymne verklangen, dann trat der Captain des Schiffes vor und salutierte.
»Eure Königliche Hoheit, Captain Vil Krasnitsky zu Euren Diensten! Gestattet mir zu sagen, welche Ehre es ist, Euch an Bord der Charles DeGlopper zu wissen!«
Desinteressiert winkte der Prinz dem Captain des Schiffs mit einer Hand zu, dann wandte er sich ab und blickte sich im Hangar um. Die zierliche Brünette, die ihm durch die Röhre gefolgt war, machte mit kaum merklich zitternden Nasenflügeln einen Schritt am Prinzen vorbei und ergriff die Hand des Captains.
»Eleanora O’Casey, Captain. Es ist uns eine Freude, an Bord Ihres prächtigen Schiffes zu sein.« Rogers ehemalige Privatlehrerin und gegenwärtige Stabschefin schüttelte dem Captain mit festem Griff die Hand, blickte ihm dabei geradewegs in die Augen und versuchte, zumindest ein gewisses Maß an Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen, indem sie wettmachte, was der Prinz durch sein Schmollen vergab. »Man hat uns davon unterrichtet, in dieser Klasse gebe es keine Crew, die es mit der Ihren aufnehmen könne!«
Kurz blickte der Captain zu dem abseits stehenden Adligen hinüber und wandte sich dann wieder der Stabschefin zu.
»Ich danke Ihnen, Ma’am. Es ist schön zu wissen, dass man geschätzt wird.«
»Sie haben zwei Jahre in Folge den Tarawa-Wettbewerb gewonnen. Für eine einfache Zivilistin wie mich ist das Beweis genug.« Sie schenkte dem Captain ihr strahlendstes Lächeln und stieß Roger sachte mit dem Ellbogen an.
Der Prinz drehte sich zum Captain um und bedachte ihn mit einem ganz anderen, einem matten, distanzierten und recht bedeutungslosen Lächeln. Der Captain, geblendet davon, die Aufmerksamkeit des Hochadels errungen zu haben, seufzte erleichtert. Es schien, als sei der Prinz zufrieden, und die Karriere des Captains würde die Klippen hochherrschaftlicher Ungnade umschiffen können.
»Darf ich meine Offiziere vorstellen?«, fragte Krasnitsky und wandte sich zu der Crew um, die in Reih und Glied angetreten war. »Und wenn Seine Hoheit es wünschen sollte: die Mannschaft des Schiffes steht jederzeit für eine Inspektion bereit.«
»Vielleicht später«, schlug Eleanora hastig vor. »Ich nehme an, Seine Hoheit würde es bevorzugen, jetzt zu seiner Kabine geleitet zu werden.«
Erneut lächelte sie den Captain an; innerlich feilte sie schon an der anstehenden Erklärung, der Prinz habe nach dem freien Fall in der Röhre an einer leichten Kinetose gelitten und sei deswegen so abwesend erschienen. Das war eine schwache Ausrede; aber ›Raumphobie‹ würde bei der Crew immer noch besser ankommen, als wenn sie zugab, dass Roger sich mit voller Absicht so mies benahm.
»Ich verstehe das vollkommen«, erwiderte der Captain mitfühlend. »Ein derartiger Wechsel der vertrauten Umgebung kann sehr anstrengend sein. Wenn ich vorausgehen darf?«
»Gehen Sie voran, Captain, gehen Sie nur voran!«, forderte Eleanora den Mann jovial auf, wieder mit einem strahlenden Lächeln. Und wieder mit einem Rippenstoß für Roger.
Bitte mach, dass ich Leviathan erreiche, ohne von Roger zu sehr blamiert worden zu sein!, wünschte sie sich inbrünstig. Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt!
»Ach du meine Fresse! Da ist es ja, unser ›Mäuschen‹!«
Kostas Matsugae blickte von den Tages-Jacketts auf, die er aus den Reisekoffern auspackte. Der Materialhangar füllte sich zügig mit Bronze-Barbaren … und die Art und Weise, wie sie ihre eigene Ausrüstung in den Spinden verstauten, ließ vermuten, dass es sich hier um eine langfristige Einteilung handelte.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte der kleinwüchsige Kammerdiener mit deutlicher Stimme, gerade laut genug, um gehört zu werden.
»Ach, nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd, Mäuschen!«, meinte der Mann, der gerade eben gesprochen hatte, einer der Privates, die schon länger im Dienst waren. »Es gibt eben nur begrenzt viel Platz an Bord dieser Sturmtransporter. Ihr werdet euch wohl in den Raum quetschen müssen, den sonst die schweren Waffensysteme ausfüllen würden. Hey, hört mal!«, fuhr der Private dann fort, die Stimme leicht angehoben, um die Gespräche der anderen und das Klappern der Ausrüstungsgegenstände zu übertönen. »Mäuschen ist hier! Nicht, dass hier irgendjemand Schweinereien anfängt, klar?«
Ein weiblicher Corporal schlängelte sich an dem Kammerdiener mittleren Alters vorbei und streifte dabei aufreizend ihre Ausgehuniform ab. »Mäuschen, oh, die mag ich! Mäuschen hab ich zum Fressen gern!«
»Knabber an den Zehchen, mag von deren Süße schwärm‹!«, fiel der Rest des Zuges im Chor ein.
Matsugae zog nur die Nase hoch und machte sich wieder daran, die Koffer des Prinzen auszupacken. Seine Hoheit sollte sich zum Dinner schließlich von seiner besten Seite zeigen.
»Ich werde doch kein Dinner in dieser verdammten Offiziersmesse einnehmen!«, platzte Roger gereizt heraus und zerrte an einer Haarsträhne. Er wusste, dass er sich wie ein verzogenes Blag verhielt, und genau das trieb ihn, wie stets, in den Wahnsinn. Natürlich schien die ganze Lage ausdrücklich darauf angelegt zu sein, ihn in den Wahnsinn zu treiben, so jedenfalls schoss ihm als erstes ein verbitterter Gedanke durch den Kopf, und er ballte die Hände zu Fäusten, bis seine Fingerknöchel weiß hervortraten und seine Unterarme zitterten.
»Ich werde da nicht hingehen!«, wiederholte er starrsinnig.
Dank ihrer langen Erfahrung wusste Eleanora, dass es meistens verlorene Liebesmühe war, mit ihm diskutieren zu wollen; doch in seltenen Fällen, wenn man sich darauf einließ, den Grund für sein Schmollen zu finden, konnte man das Ganze beenden. In seltenen Fällen. In sehr seltenen Fällen.
»Roger«, begann sie ruhig, »wenn Sie nicht am ersten Abend das Captains-Dinner in der Offiziersmesse mit allen zusammen einnehmen, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für diesen Captain Krasnitsky und seine Offiziere …«
»Ich gehe da nicht hin!«, brüllte er, und dann, fast konnte man es beobachten, fand er wenigstens einen Teil seiner Beherrschung wieder. Er zitterte jetzt am ganzen Leib, und die winzige Kabine schien zu klein für seinen Zorn und seine Frustration. Es war die Kajüte des Captains, die beste des ganzen Schiffs; doch verglichen mit dem Palast, oder auch nur den prächtigen Schiffen der Kaiserlichen Flotte, auf denen Roger bisher zu reisen pflegte, war diese Kabine nicht größer als ein Wandschrank.
Er holte tief Luft, was ihn ein wenig zu beruhigen schien, und zuckte die Achseln.
»Also gut, ich benehme mich idiotisch. Aber ich gehe trotzdem nicht zu diesem Dinner. Lassen Sie sich eine Ausrede einfallen!«, fuhr er dann fort und grinste plötzlich geradezu lausbübisch. »Darin sind Sie wirklich prima!«
Wütend schüttelte Eleanora den Kopf, dennoch musste sie dieses Grinsen erwidern. Manchmal konnte Roger einfach entwaffnend charmant sein.
»Also gut, Euer Hoheit. Wir sehen uns morgen Früh.«
Mit einem einzigen Schritt rückwärts erreichte sie die Luke, öffnete sie und verließ die Kabine. Und hätte beinahe Kostas Matsugae über den Haufen gerannt.
»Guten Abend, Ma’am«, grüßte der Kammerdiener und sprang behände zur Seite, obwohl beide Arme mit Kleidung und anderen Besitztümern den Prinzen beladen waren. Dann musste er erneut ausweichen, um nicht gegen einen Marine zu prallen, der vor der Tür Wache stand, doch die Soldatin blieb völlig ausdrucks- und reglos. Jegliche Belustigung, die sie vielleicht darüber hätte empfinden können, wie hektisch dieser Kammerdiener umhersprang, wurde sofort mit eiserner Disziplin unterdrückt. Die Mitglieder der Garde waren dafür bekannt, nahezu alles nur Erdenkliche reglos und mit unbewegter Miene durchstehen zu können. Gelegentlich hielten sie sogar Wettkämpfe darin ab, wer die größte Ausdauer und den größten Gleichmut besaß. Der letzte Sergeant Major des Gold-Bataillons hielt den derzeitigen Ausdauerrekord: dreiundneunzig Stunden ›Stillgestanden‹, ohne zu essen, zu trinken, zu schlafen oder auf Toilette zu gehen. Letzteres, so gab er zu, war das Schlimmste daran gewesen. Dehydrierung und die Ansammlung von Toxinen hatte ihn schließlich zusammenbrechen lassen.
»Guten Abend, Matsugae«, erwiderte Eleanora den Gruß und unterdrückte ein Grinsen. Es fiel ihr nicht leicht, denn dieser aufgeregte kleine Kammerdiener war so sehr mit Kleidung beladen, dass es fast unmöglich war, ihn unter dem Stapel, den er sich aufgeladen hatte, überhaupt noch zu erkennen. »Ich bedauere sagen zu müssen, dass unser Prinz das Dinner nicht in der Offiziersmesse einnehmen wird. Daher bezweifle ich, dass er für all diese Dinge da, Matsugae, wirklich Verwendung haben wird«, fuhr sie dann fort und deutete mit dem Kinn auf die riesige Kleiderauswahl.
»Was? Aber warum?«, hörte sie Matsugae irgendwo unter dem Stapel krächzen. »Ach, auch egal! Ich habe hier die etwas legerere Kleidung für die Zeit nach dem Dinner, also wird das wohl ausreichen.« Er reckte seinen Hals ein wenig, und sein allmählich kahl werdender Schädel und sein rundes Gesicht erhoben sich wie ein Pilz über dem Kleiderstapel. »Aber es ist dennoch eine Schande! Ich hatte für ihn einen so schönen Siena-Anzug ausgewählt.«
»Vielleicht können Sie ihn ja mit ein paar Kleidungsstücken wieder besänftigen.« In O’Caseys Lächeln lag ein Hauch von Resignation. »Ich scheine ihn eher noch aufgestachelt zu haben.«
»Oh, ich kann verstehen, dass er aufgebracht ist«, erwiderte der Kammerdiener mit einem weiteren scharfen Krächzen. »Es ist schon schlimm genug, auf eine sinnlose Mission in den hintersten Winkel von Nirgendwo geschickt zu werden, aber einem Prinzen von kaiserlichem Geblüt dafür einen Lastkahn zu geben, das ist einfach die schlimmste Beleidigung, die ich mir vorstellen kann!«
Eleanora schürzte die Lippen und blickte den Kammerdiener stirnrunzelnd an.
»Machen Sie es nicht noch schlimmer, als es ohnehin schon ist, Matsugae! Früher oder später muss Roger anfangen, seinen Verpflichtungen als Mitglied der Kaiserlichen Familie nachzukommen. Und manchmal bedeutet das eben auch, Opfer bringen zu müssen.« Zum Beispiel, sich genügend Zeit dafür zu nehmen, einen Stab für den Stabschef zusammenzustellen, fügte sie im Stillen hinzu. »Man muss ihn nicht auch noch in seiner Schmollhaltung bestärken.«
»Sie kümmern sich in Ihrer Art und Weise um ihn, Ms O’Casey, und ich werde das in der meinen tun«, entgegnete der Kammerdiener scharf. »Wenn man ein Kind herumschubst, ihm deutlich zeigt, dass man es verachtet, wenn man es verschmäht und seinen Vater verstößt, was glauben Sie, was das wohl für ein Kind wird?«
»Roger ist kein Kind mehr!«, schoss O’Casey verärgert zurück. »Wir können ihn nicht verhätscheln, baden und anziehen, als wäre er immer noch eins!«
»Nein«, pflichtete der Kammerdiener ihr bei. »Aber wir können ihm wenigstens genügen Freiraum lassen, in Ruhe durchzuatmen! Wir können für ihn ein Image entwerfen und einfach hoffen, dass er in dieses Image hineinwachsen wird.«
»Welches denn, das Image eines Kleiderständers?«, fauchte die Stabschefin. Das war ein alter, immer wieder aufgewärmter Streit, und der Kammerdiener schien gerade im Begriff zu gewinnen. »In dieses Image ist er ja wirklich ganz wunderbar hineingewachsen!«
Der Kammerdiener des Prinzen starrte sie an wie eine furchtlose Maus, die sich einer Katze entgegenstellt.
»Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen«, schniefte er mit einem Blick auf ihr entsetzlich schlichtes Kostüm, »weiß Seine Hoheit die feineren Dinge des Lebens zu schätzen. Aber Seine Hoheit ist mehr als ein ›Kleiderständer‹. Solange jedoch nicht wenigstens einige von Ihnen das einzusehen bereit sind, werden Sie nur immer wieder auf das stoßen, was Sie erwarten.«
Er blickte sie noch einen Augenblick lang finster an, zog erneut die Nase hoch, drückte mit dem Ellbogen die Klinke der Luke nieder und betrat, die Tür aufstoßend, die Kabine.
Roger lehnte sich, in der winzigen Kabine auf dem Bett sitzend, zurück, die Augen geschlossen, und versuchte, so effektiv wie möglich gefährliche Gelassenheit auszustrahlen. Ich bin zweiundzwanzig Jahr alt, dachte er. Ich bin ein Prinz des Kaiserlichen Reiches. Ich werde jetzt nicht weinen, nur weil Mommy mich wütend gemacht hat!
Er hörte, wie die Panzertür seiner Kabine geöffnet und dann wieder geschlossen wurde, und er wusste sofort, wer gerade eingetreten war: Das Parfum, das Matsugae aufzulegen pflegte, war in der kleinen Kabine fast überwältigend.
»Guten Abend, Kostas«, grüßte er ruhig. Allein schon den Kammerdiener in seiner Nähe zu haben, beruhigte ihn ein wenig. Was auch immer alle anderen denken mochten, Kostas nahm ihn wenigstens ernst. Wenn das, was Kostas von ihm hörte oder mitbekam, ihm missfiel, hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg; doch wenn das, was Roger tat oder sagte, durchaus sinnvoll war, dann wusste Kostas es zu würdigen – auch wenn es sonst niemand tat.
»Guten Abend, Euer Hoheit«, erwiderte Kostas und legte bereits einen der gi-artigen Chambray-Anzüge aus, die der Prinz gerne in seiner Freizeit trug. »Wünschen Sie heute Abend Ihre Haare zu waschen?«
»Nein danke«, erwiderte der Prinz höflich, ohne sich dessen allerdings bewusst zu sein. »Ich nehme an, du hast schon gehört, dass ich das Dinner nicht in der Offiziersmesse einnehmen werde?«
»Natürlich, Euer Hoheit«, gab der Kammerdiener zurück, während der Prinz sich auf dem Bett aufsetzte und sich säuerlich in der Kabine umschaute. »Wirklich eine Schande! Ich hatte einen so schönen Anzug herausgelegt: diesen einen in dem hellen Siena, das so gut zu Ihren Haaren passt!«
Der Prinz lächelte dünn. »Netter Versuch, Kosie, aber trotzdem nein. Ich bin einfach zu fertig, um heute während eines Dinners höflich sein zu können.« Mit beiden Händen griff er sich voller Frustration an die Schläfen. »Leviathan, damit würde ich ja noch klarkommen! Dieses ›Einholen der Netze‹, damit würde ich auch noch klarkommen, sogar mit diesem Nörgelöl und mit allem, was noch dazu gehört. Aber warum, warum, hat meine hochherrschaftliche Mutter sich dazu entschlossen, mich ausgerechnet auf einem Trampschiff nach Leviathan zu schicken?«
»Das ist kein Trampschiff, Euer Hoheit, und das wissen Sie ganz genau. Wir brauchen Platz für die Leibwachen, und die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, einen Transporter der Flotte abzukommandieren. Und das wäre doch ein wenig übertrieben gewesen, finden Sie nicht auch? Allerdings gebe ich gerne zu, dass das hier ein wenig … schäbig ist.«
»›Schäbig‹!« Der Prinz lachte verbittert. »Das Ding ist so abgewrackt, dass es mich wundert, dass es überhaupt noch die Atmosphäre halten kann! Es ist so alt – ich möchte wetten, der Rumpf ist noch geschweißt! Ich bin geradezu verblüfft darüber, dass das Ding nicht von internen Verbrennungsmotoren oder Dampfmaschinen angetrieben wird! John hätte einen Transporter bekommen. Alexandra hätte einen Transporter bekommen! Aber nicht Roger! Oh nein, nicht ›der kleine Roj‹!«
Der Kammerdiener war inzwischen fertig damit, die verschiedenen Kombinationen in der beengten Kabine auszulegen und trat nun mit resigniertem Gesichtsausdruck einen Schritt zurück.
»Soll ich ein Bad für Euer Hoheit einlassen?«, fragte er spitz, und Roger verzog angesichts seines Tonfalls das Gesicht.
»Damit ich aufhöre, herumzujammern und mich zusammennehme?«
Zur Erwiderung lächelte der Kammerdiener ein kleines Lächeln, doch Roger schüttelte den Kopf.
»Ich bin einfach zu aufgebracht, Kosie!« Er blickte sich in den drei Quadratmetern der Kabine um und schüttelte erneut den Kopf. »Ich wünschte, es gäbe hier in dieser Schüssel irgendetwas, wo ich in aller Ruhe trainieren könnte!«
»Es gibt einen Trainingsbereich, gleich neben den Quartieren des Assault Complement, Euer Hoheit«, gab der Kammerdiener zu bedenken.
»Ich sagte ›in aller Ruhe‹«, bemerkte Roger trocken. Normalerweise bevorzugte er es, den Truppen aus dem Weg zu gehen, die ihn begleiteten. Er hatte noch niemals in Gegenwart des Bataillons trainiert, obwohl er formal ihr direkter Vorgesetzter war – während der vier Jahre auf der Akademie hatte er genug von ihren Grimassen und ihrem Gekicher abbekommen. In der gleichen Art und Weise von seiner Leibwache behandelt zu werden, war schon schwer zu ertragen.
»Ein Großteil der Schiffsbesatzung isst gerade, Euer Hoheit«, gab Matsugae zu bedenken. »Wahrscheinlich hätten Sie die ganze Sporthalle für sich allein!«
Die Vorstellung, jetzt anständig zu trainieren, war immens verlockend. Schließlich nickte Roger.
»Also gut, Matsugae. So machen wir’s!«
Als das Dessert abgeräumt worden war, blickte Captain Krasnitsky Ensign Guha ernst an. Die junge Frau mit der mahagonifarbenen Haut errötete, was den Farbton noch ein wenig vertiefte, dann stand sie mit erhobenem Glas auf.
»Meine Damen und Herren«, begann sie vorsichtig, »auf Ihre Majestät, die Kaiserin! Möge sie lange herrschen!«
Nachdem alle mit »Auf die Kaiserin« geantwortet hatten, räusperte der Captain sich.
»Ich bedauere, dass Seine Hoheit sich unwohl fühlt, Captain.« Er lächelte Captain Pahner zu. »Können wir irgendetwas für ihn tun? Die Schwerkraft, die Temperatur und der Luftdruck in seiner Kabine wurden dem Erdstandard so weit angepasst, wie es meiner Chief Engineer nur möglich war.«
Captain Pahner stellte sein Weinglas, aus dem er kaum einen Schluck genommen hatte, auf den Tisch und nickte dem Captain zu. »Ich bin mir sicher, dass sich Seine Hoheit wieder erholen wird.« Diverse andere Sätze schossen ihm durch den Kopf; doch es gelang ihm, sie alle für sich zu behalten.
Sobald er diese Reise hier hinter sich hatte, sollte Pahner das Kommando über ein ähnliches Schiff wie dieses übernehmen. Allerdings eines größeren. Wie alle leitenden Offiziere in der Kaiserlichen Garde, war er bereits für die Beförderung vorgemerkt, und wenn er diesen Turnus hier beendet hatte, sollte er Commander des Zwoten Bataillons im 502nd Heavy Strike Regiment werden. Da das 502te die wichtigste Bodenkampftruppe der Siebten Flotte war – der Flotte, die man in fast allen Gefechten mit den Saints antraf –, konnte er damit rechnen, demnächst etwas Richtiges zu tun zu bekommen, und das war auch gut so. Er war wirklich kein Kriegsfanatiker; aber nur auf dem Schlachtfeld konnte man herausfinden, ob jemand wirklich ein Marine war oder nicht, und es würde einfach wieder gut tun, den Harnisch anzulegen.
Bei fünfzig Dienstjahren, erst als Mannschaftsdienstgrad, später als Offizier, waren diese beiden Kommandos – Kaiserliche Garde und Heavy Strike – in etwa das Beste, was man erreichen konnte. Danach ging es dann bergab. Entweder der Ruhestand oder aber Colonel, später dann Brigadier. Und das bedeutete: Schreibtischjob. Im Imperium war seit mehreren Jahrhunderten kein ganzes Regiment mehr auf das Schlachtfeld geschickt worden. Die Erkenntnis, dass man ein Licht am Ende des Tunnels sah, doch dieses Licht zu einem GravZug gehörte, konnte einen schon tief deprimieren.
Captain Krasnitsky wartete auf weitere Erläuterungen, kam nach einigen Augenblicken jedoch zu dem Schluss, dass er mehr von diesem schweigsamen Marine nicht erfahren würde. Mit einem weiteren eingefrorenen Lächeln auf den Lippen wandte er sich an Eleanora.
»Ist der Rest des Stabes bereits nach Leviathan vorausgereist, um alles für die Ankunft des Prinzen vorzubereiten, Ms O’Casey?«
Eleanora nahm einen Schluck Wein, der eine Winzigkeit größer war, als es der Höflichkeit entsprach, und blickte dann zu Captain Pahner hinüber.
»Ich bin der Rest des Stabes«, bemerkte sie dann kühl. Und das bedeutete, dass es niemanden gab, der als Vorhut ausgeschickt worden war. Und das bedeutete, dass, sobald sie erst einmal eingetroffen wären, Eleanora sich den Arsch abarbeiten könnte, um alle diese unbedeutenden Kleinigkeiten zu erledigen, um die sich eigentlich ihr Stab hätte kümmern müssen. Dieser Stab, deren Chefin sie scheinbar war. Dieser geheimnisvolle, auf magische Weise unsichtbare Stab.
Dem Captain war inzwischen klar geworden, dass er hier unbekümmert durch ein Minenfeld zu spazieren versucht hatte. Er lächelte erneut, nahm einen Schluck Wein, und wandte sich dann dem Engineering Officer zu seiner Linken zu, um mit ihm ein ungezwungenes Gespräch zu beginnen, das nicht dazu angetan war, irgendeinen Angehörigen der Kaiserliches Hofhaltung zu brüskieren.
Wieder befeuchtete Pahner mit dem Wein gerade nur die Lippen und blickte dann zu Sergeant Major Kosutic hinüber. Diese unterhielt sich ruhig mit dem Bosun, dem dienstältesten Unteroffizier des Schiffes; Kosutic fing Pahners Blick auf und hob einfach nur die Augenbrauen, als wolle sie fragen: »Ja, und was kann ich jetzt dagegen tun?« Zur Antwort zuckte Pahner eine Winzigkeit mit den Schultern und wandte sich dann dem Ensign zu seiner Linken zu. Was könnte irgendjemand von ihnen dagegen tun?
Kapitel 3
Pahner schleuderte das Memopad auf den Schreibtisch in dem winzigen Büro des Assault Complement Commanders, des Befehlshabers der Stoßtruppen.
»Ich denke, mehr können wir nicht planen, so lange wir nicht die Bedingungen vor Ort kennen«, meinte er zu Sergeant Major Kosutic, und diese zuckte gelassen mit den Schultern.
»Nun ja, Grenzplaneten voller hart gesottener Individualisten bringen sowieso nur selten Attentäter hervor, Boss.«
»Geschenkt«, räumte Pahner ein. »Aber es ist nah genug an Raiden-Winterhowe und an den Saints dran, um mich wirklich unruhig zu machen.«
Kosutic nickte, doch sie war klug genug, nicht alle Fragen zu stellen, die ihr sofort durch den Kopf schossen. Stattdessen spielte sie an ihrem Ohrläppchen, in dem leicht ein Ohrstecker, ein Totenschädel mit gekreuzten Knochen, glänzte. Dann warf sie einen Blick auf ihre altmodische Armbanduhr.
»Ich mache jetzt eine Tour durch das Schiff. Mal sehen, wie viele Wachposten schlafen«, verkündete sie.
Pahner lächelte. In den zwei Dienstzeiten, die er jetzt bei der Garde hinter sich gebracht hatte, war ihm niemals ein Wachposten untergekommen, der nicht absolut wach und aufmerksam gewesen wäre. So weit kam man einfach nicht, wenn man dazu neigte, während einer Wache auch nur die Schultern hängen zu lassen. Aber es konnte natürlich nie schaden, noch mal nachzuschauen.
»Viel Spaß«, wünschte er Kosutic.
Ensign Guha war damit fertig, ihre Schiffsstiefel zu versiegeln, und blickte sich in der Kajüte um. Alles war blitzblank; also hob sie den schwarzen Beutel zu ihren Füßen auf und berührte den Knauf, um die Luke zu ihrer Kajüte zu öffnen. Irgendwo in den Tiefen ihres Verstandes schrie eine leise Stimme auf. Aber es war eine sehr leise Stimme.
Sie trat aus der Kajüte heraus, wandte sich nach rechts, und schulterte ihren Stoffbeutel. Dieser Beutel war ungewöhnlich schwer. Was sich darin befand, wäre bei jeder Sicherheitsüberprüfung entdeckt worden, wie sie standardmäßig durchgeführt wurde, bevor ein Mitglied der Kaiserlichen Familie an Bord kam … und so war es auch gewesen. Und dann war der Inhalt akzeptiert worden. Dieses Landungsschiff war schließlich darauf ausgelegt, eine vollständig gerüstete Marines-Einheit aufzunehmen, und zu deren Ausrüstung gehörten auch Explosivstoffe. Die sechs hochverdichteten Pakete bestanden aus dem leistungsstärksten chemischen Sprengstoff, der jemals entwickelt worden war, und dieser sollte einfach jeder Aufgabe gewachsen sein. Den Gedanken empfand sie als erfreulich, und in ihrer Position als Logistik-Offizierin hatte sie jederzeit Zugriff auf dieses Material. Noch erfreulicher. Alles in allem sprühte Guha geradezu vor Freude.
Ihre Kajüte lag im Außenbereich des Schiffes, zusammen mit den meisten anderen Quartieren; und bis zum Maschinenraum hatte sie einen recht weiten Weg zurückzulegen. Doch es würde ein angenehmer Weg werden … trotz der leisen Schreie, die sie immer noch in ihrem Inneren hören konnte.
Mit großen Schritten ging sie den Gang hinunter, lächelte freundlich den wenigen Gestalten zu, die trotz der ›Nachtruhe‹, die offiziell jetzt an Bord des Schiffes eingehalten wurde, unterwegs waren. Es waren wirklich nur wenige. Doch niemand fragte die Logistik-Offizierin, warum sie zu so später Stunde noch unterwegs sei. Die ganze Fahrt über hatte sie derartige Nachtspaziergänge unternommen, und so schrieb man ihre nächtlichen Wanderungen durchs Schiff schlicht Schlaflosigkeit zu. Und das war auch durchaus richtig: Schließlich litt sie tatsächlich an Schlaflosigkeit, obwohl gerade in dieser Nacht an ihrer Schlaflosigkeit wirklich nichts ›schlicht‹ war.
Sie schritt durch die geschwungenen Korridore der riesigen Kugel, fuhr mit Fahrstühlen zu den unteren Etagen, beschrieb einen Umweg, der sie dennoch immer näher an den Maschinenraum brachte. Diesen ›Umweg‹ hatte sie bewusst so ausgewählt, um den Marines auszuweichen, die an strategischen Punkten des Schiffes Wache standen. Obwohl deren Detektoren ihre Sprengsätze nur entdecken würden, wenn sie ihnen wirklich sehr nah käme, würde ihnen wohl kaum die voll aufgeladene Energiezelle der Perlkugelpistole entgehen, die sich in dem gleichen Beutel befand.
Der Horizont in den grau gestrichenen Korridoren wurde immer schmaler, während sie sich dem Zentrum der riesigen Kugel näherte. Schließlich trat sie aus dem letzten Fahrstuhl heraus.
Der Korridor, den sie nun betrat, war zur Abwechslung einmal gerade, an seinem Ende lag eine Panzertür. Neben dieser Panzertür stand – so, dass er die Kontrolltafel der Tür versperrte – ein einzelner Marine in der silbergrauen Paradeuniform der Hauses der MacClintock.
Private Hegazi nahm Haltung an; eine Hand glitt sofort zu seiner Handfeuerwaffe, als sich die Fahrstuhltür öffnete; doch er entspannte sich fast sofort wieder, als er die Offizierin erkannte. Er war ihr schon häufig bei ihren Wanderungen durch das Schiff begegnet, aber noch nie in der Nähe des Maschinenraums.
Wahrscheinlich langweilt sie sich und will mal wieder was Neues sehen, überlegte er. Die wird ja wohl kaum meinetwegen hier sein? Ganz egal, ihm war klar, welche Pflicht er zu erfüllen hatte.
»Ma’am«, sprach er sie an, immer noch in der Grundstellung, während sie sich ihm näherte. »Dieser Bereich ist gesperrt. Ich muss Sie bitten, das Sperrgebiet umgehend zu verlassen.«
Ensign Guha lächelte schmallippig, während ein Fadenkreuz sich über ihr Blickfeld legte. Ihre rechte Hand, die in dem Beutel verborgen war, entsicherte die Perlkugelpistole, zog den Abzug durch und feuerte so eine Salve von fünf Schuss ab.
Die mit Stahl ummantelten Glaskern-Kugeln von fünf Millimetern Durchmesser wurden von den Elektromagneten, die entlang des Laufes der Waffe angebracht waren, auf eine phänomenale Geschwindigkeit beschleunigt. Der Rückstoß dieser Waffe war beachtlich; alle fünf Kugeln allerdings hatten den Lauf bereits verlassen, als dieser sich schließlich auszuwirken begann. Ensign Guhas Hand wurde aus dem jetzt rauchenden Beutel regelrecht herausgeschleudert, doch die Kugeln hielten weiterhin genau auf den wachhabenden Marine zu.
Hegazi war schnell. Das musste man auch sein, wenn man in die Garde wollte. Doch ihm blieb weniger als eine Achtelsekunde zwischen dem Moment, da seine Instinkte ihm eine Warnung zuschrien, und dem Auftreffen der ersten Perlkugel auf seinem Oberkörper.
Die äußerste Schicht seiner schweren Uniform bestand aus einem Kunststoff, der aussah wie lederfarbene Wolle, dabei aber feuerfest war. Kugelfest war dieser Kunststoff allerdings nicht. Die darunterliegende Schicht hingegen reagierte auf kinetische Energie. In dem Moment, da die Kugeln auftrafen, reagierte der Polymerwerkstoff, aus dem dieser Teil der Uniform bestand: Die chemischen Bindungen wurden durch die Energie der auftreffenden Geschosse verändert, sodass das Gewebe sich von ›weich und flexibel‹ in ›hart wie Stahl‹ verwandelte. Auch diese Panzerung besaß ihre Schwächen – so hatte sie etwa Schnitten nichts entgegenzusetzen –, aber sie war leicht und mit kleinen Schusswaffen praktisch nicht zu durchdringen.
Doch jedes Material besitzt eine Belastungsgrenze. Bei den Uniformpanzerungen der Marines lag diese Belastungsgrenze sehr hoch; allerdings ließen sich auch diese Panzerungen nicht unendlich belasten. Die erste Perlkugel zerbarst an der Oberfläche; Metall- und Glassplitter wurden in alle Richtungen geschleudert und zerfetzten dem Marine das Kinn, gerade, als dieser wieder nach seiner eigenen Waffe greifen wollte. Er verlagerte genau in dem Augenblick sein Gewicht, um eine kniende Schussposition einzunehmen, als ihn die zweite Perlkugel traf, einige Zentimeter oberhalb der ersten. Auch diese zerbarst, doch die überschüssige kinetische Energie reichte aus, die Molekülbindungen dieses widerstandsfähigen Materials zu lockern.
Die dritte Perlkugel schließlich drang durch. Sie folgte der zweiten unmittelbar, traf ihr Ziel nur ein Stückchen tiefer, ließ die ganze Kinetik-Panzerung wie Glas zerspringen und konnte nun einen Teil ihres Impulses ungehindert auf das jetzt freiliegende Brustbein des Marines übertragen.
Ensign Guha wischte das Blut von dem Tastenfeld und brachte ein kleines Gerät an dem Oberflächentemperatur-Scanner an. Sie verfügte nicht über die Codes, die erforderlich waren, um den Maschinenraum zu betreten, und auch nicht über die erforderlichen Gesichtszüge, wenn man es genau nahm. Aber jedes System kann umgangen werden, und das galt auch für dieses hier: Die Sicherheitssysteme registrierten via IR die Gesichtszüge der Chief Engineer der DeGlopper, und gleichzeitig wurde der richtige Code eingegeben – in genau der Art und Weise, wie der Chief selbst es auf dem Tastenfeld eingetippt hätte. Dann trat Guha durch die offene Panzertür und schaute sich um; sie war erfreut darüber, wenn auch nicht überrascht davon, dass niemand zu sehen war.
Die Maschinenräume des Schiffes waren riesig – sie nahmen fast ein Drittel des gesamten Innenraumes ein. Die Spulen des Tunnelantriebs und die Kondensatoren, von denen sie gespeist wurden, füllten einen Großteil dieses Raumes aus, und ihr schrilles Summen durchdrang den riesigen Raum, während sie unersättlich Energie verschlangen und dabei jegliches Konzept der einsteinschen Realität verzerrten. Die Lichtgeschwindigkeit konnte übertroffen werden; dazu allerdings waren immense Energien erforderlich, und der Tunnelantrieb verschlang Platz an Bord des Schiffes fast ebenso gierig wie Energie.
Doch das Feld, das dieses Tunnelantriebssystem erzeugte, war mehr oder weniger stationär und masseunabhängig. Wie beim Phasenantrieb gab es eine systemspezifische Grenze dafür, in welcher Größe die Felder erzeugt werden konnten – doch welche Masse sich im Inneren dieses Feldes befand, war unerheblich. Daher die Riesenhaftigkeit der Trägerschiffe der verschiedenen Kaiserlichen und republikanischen Flotten, die sich Gefechte zwischen den Sternen lieferten. Und daher die Riesenhaftigkeit der interstellaren Flottentransporter.
Doch alles, was damit zusammenhing, hing seinerseits von Energie ab – gewaltiger, fast nicht beherrschbarer Energie.
Ensign Guha wandte sich nach links und folgte dem geschwungenen Flur, während der Tunnelantrieb ohne Unterlass seine schrille Sternenmelodie hämmerte.
Kosutic nickte der Wache auf dem Waffendeck zu, als sie einen Schritt weit von der Luke zurücktrat. Die Wache, ein Neuzugang aus dem Ersten Zug, hatte sie an der Luke angehalten und darauf bestanden, dass sie sich einem Gesichtstemperatur-Scan unterzog und ihren Code eingab. Was genau das war, was von dieser Wache erwartet wurde, und das war auch der Grund, weswegen Sergeant Major Kosutic ihr anerkennend zugenickt hatte. Andererseits nahm sich Kosutic vor, mit der Zugführerin dieser Soldatin zu sprechen, Platoon Sergeant Margaretta Lai. Die Soldatin hatte sich sichtlich entspannt, als sie Sergeant Major Kosutic erkannt hatte, und sie musste dringend lernen, allem und jedem zu misstrauen. Ewige Paranoia war exakt der Sinn dieses Regiments. Anders konnte man in der heutigen Zeit unmöglich effektiv seinen Sicherheitsaufgaben nachkommen.
Trotz schneller erster Fortschritte auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und der Entwicklung neuer Prozessoren hatte die Menschheit nach dem Bau der ersten, noch sehr primitiven Computer fast ein Jahrtausend gebraucht, um ein System implantierter Prozessoren zu entwickeln, das vollständig mit dem menschlichen Nervensystem kompatibel war, ohne dass sich unerwünschte Nebenwirkungen einstellten. Diese ›Toots‹ genannten Implantate waren das Allerneueste, und sie wurden stets weiterentwickelt … und sie waren der Albtraum eines jeden Sicherheitsbeauftragten: Denn diese Toots konnten programmiert werden, die Steuerung des Körpers ihres Trägers vollständig zu übernehmen. Wenn etwas Derartiges geschah, hatte das bedauernswerte Opfer nicht mehr den geringsten Einfluss auf sein eigenes Handeln. Derartige Personen wurden von den Marines nur ›Toombies‹ genannt.
In manchen Gesellschaften wurden speziell modifizierte Toots verwendet, um das Verhalten verurteilter Straftäter zu beeinflussen; doch in den meisten Gesellschaften, das Kaiserreich der Menschheit eingeschlossen, war ein derartiger Einsatz von Hardware ausschließlich für militärische Zwecke gestattet. Die Marines selbst machten ausgiebigst Gebrauch von diesem System, zur Unterstützung im Gefecht und zur Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit; doch selbst sie blieben dieser Technik gegenüber stets ein wenig misstrauisch.
Das ganz große Problem stellten die Hacker dar. Eine Person, auf deren Toot ein Hacker zugegriffen hatte, konnte im wahrsten Sinne des Wortes dazu gebracht werden, alles zu tun. Erst vor zwei Jahren hatte jemand einen Attentatsversuch auf den Premierminister des Alphanischen Imperiums unternommen, indem er sich in das Toot eines Repräsentanten der Menschen eingehackt hatte. Der Hacker selbst war niemals gefunden worden; aber nachdem erst einmal die Sicherheitsprotokolle analysiert worden waren, hatte es sich als geradezu lächerlich einfach herausgestellt. Toots waren auf funkgesteuerten externen Dateninput ausgelegt, und im Besitz des Repräsentanten war ein kleines Gerät gefunden worden – getarnt als antike Taschenuhr. Man hatte gleich vermutet, diese sei ihm als Geschenk überreicht worden; doch woher auch immer sie stammen mochte – sie hatte die Steuerung seines Toots übernommen. Es war ganz so, als habe ein Dämon Besitz von diesem Mann ergriffen – ein Dämon, der sich in der antiken Büchse der Pandora versteckt hatte.
Seitdem mussten sich alle Mitglieder der Garde und alle Diener, die der Kaiserlichen Familie nahe kamen, in unregelmäßigen Abständen Scans unterziehen, und die Sicherheitsprotokolle ihrer Toots waren gerade erst wieder aktualisiert worden. Kosutic wusste das; aber sie wusste auch, dass es so etwas wie ›absolute Sicherheit schlichtweg nicht gab.
Sie nahm sich vor, Gunny Lai mit Hilfe von deren Toots aufzuspüren, und schmunzelte unwillkürlich über die Mehrdeutigkeit ihres eigenen Handelns. Sie hatte ihren Dienst bei den Marines angetreten, bevor diese Geräte eingeführt worden waren; jetzt allerdings war sie abhängig davon wie alle anderen auch. Deshalb entbehrte es nicht einer gewissen Komik, einer vor bitterer Ironie triefenden Komik allerdings, dass Kosutic momentan in diesen Geräten die größte Bedrohung für ihre Schutzbefohlenen sah.
Kosutic trat aus dem Fahrstuhl und ging erneut die Dienstpläne durch. Hegazi war für den Maschinenraum eingeteilt. Guter Soldat, aber noch frisch. Zu frisch. Ach verdammt, die waren alle ›zu frisch‹; achtzehn Monate reichten gerade aus, sie dazu zu bringen, ihre Arbeit anständig zu machen, und dann wechselten die meisten zum Stahl-Bataillon. Die wenigen, die bleiben wollten, waren nur selten die Besten. Dann musste Kosutic an Julian denken und lachte. Natürlich gab es ›die Besten‹ und ›die Besten‹. Aber sie nahm sich vor, Hegazi, der alles in allem ein guter Soldat war, daran zu erinnern, dass er wirklich immer und zu jeder Zeit einhundert Prozent paranoid bleiben musste.
Sie stand in der Blutlache, die sich um den Marine herum ausbreitete. Sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, seinen Puls zu überprüfen: Niemand, der so viel Blut verloren hatte, lebte noch; und sie war viel zu sehr damit beschäftigt, sich zu fragen, was sie jetzt zu tun hatte, um noch Zeit auf sinnlose Gesten zu verschwenden. Lange überlegte sie nicht – die Marines entschieden sich nicht gerade für die Zögerlichen, wenn es darum ging, Unteroffiziere für die Garde auszuwählen -; aber man hatte immer genug Zeit, Mist zu bauen, also musste es auch immer genug Zeit geben, das Richtige zu tun.
Sie tippte auf ihren Kommunikator.
»Wachhabender! Einen Trupp zum Maschinenraum! Sicherheitsverletzung! Keinen Gefechtsalarm geben!«
Sie unterbrach die Verbindung. Die Wachen würden jetzt Pahner informieren, der Attentäter jedoch erführe davon nichts, denn die Kommunikatoren der Marines waren verschlüsselt. Natürlich war es möglich, dass der Saboteur – und um Sabotage musste es dem Mörder hier gehen – ein halbes Dutzend oder mehr Signalgeber hinterlassen hatte, die ihn sofort informierten, dass er entdeckt worden war.
Kosutic löste den Sensorenstab vom Gürtel des toten Wachmanns und überprüfte die Luke. Hier gab es keinerlei erkennbarer Spuren. Kosutic gab den Zugangscode ein und trat, schnell und geduckt, durch die Luke hindurch, sobald diese sich öffnete. Hegazis Blut gerann bereits, und die Leiche kühlte ab; daher war anzunehmen, dass der Attentäter wahrscheinlich nicht noch auf der anderen Seite der Luke stand. Doch Eva Kosutic hatte nicht so lange überlebt, um den Rang eines Sergeant Major zu erlangen, wenn sie sich jemals auf ein ›wahrscheinlich‹ verlassen hätte.
»Maschinenraum, hier Sergeant Major Kosutic«, sprach sie in ihren Kommunikator. »Lösen Sie keinen, ich wiederhole, keinen Alarm aus! Mutmaßlicher Saboteur im Maschinenraum; die Wache ist tot.« Sie schwenkte den Sensorenstab. Wärmespuren waren überall zu finden, aber die meisten führten geradeaus. Alle Spuren außer einer. Eine einzige Spur löste sich vom Rest; sie führte links vom Sergeant Major weg, und diese schien frischer als alle anderen.
»Was?!«, drang eine ungläubige Stimme aus dem Kommunikator. »Wo denn?!«
»Sieht aus wie irgendwo in Quadrant Vier«, bellte sie. »An eure Scanner und Vids! Sucht ihn!«
Wer auch immer am anderen Ende der Leitung sein mochte, einen Augenblick lang schwieg er. Dann …
»Roger!«, drang aus dem Kommunikator.
Sie hoffte inständig, dass sie nicht gerade mit dem Saboteur gesprochen hatte.
Ensign Guha hielt inne und blickte nach links und rechts. Sie zog ein Messgitter hervor und lokalisierte damit den exakten Punkt, den sie an dem Schott zu ihrer rechten benötigte; dann griff sie wieder in ihren Beutel und zog eine Ein-Kilo-Ladung mit gerichteter Sprengwirkung hervor. Die Plastikabdeckung an der Unterseite zog sie ab und befestigte die Ladung sodann mit dem Klebestreifen am Schott; einen Augenblick lang begutachtete Guha ihre Arbeit, um sicherzustellen, dass sich die Ladung nicht wieder ablöste. Dann zog sie einen Stift heraus und legte einen Radschalter um. Ein rotes Licht blinkte kurz auf, um gleich wieder zu verlöschen: Die Bombe war jetzt scharf.
Wieder wandte sie sich nach links und setzte ihren Weg fort. Blieben noch drei.
Captain Pahner schloss die Vorderseite seines Tarnanzuges und stellte den Helm so ein, dass er das ganze System versiegelte, während der Fahrstuhl hinabsank. Gunnery Sergeant Jin, bereits vollständig gepanzert, stand neben ihm; er hatte Kosutics Helm in der Hand und ihren Tarnanzug über der Schulter. Die Standard-Ausführung der Marine-Uniformen bot gegen Projektilwaffen besseren Schutz als Paradeuniformen, ließ den Träger stets mit dem Hintergrund verschmelzen und war für Einsätze auch im Vakuum ausgelegt. Diese Uniformen waren nicht ganz so gut wie Kampfrüstungen, aber ihnen blieb nicht die Zeit, Vollpanzerungen anzulegen. Allerdings hatte Pahner bereits einen ganzen Zug abgestellt, der sich in Vollrüstung schon einmal warmlaufen sollte; doch sollte das alles hier nicht in den nächsten paar Minuten erledigt sein, dann wollte er nicht mehr Armand Pahner heißen.
»Eva!«, schnappte er in sein Helm-Mikro. »Reden Sie mit mir!«
»Drei bisher. Ein-Kilo-Sprengladungen, genau oberhalb der Plasma-Leitungen. So präpariert, dass sie hochgehen, wenn man sie entschärfen will. Das riech ich doch!«
»Captain Krasnitsky, hier spricht Captain Pahner«, bellte Pahner jetzt scharf in seinen Kommunikator. Überraschung ist eine mentale Verfassung und hat mit der Realität nichts zu tun, rief er sich selbst ins Gedächtnis. »Wir müssen diese Leitungen stilllegen!«
»Geht nicht«, gab Krasnitsky zurück. »Man kann einen Tunnelantrieb nicht einfach abschalten! Wenn man das versucht, dann kommt man irgendwo an einem Punkt raus, der in einer Kugel mit einem Radius von neun Lichtjahren liegt – wo, weiß man vorher nicht. Und das Plasma muss sowieso erst abgebremst werden. Wenn man das jetzt einfach abzuschalten versucht, dann … geht der Schuss nach hinten los! Dann könnte alles auf einmal zum Teufel gehen!«
»Wenn Sie unter feindlichem Beschuss stünden und wüssten, dass bald der Maschinenraum getroffen wird«, fragte Pahner, »was würden Sie dann unternehmen?«
»Dann würden wir unter Phasenantrieb fahren!«, fauchte Krasnitsky. »Man kann im Tunnelraum nicht getroffen werden! Für einen derartigen Fall existieren keinerlei Vorschriften!«
»Scheiße«, erwiderte Pahner ruhig. Das war das erste Mal, dass irgendjemand ihn hatte fluchen hören. »Sergeant Major, kommen Sie sofort da raus!«
»Ich kann keine Zeitzünder erkennen!«
»Sind aber da!«
»Wahrscheinlich. Aber wenn ich den Auslöser …«
»Vielleicht haben die eine Totmannschaltung«, unterbrach Pahner den Sergeant Major und biss die Zähne zusammen, als er aus dem Fahrstuhl trat. »Das ist ein Befehl, Sergeant Major Kosutic! Raus da! Sofort!«
»Ich komme wahrscheinlich eher in einem Stück hier raus, wenn ich mir den Zünder vornehme, als wenn ich mich zurückziehe«, entgegnete Kosutic sanft.
Pahner betrachtete die erste Bombe. Wie Kosutic gesagt hatte, gab es keinerlei Anzeichen dafür, aber es roch regelrecht danach, dass die Sprengsätze gegen Entschärfungsversuche präpariert worden waren. Er wandte sich dem wachhabenden Sergeant zu, Sergeant Bilali vom Ersten Zug, der dafür, dass er nur wenige Schritt neben einer Bombe stand, die jederzeit hochgehen konnte, geradezu unnatürlich ruhig und gelassen wirkte. Die Soldatin neben ihm, eine Private, wirkte nicht ganz so entspannt: Sie starrte den Rücken des Sergeants an und atmete tief und regelmäßig durch. Das war eine sehr gebräuchliche Methode, um mit der immensen Anspannung umzugehen, die sich im Rahmen von Feuergefechten und vergleichbaren Situationen aufbauen konnte – und genau das schien bei ihr jetzt der Fall zu sein. Mit gehobener Augenbraue schaute Pahner zu Bilali hinüber.
»Sprengkommando?«
»Schon unterwegs, Sir«, entgegnete der Sergeant sofort.
»Gut«, bestätigte Pahner mit einem Nicken, dann schaute er sich um. Wenn der Bombenleger ihnen genug Zeit ließ, dann konnten sie versuchen, die Bomben an Ort und Stelle gezielt zu zünden. Die Explosion einer weiteren Ladung, die unmittelbar neben der anderen angebracht würde, sollte den Plasmastrahl der Bombe mit gerichteter Sprengwirkung unterbrechen, und die Schotts waren extra gepanzert, um die Plasmaleitungen zu schützen. Abgesehen von dem Plasmastrahl einer gerichteten Sprengladung gab es keinerlei Möglichkeit, diese Panzerung zu durchdringen. Natürlich konnte das nur funktionieren, wenn die Bomben nicht hochgingen, bevor das Sprengkommando eintraf.
»›Wenn du den Kopf behalten kannst, während alle um dich her …‹«, flüsterte Pahner und dachte angestrengt nach.
»Wie bitte, Sir?«
»Folgt irgendjemand dem Sergeant Major?«
»Ja, Sir«, bestätigte Bilali. »Kommandos nähern sich von beiden Seiten, und eines durchquert dazu noch geradewegs den Maschinenraum.«
»Also gut. Wir wissen alle, dass wir mutig sind, aber es gibt einen feinen Unterschied zwischen ›Mut‹ und ›Dummheit‹. Nichts wie raus hier, und dann riegeln wir diesen Korridor ab, für den Fall, dass diese Dinger losgehen!«
»Aye, aye, Sir!« Der Ausdruck auf Bilalis pechschwarzen Gesicht veränderte sich nicht für einen Sekundenbruchteil, als er den Kommunikator berührte. »Wachen! Alle außer dem Einsatztrupp raus aus dem Korridor! Beide Enden abriegeln.« Dieser Korridor verlief kreisförmig um das ganze Schiff herum. Obwohl es seitlich verlaufende Verbindungsgänge gab, blieben diese selbstverständlich geschlossen. Nur die Luken des Zentralkorridors sollten offen bleiben. Und die dazwischenliegenden Panzertüren. Wenn es zum Äußersten käme …
»Captain Krasnitsky«, fragte Pahner, »was passiert, wenn wir alle Türen schließen und die Bomben dann explodieren?«
»Unschöne Dinge«, schnaubte eine weibliche Stimme. »Hier spricht Lieutenant Furtwangler – ich bin hier der Chief Engineer. Erstens sind die Panzertüren nicht auf mehrfaches Plasma-Versagen ausgelegt. Vielleicht werden die nicht verhindern können, dass das Plasma in den Maschinenraum eindringt. Und selbst wenn es den Dingern gelingen sollte, zu verhindern, dass das Plasma uns alle umbringt, würde dennoch der TA ausfallen. Bei einem derartigen Schaden würden wir den Antrieb wahrscheinlich nicht mehr zum Laufen kriegen, und selbst wenn, dann hätten wir auf jeden Fall einen Großteil unserer Reichweite verloren. Der Satan allein weiß, welche Folgeschäden sich dabei ergeben könnten. Ich sag ja: unschöne Dinge«, wiederholte sie.
Pahner nickte, als die Panzertüren seine Marines aussperrten. Unschöne Dinge schienen überall zu geschehen.
Kosutic hatte herausgefunden, nach welchem Muster die Bomben platziert worden waren, und als sie sich der sechsten Panzertür näherte, hechtete sie nach vorn und rutschte bäuchlings auf die Stelle zu, von der aus sie die nächste Bombe würde erkennen können.
Ensign Guha feuerte eine Salve Perlkugeln ab, die kreischend die Luft an genau der Stelle durchschnitten, an der sich der Sergeant Major befunden hätte, wäre sie aufrecht um die Ecke gekommen. Obwohl Guha die Waffe schon beidhändig abfeuerte, riss der Rückstoß der Pistole ihr die Hände über den Kopf, und so blieb ihr keine Zeit mehr, die Waffe wieder auf ihr Ziel zu richten.
Eva Kosutic hatte Hunderte von Feuergefechten überstanden und schoss jede Woche Tausende von Perlkugeln ab, einfach nur, um nicht aus der Übung zu kommen. Kein eingehacktes Attentäter-Programm, wie gut es auch entwickelt sein mochte, vermochte gegen derart viel Erfahrung anzukommen. Sie richtete ihre eigene Perlkugelpistole auf die Kehle der jungen Ensign, dann feuerte sie ein einziges Geschoss ab.
Die Perlkugeln, jede mit einem Durchmesser von fünf Millimetern, wurde in dem zwanzig Zentimeter langen Lauf der Waffe auf eine Geschwindigkeit von vier Kilometern pro Sekunde beschleunigt. Als die Perlkugel den Hals der Ensign traf, einen Zentimeter neben der Luftröhre, zerbarst sie und wandelte innerhalb eines Sekundenbruchteils ihre gesamte kinetische Energie in einen explosiven hydrostatischen Schock um.
Die Explosion riss den Schädel der Ensign von deren Körper und schleuderte ihn fort, während die durchtrennten Halsschlagadern pulsierend Blut über die noch nicht scharf gemachte Bombe zu Füßen der Attentäterin pumpten.
Noch bevor die kopflose Leiche von Ensign Guha auf dem Boden aufschlug, war Kosutic schon wieder in Bewegung. Die bereits scharf gemachten Bomben sollten vermutlich ferngezündet werden, aber es mochte ebenso gut einen Notfallplan geben. Zu jedem derart akribisch durchdachten Plan musste es einen Notfallplan geben! Das Einfachste wäre sicherlich ein Zeitzünder, sinnvoller jedoch wäre eine Totmannschaltung, die vom Toot der Attentäterin gesteuert würde. Sobald die Ensign starb, was wohl mehr oder weniger gerade eben geschehen war, würde das Toot ein Signal abstrahlen – wahrscheinlich in dem Moment, in dem jegliche Hirnaktivität erloschen wäre –, das die Bomben zur Detonation bringen würde. Doch auch wenn dieser Ensign-Zombie eigentlich schon tot war, blieb das Gehirn in einem derartigen Fall noch einige Sekunden aktiv. Das war auch der Grund für den Sergeant Major gewesen, ihr in den Hals zu schießen, nicht in den Kopf.
Sämtliche Bomben befanden sich hinter Eva Kosutic, und sie hatte die Absicht, dafür zu sorgen, dass sie von ihnen so weit wie möglich entfernt sein würde. Sie hämmerte auf ihrem Kommunikator. »Feuer im Loch!«, schrie sie, während sie, so schnell sie nur konnte, über das verspritzte Blut und den Schädel der Ensign hinweg hechtete.
Captain Pahner hatte gerade den Mund geöffnet, um den Befehl des Sergeant Majors zu wiederholen, als eine ganze Reihe dumpfer Schläge ertönte und die Welt sich seitwärts neigte.
Kapitel 4
Später wusste Roger nicht mehr zu sagen, ob es der Gefechtsalarm oder die groben Hände der Marines gewesen waren, die ihn aus dem Schlaf gerissen hatten.