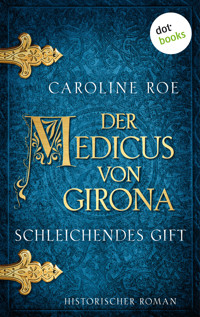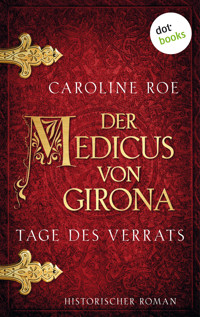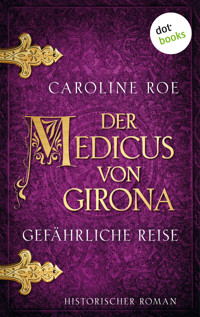
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Chroniken von Isaac von Girona
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wenn Unheil aufzieht ... Der packende historische Krimi »Der Medicus von Girona – Gefährliche Reise« von Caroline Roe als eBook bei dotbooks. Eine dunkle Bedrohung greift um sich ... Im Jahre der Herrn 1354 steht das Konzil von Tarragon kurz bevor. Berenguer, der Bischof von Girona, hat als Reisegefährten ausgerechnet seinen jüdischen Medicus Isaac auserkoren – nicht ohne Hintergedanken: Gerüchte von Intrigen und Verschwörungen in der Hafenstadt sind an sein Ohr gedrungen. Der Medicus, der sich bereits in der Vergangenheit als scharfsinniger Ermittler erwiesen hat, soll diesen auf den Grund gehen. Berenguers Ahnung bestätigt sich, als sie unterwegs die Leiche eines päpstlichen Boten finden. Während Isaac und der Bischof noch versuchen, den geheimnisvollen Brief des Papstes zu entschlüsseln, den der Tote bei sich hatte, erreicht sie eine weitere Hiobsbotschaft: Die Tochter des Königs wurde entführt ... Könnte der Brief ihnen helfen, sie zu retten? Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Medicus von Girona – Gefährliche Reise« von Caroline Roe ist der dritte Band ihrer mitreißenden Reihe historischer Krimis um den ermittelnden Medicus Isaac. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine dunkle Bedrohung greift um sich ... Im Jahre der Herrn 1354 steht das Konzil von Tarragon kurz bevor. Berenguer, der Bischof von Girona, hat als Reisegefährten ausgerechnet seinen jüdischen Medicus Isaac auserkoren – nicht ohne Hintergedanken: Gerüchte von Intrigen und Verschwörungen in der Hafenstadt sind an sein Ohr gedrungen. Der Medicus, der sich bereits in der Vergangenheit als scharfsinniger Ermittler erwiesen hat, soll diesen auf den Grund gehen. Berenguers Ahnung bestätigt sich, als sie unterwegs die Leiche eines päpstlichen Boten finden. Während Isaac und der Bischof noch versuchen, den geheimnisvollen Brief des Papstes zu entschlüsseln, den der Tote bei sich hatte, erreicht sie eine weitere Hiobsbotschaft: Die Tochter des Königs wurde entführt ... Könnte der Brief ihnen helfen, sie zu retten?
Über die Autorin:
Caroline Medora Sale Roe (1943–2021) lebte in Kanada. Sie war Doktorin der Mediävistik und als Lehrerin sowie als Übersetzerin tätig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Unter dem Pseudonym Medora Sale schrieb sie erfolgreich kontemporäre, und unter Caroline Roe historische Kriminalromane. Sie war verheiratet mit dem Mediävisten Harry Roe und hatte mit ihm eine Tochter.
Caroline Roe veröffentlichte bei dotbooks bereits »Der Medicus von Girona – Tage des Verrats« und »Der Medicus von Girona – Schleichendes Gift«.
***
eBook-Neuausgabe November 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »An Antidote for Avarice« bei Berkley Prime Crime, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Nachricht von einem Toten« bei Rowohlt.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1999 by Caroline Roe
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Artyzan, LiliGraphie, Andrey Solovjev, Prokrida
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-270-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Medicus von Girona – Gefährliche Reise« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Caroline Roe
Der Medicus von Girona – Gefährliche Reise
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Marc Staudacher
dotbooks.
Dieses Buch ist Deborah Schlow gewidmet; in vielerlei Hinsicht ist es ihres.
Die Personen
Avignon:
Gonsalvo de Marca, ein Landbesitzer aus dem südlichen Katalonien
Seine Heiligkeit Papst Innozenz VI.
Norbert, ein Franziskanermönch
Rodrigue de Lancia, ein katalanischer Edelmann
Tornas de Patrinhanis, Botschafter der Stadt Ancona in der päpstlichen Residenz
Girona:
(Kathedrale)
Arnau de Corniliano, Chorherr und Domherr in Abwesenheit von Bischof Berenguer
Galceran de Monteterno, Pere Vitalis, Ramon de Orta, drei Chorherren
Fortunat, Neffe von Galceran
Vidal de Blanes, Abt von Sant Feliu
(Call)
Daniel, ein junger Handschuhmacher, Raquels Freier
Salomó des Mestre, Hauslehrer von Yusuf
(Stadt)
Ein achtjähriges Mädchen aus Sant Feliu
Marc, Onkel der Achtjährigen Mutter
Benedicta, eine Schankwirtin
Romeu der Tischler, Schiffbauer
Die Reisenden:
Agnete, eine sündige Nonne
Andreu, ein fahrender Musikant
Berenguer de Cruilles, Bischof von Girona
Bernat sa Frigola, Sekretär des Bischofs
Elicsenda, Äbtissin des Klosters Sant Daniel
Enrique, jüngstes Mitglied der bischöflichen Leibgarde
Felip, ein fahrender Musikant
Francesc de Monterranes, persönlicher Berater und Beichtvater des Bischofs
Gilabert, ein verwundeter junger Edelmann
Ibrahim, Hausdiener bei Isaac
Isaac, Arzt und Heiler aus Girona
Judith, Isaacs Frau
Marta, eine Nonne aus Elicsendas Kloster
Naomi, Isaacs Köchin
Raquel, Tochter von Isaac und Judith
Yusuf, Isaacs Lehrling und Assistent
Barcelona:
Pedro von Aragon, Herzog von Barcelona und König
Eleanor, seine Gemahlin und Königin
Francesc Ruffach, Domherr von Barcelona in Abwesenheit von Miguel de Rigoma.
Mordecai ben Issach, ein Arzt
Tarragona:
Dinah, Judiths Schwester
Joshua, Dinahs Mann
Ruben, Joshuas Neffe
Sancho Lopez de Ayerbe, Erzbischof von Tarragona
Pons de Santa Pau, Diener des Königs
Anwohner der Straße nach Tarragona:
Emilia, Frau des Kastellans von Castellvi de Rosanes
Lluisa, ihr unfähiges Kindermädchen
Fernan, Gilaberts Onkel
Benvenist, ein Diener
Miro, ein Diener
Schankwirte, Mönche, herrschaftliche Familien und ihre Dienerschaft
Historische Vorbemerkung
Zur Zeit der Handlung dieses Romans – im Frühjahr des Jahres 1354 – residierte der Papst aufgrund der politischen Unruhen in Rom wie schon seine unmittelbaren Amtsvorgänger in Avignon. Pedro IV (auch bekannt unter dem Namen Pere III. von Katalonien, genannt der Förmliche) war König von Aragon. Das Land bereitete sich auf einen Krieg gegen seinen Vasallenstaat Sardinien vor.
Doch der Krieg war mit einem lästigen Verwaltungsaufwand verbunden. Um ihn fuhren zu können, musste Pedro mittels Steuern und Anleihen enorme Summen mobilisieren und außerdem verlässliche Vertreter finden, die die Regierungsgeschäfte übernahmen, während er mit der Königin in Sardinien weilte. Diese kriegsbedingte Abwesenheit des Königspaars bot politischen Gegnern willkommene Gelegenheit, einen Umsturz zu versuchen.
Zudem berief die Erzdiözese von Tarragona ihre Bischöfe zu einem Generalkonzil ein, was ein fast ebenso aufwändiges Unterfangen darstellte. Die Reise eines Bischofs von einer Stadt in die andere kam nahezu einem Zug in den Krieg gleich, da es üblich war, dass der Würdenträger standesgemäß mit einem kleinen Heer von Gefolgsmännern und Leibwächtern reiste, die für seine Sicherheit und den angemessenen Komfort zu sorgen hatten.
Das historische Hintergrundgeschehen sowie die meisten Figuren dieses Buches sind den zahlreichen schriftlichen Zeugnissen aus jener Periode entnommen. Pedro hat eine Chronik seiner Regierungszeit hinterlassen, die uns einen Blick auf die Menschen und die politische Situation gewährt, ebenso auf sein eheliches Zusammenleben mit Eleanor von Sizilien, seiner Vertrauten und Ratgeberin, einer klugen und furchtlosen Frau, die ihn auf all seinen Reisen begleitete, ja ihm selbst an Bord seiner Schlachtschiffe folgte.
Auch päpstliche Urkunden bilden eine ergiebige Quelle. Über Jahrhunderte hatten die päpstlichen Residenzen als internationale Gerichte fungiert und in Streitigkeiten zwischen verschiedenen Staaten Vermittlerfunktion übernommen. Ein päpstlicher Brief zur Schlichtung eines solchen Disputs liegt diesem Roman zugrunde. Aufgebrachte Händler aus der Stadt Ancona hatten fünf katalanische Schiffskapitäne der Piraterie bezichtigt und sie für den Verlust wertvoller Schiffe sowie der dazugehörigen Schiffsladungen verantwortlich gemacht. Die Italiener zerrten die Katalanen bis vor den päpstlichen Gerichtshof, nur um sich mit der bitteren Tatsache konfrontiert zu sehen, dass es leichter ist, ein Urteil zu erwirken, als es tatsächlich umzusetzen. Bei den Piraten von Ancona handelte es sich nämlich um Mitglieder der Flotte von Aragon.
Bischof Berenguer von Girona reiste auf der Via Augusta zum Konzil, jener prachtvollen römischen Straße, die von der ewigen Stadt bis zur Südküste des heutigen Spaniens führte. Die Straße existiert noch immer, wenngleich ihr Verlauf stellenweise durch spätere Baumaßnahmen unkenntlich geworden ist.
Die Historiker vermuten, dass Berenguer in die königlichen Kriegsvorbereitungen verwickelt war; sie führen diesen Umstand als Grund dafür an, dass Berenguer hinsichtlich des Konzils zu Tarragona im Jahre 1354 keinerlei Hinweise auf seine Anwesenheit beziehungsweise sein Fernbleiben hinterlassen hat. Der vorliegende Roman liefert hierzu einige alternative Erklärungen.
Berenguer de Cruilles, Bischof von Girona, hat wirklich gelebt, und die Quellen bescheinigen ihm ein freundschaftliches Verhältnis zur jüdischen Gemeinde. Sein blinder Leibarzt Isaac von Girona ist nur zum Teil eine fiktive Gestalt. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte der mystische Philosoph und Kabbalist Isaac der Blinde gelebt, der aufgrund seiner Weisheit und seiner unheimlichen Fähigkeit, Krankheiten sowie den herannahenden Tod zu »sehen«, verehrt worden war. Seine Schüler trugen seine religiösen und philosophischen Lehren in den Süden und insbesondere nach Girona. Wenn Isaac der Blinde einen Nachfahren hatte, der als junger Mann in die Stadt kam, und wenn dieser Nachfahre die Fähigkeiten seines Ahnen besaß, so hätte er gut Medizin studieren, eine Frau wie Judith heiraten, Berenguers Leibarzt werden und ebenfalls erblinden können. Jüdische Arzte waren hoch angesehen und konnten sowohl den höheren Klerus als auch den Adel zu ihren Patienten zählen.
Erster Teil
Kapitel 1
Girona
10. März 1334
»Es ist mir ganz gleich, was du dazu sagst, Isaac. Ich komme mit.«
Der Arzt wandte seiner Frau das Gesicht zu, als mustere er sie mit seinen blinden Augen. »Nein, Judith«, entgegnete er heftig. »Das ist unmöglich. Wenn da noch etwas von dem köstlichen Lamm übrig ist, würde ich es jetzt gerne haben. Raquel und ich haben heute Morgen eine ziemliche Strecke zu Fuß zurückgelegt, nicht wahr?«, sagte er, seiner Tochter zugewandt.
»Ja, Papa.«
»Natürlich«, sagte Judith. »Naomi, gib deinem Herrn noch etwas von dem Lamm.« Sobald die Köchin in der Küche verschwunden war, setzte die Frau des Arztes ihren Vorstoß fort. »Lenk nicht vom Thema ab, Isaac. Ich werde dich nach Tarragona begleiten und meine Schwester besuchen. Schließlich habe ich Dinah seit ihrer Hochzeit nicht mehr gesehen.«
»Judith, sei doch vernünftig«, erwiderte Isaac ruhig. »Die Reise wird lang werden, und Seine Exzellenz der Bischof ist ein ungeduldiger Mann.«
»Das ist mir gleich«, entgegnete seine Frau. »Soll er doch ungeduldig sein.«
»Mama«, schaltete sich ihre Tochter ein. »Die Zwillinge sitzen noch am Tisch.«
»Dann können sie jetzt aufstehen«, gab Judith gereizt zurück. »Und Yusuf auch.«
»Judith, du musst wissen, dass der Erzbischof von Tarragona über Seine Exzellenz verärgert ist«, sagte Isaac. »Ich werde nicht zulassen, dass er durch deine unvernünftigen Wünsche noch zusätzlich behelligt wird.«
»Das ist mir gleich, und wenn der Papst in Avignon seinen Kopf fordert«, sagte Judith. »Ich komme mit nach Tarragona.«
»Es würde dir sehr schnell nicht mehr egal sein, wenn er sein Amt verliert«, entgegnete Isaac.
»Soll er es meinetwegen schon morgen verlieren, mich kümmert das nicht.«
»Und wir würden mit ihm zugrunde gehen, das versichere ich dir. Er war uns stets ein guter Freund – und ein mächtiger Beschützer.« Einer der Zwillinge griff nach seinem Becher und stieß ihn ungeschickt um. Isaac wandte den Kindern ein Ohr zu. »Judith«, sagte er mit Nachdruck, »es ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort für solche Diskussionen.«
»Wenns nach dir geht, Isaac, ist niemals die rechte Zeit oder der rechte Ort. Du weigerst dich doch beharrlich, über Dinge zu sprechen, die dir nicht passen, und Raquel steht dir regelmäßig zur Seite. Ich bin es leid. Und euch beiden habe ich doch gesagt, dass ihr gehen könnt«, fauchte sie. »Das gilt auch für dich, Yusuf.«
Die zwei Siebenjährigen kletterten eilig von der Bank und stürmten hinaus; Yusuf, Isaacs Lehrling, folgte ihnen gemesseneren Schrittes und schloss die Tür sorgsam hinter sich.
»Jeder zusätzliche Mitreisende hält ihn nur auf«, sagte Isaac so langsam, wie er nur sprach, wenn er verärgert war. Raquel schob ihren Teller von sich und suchte nach einem Vorwand, den jüngeren Geschwistern zu folgen. »Niemand, der nicht absolut unentbehrlich ist, wird uns begleiten«, fügte ihr Vater hinzu. »Und ich kann dir versichern, dass ich mich ihm nicht zu meinem persönlichen Vergnügen anschließe. Ich werde arbeiten und keine Zeit haben – absolut keine Zeit –, um dich zu unterhalten.«
»Unfug. Der Bischof mag an ein paar unbedeutenden Wehwehchen leiden, wirklich krank ist er doch nie«, erwiderte Judith. »Du wirst auf der ganzen langen Hin- und Rückreise nichts zu tun haben. Ich komme mit dir. Und Raquel nehme ich auch mit.« Sie erhob sich. »Ich werde den Rabbi bitten, einen Brief für mich aufzusetzen, um Dinah von unseren Plänen in Kenntnis zu setzen. Raquel, komm mit in die Wohnstube. Ich möchte mit dir sprechen.«
»Warte hier, Raquel«, sagte Isaac und schob den Teller mit geröstetem Lamm, Knoblauch und Kräutern beiseite, um den er eben noch gebeten hatte. »Ich möchte mit dir reden.«
Judith funkelte ihre Tochter an und rauschte dann aus dem Zimmer.
»Oh, Papa«, seufzte Raquel. »Bitte, ich möchte nicht nach Tarragona. Mama und Tante Dinah versuchen doch immer noch, mich mit dem Neffen von Onkel Joshua zu verheiraten.«
»Keine Sorge. Wir werden keine Frauen mitnehmen«, beruhigte sie ihr Väter. »Seine Exzellenz ist fest entschlossen, mit so wenig Gepäck und so zügig wie möglich zu reisen.«
»Bist du sicher?«
»Absolut sicher, meine Liebe. Ich verspreche dir, dass du vor dem jungen Mann sicher bist, den deine Tante für dich ausgesucht hat, wer auch immer er sein mag.«
»Danke, Papa«, erwiderte Raquel erleichtert, denn obgleich ihre Mutter erstaunlich starrköpfig sein konnte, vertraute Raquel doch darauf, dass ihr Vater bei ernsthaften häuslichen Meinungsverschiedenheiten unbeweglich wie ein Fels bleiben würde. »Ich habe mich nur gefragt …«
»Was denn?«
»… ob du nicht auch meinst, dass es sich der Bischof bei all seinem Reichtum und seiner Wichtigkeit leisten könnte, geruhsam und mit größtmöglichem Komfort zu reisen? Insbesondere, wenn er krank ist.«
»Seine Exzellenz mag zwar ein paar Zipperlein und Wehwehchen haben, Raquel, aber er ist ein kräftiger und gesunder Mann. Und das weißt du selbst auch nur zu gut.«
»Warum soll die Reise dann so zügig vonstatten gehen, Papa?«
»Liebes, hier ist wohl überlegtes Handeln nötig. Die Situation ist schwierig für Seine Exzellenz. Er steht beim Erzbischof und beim König in Missgunst. Selbst deine Mutter hat ja schon den Papst erwähnt. Und wenn schon deine Mutter davon erfahren hat, dann bedeutet das wohl, dass das Gerücht, der Erzbischof habe jemanden nach Avignon gesandt, um beim Papst Beschwerde einzureichen, in der Tat bereits weit verbreitet ist.«
»Aber davon ist doch nichts wahr, oder? Ich meine, die Leute reden doch immer schreckliches Zeug, und meistens ist nichts dran an der Sache.«
»Jedenfalls scheint die Welt außerhalb unserer Stadt Girona zurzeit keineswegs gut auf den Bischof zu sprechen zu sein«, sagte Isaac trocken.
»Ich dachte, Seine Exzellenz könnte den Großteil der Welt außerhalb Gironas ignorieren«, bemerkte Raquel.
»Mag sein. Aber Seine Majestät der König bereitet sich auf den Krieg mit Sardinien vor –«
»Ich weiß, Papa.«
»Natürlich weißt du das. Aber wenn Krieg in der Luft liegt, fangen die Leute an, hinter jedem Busch und jeder Tür Verräter zu wittern. Erinnere dich nur daran, dass mein verehrter Freund Berenguer, der Bischof, damals jene Nonne nicht ausgeliefert hat, die an der Entführung der Tochter Seiner Majestät beteiligt war.«
»Sie hat auch einen Namen, Papa«, warf Raquel ein, wenn auch nur, um ihrem Vater in Erinnerung zu rufen, dass auch sie ein Opfer jenes missglückten Plans geworden war. »Sor Agnete. Und es war die Abtissin Elicsenda, die sie ins Gefängnis hätte stecken sollen. Nicht der Bischof.«
»Aber als Bischof der Diözese wird er als der Verantwortliche angesehen, Raquel; und dass er nicht entsprechend handelte, hat Seine Majestät erzürnt und Gerüchte von Verrat in Umlauf gebracht. Er sollte sie auch nicht ins Gefängnis stecken«, fügte Isaac hinzu, wo doch seine Tochter schon auf Genauigkeit zu bestehen schien. »Sondern lediglich in Tarragona dem Gericht überstellen.
Und dies bedeutet seinerseits natürlich, dass auch der Erzbischof über ihn verärgert ist.«
»Warum schicken sie sie dann nicht einfach fort, und die Sache ist erledigt?«
»Das müsstest du schon die Äbtissin und den Bischof fragen, meine Liebe. Ich weiß es nicht. Außer dass es etwas mit der Sicherheit der Reisevorbereitungen zu tun hat.«
Kapitel 2
Avignon
12. März 1354
»Woher weiß ich denn, dass Ihr mich auch bezahlen werdet, wenn ich es Euch sage?«, fragte der engelsgleich aussehende Page in dem samtenen Gewand.
Rodrigue de Lancia schnürte seinen Geldbeutel auf und reichte ihm eine Münze. Dann ergriff er den Jungen beim Arm und schüttelte ihn. »So – und was ist jetzt also da drinnen vorgefallen?«, fragte er.
»Euer Vetter soll hängen, Signore.«
»Aufgrund welchen Vergehens?«
»Piraterie. Und sein gesamter Besitz soll konfisziert werden.«
»Ich muss los«, murmelte Rodrigue. »Ich muss nach Empuries zurück, um ihn zu warnen, bevor –«
»Aber Signore, das Ganze ist noch lange nicht besiegelt. Haben Euch Eure Advokaten nichts gesagt?«
»Mir hat man nichts gesagt«, entgegnete er. »Jedenfalls nichts Gescheites. Was denn noch?«
»Der Fall muss Seiner Heiligkeit dem Papst vorgetragen werden«, erklärte der Junge. »Dort wird er dann unter strengster Vertraulichkeit im engsten Beraterkreis erörtert.«
»Und einer dieser engsten Berater ist also dein Herr?«, fragte Rodrigue.
Der Page hob in einer hilflosen Geste die Hände.
»Wann findet diese geheime Zusammenkunft statt?«
»Morgen, sagt mein Herr«, antwortete der Junge und hielt seine Hand auf. »Und morgen kommt der Fall Eures Freundes zur Verhandlung. Ich erwarte Euch dann um die gleiche Zeit im großen Hof und berichte über beides.«
»Der? Der ist kein besonderer Freund von mir.« Kurz huschte ein belustigter Ausdruck über Rodrigues düstere Miene. »Aber zweifelsohne wird er hier sein. Er kann dich dann selber bezahlen«, fügte er noch hinzu und wandte sich zum Gehen. Hinter ihm ertönte ein Rufen; lautstark instruierte der Architekt die Steinmetze, wie sie den nächsten sauber herausgearbeiteten Steinblock in den neuen Anbau des päpstlichen Palastes zu Avignon einzufugen hätten.
Tornas de Patrinhanis, Botschafter des Stadtstaates Ancona am päpstlichen Hof, wurde in das Chambre de Parement geführt, wo die wenigen Auserwählten auf eine Audienz bei Seiner Heiligkeit Papst Innozenz VI. warteten. Der blasse, engelsgleich anmutende Page des Botschafters trug ein blaues Gewand, das ebenso elegant geschnitten und teuer war wie das rot-goldene seines Herrn; er hatte seinen neu gewonnenen Freund Rodrigue zurückgelassen und sich dem Gefolge des Botschafters angeschlossen. Dieser und sein Sekretär wärmten sich an dem Feuer, das nahe der Treppe brannte, welche zum Schlafgemach des Papstes hinaufführte. Die übrigen seiner Gefolgsmänner schwatzten im Flüsterton am anderen Ende des Raumes.
Der kleine Page ergriff die Gelegenheit: Er lief davon, einzig mit seinen Locken und seinem bezaubernden Lächeln bewaffnet, und eilte an den Dienern vorbei durch einen kleinen Speisesaal in die private Küche des Papstes. Furchtlos tauchte er in das Labyrinth der schmalen Korridore und Treppen ein und schlängelte sich geschickt durch die verzweigten Gänge, bis er eine Nische mit einer breiten Fensterbank erreichte. Diese befand sich unmittelbar gegenüber dem päpstlichen Schlafgemach. Seine Mission war erfolgreich verlaufen. Er war nur knapp zwanzig Schritte von seinem Ausgangspunkt entfernt. Und allein. Also machte er es sich bequem und wartete.
Der Botschafter von Ancona wurde in das prachtvolle Schlafgemach geleitet, das ursprünglich für Clemens VI., Innozenz’ Amtsvorgänger, eingerichtet worden war. Während der fünfzig Jahre, die die Päpste nun schon in Avignon residierten – seit der unseligen Verstrickung Clemens’ V in den Bürgerkrieg in Rom –, waren viel Zeit, viel Überlegung und viel Gold in das Unterfangen geflossen, die bescheidene Abtei in eine den Kirchenfürsten angemessene Residenz zu verwandeln. Selbst Tornas, der schon früher in diesem Raum empfangen worden war, wurde von seiner Umgebung merklich überwältigt.
»Es ist nicht das erste Mal, dass der Heilige Stuhl Scherereien mit Aragon hat«, sagte der Papst. »Wir hatten gehofft, Zusammenstöße zu vermeiden, können es andererseits jedoch nicht billigen, wenn auf See ein christlicher Staat über den anderen herfällt.«
»Die Bürger von Ancona wären äußerst dankbar, wenn Eure Heiligkeit in ihrem Namen einschreiten würde«, sagte der Botschafter. »Sie werden durch die grausame und gewissenlose Missachtung –«
»Ja, ja«, unterbrach Innozenz. »Wir haben die Eingabe von Ancona gesehen und zur Kenntnis genommen. Wir werden«, sagte er und nickte seinem Ersten Sekretär zu, der seinerseits den Schreiber ansah, welcher augenblicklich die Feder in das Tintenfass tunkte, »einen Brief an Seine Majestät Don Pedro von Aragon aufsetzen und die Herausgabe der Schiffe verlangen.«
»Und die Schiffsladungen?«, fragte der Botschafter.
»Und die Schiffsladungen. Und was sie sonst noch an sich gebracht haben«, ergänzte der Papst ungeduldig.
Sein Sekretär raunte ihm etwas ins Ohr.
»Die Piraten sollen für ihre Untaten hängen, andernfalls droht dem König die Exkommunikation. Den genauen Wortlaut werden wir bei einer späteren Gelegenheit besprechen.«
Der schneidende Wind, der um die dicken Mauern des Palastes wehte, tat sein Bestes, um den Frühlingsanfang Lügen zu strafen. Er wirbelte durch den großen Hof, fuhr unter den Arkaden hindurch und lüftete schamlos die Gewänder jener weniger privilegierten Bittsteller, welche draußen unter den frostigen Blicken der Leibgarde warteten. Ein Mann in pelzbesetztem Umhang kam durch das Hauptportal hereingeritten, stieg unter den Arkaden vom Pferd und warf die Zügel seines glänzenden Rosses einem Lakaien zu, der aus dem Nichts aufgetaucht war. Dann eilte er die breite Treppe hinauf, während die Wartenden ihm mit scheelen Blicken nachsahen.
»Er geht in die privaten Gemächer«, sagte ein rundlicher, bleicher Mann, der das graue Habit eines Franziskanermönchs trug.
»Das bezweifle ich, Vater Norbert«, entgegnete ein Priester in Schwarz, der an seiner Seite stand.
»Man sagt, sie seien voller Schätze«, fuhr Norbert fort. »Gold, Rubine, Seidengewänder.«
»Was taugen schon Seidengewänder, wenn der Nordwind bläst?«, sagte der Priester. »Ich würde sie im Augenblick allesamt gegen den pelzgefütterten Umhang unseres jungen, betuchten Reiters hier eintauschen.« Er rieb sich die kalten Hände. »Aber was führt Euch eigentlich hierher, Vater?«, fragte er, als sei ihm plötzlich seine brüske und unfreundliche Art bewusst geworden.
Der Mönch lief rot an und trat einen Schritt zurück, als hätte ihn unvermittelt ein harter Schlag getroffen.
»Nichts Besonderes eigentlich, Vater.« Er verhaspelte sich und brach in Schweiß aus. »Eine unbedeutende Kleinigkeit.«
Unweit von ihnen wartete Rodrigue de Lancia mit einem älteren, stämmigen Herrn im bescheidenen Schutz einer Säule. Der Ältere starrte zu dem Mönch herüber, was zur Folge hatte, dass der Unglückliche noch tiefer errötete und seine Aufmerksamkeit den prächtigen Steinfliesen unter seinen Füßen zuwandte.
Rodrigue sah seinen Begleiter fragend an.
»Priester und Elstern«, sagte der ältere Mann. »Niemals schweigen sie, und niemals hört man ihr Gequake gern.« Ungeduldig trat er auf der Stelle. »Ich frage mich, wie lange wir hier wohl noch warten müssen. Dies ist wahrlich kein erfreulicher Tag.«
»Ich hoffe, nicht mehr lange, Don Gonsalvo«, antwortete Rodrigue.
»Euer trefflicher Page hat mir versichert, dass der Fall noch heute Morgen entschieden wird«, sagte Gonsalvo. »Und ich bin äußerst dankbar für ihn. Ohne Euren Rat hätte ich nicht gewusst, wohin ich mich hätte wenden sollen.«
»Nicht der Rede wert«, erwiderte Rodrigue höflich.
»Ganz im Gegenteil«, protestierte Gonsalvo eifrig. »Es war eine ganz außergewöhnliche Freundlichkeit Eurerseits, Don Rodrigue, und ein Glücksfall für mich, so fern von der Heimat auf einen Landsmann zu treffen. Noch dazu auf einen, der mit den Gepflogenheiten am päpstlichen Hof weitaus vertrauter ist als ich.«
»Bitte, Don Gonsalvo, sprecht nicht mehr davon. Es ist wirklich nicht der Rede wert«, entgegnete Rodrigue leicht gereizt. »Ich habe Euren Namen einem Knaben anvertraut, der für seinen äußerst dürftigen Dienst nun uns beide schröpft. Ich hätte das für jeden anderen auch getan.«
Als wären seine Worte ein Stichwort gewesen, schwang die Tür auf, und der Page trat heraus, umgeben von einem Dutzend Männer, die sich lautstark unterhielten. Er nickte Gonsalvo zu und schob sich unauffällig an den Rand der Gruppe. Als alle durch das Tor getreten waren, hatte der Page Rodrigue erreicht und ging nun an seiner Seite.
»Und?«, fragte Rodrigue. »Was hast du uns mitzuteilen?«
Der Page bedeckte seine schwarzen Locken mit einer Kappe und lächelte verschwörerisch. »Der Küchenjunge von unten hat mir gesagt, dass Seine Heiligkeit die Privatgemächer mit Wandgemälden von schönen nackten Weibern und wunderbaren Szenen größter Verderbtheit hat bemalen lassen. Doch ich bin nicht sicher, ob ich ihm das glauben soll. Er ist selbst nie in den päpstlichen Privatgemächern gewesen, sagt jedoch, er habe es von –«
»Worüber haben sie drinnen gesprochen?«, zischte Rodrigue. »Antworte, bevor ich dir deine lästerliche Zunge aus dem Mund schneide!«
Der Page schüttelte den Kopf. Ergeben und schweigend folgten sie ihm hinaus auf die Straße und tauchten in die Menge lärmender Käufer und Händler ein, die einander schubsten, schrien, feilschten und sich gegenseitig ihre Waren entgegenstreckten. Er zog sie durch eine Tür ins Hinterzimmer einer düsteren Schänke in einen Winkel, so weit vom schwelenden Kaminfeuer und den anderen Gästen entfernt wie nur möglich. Hier schien es so still wie in einem verlassenen Wald nach der Schlacht. »Bestellt etwas«, sagte er.
Gonsalvo bestellte einen Krug Wein. Schweigend streckte der Page die Hand aus. Der beleibte Ältere nahm eine Münze aus seinem Geldbeutel und warf sie auf den Tisch. Rodrigue legte noch eine weitere darauf. »Den Rest, wenn du geredet hast«, sagte Gonsalvo. »Ich möchte nur sichergehen, dass du auch wirklich etwas zu erzählen hast.«
»Ich weiß nur wenig außer dem einen oder anderen bisschen Klatsch, das ich hier und dort aufschnappe«, entgegnete der Page mit gespielter Demut.
Während die Wirtsfrau den Krug und drei Becher vor ihnen auf den Tisch stellte und auf ihre Bezahlung wartete, senkte sich Schweigen über die Gruppe.
»Aber ich will Euch sagen, was ich weiß«, fuhr der Page fort, sobald die Frau wieder außer Hörweite war. »Mein edler Herr, der Botschafter Tomas de Patrinhanis, hatte eine Privataudienz bei Seiner Heiligkeit. Er hat den Papst gebeten, im Namen des überaus treuen und christlichen Volks von Ancona gegen Don Pedro von Aragon vorzugehen, um zu gewährleisten, dass dieser Verdammte und seine Schergen –«
»Wir wissen, was er will«, fiel Rodrigue ihm ins Wort. »Was hat Seine Heiligkeit geantwortet?«
»Er hat ihm versichert, dass ein Brief aufgesetzt würde – ein unmissverständlicher Brief –, der die Rückgabe der geraubten Schiffe und Waren von Meister Nicolas Polluti verlangt. Mein Herr hat den Sekretär Seiner Heiligkeit gefragt, unter welchen Bedingungen diese Rückgabe erfolgen solle. Der Sekretär hat versichert, dass Seine Heiligkeit die schwersten Strafen für die Piraten forderte und dass diese Verfügung Don Pedro von Aragon unter Androhung der Exkommunikation erteilt werde.«
»Von wem hast du das? Oder warst du bei der Audienz anwesend?«
»Von niemandem. Und ich war auch nicht anwesend.«
»Wie können wir dann wissen –«
»Ich habe vor der Tür gesessen und wollte warten, bis mein Herr die Audienz bei Seiner Heiligkeit beendet hatte. Durch einen sonderbaren Zufall«, sagte er mit todernster Miene, »stand die Tür einen Spalt offen. Ich konnte alles ziemlich deutlich verstehen.«
»Wann soll dieser Brief geschrieben werden?«, fragte Rodrigue.
Der Page zuckte mit den Achseln. »Wenn Gott will, nehme ich an. Seine Heiligkeit hat keinen Termin genannt.«
»Gut. Der Brief wird bestimmt nicht mehr heute Abend verfasst, um dann gleich morgen in aller Eile fortgeschickt zu werden«, sagte Rodrigue nachdenklich.
»Ich habe gehört, wie einer der Sekretäre sagte, es sei noch dieses und jenes zu klären, bevor man sich auf den genauen Wortlaut festlegen könne«, sagte der Page.
»Was hat er denn damit gemeint?«, schaltete sich Gonsalvo ins Gespräch.
Rodrigue zuckte mit den Achseln. »Ich nehme einmal an, Seine Heiligkeit muss sich erst noch entscheiden, wie stark er Seine Majestät vor den Kopf stoßen möchte, um der Stadt Ancona zu ihrem Recht zu verhelfen.«
»Das Königreich von Aragon ist größer als die Stadt Ancona«, erwiderte Gonsalvo. »Schließlich ist es ja nicht Innozenz’ werte Mutter, die sich für den Stadtstaat stark macht. Vielmehr steht hier ein Botschafter gegen eine Horde von Piraten.«
»Seht Euch vor, Herr. Ihr sprecht von meinem ehrenwerten Vetter, einem ergebenen Kapitän in Don Pedros Flotte.«
»Und einem Piraten. Ihr gebt es ja selbst zu.«
»Ihm droht der Verlust all seines Besitzes. Möglicherweise sogar der schmachvolle Tod am Galgen, falls Don Pedro sich dem päpstlichen Erlass beugt.«
»Genug davon. Was ist mit meinem Fall?«, fragte Gonsalvo und packte den dünnen Arm des Pagen, noch bevor dieser entwischen konnte. »Wann wird der angehört?«
»Euer Fall? Ach der, ja«, sagte der Page. »Die Richter haben einen der Zeugen angehört und gesagt, es lägen ihnen mehrere eidesstattliche Aussagen vor; im Übrigen hätten sie weder die Zeit, noch bestehe die Notwendigkeit für weitere Anhörungen. Der Beschluss wird zur gegebenen Zeit an die Diözese von Barcelona gesandt. Und an den Erzbischof von Tarragona, wenn ich recht gehört habe.«
»Keine Zeit?«, fragte Gonsalvo entrüstet. »Du sagst, sie hatten keine Zeit, sich meinen Fall anzuhören? Das waren meine Zeugen! Es hat mich viel Gold gekostet, sie hierher zu bringen. Welcher von ihnen hat ausgesagt?«
»Ein Mönch, Signore«, antwortete der Page. »Ein gewisser Norbert. Ein ziemlich klägliches Bild hat er abgegeben. Aber er wird Euch ohne Zweifel selbst berichten, was vorgefallen ist. Und jetzt bitte ich untertänigst um Entschuldigung, meine Herren«, sagte er. »Jedenfalls sind Euer beider Anliegen mehr oder weniger zu Gehör gebracht worden. Ich war dort und habe Euch hiermit Bericht erstattet. Doch jetzt wird mein Herr nach mir Ausschau halten. Ich habe mein Versprechen eingelöst, Ihr Eures jedoch noch nicht.«
Der Dicke hob eine Hand und versetzte dem Pagen eine Kopfnuss.
»Nicht doch, Gonsalvo«, protestierte der andere. »Bezahlt den Burschen. Er hat Euch gute Dienste geleistet.«
Vier weitere Münzen fielen klimpernd in die ausgestreckte Hand des Pagen.
»Und sollte dir noch weiterer Klatsch zu Ohren kommen –«, sagte Rodrigue, »seitens deines Herrn, der Dienerschaft oder der Schreiber, besonders auch, was die Zeit und den genauen Inhalt der Briefe betrifft –, dann sollst du noch mehr Lohn dafür bekommen.«
»Das Doppelte?«, fragte der Page.
»Das Doppelte.«
Kapitel 3
Girona
Donnerstag, 10. April
In der Werft von Girona unten am Fluss Ter legte Romeu, der Tischler, seinen Polierstein ab und fuhr mit der Hand über das Holzstück, an dem er gearbeitet hatte. Es war abgerundet, beinahe halbmondförmig und fasste sich geschmeidig an. Dann setzte er es am Bug einer breiten Galeone an und fügte es mit einem Klaps an der vorgesehenen Stelle ein.
Er war rundum zufrieden mit seinem Leben. Die Tischlermeister arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, und der Lohn für sie und ihre Gesellen war, selbst unter der mittlerweile geltenden Festsetzung der Preise, ausgezeichnet. Noch zwei Tage Arbeit, dann würde auch dieser Schiffsrumpf fertig sein und konnte zum Schutz mit Fellen beschlagen werden. Die Aufbauten würden ihn dann noch einige Wochen lang mit Arbeit versorgen.
Das Königreich rüstete sich für den Krieg gegen Sardinien, und ein Teil der königlichen Schiffe wurde in Girona überholt. Don Pedro beabsichtigte, mit der gesamten Kriegsflotte gegen die aufständische Insel vorzugehen, um die Angelegenheit zu bereinigen, doch waren in den Seegefechten mit den Genuesen im Vorjahr viele seiner Schiffe durch Witterung und feindliche Angriffe in Mitleidenschaft gezogen worden, und überdies blieb nicht viel Zeit für die notwendigen Instandsetzungen.
An diesem Morgen hatte man die nachlässigen, schlecht ausgebildeten und faulen Arbeiter gehen lassen, obwohl Schiffsbauer rar waren; von den Verbleibenden hatte der Meister die erfahrensten und arbeitsamsten rekrutiert, um die Arbeiten voranzutreiben, bis die Schiffe flussabwärts auslaufen und zum Rest der Flotte in Rosas stoßen konnten. Krieg mochte für einige ein schreckliches Ereignis sein, dachte Romeu vergnügt, doch für Männer, die Schiffe bauen und instand setzen konnten, war er ein Segen.
Gerade hatte er ein weiteres Stück Holz ausgesucht, als er bemerkte, dass die Dämmerung anbrach. Er kennzeichnete das Holzstück als seines und versteckte es, bevor er sein Werkzeug einpackte und den anderen einen schönen Feierabend wünschte.
»Komm doch noch auf einen Becher Wein mit uns, Romeu«, lud einer ihn ein.
»Meine Frau erwartet mich zu Hause«, entgegnete er. »Und ich habe mindestens so viel Hunger wie Durst.«
»Einen Becher nur, auf unser Glück, und dann gehen wir alle zum Abendbrot heim.«
Die Schänke, die der Werft am nächsten lag, war klein und bescheiden. Als Romeu und seine Gefährten eintraten, war sie bereits voll von Männern, die dort schon seit einer Weile die unangenehme Nachricht verdauten, dass für sie die Arbeit beendet war. Eine abrupte Stille entstand im Schankraum, als die Neuankömmlinge eintraten. Sie nickten ihren ehemaligen Arbeitsgenossen zu und nahmen auf einer Bank in der äußersten Ecke Platz.
»Sieh es doch mal so.« Der Sprecher wandte sich an einen kleinen, drahtigen Mann. »Wir haben doch Karwoche, nicht wahr? Dir bleibt also noch Zeit, deine Seele auf Ostern vorzubereiten. Ich habe nämlich nicht gerade den Eindruck, dass du bislang sonderlich gefastet hättest.«
»Du wirfst mir vor, ich würde nicht fasten? Hier? Seit Wochen lebe ich von nichts anderem als von Mutter Benedictas saurem Wein und ihrer dünnen Suppe.«
»Das Zeug hier zu schlürfen ist die reinste Buße«, brummte ein anderer.
»Allein dieser eine Schluck hat mir wenigstens fünfhundert Jahre Fegefeuer erspart«, erwiderte der kleine, drahtige Mann und leerte seinen Becher.
»Jetzt, wo uns die Arbeit ausgeht, werden wir noch reichlich Gelegenheit zum Fasten haben«, bemerkte ein Untersetzter, ein kahlköpfiger und rotgesichtiger Mann. »Alle stöhnen immer, es gäbe keine Arbeiter. Aber holen sie dich, wenn du Arbeit brauchst? Nein! Da wären wir mal wieder – auf der Straße. Zu Hause hungern unsere Kinder, und unsere Frauen jammern in einem fort. Da muss etwas getan werden.«
»Wenn du mehr von dem guten Holz für den Bau des Schiffsrumpfes verwendet hättest, anstatt es zu verschneiden«, merkte ein schmächtiger, gepflegt aussehender Mann an, »so hätten sie dich vielleicht weiter beschäftigt.«
»Ach! Und was ist mit dir?«, fragte der Untersetzte.
»Ich mach zwar nicht viel, das weiß jeder, aber was ich mache, ist gut«, erwiderte der Dünne mit einem trägen Grinsen. »Ich freue mich über das Geld, solange es reinkommt, aber ich bin nie sonderlich überrascht, wenn sie mich entlassen.«
Der Untersetzte erhob sich und stand schwankend da, indem er sich mit den Oberschenkeln Hilfe suchend gegen die Tischkante lehnte. »Willst du sagen, ich verstehe nichts von meinem Handwerk?«
»Ganz genau«, bestätigte der Dünne gähnend. »Du verstehst nichts von deinem Handwerk.«
Der Untersetzte langte über den Tisch, ergriff seinen früheren Arbeitsgenossen beim Gewand und zerrte ihn auf die Füße. Der schmale Tisch kippte um, und viel Wein wurde verschüttet. Der Dünne schob die Sitzbank hinter sich mit einem Fußtritt ein Stück zurück, senkte den Kopf und rammte ihn seinem einstigen Freund in den Magen. Der Untersetzte klappte zusammen, ging zu Boden und riss dabei drei Männer mit sich, die auf seiner Seite des Tisches gesessen hatten. »Und prügeln kannst du dich auch nicht«, ergänzte der Dünne.
Im Hintergrund stieß Mutter Benedicta einen empörten Schrei aus und rang verzweifelt die Hände. Da niemand auf sie achtete, schob sie ihren massigen Körper zu den aufgeschichteten Weinfässern und holte dahinter eine große Holzkeule hervor. »Raus!«, brüllte sie. »In meiner Schänke wird nicht geprügelt. Raus, bevor ich euch die Köpfe einschlage!« Dabei hob sie die schwere Keule in die Luft, als handele es sich um einen Holzlöffel, und schwang sie drohend.
»Du verärgerst Mutter Benedicta«, sagte ein angetrunkener Gast und erhob sich. »Raus mit dir, Freundchen. Du willst ein gutes Werk verrichten? Komm, wir gehen in die Call und taufen ein paar Juden.«
Unter lautem Gelächter taumelten sie hinaus auf die Straße.
Romeu sah seine Gefährten an und schüttelte den Kopf. »Ich gehe«, sagte er und schob seinen erst zur Hälfte geleerten Becher von sich.
»Den Burschen hinterher?«
»Das wohl kaum«, entgegnete er nüchtern. »Das fuhrt doch eh zu nichts Gutem.«
Er trat in den kühlen Frühlingsabend hinaus, aber anstatt geradewegs zu seinem kleinen, sauberen Häuschen in Sant Feliu zu gehen, schlug er den Weg in die Stadt ein, den steilen Hügel zum Bischofspalast hinauf.
Es stand außer Frage, dass der junge Salomó des Mestre sich an diesem Abend nicht außerhalb der Call hätte aufhalten sollen. Jedes christliche Fest barg die Möglichkeit von gewalttätigen Ausschreitungen in sich, aber die Karwoche und Ostern waren immer am schlimmsten. Alle Türen und Fenster in den Mauern mussten verschlossen gehalten werden, verriegelt und verschanzt – einschließlich des hinteren Tores, das von einem ständigen Torhüter bewacht wurde.
Doch Salomó war verliebt. An diesem Morgen hatte er beschlossen, seiner Angebeteten ein Geschenk zu kaufen, sobald er seinen Pflichten als Hauslehrer von Yusuf, dem Lehrling des Arztes, Genüge getan hatte. Er wusste, dass in der Stadt ein Händler verlockende, neue Seidenbänder in seinen Auslagen hatte; einige davon waren schön breit und von einem tiefen Rot, das in ihrem Haar bezaubernd aussehen würde. Und so sagte er sich, dass er längst wieder zurück sein würde, bevor die Stadt aus ihrer nachmittäglichen Ruhe erwachte.
Er hatte nicht mit der Verunsicherung des Händlers gerechnet. Als er ankam, fand er die Bänder verpackt und den Stand geschlossen vor. Salomó benötigte eine beträchtliche Weile, um den Händler davon zu überzeugen, dass es die Mühe durchaus lohnen würde, die bezaubernden Bänder herauszuholen und zu einer Einigung über den Kaufpreis zu gelangen.
Triumphierend verließ er den Stand mit einem Packen von Bändern, die er sicher in seinem Gewand verstaut hatte. Als er um die erste Ecke bog, blieb er abrupt stehen. Sein Weg war von sechs oder sieben Werftarbeitern blockiert, die lachten und in verschiedensten Stadien der Trunkenheit umher torkelten.
»Ein Jude!«, rief einer.
»Schnappen wir ihn!«
»Bringen wir ihn zum Fluss runter und taufen ihn«, schlug ein anderer vor.
»In den Fluss mit ihm!«
Salomó war weder ein Schwächling noch ein Feigling, doch es unbewaffnet mit sieben Männern aufzunehmen wäre nun wirklich töricht gewesen. Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte los.
Salomó war schnell jung und vollständig nüchtern. Seine Verfolger waren durch ihren übermäßigen Weinkonsum und eine gewisse Ziellosigkeit stark beeinträchtigt, und so hatte er sie schon weit hinter sich zurückgelassen, als er um eine weitere Ecke bog und in einen Berg kaputter Körbe stolperte.
Auch Romeu kam schnell voran. Er erreichte das Quartier der bischöflichen Leibgarde just in dem Moment, als die Werftarbeiter sich auf ihren unsicheren Marsch an den Toren vorbei durch die Stadt machten. Als eine Patrouille schließlich auf die betrunkene Horde traf, schleppte diese gerade den zappelnden Salomó des Mestre auf die Brücke über dem Fluss Onyar. Beim Anblick der Garde ließ der Nüchternste der Arbeiter von dem Gefangenen ab und stürmte davon; die übrigen drei Männer waren zu benebelt und unsicher auf den Beinen, um überhaupt an Flucht zu denken. Sie wurden festgenommen. Salomó, der zerschlagen und voller Scham, aber weitgehend unverletzt war – auch seine Geldbörse und das Paket mit den Bändern waren unangetastet geblieben –, wurde zum hinteren Stadttor des jüdischen Viertels geleitet.
»Wo waren die Wächter?«, fragte Berenguer, der Bischof von Girona, als ihm der Vorfall berichtet wurde.
»Sie waren vor den Toren zur Call mit Würfeln und einem Schlauch Wein beschäftigt«, erklärte der Hauptmann. »Unsere Wache – eine Patrouille – befand sich in einem anderen Teil der Stadt. Wir benötigen eindeutig mehr Patrouillen. Ich werde sie verdoppeln.«
Freitag, 18. April
»Teurer Herr«, rief ein wohlhabend aussehender Getreidehändler seinem Freund zu, der mit Wolle und Fellen handelte. »Gerade komme ich von meinen Reisen zurück. Was gibt es Neues?«
»Wenig, das nicht aus Barcelona kommt«, sagte der Wollhändler. »Die Werft kann sich vor Aufträgen kaum retten, und die Stimmung in der Stadt ist dementsprechend gut. Ich nehme an, Eure Geschäfte sind gut gelaufen?«
»Gut genug jedenfalls. Zwischen all den Engpässen, Überschüssen und Preiskontrollen durch die Obrigkeit ist es gar nicht so leicht, im Getreidehandel sein Auskommen zu finden«, erwiderte er. »Plant der Bischof noch immer, nach Tarragona zu reisen? Vor meiner Abreise war es noch fraglich, ob er wirklich reisen wollte.«
»Ja, das tut er leider.«
»Wann reist er ab?«
»Am Dienstag bei Tagesanbruch, wie ich gehört habe«, antwortete der Wollhändler. »Und er nimmt seinen Leibarzt, Meister Isaac, mit. Das gefällt mir gar nicht.«
»Wieso denn?«
»Weil Meister Isaac auch mein Arzt ist. Und die Straße nach Tarragona ist lang und der Weg bergig. So eine Reise macht man nicht an einem Tag. Wir werden ihn für einen Monat oder länger nicht zu Gesicht bekommen. Da kann viel passieren.«
»Vielleicht lässt er ja seine schöne Tochter zurück; dann kann die sich ja um uns kümmern«, bemerkte der Getreidehändler mit einem anzüglichen Grinsen.
Doch der Wollhändler war nicht zu frivolen Scherzen aufgelegt. »Er nimmt Frau und Tochter mit«, entgegnete er steif, »wie auch seinen Lehrling. Wir werden hoffen müssen, dass wir bis zu seiner Rückkehr wohlauf bleiben.«
»Und wer kümmert sich währenddessen um die Belange der Diözese? Monterranes?«
»Nein. Don Arnau de Corniliano.«
»Unmöglich«, entgegnete der Getreidehändler mit einer Mischung aus Verärgerung und Ungläubigkeit. »Das kann ich nicht glauben.«
»Warum sagt Ihr das? Es mag ja merkwürdig sein, aber doch nicht unmöglich.«
»Er verabscheut Seine Exzellenz. Und er selbst ist so hinfällig, dass es mich erstaunt, wie ihn überhaupt jemand in Betracht ziehen kann.«
»Das habe ich Vater Bernat gegenüber auch schon erwähnt«, sagte der Wollhändler. »Und der gute Mönch meinte daraufhin, Don Arnau brauche doch nur Dokumente zu unterzeichnen und nicht die Kathedrale fertig zu bauen, und dazu reiche seine Kraft noch aus.«
»Aber warum ernennt er seinen ärgsten Feind zum Stellvertreter?«
»Warum nicht? Er wird immerhin zu beschäftigt sein, um dem Bischof zu schaden. Und Seine Exzellenz ist mittlerweile in noch größerer Bedrängnis, als er es zum Zeitpunkt Eurer Abreise gewesen war. So geht jedenfalls das Gerücht.«
»Das höre ich gar nicht gern, mein Freund. Zu Don Arnaus Unberechenbarkeit kommt noch hinzu, dass er erst hundertmal hin und her überlegen muss, bevor er sich auch nur entschließen kann, sein Frühstück einzunehmen. Ich habe allerhand vor dem bischöflichen Gericht zu klären –, das könnte mich ein hübsches Sümmchen kosten.«
»Wir alle müssen leiden, mein Freund. Ich verliere meinen Arzt, und Ihr müsst auf Euer Urteil warten.«
Und die beiden Männer schlenderten mit der Seelenruhe der Besitzenden in der warmen Frühlingssonne über den Platz und steuerten vergnügt der Gewissheit eines ausgezeichneten Abendessens entgegen, ohne auch nur einen Augenblick ihr Klagen zu unterbrechen.
Hoch über dem Fluss Galligants und dem Vorort Sant Feliu ragt die nördliche Stadtmauer von Giro na empor. Die Kathedrale Santa Maria hätte diesen Schutz gar nicht nötig: Sie erhebt sich auf ihren Fundamenten noch höher hinauf. Direkt vor der Stadt steht einsam die Kirche von Sant Feliu, und ungeachtet der überwältigenden Präsenz der Kathedrale streckt sie trotzig ihren spitzen Turm in den Himmel. Nicht weit in nordöstlicher Richtung schließlich ruht schwer und doch elegant die Benediktinerabtei von Sant Pere de Galligants.
Die drei Türme schlummerten in der nachmittäglichen Stille. Innerhalb des Dreiecks jedoch, das sie bildeten, schritt der Abt von Sant Feliu, ein von Natur aus ungeduldiger, ehrgeiziger und ruheloser Mann, über den Platz vor Sant Pere hin und her und nahm weder die friedliche Schönheit noch die Wucht der steinernen Bauten um sich herum wahr. Hätte man ihn seiner Kutte entledigt und von seiner Tonsur befreit, ihn stattdessen in ein maßgeschneidertes Gewand gesteckt und sein braunes, glänzendes Haar zu einer weltlich-modernen Frisur gekämmt, so hätte Don Vidal de Blanes durchaus ein würdiger Vertreter des Hofstaats sein können. Auf einem guten Pferd und mit dem Schwert in der Hand hätte er ein Regiment fronterfahrener Truppen anfuhren können. Doch trotz seiner adligen Abkunft und seiner kriegerischen Natur war Don Vidal für das geistliche Amt bestimmt und hatte sich nun gänzlich dem Klosterleben verschrieben. Er war mit Leib und Seele ein unnachgiebiger und kämpferischer Kirchenmann. Und seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen drang seine angeborene Kampfeslust in diesem Moment an die Oberfläche. Don Vidal war nicht erfreut.
»Er verdient den Bischofstitel nicht. Der Mann ist eine Schande. Für die Stadt, die Diözese, ja für die Heilige Mutter Kirche selbst«, sagte ein Mönch in grauer Kutte, der lammfromm bei den Stufen stand, die zur Kirche hinaufführten. Er sah zum Abt hinüber, um dessen Reaktion auf das eben Gesagte abzuschätzen, und senkte sogleich wieder den Blick.
Don Vidal blieb stehen. »Nein«, sagte er schließlich. »Ihr seid nicht der Erste, der mir mit solchen Geschichten kommt, doch hilft es der Mutter Kirche nicht, wenn der ohnehin schon unglücklichen Lage weitere Lügen und Falschaussagen hinzugefügt werden. Die Abtissin hat töricht gehandelt, aber ich glaube nicht, dass sie ihre Gelübde vergessen hat. Der Bischof ist hitzig und unbesonnen, zuweilen auch nachlässig, ein böser Mann ist er deswegen noch lange nicht. Und er hat auch keine Schande über die Kirche gebracht.«
Er runzelte die Stirn und wandte sich von dem Mönch ab. Ein Hund trottete auf die Brücke zu, ohne sich um seine Umgebung zu kümmern. Nicht weit entfernt begann ein Arbeiter ziemlich schwermütig zu pfeifen. Plötzlich eilte der Abt über den Vorplatz hinweg auf einen kleinen Friedhof zu. »Wir werden zu Fuß gehen«, rief er dem Mönch zu. »Erstattet mir Euren Bericht noch ein zweites Mal, Vater, aber bedenkt Eure Worte gut und verzichtet diesmal auf jegliche Bösartigkeit.« Diese letzten Worte hätte der Mönch beinahe überhört, so sehr schnaufte er bei dem Versuch, mit dem Mann vor ihm Schritt zu halten.
Bischof Berenguer nahm den Schädel in die Hand, den er von seinem Amtsvorgänger geerbt hatte, und blickte in die leeren Augenhöhlen. »Seid versichert, Bernat«, wandte er sich an seinen Sekretär, »dass ich die Lage begreife. Ich habe die Gerüchte vernommen, und so abenteuerlich sie sind, weiß ich dennoch, dass sie mir Arger bringen können. Und auch der Abtissin werden sie nicht helfen. Allerdings kann ich nicht glauben, dass Don Vidal sie in Umlauf setzt.« Er schüttelte den Kopf.
»Nein«, erwiderte Bernat sa Frigola. »Ich bezweifle auch, dass sie von Don Vidal kommen. Aber jetzt, da er eine mächtige Stellung bekleidet, bestürmen ihn all jene, die sich lieb Kind bei ihm machen wollen, mit ebendiesen Geschichten. Und er ist aufrichtig empört darüber, dass Ihr – so sieht er es zumindest – nichts unternommen habt, um die Abtissin Elicsenda dazu zu bewegen, Sor Agnete den Gerichten zu übergeben. Wie Ihr wisst, hat er sowohl Seiner Majestät als auch dem Erzbischof von der Angelegenheit geschrieben.«
»Ich habe der Abtissin von Sant Daniel gesagt, was sie zu tun hat. Sie bereitet die Auslieferung von Sor Agnete an das Mutterhaus in Tarragona vor. Diese Dinge benötigen nun einmal Zeit.«
»Zehn Monate?«, warf Francesc de Monterranes, einer seiner engsten Berater, ein. »Darf ich Euer Exzellenz daran erinnern, dass Seine Majestät ernstlich verstimmt ist? Ich vermute, der König hat Don Vidal zu seinem Katalonien-Beauftragten ernannt, um Euch Seinen Unmut ins Gedächtnis zu rufen.«
»Das glaubt Ihr, Francesc?«, fragte Berenguer. »Nun, ich muss gestehen, mir ist der Gedanke auch schon gekommen, doch nahm ich letztlich an, Seine Majestät habe diese Wahl aufgrund von Don Vidals verwalterischen Fähigkeiten getroffen.«
»Natürlich«, erwiderte Francesc beschwichtigend. »Aber es gibt andere in der Provinz, die dieselben verwalterischen Fähigkeiten aufweisen.«
»Ich denke«, sagte Bernat, »Ihr solltet erwägen, auf Eurem Weg nach Tarragona in Barcelona Halt zu machen, um mit Seiner Majestät zu sprechen. Bekräftigt Eure Loyalität und Eure Entschlossenheit, die Nonne ihrer gerechten Strafe zuzuführen.«
»Unsinn«, entgegnete Berenguer. »Das würde die Reise um mindestens zwei Tage verlängern.« Er erhob sich. »Es ist an der Zeit, dass ich ein freundliches Wort mit unserem guten Abt spreche.«
»Seid Ihr sicher, dass das eine kluge Entscheidung ist, Exzellenz?«, fragte Bernat.
»Allerdings. Mein Arzt hat gesagt, dass ich mäßige körperliche Ertüchtigung nötig habe. Ich werde zu Fuß nach Sant Feliu gehen. Ihr könnt mich ja begleiten, wenn Ihr wollt.«
»Werter Berenguer«, rief der Abt herzlich.
»Don Vidal«, entgegnete der Bischof. »Ich hoffe, ich finde Euch wohlauf.«
»Das tut Ihr.«
»Ich bin gekommen, um Euren Rat in einer recht wichtigen Angelegenheit einzuholen«, erklärte der Bischof gelassen. Sein Sekretär unterdrückte den Impuls, seinen geistlichen Herrn zu packen und mit Gewalt aus dem Zimmer zu zerren, bevor dieser noch etwas wirklich Ungeschicktes sagte. »Wegen der in der Karwoche angefallenen Kosten wünscht der Stadtrat die Zahl der Wachen, die das jüdische Viertel schützen, herabzusetzen und die Schutzzölle zu verdoppeln. Wie Ihr wisst, bedeutet das, dass sowohl die Juden des Königs als auch die des Bistums erheblich mehr Geld an die Stadt abfuhren müssen und zudem einem größeren Risiko ausgesetzt sein werden, falls es zu Übergriffen kommt. Zwar ist mir bewusst, dass Ihr Euren Posten als Beauftragter Seiner Majestät noch nicht angetreten habt, jedoch –«
»Ich verstehe Euch. Ich bin ja hier und in gewissem Sinne verantwortlich. Habt Ihr mit den Ratsherren gesprochen?«
»Das habe ich, und zwar äußerst nachdrücklich.«
»Als ihr geistlicher Herr. Dann werde ich mit ihnen als Vertreter ihres weltlichen Herrn sprechen. Es handelt sich hier um einen böswilligen Versuch, Steuern zuungunsten der Diözese und der Krone abzuzweigen. Und zwar in direktem Widerspruch zu Recht und Gepflogenheiten, werter Berenguer.«
»In der Tat, Don Vidal.«
»Besonders jetzt, da Seine Majestät Geld zur Instandsetzung der Flotte mobilisiert – und zwar zum äußersten Wohl der Stadt, wie ich hinzufügen darf. Die Wachen aber, die sie gestellt haben, sind nutzlos, um das Mindeste zu sagen. Könnt Ihr garantieren, zusätzliche Männer zur Verfügung zu stellen …«
Und so steckten die beiden mächtigen Männer ihre Häupter über Plänen zur langfristigen Sicherung der Stadt zusammen.
Kapitel 4
Auf der Via Augusta,
außerhalb von Figueres
Montag, 21. April
Die Herberge, die sowohl von Figueres als auch von Girona ziemlich weit entfernt am Rand der Straße stand, war beileibe kein Palast. Sie war klein, schmutzig und laut, jedoch billiger als die meisten anderen. Die alte, von den Römern angelegte Straße, die in Östlicher Richtung durch die Berge nach Perpignan, Montpellier und Avignon führte, verlief direkt vor ihrer Tür. An diesem Montag war ihr Schankraum von ortsansässigen Bauern, Durchreisenden und verschiedensten anderen, weniger leicht zu identifizierenden Gästen angefüllt. Ein Musikant spielte ein lautes und lebhaftes Lied in der Hoffnung, der Menge die eine oder andere Münze, zumindest jedoch einen Becher Wein abzuluchsen. Die meisten Besucher aber schienen von dem Wunsch beseelt, so viel wie möglich vom Wein des Wirtes durch ihre eigenen Kehlen rinnen zu lassen, und schenkten dem Musikanten keinerlei Beachtung.
Am Ende eines der langen Stelltische saßen drei Reisende schweigend am Kaminfeuer – Rodrigue de Lancia, Bruder Norbert und ein eleganter junger Mann von höchstens zwanzig Jahren. Das sonst so rundliche Gesicht des Mönchs war schmaler und eingefallener als noch einen Monat zuvor in Avignon. Der junge Mann und Rodrigue sahen von ihrem aus Brot und Käse bestehenden Nachtmahl auf, als ein Neuankömmling mit drei ungeschlachten Kumpanen lärmend die Schänke betrat. Es war Gonsalvo. Don Rodrigue lächelte eisig.
»Don Rodrigue«, rief Gonsalvo und kam schnellen Schrittes zu ihnen hinüber. »Ich hörte, dass Ihr mir auf der Straße ein gutes Stück voraus wart, und gab meinem armen Gaul gnadenlos die Sporen, um Euch einzuholen. Frau Wirtin! Einen Becher Wein und etwas von dem vorzüglich aussehenden Käse!«
»Guten Abend, Don Gonsalvo. Ihr scheint gut gelaunt.«
»Ich habe auch allen Grund dazu«, erwiderte er. »Je näher ich der Heimat komme, desto besser wird meine Laune. Reitet Ihr zufällig nach Barcelona, Don Rodrigue?«
»Leider nein«, antwortete Rodrigue und sah dabei alles andere als betrübt aus. »Ich bin unterwegs zu meinem Vetter und verlasse Euch im Morgengrauen.«
»Und habt Ihr Neuigkeiten im Fall Eures Vetters?«, fragte der Neuankömmling so laut, dass auch alle anderen es hörten.
»Solange das Urteil nicht in den Händen Seiner Majestät liegt, kann man nichts sagen«, erwiderte Rodrigue förmlich.
»Das Ergebnis meines Falles wird ebenfalls in diesem Augenblick nach Barcelona gesandt«, flüsterte Gonsalvo vorgebeugt. »Jedes Mal, wenn ich ein Pferd vorbeigaloppieren sehe, frage ich mich, ob der Reiter das Urteil im Gepäck hat. Deswegen reise ich auch dorthin und nicht auf direktem Wege nach Hause.«
Rodrigue erwiderte nichts darauf.
Gonsalvo hob seinen Becher und prostete dem Mönch zu. »Auf Euch, Vater«, rief er fröhlich aus. »Zuletzt sind wir uns in Avignon begegnet, nicht wahr? Ein bitterkalter Wind blies, wenn ich mich recht erinnere. Da ist dieses hübsche Feuerchen hier weitaus freundlicher zu den Fingern, was?«
Der Mönch sah auf und nickte, betrachtete dann aber wieder das unangerührte Essen vor sich.
Gonsalvo wandte sich an den eleganten jungen Mann. »Und Ihr, Señor, seid Ihr auch ein Reisender? Habe ich Euch nicht auch in Avignon gesehen?«
»Ich war dort, ja. Vor knapp einem Jahr. Wenn Ihr damals in der Stadt wart, dann könnten wir einander tatsächlich über den Weg gelaufen sein. Die vergangenen Monate habe ich in Montpellier verbracht, Señor«, entgegnete er höflich, »um meinen Wissensvorrat zu vergrößern und meine Geldbörse zu erleichtern. Ich bin auf der Reise von Figueres nach Girona, um meinen Onkel zu besuchen.«
»Dann seid Ihr heute ja nicht weit gekommen«, bemerkte der untersetzte Mann. »Ihr wärt ein langsamer Reisegefährte, mein Herr«, fügte er mit einem behäbigen Lachen hinzu. »Bei diesem Tempo würde ich ein Jahr brauchen, um nach Hause zu gelangen.«
»Ich bin bei meinem Aufbruch erheblich aufgehalten worden, Señor, und da ich es vorziehe, nicht nachts zu reiten, stieß ich nun also zufällig auf Euch. Fortunat ist mein Name«, sagte er, wobei er sich leicht verbeugte und schief lächelte, als bereite ihm die Pose Spaß.
»Und ich bin Gonsalvo. Zweifellos habt Ihr bereits Don Rodrigue und den guten Vater Norbert kennen gelernt. Wir kommen ja alle drei aus Avignon.«