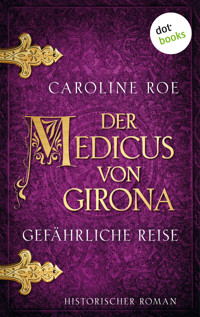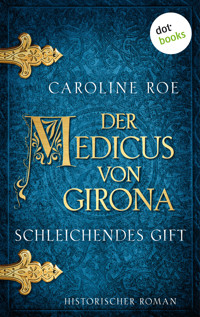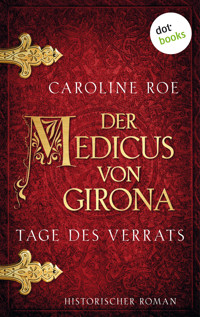
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Chroniken von Isaac von Girona
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ist der Thron in Gefahr? Der fesselnde historische Krimi »Der Medicus von Girona – Tage des Verrats« von Caroline Roe jetzt als eBook bei dotbooks. Der Tod geht um ... In Girona wütet im Jahre 1353 die Pest. Der blinde Medicus Isaac versorgt unermüdlich Kranke und rettet viele Leben – doch die Seuche ist nicht die einzige Gefahr, die Spanien bedroht: Als in den öffentlichen Bädern eine Frau unter rätselhaften Umständen stirbt, sind die Oberhäupter der Stadt alarmiert – denn es stellt sich heraus, dass die vermeintliche Nonne in Wahrheit die Erste Hofdame der Königin war! Wollte sie in der Verkleidung einem Verfolger entkommen? Weil Isaac als ebenso scharfsinnig wie verschwiegen gilt, wird er mit der Aufklärung ihres Todes betraut. Doch je näher der Medicus der Wahrheit kommt, desto mehr verstrickt er sich in einem Netz aus Intrigen, die darauf abzielen, die spanische Monarchie zu zerstören – und jeden, der sich ihr in den Weg stellt ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Medicus von Girona – Tage des Verrats« von Caroline Roe ist der erste Band ihrer mitreißenden Reihe historischer Krimis um den ermittelnden Medicus Isaac. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der Tod geht um ... In Girona wütet im Jahre 1353 die Pest. Der blinde Medicus Isaac versorgt unermüdlich Kranke und rettet viele Leben – doch die Seuche ist nicht die einzige Gefahr, die Spanien bedroht: Als in den öffentlichen Bädern eine Frau unter rätselhaften Umständen stirbt, sind die Oberhäupter der Stadt alarmiert – denn es stellt sich heraus, dass die vermeintliche Nonne in Wahrheit die Erste Hofdame der Königin war! Wollte sie in der Verkleidung einem Verfolger entkommen? Weil Isaac als ebenso scharfsinnig wie verschwiegen gilt, wird er mit der Aufklärung ihres Todes betraut. Doch je näher der Medicus der Wahrheit kommt, desto mehr verstrickt er sich in einem Netz aus Intrigen, die darauf abzielen, die spanische Monarchie zu zerstören – und jeden, der sich ihr in den Weg stellt ...
Über die Autorin:
Caroline Medora Sale Roe (1943–2021) lebte in Kanada. Sie war Doktorin der Mediävistik und als Lehrerin sowie als Übersetzerin tätig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Unter dem Pseudonym Medora Sale schrieb sie erfolgreich zeitgenössische, und unter Caroline Roe historische Kriminalromane. Sie war verheiratet und hatte mit ihm eine Tochter.
Caroline Roe veröffentlichte bei dotbooks bereits »Der Medicus von Girona – Tage des Verrats«, »Der Medicus von Girona – Schleichendes Gift« und »Der Medicus von Girona – Gefährliche Reise«.
***
eBook-Neuausgabe November 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Remedy for Treason – The Chronicle of Isaac of Girona« bei Berkeley Prime Crime, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Die neun Tage des Verrats« im Eugen Diederichs Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1998 by Caroline Roe
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Artyzam, LiliGraphic, Andrey Solovev, Prokrida
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-325-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Medicus von Girona 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Caroline Roe
Der Medicus von Girona – Tage des Verrats
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Marc Staudacher
dotbooks.
Prolog
Der Tod suchte Girona im Sommer des Jahres 1348 heim. Man erzählte – ohne allzusehr zu übertreiben –, daß während jener glühendheißen Monate ein Mann, der noch in der Frühe voller Lebenskraft und Tatendrang aufgestanden war, bereits bei Sonnenuntergang in seinem Grab liegen konnte. Vor dem Einfall der Pest hatte es in der Aljama, dem blühenden jüdischen Viertel der Stadt Girona, einhundertundfünfzig Haushalte gegeben, die zusammen etwa siebenhundertundfünfzig Seelen zählten. Als die Seuche schließlich wich, blieben einhundertunddreißig Überlebende zurück.
Die Pest – der Schwarze Tod – war allgegenwärtig: überall, wo Schiffe einliefen und Seeleute an Land gingen, und überall, wo Menschen von Stadt zu Stadt zogen. Sie wütete im gesamten Mittelmeergebiet, fraß eine Spur landeinwärts durch Italien und Frankreich und stürzte sich auf die Ostküste der spanischen Halbinsel. Ungeachtet aller Gebete und Zaubersprüche, allen Verbrennens von Kräutern und Weihrauch und aller Bußübungen fiel sie in das spanische Königreich von Aragon ein, verwüstete die Provinz Katalonien, attackierte Barcelona und sprang dann wie ein Löwe, der eine Gazelle reißt, auf Girona über. Die Stadt stank nach Tod und Verwesung. Die Luft war von den Klagen der Trauernden erfüllt. Der Tod achtete weder Rang noch Verdienst. Vor ihm waren alle gleich: der Landmann, der auf dem Feld zusammenbrach, der Bettler, der auf der Straße verendete, der Reiche, der in seidenen Betttüchern schlotterte.
König Pedro von Aragon beweinte den Tod seiner jungen Braut, die an der Pest gestorben war, noch bevor sie ihrem Herrn den ersehnten Thronfolger schenken konnte.
Graf Hug de Castellbo, der eine Woche zuvor seine Gemahlin, zwei Söhne und eine Tochter verloren hatte, pilgerte mit einer Schatulle voll Silber barfuß und in Sackleinen gehüllt zu der fast sieben Meilen entfernten Zisterzienserabtei, bevor er im Dienste des Königs nach Valencia weiterritt. Denn wer wußte schon, welche weitere scheußliche Strafe ihn ohne das vorherige Abbüßen seiner Sünden noch erwarten mochte?
Die zwölfjährige Isabel d’Empuries legte eine Wiesenblume auf dem frisch versiegelten Sarg ihrer Mutter nieder und brach auf zum Kloster Sant Daniel, um sich anderen verwirrten Waisenmädchen anzuschließen, die unter der Obhut der Benediktinerschwestern versammelt waren.
Im Haus des Arztes Isaac wand sich ein junger Mann zitternd und schwitzend, rief Isaac, den Herrgott und schließlich in seinem Delirium selbst die tote Mutter um Hilfe an, von deren Sterbebett er die Krankheit angeschleppt hatte.
»Kannst du denn nichts für ihn tun, Papa?« Rebecca trat einen Schritt aus der geöffneten Tür in den Raum hinein.
Der starke Arm ihrer Mutter schlang sich um ihre Taille und zog sie entschlossen in den Hof hinaus. »Halte dich von diesem Zimmer fern, Rebecca«, sagte sie.
»Aber Mama, es ist doch Benjamin, der da liegt.« Ihre Stimme steigerte sich zu einem Kreischen und ging in ein unbändiges Weinen über.
»Laß mich doch wenigstens seine Stirn kühlen, um das Fieber zu senken«, flüsterte sie. »Es ist mir gleich, ob ich mit ihm sterbe.«
»Rebecca, sei nicht töricht«, sagte Isaac. Seine gewohnte, kontrollierte Ruhe war an ihre Grenzen gelangt. »Alles, was wir tun können, ist, darauf zu achten, uns nicht selbst anzustecken. Wenn ich es könnte, würde ich ihn retten. Das schwöre ich dir.«
Rebecca brach erneut in Tränen aus.
»Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne ihn machen soll, liebste Judith.«
»Du wirst einen neuen Gehilfen finden, Isaac«, sagte die Frau des Arztes und legte allen Trost in ihre Stimme, während sie ihre Tochter fest im Griff behielt.
»Wo?«
Die Frage schwebte einen langen Moment unbeantwortet in der Luft. »Hat der Tod denn so viele gefordert?«
»Das hat er. Und ich weiß nicht, warum unser Haus verschont geblieben ist, mit Ausnahme deines törichten Neffen hier.«
Während er sprach, legte er seine Hand auf die Brust des jungen Mannes. Er horchte angestrengt einen Augenblick und legte dann sein Ohr auf die Stelle, wo seine Hand geruht hatte. »Laß Naomi kommen, Judith. Er ist tot.«
Seine fünfzehnjährige Tochter rang nach Luft und wandte sich gegen ihre Mutter. »Du hast mich nicht zu ihm ins Zimmer gelassen, als ich ihn trösten wollte. Und jetzt ist er tot. Mein Benjamin ist tot.« Sie befreite sich aus der Umklammerung der Mutter und floh über den Hof zur Treppe, die zu den übrigen Räumen des Hauses führte.
»Dein Benjamin, Rebecca?« frage Judith bestürzt und lief zur Treppe. »Raquel«, rief sie und wartete, daß ihre jüngere Tochter erschien.
»Judith«, rief Isaac durch die offene Tür. »Wo bist du?«
»Ich bin hier, Isaac«, antwortete seine Frau und kam eilig über den Hof zurück. »Ich habe Raquel geschickt, um Naomi zu holen und um ihre närrische Schwester zu beruhigen. Aber ist es denn wahr? Ist Benjamin ...?« Die Stimme versagte ihr.
»Ja, tot«, sagte Isaac matt. »Wie all die anderen.« Unschlüssig starrte er in die Helligkeit des Hofes hinaus. »Er muß sofort ausgezogen und gewaschen werden«, sagte er und bückte sich auf dem Weg zum Brunnen hinaus automatisch, um mit seiner hohen Gestalt unter dem Türrahmen hindurchzukommen. »Dann wirf seine Kleider und das Betttuch ins Feuer. Sag Naomi, sie soll reinigende Kräuterbündel anzünden und das Zimmer versiegeln, bis die Ansteckungsgefahr vorbei ist. Und Judith, wenn du mir mein weites Barchentgewand holst, dann kann ich mich hier waschen und umziehen.«
»Ist das denn nötig?« frage Judith blaß vor Angst.
»Bis jetzt ist unser Haus von der Pest unberührt geblieben, meine Liebe. Ich hoffe, wir können es auch weiterhin davon freihalten.« Isaac zog alle seine Kleider aus und warf sie in einen Zuber voller Wasser, der neben dem Brunnen stand. Dann nahm er einen großen Eimer und übergoß sich mit reichlich kaltem Wasser.
»Aber du hast uns doch alle von seinem Zimmer ferngehalten. Warum ...?«
»Einige sagen, die Seuche kann sich in der kleinsten Kleinigkeit festsetzen – auf einem Ring oder einem Kleidungsstück –, wenn sie nur in die Nähe eines Infizierten gelangt ist. Wenn das stimmt, Judith, dann kann mein Gewand die Krankheit von mir auf dich übertragen, von unserem Haus auf ein anderes. Deshalb gebe ich ja die Arzneien auch nur bei den Pestkranken ab, betrete aber nie die Häuser.«
»Willst du etwa sagen, daß man die Seuche wie Schmutz abwaschen kann?« Ihre Stimme klang skeptisch. »Das glaube ich nicht.«
»Das weiß niemand. Ich hoffe es zumindest.«
»Und wie hat sich Benjamin dann angesteckt? Er ist immer ein reinlicher Junge gewesen.«
»Er ist bei Hannah gewesen, als sie todkrank im Bett lag. Er hat es mir gestanden«, sagte Isaac, »als das Fieber bei ihm ausbrach.«
»Meine arme Schwester«, sagte Judith nüchtern. »Es ist hart, wenn ein Sohn dafür bestraft wird, daß er seiner Mutter diese Ehre erweist.«
»Allerdings«, erwiderte Isaac bitter und goß mehr Wasser über seinen Rücken, um die Seife abzuspülen. »Aber die Pest hat ihre eigenen Gesetze. Die unglückselige Ehrfurcht seiner Mutter gegenüber hat ihn umgebracht und die Krankheit in unser Haus geschleppt. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht, um ihr Einhalt zu gebieten.«
»Ich hole dir ein sauberes Gewand.«
Die Leiche des Gehilfen wurde auf einer Holzbahre aus dem Haus getragen, um gewaschen und in sauberes Leintuch gehüllt zu werden. Die reinigenden Feuer brannten schon, und das Sterbezimmer war von dichtem Rauch erfüllt. Naomi schloß die Tür und reichte ihrem Herrn den Schlüssel.
»Isaac«, mahnte seine Frau von hinten. »Hier ist dein Gewand. Zieh dich an. Du beschämst Naomi mit deiner Nacktheit. Ich nehme den Schlüssel.«
»Naomi sieht mich nicht zum ersten Mal nackt«, sagte Isaac.
»Aber da warst du noch ein Kind, nicht ein stattlicher Mann im besten Alter –« erwiderte seine Frau mit unfreiwilligem Kichern. »Solche Gedanken – und Benjamin liegt nur ein paar Schritte entfernt, tot«, fügte sie hinzu und errötete. »Hier ... Zieh dein Gewand an. Ich schließe die Tür ab.«
Isaac stand am Brunnen und schloß die vielen Knöpfe des langen, weiten Umhangs, wie es dem Arzt einiger der wohlhabendsten und mächtigsten Familien der Stadt Girona geziemte. Wieder sah er sich unsicher um. »Judith«, rief er fragend. »Wo bist du?«
»Hier bin ich, Isaac. An der Treppe. Was ist denn jetzt wieder?« Unruhe stand ihr ins Gesicht geschrieben, als sie zu ihm hinübereilte.
»Bleib einen Moment hier auf dem Hof mit mir. Meine Liebste, meine schöne Judith, stell dich hier mit dem Gesicht in die Sonne. Ich möchte dich ansehen.«
»Nicht nur, daß mein Augenlicht schwächer wird«, sagte Isaac, nachdem sie sich auf der Bank unter der Laube niedergelassen hatten. »Das wußtest du ja. Aber mit jedem Morgen wird es schlimmer. Seit Tagen lebe ich nun schon in einer Schattenwelt, und ich befürchte, daß ich bald nicht einmal mehr Licht und Schatten werde unterscheiden können. Bis er krank wurde, konnte mir Benjamin alles beschreiben, was ich nicht deutlich sah, und seine Hand führte ruhig das Messer, wo es nötig war. Aber nun ist er tot.« Er nahm die Hand seiner Frau und hielt sie für einen Moment ganz fest. »Wenn er die Seuche in unser Haus geschleppt hat, dann macht es nichts. Wir werden unsere Tür vor den Gesunden verriegeln, beten und einander in unseren letzten Tagen Trost spenden.«
Judith saß schweigend unter der Laube neben ihrem Mann. Sie nahm ihre Arbeit auf und legte sie wieder ab. »Wann werden wir es wissen?«
»Bald. Heute ist Mittwoch. Noch bevor der Sabbat vorbei ist, werden wir es wissen. Solange werden wir uns einschließen. Aber wenn wir durch ein Wunder verschont bleiben sollten, was soll ich dann tun?«
Judith wartete, bis sie im vollen Besitz ihrer Stimme war. »Du wirst einen neuen Gehilfen finden.«
»Und wie, inmitten von Tod und Verderben? Er muß geschickte Hände haben und schnell lernen können. Ich kann es mir nicht leisten, zwei oder drei Jahre damit zu verbringen, einem Jungen, der nichts als Luft im Kopf hat, beizubringen, wie man einem Patienten das Tor öffnet oder den Kräuterkorb trägt, ohne ihn fallen zu lassen. Denk doch nur an all die Familien hier im Viertel. Es gibt niemanden. Jeder, der nicht tot ist, arbeitet für zwei oder drei.«
»Dann werde ich eben deine Gehilfin sein. Ich gehe mit dir in den Wald, um Kräuter zu sammeln. Es gab eine Zeit, da habe ich das gemacht. Du sagst mir, was du brauchst, und ich werde es finden. Du kannst ja noch immer riechen und schmecken, um zu begutachten, was ich finde.«
»Ach, Judith, mein Schatz. Stark wie ein Löwe und ebenso tapfer. Aber du kannst mich nicht begleiten, wenn ich meine Patienten besuche«, sagte Isaac. »Es würde sich nicht geziemen.«
»Dann schicke ich eben Rebecca mit dir. Sie ist flink und geschickt mit ihren Händen. Du wirst dich mit deinen Töchtern begnügen müssen, bis Nathan alt genug ist, um an der Seite seines Vaters zu lernen.«
Eine goldäugige, braungestreifte Katze sprang Judith auf den Schoß. Ungeduldig schob sie sie wieder hinunter. »Was hat dich nur dazu gebracht, diese Viecher ins Haus zu schleppen? Als hätten wir nicht schon genug Sorgen.«
»Naomi hat über Mäuse in der Küche geklagt und meint, eine Ratte in der Speisekammer gesehen zu haben. Du mußt zugeben, daß die Kätzchen die Ratten und Mäuse verjagt haben. Und außerdem«, sagte er in seinem gewohnten, neckenden Ton, »behauptet der alte Mordecai, daß Katzen mit goldenen Augen Glück bringen. Die Familien, die eine haben, leiden weniger unter der Pest als ihre Nachbarn. Aber zu niemandem ein Wort davon, sonst stehlen sie uns noch unsere Katzen.«
Judith stand auf und sah voller Liebe und Verzweiflung auf ihren Mann. »Scherze nicht, Mann, in Gegenwart von Benjamin. Seine Leiche liegt nur ein paar Schritte entfernt. Und über uns allen schwebt ein Todesurteil.«
Isaac faßte ihre Hand. »Ich scherze nicht, Liebste. Und vielleicht ist es ja wahr – so wahr wie alles andere, was die Leute über diese schreckliche Heimsuchung glauben.«
»Ich schicke dir Rebecca. Wenn sie deine Gehilfin sein soll, beginnt sie besser sofort damit. Sie braucht eine nützliche Beschäftigung«, sagte ihre Mutter schroff.
Und die Pest wütete in jenem Sommer von Granada bis Girona, bis die kühlen Winde aus dem Norden herabwehten und die Seuche aus der Stadt fegten. Am Ende ihrer Schreckensherrschaft hatte sie jede dritte Seele eingefordert und allem Handwerk und Gewerbe in der Stadt, vom Schuster und Schreiber bis hin zum Arzt, seine gelernten Kräfte entrissen.
Aber sie rührte nicht noch einmal an das Haus von Isaac, dem Arzt.
Kapitel 1
Girona, Sonntag, 22. Juni 1353
In der Kathedrale war es kühl und dunkel, obwohl die strahlende Junisonne durch die hohen Bogenfenster sickerte und der Innenraum in leuchtenden Farben ausgeschmückt war. Die Glocken läuteten zur Messe, und die Gläubigen strömten lachend und schwatzend herein. Junge Frauen stellten ihre besten Kleider zur Schau, trugen eine Schicht bunter Seide über der anderen oder zeigten sich in einfachem, dunklem Tuch. Sie warfen ihr glänzendes Haar zurück, das ihnen in wogenden Locken auf die Schultern fiel, oder zupften Schleier zurecht, um aufwendig geflochtene Frisuren zu enthüllen. Liebe lag in der Luft. Morgen stand die Sankt-Johannis-Nacht bevor, in der junge Frauen im Spiegel klarer Wasserläufe, auf abgelegenen Wiesen und an anderen ungestörten Orten nach den Gesichtern ihrer zukünftigen Freier Ausschau hielten. Nicht wenige dieser Freier befanden sich eben jetzt in der Kathedrale und wurden durch die Nähe so vieler anziehender Leiber von der Sorge um ihr Seelenheil abgelenkt. Noch ein koketter Blick, ein Kichern, ein mißbilligendes Zischen, und die Gemeinde kam zur Ruhe.
In einem Winkel fern vom Altar waren zwei Fremde, ein Mann und eine Frau, in ein Gespräch vertieft. Der Mann war auf eine arrogante Art gutaussehend und in auffällig leuchtende, bestens sitzende Kniehosen sowie einen enganliegenden Umhang mit farbigen, bauschigen Schlitzärmeln gekleidet.
»Ist alles vorbereitet?« fragte er. Er hatte sich drängend über sie gebeugt, und sie wich beunruhigt einen Schritt zurück. Ihr Schleier verrutschte und gab dicke Zöpfe vollen roten Haares frei, das sie nach der aufwendigen Methode des französischen Hofes kurz über den Ohren anliegend trug.
»Es hat sich nichts geändert«, sagte sie und vermied den Blick ihres Begleiters. »Ich habe sie noch nicht überzeugen können, doch glaube ich, daß sie sich im Kloster langweilt und sie das Abenteuer durchaus reizt. Man sagt, sie sei furchtlos.«
»Dann wird sie ihm eine unbequeme Gemahlin sein«, meinte ihr Begleiter. »Doch das ist seine Sorge, nicht unsere. Ob sie will oder nicht, sie muß zwischen Frühmette und Laudes hinausgeschafft werden.« Er verstummte und schien dem Gottesdienst zu folgen. »Gebt ihr dies, wenn nötig«, sagte er und reichte ihr ein kleines Päckchen. »Einen Tropfen oder zwei in Wein gemischt, nicht mehr, und sie wird schlafen wie eine Tote. Jemand Vertrauenswürdiges wird vor dem kleinen Tor postiert, um Euch mit ihr zu helfen. Aber Ihr müßt sie so weit bekommen.«
»Und was, wenn man mich sieht?«
»Das wird nicht passieren. Es wird einen solchen Aufruhr in der Stadt geben, daß niemand die Gelegenheit haben wird, Euch zu bemerken.«
»Einen Aufruhr? Woher wollt Ihr das wissen?« Sie warf ihm einen erschrockenen Blick zu und überlegte kurz. »Soll ich sie denn immer noch zum arabischen Bad bringen?«
»Ja. Welcher Ort wäre näher und ungestörter? Wir werden von dort aus aufbrechen. Und dies ist kein Spiel, Verehrteste«, fügte er hinzu. »Wenn Ihr sie nicht dorthin bringt, sind wir alle in ernsten Schwierigkeiten.«
Montag, 23. Juni
Am Abend vor Sankt Johannis – Sant Johan galt als Schutzheiliger der Mittsommerfeiern – läuteten die Glocken des Klosters Sant Daniel zum Tagesabschlußgebet, und die Nonnen schritten in einer Reihe in ihre neu gebaute Kapelle, um das letzte Gebet des alten Tages zu verrichten. Die Dunkelheit schien trotz der späten Stunde nur zögerlich hereinzubrechen. Die letzte Glut der Sonne beleuchtete gemeinsam mit dem wächsernen Mond das Kloster und die Stadt. Während die Stimmen der Schwestern zu einem Gesang von melancholischer Schönheit anhoben, um Leib und Seele dem Herrn bis zum Anbruch des neuen Tages anzuvertrauen, nahm die Musik, die die Stadt zur Feier wecken sollte, ihren eigenen, drängenden Rhythmus an.
Unten in Rodrigues Schenke unweit des Flusses Onyar hatte sich eine unruhige und verdrossene Menge versammelt. Der Einbruch der Dunkelheit schien ihre Hoffnung auf Vergnügungen zu steigern, ohne sie zu erfüllen. Der Raum war drückend heiß und vom Rauch der blakenden Lampen angefüllt. Die Unterhaltungen waren verflacht, die angetrunkenen Gäste mürrisch und reizbar. Auf der Treppe wurden schnelle Schritte hörbar, und der Fremde, der der Messe in der Kathedrale beigewohnt hatte, trat ein und brachte die naßkalte Luft vom Flußufer mit sich herein. Im Raum machte sich Schweigen breit.
Der Aufzug des Fremden hatte sich seit dem Vortag gewandelt. Der Mantel, den er nun trug, war nicht so vornehm geschnitten, noch saßen seine Kniehosen so elegant wie zuvor. Sein Lächeln war offener, der Blick weniger hochmütig. Ein oder zwei der Anwesenden erkannten ihn und nickten vorsichtig abwartend. Er bedachte die versammelte Menge mit einem breiten und verwegenen Lächeln.
»Josep«, sagte er in die Stille hinein und nickte einem vierschrötigen, kräftig aussehenden Mann mit wohlhabender Miene zu. »Pere, Sanch.« Er warf auch diesen beiden Männern jeweils einen erkennenden Blick zu. Noch immer sprach niemand. »Wirt«, rief er, »einen Krug Wein für meine Freunde hier, zu Ehren des Heiligen. Nein – das wird nicht genügen. Drei Krüge für den Anfang. Der gesegnete Johan hat mir Glück gebracht, und ich muß es ihm gebührlich danken.«
»Danke, Herr«, sagte ein Mann, der sich bequem im Fenster rekelte. »Und wem spreche ich meinen Dank aus? Außer dem gesegneten Heiligen, meine ich.«
»Romeu«, sagte er. »Romeu, Sohn des Ferran, geboren in Vic, Soldat, Reisender, Wanderer, und erst letzte Woche in mein Vaterland zurückgekehrt.«
Die Krüge wurden gebracht und auf die langen Tische gestellt. Romeu füllte die Becher, ließ einen weiteren Weinkrug bringen und goß sich schließlich selbst ein. Er hob seinen Becher. »Auf die schönste Stadt der Welt«, sagte er, »lang möge sie blühen«, und trank. Und alle tranken. Er füllte ihre Becher nach, sie tranken wiederum, diesmal auf Fortuna. Er schob den Krug über den nächststehenden Tisch, und so plötzlich, wie sie verstummt war, setzte die allgemeine Unterhaltung wieder ein. Romeu schlenderte hinüber zu dem anderen langen Tisch und schob nun einen Krug auf einen Riesen von Mann zu, der ehrfürchtig, wenn nicht gar verständig einem dünnen, geschmeidigen Mann mit schmollendem Gesicht und gerunzelter Stirn zuhörte.
»Laßt mich Eure Becher füllen«, sagte Romeu zu den beiden, schenkte dem Riesen nach und langte nach dem Becher des Dünnen.
»Ich trinke nicht«, sagte der Dünne und riß seinen Becher an sich, »da ich nicht über die Mittel verfüge, Eure Großzügigkeit zurückzuzahlen.«
»Er hat mir seine Sorgen anvertraut«, sagte der Riese und verfiel erneut in Schweigen.
»Der Große Johan hat ein geduldiges Ohr für die Sorgen anderer«, erklärte sein Freund.
»Ein geduldiger Zuhörer ist eine Seltenheit«, bemerkte Romeu und goß dem Mann geistesabwesend nach. »Auch ich habe schwere Zeiten durchgemacht.« Er senkte seine Stimme und verfiel in einen verschwörerischen Ton. »Durch die Ränke anderer, deren Namen Euch in Erstaunen versetzen würden, habe ich meine Stellung, meinen guten Ruf und mein bescheidenes Vermögen verloren. Drei Jahre habe ich ohne einen Pfennig im Exil verbracht. Doch wie Ihr seht, hat sich das Blatt gewendet. Man hat meine Widersacher überführt. Ich habe meine Stellung wiedererhalten, und meinen guten Namen auch.« Er füllte erneut den Becher des Dünnen.
»Ich bin Buchbinder«, sagte der Dünne. »Mit Namen Martin.«
»Ein prächtiges Gewerbe«, sagte Romeu. »Gibt es in Girona keine Bücher mehr, oder warum könnt Ihr den Becher nicht auf das Wohl des gesegneten Heiligen leeren?«
»Ach – Bücher gibt es genug! Vor nicht langer Zeit bekam ich alle Bücher der Kathedrale, der kirchlichen Gerichte sowie Gelegenheitsaufträge einiger Herren in der Stadt. Ich hatte ein ausgezeichnetes Auskommen. Ich bin nicht älter als Ihr es seid, Herr, und ich beschäftigte einen Gesellen und zwei Lehrlinge. Doch dann kam ein niederträchtiger Kanoniker – ich kenne seinen Namen«, sagte Martin und goß sich diesmal selber nach. »Er klagte über Nachlässigkeit. Es war der Lehrling – in diesen Zeiten bekommt man einfach keine Lehrlinge mehr. Nicht seit die Pest so viele dahingerafft hat. Und jetzt glaubt jeder dahergelaufene Tunichtgut, er sei Gold wert und eine Unterkunft, nur um dann den lieben langen Tag auf seiner Bank in der Werkstatt zu schlafen.« Er schüttelte den Kopf. »Also, ich war gut beschäftigt, da vergab der Stellvertreter des Bischofs – ein harter Brocken – einen Teil der Arbeit an einen anderen, einen Juden, und es heißt, er mache es besser, und zu einem günstigeren Preis.«
»Und man gab Eure Arbeit –«
»Genau, Herr. Sie gaben ihm die ganze Arbeit. Einem Juden. Im Dienste des Bischofs.« Er senkte die Stimme. »Man sagt, er habe Sklaven. Er hält sie in der Buchbinderei hinter Schloß und Riegel, gibt ihnen Schweinefutter und hält seine Ausgaben schön klein. Das ist nicht rechtens. Der Bischof sollte seine Arbeit von Christen verrichten lassen, nicht von Juden und ihren maurischen Sklaven.«
»Hast du das gehört, Josep?» fragte Romeu. »Was passiert, wenn die Papierproduktion von Juden übernommen wird?«
»Dazu wird es nicht kommen, mein Freund«, sagte der wohlhabend wirkende Mann. »Ich weiß, wie ich meine Interessen wahre.«
»Höchste Zeit, daß wir etwas unternehmen«, meldete sich eine andere Stimme von der gegenüberliegenden Seite des Tisches.
»Tun wir ja, Marc«, erwiderte ein Dritter. »Mach mit.«
»Still, ihr Narren«, raunte abermals ein anderer. »Wer weiß, wer hier mithört?«
»Das Racheschwert des Erzengels Michael wird die blutbefleckten Herren niederstechen, die schmutzigen Priester und die jüdischen Hexenmeister«, ertönte eine Stimme aus der Dunkelheit. »Genau wie an seinem Tag zur Zeit unserer Großväter, als er uns vor den französischen Angreifern rettete.«
Doch als sie sich umwandten, um zu sehen, wer da sprach, war dort niemand.
Romeu lächelte, strahlenden Auges mit dem ersten Becher Wein in der Hand – er hatte ihn nur halb geleert. Er stellte ihn ab, wechselte ein paar Worte mit dem Wirt, legte Geld für noch mehr Wein hin und verschwand hinaus in die warme Nacht. Sein Werk hatte gerade erst begonnen.
Als die halbe Nacht verstrichen und der Mond hinter den Hügeln versunken war, lag die Hitze noch immer wie eine Decke über der samtenen Dunkelheit von Girona. Der Gestank von Schlamm und toten Fischen drang vom Fluß herauf und vermischte sich mit den häuslicheren Gerüchen der Stadt: mit Küchendünsten, verfaulendem Müll, Kloakengestank und dem Rauch ausgehender Feuerstellen.
Die Stadt kam zur Ruhe. Lediglich einige wenige entschlossene Nachtschwärmer hatten noch immer kein Bett für die Nacht aufgesucht – eine duftende Wiese, ein Paar zarter Arme oder auch nur das eigene, einsame Strohlager. Am nördlichen Stadttor verabschiedete sich Isaac von seinem Begleiter, entrichtete dem Torhüter ein Grußwort und eine Münze und schlug den Weg zum jüdischen Viertel ein. Das Geräusch seiner geschmeidigen Lederstiefel auf dem vertrauten Kiespfad hallte in der stillen Juniluft wider. Er hielt inne. Das Echo klang einen Moment lang fort und verstummte. Jemand lauerte in der Nacht. Isaac erhaschte einen Luftzug, der nach Angst und nach Lust roch und an ihm vorbeizog; dann den widerlichen Gestank des Bösen. Er faßte seinen Stock fester und beschleunigte seinen Gang.
Die Schritte verklangen in der Ferne, und der Arzt richtete seine Gedanken auf das kränkelnde Kind, das er eben verlassen hatte. Die vergangene Woche hatte eine deutliche Besserung seines Zustandes mit sich gebracht. Sein Appetit war gut, und es brannte schon wieder darauf, in den Ställen oder am Flußufer zu spielen. Ohne ärztliche Hilfe und mit keiner weiteren Medizin als frischer Luft und gutem Essen müßte es am Ende des Sommers wieder so kräftig und lebhaft sein wie jeder andere Junge seines Alters auch. Sein Vater würde zufrieden sein.
Das Tor zum Viertel war längst verschlossen und verriegelt. Isaac schlug mit seinem Stock gegen die schweren Planken. Nichts geschah. Er schlug stärker. »Jacob«, rief er mit tiefer, durchdringender Stimme, »du fauler Nichtsnutz. Wach auf. Soll ich hier vielleicht die ganze Nacht herumstehen?«
»Komme schon, Meister Isaac«, murrte Jacob. »Komme. Hätte ich etwa das Tor die ganze Nacht lang offenhalten sollen in der Hoffnung, daß Ihr vielleicht irgendwann hier vorbeispaziert?« Seine Stimme war nun in ein Murmeln übergegangen und konnte getrost ignoriert werden. Isaac stellte seinen Korb auf den Boden, lehnte sich auf seinen Stock und wartete. Eine leichte Brise hob an und trug den schweren Duft von Rosen aus dem Garten des Bischofs herab; sie wehte Isaac die Haare aus dem Gesicht und legte sich dann. Irgendwo bellte ein Hund. Im Viertel durchschnitt das dünne Gewimmer eines Säuglings die Nachtluft. Dem kränklichen Ton nach zu urteilen, handelte es sich wahrscheinlich um den Erstgeborenen von Reb Samuel, der noch nicht einmal drei Monate alt war. Isaac schüttelte den Kopf. Sein Herz trauerte mit dem Rabbi und seiner Frau. Jeden Moment würde ihre Dienerin an seinem Tor auftauchen und ihn bitten, sein Gewand anzuziehen und zu dem Kind zu kommen.
Der schwere Riegel wurde aus seiner Halterung geschoben, ein Schlüssel schabte in einem Schloß, und das kleine Tor öffnete sich kreischend. »Es ist eine schrecklich späte Stunde, um jemanden einzulassen, Herr«, sagte Jacob. »Selbst jemand so Ehrenwerten wie Euch. Außerdem ist es eine unruhige Nacht voller betrunkener Rüpel, die nichts Gutes im Schilde führen. Schon das zweite Mal, daß ich aus meinem Bett geholt werde«, fügte er bedeutungsschwer hinzu. »Und der andere, den ich eingelassen habe, suchte Euch auch.«
»Ach, Jacob – wenn der Rest der Welt ungestört die Nacht verbringen würde, könnten du und ich in Frieden schlafen, nicht wahr?« Er drückte dem Wächter eine Münze in die Hand. »Aber wie würden wir dann unser Brot verdienen?« fügte er mit einem Funken Bosheit hinzu und machte sich auf den Weg zu seinem Haus.
An seinem Tor wurde er von einer unbekannten Stimme begrüßt. Sie klang, als gehöre sie einem stattlichen jungen Mann. Seinem Akzent nach stammte er aus den entlegenen Bergen Kataloniens.
»Meister Isaac«, sagte der Fremde, »das Kloster Sant Daniel schickt mich. Eine unserer jungen Damen ist schwer krank. Sie schreit vor Schmerzen.« Er klang, als hätte er seine Worte mit Mühe auswendig gelernt, um sie nun bröckchenweise wiederzugeben. »Man bat mich, Euch und Eure Medizin zu holen.«
»Ins Kloster? Noch heute nacht? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen.«
»Man sagte mir, ich müsse Euch unbedingt holen«, sagte der Fremde, und seine Stimme schwoll erschreckt an.
»Still, Junge«, sagte Isaac ruhig. »Ich komme, doch zuerst muß ich holen, was ich brauche. Wecken wir das Haus nicht auf.« Er schloß das Tor auf und trat hindurch. »Warte im Hof«, sagte er und zeigte voran. »Ich habe noch im Haus zu tun.«
Der Gärtnerbursche des Klosters beobachtete Isaac mit einer Neugier, die an Ehrfurcht grenzte. Es stimmte, was man sich in der Stadt erzählte. Meister Isaac konnte eine Steintreppe hinaufsteigen, ohne das geringste Geräusch zu verursachen. Man munkelte auch, daß man nur am Luftzug merken könne, daß Isaac im Dunkel an einem vorübergegangen war. Der Junge strengte seine Augen an, um zu sehen, ob der Arzt wirklich die Treppe hinaufstieg oder ob er von seinem Dämonengefolge hinauf in die oberen Stockwerke des Hauses getragen wurde.
Etwas Weiches, Formloses und Bedrohliches drückte sich gegen sein Bein und unterbrach seine Spekulationen. Er machte einen Satz in die Luft und unterdrückte heldenhaft einen Schreckensschrei. Sein erstickter Ausruf wurde von einem fragenden Miau beantwortet. Eine Katze. Voller Scham beugte er sich hinunter, kraulte ihren Kopf und ließ sich nieder, um zu warten.
Als Isaac das obere Ende der Treppe erreicht hatte, horchte er kurz an der Zimmertür seiner Frau und ging dann in den Raum auf der anderen Seite des Ganges. Er klopfte behutsam an. »Raquel«, flüsterte er, »bist du wach? Ich brauche deine Hilfe.«
Die sanfte Stimme seiner sechzehnjährigen Tochter antwortete ihm. Er lehnte sich an die Wand und wartete.
»Isaac!« Der Ruf zerschnitt die Nachtluft wie der Trompetenstoß vor den Mauern von Jericho. Er mühte sich, Haltung zu bewahren. Immer wenn er es am wenigsten erwartete, griff Judiths Besorgnis um sich, umschloß ihn wie ein erstickendes Tuch und raubte ihm all seine Kraft und Energie. »Was ist denn los?«
Er hörte, wie sie aus ihrem Bett stieg und rasch durch ihr Zimmer lief. Die Tür öffnete sich knarrend und ließ einen kühlen Lufthauch aus den Bergen in den stickigen Gang dringen.
»Nichts, meine Liebste«, sagte Isaac. »Alles ist gut. Das Kloster hat nach mir geschickt, und Raquel muß mir zur Hand gehen.«
»Wo bist du denn gewesen?« fragte Judith. »Die ganze Nacht bist du alleine unterwegs gewesen, nicht einmal ein Diener hat dich begleitet. Das ist zu gefährlich.«
Er streckte seine Hand aus, um ihr Gesicht zu berühren und ihrem Klagen Einhalt zu gebieten. »Der Sohn des Rabbis kämpft mit dem Tod, meine Liebe. Seine Frau ist verzweifelt. Nachdem sie über drei Jahre auf einen Sohn gewartet haben, muß sie es als einen schweren Schlag empfinden. Wenn sie nach mir schicken, dann sag ihnen, daß wir direkt vom Kloster aus zu ihnen kommen werden.«
Judith schwieg, eine Gefangene ihres eigenen ausgefeilten und strengen Verhaltenskodex. Man klagte nicht laut, wenn es darum ging, dem Rabbi zu helfen. Doch hatte Judith selbst vor der Geburt der Zwillinge zwei Söhne im Kindesalter verloren und dachte bei sich, daß der Rabbi und seine Frau das Recht auf Trauer nicht für sich gepachtet hätten. Ihre Unschlüssigkeit, was nun zu tun sei, lenkte sie derart ab, daß ihr entging, daß Isaac ihre Frage nicht beantwortet hatte. »Mir will nicht in den Kopf, warum das gesamte Haus nicht schlafen soll, nur weil eine Nonne krank geworden ist«, sagte sie. »Was haben die Nonnen denn je für dich getan, Mann?«
»Still«, entgegnete Isaac. »Der Bischof ist immer unser Freund gewesen ...«
Glücklicherweise schlüpfte Raquel aus ihrem Zimmer, bevor ihre Mutter ihre Meinung über den Bischof kundtun konnte. Sie umarmte ihre Mutter und hüllte sich trotz der Hitze sorgfältig in einen Umhang.
»Wartet einen Augenblick«, sagte Judith.
»Worauf?« fragte Isaac mit einem Anflug von Ungeduld. »Es ist eine recht dringliche Angelegenheit.«
»Ich begleite Euch bis zum Haus des Rabbis«, sagte sie. »Geht schon vor und wartet im Hof auf mich.«
Raquel folgte ihrem Vater die Treppe hinunter. Er entriegelte die Tür zu einem großen, niedrigen Raum, der ihm als Herbarium, Destillationsraum, Behandlungszimmer und – sofern er erwartete, während der Nacht gerufen zu werden – als Schlafkammer diente.
Isaac nahm einen weiteren Korb aus dem Regal und fing an, ihn mit Phiolen und in Tücher gewickelten Wurzeln und Kräutern zu füllen. »He, Junge«, rief er leise durch die geöffnete Tür hinaus. »Was weißt du von der Krankheit der Dame?«
»Nichts, Herr«, antwortete er. »Ich nehme nur Nachrichten entgegen und hole das Nötigste aus der Stadt. Ansonsten arbeite ich im Garten. Mir sagt keiner was.« Er verstummte und dachte nach. »Ich habe sie schreien gehört«, sagte er in einem behaglichen Tonfall. »Als mich die Äbtissin losgeschickt hat, um Euch zu holen!«
»Wie schreit sie? Schreit sie laut?«
Er dachte einen Moment lang nach. »Ein lautes Schreien, Herr. Wie ein gestochenes Schwein oder – oder eine Frau, die ein Kind kriegt. Und sie schluchzt. Und dann ist es still.«
»Danke Junge. Komm, Raquel. Ich höre deine Mutter kommen.«
Ausnahmsweise wartete die Äbtissin Elicsenda persönlich am Portal; neben ihr standen Sor Agnete, die Schatzmeisterin, und Sor Marta, die Pförtnerin. »Meister Isaac«, sagte sie. »Ich danke Euch.« Sie raunte den zwei Nonnen mit unruhig angespannter Stimme einige kurze Worte zu Isaacs Person zu und nahm dann von jeglichem Versuch, belanglose Konversation zu betreiben, Abstand. »Ich werde mich kurz fassen. Fräulein Isabel ist ein Schützling des Klosters. Ihre Krankheit hat sie plötzlich befallen. Sie ist sich ihrer Umgebung nur noch in kurzen lichten Momenten bewußt; die meiste Zeit tobt sie und wird von quälenden Wahnvorstellungen heimgesucht. Ich befürchte, daß sie die Nacht nicht überstehen könnte. Ich bitte Euch, falls Ihr sonst nichts für sie tun könnt, ihr zumindest das Leiden etwas zu erleichtern. Ich habe auch nach dem Bischof geschickt. Sor Marta wird Euch zu ihr führen.«
Sor Marta ließ Isaac keine Zeit, sich zu fragen, warum sein Freund, der Bischof, anstelle des regulären Beichtvaters des Klosters aus dem Bett gerissen werden sollte, um einem sterbenden Mädchen Beistand zu leisten. Sie drängte ihn enge, steinerne Wendeltreppen hinauf und durch lange Gänge, die vom raschen Schritt ihrer geschmeidigen Lederschuhe widerhallten. Dann verlangsamten sich die Schritte. Isaac vernahm einen lauten Schrei, gefolgt von einem Schluchzen, und dann Luftschnappen und trockenes Würgen. Sor Marta klopfte einmal an eine schwere Tür und entfernte sich, nachdem sie leise angekündigt hatte, daß Sor Benvenguda, die Krankenschwester, gleich zu ihm herauskommen würde.
Die Tür öffnete und schloß sich wieder. Das Rascheln von Kleidung und die Nähe eines warmen Körpers kündigten Isaac die Gegenwart der Krankenschwester an. »Meister Isaac, wir schätzen Eure Hilfe sehr«, sprach ihr Mund, aber in ihrer Stimme schwangen Ärger und Beleidigung mit. »Der Bischof hat uns persönlich geraten, nach Euch zu schicken. Ihr werdet wissen wollen, was sie quält.«
Die Tür wurde geöffnet und entließ noch jemanden aus dem Krankenzimmer in den Gang. Der Neuankömmling brachte den Geruch von Fieber und Auszehrung sowie einen schwachen Gestank faulen Fleisches mit sich aus dem Zimmer.
»Ich kann Euch sagen, was sie quält«, sagte Isaac knapp. »Sie leidet an eitrigen offenen Wunden, die die schweren Schmerzen und das hohe Fieber verursachen.«
Eine der Schwestern, die im Gang standen, schnappte erstaunt nach Luft.
»Bevor ich Genaueres sagen kann«, fügte er hinzu, »muß ich sie untersuchen, um die Ursache festzustellen und um zu entscheiden, ob meine bescheidenen Möglichkeiten ihr zu helfen vermögen.«
Sor Benvenguda war nicht erstaunt. Sie war entsetzt. »Das ist unmöglich. Ihre Sittsamkeit ...«
»... wird durch den starren Blick eines Blinden nicht beleidigt werden.«
Die Krankenschwester hielt inne und suchte nach Worten. »Das wußte ich nicht, Meister Isaac«, sagte sie schließlich. »Ich komme aus unserem Mutterhaus in Tarragona und bin neu in diesem Kloster.« Dann holte sie tief Luft, um den Kampf fortzusetzen. »Und dennoch geziemt es sich nicht, daß selbst ein Blinder sie entblößt ...«
»Allein meine Tochter wird sie berühren. Sie wird mir berichten, was sie sieht.«
»Das können wir nicht zulassen. Nicht einmal unsere eigenen Schwestern haben die Erlaubnis.«
»Das ist nicht dasselbe«, entgegnete Isaac entschieden. »Eure Schwestern sind gehalten, besondere Zurückhaltung zu üben, um nicht ihre eigene Keuschheit zu gefährden. Meine Tochter ist diskret und sittsam, aber sie hat kein Gelöbnis abgelegt, das sie verletzen könnte, wenn sie der Unglücklichen helfen würde.«
»Unmöglich.«
Ein weiteres Paar Füße kam den Gang entlanggeeilt und hielt neben ihnen inne. »Was ist unmöglich, Schwester?«
»Zuzulassen, daß dieser Mann und seine Tochter das Fräulein Isabel untersuchen, Mutter.«
»Fräulein Isabel ist die Nichte unseres Bischofs«, erwiderte die Äbtissin scharf. »Er hat sie unserer Obhut anvertraut. Wir sind für ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen verantwortlich. Ich bitte Euch zu bedenken, Schwester, daß sich Seine Exzellenz herabgelassen hat, uns seinen Wunsch anzutragen, Meister Isaac möge seine Nichte untersuchen und all das tun, was er für ihre Behandlung als notwendig erachtet. Ich denke, wir können seine Wünsche nicht übergehen.« Ihre Stimme zerschnitt die stickige Luft wie Stahl.
»Jawohl, Mutter«, murmelte Sor Benvenguda.
»Ausreichend Licht und was immer sie sonst noch benötigen.«
»Licht? Aber er ...«
»Er nicht, Schwester. Aber sie.« Schritte entfernten sich. »Wie heißt du, Tochter?«
»Raquel, Herrin.« Isaac hörte, wie ihr leichtes Barchentgewand den Steinboden berührte, als sie einen Knicks machte.
»Unser Dank und unsere Gebete für Euer Unterfangen sind mit Euch, wie auch immer es ausgehen mag. Es mag Euch helfen zu wissen, daß Fräulein Isabel siebzehn Jahre alt ist und daß sie sich während der fünf Jahre, die sie hier im Kloster verbracht hat, stets ausgezeichneter Gesundheit erfreut hat – bis diese Krankheit sie befallen hat. Wenn etwas fehlen sollte, laßt mich kommen. Sor Agnete wird hierbleiben und dafür sorgen, daß ich Eure Nachrichten umgehend erhalte.«
Raquel betrat das Krankenzimmer mit ihrem Vater und führte ihn zu dem schmalen Bett in der Mitte des Raumes, wo die Leidende lag. An der rechten Wand befand sich ein großer Kamin mit einem Vorsprung für den Kessel. Trotz der Hitze der Nacht brannte Feuer, und nicht weit davon glühte eine große Kohlenpfanne. Eine sehr alte Nonne saß auf einem Hocker zwischen dem Herd und dem Kohlenfeuer und rührte eine haferschleimartige Masse in einem Kupfertopf um. Hin und wieder griff sie in einen Korb, der auf dem Boden zu ihren Füßen stand, nahm eine Handvoll Kräuter heraus und warf sie in die Glut. Ihr süßlicher Duft überdeckte notdürftig den Eitergeruch im Zimmer. Eine Laienschwester mit starken Armen und kämpferischem Gesichtsausdruck stand zwischen den zwei schmalen Fenstern und machte einen verlorenen Eindruck, so als hätte man sie bestellt, um die Leiche zu waschen, und sie wäre nur zu früh eingetroffen. Das geräumige Zimmer wurde von einer Kerze und dem Flackern des Feuers spärlich erleuchtet. Zwei jüngere Nonnen standen bleich vor Müdigkeit und schweißgetränkt unweit der Kerze neben der Krankenschwester, und die wild dreinblickende Sor Agnete überwachte alle von der Tür aus.
»Hier ist das Bett, Papa«, sagte Raquel, »und der Tisch steht links von dir. Am Fußende des Bettes steht noch ein Tisch, der ist groß genug für den Korb. Soll ich ihn dort hinstellen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, stellte sie den Korb am Fußende des Bettes ab.
»Sag mir etwas über unsere Patientin, Kind.« Isaac sprach so leise zu ihr, daß die wartenden Nonnen es kaum wahrnahmen.
Raquel holte die Kerze und hielt sie näher an das Mädchen heran. Sie sog überrascht die Luft ein, als der Lichtschein auf die zarten Gesichtszüge fiel. »Sie –« Raquel verstummte, wurde sich der zusehenden Nonnen bewußt und setzte erneut an. »Sie sieht krank aus, Papa. Ihre Augen sind eingesunken, ihre Lippen trocken und rissig, ihre Haut bleich – und ...« Die Tür öffnete sich, etwas kühlere Luft gelangte mit den zwei Nonnen, die mehr Kerzen brachten, in den Raum. »Sie haben mehr Kerzen gebracht. Im Licht kann ich jetzt sehen, daß ihre Haut grau aussieht, aber es ist kein Gelb darin. Auf ihren Wangen sind Fieberflecken. Sie wirft den Kopf hin und her, so als habe sie große Schmerzen, aber sie liegt auf dem Rücken, Papa, steif und gerade.«
»Frag sie ganz leise und vorsichtig, wo der Schmerz sitzt.«
Raquel kniete sich neben das Bett und näherte sich mit ihrem Gesicht dem der Patientin. »Fräulein«, sagte sie leise, »hört Ihr mich?« Der totenähnliche Schädel bewegte sich. »Sagt mir – wo sitzt der Schmerz?«
»Sag ihr, sie soll auf die Stelle zeigen, wenn sie kann. Und stell dich zwischen sie und die neugierigen Nonnen.«
Fräulein Isabel hatte gehört und streckte nun ihre Hand aus. Sie zog Raquel ganz nah zu sich heran und flüsterte ihr heiser etwas ins Ohr.
Raquel richtete sich auf, stellte sich auf die Zehenspitzen und flüsterte nun wiederum ihrem Vater ins Ohr. »Sie sagt, die Schwellung sei auf ihrem Oberschenkel, Papa.«
Isaac wandte sich um und bewegte den Kopf vor und zurück, bis er meinte, die Krankenschwester geortet zu haben. »Es sind zu viele Menschen hier im Raum, Schwester«, sagte er mit autoritärem Ton. »Sie verderben die Luft und stören die Ruhe. Schickt sie fort.«
Sor Benvenguda sah zu Sor Agnete, welche finster nickte.
»Wie Ihr es wünscht, Meister«, antwortete die Krankenschwester. »Aber Sor Tecla doch bestimmt nicht. Sie war früher unsere erfahrene und geschätzte Krankenschwester und kann sehr behilflich sein.« Die nächsten Sätze sprach sie leise murmelnd. »Sie arbeitete hier ganz alleine, nachdem alle ihre Helferinnen dem Schwarzen Tod anheimgefallen waren. Es würde sie sehr verletzen, wenn Ihr sie fortschickt.« Sie hob ihre Stimme wieder. »Sor Tecla bereitet einen Breiumschlag aus Kleie und Hafer vor, falls er gebraucht werden sollte.«
»Auch ich habe einen geschätzten Gehilfen an die Pest verloren«, sagte Isaac. »Aber der Herr hat mir in Seiner Weisheit eine kluge Tochter mit geschickten Händen beschert, die nun an seine Stelle getreten ist. Selbstverständlich kann Sor Tecla bleiben. Sie ist nicht im Weg.«
»Und ich werde ebenfalls bleiben«, sagte Sor Agnete. »Sonst sind alle abkömmlich. Ich werde hier bei der Tür stehen und jede Nachricht weiterleiten, die weitergeleitet werden muß. Schwester, Ihr könnt draußen warten, bis man Euch braucht.« Sor Benvenguda bedachte sie mit einem bösen Blick und ging zur Tür.
»Danke, Schwester«, sagte Isaac. Er wartete, bis das Geräusch der Schritte verklungen und die Tür geschlossen war, bevor er sich wieder seiner Patientin zuwandte.
Behutsam hob Raquel das Bettzeug und schließlich das dünne leinene Unterkleid an und legte eine riesige, rotglänzende Schwellung frei, die sich ganz oben an Fräulein Isabels Oberschenkel nahe der Leiste befand. Während dieser Verrichtungen fuhr Raquels Stimme unablässig fort mit der genauen Beschreibung all dessen, was sie sah und tat.
Isaac überlegte. »Was für eine Schwellung?«
»Es ist eine Pustelschwellung, da bin ich sicher, keine Pestbeule«, sagte Raquel. Sie beugte sich hinunter. »Wie lange ist sie schon da?«, fragte sie.
Fräulein Isabel blinzelte und strengte sich an, Raquel zu fixieren. »Freitag«, flüsterte sie. Ihre Augen schlossen sich wieder; sie warf den Kopf hin und her und stammelte Unverständliches.
»Hat sie sich ausgebreitet?« fragte er.
»Noch nicht, Papa. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck.«
»Mein tapferes Fräulein Isabel, ich muß Euch nun berühren, damit ich weiß, was zu tun ist. Aber ich bin blind und kann Euch nicht sehen. Meine Finger sind meine Augen.«
Die junge Dame stöhnte, riß ihre Augen weit auf und griff suchend nach Raquels Hand. »Mama«, hauchte sie.
»Versucht, nicht zu schreien«, sagte Isaac, »damit die guten Schwestern nicht denken, ich bringe Euch um.«
»Sie versteht dich nicht mehr, Papa«, sagte Raquel.
»Mag sein. Oder auch nicht. Zuerst werden wir ihre Schmerzen lindern.« Raquel nahm eine Flasche Wein aus dem Korb, füllte einen Becher zur Hälfte damit und goß Wasser und eine dunkle Flüssigkeit aus einer Phiole dazu. Sie richtete Fräulein Isabel auf und hielt ihr den Becher an die Lippen.
»Ihr müßt das trinken, Fräulein Isabel«, sagte Isaac bestimmt.
Aus den Tiefen ihres Deliriums hörte sie ihn und schluckte die Hälfte der Mixtur. Isaac wartete, zählte die Sekunden, beugte sich über das Bett, und Raquel führte seine Hand an den Rand der Schwellung. Er tastete sie ab und nickte.
***
Raquels ruhige Hand stach den Abszeß auf und entfernte den austretenden Eiter. Sie tupfte die Wunde mit Wein ab, gab einige getrocknete Blätter und Kräuter zu dem Breiumschlag der alten Nonne hinzu und legte ihn an.
»Wie fühlt Ihr Euch jetzt, mein Fräulein?« fragte Isaac.
Fräulein Isabel, trunken vor Erschöpfung, dem Nachlassen des Schmerzes und der Kombination von kräftigem Wein und starken Schlafmitteln, antwortete nicht. Zum ersten Mal seit Tagen schlief sie tief und fest.
Isaac nahm seinen Stock und schritt durch das Krankenzimmer. Bevor er die unvertraute Tür erreichte, öffnete Sor Agnete für ihn und wünschte ihm freundlich eine gute Nacht. Draußen im Gang faßte eine große Hand die seine, und eine vertraute Stimme grüßte ihn. »Meister Isaac, alter Freund. Ich bin Euch dankbar dafür, daß Ihr meine Nichte behandelt. Wie geht es ihr?«
»Sie schläft, Exzellenz Berenguer. Raquel wird hierbleiben und sie pflegen. Ich will nichts beschwören und sagen, sie sei außer Gefahr, doch habe ich das Gefühl, daß der Herr noch nicht bereit ist, sie zu sich zu nehmen. Ich werde morgen früh wiederkommen, um zu vermerken, welche Fortschritte sie macht. Raquel wird nach mir schicken, sollte ich vorher gebraucht werden.«
»Kommt«, sagte der Bischof von Girona. »Das sind gute Nachrichten. Laßt uns ein Stückchen Weges gemeinsam gehen.«
Als sie die Treppe hinunterstiegen, erhob sich ein glockengleicher Sopran und hallte in den stillen Gängen wider. Zwei oder drei weitere Stimmen fielen ein und gaben dem klagenden Gesang mit ihren kräftigen, tieferen Tönen ein Fundament. Isaac blieb stehen.
»Das sind die Schwestern«, sagte Berenguer, »die eben aufgestanden sind und die Laudes singen. Eine Buße, die ein paar tun«, murmelte er mit der Andeutung eines Lachens, »weil sie bessere Stimmen besitzen als die meisten.«
»Ein kleiner Preis für solche Schönheit. Fräulein Isabel ist Eure Nichte, Exzellenz? Ich glaube, ich habe Euch nie von ihr sprechen gehört.«
»Dafür gibt es gute Gründe, mein Freund. Und um es noch einmal deutlich zu sagen, sie ist meine Nichte, das Kind meiner Schwester, nicht etwa eine Verfehlung aus meiner Jugendzeit«, sagte der Bischof, während sie darauf warteten, daß Sor Marta das Klostertor öffnete. »Geboren zu einer überaus glücklichen Stunde, vor siebzehn Jahren. Ein sittsames Mädchen, aber beherzt, mit einem gescheiten Kopf und einer schlagfertigen Zunge. Ich habe sie sehr gern.« Er blieb stehen, damit sie die Treppe zusammen hinuntergehen konnten. »Seit dem Tod ihrer Mutter bin ich Vormund. Ich beherberge sie hier, wo ich ihre Erziehung überwachen kann.«
Jemand glitt auf Isaacs Seite an ihnen vorbei und ließ einen schweren Duft von Moschus und Jasmin zurück, der von tierhafter Angst überlagert war. Gehetzte, nervöse Frauenschritte verloren sich im Tumult des Hofes, wo das Gefolge des Bischofs inmitten von Pferdegetrampel und Harnischklirren wartete. Der Duft der Frau wurde von den Gerüchen der Nacht verschluckt: Pferde, brennende Fackeln, Männerschweiß. Eine scherzende Bemerkung lag Isaac auf den Lippen, doch er unterdrückte sie. Es war nicht seine Angelegenheit, wenn eine Nonne meinte, ein mitternächtliches Rendezvous einhalten zu müssen. »Ist die Nacht dunkel?« fragte er den Bischof.
»Wie die tiefste Hölle«, antwortete Berenguer und klopfte seinem Freund gutmütig auf die Schulter. »Der Mond ist untergegangen und hat die Sterne anscheinend mit sich genommen. Ihr werdet mich durch die Straßen führen müssen.« Der Bischof gab seinem Gefolge ein Zeichen, den Abstand hinter ihnen zu wahren, und die zwei Männer schlugen zu Fuß den Weg ein, der dem Fluß Galligants folgte und sie zum nördlichen Stadttor und schließlich in die Stadt selbst führen würde.
Die geängstigte Nonne entwischte durch die Menge vor dem Haupteingang des Klosters. Sie zog ihr Kopftuch zurecht, um ihr bleiches Gesicht und den weißleinenen Nonnenschleier zu verbergen und wurde umgehend vor der benachbarten Mauer unsichtbar. Mit zitternden Fingern tastete sie sich die Wand entlang und spähte in die Dunkelheit, bis sie den Punkt erreichte, wo sie sich im offenen Gelände zwischen Fluß und Anger wiederfand. Die Strecke vom Kloster bis zur Brücke, die sie zum arabischen Bad führen würde, erschien ihr endlos. Sie kam sich so auffällig vor wie eine schwarze Katze in einem weißen Schneefeld. Endlich stolperte sie den Pfad zur Tür hinunter, direkt in Romeus Arme. Er legte ihr eine Hand auf den Mund, um ihren Aufschrei zu ersticken und zog sie in das Gebäude.
»Wo ist sie?« zischte er scharf.
»Ich konnte nicht an sie herankommen. Sie ist krank – sterbenskrank. Man sagt, es gebe keine Hoffnung mehr für sie. Ich konnte doch unmöglich ...« Sie brach in einen Tränenschwall aus.
»Ihr und Eure Freundin hättet sie tragen können.«
»Sie liegt im Krankenzimmer und wird vom Arzt und einer ganzen Schar Nonnen betreut. Habt Ihr den Jungen?«
»Sein Kindermädchen bringt ihn. Zum Osttor.«
»Wie habt Ihr sie dazu gebracht?« fragte sie erstaunt.
»Ihr wurde gesagt, es handele sich um einen Befehl Seiner Majestät. Wir brauchen sie. Wir wollen doch keinen wimmernden Säugling am Hals haben, oder?«
»Bitte. Laßt uns den ganzen Plan vergessen«, sagte sie mit Nachdruck. »Es ist zu gefährlich. Es kann nicht gutgehen.«
»Zu spät. Das Kindermädchen wird bei Sonnenaufgang am Osttor sein. Und es sind noch andere beteiligt. Es wäre für alle gefährlich, wenn wir jetzt versuchen würden umzukehren.« Er schloß das Thema mit einer beiläufigen Handbewegung ab. »Wußtet Ihr denn nicht vorher, daß Fräulein Isabel im Sterben liegt?« fügte er erregt hinzu.
Sie schwieg. Sie schwieg lange. Er schüttelte sie, und sie begann von neuem. »Ich werde das Kind nehmen. Ich werde zu Ihrer Majestät gehen und sagen, daß ich Gerüchte über ein Komplott vernommen hätte, daß ich den Prinzen aus Sorge um sein Leben von seinem Aufenthaltsort entfernt und zu ihr gebracht hätte. Sie wird mir vergeben. Sie hat ein aufbrausendes Gemüt, aber ein vergebendes Wesen.«
»Ihr seid nicht nur unfähig, Ihr seid auch noch dumm dazu«, sagte er. »Und wenn sie fragen, wer Euch geholfen hat, was sagt Ihr dann?«
»Ich würde Euch nie verraten. Niemals.«
»Wie günstig für mich«, sagte er kalt, »daß Ihr dazu keine Gelegenheit haben werdet.«
»Wie könnt Ihr es wagen, so mit mir zu sprechen?« erwiderte die Frau und sammelte, was ihr an Ehre und Standeswürde geblieben war.
»Ich wage es, weil mir nichts anderes übrigbleibt, wenn wir beide überleben wollen. Seid vernünftig, Gnädigste. Wartet hier auf mich. Ich habe Dinge zu erledigen. Sollte ich beim ersten Tageslicht nicht zurückgekehrt sein, so sucht uns draußen vor dem Osttor. Ich habe Eure Kleider mitgebracht. Zieht Euch um, bevor ich zurück bin.«
»Was könnt Ihr über die Ursache der Krankheit meiner Nichte sagen?« fragte Bischof Berenguer betont beiläufig, als sie gemächlich durch die Dunkelheit schlenderten. Die lodernden Fackeln hinter ihnen warfen genug Licht, so daß Berenguer den Weg vor sich erkennen konnte. Für Isaac war die Straße ohnehin zu vertraut, als daß er irgendeiner Führung bedurft hätte.
»Es gibt viele mögliche Ursachen, Exzellenz«, erwiderte Isaac mit großer Vorsicht. »Es könnte der Stich eines Insekts gewesen sein, durch dessen Gift die Wunde schwärt und eitert. Wäre Fräulein Isabel ein Soldat oder ein Haudegen, so würde ich sagen, daß die Krankheit durch Vernachlässigung einer kleinen Wunde, die dann zu eitern begann, ausgelöst wurde.«