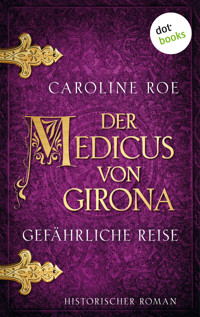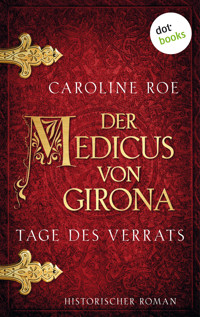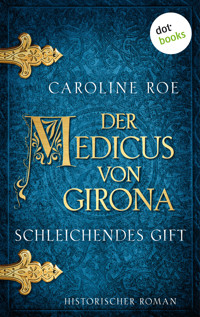
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Chroniken von Isaac von Girona
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Stadt in Aufruhr: Der packende historische Krimi »Der Medicus von Girona – Schleichendes Gift« von Caroline Roe jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn die Heimtücke zuschlägt ... Girona im 14. Jahrhundert: Als ein Bäckerssohn, der bis vor kurzem noch kerngesund war, plötzlich mit dem Tod ringt, wird eilends der Medicus Isaac geholt. Doch für den jungen Mann kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt qualvoll und unter Wahnvorstellungen. Kurz darauf ereilt dasselbe Schicksal einen Weber und einen Wollhändler. Isaac ist sich sicher, dass ein seltenes Gift sie getötet haben muss. Unterstützt von seiner Tochter Raquel begibt er sich auf die Suche nach dem heimtückischen Mörder. Die Zeit drängt, denn je länger seine Suche dauert, desto mehr brodelt es in der Stadt: Ein wütender Mob fordert Vergeltung. Die Schuldige soll eine Hexe sein – und verdächtigt wird ausgerechnet Raquel! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Medicus von Girona – Schleichendes Gift« von Caroline Roe ist der zweite Band ihrer mitreißenden Reihe historischer Krimis um den ermittelnden Medicus Isaac. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn die Heimtücke zuschlägt ... Girona im 14. Jahrhundert: Als ein Bäckerssohn, der bis vor kurzem noch kerngesund war, plötzlich mit dem Tod ringt, wird eilends der Medicus Isaac geholt. Doch für den jungen Mann kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt qualvoll und unter Wahnvorstellungen. Kurz darauf ereilt dasselbe Schicksal einen Weber und einen Wollhändler. Isaac ist sich sicher, dass ein seltenes Gift sie getötet haben muss. Unterstützt von seiner Tochter Raquel begibt er sich auf die Suche nach dem heimtückischen Mörder. Die Zeit drängt, denn je länger seine Suche dauert, desto mehr brodelt es in der Stadt: Ein wütender Mob fordert Vergeltung. Die Schuldige soll eine Hexe sein – und verdächtigt wird ausgerechnet Raquel!
Über die Autorin:
Caroline Medora Sale Roe (1943–2021) lebte in Kanada. Sie war Doktorin der Mediävistik und als Lehrerin sowie als Übersetzerin tätig, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Unter dem Pseudonym Medora Sale schrieb sie erfolgreich kontemporäre, und unter Caroline Roe historische Kriminalromane. Sie war verheiratet mit dem Mediävisten Harry Roe und hatte mit ihm eine Tochter.
Caroline Roe veröffentlichte bei dotbooks bereits »Der Medicus von Girona – Tage des Verrats und »Der Medicus von Girona – Gefährliche Reise«.
***
eBook-Neuausgabe November 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Cure for a Charlatan« bei Penguin Group, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Der blinde Heiler von Girona« bei Rowohlt
Copyright © der englischen Originalausgabe 1999 by Caroline Roe
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Artyzan, LiliGraphie, Prokrida
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-269-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Medicus von Girona – Schleichendes Gift« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Caroline Roe
Der Medicus von Girona – Schleichendes Gift
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Marc Staudacher
dotbooks.
Dieses Buch ist in herzlichster Zuneigung
Bella Pomer gewidmet,
deren Zuversicht, Energie
und kritischer Blick
mich niemals im Stich gelassen haben
Die Personen
Das jüdische Viertel
Isaac, der Arzt
Judith, seine Frau
Nathan und Miriam, Zwillinge, die jüngsten Kinder
Rebecca Mallol, die älteste Tochter, von ihren Eltern getrennt lebend
Raquel, Isaacs Zweitälteste Tochter und Helferin
Naomi, Leah und Ibrahim, die Hausangestellten
Yusuf, Isaacs Lehrling, eine maurische Waise aus Granada
Mossé, ein Bäcker
Esther, seine Frau
Daniel, ihr ältester Sohn und Erbe seines Onkels Ephraim
Aaron, ihr jüngerer Sohn
Sara, ihre zehnjährige Tochter
Mordecai, ein wohlhabender Geschäftsmann
Bianca und Dalia, seine Töchter
Ephraim, ein Handschuhmacher
Dolsa, seine Frau
Salomo des Mestre, Sohn des Bankiers und Yusufs junger Tutor
Abraham Ravaya, Astruch Caravida, Astruch des Mestre, Bonastruch Bonafet, Mahir Ravaya, Vidal Bellshom, allesamt Ratsmitglieder
Die Kathedrale
Berenguer de Cruilles, Bischof von Girona
Francesc Monterranes, rechte Hand und erster Ratgeber des Bischofs
Bernat sa Frigola, sein Sekretär
Nicholau Mallol, bischöflicher Schreiber und Ehemann Rebeccas
Carles Mallol, ihr zweijähriger Sohn
Lorens, ein Seminarist
Bertran, Seminarist und Cousin des Bischofs
Marieta, Wirtin des Etablissements
Guillem de Montpellier, Gelehrter, Magus und Logiergast Marietas
Lup, sein Diener
Hasan, genannt Ali, Guillems Sklave
Zeynab, genannt Romea, Flötenspielerin und Tänzerin, Sklavin Marietas
Die Stadt
Ramon, ein Weber
Marc, sein Sohn
Pons Manet, ein wohlhabender Wollfabrikant
Joana, seine Frau
Jaume, ihr ältester Sohn
Francesca, ihre Schwiegertochter
Der Gerichtshof
Francesc Adrober, Richter und Gerichtsvorsteher
Guillema, eine Prostituierte, und Venguda de Costa, eine verheiratete Frau, die Opfer
Tomas de Costa, Marc de Puig, Pere Vives und Bernat, die Angeklagten
Kapitel 1
Freitag, 18. August 1333
»Wie viel?«, murmelte der dünne, asketisch anmutende Mann so beiläufig wie jemand, dessen Gedanken höheren Dingen gelten. Er trug das nüchterne schwarze Gewand eines Gelehrten oder Priesters und wirkte in dem schäbigen Raum der abgewirtschafteten Schänke fehl am Platz. »Das haben wir doch ganz gut hinbekommen. Es ist an der Zeit, gen Süden aufzubrechen.«
Draußen lag die Stadt Girona still und schläfrig und wartete geduldig darauf, dass der Abend Abkühlung brachte. Der Schankraum war dunkel und eng; die Atmosphäre gemahnte noch immer an verschütteten Wein und die längst heimgegangenen Gäste. Nicht der kleinste Lufthauch drang durch die geöffneten Fensterläden. Fliegen summten träge umher, so als wären sie nicht richtig bei der Sache. Rodrigue, der Wirt, döste schwitzend in einer Ecke und ignorierte seine beiden einzigen Gäste.
»Das nennst du gut hinbekommen?«, erwiderte der zweite Mann verächtlich und schwenkte einen Sack mit Münzen vor dem Gesicht seines Begleiters hin und her. »Hör mal zu, Guillem, mein bescheidener, kleiner Freund. An einem guten Tag nimmst du genug für ein Zimmer und einen Teller Suppe ein.«
»So schlecht ist es nun auch wieder nicht gelaufen«, entgegnete Guillem empört.
»Ich rede von Gold, du Narr. Gold! Genug, um davon zu leben wie ein Fürst.«
»Du bist verrückt«, sagte Guillem. »Girona mag zwar voll von gut genährten Kaufleuten und ihren in Seide gehüllten Frauen sein, aber deswegen verschleudern die ihr Gold noch lange nicht für Kleinigkeiten.«
»Das ist allerdings wahr. Demnach bleibt umso mehr für uns übrig.«
Er schüttelte skeptisch den Kopf. »Nur, wie kriegen wir es in die Finger?«
»Darüber mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß, wer es hat und wie wir es kriegen.«
Guillem beugte sich vor. »Dir scheint es ernst zu sein«, sagte er verwundert. Und noch bevor sein Gegenüber antworten konnte, fragte er: »Wie gefährlich ist das Ganze?«
Der andere warf ihm einen neugierigen Seitenblick zu. »Es ist kein Verbrechen, Gestohlenes zu stehlen«, sagte er.
Der Gelehrte biss sich auf die Lippe, eine nervöse Geste, die seinen Begleiter reizte. Schließlich fragte er: »Also, wie fangen wir es an?«
»Mama?«, fragte Miriam.
»Was willst du?«, entgegnete Judith, die Frau von Isaac, dem Arzt, barsch. Sie war von Natur aus keine sonderlich langmütige Frau, und ihre begrenzte Geduld war an diesem Morgen bereits empfindlich strapaziert worden. Der Sommer hatte sich unbarmherzig bis in den September gezogen, und ihr war heiß unter ihrem dunklen Schleier. Die schattigen Hauptstraßen und Unterführungen der Call, des prosperierenden jüdischen Viertels von Girona, muteten wie ein riesiges Bad an, das aufgeheizt wurde von der stechenden Sonne, die den feuchten, von den Flüssen aufsteigenden Dunst vertilgte. Judith ging keuchend und schwitzend die hügelige Straße hinauf.
Leah, ihr Hausmädchen, hatte sich an diesem Morgen schwindlig und von Kopfschmerz geschwächt gefühlt und war im Bett geblieben. Die Köchin Naomi hatte sich in der Küche verschanzt und hantierte wütend mit Töpfen und Geschirr, dass es nur so schepperte; Miriam schließlich war ihrer Mutter hinterhergelaufen und wollte unterhalten werden. Judiths durchorganisierter Haushalt war im Begriff, nach allen Seiten hin auseinander zu fallen.
Schuld daran war ihr Mann. Isaac, normalerweise der denkbar gütigste Gatte, hatte die ganze Nacht bei einem kranken Kind gewacht, und auch seine Geduld ging nun langsam zu Ende. Er war hungrig und durstig zum Frühstück zurückgekommen. Judith hatte eine herrliche reife Birne gepflückt und sie ihm mit einem verlockenden kleinen Brötchen auf einem Teller serviert. »Ist das alles?«, hatte er gefragt. »Soll ich wegen dem bisschen Hitze etwa fasten?«
Noch während er sprach, war Naomi in den Hof getreten, und seine Spitze prallte an der Brust ihres Adressaten, seiner Ehefrau nämlich, ab, um sich geradewegs in das verletzliche Herz der Köchin zu bohren.
»Papa«, flüsterte Raquel, »Naomi steht direkt neben uns.«
Isaac, der sich über sich selbst und seinen Schnitzer ärgerte, den er seiner Blindheit zu verdanken hatte, stand abrupt vom Tisch auf, wobei er einen Wasserkrug umstieß; er zog sich in sein Arbeitszimmer zurück. Naomi verbarrikadierte sich, dampfend vor gekränktem Stolz, in ihrer Küche und verwandelte das solide Steinhaus mit ihren Vorbereitungen in ein regelrechtes Inferno. Da Leah im Bett lag und der Küchenjunge zum Schüren der Feuer gebraucht wurde, degradierte die Köchin Ibrahim, den Hausdiener, zum Botenjungen. Doch als er von ihr den Auftrag erhielt, ein drittes Mal auf den Markt zu gehen, löste sich seine gewohnte phlegmatische Gleichgültigkeit in Luft auf. Kochend vor gerechter Wut, baute er sich vor seiner Herrin auf. Der Hof war ebenso wenig gefegt wie das Haus oder das Arbeitszimmer des Hausherrn; wann sollte er denn bitte schön ihrer Meinung nach seine eigene Arbeit erledigen? Judith unterdrückte den Wunsch, die gesamte Dienerschaft zu entlassen, mit Ausnahme vielleicht des Küchenjungen, der ja bereits unter der vollen Wucht von Naomis Wutausbrüchen zu leiden hatte, und fing an, Ordnung in das Chaos zu bringen. Sie stimmte Ibrahim versöhnlich, indem sie ihm versprach, den Gang zum Markt selber zu tätigen, trug ihrer Tochter Raquel auf, die Betten zu machen, schnappte sich dann die schmollende Miriam und verließ fluchtartig das Haus.
»Und? Was ist denn nun?«, fragte sie ihre jüngste Tochter.
»Warum kann ich denn nicht mit Nathan zur Schule gehen, Mama? Papa sagt, Mädchen sollten genauso zur Schule gehen wie Jungs. Und außerdem bin ich auch schon sieben. Mir ist langweilig, keiner ist zum Spielen da und alle sind böse auf mich.«
»Du kannst eben nicht, und jetzt basta«, erwiderte Judith. »Ich will nichts mehr davon hören. Wenn du mal mit dem Gejammer aufhören und dich etwas nützlich machen würdest, dann wäre auch niemand böse auf dich. Und jetzt komm schon.«
Sie zerrte ihre Tochter mit finsterer Miene die Hauptstraße des Viertels entlang und marschierte dann stracks mit ihr durch das Tor am nördlichen Rand. Sie kamen am Fuße des Hügels heraus, der zur Kathedrale hinaufführte, und Judith machte einen vergeblichen Versuch, sich etwas abzukühlen, indem sie eine kleine Verschnaufpause im Schatten einlegte.
»Wo gehen wir denn hin, Mama?«
»Das wirst du schon sehen, wenn wir da sind.«
Eine schwache Brise aus westlicher Richtung kam über die hohe Stadtmauer geweht und brachte den Geruch von Hefe, warmem Brot und Gewürzen mit sich. Judith zog ihren Schleier dichter vor ihr Gesicht, griff Miriam fest am Arm und bog in die Straße ein, die zur Bäckerei hinunterführte. Sie passierten die Körbe mit frischem Brot, die an der Eingangstür standen, und gingen auf eine rotgesichtige Frau zu, die hinter ihrem Arbeitstisch stand und einen stattlichen Berg frischen Teiges betrachtete. Ein stämmiges zehn- oder elfjähriges Mädchen nahm die fertigen Laibe aus dem Ofen und legte sie in ein Holzgestell im hinteren Bereich des Bäckerladens.
»Morgen, Frau Judith«, sagte die Bäckersfrau und sah überrascht auf.
»Guten Morgen, Frau Esther«, antwortete Judith, während sie sich stirnrunzelnd nach dem speziellen runden Brotlaib umsah, den Naomi für das heutige Abendessen für so unerlässlich hielt.
»Schöner Tag heute. Womit kann ich Ihnen denn dienen? Hat Ibrahim heute Morgen etwas vergessen?«, fragte Esther, um die Frau des Arztes diplomatisch daran zu erinnern, dass sie ja bereits all das nötige Brot hatte – nur für den Fall, dass Judith das Geschäft etwa aus Geistesabwesenheit noch einmal aufgesucht hatte. »Ein Gewürzbrötchen für ein hungriges kleines Mädchen vielleicht?«
Doch Miriam war schon in dem höhlenartig überwölbten hinteren Ladenbereich verschwunden und beobachtete fasziniert das Schauspiel, wie die junge Sara die abgekühlten Brote in Körbe packte, um sie dann nach vorn zu tragen.
»Ibrahim!«, sagte Judith bedeutungsschwer und begann mit der Schilderung der betrüblichen Vorfälle dieses Morgens: die Übellaunigkeit der Köchin, die Gedankenlosigkeit ihres Mannes und die allgemeine Meuterei und Bockigkeit der Hausbewohner, seien es nun die Angestellten oder die eigenen Kinder. »Und hier stehe ich nun, das Haus voller Diener, die mir die Haare vom Kopf fressen und unglaubliche Löhne einstreichen und die weniger im Haus zu tun haben, als sich irgendjemand vorstellen kann … und muss selber auf den Markt gehen! Ich weiß einfach nicht, was in die alle gefahren ist«, sagte sie. »Früher waren die Leute froh, wenn sie hart arbeiten und ein ehrbares Leben führen konnten, aber jetzt …« Sie gab sich einem viel sagenden Schweigen hin. »Und was macht denn Ihr hier eigentlich, Ihr und Sara, Backen und gleichzeitig den Laden führen? Wo sind denn bloß alle?«
Die Bäckersfrau zuckte die Achseln. »Mossé ist zur Mühle. Und Aaron ist – na ja – Ihr wisst ja, wie er in letzter Zeit ist. Der neue Lehrling ist schon wieder krank, seine Mutter kümmert sich zu Hause um ihn, sagt er, und der Junge schläft irgendwo tief und fest, schätze ich mal. Nicht, dass er eine Hilfe wäre. Unser Hausmädchen ist fortgegangen, um zu heiraten, und das neue Mädchen stümpert gerade in der Küche herum.« Während sie sprach, bestreute sie den Teig mit Mehl, strich ihn glatt und wendete ihn mit geübten Handgriffen.
Judith hatte den größten Teil dieses Klageliedes bereits gehört, doch es war offenkundig, dass ihr einige wichtige Neuigkeiten entgangen waren, die den Gesundheits- und Geisteszustand des jüngeren Bäckerssohnes betrafen. Sie vergaß also für einen Moment ihre eigene häusliche Misere und wandte Esther ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu.
»Aber die Zeiten haben sich gewandelt, Frau Judith«, sagte nun diese ehrbare, hart arbeitende Frau, während sie anfing, den Teig zu kneten. »Nehmt zum Beispiel unsere Jungen.« Bei jedem Halbsatz wendete sie den Teig, schlug ihn klatschend um oder boxte ihn, als hätte sie den robusten Schädel ihres Mannes unter ihren Händen. »Ich hab es Mossé immer und immer wieder gesagt: Daniel auswärts in Lehre zu geben – auch wenn es bei meinem Bruder ist – stellt einen Schlag ins Antlitz unseres Herrn dar, der uns nun einmal einen gescheiten Erstgeborenen geschenkt hat, der das Geschäft nach uns weiterfuhren könnte. Aber er hört ja nicht auf mich«, sagte sie und unterstrich ihre Worte mit einem besonders kräftigen Hieb in den Teig. »Egal, wie oft er sich schon geirrt hat, er hört immer noch nicht auf mich.«
»Aber ist Aaron denn nicht –«
»Ach, Aaron bemüht sich, ja«, sagte Esther, »aber er wird nie so ein Mann sein wie sein Bruder.«
»Ich weiß, dass Isaac ihn besucht hat«, sagte Judith und schnitt ein heikles Thema an. Die Diskretion ihres Ehemanns, wenn er über seine Patienten sprach, war ihr ein ewiger Quell des Ärgers. Sie erfuhr von den Leiden und Klagen ihrer Nachbarn ausnahmslos von Dritten, die dann glucksend lachten und so taten, als überrasche sie Judiths Unwissenheit. »Geht es ihm besser?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Esther mit einem Seufzer. »Danke, Herr«, sagte sie automatisch zu einem Kunden, der für ein kleines Brot eine Münze in ihren Geldtopf warf. »Manchmal glaube ich, dass es immer schlimmer mit ihm wird. Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Und das ist nicht meine einzige Sorge.« Sie senkte ihre Stimme und beugte sich zu Judith vor. »Ein Dieb geht um. Ich habe heute das Geld gezählt, weil Mossé zur Mühle ist, und ich bin fast sicher, dass etwas fehlt. Und das ist nicht das erste Mal. Ich prüfe nämlich alles sehr genau.«
Judith bestätigte, dass genaue Kontrolle äußerst wichtig sei. »Vielleicht hat Mossé –«
»Nein, da sagt er mir jedes Mal Bescheid. Er hat eine Münze rausgenommen, um das Korn zu bezahlen, aber es fehlt mehr. Es gibt nur unseren einen Schlüssel zu der Kasse, und den trage ich immer am Leib. Ich weiß also nicht, wie das Geld verschwunden sein könnte, es sei denn, er hat mir den Schlüssel abgenommen, während ich schlief.« Sie hielt inne und sah zu den beiden Kindern hinüber, die über irgendetwas kicherten. »Es sei denn, er gibt es irgendeiner Frau. Und wenn er das tut, Frau Judith, dann ist er nicht zu beneiden, wenn ich herausfinden sollte, wer sie ist. Und sie wird noch weniger zu beneiden sein.«
Judith betrachtete Esthers markanten Kiefer und ihre muskulösen Arme und musste ihr stillschweigend zustimmen. Mossé würde zweifellos nicht zu beneiden sein. Um Mossés und ihrer selbst willen hoffte Judith, dass es ein Dieb gewesen war. Mossé war ein guter Bäcker; er hatte ein besseres Händchen als der alte Ruca. Sie hätte ihn nur äußerst ungern verloren.
»Und niemand sonst hätte –«
»Mit Sicherheit nicht. Wer sollte denn sonst den Schlüssel haben? Und die Schatulle ist sehr stabil. Da steckt eine Frau dahinter, oder es ist Hexerei, wenn Ihr meine Meinung hören wollt.«
»Da sind auch noch Eure Söhne«, sagte Judith.
»Nicht mal Mossé wäre so blöd, diesen zwei Rotznasen den Schlüssel zur Schatulle zu überlassen«, antwortete die Bäckersfrau voller Verachtung.
»Daniel muss doch beinahe zwanzig sein, Frau Esther. Er ist ein Mann.«
»Und wenn schon. Bedenkt doch die Versuchung! Und der ganze Ärger, in den sie geraten könnten mit so viel Extrageld. Frauen. Alkohol.« Wieder senkte sie ihre Stimme. »Unaussprechliche Sünden und Verwerflichkeiten.« Ihre Augen leuchteten vor Erregung. »Nicht etwa, dass wir reich wären«, fügte sie eilig hinzu, »nein, das ist unser Geld für die Abgaben, die Pacht für den Laden und auch unser Notgroschen. Nein – die Jungen wissen ja nicht einmal, wo wir das Geld aufbewahren.«
Judith bezweifelte dies und griff nach dem runden Brot, dessentwegen sie gekommen war.
»Außerdem würde Aaron uns niemals bestehlen«, fügte seine Mutter hinzu.
»Natürlich nicht«, sagte Judith, die bei sich dachte, wie wenig doch Esther und Mossé über ihre eigenen Kinder Bescheid wussten.
»Er war immer der Stille und Brave von den beiden. Wenn es Daniel gewesen wäre, der hier gewohnt hat, tja –« Sie nickte vehement mit dem Kopf. »Das könnte ich mir vorstellen. Der würde sogar etwas Geld stibitzen, nur um zu beweisen, wie leicht das ist. Als Schabernack. Aber dann würde er es mir sagen und das Geld zurückgeben, und wir würden beide drüber lachen. So einer ist das.«
»Hat er das denn schon einmal gemacht?«
»Nun ja –« Esther schien sich nicht ganz sicher zu sein. »Das letzte Mal als achtjähriger Knirps, als er etwas Zuckerzeug aus einem verschlossenen Schrank stahl.«
»Was ist denn nun eigentlich mit Aaron los?«, fragte Judith, die der Gedanke an das Chaos daheim so direkt werden ließ.
»Meiner Meinung nach ist es die Tochter vom alten Mordecai«, sagte Esther.
»Dalia?«, fragte Judith. Mit sechzehn war der schüchterne, linkische Aaron ein eher unwahrscheinlicher Kandidat, wenn es darum ging, der lebhaften Tochter des reichen Kaufmannes nachzustellen.
»Dalia. Er verzehrt sich regelrecht nach ihr. Ich weiß es. Bloß, dass er so schüchtern ist, dass er augenblicklich puterrot wird und fortläuft, sobald sie den Laden betritt.« Der Rhythmus des Wendens, Umschlagens und Klatschens wurde wieder schneller. »Das ist eine kleine Füchsin, müsst Ihr wissen – sie quält und neckt ihn jedes Mal, wenn sie ihn sieht. Aber Mordecai ist ein reicher Mann, ein reicher Mann ist das. Sein Keller ist voll von dem Geld, das er mit seinen Stiefeln verdient hat, bevor er sich anderen Dingen zugewendet hat. Auch kein Wunder, bei den Preisen. Nicht wie wir, die wir nur soundso viel für einen Laib nehmen können und davon noch die Kosten für das Korn, das Feuerholz und die Abgaben bestreiten müssen. Immer diese Abgaben! Wie soll eine Familie da vorwärts kommen? Außer, wenn einer gut einheiratet. Und jedes Mal, wenn ich ihm eine gute Partie vor schlage, wird er wütend. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Neulich«, fügte sie hinzu und sprach nun wieder leiser, »hat er gesagt, dass er gar nicht Bäcker werden will. Er sagte, er will ein Gelehrter werden – Geistlicher. Mossé ist ganz fassungslos.«
»Ein Lehrer? Oder ein Rabbi?«, fragte Judith erstaunt. »Aaron?«
»Nein«, erwiderte seine Mutter. Ihre geschäftigen Hände hielten inne. »Nicht einmal das. Etwas anderes. Er ist ruhelos, schläft nicht und stromert die ganze Nacht in der Gegend herum. Es muss Liebe sein«, sagte sie beklommen. »Was könnte es denn sonst sein? Er ist ständig so müde, dass er kaum einen Sack Mehl anheben kann, doch anstatt sich auszuruhen, wenn Zeit dazu ist, verschwindet er abends – Gott weiß wohin. Meint Ihr, Meister Isaac kann ihn kurieren?«
»Von der Liebe?«, fragte Judith. »Ich glaube, das kann nicht einmal mein Mann.«
An diesem Abend hatten sich fünfzehn oder zwanzig Männer auf dem Anger jenseits des Flusses Onyar versammelt und hörten dem Gelehrten aus der Schänke zu. Er hatte schon über eine Viertelstunde gesprochen, und der Großteil seiner Zuhörerschaft starrte ihn apathisch und verständnislos an, so wie Kühe auf dem Feld einen Wanderer anglotzen. Sie warteten einfach ab, bis etwas Unterhaltsameres passierte. Einige wenige jedoch betrachteten ihn mit lebhafter Neugier, und drei junge Männer in der ersten Reihe hörten ihm gar mit brennendem Interesse zu. Am Rande der Menge las ein kleiner Junge gelangweilt und ungeduldig einen Stein auf, hob den Arm und holte zum Wurf aus. Der Begleiter des Redners – er war in ein ärmliches, abgewetztes Flickengewand gehüllt, hatte zerzauste graue Haare und ein vernarbtes Gesicht – bekam den Jungen am Handgelenk zu fassen und drückte zu.
»Au!«, jaulte der Junge. »Ihr tut mir weh!«
»Gut«, sagte der Mann. »Vergiss das nicht. Beim nächsten Mal erwischt es nämlich nicht bloß dein Handgelenk. Und jetzt verzieh dich!«
Der Junge wirbelte herum und rannte in das hohe Gras am Rande des Angers, wo er zwischen den trockenen Halmen und büscheligen Ähren verschwand, die allesamt so hoch aufragten, wie jeder einzelne der anwesenden Männer groß war.
»Freunde«, sagte der Redner, ohne weiter auf den läppischen Zwischenfall zu achten, »das Wenige, was ich, Meister Guillem de Montpellier, Euch soeben mitgeteilt habe, ist nur eine kleine Kostprobe der Weisheit der Alten, des verborgenen Wissens der Magie, das ich an der Universität zu Montpellier sowie von verschiedenen Astrologen, Sehern und Mystikern gelernt habe, die ich auf meinen Reisen durch die Welt aufgesucht habe. Indem Ihr die Worte sprecht, die ich Euch lehren will, sämtlich heilige Worte und keines von ihnen von Hexerei oder Ketzerei befleckt, und indem Ihr von den Kräutern Gebrauch macht, von denen ich Euch erzählen will, werdet Ihr in der Lage sein, Eurem Körper Gesundheit und Kraft zurückzugeben, Euren Geist zu stärken und das nötige Wissen zu erlangen, um jene Dinge zu verstehen, die Euch noch verborgen sind. Und diese werden Euch Gesundheit, Weisheit und Wohlstand verleihen.«
»Und was ist mit göttlicher Gnade?«, fragte einer der drei jungen Männer, der ebenfalls wie ein Geistlicher gekleidet war.
»Dafür müsst Ihr schon in die Kirche gehen«, erwiderte der Redner rasch. »Sie wird Euch lehren, die Gnade zu empfangen. Ich bitte Euch nun ergebenst, so Ihr das eben Genannte zu lernen bereit seid, dass Ihr meinem Freund und Helfer Lup, wenn er bei Euch vorbeikommt, gebt, was Ihr könnt, damit wir unser Brot kaufen und den Armen helfen können.«
»Ich kann mir schon denken, was das für Arme sind, denen die helfen wollen«, sagte ein wohlhabend aussehender Herr im Hintergrund zu seinem Nebenmann.
»Arme Schankwirte und Dirnen?«, erwiderte der andere.
»Solche Leute sind mir schon früher begegnet. Aber bald werden sie fort sein. Und die beiden da riechen förmlich nach Offizieren.« Er deutete mit einem Kopfnicken auf zwei berittene Männer, die in schnellem Galopp auf die Wiese zugeprescht kamen.
Als sie im Licht der untergehenden Sonne die Straße nach Girona zurückschlenderten, hörten sie die Rufe und Jubelschreie der kleinen Menschenansammlung sowie die durchdringende Stimme von Meister Guillem. »Wir treffen uns morgen wieder«, rief er soeben. »Und Ihr wäret Narren, wenn Ihr versuchtet, mich zum Schweigen zu bringen, wo ich den Bewohnern der Stadt doch Reichtum und Gesundheit bringen kann.« Die beiden wohlhabend aussehenden Männer grinsten einander zufrieden an und gingen dann getrennte Wege.
Die Offiziere sahen gelangweilt aus und klangen auch so. »Wir haben nicht vor, Euch zum Schweigen zu bringen, Meister Guillem«, sagte der eine. »Wir wollen, dass Ihr eine Genehmigung einholt, die Euch gestattet, in der Öffentlichkeit zu sprechen.«
»Aber wir befinden uns hier doch eindeutig außerhalb der Stadttore«, wandte Guillem ein.
»Nichtsdestotrotz müsst Ihr eine schriftliche Erlaubnis haben.«
»Damit Ihr eine fette Gebühr einkassiert«, murmelte Lup und stopfte seinen Geldsack zur Sicherheit tiefer unter sein Gewand. Er blickte Meister Guillem an, wies mit einem Kopfnicken auf die drei jungen Männer – schlaksige Jugendliche von sechzehn oder siebzehn Jahren – und wandte sich dann der übrigen Menschenmenge zu. »Ihr habt gehört, was der Herr gesagt hat«, rief er. »Kehrt jetzt in Eure Häuser zurück.«
Während die Versammlung sich in Bewegung setzte – die Obrigkeit hatte ihnen einen gründlichen Strich durch ihre spärliche Abendunterhaltung gemacht –, schritt Meister Guillem rasch auf die drei Jungen zu.
»Guten Abend, meine Herren«, sagte er ernst. »Es tut mir Leid, dass unsere Versammlung aufgelöst wurde. Die wackeren Männer der Stadtregierung leiden unter einer gewissen, nun ja, sagen wir, Engstirnigkeit.«
»Die sind aber nicht aus der Stadt«, bemerkte einer der Jungen.
Meister Guillem ignorierte die Zwischenbemerkung. »Seid Ihr daran interessiert,Wissen zu erlangen?«
»Das sind wir«, sagte der junge Mann, der der Anführer des Trios zu sein schien. Auch er trug ein schwarzes Priestergewand. »Aber wir wissen nicht, ob Ihr der Richtige seid, um uns derartig ehrwürdige Dinge zu lehren.«
»Das weiß ich auch nicht«, sagte Guillem mit geübter Bescheidenheit. »Es mag sein, Ihr jungen Herren, dass Eure Bildung meine Fähigkeiten bereits überschreitet. Besitzt Ihr Kenntnisse der mystischen Kräuter, die den Weg zur Weisheit bilden?«
»Wir wissen gar nichts, nicht wahr, Lorens?«, sagte der Kleinste der drei.
»Sei still, Marc«, erwiderte Lorens. »Lass mich reden. Wir sind arme Studenten«, fuhr er fort. »Wir können keine großen Summen bezahlen. Einen Pfennig von uns dreien dafür einzukassieren, dass wir ein paar Worte über die Wichtigkeit des Lernens vernommen haben, ist eine Sache; was aber verlangt Ihr, wenn Ihr wirkliches Wissen vermittelt?«
»Von Euch jeweils zehn Pfennige«, mischte Lup sich in das Gespräch. »Und das nur, weil dem Meister das brennende Interesse und die Intelligenz in Euren Gesichtern nicht entgangen ist. Normalerweise kostet das viel mehr. Denn wir haben schließlich auch Ausgaben, müsst Ihr wissen. Wir brauchen seltene Kräuter und Salben, und süßer Weihrauch ist unerlässlich, damit die Sache Erfolg zeitigt. Für uns selber springt bei zehn Pfennigen gar nichts heraus, aber der Meister ist ein freundlicher und großzügiger Mensch, immer bestrebt, jenen Weisheit zu vermitteln, die davon auch profitieren können.«
»Falls wir uns nun also entschließen, Euer äußerst großzügiges Angebot anzunehmen«, sagte Lorens trocken, »wann können wir dann Zusammentreffen? Wir können von Standes wegen über unsere Zeit leider nicht frei verfügen.«
Meister Guillem warf seinem Diener einen leicht panischen Blick zu. »Ihr werdet verstehen, werte Herren, dass wir die Gutmütigkeit anderer beanspruchen müssen, um Orte für unsere privaten Zusammenkünfte zu finden –«
»Aber wenn Ihr uns in der zweiten Stunde nach der Komplet aufsucht, wenn die Stadt schläft«, schaltete sich Lup ein, »dann werden wir Zeit und Möglichkeit haben, Euch zu beherbergen.«
»Und wo sollen wir Euch aufsuchen? Oder lebt Ihr etwa in diesem Feld?«
»Schön, wenn es so wäre«, sagte Guillem getragen, »aber das wäre zu kompliziert. Wir wohnen bei Dona Marieta in San Feliu. Sie tut Buße für ihren Lebenswandel, indem sie uns umsonst beherbergt. Jeder wird Euch den Weg zu ihrem Haus weisen können.«
»Morgen Abend wird die Präsenz der Geister stark sein«, sagte Lup. »Kommt dann, und Ihr werdet viel lernen können.«
»Ich weiß, wo das ist«, sagte der dritte junge Mann und lief krebsrot an.
»Du, Aaron?«, fragte Lorens ungläubig. »Weißt du denn auch, was sie ist?«
»Jawohl«, antwortete er gefasst. »Aber sie und ihre Mädchen essen trotzdem unser Brot.«
»Also was meint ihr?«, murmelte Lorens, nachdem die drei Burschen an einem Tisch bei Rodrigue Platz genommen hatten. Der Wirt knallte drei Holzbecher vor ihnen auf die Tischplatte, schenkte ihnen von seinem dünnsten, sauersten und billigsten Wein ein und blieb ab wartend stehen. Langjährige Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass er seinem Geld ziemlich häufig hinterherlaufen musste, wenn Lehrlinge, Studenten und andere junge Taugenichtse nicht sofort bezahlten. Nach beträchtlichem Suchen und Kramen gelang es den dreien, aus ihren Taschen genug zusammenzukratzen, um den Wirt zufrieden zu stellen.
»Du meinst, zu Meister Guillem? Zu teuer«, sagte Marc niedergeschlagen. »Ich kann mir ja gerade mal den Essig hier leisten, den Rodrigue als Wein verkauft; für Sonderausgaben bleibt da nichts übrig.«
»Lernen kostet eben immer etwas«, sagte Aaron.
»Nicht, wenn dich dein Vater unterrichtet«, sagte Marc. »Wer würde sonst schon Weber werden?«
»Musstest du Weber lernen?«, fragte Lorens. »Übernimmt nicht dein Bruder das Geschäft?«
»Wenn du es so nennen willst«, sagte Marc. »Aber es hätte meinen Vater Geld gekostet, mich anderswo in die Lehre zu geben. Dazu ist er zu knauserig.« Er hob seinen Becher. »Auf die Arbeit. Ich hasse sie. Ich haue ab, sobald ich kann.«
»Du kannst wenigstens abhauen«, sagte Aaron. »Von mir erwarten sie, dass ich ewig in der Bäckerei bleibe. Sonst heißt es nämlich gleich, dass meine Eltern im Alter am Hungertuch nagen müssen, weil ich sie im Stich lasse.«
»Dann soll deine Schwester eben einen heiraten, der das Handwerk erlernen will«, sagte Lorens. »Du bist doch nicht der Sklave deiner Eltern.«
»Was würdest du denn anfangen«, fragte Marc, »wenn du abhauen würdest?«
»Ich würde in den Norden gehen«, sagte Aaron. »Nach Toulouse oder so. Wo die Leute Poesie und Bildung zu schätzen wissen.«
»Aaron hat die ganzen neuen Gedichte abgeschrieben«, sagte Lorens. »Und viele von den alten auch.«
»Ich gebe mein ganzes Geld für Papier und Tinte aus«, sagte er mit einem verschämten Lächeln. »Und für Wein.«
»Wo hast du die Gedichte denn besorgt?«, fragte Marc.
Lorens zwinkerte. »Hat er ja nicht. Ein paar hat er von meinem Vater, andere von meinen Lehrern, und dann noch welche aus einem ganz edlen Buch vom Bischof persönlich.«
»Ich war vorsichtig«, sagte Aaron. »Ich hab sie zurückgegeben, so schnell ich konnte. Wenn sie nicht wollen, dass ich lese, warum haben sie mich dann erst zur Schule geschickt?«
»Weil sie sich dann wichtig Vorkommen«, bemerkte Lorens. »Und sie denken, es bedeutet, dass Geld in die Kasse kommt. Mein Vater ist da genauso. Aber ich bleib nicht hier. In dieser Stadt denken doch alle bloß an den Preis für Wolle und Tuch, ans Reichwerden. Ich gehe nach Montpellier, um Astronomie und Astrologie und die Logik und Mathematik der alten Griechen zu studieren. Ich werde Meister Guillem nach den dortigen Vorlesungen und den besten Lehrern fragen.« Er hob seinen Becher mit einem wehmütigen Lächeln. »Auf die Freiheit.«
»MeinVater sagt, dass nur die reichen Christen sich erlauben können, ihre Zeit mit solch müßigen Dingen wie Poesie und Mathematik zu verschwenden«, sagte Aaron. »Er will, dass ich ein arbeitsames Mädchen mit einer guten Aussteuer heirate und Wurzeln schlage. Schon allein der Gedanke daran verursacht mir Übelkeit.«
»Im Grunde genommen«, sagte Lorens, »denkt mein Vater das Gleiche. Außer was meine Heirat betrifft; schließlich will er ja, dass ich einmal Bischof werde. Ich schätze, wenn ich ein Graf wäre, dann könnte ich meine Zeit mit dem Studium von weltlichen Dingen zubringen.«
»Wenn du ein Graf wärst«, entgegnete Marc, »würdest du wahrscheinlich in irgendeinen Krieg ziehen und darin umkommen.«
»Stimmt auch wieder«, räumte Lorens ein. »Was würdest du gerne machen, wenn du nicht für deinen Vater arbeiten müsstest? Außer der Stadt den Rücken kehren?«
»Schöne Dinge erschaffen«, lautete Marcs simple Antwort. »Ich kann das zum Beispiel am Webstuhl machen, aber Papa sagt, das ist nur Zeitverschwendung und Vergeudung von guter Wolle. Nicht etwa, dass er gute Wolle verwendet«, fügte er hinzu. Allgemeine Trübsal senkte sich über die drei jungen Männer.
»Aber was ist nun mit Meister Guillem?«, fragte Aaron.
»Wir brauchen dreißig Pfennige für einen Unterricht«, sagte Lorens.
»Es könnten genauso gut dreißigtausend sein«, entgegnete Marc. »Ich habe gerade noch genug für den Wein morgen, und damit hat sich’s.«
»Ich habe fünf«, sagte Lorens. »Aber ich bin nicht sicher, ob ich im Moment noch mehr von meinem Vater kriegen kann. Er ist nicht sonderlich zufrieden mit mir. Aber ich will es versuchen.«
»Ich kann für uns alle bezahlen«, sagte Aaron. »Los, wir machen es.«
»Wirklich?«, fragte Marc erstaunt. »Das ist ziemlich viel Geld.«
»Geld? Was für Geld, Marc, alter Freund?« Ein weiterer junger Mann in Schwarz nahm an ihrem Tisch Platz und gab ein paar Freunden mit einem Wink zu verstehen, dass sie auch dazukommen sollten. »Das ist bei mir nämlich Mangelware, kann ich dir sagen. Und der Gauner auf dem Anger kann sich auch gleich abschminken, mir mein letztes Kneipengeld aus der Tasche zu ziehen.«
»’n Abend, Bertran. Wieso nennst du ihn Gauner?«, fragte Lorens.
»Aber, mein Freund Lorens, hast du ihm denn nicht zugehört? Mir sind in meinem Leben noch nie so viele Halbwahrheiten und eine so verquere Logik zu Ohren gekommen.«
»Was weißt denn du von Logik?«, fragte Lorens merklich erregt. »Und wenn du bei seinen ersten beiden Reden dabei gewesen wärst, hättest du seine Argumentation auch verstanden.«
»Wenn jemand anbietet, mich in sieben schnellen Lektionen in die Mysterien der Magi, der Sieben Weisen und weiß Gott in wessen Geheimnisse noch einzuweihen, dann weiß ich einfach, dass ich ordentlich übers Ohr gehauen werden soll.«
»Du hast uns belauscht«, sagte Aaron.
»Man kann auf dem Anger keine Privatgespräche fuhren«, entgegnete Bertran. »Wie dem auch sei; zu Wissen gelangt man durch beständige, harte Arbeit oder den Unterricht von guten Lehrern.«
»Wessen Predigt ist das denn jetzt, Bertran?« Der ganze Tisch lachte.
»Die meines Vaters«, erwiderte er und wurde rot. »Aber sie stimmt trotzdem. Und wieso wohnt dieser weise Mann eigentlich überhaupt bei Marieta?«
»Ihr Jungs wollt bei Marieta was lernen?«, fragte ein Bauer mit ledriger Gesichtshaut am Nachbartisch und grölte vor Lachen. »Die wird euch ihre Weisheit schon beibringen.«
»Passieren ’n paar ganz schön komische Sachen zurzeit«, bemerkte ein anderer. »Ich hab Geschichten gehört, die würdet ihr gar nicht für möglich halten.«
»Wir haben dieses Jahr genug Arger gehabt«, erwiderte der Bauer. »Und die Geheimnisse der Magi, wenn ihr mir mein Lauschen verzeihen wollt, klingen in meinen Ohren bloß nach noch mehr Arger. Ich würde mich an eurer Stelle aus diesem ganzen Kram raushalten. Jedenfalls im Moment. Lasst die Magi ihre Geheimnisse lieber für sich behalten.«
Eines Donnerstagmorgens gegen Ende September wurde Isaac, der Arzt, von der Stimme seiner Frau geweckt. Sie schimpfte Ibrahim aus, weil er Lärm mache, obwohl er doch wisse, dass sein Herr noch schlafe. Isaac täuschte sich nicht. Ein panischer Hilferuf der jungen Frau von Astruch hatte ihn nach Mitternacht erreicht und bis zur Erschöpfung auf den Beinen gehalten; die Kühle des Morgengrauens hatte seine Finger unbeweglich werden lassen. Er hatte den kläglichen Rest der Nacht auf der Liege in seinem Arbeitszimmer verbracht, das vom Hof aus separat zu erreichen war. Judith wollte, dass er aufstand, doch war sein Arbeitszimmer heilig, und sie zögerte normalerweise, es zu betreten, es sei denn, es handelte sich um eine ausnehmend wichtige Angelegenheit.
Nun war es wieder still im Hof. Isaac kroch aus dem Bett, öffnete die Tür und schnupperte. Trotz der ewigen Finsternis, in der er mittlerweile lebte, wusste er, dass die Sonne bereits hinter den Schleiern des Frühnebels strahlte und dass die Morgenkühle schon bald einem weiteren heißen Tag weichen würde. Er konnte den Nebel, die aufsteigende Hitze und die kräftige Sonne riechen, noch bevor die anderen sie auch nur sahen oder spürten. Gerade hatte er mit seiner systematischen und gründlichen kalten Morgenwäsche begonnen, da hörte er, wie das Tor in den Angeln quietschte und Judith, die inzwischen wieder im Hof war, sich über den jungen Salomo, den Sohn von Vidal, dem Bankier, aufregte.
Isaac hatte Salomo des Mestre für drei Monate als Lehrer für seinen dreizehnjährigen Lehrling Yusuf angestellt. Der maurische Knabe war ihm zu Beginn des Sommers regelrecht in die Arme gelaufen; das hungrige und verwahrloste Kind hatte den blinden Arzt aus einem gewalttätigen Handgemenge herausgeführt. Yusufs Vater war ein Gesandter des Emirs Abu Hadschidsch Yusuf von Granada gewesen und vor fünf Jahren im Zuge der Feindseligkeiten zwischen Don Pedro und seinem Bruder Fernando ums Leben gekommen. Mit Isaacs Hilfe war Yusuf dem persönlichen Schutz von Don Pedro, dem König von Aragon, unterstellt worden.
Yusuf war nicht nur blitzgescheit; er war als Kind sorgsam unterrichtet worden. Er hatte Arabisch in Grundzügen lesen und schreiben gelernt, bevor ihn das Schicksal auf die Straße geworfen hatte, wo ihm einzig sein Verstand und seine Sinne überleben halfen; in seiner neuen Umgebung nun war er eifrig darauf bedacht, so viel zu lernen wie nur möglich. Doch ein Blinder konnte dem Jungen nur schwerlich das lateinische Alphabet beibringen, auch nicht die Grammatik der lateinischen Sprache, in der ein Teil der umfangreichen medizinischen Literatur des Arztes ab gefasst war. Wenn der Junge die Wörter erst einmal laut lesen konnte, wollten die beiden Zusammenarbeiten; im Augenblick aber brauchte Yusuf noch einen Lehrer, der sehen konnte.
Salomo war selbst fast noch ein kleiner Junge. »Wie gefällt dir dein neuer Lehrer?«, fragte Isaac, ein paar Tage nachdem der Unterricht begonnen hatte.
»Ganz gut«, antwortete Yusuf mit der gesamten Erfahrenheit seiner dreizehn Jahre. »Er ist ein sympathischer junger Mann, Herr, und scheint sehr gebildet zu sein. Aber von der Welt versteht er nichts. Fräulein Raquel scheint es ihm ziemlich angetan zu haben«, fügte er unschuldig hinzu.
»Ach wirklich?«, entgegnete Isaac. »Und, hat er auch bei ihr einen entsprechenden Eindruck hinterlassen?«
»Ich glaube nicht. Ich denke, er ist zu jung für ihren Geschmack, aber sonst weiß ich nichts weiter darüber«, fügte er eilig hinzu. »Sie hat weder zu mir noch zu ihm etwas gesagt. Ich lese das nur in ihren Augen. Und daraus, dass sie sich gut verschleiert hält, wenn er in der Nähe ist.«
Schließlich war das kurze Gezeter draußen vorbei, und das einzige Geräusch, das Isaac jetzt noch vernahm, war Ibrahims langsames Kehren im Hof.
Isaac sprach sein Morgengebet und trat hinaus.
»Ist es zu kalt, um im Hof zu frühstücken, Isaac?«, fragte seine Frau, die ihn leicht am Arm hielt. »Wir können den Tisch auch am Kamin decken, wenn dir das lieber ist.«
»Judith, meine Liebe«, erwiderte Isaac amüsiert, »meine Patienten sind krank, nicht ich! Es ist sehr angenehm hier draußen, und es wird nicht lange dauern, dann wirst du dich wieder über die Hitze beschweren. Außerdem höre ich, wie sich unsere fabelhafte Naomi mit einem Frühstück nähert, das so lecker ist, dass selbst einem Toten das Wasser im Mund zusammenlaufen würde. Ich habe letzte Nacht viel zu tun gehabt und bin sehr hungrig. Komm, essen wir.« Naomi stellte eine dampfende Platte mit Reis und Gemüse auf dem Tisch ab, wo auch schon die üblichen Teller und Schüsseln mit verschiedenen Käsesorten, Obst und weichem Brot warteten.
»Bist du sehr spät zurückgekommen?«, fragte Judith. »Raquel schläft nämlich immer noch.«
Die Frage war weitaus komplizierter, als sie klang. Erstens ärgerte sich Judith über Leute, die unbedingt mitten in der Nacht einen Arzt kommen lassen mussten. Sollten sie doch ihre Gebete aufsagen und geduldig warten, bis die Sonne aufging, bevor sie nach ihrem Gatten schickten. Und zweitens war sie der Ansicht, dass ihre siebzehnjährige Tochter besser so bald wie möglich heiraten sollte, anstatt zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ihrem Vater das Haus zu verlassen, um ihm zur Hand zu gehen. Und schließlich wollte sie sichergehen, dass die beiden wirklich spät zurückgekommen waren und Raquel ihre verantwortungsvolle Rolle nicht nur als Vorwand benutzte, um den ganzen Morgen faul im Bett herumzuliegen.
Das alles wusste Isaac so gut, wie er wusste, was für einen Aufguss man zubereiten musste, um Kopfschmerzen zu kurieren. »Allerdings«, sagte er. »Es war sehr spät. Es überrascht mich nicht im Mindesten, dass sie noch im Bett liegt. Aber dem Sohn vom jungen Astruch geht es schon wieder besser, denke ich. Es war gut, dass sie mich gestern noch so spät gerufen haben.«
»Und mich, Papa«, rief Raquel. »Guten Morgen, Mama«, sagte sie und gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Wange. »Ich hatte im Übrigen viel zu großen Hunger, um den Morgen zu verschlafen«, fügte sie hinzu, um die beiden wissen zu lassen, dass sie gelauscht hatte. Und dann langte sie nach der Terrine mit dem Reis.
Sie hatten kaum mit dem Frühstück begonnen, als jemand an das Tor hämmerte.
»Ich seh mal nach«, sagte Isaac.
»Das tust du nicht«, entgegnete Judith. »Wer es auch ist, er kann warten! Du frühstückst erst in Ruhe zu Ende, bevor du deinen Tag beginnst. Ibrahim wird aufmachen. Wenn es wirklich so wichtig ist, wird derjenige schon hereinkommen.«
Offensichtlich war es so wichtig. Mossé, der Bäcker, kam in den Hof hereingestürzt und stammelte eine Reihe komplizierter, nahezu unverständlicher Entschuldigungen. »Bitte um Verzeihung, Meister Isaac, Herr, und Frau Judith. Und Fräulein Raquel. Dafür, dass ich Euch beim Frühstück stören muss. Ihr wart gestern Nacht ohne Zweifel lange unterwegs. Ich weiß, dass so was vorkommt. Und ich würde Euch niemals stören, wenn ich mir nicht solche Sorgen machen würde, Herr, und meine Frau ist auch ganz krank vor Kummer und Angst, also hab ich zu ihr gesagt, Esther, meine Liebe, ich gehe zu Meister Isaac und spreche mit ihm, er wird schon wissen, was zu tun ist. Nur Pfefferminztee, sonst nichts, nichts weiter – davon kann man doch nicht leben, hab ich Recht?«
»Mossé, mein Freund«, sagte Isaac, »wer ist denn der Kranke?«
»Aaron, Meister Isaac, und er ist –«
»Erzählt mir genau, was heute Morgen passiert ist, dass sich Eure Frau solche Sorgen um ihn macht.«
»Oh. Ja, also …«, sagte er undeutlich, »er ist einfach nicht aufgestanden. Sagte, er fühle sich nicht wohl.«
»Inwiefern fühlte er sich nicht wohl?«
»Ja, also –« Mossé hielt inne und sah zu Judith und Raquel. »Er hat letzte Nacht nicht gut geschlafen.«
»Komm, Raquel«, sagte Judith. »Es ist schon spät und es gibt viel zu tun. Bitte entschuldigt uns, Mossé. Wir essen in der Küche beim Arbeiten weiter.«
»Gut«, sagte Raquel. »Findest du es hier draußen nicht kühl, Mama?«
»Naomi?« Judiths Stimme hallte im ganzen Haus wider. »Komm und hilf uns die Teller reintragen.« Und Naomi kam herausgelaufen, um alles wieder an seinen Platz in der Küche zurückzustellen.
Isaac wartete, bis er hörte, wie sie sich entfernten. »Also Mossé, nun setzt Euch schon und erzählt mir, was mit Aaron nicht in Ordnung ist. Noch immer diese schrecklichen Albträume?«
»Schlimmer, Meister Isaac. Vor drei Nächten habe ich ihn schlafwandeln sehen, die Augen weit aufgerissen, aber ohne dass er etwas sah. Und die Albträume haben auch nicht aufgehört. Er schreckt vor Geräuschen zusammen, die es gar nicht gibt, und sieht in jedem Schatten an der Wand eine Gestalt. Er isst nichts und schreit seine Schwester und Mutter an, dass sie es langsam mit der Angst zu tun kriegen.«
»Was habt Ihr denn bislang für ihn getan?«
»Esther kocht ihm Pfefferminztee und Kamille und andere Kräuter für die Nacht, aber die werden nicht helfen, ich weiß es.« Der Bäcker beugte sich vor, bis Isaac seinen Atem im Gesicht spüren konnte. »Mein Sohn hat einen Feind. Oder ich habe einen Feind. Jemand hat meinen Sohn verhext. Jemand, der versucht, mich aus dem Viertel zu vertreiben. Bäcker zu sein ist eine wichtige, man könnte sagen, heilige Aufgabe, meint Ihr nicht auch, Meister?«
»Allerdings, Mossé. Und Ihr seid ein sehr guter Bäcker dazu, doch bevor Ihr anfangt, von Hexerei zu reden, sollten wir meiner Meinung nach mehr über Euren Sohn erfahren.«
»Dann kommt mit mir! Untersucht ihn, sprecht mit ihm. Ihr werdet herausfinden können, was für Flüche auf ihm lasten.«
»Es könnte auch andere Gründe für Aarons Benehmen geben«, merkte Isaac an. »Ich könnte mir ein paar denken.«
»Es ist Hexerei«, sagte Mossé bestimmt. »Ich weiß es.«
»Warum seid Ihr Euch denn so sicher?«
Mossé sah sich misstrauisch im Hof um. »Weil es mich auch schon befallen hat«, flüsterte er dann. »Sie wollen meinen Sohn und Erben umbringen, aber das funktioniert nur, wenn ich nicht noch einen Sohn haben kann. Und deshalb haben sie einen Zauber über mich ausgesprochen, um – um zu verhindern, dass ich ein weiteres Kind zeuge.«
»Auch dafür könnte es andere Gründe geben, Mossé«, erwiderte Isaac sanftmütig.
»Zuerst dachte ich, der Herr bestraft mich dafür, dass ich meinen erstgeborenen Sohn zu meinem Schwager Ephraim geschickt habe, als dessen Sohn vom schwarzen Tod dahingerafft wurde.«
»Der Herr würde doch keinen Mann bestrafen, der dem Bruder seines Weibes aushilft«, entgegnete Isaac.
»Aber ich habe es ja nicht aus reiner Freundlichkeit getan«, murmelte Mossé.
»Ihr wollt sagen, er hat Euch dafür bezahlt«, sagte Isaac. Jeder wusste, dass Mossé einen prall gefüllten Geldbeutel dafür eingestrichen hatte, dass er seinem Schwager gestattete, seinen ältesten Sohn zu sich zu nehmen. Einzig Mossé glaubte, dass dies ein Geheimnis war.
»Ich habe meinen Sohn verkauft. Eine große Sünde! Aber Daniel wird ein gut laufendes Geschäft erben und ein reicher Mann sein. Ich habe es auch für ihn getan.«
»Aber in erster Linie für Euch selbst«, sagte Isaac.
»Ja. Und jetzt werde ich dafür bestraft. Ich hätte ihm Aaron schicken sollen, doch ich dachte, Daniel wäre der Gefügigere von beiden. Und jetzt ist eben alles schief gelaufen.«
»Also nochmal, was wollt Ihr von mir, was soll ich tun?«, fragte Isaac.
»Ich möchte, dass Ihr den Zauber von Aaron nehmt, und von mir, und dass Ihr den Schurken mit einem Fluch belegt, dem wir das alles zu verdanken haben. Ich weiß nämlich, wer dieser Schuft ist, Meister, und ich kann Euch besorgen, was immer Ihr auch braucht, um ihn zu verhexen.«
»Mossé, mein Freund«, sagte der Arzt, »ich benutze Arzneien, keine Zaubersprüche. Aber nach dem zu urteilen, was Ihr mir sagt, ist es möglich – ja sogar wahrscheinlich dass der Junge an einer Krankheit leidet, bei deren Linderung ich behilflich sein kann. Und auch für Eure Beschwerden hätte ich da ein paar Mittel. Vergesst erst einmal den Gedanken, dass Ihr zwei verhext sein könntet; ich will mit Euch kommen und sehen, was ich tun kann. Wartet hier, bis ich meine Arzneien zusammengesammelt habe.«
Isaac stopfte sich hastig den Mund voll Reis und nahm ein mit Käse belegtes Brot in die Hand. Yusuf wurde aus seinem Unterricht herausgerissen und Raquel losgeschickt, um einen Korb mit Kräutern und Tinkturen fertig zu machen. Noch bevor Mossé Zeit hatte, sich zu überlegen, ob er nun aus dieser Zusammenkunft mit dem Arzt als Sieger oder Verlierer hervorgegangen war, marschierten die vier auch schon den Weg hinauf zur Hauptstraße.
Die Bäckerei war gegen die nördliche Mauer des Viertels gebaut; wie bei einigen anderen Geschäften befand sich ihr Eingang auf der der Stadt zugewandten Seite in Form einer Tür in der Stadtmauer. Doch anstatt durch das Stadttor zu treten und zum Eingang der Bäckerei herumzulaufen, bog Mossé in die erste Gasse vor dem Tor ein und betrat seine gemütlichen Wohnräume durch eine Tür, die noch im jüdischen Viertel lag. Mossés Familie brauchte also Jacob, den Torwächter, nicht zu wecken, wenn jemand das jüdische Viertel nachts betreten wollte, wenn die Tore verschlossen waren. Man brauchte nur die kleine Tür in der Mauer aufzusperren, die der Bäckerei Zutritt zur restlichen Stadt gewährte.
Als sie das Haus des Bäckers betraten, wurden sie von einem herzzerreißenden Jammern empfangen, das aus den oberen Wohnräumen herunterdrang. Esther kam die Treppe heruntergelaufen und sah ihren Mann entsetzt an. »Er ist tot, Mossé!«, kreischte sie. »Er ist tot! Mein Aaron ist tot!«
Kapitel 2
Für Raquel, die ihrem Vater seit nunmehr drei Jahren assistierte, war der Tod mitsamt der Trauer und dem Schock, den er hinterließ, zu einer vertrauten Erfahrung geworden. Isaacs schwindendes Augenlicht und der Tod seines früheren Helfers Benjamin während der Pest hatten Raquels Schwester Rebecca dazu genötigt, ihrem Vater in jenen schwierigen Zeiten auszuhelfen. Nach Rebeccas Hochzeit hatte Raquel naturgemäß die Rolle ihrer Schwester übernommen: dem Vater das Augenlicht zu ersetzen und in Fällen, wo Sehkraft für bestimmte Handgriffe nötig war, auch die Hände. Seit dieser Zeit hatte sie in den Gesichtern der wirklich trauernden Hinterbliebenen Elend und Verzweiflung gesehen – aber auch das geheuchelte Leid in den Gesichtern derer, die durch den schwarzen Tod aus den Verhältnissen ihrer häuslichen Tyrannei befreit worden waren. Der Bäcker jedoch glich keinem der Trauernden, denen sie je zuvor begegnet war. Er stand nur da, machte keine Anstalten, seine völlig aus der Fassung geratene Frau zu trösten, und schien den Verlust ihres Erben mit stoischer, ja beinahe trotziger Fassung zu tragen. Mossé war ein exzellenter Bäcker, das wusste sie, doch niemand hatte ihn je als heldenhaftes Musterbeispiel betrachtet, wenn es galt, widrigen Umständen die Stirn zu bieten. Es entstand eine peinliche Pause, doch dann trat ihr Vater auf den Plan.
»Bitte, Frau Esther«, sagte Isaac und streckte der schluchzenden Mutter seine tröstende Hand entgegen. »Untersuchen wir ihn doch erst einmal. Manchmal –«
»Es ist zu spät, Meister Isaac«, wimmerte sie. »Ich weiß es. Ich habe schon Tote gesehen. Mein Aaron ist tot. Ihr seid zu spät gekommen.«
Mossé hielt sich im Hintergrund, schweigend und unbewegt.
»Wenn Ihr mit mir kommen wollt«, sagte eine leise Stimme am Fuße der Treppe. »Ich führe Euch zu ihm, Meister Isaac. Papa«, fügte die Stimme schroff hinzu, »ich führe den Arzt nach oben. Bitte bleib du bei Mama.« Die Stimme gehörte einem gut aussehenden jungen Mann; er war von kräftiger Statur, bewegte sich aber geschmeidig und war beinahe so hoch aufgeschossen wie sein Bruder. Seine Augen waren von Tränen gerötet, doch seine Umgangsformen noch immer tadellos. »Meister Isaac, Fräulein Raquel«, sagte er. »Und Yusuf. Ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank für Euer schnelles Kommen.«
»Das ist Daniel, richtig?«, erkundigte sich Isaac mit gedämpfter Stimme. »Wenn du vorangehst, folgen wir dir.«
Sie stiegen hintereinander die Treppe hinauf bis zu einem kleinen Zimmer über der Backstube. »Er liegt hier drinnen«, sagte Daniel. Isaac blieb in der geöffneten Tür stehen, lauschte und atmete schnuppernd die Luft ein. »Wann ist er gestorben?«, fragte er.
»Nur wenige Augenblicke bevor Ihr angekommen seid, Herr. Noch bevor wir seinen Leib entsprechend betten konnten, hörte Mama Euch bereits kommen und eilte die Treppe hinunter.«
»Warst du bei ihm, als er starb?«
»Jawohl, Herr«, erwiderte Daniel und verstummte.
»Führ mich zu ihm«, sagte Isaac. Raquel nahm ihren Vater an der Hand und geleitete ihn an das Kopfende des erbärmlich zerwühlten Bettes. Isaac fuhr mit seinen Fingern über den Körper, der, verkrampft und verrenkt, noch genauso dalag wie in dem Moment, als der Tod sich seiner bemächtigt hatte.
»Er ist keinen friedlichen Tod gestorben«, bemerkte Isaac.
»Der Anblick war grauenvoll«, sagte Daniel ernst. »So leicht werde ich das wohl nicht vergessen.«
»Wie lange hast du hier an seiner Seite gewacht?«
»Mein Vater hat den Jungen mitten in der Nacht nach mir geschickt.«
»Dann ging es ihm also schon so früh schlecht?«
»Nein, Meister Isaac. Aaron hat Papa noch selbst aufgeweckt.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Isaac. »Er ist in sein Zimmer gegangen und hat ihn um Hilfe gebeten?«
»Nein. Er wandelte durch das Haus, immer treppauf, treppab.«
»Ah. Im Schlaf also?«
»Ja.«