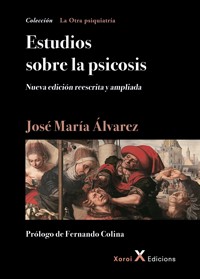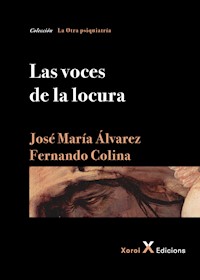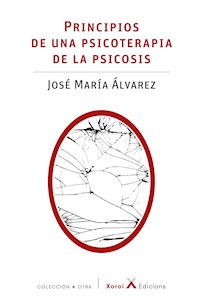9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein spanischer Schriftsteller in seinen besten Jahren, der das ausschweifende Leben der Madrider Künstlerszene mit all seinen Facetten genossen hat, verfällt den sinnlichen Reizen der Tochter seiner engsten Freunde. Das Mädchen reift sehr bald unter seiner Regie zur perfekten Bettgefährtin heran. Beide sind beseelt von dem Gedanken, ihre phantasievolle Lust zur vollen Entfaltung zu bringen und sich an der Einzigartigkeit ihrer Leidenschaft immer wieder zu berauschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
José María Álvarez
Der Meister und das Mädchen
Aus dem Spanischen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein spanischer Schriftsteller in seinen besten Jahren, der das ausschweifende Leben der Madrider Künstlerszene mit all seinen Facetten genossen hat, verfällt den sinnlichen Reizen der Tochter seiner engsten Freunde. Das Mädchen reift sehr bald unter seiner Regie zur perfekten Bettgefährtin heran. Beide sind beseelt von dem Gedanken, ihre phantasievolle Lust zur vollen Entfaltung zu bringen und sich an der Einzigartigkeit ihrer Leidenschaft immer wieder zu berauschen.
Über José María Álvarez
José María Álvarez, geboren 1942 in Cartagena, Spanien. Er studierte Philosophie und Literatur und widmete sich früh dem Schreiben. Seine lyrischen Werke sind in einem umfangreichen Sammelband «Museo de cera» erschienen.
1976 erhielt José María Álvarez den Förderpreis der Fundación March. Ferner übersetzte er Hölderlin und Shakespeare (die Sonette) ins Spanische sowie vor allem das Gesamtwerk des griechischen Dichters Konstantinos Kavafis. 1985 leitete er in Venedig die internationale Hommage an Ezra Pound.
Inhaltsübersicht
Für Francisco Javier Roca y Mocorrea, der so vieles über diese Abgründe weiß.
Für Eduardo Chamorro,dito
Für Alberto Viertel,dito
Für meine Kinder mit einem einzigen Rat, jenen, den Properz im Zweiten Buch seiner Elegien formulierte:
Dum nos fata sinunt, oculos satiemus amore.
Was (mehr oder weniger)auf dasselbe hinausläuft wie:
Wie der Geliebten holdes Lächelnunser Herz jubeln läßt!
Aus: Cavalleria rusticana
Ich erinnere mich an den Tag Ende Juli, an dem wir einander ‹kennenlernten›. Ich trank im Haus deiner Eltern einen Gin Tonic, während sich Beatriz und deine Mutter über ichweißnichtwas unterhielten im Zusammenhang mit einer Ausstellung, zu der die beiden nach Venedig fahren wollten. Du schwammst. Seit dem Vorjahr hatte ich dich nicht mehr gesehen: da warst du noch ein kleines Mädchen. Doch hatte ich natürlich in deinen Augen stets dies heilige Leuchten gesehen, das ich so gut erkenne, auch wenn du noch zu sehr Kind warst. An jenem Julinachmittag aber warst du das nicht mehr. Als du da aus dem Schwimmbecken stiegst und auf mich zukamst, naß, schlank, gebräunt, und die Sonne den feinen und bernsteinfarbenen Flaum auf deiner Haut wie eine Aura leuchten ließ, warst du schon dies andere außergewöhnliche Wesen, in das sich die Frauen während einer kurzen Spanne ihres Lebens verwandeln. Es ist die kurze Zeit, in der sie der Kindheit gerade entwachsen sind, unmittelbar bevor sie zu reifen Frauen heranwachsen.
Du sahst mich an, und ich erkannte in deinen Augen etwas, das mich wie eine Hand auf den Sitz meines Stuhls drückte. Meine Schläfen pochten. Deine Lippen waren feucht. Du lächeltest. Du schütteltest die Haare, daß die Wassertropfen flogen. Vor dem Blick deiner blauen Augen stand ich wie nackt da. Deine Eltern stellten uns einander noch einmal vor: «Erinnerst du dich noch an Alexandra? Sie ist ganz schön in die Höhe geschossen, was?»
In die Höhe geschossen … was die schon wußten … Ich gab dir einen Begrüßungskuß, besser gesagt ich empfing den deinen und spürte eine Hitze, die mich versengte; es kam mir vor, als schürften deine Lippen meine Haut auf. Es war klar, daß du sehr wohl wußtest, was du wolltest und wen du da küßtest. Dieser tödliche Hauch, der dir innewohnte, beschränkte sich keineswegs ausschließlich auf oberflächliche Reize, sondern äußerte sich in einer unsagbaren Anmut. Du gehörtest nicht zu denen, die durch Lebhaftigkeit oder verführerische Schönheit zum Herzen sprechen. Du warst anders. Du warst dies andere.
Der Pfeil, den Cupido auf mich abschoß, kaum daß ich das majestätische Schauspiel wahrnahm, das dein Körper bot, als du auf mich zugeschritten kamst, war so beschaffen, daß er eine Wunde reißen mußte, die sich nie schließt. Noch heute, so lange nach jenem Tag, überläuft mich ein Schauer. Unmöglich, dir zu beschreiben, welche Ausstrahlung von dir ausging. Welche Aura von Berückung, Begehren und Wahn sich mir da näherte, ist auf den Fotos nicht zu erkennen. Man mußte es gesehen haben, mußte selbst dabei gewesen sein! Deine gleichsam schlafwandlerischen Bewegungen, die von der Sonne übergoldete dunkle Haut, die blauen Augen, dein Gesicht – doch ich wiederhole, was ich damals erlebte läßt sich auf den Fotos nicht erkennen – brannten sich mir wie Feuer ins Herz. Dein Mund war der lockendste, geheimnisvollste, sinnlichste und verhängnisvollste, der mir je vor Augen gekommen ist.
Du bliebst in meiner Nähe, und mich überlief eine Ahnung von dem, was Ernst Jünger am Anfang von Auf den Marmorklippen so beschreibt: «Da begann auch sie zu lächeln, und leise legte sie mir die Hand auf den Mund – daß ich nur den Atem, der durch ihre Finger wehte, in der Stille noch vernahm.» Es versteht sich von selbst, daß mich dein Anblick versteinerte. Dein Blick kam aus der Hölle. Ich atmete tief, wie jemand, dem übel wird, und goß mir ein weiteres Glas ein.
Den ganzen Nachmittag hindurch fiel mir auf, daß ich Mühe hatte zu atmen und meine Bewegungen zu koordinieren. Ich lernte in mir einen Meister des Seufzens kennen. Mit einem Wort: Du gingst mir nicht aus dem Kopf.
Ihr Frauen seid alle, genauer gesagt, fast alle, in jedem Abschnitt des Lebens wunderbar, von unerschöpflicher und aufregender Anziehungskraft. Doch hinter diesen euren Reizen verbargen sich Rufe der dahinströmenden Natur, die wir unter Umständen nie vernehmen und die uns doch um den Verstand bringen und zu jener äußersten Leidenschaft treiben, die es uns so gut wie unmöglich macht, dem einzigen aus dem Weg zu gehen, worauf die blinde Schöpfung es anlegt, nämlich die Fortpflanzung der Art. Wie auch immer das im einzelnen aussehen mag, auf jeden Fall geht es um Fortdauer und Vermehrung. Du aber warst nicht natürlich. Deine Macht zielte nicht so sehr auf die Lüsternheit, sondern machte eher den Eindruck einer Kunstform: Wie könntest du als Tochter dieses verzauberten Jenseits dein Glück in der trüben Brühe finden, in der sich die Mehrheit suhlt. Diesen deinen Einfluß spürte ich, er drang durch alle Poren in mich ein. Hier stand mir ein weiteres der seltenen Geschöpfe gegenüber, die dem Außergewöhnlichen geweiht sind.
Ohnehin kommt man in gleicher Weise als hinreißende Liebhaberin zur Welt wie man als Maler, als Mutter Teresa, als General Patton oder als Rilke oder Fangio geboren wird. Als wir einander gegenüber traten, wurde uns – wie im Aufleuchten eines Blitzes – klar, daß wir gemeinschaftlich erreichen konnten, wovon wir träumten. Wie dem Wahnsinn haftet dieser Leidenschaft etwas Heiliges an; das wußten die Menschen früherer Zeiten.
Von der ersten Minute an war mir klar, daß es uns bestimmt war, gemeinsam den Verstand zu verlieren, ins prunkvolle Reich der ‹Vergänglichkeit› emporzusteigen, das der großartige Robert de Montesquiou so sehr bewunderte, im Schweif des Kometen zu verglühen, ein Guckloch zu den Himmeln zu öffnen. Schon bei anderen Gelegenheiten hatte ich Wesen wie dich kennengelernt und geliebt, doch keine von ihnen hatte mich so beeindruckt, in mir eine so beunruhigende Spur hinterlassen (wie die Fährte im Sand, die eines Mittags Robinson so sehr erschreckte). Ein Stoß, der aus dem Dunkeln kam, schleuderte uns einander in die Arme. Gemeinsam machten wir uns daran, der Lust ein Denkmal zu setzen, das über die Düsternis des Todes hinausreichte.
Du trocknetest dich mit einem gelben Handtuch ab und setztest dich neben mich. Während du dir die Oberschenkel trocken riebst, sahst du mich an, Unendlichkeit im Blick deiner Augen. Dann ließest du das Handtuch zu Boden fallen und trankst eine Cola. Ein Tropfen fiel vom Glas auf deinen goldbraunen Körper. Als du ihn mit der Hand verriebst, spürte ich seine Kühle auf meinem eigenen Körper.
Du brachst als erste das Eis: «Mama hat gesagt, daß du ein sehr hübsches Haus hast. Du mußt es mir gelegentlich zeigen.»
«Ach ja», sagte dein Vater. «Das könntest du gelegentlich tun. Alexandra ist nicht wie die anderen; sie macht sich viel aus Büchern und dergleichen.»
Du wandtest dich wieder dem Trinkhalm zu, aus dem du deine Cola schlürftest, und ließest mit einem Blick auf mich kaum wahrnehmbar die Zungenspitze darüber gleiten. Feucht glänzten deine Lippen. Deine zarten Schultern drängten gegen die Lehne des Korbsessels, und mit einer leichten Kopfbewegung schütteltest du dir die Haare aus dem Gesicht.
«Wird gemacht – demnächst mal», sagte ich und richtete den Blick, so daß du es merken mußtest, dorthin, wo sich unter dem Badeanzug dein Schamhügel abzeichnete. Als ich dir darauf in die Augen sah, erwidertest du lächelnd meinen Blick und senktest den deinen unverhohlen dorthin, wo mittlerweile mein Glied glühend anschwoll.
Es war ein sehr heißer Nachmittag, und Schweiß bedeckte deinen Körper. Ich stellte ihn mir auf deinem Rücken vor, auf deinen Brüsten, in deinen Achselhöhlen, auf deinem Hintern.
«Morgen habe ich nichts zu tun», sagtest du. «Wenn du möchtest, komme ich mit dem Fahrrad rüber.»
‹Das ist sie›, sagte ich mir. ‹Das ist sie. Von ihr habe ich geträumt, und bisweilen ist sie teilweise in anderen Frauen aufgetaucht. Aber sie ist es wirklich, sie ist es. In jeder Beziehung und ohne Makel. Und sie hat mich auch ,herausgeschmeckt‘, hat genauso große Lust auf mich wie ich auf sie.› Ich stellte mir dich entkleidet vor, sah vor meinem inneren Auge, wie du mich liebkostest und ich dich. Nach nichts anderem stand mir in jenem Moment der Sinn. Ich dachte daran, wie viele Große der Kunst nach Geschöpfen wie dir verrückt gewesen waren: Dante verlor sein Herz an eine neunjährige Beatrice; Petrarcas Laura war zwölf; dasselbe Alter sprach der Marquis de Sade zu Beginn ihrer wilden Erziehung Justine zu; zehn Jahre alt war das ‹schlanke Reh›, als das sich Goethe seine Helena erträumte, und eine Vierzehnjährige trat dem Doktor Faustus vor die Augen. Auch Byron liebte diese wunderbaren Wesen, ebenso Nabokov. So viele träumerische Gedanken drängten sich in jenem Augenblick in meinem Kopf, daß ich glaubte, er werde platzen. Ich kam zu dem Ergebnis, daß ich dich unter allen Umständen haben mußte, und wenn mich das in die Hölle brächte. Ich war so sicher – und du siehst, daß ich mich nicht irrte –, schließlich gefunden zu haben, was ich so lange gesucht hatte; jemanden, mit dem ich auf den Trümmern dieser Welt ein Reich errichten konnte, das der Intelligenz und der Lust gewidmet war.
Am folgenden Tag kamst du mich besuchen, und ich merkte, daß du mein Haus aufregend fandest, daß es ‹das› war, was du ebenfalls gewollt hattest.
Erinnerst du dich an dies erste Mal?
Ohne das leiseste Zögern oder das geringste Befremden wurden wir zu Liebenden. Wir brauchten einander nichts zu sagen. Ich hatte dir einen Teil der Bibliothek gezeigt, dir eine alte Verne-Ausgabe zum Durchblättern gegeben, eine Zarah Leander-Platte aufgelegt, mich auf das Sofa gesetzt und mir ein Glas eingegossen.
«Möchtest du etwas trinken?» fragte ich dich.
Du bejahtest, legtest das Buch aus der Hand und kamst zu mir, wobei du mich mit einem Lächeln unablässig ansahst. Du nahmst mir das Glas aus der Hand, setztest dich auf meinen Schoß, schobst dich höher und küßtest mich lange und voll Sanftheit. Dann öffnetest du mit der Zunge meinen Mund und schobst die Lippen auseinander, während du meinen Hals mit deinen weichen Armen zärtlich umschlangst. Zarah Leander sang «Wunderbar, wunderbar …». Meine Hand lag auf deinem Schenkel. Wie sehr mich deine Beine erregten! Ich spürte den weichen Flaum ihrer Haut, die Kühle deiner Schenkel. Dann schob ich die Hand unter deinen Slip und liebkoste dir den Po. Ich merkte, wie du dich an mich drängtest und mir deine Zunge erneut zwischen die Zähne fuhr.
«Ich bin noch Jungfrau», flüstertest du mir zu.
«Hast du es noch nie getan?»
«Doch, fünf- oder sechsmal, mit einem Jungen aus unserer Schule. Bei Parties, aber nur gestreichelt. Ich bin noch Jungfrau.»
«Das gefällt mir», sagte ich. Es entzückte mich.
Ich zog dir die Shorts aus und legte dich aufs Sofa. Du lächeltest zufrieden.
«Weißt du, daß ich mich mehr als einmal selbst befriedigt habe, während ich an dich dachte und daran, daß wir es taten?» fragtest du mich.
Deine Vagina war feucht. Ich zog dir das Höschen aus und betrachtete dein rötlich behaartes Geschlecht. In der Leistenbeuge zeichneten sich bläuliche Äderchen ab. Als ich deine Scham küßte, durchlief dich ein Schauer. Ich öffnete sie mit den Fingern, beugte mein Gesicht darüber und hatte zum erstenmal deinen Geschmack in meinem Mund.
Du hobst meinen Kopf und küßtest mich erneut.
«Wir müssen woanders hingehen», sagtest du. «Hier geht es nicht.»
Du hattest recht. Auch du hast gespürt, daß etwas, das damals begann, einen passenden Ort brauchte, seinen ‹heiligen Bezirk›, wo wir unser eigenes Reich errichten konnten.
«Ich habe eine Wohnung, die sich gut dafür eignet. Dort können wir hingehen, da sieht uns niemand. Beatriz braucht nicht zu wissen, daß der Mieter vor kurzem ausgezogen und sie nicht mehr vermietet ist. Wenn du möchtest, gehen wir morgen hin», schlug ich vor.
Du warst einverstanden.
Es war eine Verabredung, wie Liebende sie hätten treffen können, die sich schon seit Jahren kannten. Wir hatten keine Eile, so, als hätten wir schon viel Zeit miteinander verbracht. Eine Weile lagen wir auf dem Sofa beieinander, Musik spielte, und ich liebkoste dich voll Zärtlichkeit. Zwar fiel dir auf, wie mein Schwanz in der Hose anschwoll, doch begnügtest du dich damit, ihn leicht zu liebkosen, wobei du die Finger über den Stoff an ihm entlang gleiten ließest.
«Er ist größer als der von deinem Freund in der Schule», sagte ich.
Du lächeltest.
«Was denn sonst.»
Ich öffnete die Hose und holte ihn heraus. Mit aufgerissenen Augen sahst du unverwandt hin.
«Er ist herrlich.»
«Er gehört dir.»
Du nahmst das Glied in die Hände und fuhrst mit einer Fingerspitze kreisförmig über die Eichel. Dann umschlossest du es fest mit der Hand.
«Er ist wie ein Spielzeug», sagtest du.
«Es gibt kein besseres», gab ich zur Antwort. Du führtest die fest geschlossene Hand nach oben, so daß die hochgeschobene Haut die Eichel nahezu bedeckte. Dann ließest du mit einer beinahe wilden Gebärde los, so daß sich die Haut zurückzog. Deine Lippen öffneten sich leicht.
«Küß ihn ruhig», sagte ich.
Du schlossest die Augen, nähertest dich ihm mit den Lippen und küßtest ihn sanft.
«Hast du schon mal jemand einen abgelutscht?» fragte ich.
«Nein.» Dabei sahst du mich an wie jemand, der auf eine Anweisung wartet.
«Es macht dir bestimmt Spaß», sagte ich. «Mach doch mit der Zunge, was du mit den Fingern gemacht hast, um die Spitze herum.»
Deine heiße kleine Zunge begann die Spitze meines Glieds zu liebkosen. Ich merkte, daß ich eine so gewaltige Erektion bekam, als ob mein Schwanz zu platzen drohte.
Dir schien all das zu gefallen. Wie sonst hättest du mit solcher Hingabe bei der Sache sein können.
«Jetzt», sagte ich, «fahr mit der Zunge nach unten, von da, wo du jetzt bist, und massiere ihn bis ganz unten.»
Du folgtest meinen Anweisungen mit unglaublicher Geschicklichkeit.
«Gut. Jetzt wieder mit der Zunge rauf, bis ganz oben, richtig kräftig. Mach es ein paarmal.»
Ich mußte dich nicht lange bitten. Ich merkte, wie das Sperma langsam stieg und sich meine Bauchdecke immer mehr spannte.
«Jetzt. Jetzt umschließ die Eichel mit den Lippen, steck ihn in den Mund.»
Du begannst daran zu saugen. Schmerzhaft spürte ich deine Zähne.
«Moment mal», sagte ich. «Sei vorsichtig mit den Zähnen. Zieh sie ein. Nimm nur die Lippen. Zuerst die Lippen, und wenn ich es dir sage, steck ihn so weit in den Mund, wie du kannst.»
Viel brauchte ich dir nicht beizubringen. Du lerntest rasch. Ich spürte deine Zähne nicht mehr, nur noch die Wärme deines Mundes um mich herum. Du lutschtest an meinem Schwanz als wäre es ein Eis am Stiel. Ich spürte, wie die Hitze in mir hochstieg. Der Orgasmus stand unmittelbar bevor.
«Jetzt, jetzt!» sagte ich. «Jetzt nimm ihn ganz!»
Du stecktest dir das Glied in den Mund, so daß ich glaubte, du wolltest es verschlingen. Du lutschtest und lutschtest. Es war überwältigend. Unterdessen liebkostest du mir mit der freien Hand Schenkel und Hoden. Ich konnte es nicht länger zurückhalten.
«Gleich kommt es», sagte ich. «Soll ich dir in den Mund spritzen?»
Du nicktest, ohne ihn aus dem Mund zu nehmen. Als ich mich ergoß, warfst du den Kopf zurück, umschlossest das Glied aber kräftiger mit den Lippen und schlucktest, ohne mit Lutschen aufzuhören. Ich liebkoste deinen zarten Nacken. Du bliebst auf meinen Oberschenkeln liegen, als seiest du eingeschlafen, noch immer mein Glied im Mund, das hin und wieder zuckte, während dir ein dünnes Rinnsal von Samen seitwärts aus dem Mund rann.
«Es ist wunderbar», sagtest du. «Und weißt du was? Ich glaube, mir ist es auch gekommen. Zumindest fast.»
Dann zogen wir uns wieder an, und du kehrtest auf dem Fahrrad nach Hause zurück.
Am nächsten Tag trafen wir uns am Eingang des Gebäudes, in dem meine Wohnung lag. Wir gingen nach oben. Im Aufzug küßtest du mich, als wolltest du mit meinem Körper verschmelzen. Ich spürte, wie dein Duft auf meinen Körper überging. Wir traten ein. Ich setzte mich aufs Bett, du kamst zu mir und bliebst vor mir stehen. Ich löste dir den Rock, der an deinen Beinen hinabglitt, und während ich deinen Bauch küßte, zog ich dir das Höschen herunter. Meine Lippen tasteten sich weiter hinunter zu deiner Scham, die du schon erwartungsvoll gegen mein Gesicht drängtest. Ich warf dich aufs Bett und begann dich ganz behutsam zu liebkosen und zu streicheln.
«Entspann dich», sagte ich. «Mach die Augen zu und laß dich einfach treiben.»
Ich schob deine Schenkel auseinander und begann mit den Fingern dein Geschlecht zu streicheln. Kaum berührte ich deine Klitoris, als du dich krümmtest und dich auf dem Laken wälztest, als könntest du der Macht der Wollust nicht mehr widerstehen. Nach und nach weitete sich die Öffnung, die mich erwartete.
«Sag mir, wenn es weh tut.»
«Nein, es ist gut, mach weiter», flüstertest du.
Während ich die Innenseiten deiner Schenkel streichelte, den Ansatz deines wunderbaren Pos, deine Schamlippen, vom selben zarten Rosa wie das Innere einer Venusmuschel, fuhrst du mir mit den Händen, deinen schlanken Fingern, über den ganzen Körper, küßtest mir die Augenlider und faßtest mir an meinen Schwanz. Dabei lachtest du, du lachtest … Als ich sah, daß du bereit warst, mich zu empfangen, feucht und geschmeidig, drehte ich mich auf den Rücken und hob dich auf mich.
«Jetzt laß mich ganz langsam in dich kommen. Verkrampf dich nicht. Mach dir keine Sorgen, wenn es ein bißchen weh tut.»
«Bestimmt nicht. Ich liebe dich», sagtest du, während du mich mit Küssen bedecktest. Wieder schobst du deine samtweiche Zunge in meinen Mund.
Mein Schwanz glitt langsam in dich hinein. Während er sich kraftvoll durch die stark befeuchtete Spalte drängte, spürte ich deine Härchen an meiner Hand entlangstreifen. Deine Vulva umschloß mich fest wie eine Hand. Du bewegtest dich ein wenig, um mir den Weg zu bahnen, und schon spürte ich, wie er weiter hineinglitt. Nicht das geringste Anzeichen wies darauf hin, daß dir irgend etwas weh tat. Bevor wir es richtig merkten, war ich vollständig in dich eingedrungen, und wir bewegten uns rhythmisch in einer wunderbaren, köstlichen und überwältigenden Vereinigung.
«Dich in mir zu spüren ist das Schönste, was ich je erlebt habe», sagtest du und bissest dir vor Entzücken auf die Lippen. «Es ist himmlisch. Ich liebe dich.»
Ich merkte, daß deine Bewegungen rascher wurden. Da ich aber noch nicht wollte, daß es mir kam – und auch bei dir wollte ich es noch nicht –, zog ich mein Glied heraus und legte dich neben mich aufs Bett. Ich bedeckte deinen ganzen Leib mit Küssen, deine kleinen Brustwarzen, deine hinreißenden Hüften; ich drängte mein Gesicht an deine Scham; der mit einigen rötlichen Streifen vermischte köstliche Saft aus deinem Innern tropfte darauf, aber du blutetest nicht. Ich drehte dich um und fuhr dir mit der Zunge über den Hintern, zwischen die Halbkugeln deiner Backen, die vollkommene Linie deiner Wirbelsäule empor, um deinen Hals herum zum Mund. Erneut legte ich mich neben dich, schob deine Schenkel auseinander und ging daran, ihn dir wieder hineinzustecken.
«Bleib ein wenig so», sagte ich. «Langsam, langsam …»
Du umarmtest mich mit aller Kraft. Dein Leib verschmolz mit meinem, die Schenkel umschlossen mich und deine Füße flatterten wie Vögel. Wie ich diese Füße anbetete. Ich zog mein Glied heraus und küßte sie, Zeh um Zeh, saugte und knabberte an ihnen.
«Du bringst mich noch um vor Wollust», keuchtest du. «Was soll ich jetzt tun? Was würde dir gefallen?»
«Mir gefällt alles.»
Erneut steckte ich mein Glied hinein und merkte, wie wollüstig dein Körper bereits war, wie bewandert. Ich drängte mich ein wenig näher und schob mich nach unten.
«Mach die Beine so breit, wie du kannst.»
Ich drang so tief in dich, daß es mich fast schmerzte. Während ich mich bewegte, tastete meine Hand hinab zum Wunder deines Paradiesgartens. Meine Finger berührten die überfluteten Ränder der Schamlippen, spürten die Glut meines Glieds, das sich in dir hin und her bewegte. Ich berührte, so zart ich vermochte, deine Lustknospe. Ich zog mein Glied ein wenig heraus und rieb kräftiger. Als du vor Wonne zu zittern begannst, drang ich erneut machtvoll in dich ein.
Schließlich konntest du nicht mehr: «Es kommt! Oh, oh, oh, oh …! Es kommt! Es kommt!»
Ich steigerte das Tempo meiner Bewegungen und ergoß mich gemeinsam mit dir.
Wir blieben lange vereint. Über uns erklang ein Violinkonzert von Vivaldi. Mit rötlichem Schimmer drang das Dämmerlicht eines südlichen Augusts durch die Fensterladen.
Wie traumhaft es bei diesem ersten Mal war … wir konnten die Herrlichkeit mit Händen greifen. Es war aber nicht nur die wunderbare Vereinigung, sondern außerdem das Gefühl, daß wir – wie man so sagt – füreinander geschaffen waren. Der Zauber jenes Nachmittags ist in den vier Jahren, die wir jetzt beinahe miteinander verbracht haben, noch nicht verflogen. Jedes Beisammensein war von der gleichen Intensität, war vom gleichen süßen Wahn gekennzeichnet.
Du warst ein Glücksfall der Schöpfung, der Puls des Lebens, die reinste Empfindung, die jedem Genuß offenstand, du machtest jeden Freudenrausch herrlicher und schufst das Reich meiner Begierde. Du verliehst meinen Träumen, der Raserei dieser Träume – endlich! – Wirklichkeit.
Schön, hemmungslos, launisch, lieblich, verführerisch, außergewöhnlich, ohne Erbarmen … Damals wußte ich nicht, wie lange du so sein würdest, ob nicht dieser Zauber im Laufe deines Heranwachsens dahinschwände (wie das so zu gehen pflegt). Doch ich setzte darauf, daß die Verzückung fortdauerte. Ich hatte in diesem Augenblick ein Geschöpf in Händen, das sich im Zustand des höchsten Taumels seines Lebens befand. Doch du warst nicht mehr ‹das Kind› – es war nicht diese Art von Bezauberung, die manchen angeregt hatte, nicht diese spezielle Leidenschaft, die jemanden gegebenenfalls erfassen kann; auch warst du nicht die voll erblühte Heranwachsende, fast schon Frau, die für gewöhnlich eingebildet und anmaßend auftritt.
Explosiv brachst du in mein Leben ein, mit derselben Macht wie die Lava eines Vulkans. Dies Feuer gehörte mir. Und es liebte mich.
Es behagte mir, dir in den sich träge dahinschleppenden frühen Abendstunden die Möse zu lecken, wenn du nicht mehr stöhntest, sondern dich, einem Traum von Wollust hingegeben, einem Houdini gleich zu verflüchtigen schienst; auf deinem wie schlafenden Gesicht lag lediglich ein leichtes Lächeln, und du machtest eine angedeutete Bewegung, so als rekeltest du dich morgens beim Aufwachen auf deinem Lager.
Nur eine kurze und flüchtige Zeit konnten wir in unserem ersten Sommer an einer einsamen Bucht verbringen. Wir sammelten Muscheln und betrachteten das Meer. Doch schon bald erwachten die Begierden wieder in uns. Ungehindert legtest du eine Hand auf meine Badehose, um zu spüren, wie mein Glied anschwoll. Auf die Vergrößerung meines Glieds reagiertest du unverzüglich mit einem leisen Pochen deiner Schläfen, einem Erschauern der hellen Härchen auf den gebräunten Beinen oder einem Blick aus deinen Augen, der selbst Apoll geblendet hätte.
Als du in mein Leben tratest, stand ich im Begriff, das Handtuch zu werfen. Die Literatur interessierte mich nur noch am Rande. Unsere alte Welt war inzwischen wie der Abfall, der mit dem Wasser davonschwimmt. Die Freunde, die Art zu leben, die grandiosen Nächte, in denen wir bis zum Morgengrauen tranken, rauchten und diskutierten, gehörten der Vergangenheit an (alle waren ‹erwachsen geworden›). Lange hatte ich allein gelebt; Beatriz mußte sich wegen der Restaurierung eines Gemäldes nahezu ein halbes Jahr in Madrid aufhalten, und ich kann dort nicht leben. Madrid langweilt mich. Meine Tage brachte ich im Haus am Meer damit hin, daß ich mich ein wenig um den Garten kümmerte und las – das schon. Das einzige, was mich zu trösten vermag, sind Lesen und Musikhören. Ich machte lange Spaziergänge, und bei jedem drängten sich mir schwermütige Vorstellungen auf. Überdies hatte mir eine lange Reise, die ich törichterweise unmittelbar zuvor unternommen hatte, in gewisser Hinsicht einen Maßstab dafür geliefert, auf welche Weise sich mein Leben verändert hatte: es war ein planloses Hin und Her, inmitten von Menschen, die einen begafften wie eine unbekannte Lebensform, einen Gegenstand, an dem sich Medizinstudenten in der Kunst des Sezierens üben. Die Welt kam mir verächtlich vor, und ich hatte den Eindruck, daß das, was mir die Götter an Begabung geschenkt haben mochten – ob gering oder bedeutend –, mit anderem dahingegangen war. Die Vorstellung, mich hinzusetzen und zu schreiben, wurde mir geradezu unerträglich. Mir fiel einfach nichts ein, das der Mühe wert schien. Zäh und voll Langeweile schleppten sich die Tage dahin, und nicht einmal der Besuch einiger Freundinnen vermochte mich aus meiner Teilnahmslosigkeit zu reißen.
Einmal sagtest du mir: «Dir verdanke ich es, daß ich das Leben bewundere. Als ob ich es vor deiner Zeit nie verstanden hätte.» Ich will dir berichten, in welcher Welt du auftauchtest, damit du begreifst, wie es kommt, daß ich ohne dich am Ende vermutlich den Kopf verloren hätte. Jene sinnlose Reise zeigt deutlich, in welchem Stumpfsinn ich meine Tage dahintreiben ließ.
Ich habe dir bereits gesagt, daß meine Tage lang, unerträglich und leer waren. Daher erklärte ich mich auch einverstanden, als meine Agentin anrief und mir mitteilte, für den Fall, daß ich ein Interview mit Fellini machte, sei eine nordamerikanische Zeitung bereit, es zu kaufen. Damit sich die Reise lohnte, baute ich noch je einen Kongreß in Paris und Athen ein, zu denen man mich eingeladen hatte. Gut, dachte ich: etwa eine Woche. Möglicherweise passiert ja was, das mich auf andere Gedanken bringt. In Paris, einer Stadt, die ich schon immer geliebt habe, könnte ich bei alten Freunden einen geselligen Abend verbringen; und Rom vermag mir ohnehin stets das Herz zu wärmen; überdies paßte mir der Aufenthalt dort gut, weil ich versuchen konnte, ein Buch aufzutreiben, hinter dem ich schon seit einer Weile her war, eine Erstausgabe von Lampedusas Lezioni su Stendhal. In Athen schließlich habe ich mich auch immer wohl gefühlt. Also sagte ich ja.
Doch kaum war die Maschine in Madrid gestartet, wurde der Flug unangenehm. Über den Pyrenäen bat ich um einen Scotch mit Eis. Eine Stewardess mit Augen wie Geranienblüten brachte ihn mir. Sie war das einzige annehmbare Wesen in jener Kapsel voll trübseliger Touristen, die geröstet in ihre Heimat zurückkehrten. Einige Minuten lang unterhielt ich mich damit, deren leeren Gesichter und die Beine der Stewardess zu betrachten. Ich trank den Whisky aus, ließ noch einen kommen und schlug Suetons Beschreibung des Lebens berühmter Männer auf. Kaum hatte ich einige Seiten darin gelesen, landeten wir in Paris.
Die zwei Tage, die ich dort verbrachte, waren eintöniger, als ich erwartet hatte: Meine Freunde waren nicht da, so daß ich kaum mehr tat, als vom Hotel zur Universität und zurück ins Hotel zu eilen, wobei ich natürlich wie gewohnt auf die unvermeidlichen ausgesucht geistlosen Fragen antworten mußte: «In Ihrem Land … die Demokratie … die Linke … Sie als Mann der Linken …» Sinnlos zu erklären, daß mir jegliches Schubladendenken zuwider ist, daß linke wie rechte Dogmatiker mir gleichermaßen auf die Nerven gehen, daß ich am liebsten mich einzig der großen Literatur widmen würde – und den Frauen. An den Abenden aß ich in zwei alten Restaurants, wobei sich mir das eine oder andere Bild aus meiner Jugend aufdrängte, und ich unternahm einen Spaziergang, bei dem ich erneut das Empfinden gewann, daß von gewissen Orten nach wie vor der Zauber ausging, die magische Kraft, die sie meiner Erinnerung nach hatten.
Am letzten Abend, als ich mit einigen Leuten, die sich für mein Werk interessierten, etwas trank, fiel mir auf, daß mich eine Frau mit Blicken förmlich bombardierte. Sie war Gymnasiallehrerin, noch recht jung und ziemlich anziehend. Die Vorstellung, sie könne scharf auf mich sein, erregte mich ein wenig. Wir sonderten uns von den anderen ab, tranken noch ein Glas miteinander und gingen in mein Zimmer hinauf. Etwas Besonderes hatte ich von jener Nacht nicht erwartet, bekam aber noch weniger als das. Hélène – so hieß sie, glaube ich – stellte sich die Wonnen einer Liebelei offenbar so vor, daß sie sich jemandem an den Hals warf, dann eine Zigarette nach der andern ansteckte und ihr eheliches Unglück bis in die feinste Verästelung ausbreitete. Eben das brachte sie von Zeit zu Zeit dazu, sich einem anderen in die Arme zu werfen. Ihr Wortschwall mußte jedes Begehren im Keim ersticken. Ich versicherte ihr, daß Millionen Menschen ihr Schicksal teilten und der Zauber der Ehe, wie der große Oscar Wilde gesagt hat, lediglich darin bestehe, ein aus unerläßlichen Täuschungen bestehendes Leben gleichmäßig auf beide Seiten zu verteilen. Da sie nun einmal mich als denjenigen ausersehen hätte, der ihrem Mann die Hörner aufsetzen sollte, sei es das beste, uns sogleich ans Werk zu machen. Sie wandte mir ihr Gesicht zu, umarmte mich und brach in Tränen aus. Daraufhin regte ich an, wenn es sie so viel Überwindung koste, ihren Mann zu betrügen, solle sie es doch lieber bleiben lassen. Ohnehin war es über der Aufzählung des ihr widerfahrenen Ungemachs inzwischen fünf Uhr morgens geworden, und ich mußte ein sehr frühes Flugzeug bekommen. Mit entsagungsvollen großen Augen sah sie mich an, zog sich wieder an und verschwand Gott sei Dank.
In Rom blieb ich drei Tage. Meine Suche nach Lampedusas Buch über Stendhal verlief ergebnislos. Zu Fuß suchte ich die vertraute Via Margutta auf, wo ich im Haus Nummer 110 drei äußerst anregende Stunden mit Fellini verbrachte. Ich unternahm meinen üblichen Streifzug durch Kirchen und Lokale und flog am nächsten Tag nach Athen weiter.
Über dem Mittelmeer meldeten sich die ersten Anzeichen meiner sexuellen Enthaltsamkeit. Der Körper stellt seine unabweisbaren Forderungen. So lange war ich schon allein, daß mich sogar eine Feministin hätte verlocken können. Ein leichter, aber beharrlicher Kitzel in den Lenden war nicht zu verkennen. Eine Stewardess kam vorüber, deren lockende, üppige Formen der straff sitzende Rock deutlich nachzeichnete. Ich rief sie zu mir und bat sie, mir ein Glas Gin zu bringen. Als die Maschine zum Landeanflug ansetzte, wäre ich mit ihr bereits bis ans Ende der Welt gegangen. Sie hieß Gina, war Kommunistin, blond und sentimental. Ich schlug ihr vor, die Nacht in Athen gemeinsam zu verbringen. Ich glaube, ich war ihr von A bis Z zuwider. Den Flughafen verließ ich wie eine Ratte, dürfte doch mein Gang die Flugzeugtreppe hinab kaum anmutiger gewesen sein als das vierbeinige Gewackel eines solchen Tieres.
In Athen hielt ich eine Lesung, die ‹Aufsehen› erregte, auch wenn man dergleichen nicht von sich selbst sagen sollte. Nach dem Abendessen, das ich mit einem guten Freund, dem Lyriker Tassos Denegris, in einer Gaststätte in Piräus einnahm, kehrte ich in mein Hotel oben auf dem Lykabettos zurück. In der Bar stieß ich betrüblicherweise auf eine junge spanische Journalistin, die ich von den Dreharbeiten zu Prinz und Bettelknabe in Budapest her kannte. Das Kokain kam ihr förmlich zu den Ohren heraus. Bei meinem Anblick rief sie aus: «Ja, da leck mich einer am Arsch! Du bist es!»
«Eben der», gab ich zur Antwort. «In Person.»
«Was führt dich nach Athen?»
«Eine Lyriklesung.»
«Ist ja toll», sagte sie. «Dieser Idiot da ist so was von fade» – mit diesen Worten wies sie auf eine Art gramvoll vor sich hinblickenden Mandrill, der mit großer Anstrengung ein Getränk von abscheulich orangener Färbung in sich hineinschüttete.
«Ich werde ihn zum Teufel schicken», teilte sie mir mit und machte eine verschwörerische Handbewegung. «Wenn du möchtest, gehen wir woanders hin.»
«Eigentlich wollte ich mich schlafen legen», teilte ich ihr mit. «Ich hab ein paar Tage schwer gearbeitet und so gut wie nicht geschlafen.»
«Na hör mal. Ein Gläschen.»
«Nein.»
«Und was ist mit einem Nümmerchen?»
«Glaub mir», versuchte ich die Katastrophe abzuwenden, «diese Nacht mit mir zu verbringen wäre so, als wenn du dich mit dem heiligen Alfonso Maria de Ligorio ins Bett legtest.»
«Das käme darauf an», säuselte sie aufdringlich und mit unübersehbarem Schlafzimmerblick.
«Es wäre wirklich sinnlos», beharrte ich.
«Laß mich nur machen …»
«Du würdest mir höchstens mit Gewalt einen rausquetschen.»