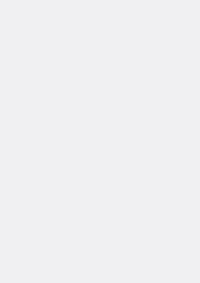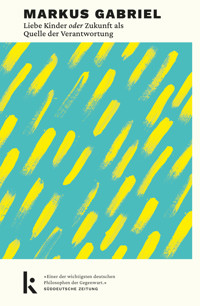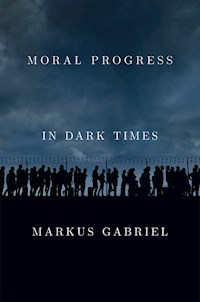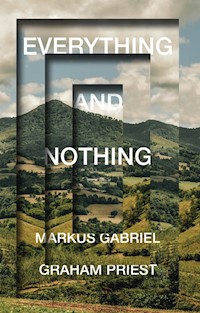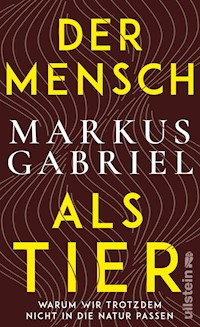
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Markus Gabriel über drängende Fragen unserer Zeit: Ist der Mensch "nur" ein Tier? Wie viel Tier steckt im Menschen? Wo stehen wir in der Natur? Um unsere drohende Selbstausrottung zu verhindern, müssen wir Menschen lernen, damit zu leben, dass wir Tiere sind und niemals imstande sein werden, unsere körperliche und seelische Verwundbarkeit zu überwinden. Seit unvordenklichen Zeiten beschäftigt uns die Frage, wer oder was wir Menschen sind. Sind wir nichts anderes als vernunftbegabte Tiere? Oder sind wir die Krone der Schöpfung, selbst wenn wir nicht an eine Schöpfung glauben? Sind wir deshalb "bessere Tiere"? Oder "schlechtere Tiere", weil wir den Zugang zur Natur in uns und um uns verloren haben? Markus Gabriel setzt sich mit diesen Fragen offen, klug und vorurteilsfrei auseinander. Auf beeindruckende Weise verbindet er neueste naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit zeitgemäßer Philosophie. Er fordert die Anerkennung der radikalen Andersheit von Natur und Tier. Dieser Andersheit müssen wir mit einer Ethik des Nichtwissens begegnen. Ausgehend von den Fragen: Was ist ein Tier? Und was ist Leben? führt er uns weiter zur Frage aller Fragen: Was ist der Sinn des Lebens?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Mensch als Tier
Der Autor
Markus Gabriel, geboren 1980, studierte in Bonn, Heidelberg, Lissabon und New York. Seit 2009 hat er den Lehrstuhl für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn inne und ist dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie. Er ist Direktor des interdisziplinären Center for Science and Thought und regelmäßiger Gastprofessor an der Sorbonne (Paris 1) sowie der New School for Social Research in New York City. Seit 2022 ist er Academic Director an The New Institute in Hamburg.
Das Buch
Seit unvordenklichen Zeiten beschäftigt uns die Frage, wer oder was wir Menschen sind. Sind wir nichts anderes als vernunftbegabte Tiere? Oder sind wir die Krone der Schöpfung, selbst wenn wir nicht an eine Schöpfung glauben? Sind wir deshalb »bessere Tiere«? Oder »schlechtere Tiere«, weil wir den Zugang zur Natur in uns und um uns verloren haben? Um unsere drohende Selbstausrottung zu verhindern, müssen wir Menschen lernen, damit zu leben, dass wir Tiere sind und niemals imstande sein werden, unsere körperliche und seelische Verwundbarkeit zu überwinden. Markus Gabriel fordert die Anerkennung der radikalen Andersheit von Natur und Tier. Dieser Andersheit müssen wir mit einer Ethik des Nichtwissens begegnen. Ausgehend von den Fragen: Was ist ein Tier? Und was ist Leben? führt er uns weiter zur Frage aller Fragen: Was ist der Sinn des Lebens?
Markus Gabriel
Der Mensch als Tier
Warum wir trotzdem nicht in die Natur passen
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2022 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Uta RüenauverAutorenfoto: © Gerald von ForisUmschlaggestaltung: Rothfos & GablerUmschlagmotiv: © Shutterstock/ashetanaE-Book powerded by pepyrusISBN 978-3-8437-2789-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Einleitung
Erster Teil Wir und die anderen (Tiere)
Das Logiktier – Wie der Mensch zum Tier wird
Das spezifische Etwas
Die Natur ist keine Safari
Das Anthropozän als Selbstüberschätzung
Das Geflecht: Pflanzen, Fledermäuse, Pilze
Kontinuität, Diskontinuität oder doch irgendwie beides?
Spiegelfechterei
Was heißt es eigentlich, sich selbst als Tier zu verstehen?
Warum wir keine Amphibien sind
Das Tierwort – Warum es den Zoo nicht gibt
Animalismus, Prestige und Die Anomalie
Der Mensch als Tier als Maschine?
Tiere wie wir? Korsgaards Werte
Alice Crary – Inside Ethics
Subjektivität und Objektivität – Warum wir keine Fremdlinge in der Natur sind
Neue Aufklärung im Zeitalter des Lebendigen
Kants vier Fragen – Der Mensch als Frage-Antwort
Der Mensch als das Tier, das keines sein will
Zweiter Teil Der Sinn des (Über-)Lebens
Die Grundidee des liberalen Pluralismus
Die Geschichte des Lebens
Die Idee des Lebens
Leben und Überleben – Die Grundform der menschlichen Gesellschaft
Wollen wir für immer leben?
Der Sinn im Leben
Der Sinn des Lebens ist kein Unsinn
Unsinn ist Sinnentzug
Grenzen des liberalen Pluralismus?
Wer wir sind und wer wir sein wollen – Radikale Autonomie und Neue Aufklärung
Soziale Freiheit und der Sinn des Lebens
Warum die Naturwissenschaften nicht entdeckt haben, dass das Leben keinen Sinn hat
Vom Geist zurück zur Natur
Dritter Teil Unterwegs zu einer Ethik des Nichtwissens
Natur, Umwelt, Universum
An und für sich …
Sind die Naturwissenschaften Fiktionen?
Grenzen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis
Andersheit – Aufbruch zu einer ökologischen Ethik
Unterkomplex, komplex, überkomplex
Homo sapiens oder der Weisheitsspruch des Sokrates
Meinungen, Wissen und die Idee des Guten
Noch einmal: Es gibt moralische Tatsachen und ethische Fakten
Nichtwissen
Ethik des Nichtwissens
Danksagungen
Glossar
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Einleitung
Widmung
Für Leona MayaDu überstrahlst die Logik mit Lebenund die findigen Tiere merken es schon,daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sindin der gedeuteten Welt.Rainer Maria RilkeEinleitung
Der Mensch befindet sich in einem komplexen Krisenszenario. Unser Habitat, die Umwelt, droht vor aller Augen unter dem Druck unserer modernen Lebensform zu kollabieren. Dank Naturwissenschaft und Technik haben wir einerseits unsere Überlebensbedingungen rasch verbessert und sie andererseits noch rascher verschlechtert – ein Dilemma, das sich mit jeder modernen Krise weiter verschärft.
Inzwischen hat uns das Zivilisationsmodell der Moderne, das darin besteht, die Ressourcenprobleme des Überlebens unserer Spezies durch Naturwissenschaft und Technik unter Kontrolle zu bringen, an den Rand der Selbstausrottung gebracht. Unsere Instrumente der Natur- und Gesellschaftsbeherrschung (Atomkraft, Automobile, Flugzeuge, Smartphones, Künstliche Intelligenz, Waffensysteme, das Internet usw.) wenden sich gegen uns. Es ist geradezu paradox, dass unser technologisches Wissen, dank dem wir über das Internet, KI und soziale Netzwerke verfügen, zugleich die Grundlage dafür ist, dass sich Fake News, Propaganda und Verschwörungsideologien wie ein Lauffeuer verbreiten. Und durch Automobile, Flugzeuge und unsere fossile Lebensform sind wir einerseits besser denn je miteinander vernetzt und können mit räumlich weit entfernten Kulturen und Menschen interagieren, während wir dadurch andererseits unsere geteilte Umwelt zerstören.
Es ist illusorisch, die komplexe Krisenlage der Spätmoderne, in der wir uns befinden, durch mehr vom Gleichen bewältigen zu wollen.1 Stattdessen bedürfen wir einer Neuorientierung unseres Menschen- und Naturbildes. Darum geht es in diesem Buch.
Sein Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass wir Menschen Tiere sind. Die französische Philosophin Corine Pelluchon spitzt dies in einer Reihe von Büchern mit der konkreten Forderung nach einer Neuen Aufklärung zu, in deren Zentrum der Mensch als Tier steht.2
Diese Neue Aufklärung, der inzwischen viele globale Vordenker:innen3 auf allen Kontinenten verpflichtet sind, setzt nicht bei der Natur, sondern bei unserer Natur an. Es gilt, uns selbst als geistiges Lebewesen, d. h. den ganzen Menschen (der als geistiges Lebewesen ein Mischwesen aus Natur und Geist ist) wieder ins Zentrum zu rücken, von dem wir uns zu Unrecht zugunsten einer mechanistischen Vorstellung der Welt als letztlich kontrollier- und vorhersagbarem Gefüge entfernt haben.
Dies wiederum wirft eine alte Frage auf, der wir uns erneut stellen müssen: Was bedeutet es eigentlich, den Menschen als Tier zu betrachten?
Diese Frage ist deswegen so wichtig, weil unser Selbstbild als Tier einen wesentlichen Beitrag zu den soziopolitischen Steuerungsmechanismen der Gegenwart und Zukunft liefern kann. Das lässt sich im Umgang mit Pandemien und anderen Naturkatastrophen leicht erkennen: Krankheit und (menschengemachter) Klimawandel werden als prinzipiell vermeidbare Übel wahrgenommen, die sich technisch möglichst zeitnah beheben lassen sollen. Das ist weder im Fall von SARS-CoV-2 noch gar beim Klimawandel gelungen. Beide werden bisher fast ausschließlich reaktiv und nicht proaktiv behandelt.
Unsere prognostischen Modelle und Lösungsansätze scheitern an der Herausforderung, der wir als Tiere ausgesetzt sind, die ihre ökologische Nische niemals vollständig durchschauen, geschweige denn technisch kontrollieren können. Wir müssen uns daher von der Illusion befreien, unsere Richtlinien für die Krisen- und Katastrophenzeit, in der wir uns befinden, durch eine Kombination aus Naturwissenschaft, Technik und Politik allein zu erhalten.
Wir erfahren durch wissenschaftlichen Fortschritt (das gilt für alle, auch die geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen) stets auch mehr darüber, was wir nicht wissen. Die täglich stattfindende Verschiebung der Grenzen des Wissens besteht nicht darin, dass wir uns dem Allwissen nähern. Es gibt kein Allwissen. Und es gibt auch keine sinnvolle Möglichkeit, die Überlebensbedingungen des Menschen in komplexen Systemen technokratisch zu verwalten. Das Leben lässt sich nicht einhegen, es lässt sich auch nicht vorhersagen, wie die Viruspandemie mit ihren vielfältigen Varianten eindrücklich belegt. Wir kennen immer nur Ausschnitte unserer eigenen Lebensform, das Tier Mensch lässt sich nicht durch Technik überwinden, der Homo Deus, den der berühmte Historiker Yuval Noah Harari in seinem gleichnamigen Buch als Mensch der Zukunft entwirft, wird nicht kommen.
Genau das war eigentlich von Sokrates bis Carl von Linné bekannt, denen wir unseren Artnamen als homo sapiens verdanken: Weil wir uns nicht vollständig durchschauen können, sind die Selbstmodelle, auf die wir angewiesen sind, fehleranfällig. Linné definiert den Menschen über die Fähigkeit, sich ein Bild von sich selbst zu machen. Der Eintrag homo, den Linné in seinem System der Natur den Primaten zuordnet, womit er den Menschen eindeutig im Tierreich verortet, ergänzt er durch das Merkmal der Weisheitsfähigkeit, der sapientia, die unser summum attributum, unsere vorzüglichste Eigenschaft sei. Der Mensch wird auf diese Weise über die Aufforderung definiert, sich selbst zu erkennen. Neben dem Eintrag homo in seinem System steht daher lapidar: nosce te ipsum, also erkenne dich selbst, womit Linné auf Sokrates anspielt. Die Devise und der Auftrag der Philosophie ist und bleibt Sokrates zufolge das »Erkenne dich selbst (gnôthi sauton)« – ein Ausspruch des delphischen Orakels, den Sokrates mit Weisheit (sophia) in Verbindung gebracht hat. Linné übersetzt das lediglich ins Lateinische. Weil sie der Liebe zur Weisheit verpflichtet sind, was eine mögliche Übersetzung des griechischen Worts philo-sophia ist, sind Philosophinnen und Philosophen überall dort gefragt, wo es darum geht, wer wir, die Menschen, sind.
In der Philosophie geht es um Selbsterkenntnis. Dazu gehört die Einsicht in unsere Freiheit. Als geistige Lebewesen sind wir frei, woraus der Wert der Autonomie, des eigenverantwortlichen Handelns, folgt, der derzeit auch im Herzen Europas unter Druck gerät. Um Werte wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität in ein angemessenes Verhältnis zu setzen und damit das Vertrauen in die Lösungskompetenz der liberalen Demokratie zurückzugewinnen, muss der Mensch als freies, geistiges Lebewesen wieder ins Zentrum der Gesellschaft rücken. Freiheit ist dabei immer auch soziale Freiheit, weil wir prosoziale Lebewesen sind, die nichts tun können, ohne dies im Verbund mit anderen zu tun. Freiheit und Gesellschaft, Individuum und Kollektiv widersprechen sich nicht. Man ist nicht freier, wenn man allein ist, weil wir das meiste dessen, was uns als Menschen interessiert, gar nicht ohne andere tun können. Freiheit ist etwas, was wir gemeinsam realisieren, und nicht etwas, was uns gegeneinander in Stellung bringt.
Es gibt vieles, was Sie und ich gemeinsam haben. Mindestens teilen wir die Eigenschaft, ein Mensch zu sein. Damit haben wir vieles Weitere gemeinsam. Wir haben Wünsche, Hoffnungen und Ängste und sind als endliche, vergängliche Lebewesen verkörpert. Wir gehören zur Natur. Die moderne Physik lehrt, dass es Kräfte und Naturgesetze gibt, die alles Materielle bestimmen. Sofern wir materiell, als Tiere verkörpert sind, bilden wir hiervon keine Ausnahme. Die moderne Biologie und Humanmedizin haben uns darüber hinaus gezeigt, dass unsere Körper auf einer elementaren Ebene ›tierisch‹4 sind und viele Grundstrukturen mit anderen Lebewesen teilen.
Alle uns bekannten Lebewesen bestehen aus Zellen (oder sind, wie Einzeller, mit einer einzigen Zelle identisch), die wiederum aus Bausteinen bestehen, die biochemisch und physikalisch erforschbar sind. Damit befassen sich die heute sogenannten Lebenswissenschaften (Medizin, Biochemie, Molekularbiologie, Bioinformatik, Genetik, Pharmakologie, Zoologie, Ernährungswissenschaft, Neurowissenschaften usw.), deren Gegenstand Prozesse und Strukturen des Lebendigen sind.
Im Laufe der Moderne sind zur Physik und den Lebenswissenschaften Erkenntnisse über das Verhalten von Menschen und anderen Lebewesen hinzugekommen, die heute in Verhaltenswissenschaften wie der Psychologie, Kognitionswissenschaft, Verhaltensökonomik und Soziobiologie erforscht werden. Dabei stellt sich heraus, dass wir als Menschen auf verschiedenen Ebenen unserer Existenz (von der Zelle bis hin zu sozialen Verbünden wie der Familie, Freundesgruppe oder gar einer gesamten Gesellschaft) bis zu einem gewissen Grad entziffer- und somit auch steuerbar sind. Viele der unzähligen Entscheidungen, die wir jeden Tag bewusst und nicht-bewusst treffen (wann wir frühstücken; mit wem wir uns verabreden; wie lange wir uns die Hände waschen; auf welcher Straßenseite wir gehen; ob wir auf dem Bauch oder dem Rücken einschlafen usw.), lassen sich wissenschaftlich dadurch erklären, dass man in ihnen mehr oder weniger allgemeine Muster erkennt.
Der Mensch ist somit vom Standpunkt der dritten Person,5 wie man dies in der Philosophie bezeichnet, zugänglich, er ist ein Gegenstand natur- und sozialwissenschaftlicher Forschung, ein Forschungsobjekt unter anderen. Auf diese Dimension des Menschseins spielt der Titel dieses Buchs an: Der Mensch als Tier.
Doch das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Denn trotz der genannten modernen natur-, lebens- und verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse über den Menschen als Tier empfinden wir, dass wir trotzdem nicht in die Natur passen. Der Mensch ist nicht nur ein Tier. Darauf spielt der Untertitel des Buchs an.
Wir sind nicht nur Naturphänomene, was man daraus ableiten kann, dass wir Naturphänomene erklären. Die Erklärung der Naturphänomene und damit auch derjenigen Aspekte unseres Lebens, die irrational sind, ist schließlich selbst nicht irrational.
Darauf weist jüngst auch der berühmte Kognitionswissenschaftler Steven Pinker hin, der uns daran erinnert, dass Logik, Mathematik und kritisches Denken rational sind und auch von unseren Vorfahren eingesetzt wurden, um erfolgreich zu jagen, sich zu ernähren und über Tausende von Jahren eine stabile Beziehung zu anderen Menschengruppen und der geteilten Umwelt aufzubauen.
Der Mensch ist und bleibt grundsätzlich rational, was nicht bedeutet, dass er fehlerfrei wäre, was die Erkenntnisse der modernen Verhaltensforschung, Psychologie usw. belegen. Aus ihnen allerdings zu schließen, dass wir leider doch nicht rational sind – ein Schluss, der ja selbst rational wäre –, ist nicht richtig.6
Wenn wir in der Moderne entdeckt haben, dass das ›Tier in uns‹ von nicht-rationalen Impulsen, Instinkten, Prozessen und Kräften gesteuert wird, kann dies nicht unsere gesamte Existenz betreffen. Ansonsten träfe dies auch auf die wissenschaftliche Erklärung selbst zu. So wissen wir einerseits, dass unsere Entscheidungen auf kognitiven Verzerrungen (Bias) sowie auf »Lärm (noise)« beruhen, also auf Entscheidungsgrundlagen, die nach irrationalen Regeln zustande kommen. Andererseits unterliegt dieses Wissen, diese Selbsterkenntnis, nicht ihrerseits eben diesen kognitiven Verzerrungen, weil wir ansonsten nicht rational Auskunft über die Grenzen unserer Rationalität geben könnten. Dieses Wissen ist vielmehr objektiv, durch wissenschaftliche Methoden abgesichert, eben drittpersonal. Kurzum: Es gibt objektives Wissen über uns als Objekte und Subjekte.
Die Evolutionstheorie, Tiefenpsychologie, Soziologie und Verhaltensforschung, vor allem die Verhaltensökonomik haben in der Tat gezeigt, wie sehr unser Denken, individuelles und kollektives Handeln von Kräften und Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird, die wir nicht gänzlich kontrollieren können. Spätestens seit den internationalen Bestsellern des Psychologen und Nobelpreisträgers Daniel Kahneman ist es allgemein bekannt, dass wir jedenfalls nicht ganz so rational und vernünftig sind, wie wir dies gerne meinen.7 Unsere Impulse, Wünsche und inneren mentalen Zustände sind immer auch Teil der Naturphänomene und damit von Prinzipien geprägt, die wir nicht in der Hand haben. Ein Teil unserer selbst, unser ›Tiersein‹, scheint mithin geradezu von außen – von Naturgesetzen, der Evolution, der Gesellschaft usw. – gesteuert zu werden.
Wir beharren etwa hartnäckig auf Überzeugungen, auch wenn wir bereits Informationen haben, die ihnen widersprechen, was als Bestätigungsverzerrung (confirmation bias) bezeichnet wird. Die Liste kognitiver Illusionen oder Verzerrungen ist lang, und wir wissen alle, dass wir eine Perspektive auf die soziale und natürliche Wirklichkeit haben, die keineswegs automatisch richtig ist und die wir deswegen dauernd korrigieren. Doch können wir unsere Beschränkungen gemeinsam mit anderen und durch Arbeit an uns selbst korrigieren.
Dass wir kognitive Verzerrungen psychologisch, sozialwissenschaftlich und durch alltägliche Praktiken der Entscheidungsfindung korrigieren können, beweist, dass kognitive Verzerrungen keine Naturnotwendigkeit sind. Wir sind und bleiben frei, woran die Tatsache, dass wir uns täuschen können, weil wir immer nur selektiv wahrnehmen und denken können, nichts ändert.
Die Frage, was oder wer der Mensch ist, ist keineswegs endgültig beantwortet. Denn wir wissen heute nicht, worin unser Bewusstsein sowie unser Geist bestehen, dank denen wir uns selbst überhaupt als Naturphänomen betrachten können. Es gibt nicht nur den Standpunkt der dritten Person, die Außenperspektive auf uns, sondern es gibt auch noch: uns (d. h. zum Beispiel Sie und mich). Wir teilen nicht nur biochemische Strukturen wie das menschliche Genom, sondern auch, dass wir Subjekte sind, also jeweils unseren eigenen Standpunkt der ersten Person (Subjektivität) einnehmen. Zu diesem gehören die Wirklichkeit unserer Gefühle und Gedanken, aber auch unsere sinnliche Perspektive und unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das Rätsel des Menschseins kann nicht rein objektiv im Sinne von drittpersonal gelöst werden. Es gibt keine Außenperspektive auf das Menschsein, die wir einnehmen könnten, um von dort aus den Sinn des Lebens zu ermessen bzw. zu erkennen, dass unser Leben gar keinen Sinn hat.
Selbst die objektivste Naturwissenschaftlerin, sagen wir eine Chirurgin, die am offenen Herzen operiert, hat ihre subjektive Perspektive auf das Geschehen. Die Chirurgin muss schließlich das Herz sehen, an dem sie operiert, und dabei innerlich gefasst und professionell vorgehen, was eine Menge Arbeit an sich selbst erfordert. Die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston und der Wissenschaftshistoriker Peter Galison haben in ihrem Buch Objektivität eindrücklich nachgewiesen, dass die Geschichte der Objektivität darin besteht, ein Verhaltensideal des Wissenschaftlers zu entwerfen, um auf diese Weise die Naturphänomene möglichst neutral erkennen zu können.8 Keine Objektivität ohne eine zu dieser passenden Subjektivität; Objektivität bleibt ein Ideal, das wir anstreben, ohne es jemals vollständig zu erreichen.
Es soll im Folgenden um nichts Geringeres als darum gehen, das Verhältnis von Natur und Geist anhand der Schnittstelle Mensch-Tier zu untersuchen. Im Menschen als Tier reichen sich Natur und Geist die Hand. Die Selbsterforschung des Menschen nennt man Anthropologie; sofern wir uns dabei als Tiere betrachten, spricht man auch von Anthrozoologie. Wenn es im Folgenden um den Menschen als Tier geht, lasse ich mich von Auseinandersetzungen mit gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ebenso leiten wie von Beiträgen der Gegenwartsphilosophie.
Der Mensch ist das transdisziplinäre Thema schlechthin. Wer wir sind und wer wir sein wollen, kann nicht aus der Perspektive einer einzigen Wissenschaft oder einer einzigen Art von Wissenschaft (etwa den Naturwissenschaften) ermessen werden. Und die Wissenschaften, die wir als akademische Disziplinen in Lehre und Forschung voranbringen, erschöpfen unser Menschsein ebenfalls nicht. Die Künste, die Politik, der gesunde Menschenverstand, die Wirtschaft und die Arbeitswelt, die Medien und unsere Lebenserfahrung sind als menschliche Tätigkeiten allesamt auch Formen der menschlichen Selbsterkenntnis.
Vor diesem Hintergrund richtet sich das Buch aus einer philosophischen Perspektive an alle, die sich fragen, worin das Menschsein und der Sinn des Lebens bestehen und wie unsere Wissensgesellschaft damit vereinbar ist, dass wir vermutlich unendlich weit von Allwissen sind. Ob uns dies gefällt oder nicht, gerade die komplexe Krisenlage, in der sich die Menschheit im 21. Jahrhundert befindet, belegt nicht nur unser Wissen (etwa bezüglich der ökologischen Krise), sondern auch unser Nichtwissen und unsere Ohnmacht. Deswegen müssen wir umdenken und unser Handeln den neuartigen Umständen dieses Jahrhunderts anpassen, was auch voraussetzt, endlich von denjenigen zu lernen, die Opfer des modernen Kontrollwahns und der Naturzerstörung waren und sind. Menschliche Selbsterkenntnis und Rationalität können viele Formen annehmen, von denen wir lernen können, wie etwa Tyson Yunkaporta in seinem bemerkenswerten Buch Sand Talk gezeigt hat, in dem er das indigene Wissen der Aborigines (er selbst ist Angehöriger des Apalech-Clans) als dynamisches Modell eines Umgangs mit Komplexität und Krisen empfiehlt.9
Die These, dass der Mensch das transdisziplinäre, uns alle betreffende Thema schlechthin ist, wird dabei vom Standpunkt der Geisteswissenschaften aus getroffen, die – so wie ihr Name dies schon ganz richtig sagt – den Geist zum Subjekt und Objekt haben. Hierbei verstehe ich unter »Geist« kein Gespenst oder irgendein Relikt eines angeblich vergangenen und überwundenen metaphysischen oder religiösen Denkens. Geist ist vielmehr im Allgemeinen die Fähigkeit, sein Leben im Licht einer Vorstellung davon zu führen, wer oder was man ist. Dass wir geistige Lebewesen sind, ist die Hauptthese des Neo-Existenzialismus.10
Der Mensch ist das Tier par excellence: Was wir über das Tiersein wissen, ergibt sich aus unserer Selbsterforschung, weil wir uns für ›die Tiere‹ seit Jahrtausenden vor allem deswegen interessieren, weil unklar ist, wie Mensch und Tier sich zueinander verhalten. Im Nachdenken über ›die Tiere‹ geht es also immer auch um uns. Dank unserer Selbstauffassung als Tier sind wir der Prototyp des Tierseins. Der Tierbegriff, so werde ich argumentieren, sagt mehr über den Menschen als über die ›Tiere‹ aus, von denen wir uns seit Jahrtausenden auf eine falsche Weise unterscheiden.11
Weil wir als Tiere Teil der Natur sind, sind wir mit dem Lebendigen verwoben, sodass unser Handeln immer auch ökologisch, im Zusammenhang mit anderen Lebewesen und unserem geteilten Habitat, dem Planeten Erde, betrachtet werden muss. Wer wir sind und wer wir sein wollen, zeigt uns mithin auch, was wir tun bzw. unterlassen sollen.12 In der menschlichen Selbsterkenntnis reichen sich Sein und Sollen die Hand.
Offensichtlich stößt das heute wirksame Menschen- und Weltbild an seine planetarischen Grenzen. Inzwischen ist es allgemein bekannt und sogar von Wirtschaftsministern und führenden Ökonomen anerkannt, dass es »Grenzen des Wachstums« gibt, wie der Club of Rome zur Lage der Menschheit und Weltwirtschaft bereits 1972, also vor inzwischen fünfzig Jahren, feststellte.13
Wir müssen die Idee überwinden, dass sich der naturwissenschaftlich-technologische Fortschritt als Treiber rein quantitativen Wirtschaftswachstums vom humanen und moralischen Fortschritt entkoppeln lässt. Denn diese irrige Idee führt zur Selbstzerstörung des Menschen. Sie ist Ausdruck eines gestörten Selbstverhältnisses, das es zu durchschauen und zu überwinden gilt.
Wir drücken unser Selbstverhältnis individuell und kollektiv, als Einzelne und als Gesellschaft, in starken Wertungen aus. In jeder Gesellschaft zirkulieren Visionen des guten Lebens. Vor diesem Hintergrund geht es im Folgenden auch um den Sinn des Lebens. Weil der Mensch ein ›Tier‹, aber nicht nur ein ›Tier‹ ist, erschöpft sich der Sinn des Lebens nicht in der individuellen und soziopolitischen Planung unseres Überlebens. Leben ist mehr als Überleben.
Ich werde versuchen, den liberalen Pluralismus der individuellen Lebensformen – den ich auch im 21. Jahrhundert für tragfähig halte – mit der Frage nach dem Sinn des Lebens zu verbinden. Dabei hilft die Gegenwartsphilosophie. Die US-amerikanische Philosophin Susan Wolf hat vorgeschlagen, den liberalen Pluralismus (»Ein jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden«) als eine Suche nach dem Sinn im Leben aufzufassen. Dieser kann für jeden anders ausfallen. Allerdings schließt das nicht aus, dass es einen Sinn des Lebens gibt, den wir alle teilen und auf dessen Grundlage der liberale Pluralismus steht. Unser Grundgesetz drückt dies mit einem starken Bekenntnis zur Menschenwürde aus, worin die aufklärerische Tradition nachwirkt. Das Nachdenken über unser Tiersein, das Leben und seinen Sinn hat politische Konsequenzen.
Im Rahmen einer Neuen Aufklärung im Zeitalter des Lebendigen, wie dies Corine Pelluchon jüngst treffend bezeichnet hat, können wir den Sinn des Lebens als unseren moralischen Auftrag verstehen.14 Das entspricht dem derzeit spürbaren gesellschaftlichen Aufbruch, der mit der Sehnsucht verbunden ist, eine neue Gemeinsamkeit der Menschen zu finden, um die komplexe Krisenlage, in der wir uns befinden, zu bewältigen. Dieselbe Idee eines Auftrags des Menschen kann man mit Yunkaporta daran festmachen, dass wir »Hüter der Wirklichkeit (custodian of reality)«15 sind.
Für die ökologische Transformation, die die Menschheit in diesem Jahrhundert zwangsläufig stemmen muss, bedarf es einer normativen Gestaltung des sozialen Wandels und damit auch der Ethik. Wir können uns nicht mehr auf das falsche moderne Versprechen verlassen, dass die Natur- und Ingenieurswissenschaften gemeinsam mit Ökonomen die grundlegenden politischen Probleme lösen und uns damit die eigentlichen normativen Entscheidungen darüber abnehmen, wer wir sind und sein wollen.
Die Selbstauffassung des Menschen hat politische Konsequenzen. Die spürbare und von vielen Soziologinnen und Politikwissenschaftlern beobachtete Demokratiekrise rührt auch daher, dass Menschen mehr von der Politik verlangen als eine geschickte Ressourcenverteilung. In Krisenzeiten kommt es massiv auf dasjenige an, was man zu unkritisch als »Kommunikation« bezeichnet. Politikerinnen und Politiker sollen nicht nur ihre Entscheidungen klug kommunizieren, um die Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen, sondern ihre Entscheidungen begründen und auf diese Weise die Wertungen explizit machen, die sie vornehmen. So verlangen etwa die von der verheerenden Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal (aus dem ich selbst stamme) nicht nur, dass man die politischen Entscheidungen im Nachgang der Katastrophe gut kommuniziert, sondern dass gemeinsam nach wertegeleiteten Lösungen gesucht wird. Der Wiederaufbau der zerstörten Regionen soll im Licht ökologisch nachhaltiger Modelle geschehen.
Zur modernen Wissenschaft gehört auch die Erkenntnis der Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis. Wir wissen, dass wir vieles nicht wissen. Die Krisenlagen, in denen wir uns befinden, bestehen auch darin, dass wir mit Komplexität, Unsicherheit und Nichtwissen umgehen müssen. Das erfordert eine Ethik des Nichtwissens.
Der Grundgedanke, der sich durch das Buch zieht, ist die Idee, dass wir über die Selbsterforschung unseres Tierseins lernen können, die Natur in uns und außer uns als etwas zutiefst Fremdes anzuerkennen, das wir nicht beherrschen können und auch nicht beherrschen sollen. Wir können die Natur niemals vollständig entziffern und unter unsere Kontrolle bringen. Wir Menschen sind auf Naturprozesse angewiesen, die wir konkret nicht ansatzweise so weit durchschauen können, dass wir ein technokratisches Paradies auf Erden etablieren könnten. Von eitlen Hoffnungen wie der Vorstellung, wir könnten andere Planeten (wie den Mars) besiedeln, um neu anzufangen, oder der noch abwegigeren Fantasie, wir könnten unser Bewusstsein wie in der Fernsehserie Westworld als Software auf unkaputtbare Plastikkörper hochladen, müssen wir uns verabschieden. Die Corona-Pandemie hat unsere Verwundbarkeit sowie die soziale Komplexität für uns alle spürbar offengelegt.
Komplexität und Verwundbarkeit bestanden auch schon vor der Pandemie, waren aber sozusagen »demobürokratisch« (Niklas Luhmann) überdeckt, d. h., sie waren uns nicht bewusst, weil insbesondere unser Gesundheitssystem für die meisten Menschen mehr oder weniger reibungslos funktionierte. Die Erkenntnis, dass der Mensch ein verwundbares Tier ist, das ökologischen Transformationen ausgesetzt ist, die es teils selbst zu verantworten hat, muss der Politik immer innewohnen. Da wir nicht nur Tiere, sondern geistige Lebewesen sind, die über ethische Einsicht in moralische Zusammenhänge verfügen, sind Anthropologie, Ethik und Politik im Menschen untrennbar miteinander verwoben.
Die Neue Aufklärung fordert zwar, dass wir mehr Wissenschaften (vor allem auch die Geistes- und Sozialwissenschaften auf Augenhöhe mit den Natur-, Lebens- und Verhaltenswissenschaften) einsetzen, um ein angemessenes Selbstporträt des Menschen zu erarbeiten. Sie fordert darüber hinaus aber auch eine Ethik des Nichtwissens, die auf der Anerkennung der Tatsache beruht, dass wir nicht einmal näherungsweise in einem Zeitalter der vollständigen Naturerkenntnis und -beherrschung leben. Die fraglos beeindruckenden und teils wünschenswerten Erkenntnis- und Technikfortschritte der Moderne dürfen nicht länger darüber hinwegtäuschen, dass es unbestimmt, vielleicht sogar unendlich vieles gibt, was wir nicht wissen und niemals wissen werden. Wie groß auch immer unser Wissen von der Natur ist, unser Nichtwissen ist noch größer (was wir heute sogar wissen, seit deutlich geworden ist, dass das beobachtbare Universum zu 95 Prozent aus dunkler Materie und dunkler Energie besteht, die wir nicht direkt experimentell erforschen können). Die Wirklichkeit überragt unsere Wissensansprüche. Dies ist keine bloße Vermutung, sondern etwas, was wir wissen. Wir wissen also wirklich, dass es vieles gibt, was wir nicht wissen.
Wie wir sehen werden, hatte Sokrates recht, der allerdings nicht gesagt hat, dass wir nichts wissen, sondern vielmehr, dass wir uns dessen bewusst werden können, dass wir vieles nicht wissen. Sokrates’ Weisheit ist eine Form des Wissens und kein skeptischer Kult der Ignoranz. Der Mensch als Tier kann sich seines eigenen Nichtwissens bewusst werden. Das nannte Sokrates Weisheit. Und darin ist ihm Carl von Linné mit seiner Gattungsbestimmung des Menschen als homo sapiens gefolgt. Denn sapiens heißt »weisheitsfähig«, nicht »weise«. Der Mensch ist als geistiges Lebewesen das philosophische Tier, das sich und die nicht-menschliche Wirklichkeit dadurch historisch verändern kann, dass es sich ein Bild seiner selbst macht. Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg, um unser Mensch- und Tiersein, den Sinn des Lebens und die Tiefe unseres Nichtwissens auszuloten!
Erster Teil Wir und die anderen (Tiere)
… immer noch drückt uns dieselbe Unbegreiflichkeit, wie zwischen Materie und Geist Zusammenhang möglich sei.
Wir lassen den Menschen zurück, als das sichtbare, herumwandernde Problem aller Philosophie.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Seit unvordenklichen Zeiten beschäftigt die Menschen die Frage, wer oder was sie eigentlich sind. Um darauf eine Antwort zu geben, müssen wir uns von irgendetwas unterscheiden. Denn etwas zu definieren besteht darin, es von etwas anderem abzugrenzen. Dabei lautet eine der ältesten bekannten Definitionen des Menschen, wir seien vernunft- und sprachbegabte Tiere. Der Mensch, so Aristoteles, ist das zôon logon echon, das Lebewesen, das Logos (Sprache, Vernunft) hat, woraus im Lateinischen das animal rationale, das rationale Tier, wurde.16
Ehe wir uns dieses Merkmal von Sprache und Rationalität, das den Menschen auszeichnen soll, genauer anschauen, ist es wichtig, festzuhalten, dass die älteste bekannte Selbstdefinition des Menschen, also die älteste Anthropologie, den Menschen bereits als Lebewesen bzw. als Tier, als zôon bzw. als animal, bestimmt. Schon vor Aristoteles, in den Phasen des mythologischen Bewusstseins des Menschen, wird der Mensch in das Tierreich eingereiht.
Das biblische Menschenbild ist dabei eher eine Ausnahme, weil es Mensch und Tier stark voneinander trennt. Nur der Mensch ist als Ebenbild Gottes ein herausgehobener Paradiesbewohner. Zwar wird er als Bewohner eines Gartens, als ein Teil der Natur betrachtet, doch, man denke nur an die Geschichte von der Arche Noah, nicht nur als Krone der Schöpfung, sondern auch als das Wesen, das für die Tiere verantwortlich ist.
Als eine erste Beobachtung können wir festhalten, dass der Mensch damit jedenfalls lange vor den Erkenntnissen der Evolutionstheorie sowie der auf sie folgenden rasant fortschreitenden Ausdifferenzierung der Lebenswissenschaften (Medizin, Biochemie, Molekularbiologie, Bioinformatik, Genetik, Pharmakologie, Zoologie, Ernährungswissenschaft, Neurowissenschaften usw.) schon als Lebewesen bzw. als Tier aufgefasst wurde. Ja, es ist sogar der Normalfall der menschlichen Geistesgeschichte, dass der Mensch sich als Tier definiert.
Im Laufe der Jahrtausende hat sich das Menschenbild dabei vor allem dadurch entwickelt, dass wir unser Tierbild verändert haben. Durch die Fortschritte der Naturwissenschaften und der Technik in der Moderne haben wir erkannt, wie komplex die Naturgeschichte ist. Im 19. Jahrhundert hat sich vor allem im Gefolge der darwinistischen Revolution die Einsicht durchgesetzt, dass die vielfältigen Formen des Lebendigen und damit eben auch die Tierarten Prozessen der natürlichen Auslese unterliegen. Sofern wir Tiere sind, passen wir uns auf den verschiedenen Ebenen unseres Lebens unserer Umwelt an, die wir im selben Atemzug natürlich immer auch gestalten. Die Natur, zu der wir gehören, ist kein statischer Behälter, sondern etwas, das wir durch unsere Lebensprozesse verändern. Und heute wissen wir, dass diese Natur, an die wir angepasst sind, schon seit Milliarden von Jahren von Lebensprozessen anderer Lebensformen modifiziert wird, etwa von den Cyanobakterien, die über Millionen von Jahren den Sauerstoff in der Atmosphäre produziert haben.
Im 19. Jahrhundert hat sich neben dem bahnbrechenden Evolutionsgedanken auch die Auffassung durchgesetzt, dass wir unsere Animalität, unser Tiersein, als etwas verstehen, das uns fremd ist und das uns unbewusst steuert. Die damals neu entstandenen Wissenschaften der Biologie, der Psychologie und Psychiatrie haben uns einen Spiegel vorgehalten, in dem wir keineswegs nur rationale Akteure, sondern auch Tiere zu Gesicht bekamen, die sich alles andere als durchgängig vernünftig verhalten.
Die beeindruckenden Erkenntnisse in den Lebenswissenschaften haben im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte dazu geführt, dass wir uns für Marionetten unserer Lebensprozesse halten können. So ist es heute weit verbreitet, zu glauben, unsere Gene, unsere Instinkte, unsere neuronalen Schaltkreise oder unsere biologisch determinierte Persönlichkeit steuerten unsere Entscheidungen. So glaubt etwa der renommierte, mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Neurowissenschaftler Eric Kandel, dass dasjenige, was Freud als das Unbewusste bezeichnet hat, sich inzwischen mit lebenswissenschaftlichen Methoden als ein evolutionäres Erbe verstehen lässt.17 Wir sind demnach nicht nur, wie Freud mutmaßte, nicht »Herr im eigenen Haus«18 unseres Seelenlebens, sondern sogar Fremdlinge im eigenen Körper, der unser bewusstes Erleben, unser Ich, allenfalls als Steuerungszentrale produziert, um sich im Idealfall noch besser an die Umwelt anzupassen.
Wohlgemerkt hat Freud den Menschen nur scheinbar entthront. Er identifiziert nur das berühmte Es sozusagen mit dem ›Tier in uns‹ und schreibt uns Menschen darüber hinaus einen komplexen psychischen Apparat zu. Obwohl Freud uns mit Darwin in die »Tierreihe«19 eingliedern möchte, meint er doch, die anderen Tiere verfügten keineswegs über dasjenige, was er als Ich, ganz zu schweigen von demjenigen, was er als Über-Ich betrachtet. Freuds Auffassung unseres Seelenapparats folgt dem Modell, das Tier in uns (das Es) von unserer Vernünftigkeit (dem Ich und dem Über-Ich) abzugrenzen, die in seinen Augen freilich dauernd von unserem Tiersein, von unseren Trieben, gestört wird, weshalb er bekanntlich mutmaßte, unsere Zivilisation sei von einem Unbehagen geprägt.20
An der Geschichte des Natur-, Körper-, Tier- und Menschenbildes, die ich hier nur anreißen kann, erkennt man, dass es einerseits der Normalfall ist, dass sich der Mensch als Tier definiert, mit der jeweiligen Ausgestaltung des Tierbegriffs aber andererseits auch das Menschenbild variiert. Das in jüngster Zeit als Animal Studies sowie als Anthrozoologie bekannte interdisziplinäre Forschungsfeld befasst sich genau damit. Je nachdem, was man sich unter einem »Tier« vorstellt, verändert sich auch unser Selbst-, d. h. unser Menschenbild, was wiederum ethische Konsequenzen hat. Wenn man etwa zu Recht darauf besteht, dass wir eine Tierethik brauchen, dann aber im Wesentlichen nur an Säugetiere denkt und Insekten ignoriert, weil der Tierbegriff nicht hinreichend weit verstanden wird, wird man ganz anders handeln, als wenn man umgekehrt beinahe alle sich selbst bewegenden, nicht-pflanzlichen Lebensformen (vielleicht sogar Bakterien) schon für Tiere hält, mit denen man ethisch umgehen muss.
Der Satz: »Der Mensch ist ein Tier« hat es deswegen bei genauerer Betrachtung in sich – und darum geht es in diesem Teil des Buchs. Denn einerseits ist es entscheidend, was der Mensch jeweils unter »Lebewesen« bzw. »Tier« versteht, wenn er sich selbst auf diese Weise in ein Naturgeschehen einreiht. Und andererseits ist es mindestens ebenso wichtig, genauer darüber nachzudenken, durch welches weitere Merkmal er sich von den anderen Lebewesen bzw. Tieren unterscheidet, mit denen er seiner eigenen Auskunft gemäß das Tiersein, die Animalität, teilt.
Das Logiktier – Wie der Mensch zum Tier wird
Die Geschichte der Logik wird maßgeblich genau von der Selbstdefinition des Menschen als animal rationale vorangetrieben. Wie gesagt, bestimmt Aristoteles den Menschen als dasjenige Lebewesen, das über Logos verfügt, woraus sich die Idee der Logik ableitet.
Die Logik ist diejenige Grundlagendisziplin der Philosophie, deren Gegenstand das vernünftige Denken selbst ist. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie wir richtig (d. h. vernünftig) denken (bzw. denken sollen), ihre Vollzugsform ist das Denken über das Denken. Die Pointe von Aristoteles’ Definition des Menschen als Logostier ist, dass wir damit auch ein Logiktier sind: Einen Logos zu haben heißt, imstande zu sein, Dinge und sich selbst ausdrücklich von anderem abzugrenzen, also Wissen von sich selbst und anderem zu erlangen.
Seit Aristoteles lehrt die Logik, dass der Paradefall einer Definition gerade darin besteht, dass man zunächst eine Gattung (griechisch genos, lateinisch genus) angibt, zu der etwas gehört, um es sodann von anderen Arten (griechisch eidê, lateinisch species) zu unterscheiden. Der Ursprung der wissenschaftlichen Einteilung des Lebendigen in Gattungen und Arten ist die altgriechische Logik.
Seit den alten Griechen wird der Stammbaum des Lebendigen auf eine höchste Gattung bezogen, die von göttlichen Lebewesen repräsentiert wird, die der Mensch nachahmen soll, um ihnen gleich zu werden. In dieser Tradition wird die Ordnung von Gattung und Spezies als Hierarchie betrachtet: Je höher etwas in der Hierarchie steht, desto näher soll es der Spitze der Wertordnung, dem vollendeten Sein oder dem Guten stehen. Hierarchie heißt übrigens wörtlich übersetzt »heilige Ordnung«, und der Gedanke stammt insbesondere aus der Angelologie, also aus der spätantiken und dann mittelalterlichen Diskussion darüber, wie sich der Mensch zu den Engeln und letztlich zu Gott als der Quelle allen Seins und Denkens verhält. Der Klassiker auf diesem Gebiet ist die Schrift Über die himmlische Hierarchie des sogenannten Pseudo-Dionysios Areopagita. Sie stammt aus dem 5. oder 6. Jahrhundert und untersucht die Ordnung der Engel. Der in Wirklichkeit unbekannte Autor dieser Schrift hat den Begriff der Hierarchie geprägt, der damit immer auch eine theologische Dimension aufweist. Der Mensch definiert sich seit Jahrtausenden eben nicht nur im Unterschied zum Tier (bzw. zu den anderen Tieren), sondern immer auch im Unterschied zu göttlichen Wesen.
Diesen Aspekt darf man auch heute nicht mit dem naiven Hinweis auf ein weitverbreitetes säkulares Menschenbild beiseiteschieben, das uns als mehr oder weniger normales Element in der Reihe der Naturerscheinungen betrachtet. Denn viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen glauben auch in unseren Zeiten, dass wir eine privilegierte Stellung im Tierreich einnehmen, ja sogar, dass wir über eine unsterbliche Seele verfügen oder wiedergeboren werden, dass wir also jedenfalls keineswegs identisch mit unserem Tierkörper sind, der sich vielleicht eines Tages vollständig in der Sprache der heutigen Lebenswissenschaften beschreiben lassen wird.
Der Tierbegriff, der das Reich des Lebendigen in Gattungen und Arten unterteilt, ist seinem historischen Ursprung zufolge also keineswegs wertneutral. Vielmehr enthält er von vornherein Wertungen, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden. So wird etwa auch zwischen normalen Exemplaren einer Art und ihren Abweichungen unterschieden, sodass die Begriffe des Menschen, des Löwen, der Taube usw. als Normalformen verstanden werden, von denen mangelhafte Exemplare abweichen – eine Auffassung, die zu Recht von den Gendertheorien oder den disability studies kritisiert wird.
Die griechischen Philosophen gingen grundsätzlich davon aus, dass die fundamentalen Prinzipien der Wirklichkeitsordnung in ihrem Wesen mächtiger und auch besser sind als dasjenige, was von diesen Prinzipien abhängt. So wurden etwa Elemente wie Wasser, Feuer und Luft als grundlegend an die Spitze der Seinsordnung gestellt, während die einzelnen Dinge, die man in der Natur vorfindet, als Manifestationen einer tieferen Struktur grundlegender Elemente aufgefasst wurden, die mächtiger ist als wir. Das hallt noch heute in dem Gedanken nach, die Naturgesetze schrieben wie göttliche Gesetze vor, was überhaupt geschehen kann. Schließlich könne sich nichts und niemand der Schwerkraft entziehen. Der griechische Begriff eines Prinzips (archê) bedeutet nicht nur Anfang, sondern auch Imperium. Lebenswissenschaftliche Ordnungsbegriffe und Ideen der Macht sind traditionell eng verschränkt. Das ist bis heute tief in unser Denken eingeschrieben, wenn wir uns etwa als Endprodukt der Evolution verstehen und meinen, wir stünden immerhin im negativen Sinne an der Spitze der Entwicklung, weil wir glauben, die Natur insgesamt hänge davon ab, wie wir leben.
Was eine Art von allen anderen Arten innerhalb derselben Gattung unterscheidet, heißt im Allgemeinen die spezifische Differenz. Im Besonderen interessiert uns im Folgenden eine spezifische spezifische Differenz (eine typisch philosophische Verschachtelung, kein Druckfehler): die anthropologische Differenz. Sie besteht darin, wie und in was sich der Mensch von anderen Lebewesen unterscheidet.21
Die Ausgangslage dieses Teils des Buchs ist die Auffassung, dass der Mensch dadurch zum Tier wurde, dass er anfing, sich auf eine spezifische Weise von anderen Lebewesen zu unterscheiden, d. h. sich selbst zu definieren. Indem der Mensch sich selbst definiert, führt er die Vorstellung ein, er sei ein Tier + Irgendetwas anderes (sagen wir zum Beispiel: Sprache, Vernunft, Geist, unsterbliche Seele), und werde eben dadurch nicht nur zum Menschen, sondern zu einem aus seiner Sicht besonderen Tier. Der Mensch ist somit dadurch ein Tier, dass er sich als Tier auffasst. Um ein Diktum der großen existenzialistischen Philosophin Simone de Beauvoir abzuwandeln, kann man geradezu sagen, dass der Mensch nicht als Tier geboren wird, er wird es.22
Anders ist es um uns als Menschen bestellt. Wir müssen nicht erst zu Menschen werden, sondern sind es bereits während unserer Entwicklung im Mutterleib, weil wir eine typisch menschliche DNA haben, die Entwicklungsschritte ermöglicht, die zunächst im Mutterleib und nach der Geburt in größeren Gemeinschaften ausgeführt werden, worin sich unsere biologisch beschreibbare Lebensform ausdrückt. Ob sich dies anhand einer Zellstruktur oder einer Zeitskala festmachen lässt, die bestimmt, ab wann genau eine befruchtete Eizelle zu einem Menschen wird, ist eine schwierige und ethisch bedeutsame Frage, die ich hier nicht weiterverfolgen möchte. Fest steht nur, dass wir jedenfalls viele Monate vor unserer Geburt Menschen sind, sodass Menschsein nicht erst etwas ist, was man lernen kann und woran man demnach auch scheitern könnte. Unser Menschsein ist unveräußerlich und kann auch nicht verloren gehen. Unser Tiersein, d. h. unsere Selbstauffassung als Tier hingegen ist historisch kontingent, d. h. andere Menschenbilder waren und sind möglich.23
Das spezifische Etwas
Der Mensch kommt also nicht etwa als Tier zur Welt bzw. entwickelt sich im Mutterleib zum Tier, um sodann durch gesellschaftliches Training Teil der kulturell, geistig geformten Menschengesellschaft zu werden. Vielmehr ist ein Mensch, sobald er überhaupt ein Lebewesen ist, was im Mutterleib beginnt, auch schon im Vollsinne ein Mensch. Der Mensch kommt also nicht als biologische Hardware zur Welt, auf der dann noch eine kulturelle Software durch Erziehung installiert werden muss. Deswegen ist die Menschenwürde auch lediglich an das Menschsein und an keine weitere Bedingung – wie die Ausbildung besonderer Fähigkeiten und höherer Vermögen – gebunden.
Es ist damit genau besehen nicht so, wie Aristoteles sich die Sachlage ausmalte, dass der Mensch von den anderen Tieren durch seine Merkmale der Vernunft und der politischen Organisation (die er neben der Vernunft für kennzeichnend hielt) unterschieden ist.24 Auch keine andere traditionelle Auffassung, der zufolge wir ein herausragendes Merkmal, ein Definiens des Menschen, feststellen können, das uns von allen anderen Tieren eindeutig unterscheidet, trifft den Wesenskern des Menschen.
Der Mensch ist nicht an sich ein Tier, sondern durch seine Selbstdefinition. Im Rahmen seiner Beantwortung der Frage, wer oder was wir sind, spaltet der Mensch einen Teil seiner selbst, die Animalität, ab. Diese Abspaltung ist der Ursprung des irrigen Begriffs von einem Tierreich, aus dem der Mensch durch besondere Merkmale, durch seine spezifische Differenz hervorragt.
Indem der Mensch sich selbst definiert, unterscheidet er sich von anderen Tieren. Er versteht sich als Tier + Irgendetwas. Dieses spezifische Etwas, das uns auszeichnet, muss dieser Logik zufolge den anderen Tieren fehlen, weil wir uns ansonsten eben nicht ordentlich von ihnen abgegrenzt hätten.
Die eigentliche Schwierigkeit ist dabei nicht, wie viele heute glauben, dass es in Wirklichkeit kein besonderes Merkmal des Menschseins gibt (es gibt vielmehr ziemlich viele solcher Merkmale), sondern eher, dass wir in uns selbst einen Kern des Tierseins, den Begriff der Animalität, identifizieren. Diese Animalität teilen wir mit den anderen Tieren und sollen uns doch durch das spezifische Etwas dann von ihnen unterscheiden.
Wenn das spezifische Etwas in Sprache und Rationalität besteht, an denen es den anderen Tieren per definitionem mangelt, dann müssen diese Vermögen unserer eigenen Animalität auch fehlen. Das ›Tier in uns‹ erscheint deswegen als ein irrationaler Seelenteil, eine Vorstellung, die von Platon, Aristoteles’ Lehrer, ausdrücklich vertreten wird.
Nun ist es aber so, dass die Animalität durch die Selbstdefinition des Menschen ihrerseits definiert ist. Denn wir grenzen sie in der Selbstdefinition von unserem besonderen Etwas ab. Das heißt aber, dass die Animalität, über die wir uns auf diese Weise definieren, schon defizient ist, also einen Mangel darstellt, weil sie nicht der ganze Mensch ist. Kurzum, der Tierbegriff, den wir durch die Selbstdefinition des Menschen als Tier + Irgendetwas erhalten, erzeugt die Vorstellung eines Tierreichs, zu dem alle Tiere auf die gleiche Weise gehören, sich aber durch spezifische Merkmale auch von ihm abheben. Damit projizieren wir einen Teil unserer Selbstdefinition, das defiziente Tiersein, auf die anderen Lebewesen. Im Unterschied zum Menschentier werden sozusagen die Tier-Tiere als Mängelwesen definiert, denen dasjenige fehlt, was uns auszeichnet.
Doch damit nicht genug, enthält der Begriff unserer eigenen Animalität im zweiten Schritt bereits eine implizite oder explizite Wertung. Denn dasjenige, was den Menschen auszeichnet und definiert, wird seit Jahrtausenden nicht nur als eine Eigenschaft betrachtet, die wir haben, sondern als eine besondere Wertquelle angesehen. Und durchaus zu Recht, denn es ist richtig, dass wir Menschen zu einer besonderen Art der moralischen Reflexion, d. h. zur Ethik, befähigt sind.
Im Allgemeinen kann man die Ethik als eine Teildisziplin der Philosophie auffassen, die sich mit der Frage beschäftigt, was wir insofern, als wir alle Menschen sind, tun bzw. unterlassen sollen.25
Weil wir zur Einsicht in die Grundlagen unseres Handelns fähig und in der Lage sind zu definieren, wie wir als Menschen sind, können wir uns auch ändern. Wie wir uns als Menschen selbst definieren, bestimmt mit, wer wir sind, sodass die Anthropologie eine entscheidende Quelle der Werterkenntnis ist. Menschen sind wir auch ohne Definition, unsere Menschenwürde hängt daher auch nicht an irgendeiner Definition oder einem Menschenbild. Allerdings gibt es Menschenbilder, die unsere Menschenwürde bezweifeln oder Menschen dehumanisieren, weshalb es wichtig ist, kritisch zu beobachten, wie genau Menschen sich von anderen Dingen oder Lebewesen abgrenzen.
Der US-amerikanische Psychologe Barry Schwartz bringt es auf den Punkt, wenn er in seinem Büchlein Warum wir arbeiten feststellt:
Theorien über die menschliche Natur nehmen in den Wissenschaften einen einzigartigen Platz ein. Es steht nicht zu befürchten, dass unsere Theorien über den Kosmos den Kosmos verändern. Die Planeten kümmern sich herzlich wenig darum, was wir denken und welche Theorien wir über sie aufstellen. Dagegen ist die Sorge, dass unsere Theorien über die menschliche Natur auf Dauer die menschliche Natur verändern könnten, durchaus berechtigt. […] [E]s [liegt] in der Natur des Menschen […], wenn seine Natur weitgehend das Produkt der Gesellschaft um ihn herum [ist].
26
Es stimmt also durchaus, dass wir Menschen eine besondere Verantwortung für uns selbst und andere Lebewesen haben. Während Löwen nicht erwägen, Vegetarier zu werden, und Schimpansen nicht daran arbeiten, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, indem sie die berechtigten Anliegen des Feminismus institutionell umsetzen, sind wir Menschen zu solchen fundamentalen Revisionen und damit zum moralischen Fortschritt befähigt. Wir sind deshalb auch nicht nur das Problem, das den Klimawandel und die Umweltzerstörung befeuert, sondern die einzige Lösung, die uns retten kann. Die anderen Lebewesen werden nicht an ihrem CO2-Ausstoß arbeiten oder ihre Konsumwünsche verändern. Es liegt in unserer Hand, es ist unsere Verantwortung, unser Natur-, Tier- und Menschenbild zu revidieren, wenn es uns in der hoch industrialisierten, global vernetzten, technologischen Moderne gelingen soll, gemeinsam daran zu arbeiten, dass möglichst alle Menschen auf diesem Planeten ein menschenwürdiges Leben führen können. Davon sind wir trotz aller modernen Fortschritte weit entfernt, wobei wir immer bedenken müssen, dass eben diese modernen Fortschritte, die viele Menschen von extremer Armut befreien, auch Klimawandel, Umweltzerstörung und Massenvernichtungswaffen und damit eben diese Armut in der Moderne allererst hervorgebracht haben. Moderne Hungersnöte sind auch Ergebnisse des modernen naturwissenschaftlich-technologischen Fortschritts und globaler Lieferketten, die eng mit neoliberalen Vorstellungen verzahnt sind, denen zufolge der globale Handel irgendwie von selbst für humanen Fortschritt sorgt, was schlichtweg falsch ist, wie jüngst einmal mehr der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine belegt.
Diese unsere Fähigkeit zur Ethik erhebt uns nicht über die anderen Lebewesen. Sie begründet keinen Führungs- oder Machtanspruch auf Planet Erde, sondern ist allenfalls Grundlage dafür, dass wir verantwortungsvoll miteinander und mit anderen Lebewesen umgehen, die unser Habitat, d. h. die Oberfläche von Planet Erde, mit uns teilen.