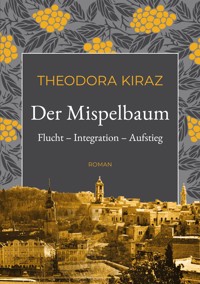
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dalia wächst in Bethlehem auf, wo sie in ein deutsches Internat kommt, weil ihren Eltern das Geld für eine warme Mahlzeit am Tag fehlt. Nach dem Abitur fliegt sie mit einem Stipendium nach Deutschland, um durch Bildung den sozialen Aufstieg zu erringen. Das Medizinstudium in Heidelberg soll der Schlüssel zu allem Glück sein, das sie sich erträumt hat. Schnell schaukelt sie im Meer ihres Lebens: Mal fröhlich auf hohen Wellen reitend und mal um Luft schnappend nach einem tiefen Fall. Als ihre Eltern in die USA auswandern, sie das Recht auf die Rückkehr in ihre Heimat verliert und sie zur selben Zeit das medizinische Vorexamen nicht besteht, bricht ihre Welt zusammen. Wie geht es weiter? "Es scheint unsere Zeit zu sein, und doch ist es wohl alle Zeit so gewesen, dass Menschen aus den verschiedensten Gründen ihr angestammtes Gebiet verlassen, sehr oft verlassen müssen. Theodora Kiraz, eine christliche Palästinenserin, erzählt die Geschichte Dalias zu einer Zeit, als die Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern wieder eskaliert. Die Geschichte Dalias ist die Geschichte einer Entwurzelung und die manchmal verzweifelte Suche nach einem Boden, in dem die Wurzeln wieder anwachsen können. Den nicht immer leichten, manchmal sehr schmerzhaften Weg in eine neue Heimat, in eine neue Sprache, eine neue Kultur, in anfangs oft unverständliche Verhaltensweisen, zeichnet Theodora Kiraz feinfühlig nach." MATTHIAS BRONISCH Schriftsteller und Kunsthistoriker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung und alle Figuren dieses Romans bis auf Dalia und ihre Familie sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
In diesem Roman wende ich mich an alle Geschlechter. Soweit grammatikalische männliche, weibliche oder neutrale Personenbezeichnungen verwendet werden, dient dies allein der besseren Lesbarkeit.
Inhaltsverzeichnis
Ankunft in Heidelberg
Achtzehn Monate vorher –Entlassung–
Über den Dächern von Bethlehem
Schicksal
Überraschung
Ein Vogel in der Hand ist besser als zehn auf dem Baum
Eppelheim
Mein Zimmer
Heimweh
Weihnachten in Rutesheim
Der Mispelbaum
Besuch in Bethlehem
Aufwind
Erfolge und Misserfolge
Der Zug fuhr weiter
Zwei Jahre später
Fügung
DANKSAGUNG
Zur Autorin
Ankunft in Heidelberg
Nach einem erfolgreichen Sprachkurs im Goethe-Institut in Lüneburg und den ersten Erfahrungen im Ausland, fuhr ich mit dem Zug nach Heidelberg, weil ich laut meinen Stipendiumsunterlagen dort Medizin studieren sollte. Das war meine erste lange Fahrt mit der Eisenbahn seit meiner Ankunft vor sechs Monaten in Deutschland.
Um keine Unannehmlichkeiten bei der Reise zu erfahren – wie in einen falschen Zug umzusteigen oder einen zu verpassen – entschied ich mich für eine direkte Verbindung von rund fünf Stunden Dauer. Es werden sich Menschen finden, mit denen ich mich auf dieser langen Fahrt unterhalten kann, dachte ich.
Ich packte mein ganzes Hab und Gut in meinen Koffer. Bis auf ein paar Bücher und Hefte, die ich in Lüneburg gekauft hatte und gut in meinem Rucksack verstauen konnte, kamen seit meiner Abreise aus Bethlehem keine neuen Dinge dazu.
„Jetzt fängt das wirkliche Abenteuer an“, sagte ich zu Maha, meiner Freundin aus Jerusalem, die Stunden vor mir nach Braunschweig abgereist war, um dort Pharmazie zu studieren. Wir umarmten uns wie zwei Schwestern, die sich wegen einer Lebensreise trennten und die Eine bis ans Ende der Welt ginge. Tränen flossen, weil jede von uns den einzigen Halt, den sie in Deutschland hatte, verlor. Aber die Zukunft versprach uns ein besseres Dasein unter erfreulicheren Existenzbedingungen, für die wir bereit waren, uns von Familie und Freunden zu trennen.
Ich stand am Bahnsteig und wartete auf den Intercity. Alle paar Minuten fragte ich fremde Menschen, die ebenso am Bahnsteig auf ihren Zug warteten, ob der kommende Zug nach Heidelberg fahren würde. Ich tat das, nachdem ich sie beobachtet hatte, ohne zu wissen, nach welchen konkreten Kriterien ich sie ausgesucht hatte. Mutmaßlich nach meinem Bauchgefühl. Sie gaben mir die Antwort nett oder reserviert, aber sie nutzten nicht die Gelegenheit, mit mir ins Gespräch zu kommen. Da hätte mich jeder an der Bushaltestelle in Bethlehem oder Jerusalem mit tausenden Fragen gelöchert:
Wo willst du hin?
Zu wem willst du?
Was willst du dort machen?
Fährst du zu Besuch oder beruflich hin?
Kennst du diese Sehenswürdigkeit? Und, und, und.
Man hätte tausend Fragen stellen können, um ins Gespräch zu kommen, aber hier in Deutschland stand jeder für sich allein, starrte ins Leere oder auf seine Uhr. Nur Familien oder Menschen, die sich kannten, sprachen miteinander. „Na ja, dann findet sich jemand im Zug.“
Ein Mann, der hinter mir stand, half mir den Koffer in den Zug hinaufzuziehen. Ich bedankte mich und beobachtete, was die Reisenden vor mir taten: Sie gingen durch den Gang und öffneten die Türen zu den Abteilen und fragten: „Ist hier ein Platz frei?“ Entweder war ein Platz frei und sie gingen hinein oder sie schritten zum nächsten Abteil. Es waren sechs Sitze pro Abteil. Man konnte durch das Glas der Abteiltür sehen, wie viele Personen darinsaßen. Es gab Abteile, in denen die Gardinen zugezogen waren. Trotzdem öffneten die eingestiegenen Personen diese Türen und fragten nach einem freien Platz. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Als eine Frau vor mir nach einem freien Platz fragte und ich sah, dass ein weiterer Sitz leer war, fragte ich sofort:
„Und einer für mich?“
„Ja, kommen sie herein“, hieß es.
Der Zug hatte sich vor Minuten in Bewegung gesetzt und ich war zufrieden, im richtigen Zug zu sitzen und einen Sitzplatz erstritten zu haben. Die Frau half mir, den großen Koffer auf den Gepäckträger über unseren Köpfen zu stellen und wir beide setzten uns hin. Ich saß neben der Tür gegen die Fahrtrichtung. Neben mir saß die Frau, die mit mir eingestiegen war. Auf den anderen Sitzen, uns gegenüber, saßen zwei ältere Herren und eine Frau saß am Fenster in Fahrtrichtung. Die Frau war um die vierzig Jahre alt, hatte ein dickes Buch in der Hand, in das sie so vertieft war, dass sie uns keines Blickes würdigte. Ihr gegenüber saß ein etwas jüngerer Mann mit wirren Haaren, der seine Augen fast über die ganze Fahrt geschlossen hielt.
Inzwischen waren wir an Celle und Hannover vorbeigefahren. Alle aus unserem Abteil saßen noch im Zug und keiner fing irgendeine Unterhaltung an. Nur wenn wir an einem Bahnhof anhielten, hieß es: „Können Sie bitte die Tür und das Fenster auf dem Gang uns gegenüber zum Lüften öffnen?“ Da ich neben der Tür saß, sprang ich auf und öffnete Tür und Fenster. Die Dame, die in ihr Buch vertieft war, kippte das Fenster des Abteils.
Ich staunte, wie still und zurückgezogen sie sitzen, den anderen neben sich aushalten konnten, ohne miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Fahrt bis jetzt war öde. Ich konnte diese Totenstille im engen Raum kaum aushalten. Wie gleichgültig, dachte ich. Ich hätte mir ein Buch mitbringen sollen.
Der Zug verließ Hannover. Ich sprang auf, um Tür und Fenster zuzumachen. Da sah ich in der Mitte des Ganges eine Frau, die am offenen Fenster stand. Wie es aussieht, darf man es machen, dachte ich. Es reizte mich, ihr nachzueifern und der Totenstille im Abteil für eine Weile zu entfliehen. So schloss ich die Tür des Abteils und blieb am offenen Fenster stehen. Zeitweise streckte ich meinen Kopf heraus, um den kühlen Fahrtwind zu spüren und den Geruch der frischen Luft in mich aufzusaugen. Instinktiv verzogen sich meine Gesichtsmuskeln zu einem Lächeln und ich genoss den Augenblick.
Wir rauschten an Wiesen und Feldern vorbei, von denen manch eines streng duftete, an Bauernhöfen, Dörfern und Städten. Bilder rauschten durch meinen Kopf und meine Fantasie nahm ihren freien Lauf. Wie leben die Menschen in diesen großen Bauernhöfen? Was für eine große Anzahl an Kühen, Schafen und Pferde sie besitzen! Ich staunte über das weite unbebaute Land, die grüne Landschaft, die mir fremd war. Da könnte man neue Städte bauen, dachte ich. Und die Wälder! Welche Raubtiere leben darin? Ich bekam Gänsehaut und strich mir über die Arme. Nicht dass ein Wolf wie bei der Geschichte von Rotkäppchen aus dem Hinterhalt kommt! Die Reisefreude packte mich und ich fühlte, wie wunderbar das Leben sein kann.
Erst als wir bei Göttingen durch die vielen Tunnel fuhren, schloss ich das Fenster und begab mich zu meinem Sitz. Im Abteil herrschte weiterhin Totenstille. Warum reden sie nicht miteinander? Soll ich etwas fragen? Aber was? Feige entschloss ich mich, still zu bleiben. Ich schaute aus dem Fenster des Abteils in die Ferne. Wie doof, dass ich kein Buch dabeihabe.
In Göttingen stiegen die zwei alten Herren und die Frau mit dem Buch aus.
„Auf Wiedersehen“, sagten sie.
„Auf Wiedersehen“, antwortete der Rest.
Was für eine lange Unterhaltung.
Eine alte Frau mit zwei Kindern stieg in unser Abteil ein. Ich lächelte den Kindern zu. Die Oma schien sich darüber gefreut zu haben. Sie brachten etwas Leben ins Abteil. Zumindest bis Frankfurt. Aber dann war es nicht mehr so weit bis nach Heidelberg.
❖❖❖
„In wenigen Minuten erreichen wir Heidelberg Hauptbahnhof“, erklang es aus dem Lautsprecher des Zuges. Angespannt zog ich meine Jacke an, schleifte den Reisekoffer hinter mir her und begab mich zum Ausgang des Zuges. Die Bremsen quietschten auf den Schienen und mit einem Ruck kam der Zug zum Stehen. Ich stieg die Stufen hinab, blieb kurz auf dem Bahnsteig stehen und schaute mich zur Orientierung um: Menschen eilten in alle Richtungen. Abgehetzt rannten einige zu ihren Anschlussverbindungen. Andere umarmten fröhlich und munter ihre Lieben, während eine Schar von Abreisenden drängelte vor den Türen der stehenden Züge, um als Erste hinaufzusteigen und sich einen Sitzplatz zu sichern.
Die zwei jungen Menschen am Absatz der Stufen zur Empfangshalle – ich schätzte sie in meinem Alter – fesselten meine Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich, wie zwei Liebende sich in der Öffentlichkeit leidenschaftlich küssten und so eng miteinander verschlungen waren, als wälzten sie sich im Schlafzimmerbett. Ihre Gesichter schmolzen zusammen und ihre Zungen schienen sich ineinander zu verhaken. „Donnerwetter, wie frei und unbekümmert leben die Menschen in diesem Land?“ Aber schnell lenkte ich meinen Blick von ihnen ab, da ich bemerkte, wie ich sie mit großen Augen anstarrte. Ich beobachtete weiterhin meine Umgebung und lauschte dem gedämpften rhythmischen Klopfen der Räder des Zuges, als er kurz darauf losfuhr.
Immer noch am Bahnsteig stehend, alles um mich herum beobachtend, überlegte ich: Warum hetzen die Menschen so, als wäre ihnen die Zeit vorausgeeilt? Wollen sie die Zeit einholen? Es war nur der scherzhafte Versuch, eine Erklärung für das zu finden, was mir so fremd war. Alles schien genau getaktet zu sein und ich musste mich diesem Takt anpassen. Denn ich sah, wie Menschen versuchten, die Tür eines stehenden, doch abfahrbereiten Zuges zu öffnen. Aber vergeblich, obwohl der Zug noch am Bahnsteig stand. Die Türen waren geschlossen, nachdem kurz davor der Pfiff der Schaffnerin am Bahnsteig zu hören war. Kurz darauf setzte sich der Zug in Bewegung und der Fahrtwind wehte ins Gesicht der wütenden Menschen, die ihren Zug verpasst hatten. Ich begann zu begreifen, warum die Deutschen in meiner Schule so viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt hatten. Mein orientalisches Gemüt, das solche Hektik nicht kannte, realisierte, dass sich ab jetzt vieles in meinem Leben ändern wird.
Ich dagegen hatte meinen Koffer erst neben mir abgelegt und genoss den Augenblick meiner Ankunft in Heidelberg. Eine gewisse Magie lag über dem Fortgehen, empfand ich. Es gefiel mir, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Alles war aufregend und ungewohnt: die Menschen, ihre Sprache, ihre Kleidung, ihre schnelle Gangart, ihr Verhalten … Und ich? Ich schwebte dazwischen und suchte meinen Platz.
„Ob ich eines Tages so werde wie sie?“
Nach einer Weile – es waren nur zwei, drei oder vier Minuten – folgte ich der Menschenmenge die Treppen in die Bahnhofshalle hinauf. Zwischen dem geschäftigen Treiben fiel mir eine junge Frau auf, im langen schwarzen Mantel, mit schwarzem lockigem Haar und einem zaghaften Lächeln im Gesicht. Sie hielt einen Karton in der Hand mit der Aufschrift –D a l i a –. Sie lächelte mich an.
„Bist du Dalia?“
„Ja, das bin ich.“
„Mein Name ist Corinna. Ich bin deine WG-Mitbewohnerin. Bruder Jacob hat mich gebeten, dich vom Bahnhof abzuholen. Herzlich willkommen in Heidelberg, Dalia.“
Inzwischen wusste ich, dass WG-Wohngemeinschaft bedeutet. Corinna machte einen Schritt auf mich zu und fragte:
„Ihr kennt euch aus Bethlehem, nicht wahr?“
„Ja, das stimmt. Er hat mir bei der Zimmersuche geholfen. Ich wusste nicht, wie schwer es ist, eine Unterkunft in Heidelberg zu finden. Das Studentenwerk hat mir kein Zimmer im Studentenwohnheim geben können. Ich hätte mich zu spät beworben, meinten sie.“
❖❖❖
Den Koffer zog ich hinter mir her und ich folgte Corinna zur Straßenbahnhaltestelle. Die Räder des Koffers ratterten auf dem Bürgersteig und weil er schwer beladen war, blieb er oft zwischen den Pflastersteinen stecken.
Wir kauften mir eine Fahrkarte und stiegen in die Straßenbahn Linie zwei, in Richtung Eppelheim, wo die WG war. Die ersten Eindrücke der neuen Heimat zogen durch das Fenster an mir vorüber, ohne dass ich sie genauer betrachtet hätte.
Müde ließ ich den Koffer im Gang, hängte die Jacke an die Garderobe und folgte Corinna in die Küche. Dort angekommen, wartete Christel, meine zweite Mitbewohnerin mit Tee und Keksen auf uns. Noch etwas zurückhaltend und unsicher versuchte ich der Unterhaltung am Tisch zu folgen. Hin und wieder fragte ich nach, was sie mit dem einen oder anderen, was sie gesagt hatten, meinten. Corinna sprach in einem Dialekt, den man „schwäbisch“ nennt, erklärte sie und Christel mit einem „pfälzischen“. Der Klang ihrer Sprache war ungewohnt. Zögerlich bat ich sie, etwas langsamer zu sprechen, damit ich ihnen folgen konnte. Und bald gaben sich beide Mühe, hochdeutsch mit mir zu sprechen.
Ich, die keinen Luxus gewohnt war, erwartete nichts Großes von meinem neuen Zuhause. Ein karges Zimmer würde reichen: Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch und Stuhl würden mir genügen. Allein die Tatsache, ein eigenes Zimmer zu haben, war mehr, als ich je bisher besessen hatte. Der Moment, mein Zimmer in der WG zu besichtigen, war gekommen. Ich war angespannt. Corinna ging voran und öffnete die Tür zum mittleren Zimmer.
„Das hier ist dein Zimmer. Ich habe dir die Heizung etwas aufgedreht“, verkündete sie mir freundlich und lud mich mit einer Handbewegung in mein neues Reich ein. „Es ist langsam kalt geworden“, fügte sie hinzu.
Mir stockte der Atem, als ich, hinter Corinna stehend, ins Zimmer hineinblickte und das sah, was sich mir bot – vier kahle Wände, ein Fenster und eine Zimmerdecke ohne Lampe.
„Und, gefällt es dir?“, erkundigten sich Corinnas strahlende Augen.
Wie sollte ich jetzt darauf reagieren? Ich will nicht gleich unhöflich erscheinen.
„Ja, ja, es ist gut“, meinte ich.
Nach einer kurzen Pause, in der ich mich gesammelt hatte, um nicht in Tränen auszubrechen, fragte ich unbedarft:
„Ist es normal, dass man ein leeres Zimmer bekommt? So ohne alles. Ohne Licht an der Decke?“
„In einer WG bringt man die eigenen Möbel mit. Hast du nichts dabei?“, fragte Corinna.
„Ich habe nur diesen einen Koffer mit meinen Kleidern. Mehr darf man im Flugzeug nicht mitnehmen.“
Den Koffer schob ich jetzt ins Zimmer. Dabei schluckte ich kräftig und senkte den Kopf, um meine Tränen zu verbergen. Schnell wischte ich mit dem Ärmel über mein Gesicht, ohne dass sie davon Wind bekommen konnten. Das dachte ich zumindest.
Die beiden wurden ernst. Sie schienen in einen entsetzten Gesichtsausdruck geblickt zuhaben. Corinna sagte:
„Ich kann dir eine Matratze und eine Tischlampe ausleihen, bis du deine eigenen Möbel hast.“
„Ich habe eine Decke und ein Kissen übrig“, fügte Christel hinzu.
„Hast du Bettwäsche dabei?“, fragte Corinna, als sie die Matratze ins Zimmer schob.
„Nein, an so etwas habe ich nicht gedacht. Ich durfte nur zwanzig Kilogramm mitbringen. Ich glaubte, ein möbliertes Zimmer vorzufinden“, sagte ich etwas beschämt.
„Nur in den Studentenwohnheimen sind die Zimmer voll möbliert. Aber es ist nicht schlimm. Ich gebe dir welche von mir, bis du deine eigene gekauft hast“, erklärte sie erneut.
Schnell waren die Sachen in dem leeren Zimmer zusammengetragen. Ich stellte den Koffer auf den Boden neben der Tischlampe ab und öffnete ihn. Darin lagen alle meine Habseligkeiten aus der Heimat. Neben der Kleidung und den Urkunden habe ich den Wandteller, den ich von meiner Schule zur Abiturfeier geschenkt bekommen hatte und mein Freundschaftsbuch, in dem manche meiner ehemaligen Freundinnen und Lehrer sich verewigt hatten, mitgebracht.
Mein Blick wandte sich nochmal hoch zur Decke. Ich war verzweifelt, wie ich diese große Herausforderung, ein Licht an der Decke anzubringen, allein bewerkstelligen sollte. Bisher hatte ich mich um solche Angelegenheiten nicht kümmern müssen. Alles Organisatorische erledigte zuhause mein Vater. Er bestritt alle Einkäufe der Familie, sogar das Nähzubehör für Mamas Arbeit besorgte er ihr. Er kümmerte sich um meine Ausreisegenehmigung, die man beim israelischen Militär beantragen muss, und mein Visum aus der deutschen Botschaft und, und, und. Ich begleitete ihn nur, um meine Unterschrift zu leisten, wenn sie überhaupt nötig war.
❖❖❖
Mit den Stipendiumunterlagen in meinem Rucksack fuhr ich am nächsten Tag mit der Straßenbahn nach Heidelberg, um mich an der Universität immatrikulieren zu lassen. Corinna begleitete mich zur Straßenbahnhaltestelle und erklärte mir, wie man sich aus dem Automaten eine Fahrkarte ziehen kann: „Billiger wäre es, wenn du dir eine Mehrfahrtenkarte kaufen würdest, bis du dich an der Universität eingeschrieben hast. Denn dann kannst du dir mit deinem Studentenausweis eine preisgünstige Monatskarte kaufen. Aber am preiswertesten wäre es, mit dem Fahrrad zur Universität zu fahren. So tun es Christel und ich.“
Genaustens lauschte ich ihr, um ja nichts Verkehrtes zu machen. Es war in mir drin, alles richtig machen zu wollen. Anderenfalls fühlte ich mich unsicher und die Ungewissheit schürte Ängste in mir hoch, die mich noch mehr verunsicherten.
Ich zog mir eine Mehrfahrtenkarte aus dem Automaten und versuchte mir alles, was Corinna mir erklärte, zu merken – zum Bismarckplatz fahren, dort in den Bus Nummer zehn oder elf in Richtung Universitätsplatz umsteigen. An der Haltestelle Universitätsplatz aussteigen …
Im Immatrikulationsbüro kümmerte sich eine Sachbearbeiterin gesondert um die Stipendiaten. Frau Richter, eine freundliche und charmant gekleidete Frau im mittleren Lebensalter, mit hohen Stöckelschuhen, einem körperbetonten mit Blumen bedruckten weißen Kleid, die goldenen Haare hochgesteckt und das Gesicht dezent hinter der großen hellbraunen Brille geschminkt, der Lippenstift rosafarben und passend zu den Blumen auf dem Kleid. Sie beeindruckte mich vom ersten Augenblick an.
Frau Richter lief routiniert von einem Büro ins Nächste und brachte immer wieder neue Formulare und Merkblätter mit, die sie ausfüllte und von mir unterschreiben ließ. Zum Schluss gab sie mir welche mit, die ich selbstständig zuhause ausfüllen sollte.
„Bitte bringen Sie mir bis Ende der Woche die ausgefüllten Formulare mit folgenden Unterlagen zurück: Zwei Passbilder, Ihren Reisepass mit der Aufenthaltserlaubnis darauf – diese bekommen Sie in der Ausländerbehörde der Stadt – sowie eine Bestätigung von einer Krankenkasse, dass Sie dort krankenversichert sind.“
„Entschuldigen Sie bitte. Was ist eine Krankenkasse? Was muss ich machen? Das habe ich jetzt nicht verstanden“, fragte ich zögerlich.
Frau Richter zeigte keine Spur von Missbilligung. Geduldig erklärte sie mir, dass ohne Krankenversicherung kein Student an der Universität eingeschrieben werden kann.
„Und was ist mit der Stadt? Mmh … Erlaubnis?“
„Aufenthaltserlaubnis, heißt das.“
Ich schrieb auf den Briefumschlag „Aufenthaltserlaubnis“.
„Das bekommen Sie bei der Ausländerbehörde im Einwohnermeldeamt. Die Erlaubnis berechtigt Sie, in Deutschland zu leben. Ich gebe Ihnen Ihre Adresse.“
Ich kritzelte auf die Rückseite des Briefumschlages „Einwohnermeldeamt“.
Mit einem Stapel Formulare und ein paar Aufträgen und Notizen verabschiedete ich mich von der netten Frau Richter. Noch auf dem Gang stehend wiederholte ich im Stillen, was von mir gefordert worden war: Zuerst mit dem Zettel zur Adresse, welche ich von Frau Richter als erstes erhalten hatte, zur Dresdner Bank in die Rohrbacher Straße fahren, um dort das Stipendiumsgeld abzuholen. Dort kann ich mir ein Bankkonto einrichten lassen, sagte sie. Danach muss ich zur Ausländerbehörde und irgendetwas wie krank … Ich suchte auf dem Briefumschlag meine Notiz und las „Krankenkasse.“
❖❖❖
Mein Kopf platzte von den vielen neuen Informationen. Kopfschmerzen deuteten sich an. Ich wusste, dass ich diese für den Rest des Tages nicht loswerden würde. Mit Kopfschmerzen bin ich seit meiner Kindheit vertraut. Eine Packung Aspirintabletten hatte ich von zuhause mitgebracht. Diese waren im Koffer. Am Universitätsplatz suchte ich nach einer Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu essen. Es war wichtig, dass ich keinen Hunger oder Durst erlitt, da diese meine leidige Migräne zusätzlich triggerten. Ich legte eine Pause an der Bäckerei neben der Sparkasse ein.
Obwohl ich Deutschunterricht an der Schule hatte und glaubte, gut darin zu sein, konnte ich die Menschen auf der Straße nicht sofort verstehen. Nach meinem Dafürhalten sprachen die Menschen zu schnell und undeutlich. Später erfuhr ich, dass sie einen kurpfälzischen Dialekt sprachen. Nicht alle Dialektwörter konnte man vom Hochdeutsch ableiten, weil sie nicht immer einen Bezug dazu hatten. Das machte die Verständigung stockend. In den ersten Tagen hatte ich ein paar Wörter aufgeschnappt, wie: ajooh, was so viel wie „na klar“ bedeutet. Uff bedeutet „geöffnet oder offen“. Do Nei heißt „hier rein“ und Appll steht für „Apfel“. Und eben lernte ich in der Bäckerei, dass ein Brötchen „Weck“ heißt. Dass das Wort Brot zum Brötchen verniedlicht wird, fand ich seltsam aber durchaus logisch und nachvollziehbar. Aber was hat das Wort „Weck“ mit „Brot“ gemeinsam, fragte ich mich.
Das Essen und Trinken halfen dieses Mal nicht und ich musste schleunigst nach Hause fahren, um eine Aspirintablette einzunehmen und mich kurz hinzulegen. Unterwegs besorgte ich mir einen Stadtplan. Das war unbedingt notwendig, um zu all den Behörden zu finden. Mein Kopf klopfte und hämmerte, meine Augen mieden jegliche Helligkeit und ich eilte zum Bismarckplatz, um nach Hause zu fahren.
Dort angekommen, stand die Straßenbahn Linie zwei zwischen der Linie drei nach Leimen und der Linie vier nach Rohrbach an der Haltestelle. Ich stieg ein und setzte mich auf einen Einzelplatz, nachdem ich meine Mehrfahrtenkarte entwertet hatte. Dann schloss ich die Augen, weil das grelle Licht in der Bahn die Kopfschmerzen verstärkte. Kurz darauf fuhr die Straßenbahn in Richtung Bergheimer Straße und der Czerny Brücke. Von da an zählte ich die Haltestellen bis zu meiner Station, Eppelheim/Rathaus.
❖❖❖
Die Unterlagen legte ich auf den Boden neben den Koffer und nahm eine Aspirintablette ein. Christel und Corinna warteten in der Küche auf mich, weil wir am Tag zuvor ausgemacht hatten, dass Corinna mir das Lebensmittelgeschäft am heutigen Nachmittag zeigen soll. Das hatte ich nicht vergessen, aber ich musste unbedingt eine Ruhepause einlegen. Das ist wichtig, wenn man an Migräne leidet. Als ich nach circa zehn Minuten nicht zu ihnen stieß, riefen sie mich. Und ohne Rücksicht auf die Kopfschmerzen stand ich auf und begab mich in die Küche.
Bei einer Tasse Tee lernte ich, wie sie einen Einkaufszettel zusammenschrieben und welche Lebensmittel sie kauften. Natürlich hatte ich wieder nur die Hälfte davon verstanden. Aber ich war zu müde, um sie nach den Einzelheiten zu fragen, und so ließ ich es mir nicht anmerken.
Am liebsten wollte ich so schnell wie möglich wieder ins Bett. Trotz alledem mochte ich aus Höflichkeit den Termin nicht absagen. Wie sähe es aus, wenn ich nicht mitginge? Womöglich würden sie denken, dass ich für die Unterstützung, die sie mir zukommen lassen, nicht dankbar wäre.
„Und wie war es in der Stadt?“, erkundigte sich Christel, „hast du dich jetzt an der Universität eingeschrieben?“
„Nein, nein. So schnell geht das nicht. Ich muss vieles vorher erledigen. Unterlagen ausfüllen, ein Konto bei der Bank in Rohrbach eröffnen, Passfotos machen lassen und irgendetwas, wie Kranken- sollte ich abschließen. Moment mal, ich schaue gleich in meinen Unterlagen nach. Ich habe alles aufgeschrieben.“
Ich holte den Umschlag aus meinem Zimmer und las vor: „Krankenkasse“. „Ich muss zur Krankenkasse. Ohne Krankenversicherung kann ich mich nicht immatrikulieren lassen, sagte die Sekretärin. So etwas gibt es bei uns nicht. Ich verstehe immer noch nicht, was es sein soll, obwohl sie es mir erklärt hat. Und sie meinte, ich könnte mir selbst aussuchen, zu welcher Krankenkasse ich möchte. Aber ich kenne doch keine.“
„In einer Krankenkasse Mitglied sein bedeutet, dass du jeden Monat einen Betrag Geld an die Krankenkasse überweist, damit du, wenn du krank wirst, zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen kannst. Dann musst du nicht den Arzt bezahlen, weil sie es für dich tun.“
„Du bekommst auch die nötigen Medikamente kostenfrei von der Apotheke“, erklärte Christel.
„Wir helfen dir“, meinte Corinna, die mir selbstlos vorkam. „Aber warum musst du in der Rohrbacher Straße dein Bankkonto eröffnen. Hier in der Nähe gibt es eine Bank, die Sparkasse.“
„Weil ich jeden Monat das Geld vom Stipendium nur von der einen Bank abholen darf. Ich muss in den ersten zehn Tagen des Monats persönlich erscheinen und gegenzeichnen, dass ich das Geld erhalten habe, sagte Frau Richter.“
„Okay. Ich verstehe.“, murmelte Corinna. „Die DAK, das ist eine Krankenkasse, sie liegt auf dem Weg nach Rohrbach. An der zweiten Haltestelle nach dem Hauptbahnhof steigst du an der Kurfürstenanlage aus. Gleich auf der rechten Seite findest du die DAK. Da kannst du dich krankenversichern. Dort erklären sie dir alles. Danach kannst du von dort aus mit der Linie Nummer vier Richtung Rohrbach zur Bank weiterfahren. Wir können später auf dem Stadtplan nachschauen, an welcher Haltestelle du dort aussteigen musst. Komm erst mit zum Einkaufen. Ich bin heute dran.“
Bevor ich antworten konnte, fragte Christel:
„Wie hast du die Stadt gefunden?“
„Was ich gesehen habe, war schön, insbesondere das Universitätsgebäude.“
„Ach, wenn mein Vater hier wäre, würde er dir jetzt die Geschichte der Universität erzählen, bis dir schwindelig wird.“
Sie lachten und ich erzählte dann von meinem Erlebnis in der Bäckerei. Corinna verwirrte mich zusätzlich mit ihrem Schwäbischen – da heißt Brötchen in ihrer Heimat: „Weggle“ oder „Weckle.“
Die Tablette begann zu wirken und die Kopfschmerzen ließen leicht nach, nachdem ich etwas gegessen und getrunken hatte.
In der WG wurde das Haushaltsgeld zusammengelegt. Jede Woche war eine an der Reihe, die Einkäufe zu erledigen. In einer Schublade in der Küche hatten sie eine Geldbörse, in die jede fünfzig Deutsche Mark einzahlte. Wenn das Geld verbraucht war, wurde das Portemonnaie erneut mit Geld gefüllt. Die Quittungen des Einkaufs legten sie auf dem Tisch für alle sichtbar. Aber es war eine Vertrauenssache, erklärten sie, und keine von ihnen kontrollierte, ob die Rechnung stimmte.
Es gab auch einen Putzplan für Küche, Bad, Flur und Treppenhaus. Die Vermieterin, die eine Etage unter uns wohnte, legte großen Wert darauf, dass das Fenster im Treppenhaus jede Woche geputzt wurde. Das seien die Hausregeln, sagten sie.
Wenn es nur das ist. Mehr an Information hatte ich an diesem Tag nicht verarbeiten können. Nur noch das Einkaufen und dann ist Schluss für heute.
Im Supermarkt staunte ich über das große Angebot: Verwirrend, wie viele Brot-, Käse- und Wurstsorten sie haben. Und jede Sorte hat ihren eigenen Namen. Ob ich mir all diese Namen merken kann?
Achtzehn Monate vorher –Entlassung–
Nach 15-jähriger Gefangenschaft stand meine Entlassung bevor. Die Freiheit als höchstes Gut der Menschheit war endlich zum Greifen nahe. Sie bedeutete für mich die Erlösung aus der Aufsicht anderer, mein Übergang vom Dunklen ins Helle, vom bevormundeten Sein in die Selbstbestimmtheit, vom gehorsamen Befolgen zum kreativen Gestalten. Alle Zwänge der letzten fünfzehn Jahre wäre ich an diesem Tag auf einem Schlag los. Die eiserne Hand, die mich so prägte und fesselte und aus mir das gemacht hat, was ich geworden bin, wird mit der Zeit verblassen und eine fahle Erinnerung bleiben. Ohne Zweifel.
Bisher waren die Freiheit und all die angenehmen Dinge, die damit verbunden waren, nur ein Traum gewesen. Eine Fantasievorstellung. Unwirklich. Eine Illusion. All das war jetzt nicht mehr fern und doch auf irgendeine Weise konnte ich es kaum glauben, bald ein freier Mensch zu sein.
Wie ich all die Jahre zutiefst meinen 18. Geburtstag ersehnt hatte. Nicht weil ich volljährig werden würde. Nein! In meiner Kultur bleibt eine Tochter unter der Obhut ihrer Eltern, bis sie geheiratet hat. Nächte, Tage, Wochen, Monate und Jahre vergingen, ganze fünfzehn Jahre wartete ich auf meine Entlassung. Meine Erlösung. Und diese war einen Monat vor meinem 18. Geburtstag datiert.
Ich glaubte: An dem Tag meiner Entlassung wird meine Vergangenheit explosionsartig beendet sein. Paff, weg und vorbei. Wie Asche, vom Winde verweht. Ich werde die Finsternis hinter mir lassen. Das Licht, ja das warme helle Licht da draußen, wird mein Leben erleuchten, in jede Pore meines Körpers eindringen und sie wie eine Sonnenblume zum Erblühen bringen.
Juhu! Frei werde ich sein. Wie ein Vogel am Himmel. Ich werde das Leben erobern und mich nie mehr erobern lassen.
Meine Sehnsucht nach der Freiheit war so unendlich groß und meine Bereitschaft, die Vergangenheit schnell zu begraben, ungeheuer. Ich war davon überzeugt, dass ich eines Tages frei sein werde. Dafür hatte ich es all die Jahre ausgehalten und manches durchgestanden. Ich war jung und voller Tatendrang. Gott wird es richten. Unweigerlich. Davon war ich überzeugt.
Im Namen der Schule „Talitha Kumi“ laden wir Sie am Samstag, den 17.05.1980, herzlich zu unserer 24. Verabschiedungsfeier unserer Abiturientinnen ein. Unter der Schirmherrschaft des Bischofs der evangelisch-lutherischen Kirche findet die Feier um 15:00 Uhr im großen Saal der Schule statt.
So lautete die Einladung zu meiner Abiturfeier. Auf der Rückseite der schmucklosen Einladungskarte standen die Namen aller Abiturientinnen unserer Mädchenschule aufgelistet.
Zwölf Namen standen unter der Überschrift „Literarischer Zweig“. Mein Name war der vierte unter der Überschrift „Naturwissenschaftlicher Zweig“. Diese nüchterne Einladungskarte mit meinem Namen darauf war der Beweis, den ich in den Händen hielt und der mir deutlich machte, dass mein Traum bald Wirklichkeit werden wird. Am 17.05.1980. Spätestens nach der Feier gegen 16:00 Uhr werde ich ein freier Mensch sein.
Euphorisch und mit jugendlicher Leichtigkeit blickte ich auf eine glückliche Zukunft. Wie sie im Einzelnen sein würde? Das wusste ich nicht. Aber ich war zuversichtlich, dass sie besser sein würde als all das, was ich bisher kannte: Ich wähnte: „Es wird eine Zukunft sein, in der meine Träume wahr werden können, in der ich selbst bestimme, was ich machen oder lassen will. Und sie wird eine Zukunft sein, in der ich ich selbst sein kann. Ich werde nur das essen, was mir schmeckt, die Kleidung tragen, die ich mag. Ich werde lernen, meine Meinung zu äußern, ohne zu befürchten, dafür belangt oder sogar bestraft zu werden. Ich werde meine Ängste abschütteln und ein mutiges Mädchen werden.“
Davon hatte ich geträumt.
Der Tag, an dem mein Leben eine gewaltige Kehrtwendung nehmen wird und an dem es ein Davor und ein Danach geben wird, war nicht mehr fern. Dieser geheimnisvolle Tag verlieh mir Flügel und ließ Hoffnung in mir aufsteigen. Ich war froh, weil die Mühen der letzten Jahre sich an diesem Tag auszahlen werden. Er wird der Tag der Anerkennung für meine schulischen Leistungen und vor allem für mein Durchhaltevermögen in diesem streng geführten Internat werden. Dieser Tag war real. Haptisch an der schlichten Einladungskarte spürbar. Meine Augen konnten deutlich meinen Namen darauf lesen. Alle meine Sinne spürten die große Erleichterung und freuten sich auf das, was danach kommen würde.
Fünfzehn Jahre Internat!
Fünfzehn Jahre Haft!
Fast mein ganzes Leben.
Ein Leben wie im Hochsicherheitsgefängnis schien bald der Geschichte anzugehören.
❖❖❖
Früher, wenn ich mit meinen Schwestern in den Schulferien aus dem Internat nach Hause fuhr, war ich glücklich, zuhause zu sein. Unsere Eltern gaben sich größte Mühe, uns eine angenehme Zeit bei sich zu bieten. Sie unternahmen mit uns kleine Tagesausflüge, zum Toten- oder Mittelmeer, fuhren mit uns nach Jerusalem, Ramallah oder Nazareth, um Freunde oder Bekannte der Familie zu besuchen. Oder wir besuchten unser Kloster, das der Syrischorthodoxen-Kirche, in der Altstadt von Jerusalem. Es gab zuhause immer genug zu essen und wir hatten tadellose Kleidung, so dass ich als Kind nie das Gefühl hatte, dass wir arm waren, und deswegen in einem Internat leben mussten.
Als junges Mädchen stellte ich meinen Eltern oft die Frage: Warum sind wir im Internat? Ihre Antwort lautete: Dort habt ihr zumindest eine warme Mahlzeit am Tag und ihr bekommt eine ausgezeichnete schulische Bildung. Das stimmte. Folglich gab ich mich damit zufrieden und musste davon ausgehen, dass wenn wir nicht zu Hause waren, sie nicht täglich eine warme Mahlzeit hatten. Ob es den Tatsachen entsprach?
Die dreimonatigen Sommerferien verbrachten wir zuhause; zum Teil gelangweilt, weil keine Ferienaktivitäten angeboten wurden und weil wir drei Mädchen bei unserer Mama, die eine examinierte Schneiderin war, daheimblieben. Mama arbeitete von zuhause. Um uns zu unterhalten, hatte sie uns das Sticken, Stricken und Häkeln beigebracht. Aus den Stoffresten ihrer Kundinnen schnitt sie mir Kleider für meine Puppe, die ich unter ihrer Anleitung per Hand nähte.
Bis auf meine Cousine Sana, die in unserer Nachbarschaft wohnte, hatte ich keine Freundinnen in Bethlehem. Sie war ein Jahr jünger als ich und wir verstanden uns blendend. Sie war clever. Ein Mädchen mit Sommersprossen und rotem Haar, wie Pippi Langstrumpf. Deretwegen wurde sie manches Mal gehänselt. Wir spielten stundenlang ein Kartenspiel mit ihrem Vater, bei dem man strategisch denken musste. Der Name dieses Spieles ist „Hand“. Wir kamen uns schlau vor, wenn wir ihn besiegen konnten.
Er arbeitete als Koch in einem Benediktinerkloster. Dort lernte er, italienische Speisen zuzubereiten. Wenn er seiner Familie Spaghetti kochte, meistens an einem Samstag, und ich bei unseren Eltern war, ließ er Sana mich zum Mittagessen zu ihnen rufen, weil er wusste, wie gerne ich Spaghetti aß.
❖❖❖
Meine Geschwister und ich wurden, wenn wir einmal im Monat, an einem Wochenende zu Besuch bei den Eltern oder in den Ferien in Bethlehem waren, von den Nachbarn registriert und durchdringend angeschaut. Mich irritierten ihre Blicke. Ich kam mir vor, wie eine aus der Haft Entlassene, die in Augenschein genommen wird. Eine bemitleidenswerte Person, die ich nicht sein wollte. Ich schämte mich dafür, ein Internatskind zu sein. Eine verklemmte scheue Person ohne Selbstvertrauen. So sah ich mich. Ob sie mich so sahen?
Insbesondere die Shisha rauchenden Männer, die vor dem Café schräg gegenüber unserer Wohnung saßen und die vorbeigehenden Menschen mit ihren bohrenden Blicken verfolgten, versetzten mich in eine innere Anspannung. Immer wenn ich an ihnen vorbeilief, wurde mein Schritt rascher. Meinen Blick wandte ich mit erhobenem Haupte gen Himmel und spielte ihnen vor, eine selbstbewusste junge Frau zu sein. In meiner Stadt und im eigenen Land fühlte ich mich fremd und eingesperrt. Wie ein Sonderling. Nicht dazugehörig, obwohl ich eine von ihnen war. Ich konnte mir damals nicht erklären, warum es so war. Wie tief wünschte ich mir, dass es nicht so sei, dass ich, wie jedes andere Kind auf der Straße dazu gehöre. Aber ich fühlte anders.
Ich, Dalia, träumte von der Freiheit und von einem Stipendium, mit dem ich in die USA oder nach Westeuropa fliegen könnte. Ein Stipendium, welches mir ein Visum in einer dieser Länder sicherte, um meinem bisherigen Dasein und dem eigenen Land zu entfliehen. Nicht dass ich meine Heimatstadt Bethlehem nicht mochte. Nein! Aber neben dem eisernen Leben im Internat fühlte ich mich in Bethlehem gefangen. Doppelt gefangen. Die Fesseln der strengen Internatserziehung und die der israelischen Besatzung wollte ich sprengen und allem entrinnen. Ich wollte ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen. Darin zu ersticken war keine Option für mich. Für die Freiheit und ein besseres Leben lernte ich in der Schule fleißig. Denn mein Ziel konnte ich nur mit besten Noten und einem Stipendium realisieren. „Tief Luft holen, durchatmen und dabei die Freiheit spüren. Wie himmlisch muss das sein!“
❖❖❖
Es war Frühling geworden. Die Felder und Täler der hügeligen Landschaft Bethlehems verwandelten sich langsam in blühende Meere. Hier und da bildeten sich flickenteppichartig bunte Blumenwiesen aus wilden Gewächsen und Kräutern. Sie trotzten mit ihren dünnen Stängeln und prächtigen Farben dem trockenen Boden der judäischen Wüste. Das war die perfekte Jahreszeit für eine Verabschiedungsfeier.
Wir lebten zu sechst in einer Dreizimmerwohnung in der Sternstraße, die nach dem Stern von Bethlehem aus der biblischen Geschichte benannt wurde. Die Innenstadt mit ihrer Steinbebauung und ihren engen Straßen und Gassen sah kahl aus. Keine grüne Vegetation weit und breit, bis auf die Reyhan Blumentöpfe auf den Fenstergittern der Häuser, die zur Straße hinzeigten. Die Pflanze gehört zu den Lippenblütlern, wie das Basilikum und die Pfefferminze. Diese sind reich an ätherischen Ölen und verströmen einen betörenden Duft. Aber im Gegensatz zu den obengenannten ist die Reyhan Pflanze zum Verzehr nicht geeignet. Sie ist wegen ihres hinreißenden Duftes äußerst beliebt. Meine Mama, Rebecca, hatte jedes Jahr im Frühling neue Reyhan Blumentöpfe an die Fenster des Schlaf- und Wohnzimmers gestellt und sie liebevoll gegossen. Mit jedem Windstoß oder bei jeder Berührung der Pflanze verströmte sich ihren Duft in der Luft und beglückte uns.
❖❖❖
Wir, die Abiturientinnen der deutschen Mädchenschule, waren drei Wochen vor Ende des Schuljahres zur Vorbereitung auf die staatlichen Prüfungen entlassen worden. Die Abschlussprüfungen der eigenen Schule hatten wir schon abgelegt. Dafür würden wir unsere Schulabschlusszeugnisse auf der Feier am 17.05. erhalten. Neun Tage danach standen die staatlichen Prüfungen an. Nur diese waren weltweit für die Zulassung an den Universitäten von Bedeutung.
Die palästinensischen SchülerInnen waren in ihrem Schulsystem den politischen Zerwürfnissen unterworfen. Sie lebten im eignen Land und besuchten regulär die Schule, aber es gab keine eigene Schulbehörde für sie, die ihnen eine staatliche Prüfung abnehmen durfte. Israel war die Besatzungsmacht und führte ein eigenes Schulsystem für die Israelis. Die 1967 besetzten Gebiete von Israel, zu denen Bethlehem zählt, waren dagegen in das jordanische Schulsystem eingegliedert. Das ist der Grund, warum ich und alle palästinensischen SchülerInnen sämtliche Abiturfächer zweimal ablegen mussten. Einmal, um den Schulabschluss der eigenen Schule zu erhalten und das zweite Mal, um das international staatlich anerkannte jordanische Abitur abzulegen. Die Prüfungen fanden in Jordanien und in den besetzten Gebieten von Israel am selben Tag und zur selben Uhrzeit innerhalb einer Woche statt. Und so war ich zuhause und lernte, Tag und Nacht.
„Ich werde nach den Prüfungen sofort mit den Recherchen für die Auslandsbewerbungen beginnen“, besprach ich mit meinen Eltern in meinen Lernpausen. „Ich werde an dem Englischtest ‚TOEFEL‘, der für das Studium in den USA vorausgesetzt ist, teilnehmen.“
Mein Vater David, der meistens auf dem Diwan im Schlafzimmer saß, dort seine Pfeife rauchte und die Rauchwolken zur Straße hin ausatmete, unterstützte mich in meinem Vorhaben. Er schrieb Briefe an seine amerikanischen Freunde und bat sie um ihre Unterstützung. Auf diese Weise gelang es ihm, meiner ein Jahr älteren Schwester, Elara, ein Stipendium durch eine Kirche zu sichern. Elara würde, wenn alle Vorbereitungen getroffen waren, in zwei Monaten nach Iowa City in die USA fliegen, um dort Pharmazie zu studieren. Dort würde sie bei einer Pfarrerfamilie leben. Solch ein Stipendium wünschte ich mir.
Meine Mama, als die bestbekannte Schneiderin der Stadt und darüber hinaus, wollte unbedingt mein Verabschiedungsfeierkleid selbst nähen. Ein Unikat sollte es werden. Vergnügt stöberten wir ihre Burda-Zeitschriften durch, die sie für ihre Kundinnen abonnierte, bis ich mir ein gewagtes Modell aussuchte. Es war ein knielanges Kleid mit einem großen V-Ausschnitt und Spaghettiträgern, Raffungen unter der Brust, und einer Taillennaht. Die Farbe Weiß war nach dem Brauch vorgegeben. Weiß symbolisiere die Reinheit, hieß es.
Die letzten Wochen, in denen ich von zuhause aus lernen durfte, genoss ich ungemein. Fleißig lernte ich tagein tagaus und nächtelang für einen möglichst guten Abiturschnitt, der mir ein Auslandsstipendium ermöglichen sollte. Meine Eltern hätten es sich nicht leisten können, mir oder meinen Geschwistern ein Studium im Ausland zu finanzieren.
Ich war so glücklich, den Mauern des Internats entkommen zu sein, dass die bevorstehenden Prüfungen für mich keine wirkliche Last waren. Ich spürte die Liebe und Fürsorge meiner Eltern. Sie gaben mir Kraft.
❖❖❖
„Dalia! Kannst du für eine Anprobe eine kurze Pause einlegen?“, rief meine Mama ein paar Tage später aus ihrer Arbeitsecke im Schlafzimmer.
„Ja Mama, gleich, in zehn Minuten“, antwortete ich aus dem Wohnzimmer, das durch eine Tür mit dem Schlafzimmer verbunden war und wo ich mich mit meinen Büchern und Notizen am großen Schreibtisch, der meiner Mama zum Schneidern von Kleidern diente, ausbreitete.
Mamas Arbeitsplatz war in der eigenen Wohnung. Er nahm eine kleine Ecke im Familienschlafzimmer ein. Dort standen ihre Nähmaschine und ein Stuhl. Für die Anprobe ihrer Kundinnen hatte Vater ihr einen großen Spiegel an den Familienkleiderschrank angebracht und an den Knäufen der vielen kleinen Wandschränke gegenüber der Fensterfront hängte sie die Kleider ihrer Kundschaft auf.
Obwohl das Schlafzimmer fast nur aus Betten, vier an der Zahl, einem Schrank, einem Diwan am Fenster zur Straße hin, einer Kommode zwischen Diwan und Schrank und der Nähmaschine mit ihrem Arbeitsstuhl bestand, war es der Dreh- und Angelpunkt unseres Familienlebens. Es war ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer, ein Anprobezimmer und der Treffpunkt der Familie in einem.
Im Sommer, wenn die Mittagssonne ihre silbrigen Strahlen auf die hängenden Kleider fallen ließ und die Perlen und Pailletten, die an manches Hochzeitskleid genäht waren, funkeln ließ, verwandelte sich die Wand des Schlafzimmers in ein dreidimensionales surreales Gemälde, das ich gern betrachtete. Mit meiner kleinen Hand fuhr ich als Kind über die Stoffe, um ihre Beschaffenheit zu ertasten und zu erraten, ob es sich dabei um Baumwolle, Seide, Samt, Chiffon oder einen anderen Stoff handelte. Und wenn dazu ein Windstoß den Reyhanduft ins Zimmer blies und dieser die bunten Sommerkleider an der Wand im Rhythmus der Brise tanzen ließ, entfaltete sich die Komposition aus Farbe, Duft und dynamischem Tanz zur prachtvollen Orchestrierung eines lebendigen Gemäldes, welches alle Sinne bediente und mich immer wieder bezauberte.
Mama half mir, ins Kleid zu schlüpfen.
„Pass auf, wie du das Kleid herunterziehst. Der Saum ist mit Stecknadeln geheftet und die Seitennähte sind bisher nicht festgesteppt“, merkte sie an.
Ich zog das Kleid vorsichtig herunter. Mit einem Lächeln stand ich vor dem Spiegel und betrachtete mich in meinem weißen Kleid: Der großzügige V-Ausschnitt und die Raffungen betonten meine Weiblichkeit, die ich jetzt aufmerksam wahrnahm. Die Spaghettiträger hoben meine freien Schultern und betonten meinen grazilen Hals. Erwachsen, wie eine junge Dame, kam ich mir vor.
Während ich mich im Spiegel betrachtete, zog Mama eine Schachtel aus der oberen Schublade der Kommode heraus. Darin lag eine weiß-goldene Kette mit den passenden Ohrringen dazu. Meine Augen, die den Schmuck zum ersten Mal sahen, funkelten vor Staunen. Mama legte die Halskette um meinen Hals:
„So siehst du fantastisch aus. Der Schmuck passt zu deinem Kleid. Magst du ihn zur Feier tragen?“
„Ja Mama, den möchte ich auf jeden Fall tragen; er ist so cool. Aber, Mama, kannst du das Kleid bitte ein klein wenig kürzen?“
Mama schaute kritisch in den Spiegel. Dann ging sie ein paar Schritte zurück, um die Länge des Kleides aus der Entfernung genauer zu betrachten.
„Ja, schon! Meine Liebe“, sagte sie nicht ganz überzeugt. „Aber es ist üblich, dass die Kleider zu diesem Anlass bodenlang sind. Deins reicht jetzt nur knapp unter das Knie. Ich weiß nicht, ob es dann nicht zu kurz sein wird.“
„Ich weiß Mama, aber ich möchte nicht wie eine Braut in Weiß aussehen. Bitte Mama! Nur ein paar Zentimeter kürzen. Nur bis über dem Knie.“
Mama nahm ein paar Stecknadeln aus dem Saum in ihre Mundwinkel und presste ihre Lippen zusammen, um sie dort festzuhalten. Währenddessen stand ich stramm und mit einem zwinkernden Auge und Genugtuung vor dem Spiegel, damit sie das Kleid geradlinig kürzen konnte.
Mein Lächeln war ihr nicht entgangen. Als sie die letzte Stecknadel aus ihrem Mundwinkel nahm, noch kniend, um sie ans Kleid zu heften, schaute sie hoch zu mir und flüsterte:
„Möge Gott dir all deine Träume erfüllen und dir dein Lächeln bewahren, Ya- Binti, meine Tochter.“
„Inschallah, Mama“, erwiderte ich, von ihrer Liebe beflügelt.
❖❖❖
Am Freitag, einem Tag vor der Feier, lief ich im Wohnzimmer auf und ab. Ich übte mehrmals meine Abschiedsfeierrede laut zu halten. Ohne Publikum gelang es mir problemlos. Aber wie unsicher werde ich, wenn Leute vor mir sitzen, viele Menschen, die ich größtenteils nicht kenne? Ich rief meine beiden Schwestern Katy und Elara, meinen Bruder Georgis und meine Eltern zu mir ins Wohnzimmer und ließ sie auf der Couch vor dem Fenster Platz nehmen. Ich entfernte mich ein paar Schritte und blieb vor der Tür zum Innenhof der Wohnung stehen. Von dort aus begann ich meine Rede vorzulesen. Meine Stimme war zittrig und leiser als die Male davor. Am Ende sagte mein Vater: Das war prima, stell dich aber jetzt draußen in den Hof, denke nicht daran, dass wir da sind, und lese sie ein zweites Mal laut vor. Ich ging in den Hof und trug die Rede ein letztes Mal laut und deutlich meinem imaginären Publikum vor. Mama hatte mir extra eine Seitentasche für die Rede an das Kleid angenäht.
Samstag, der lang ersehnte Tag meiner offiziellen Entlassung war gekommen. Die Familie – von Glück ergriffen – hatte sich in





























