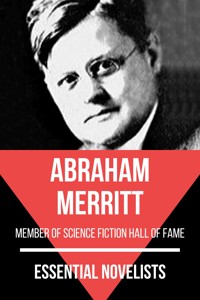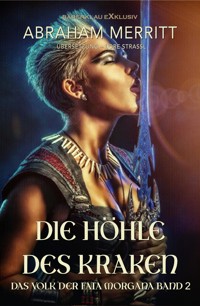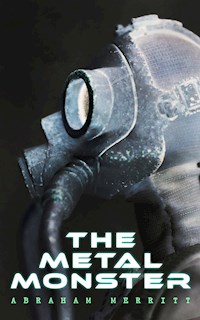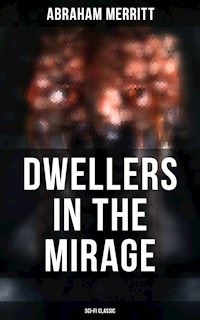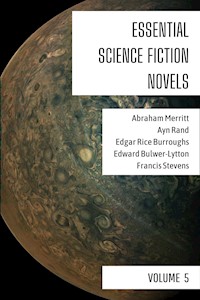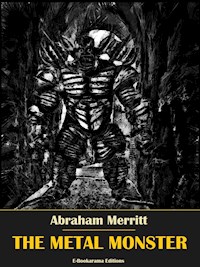4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Auf einer Forschungsreise im Südpazifik stößt der Botaniker Dr. Goodwin überraschend auf einen alten Freund, den Wissenschaftler Dr. Throckmartin, der ihm eine äußerst merkwürdige Geschichte erzählt. In den zyklopischen Ruinen der vorzeitlichen Ponape-Kultur auf einer der Karolineninseln verschwanden Throckmartins junge Frau und zwei weitere Expeditionsteilnehmer, entführt von einem rätselhaften, körperlosen, schimmernden Lichtwesen. Goodwin lauscht diesem Bericht zunächst recht skeptisch, muß sich aber eines Besseren belehren lassen, als er kurz darauf Zeuge wird, wie das geheimnisvolle Wesen auch Dr. Throckmartin zu sich holt … Ein phantastischer Abenteuerroman voller Spannung und Exotik. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Ähnliche
Abraham Merritt
Der Mondteich
Roman
Aus dem Amerikanischen von Marcel Bieger
FISCHER Digital
Inhalt
Bibliothek der phantastischen Abenteuer Herausgegeben von V. C. Harksen
Die Hauptpersonen
Dr. Walter Goodwin
amerikanischer Naturforscher, der in fernen Ländern seltene Pflanzen sucht und phantastische Abenteuer findet
Dr. David Throckmartin
Wissenschaftler, ein Freund Goodwins, der mitten im Meer ein rätselhaftes Ende findet
Larry O’Keefe
ein junger irisch-amerikanischer Abenteurer, der an die Banshee der O’Keefes glaubt und sich Goodwin anschließt
Olaf Huldricksson
ein norwegischer Kapitän, ebenfalls Goodwins Begleiter
Marakinow
ein russischer Forscher und Geheimagent
Der Glänzende
ein unheimliches Wesen, Bewohner des Mondteichs, mit Zauberkräften begabt
Rador
ein Krieger im unterirdischen Land Muria
Lakla
das goldene Mädchen, Radors Nichte und Dienerin der Schweigenden Götter
Yolara
die verführerische, korrupte Priesterin des Glänzenden
Lugur
ihr Geliebter, Heerführer von Muria
Für ROBERT H. DAVIS
In Anerkennung, neben vielem anderen, für Larry O’Keefes Vertrauen in die Märchen.
Vorwort
Die Veröffentlichung der folgenden Erzählung von Dr. Walter T. Goodwin wurde vom Exekutivrat des Internationalen Wissenschaftsverbands autorisiert.
Erstens: Um offiziell den Spekulationen den Boden zu entziehen, die sich um das sogenannte Throckmartin-Rätsel ranken, und um die versteckten wie offenen, skandalösen Verdächtigungen zu beenden, die bereits jetzt das Ansehen von Dr. David Throckmartin, seiner jungen Frau und seines ebenso jungen Mitarbeiters, Dr. Charles Stanton, beflecken. Diese Gerüchte kamen durch ein verspätetes Telegramm aus Melbourne, Australien, in Umlauf, das über das Verschwinden des Obengenannten von Bord eines Schiffes mit Kurs auf selbigen Hafen berichtete; zusätzliche Nahrung erhielten diese Gerüchte durch die anschließenden Nachrichten vom Verschwinden seiner Frau und seines Mitarbeiters aus dem Lager, das ihre Expedition auf einer der Inseln der Karolinen aufgeschlagen hatte.
Zweitens: Der Exekutivrat ist zu der Ansicht gelangt, daß Dr. Goodwins Erfahrungen bei seinen heroischen Bemühungen, die drei zu retten, und der Wissensschatz und die Warnungen aus diesen Erfahrungen für die Menschheit als Ganzes zu wichtig sind, um in wissenschaftlichen Periodika versteckt zu werden, wo sie nur einer kleinen Gruppe einschlägig Vorgebildeter zugänglich werden. Auch soll Dr. Goodwins Bericht nicht in den Tageszeitungen abgedruckt werden; denn angesichts der in diesen Medien vorherrschenden Platznot könnte er nur stark gekürzt und fragmentarisch erscheinen.
Aus diesen Gründen hat der Exekutivrat Mr. A. Merritt beauftragt, die stenographischen Aufzeichnungen von Dr. Goodwin, die er dem Rat vorlegte, in eine auch dem Laien verständliche Form zu übertragen. Diese Notizen wurden von mündlichen Zusätzen und Kommentaren Dr. Goodwins ergänzt und erweitert. Diese Übertragung nun bildet, nachdem sie vom Exekutivrat durchgesehen und streng geprüft wurde, den Inhalt des vorliegenden Werks.
Dr. Walter T. Goodwin, selbst Mitglied des Exekutivrats, Dr. phil., Mitglied der Königlichen Geographischen Gesellschaft etc., ist ohne jeden Zweifel der führende amerikanische Botaniker, ein Forscher von höchstem internationalem Ansehen und der Autor verschiedener epochaler Abhandlungen aus dem von ihm gewählten Zweig der Naturwissenschaften. Seine Geschichte, verblüffend im wahrsten und eigentlichsten Sinn des Wortes, wird von mehr als ausreichenden Beweisstücken gestützt, die er uns höchstpersönlich vorlegte und die von der Organisation, der ich als Präsident vorzusitzen die Ehre habe, vollständig und ohne Bedenken akzeptiert wurden. Was auch immer aus dieser populären Darstellung gestrichen wurde – aus Gründen der äußerst bedrohlichen Möglichkeiten, die darin enthalten sind, oder die sich, sollten sie in falsche oder unachtsame Hände geraten, zu einer schweren Gefahr entwickeln könnten –, soll in reinen Wissenschaftsorganen abgehandelt und nur einem sorgfältig ausgesuchten Kreis zugänglich gemacht werden.
Für den Internationalen Wissenschaftsverband J.W.K. Der Präsident
I Das Ding auf dem Mondpfad
Zwei Monate hatte ich auf den D’Entrecasteaux-Inseln[*] verbracht, um dort Proben und Daten für die abschließenden Kapitel meines Werks über die Flora der vulkanischen Inseln im Südpazifik zu sammeln. Tags zuvor hatte ich Port Moresby[**] erreicht und die sichere Verladung meiner Proben an Bord der Southern Queen überwacht. Als ich dann später auf dem Oberdeck saß, dachte ich voller Heimweh an die vielen Seemeilen, die mich von Melbourne trennten, und an die noch viel längere Strecke zwischen Melbourne und New York.
Es war einer jener gelben Morgen auf Papua, an denen sich die Insel von ihrer düstersten und unheilvollsten Seite zeigt. Der Himmel schwelte in ockerfarbenen Tönen. Über dem Land lag eine dumpfe, eigentümliche und Unheil verkündende Stimmung, in der die Bedrohung von geheimnisvollen, bösartigen Mächten mitschwang, die nur darauf zu warten schienen, freigelassen zu werden. Diese Stimmung schien aus dem ungezähmten, wilden Herzen Papuas selbst zu strömen; eine Insel, die selbst noch in ihrem Lächeln unheilbringend wirkt. Hin und wieder kam wie ein Hauch aus den unberührten Dschungeln ein Windstoß, beladen mit unbekannten Düften, die geheimnisvolle Feindseligkeit verhießen.
An solchen Morgen flüstert Papua seinen Besuchern zu, wie unvorstellbar alt das Land ist und welche Macht ihm innewohnt. Und so, wie es jedem Weißen ergeht, kämpfte ich gegen den Bann an, unter den ich zu geraten drohte. Während ich noch rang, bemerkte ich einen hoch aufgerichteten Mann, der den Pier heraufmarschierte. Ihm folgte ein junger Kapa-Kapa, der einen neuen Koffer trug. Irgend etwas an dem Mann kam mir bekannt vor. Als er die Laufplanke erreichte, sah er mir direkt in die Augen, starrte mich einen Moment lang an und winkte dann mit der Hand.
Jetzt erkannte ich ihn. Es war Dr. David Throckmartin. Für mich war er immer nur »Throck« gewesen, einer meiner ältesten Freunde und dazu eine Geisteskapazität ersten Ranges, dessen Charakter und Leistungen für mich – wie für etliche andere – eine stete Quelle der Inspiration waren.
Gleichzeitig mit meinem Wiedererkennen traf mich ein überraschender und ganz sicher unerfreulicher Schock. Sicher, es war Throckmartin, aber von ihm ging etwas Beunruhigendes aus, wie ich es von dem Mann nicht kannte, mit dem ich nun schon so lange und so gut bekannt war und dem ich mit seiner kleinen Gesellschaft vor kaum einem Monat Lebewohl gewünscht hatte, bevor ich in See gestochen war. Throckmartin war damals erst ein paar Wochen verheiratet gewesen, mit Edith, der Tochter von Professor William Frazier. Sie war mindestens zehn Jahre jünger als er, aber eins mit seinen Idealen und genauso, wenn das überhaupt möglich war, in Throckmartin verliebt wie er in sie. Dank der Ausbildung durch ihren Vater war sie eine ideale Assistentin, und dank ihres süßen und ehrlichen Herzens war sie – und ich benutze das Wort hier im altertümlichen Sinne – eine vollkommene Geliebte. Mit dem ebenfalls noch recht jungen Mitarbeiter, Dr. Charles Stanton, und der Schwedin Thora Halversen, die seit Ediths Geburt ihr Kindermädchen war, hatten sie sich nach Nan-Matal aufgemacht, jener bemerkenswerten Gruppe von Inseltrümmern, die sich vor der Ostküste der Karolineninsel Ponape erstrecken.
Ich wußte, daß Throckmartin mindestens ein Jahr auf diesen Inseln verbringen wollte, zwischen Ponape und Lele – dem Zwillingsrätsel einer bis heute nicht entschlüsselten Zivilisation, die Äonen vor dem Beginn der alten ägyptischen Kultur geblüht hatte. Von ihren Künsten wußten wir nur wenig und von ihrem Wissen rein gar nichts. Throckmartin hatte eine ungewöhnlich große Ausrüstung für die Arbeit mitgeführt, die ihn dort erwartete … und von der er hoffte, daß sie ihm ein Denkmal setzen würde.
Was um alles in der Welt hatte Throckmartin heute nach Port Moresby geführt? Und was war das für eine seltsame Veränderung, die ich an ihm wahrgenommen hatte?
Ich eilte zum tiefer gelegenen Deck hinunter und entdeckte ihn dort beim Zahlmeister. Als ich ihn anrief, drehte er sich um und streckte mir hastig eine Hand entgegen. Da erkannte ich, was sich an ihm so verändert hatte, daß es mir einen Schauer über den Rücken jagte. Natürlich begriff er, daß mein plötzliches Schweigen und Zurückweichen auf den Schock zurückzuführen waren, den sein Anblick bei mir ausgelöst hatte. Tränen schossen in seine Augen. Er wandte sich brüsk vom Zahlmeister ab, zögerte noch einen Moment und eilte dann in seine Luxuskabine.
»Ein seltsamer Kauz, nicht wahr?« brummte der Zahlmeister. »Kennen Sie ihn, Sir? Er scheint Ihnen ja einen gehörigen Schrecken eingejagt zu haben.«
Ich gab ihm etwas Belangloses zur Antwort und kehrte langsam zu meinem Sonnenstuhl zurück. Da saß ich dann, bemühte mich, meine Gedanken zu ordnen, und versuchte herauszufinden, was mich so in Unruhe versetzt hatte. Dann kam mir die Erleuchtung. Der Throckmartin, wie ich ihn gekannt hatte, war am Vorabend seines Aufbruchs ein kräftiger, durchtrainierter und blühender Vierziger gewesen. Sein Herz war erfüllt von Enthusiasmus, und sein Geist war voller Frische und wissenschaftlicher Neugier – oder sollte ich besser sagen: voller Erwartung – gewesen. Sein ständig fragender Geist hatte seinem Gesicht den Stempel aufgedrückt.
Aber der Throckmartin, dem ich gerade eben begegnet war, sah aus wie ein Mann, der einen gehörigen Schock in einer Mischung aus Taumel und Entsetzen erlebt hatte. Eine verheerende Sintflut in seiner Seele, die auf ihrem Höhepunkt den Ausdruck seines Gesichts tiefgreifend umgestaltet hatte, die seinen Zügen statt Begeisterung Ekstase und Verzweiflung aufgedrückt hatte. So als seien diese beiden Regungen Hand in Hand und ungehindert hochgekommen, hätten Besitz von ihm ergriffen und dann beim Davongehen unauslöschlich ihren Schatten hinterlassen.
Ja, genau das war das Entsetzliche an ihm. Wie konnten zwei so gegensätzliche Regungen wie Ekstase und Verzweiflung – ein Paar wie Katz’ und Hund – sich miteinander verbrüdern, einander an der Hand fassen, sich umarmen?
Aber in Throckmartins Gesicht waren sie einander wie Busenfreunde nahe gewesen!
Tief in Gedanken – und unterbewußt mit Erleichterung – beobachtete ich, wie die Küstenlinie hinter uns immer kleiner wurde. Ich hieß die frische Brise des offenen Meeres willkommen. Ich hoffte, und in dieser Hoffnung lag gleichzeitig eine unerklärliche Angst, Throckmartin beim Lunch zu begegnen. Aber er kam nicht in die Messe, und in meiner Enttäuschung spürte ich tief in mir auch Erleichterung. Den ganzen Nachmittag schlenderte ich unstet umher, aber er blieb in seiner Kabine. Und mir fehlte die Kraft oder der Mut, ihn dort aufzusuchen. Throckmartin ließ sich auch beim Dinner nicht blicken.
Die Dämmerung war nur kurz, und die Nacht brach rasch herein. Die Luft war warm, und so setzte ich mich wieder in meinen Deckstuhl. Die Southern Queen stampfte durch eine unruhige Dünung, und ich war ganz allein auf dem Deck.
Am Himmel breitete sich ein Wolkenbaldachin aus, der mit schwachem Leuchten vom Mond dahinter kündete. Überall funkelte Meeresleuchten. Ungleichmäßig stiegen am Bug und an den Seiten des Schiffes die kleinen Gischtnebel hoch, die typisch sind für die Südsee und an den Atem von Meeresungeheuern erinnern, nur kurz brodeln und dann eilig wieder verschwinden.
Unerwartet öffnete sich die Decktür, und Throckmartin trat heraus. Er blieb unsicher stehen, sah mit einem sonderbar begierigen und intensiven Blick in den Himmel und schloß dann langsam die Tür hinter sich.
»Throck!« rief ich. »Komm her, ich bin’s, Goodwin.«
Er kam zu mir.
»Throck«, sagte ich geradeheraus, um keine Zeit mit Vorreden zu verlieren, »was fehlt dir? Kann ich dir irgendwie helfen?«
Mir fiel sofort auf, wie sein Körper sich versteifte.
»Ich fahre nach Melbourne, Goodwin«, antwortete er. »Muß da ein paar Dinge besorgen, die ich dringend benötige. Und neue Männer anwerben … weiße Männer …«
Er hielt abrupt inne, sprang aus seinem Stuhl und starrte angespannt nach Norden. Ich folgte seinem Blick. Weit, weit fort war der Mond durch die Wolken gebrochen. Unweit des Horizonts war sein schwaches Leuchten auf der glatten See zu erkennen. Der weit entfernte Lichtfleck zitterte und schwankte. Die Wolken wurden wieder dichter, und damit verschwanden Mond und Licht. Das Schiff stampfte rasch, aber stetig nach Süden.
Throckmartin ließ sich in seinen Stuhl fallen. Als er sich eine Zigarette anzündete, zitterte seine Hand. Plötzlich wandte er sich mir zu, so als sei er zu einem Entschluß gekommen.
»Goodwin«, sagte er, »ich brauche wirklich Hilfe. Wenn jemals ein Mensch Hilfe gebraucht hat, dann ich. Goodwin, kannst du dich in einer anderen Welt vorstellen … eine fremde, unbekannte Welt voller Schrecknisse, deren einziger Daseinszweck zu sein scheint, die furchterregendsten Dinge auszubreiten? Du ganz allein in einer solchen Welt, ein Fremder, der sich nicht auskennt? Wenn man einem solchen Mann Hilfe zugestehen will, dann muß man mir Hilfe gewähren …«
Wieder hielt er von einem Moment auf den anderen inne und sprang auf. Die Zigarette fiel ihm aus den Fingern. Der Mond war nochmals durch die Wolken gebrochen, doch jetzt viel näher als vorhin. Kaum anderthalb Kilometer war der Lichtfleck entfernt, den er auf die Wellen warf. Dahinter glitt eine Straße aus Mondlicht bis fast an den Horizont entlang. Eine gigantische glitzernde Schlange, die über den Rand der Welt direkt aufs Schiff zuzurasen schien.
Throckmartin erstarrte davor wie ein Jagdhund, der einen Bau ausgemacht hat. Mir schien es so, als würde von meinem Freund eine Woge des Schreckens ausgehen … jedoch Schrecken, in dem eine unbekannte, unmenschliche Freude mitschwang. Die Woge streifte mich und war fort … ließ mich zitternd unter dem Eindruck ihrer bitteren Süße zurück.
Throck beugte sich vor, und seine Seele lag offen in seinen Augen. Die Mondstraße kam näher, immer näher. Sie war nun kaum noch einen Kilometer von uns entfernt. Und vor ihr floh das Schiff … gerade so, als fühlte es sich verfolgt. Rasch und bestimmt wie ein strahlender Regenguß, der durch die Wellen pflügte, raste die Mondschlange heran.
»Großer Gott!« keuchte Throckmartin, und wenn je Worte wie ein Gebet und eine Beschwörung zugleich geklungen hatten, dann in diesem Augenblick.
Dann, zum erstenmal … sah ich … es!
Die Mondstraße reichte bis zum Horizont und wurde zu beiden Seiten von der Dunkelheit der Nacht begrenzt. Es schien so, als seien die Wolken am Himmel so geteilt worden, daß sie einen Pfad offenließen. Wie Vorhänge waren sie beiseite gezogen … oder geteilt wie das Rote Meer, um die Israeliten hindurchzulassen und hinter ihnen ihre Feinde zu zerschmettern. Zu beiden Seiten des Stroms hingen die schwarzen, von den Zusammenballungen der Wolken am Himmel geworfenen Schatten. Und gerade wie eine Straße glänzten, schimmerten und tanzten zwischen den dunklen Wänden die rasenden Strahlen des Mondlichts.
Weit, unmeßbar weit auf diesem Strom von silbernem Feuer spürte ich eher, als daß ich es sah, wie etwas heranpreschte. Als es zum erstenmal sichtbar wurde, präsentierte es sich als tiefes Glühen inmitten des Lichts. Unbeirrbar näherte es sich uns, ein dunkler Nebel, der beim Heransausen an ein geflügeltes Wesen erinnerte. Dunkel kam mir die Legende der Dajak von einem geflügelten Boten Buddhas ins Bewußtsein: der Vogel Akla, dessen Federn aus Mondstrahlen gewebt sind, dessen Herz aus einem lebendigen Opal besteht und dessen Schwingen im Flug das Echo der kristallklaren Musik der weißen Sterne widerhallen lassen; dessen Schnabel aber aus gefrorenen Flammen gemacht ist, und mit diesem zerstückelt er die Seelen der Ungläubigen.
Noch näher kam der Nebel heran, und nun erreichte auch ein süßes, anregendes Klingeln mein Ohr; wie Pizzicati auf gläsernen Violinen gespielt. Kristallklare Klänge wie Diamanten, die in Töne zerschmelzen.
Nun hatte dieses Ding fast das Ende des Mondlichtpfads erreicht und war der Barriere aus Schwärze ganz nahe, die sich zwischen dem Schiff und dem glitzernden Kopf des leuchtenden Stroms erstreckte. Jetzt schlug es gegen die schwarze Mauer an wie ein Vogel, der gegen die Stangen seines Käfigs anstürmt. Das Ding wirbelte wie mit schimmernden Federn, wie mit lichternen Schwingen, wie mit Spiralen von lebenden Nebeln. In seinem Innern aber waren sonderbare, fremde Lichter, die vage an in Unruhe versetztes Perlmutt erinnerten. Blitze und glitzernde Atome strömten hindurch, so als würden sie aus den Strahlen gesaugt, in denen das Ding gebadet wurde.
Noch näher rauschte es heran, getragen von den funkelnden Wogen, und schmaler und schmaler schrumpfte die schützende Wand aus Dunkelheit zwischen ihm und uns zusammen. In dem Nebel befand sich ein Kern, ein Nucleus aus intensiverem Licht … ein geäderter, opalisierender, strahlender und unzweifelhaft lebendiger Kern. Und über ihm hingen in dem Gefieder und den Spiralen, die zuckten und wirbelten und pulsierten, sieben glühende Lichter.
Durch all diese unaufhörliche, aber geordnete Bewegung des … Dings … blieben diese Lichter fest an ihrem Platz. Sieben Lichter wie sieben kleine Monde. Einer war von einem perlfarbenen Rosa, einer von einem perlmuttartigen, zarten Blau, einer von einem funkelnden Saffrangelb, einer von dem Smaragdgrün, wie man es in den seichten Küstenwassern tropischer Inseln sieht, einer von einem tödlichen Weiß, einer von einem geisterhaften Amethyst und der letzte von dem Silber, wie man es nur auf den Schuppen fliegender Fische sieht, die im Mondlicht über das Wasser springen.
Die glockenhafte Musik wurde lauter. Sie durchbohrte die Ohren wie mit einem Schauer von winzigen Lanzen, daß einem das Herz vor Freude immer wilder schlug … und gleichzeitig brachte sie das Herz ruckartig zum Stehen. Sie schnürte einem die Kehle mit dem Pulsschlag des Entzückens zu und drosselte sie zugleich mit der Hand unendlicher Trauer.
Dann hörte ich einen gemurmelten Schrei, der die Klingeln und Glocken verstummen ließ. Unzweifelhaft ein Schrei, aber ausgestoßen von einem Wesen, das in dieser Welt ganz und gar fremd war. Das Ohr nahm den Schrei auf und bemühte sich angestrengt, ihn in einen irdischen Klang zu übertragen. Und während dieser Arbeit zuckte das Gehirn unwillkürlich vor diesem Laut zurück, während es gleichzeitig mit aller Macht zurückdrängte, hin zu dem Schrei.
Throckmartin marschierte zur Reling, direkt auf den Nebel zu, den nun nur noch wenige Meter vom Schiff trennten. Alles Menschliche war aus dem Gesicht meines Freundes gewichen. Reine Agonie und pure Ekstase ruhten Seite an Seite auf seinen Zügen, so als bestünde keine Widersprüchlichkeit zwischen ihnen. Unheimliche, unmenschliche Gefährten, die sich zu einem Ganzen vereinten, wie es für keine von Gottes Kreaturen vorgesehen ist. Und tief und intensiv waren diese Regungen, so daß sie nur aus der Seele selbst kommen konnten. Ein Gott und ein Dämon wohnten Throck in höchster Harmonie inne! So muß Satan erschienen sein, als er gerade fiel und immer noch göttlich war, als seine Gedanken noch im Himmel waren und er gleichzeitig schon die Hölle erwartete.
Doch dann verging übergangslos die Straße aus Mondlicht! Die Wolken waren wieder zusammengezogen, so als habe eine Riesenhand den Vorhang geschlossen. Vom Süden wehte ein kreischender Windstoß heran. Als der Mond hinter den Wolken verschwand, verschwand mit ihm das, was ich zu sehen geglaubt hatte … ausgelöscht wie das Abbild auf einer Laterna magica. Das Klingeln setzte mittendrin aus und hinterließ ein Schweigen, wie es nach einem plötzlichen, heftigen Donnerschlag zu vernehmen ist. Nichts mehr umgab uns außer Stille und Schwärze.
Ein Schaudern durchfuhr mich, und ich kam mir vor wie jemand, der am äußersten Rand des Abgrunds gestanden hat, in dem, wie die Bewohner der Louisaden sich erzählen, der Fischer haust, der nach den Seelen der Menschen angelt.
Throckmartin legte einen Arm um mich.
»Es ist so, wie ich es erwartet habe«, erklärte er. Ein neuer Ton war in seiner Stimme. Eine Ruhe und Sicherheit, die alle lauernden Schrecken des Unbekannten fortgewischt hat. »Nun weiß ich es. Begleite mich in meine Kabine, alter Freund. Denn nun, da auch du es gesehen hast, kann ich dir alles erzählen …« er zögerte …»erzählen, was das war, das du gesehen hast.«
Als wir durch die Decktür schritten, begegneten wir dem Ersten Offizier des Schiffs. Throckmartin gelang es, seine Miene so normal wie möglich aussehen zu lassen.
»Steht uns ein größerer Sturm bevor?« fragte er.
»Ja«, bestätigte der Offizier, »wahrscheinlich die ganze Fahrt über bis nach Melbourne.«
Throckmartin richtete sich gerade auf, so als sei ihm etwas klargeworden. Unbeherrscht zog er den Mann am Ärmel.
»Heißt das, der Himmel ist bewölkt …« wieder hielt er inne …»für die nächsten drei Nächte?«
»Höchstwahrscheinlich für die nächsten sechs Nächte«, antwortete der Offizier.
»Gott sei Dank!« entfuhr es Throck, und ich habe wohl nie so viel Erleichterung und Hoffnung in einer menschlichen Stimme vernommen.
Der Seemann sah ihn verblüfft an. »Gott sei Dank?« wiederholte er verständnislos. »Was meinen Sie denn damit?«
Aber Throck war schon auf dem Weg zu seiner Kabine. Ich beeilte mich, ihm zu folgen. Aber der Erste Offizier hielt mich zurück.
»Fehlt Ihrem Freund etwas?« wollte er von mir wissen.
»Die See!« antwortete ich hastig. »Das Schlingern, er ist nicht daran gewöhnt. Ich werde mich um ihn kümmern.«
Zweifel und Ungläubigkeit standen deutlich in den Augen des Mannes zu lesen, aber ich wollte mich nicht mehr mit ihm befassen. Denn mir war nun klar, daß meinem Freund wirklich etwas fehlte … aber diese Krankheit konnte weder der Schiffsarzt noch sonst jemand heilen.
II»Tot! Alle tot!«
Er hockte auf dem Rand seiner Koje und hielt die Hände vors Gesicht. Den Mantel hatte er bereits abgenommen.
»Throck!« rief ich beim Eintreten. »Was um alles in der Welt war das? Wovor fliehst du, Freund? Wo ist deine Frau … und wo ist Stanton?«
»Tot!« antwortete er tonlos. »Tot! Alle sind tot!« Als ich entsetzt zurückfuhr, sagte er wieder: »Tot! Alle tot! Edith, Stanton, Thora … tot … oder sogar noch Schlimmeres! Edith im Mondsee … bei ihnen … angezogen von dem, das du auf dem Mondlichtpfad gesehen hast … das mir sein Mal aufgedrückt hat … das mir seither unbarmherzig folgt …«
Er riß sich das Hemd auf.
»Sieh dir das an«, sagte er. Auf seiner Brust rund um das Herz war die Haut perlweiß. Ein Weiß, das sich scharf von der gesunden Bräune des restlichen Körpers abhob. Ein Kreis von etwa fünf Zentimetern Durchmesser.
»Drück sie darauf aus!« sagte er und hielt mir seine Zigarette entgegen. Ich schrak zurück. Er drängte mir die Zigarette auf. Ich drückte das glühende Ende in den weißen Kranz. Throck zuckte nicht im mindesten zusammen, und es roch auch nicht nach verbranntem Fleisch. Als ich die Zigarette fortzog, war auf dem weißen Fleck keinerlei Veränderung zu erkennen.
»Fahr mal mit den Fingern darüber«, forderte er mich auf. Ich betastete den Kranz mit den Fingerspitzen. Er fühlte sich kalt an, kalt wie Marmor.
Throck knüpfte sich das Hemd wieder zu.
»Zwei Dinge hast du nun gesehen«, sagte er. »Das Ding und das Mal. Diese beiden Belege müssen dir ausreichen, meiner Geschichte Glauben zu schenken. Goodwin, ich sage es noch einmal: Meine Frau ist tot … oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten … ich weiß es leider nicht genau. Sie ist dem Nebel zum Opfer gefallen … ebenso wie Stanton und ebenso wie Thora. Warum nur …«
Tränen rannen über sein gezeichnetes Gesicht.
»Warum nur hat Gott es zugelassen, daß wir in die Fänge eines solchen Wesens gerieten? Warum hat Er mir meine Edith genommen?« rief er in bitterster Verzweiflung. »Ist dieses Wesen stärker als Gott, oder wie soll man es sich erklären, Walter?«
Ich schwieg, weil ich nicht wußte, was ich hätte antworten sollen.
»Gibt es solche Wesen? Wesen, die mächtiger sind als Gott?« Seine wilden Augen starrten mich durchdringend an.
»Ich weiß nicht, was Gott für dich bedeutet«, bezwang ich endlich meine Fassungslosigkeit. »Wenn du den Willen meinst, zur Erkenntnis zu gelangen, die Grenzen der Wissenschaft immer weiter fortzuschieben …«
Er winkte nur unwillig ab.
»Wissenschaft«, schnaubte er. »Was ist schon unsere Wissenschaft gegen das? Oder gegen die Wissenschaft der Teufel, die dieses Ding gemacht haben … oder den Weg bereitet haben, auf dem es auf die Erde kommen konnte?«
Mühsam gewann er die Kontrolle über sich zurück.
»Goodwin«, sagte er, »was weißt du von den Ruinen auf den Karolinen; von den zyklopenhaften, ungeheuerlichen Städten und Häfen von Ponape und Lele, von Kusaie, von Ruk und Hogola und von einer Vielzahl weiterer dortiger Inselchen? Und was weißt du insbesondere von Nan-Matal und Metalanim?«
»Von Metalanim habe ich gehört und auch einige Photographien gesehen«, antwortete ich. »Man nennt diesen Ort doch das Vineta des Pazifiks, nicht wahr?«
»Sieh auf diese Karte«, sagte Throckmartin. »Das ist Christians Karte vom Metalanim-Hafen und von Nan-Matal. Und hier die Rechtecke, über denen Nan-Tauach steht, siehst du sie?«
»Ja«, erklärte ich.
»Unter diesen Wällen«, fuhr er fort, »liegen der Mondsee und die sieben glühenden Lichter, die den Bewohner des Sees heraufholen; und der Altar und der Schrein des Bewohners. Und mit ihm im Mondsee liegen Edith, Stanton und Thora.«
»Der Bewohner des Mondsees?« wiederholte ich ungläubig.
»Das Ding oder das Wesen, das du heute nacht gesehen hast«, antwortete Throckmartin düster.
Ein heftiger Regenguß prasselte an die Schiffsseite, und die Southern Queen fing in dem unruhiger werdenden Seegang an zu schlingern. Throckmartin atmete tief erleichtert aus, zog den Vorhang beiseite und starrte hinaus in die Nacht. Die Dunkelheit schien ihm Sicherheit zu geben. Als er sich wieder auf die Koje setzte, war er ruhig und gelassen.
»Auf der ganzen Welt finden sich keine wunderbareren Ruinen«, erklärte er fast schon beiläufig. »Sie breiten sich über gut fünfzig Inseln und Inselchen aus und bedecken mit ihren Verbindungskanälen und Lagunen eine Fläche von etwa zwanzig Quadratkilometern. Wer das erbaut hat, ist uns leider nicht bekannt. Auch nicht, wann dieses Gebilde angelegt wurde. Wohl Äonen vor der Bewußtseinswerdung des Menschen. Vor zehn-, zwanzig- oder hunderttausend Jahren … mir scheint das letzte am wahrscheinlichsten zu sein.
Alle diese Eilande, Walter, sind viereckig, und ihre Küsten bestehen aus gigantischen Basaltblöcken, die bearbeitet und von den damaligen Menschen an ihren Platz gebracht worden sind. Titanische Dämme, Walter, an deren Binnenseiten Terrassen aus Basaltblöcken angebracht sind, die zwei Meter über den seichten Kanälen hinausragen, die sich zwischen den Steinen hindurchschlängeln. Landeinwärts stehen Festungen, an denen der Zahn der Zeit nicht spurlos vorübergegangen ist. Forts mit Palästen, Terrassen und Pyramiden. Gewaltige Parks und Gärten, die mit Ruinen übersät sind. Und alles ist so uralt, daß es den Blick des Betrachters welk macht.
Irgendwann hat eine größere Bodensenkung stattgefunden. Man kann fünf Kilometer entfernt am Metalanim-Hafen stehen und auf die Spitzen ähnlicher monolithischer Strukturen und Wände hinaussehen, die zum Teil mehrere Meter tief unter der Wasseroberfläche liegen.
Und überall wie Perlen an einer Kette liegen entlang den Kanälen die befestigten Inselchen und starren mit ihren rätselhaften Mauern aus den dichten Mangrovendschungeln. Tot und verlassen seit undenklicher Zeit und gemieden von denen, die hier leben.
Du als Botaniker bist mit der Theorie vertraut, daß einst im Pazifik ein großer, geheimnisvoller Kontinent existiert haben muß. Ein Erdteil, der nicht wie das legendäre Atlantis im Atlantik durch vulkanische Gewalt unterging. Meine Arbeiten auf Java, Papua und den Ladronen haben mein Augenmerk auf diesen untergegangenen Pazifik-Kontinent gelenkt. Man nimmt ja allgemein an, daß die Azoren die letzten hohen Gipfel von Atlantis sind. Und ähnlich dem erhielt ich ständig Hinweise dafür, daß Ponape und Lele mit ihren basaltbefestigten Inselchen die letzten Punkte des langsam versunkenen Kontinents gewesen sein müssen. Der letzte Ort, der sich ans Sonnenlicht klammerte, der letzte Fluchtpunkt und der heilige Ort der Herrscher jener Rasse, die ihr Reich unter dem ansteigenden Wasser des Pazifiks verloren hatten.
Wie dem auch sei, ich war fest entschlossen, unter diesen Ruinen die Beweise für meine Theorie zu finden.
Meine … meine Frau und ich hatten vor unserer Hochzeit lange und ausführlich über dieses gewaltige Vorhaben diskutiert. Nach den Flitterwochen stellten wir alles für die Expedition zusammen. Stanton war davon nicht minder begeistert als wir. Und wie du weißt, segelten wir im letzten Mai los, um meinen Traum wahr werden zu lassen.
Auf Ponape haben wir – nicht ohne Schwierigkeiten – Männer für die Grabungsarbeiten angeworben. Ich mußte außerordentliche Belohnungen in Aussicht stellen, bis ich meine Truppe zusammen hatte. Diese Ponapeer sind reichlich abergläubisch. Ihre Sümpfe, Wälder, Berge und Küsten sind mit bösen Geistern übervölkert … sie nennen sie Ani. Aber noch größere Angst haben sie vor den Ruineninseln und vor allem vor denen, die nach ihrem Glauben dort hausen. Und seit meinen dortigen Erlebnissen kann ich darüber nicht mehr lachen!
Als die Arbeiter hörten, wohin die Reise gehen sollte und wie lange wir dort bleiben wollten, fingen sie an zu murren. Diejenigen, die ich dann doch noch gewinnen konnte, machten das von einer Bedingung abhängig, die ich damals für puren Aberglauben hielt: Sie bestanden darauf, uns in den drei Nächten des Vollmonds verlassen zu dürfen. Walte Gott, wir hätten besser auf sie gehört und wären mit ihnen gegangen!
Bald danach liefen wir in den Hafen Metalanim ein. Zu unserer Linken erhob sich anderthalb Kilometer entfernt ein massives Viereck. Seine Mauern waren zwölf Meter hoch und fünfzig oder sechzig Meter lang. Als wir das Gebilde passierten, wurden unsere Eingeborenen sehr still. Verstohlen und furchtsam starrten sie auf die Mauern. Ich kannte diesen Ort als die Ruine der Anlage, die man Nan-Tauach nennt, die ›Stätte der drohenden Mauern‹. Durch das Schweigen meiner Arbeiter fiel mir wieder ein, was Christian über diese Anlage schreibt; wie er auf sie gestoßen war, ihre ›uralten Hochebenen und vierkantigen Einfassungen aus Mauerwerk‹ entdeckt hatte; wie er das Wunder ihrer kurvenreichen Straßen und des Labyrinths ihrer flachen Kanäle betrachtet hatte; die drohenden Massen aus behauenem Stein, die aus grünen Wänden herausragten; die zyklopenhaften Barrikaden; und auch, wie er sich umwandte und in ›geisterhafte Schatten‹ starrte. Im Nu sei alle Fröhlichkeit seiner Führer wie fortgeweht gewesen, und man habe sich nur noch im Flüsterton unterhalten.«
Er schwieg einige Sekunden lang.
»Selbstverständlich hatte ich vor, genau dort mein Lager aufzuschlagen«, fuhr er dann leise fort. »Aber ich gab diesen Plan bald wieder auf. Die Eingeborenen hatten eine Angst, die man nur noch mit Panik umschreiben konnte. Sie drohten gar, auf der Stelle umzukehren. ›Nein‹, riefen sie, ›Große Ani seien dort. Wir an jeden anderen Ort gehen, aber nicht hier‹.«
Er schüttelte nachdenklich den Kopf.
»Wir entschieden uns schließlich für ein Inselchen namens Uschen-Tau. Es lag nicht allzu weit von meinem ursprünglichen Standort entfernt, war aber weit genug davon entfernt, um meine Arbeiter wieder zur Ruhe kommen zu lassen. Wir fanden dort einen vorzüglichen Lagerplatz mit einer frischen Wasserquelle. Die Männer schlugen die Zelte auf, und nach ein paar Tagen war unsere Arbeit in vollem Gange.«
IIIDer Mondstein
»Ich habe im Moment nicht vor«, erklärte Throckmartin, »dir von den Ergebnissen der beiden ersten Wochen zu berichten und auch nicht davon, was wir in dieser Zeit gefunden haben. Später will ich, insofern es mir möglich ist, das alles nachholen. Es mag an dieser Stelle ausreichen zu erwähnen, daß ich nach diesen vierzehn Tagen etliche Bestätigungen für meine Theorien aufgespürt hatte.
Der Ort hatte uns trotz all seines Verfalls und all seiner Trostlosigkeit nicht morbide machen können, weder Edith noch Stanton noch mich. Nur Thora war etwas unglücklich. Wie du weißt, ist sie Schwedin, und die Sagen und Mythen, den ganzen Aberglauben ihrer Heimat hat sie quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und sonderbarerweise wirken einige der nordischen Legenden auf ungeheuerliche Weise denen hier im Südpazifik verwandt. Der Glaube an Berg- und Waldgeister zum Beispiel, oder die Vorstellung von Werwölfen und anderen unangenehmen Wesen. Von Anfang an zeigte Thora eine seltsame Empfänglichkeit für den, wie ich ihn vielleicht nennen sollte, ›Einfluß‹, der von diesem Ort ausging. Die Schwedin behauptete, es ›rieche‹ nach Geistern, nach Zauberei …
Zuerst lachte ich sie aus …
Zwei Wochen vergingen, und dann kam der Sprecher der Eingeborenen zu uns. Er erklärte, in der nächsten Nacht sei Vollmond, und erinnerte uns an unser Versprechen. Am Morgen wollten die Arbeiter in ihr Dorf gehen und erst nach drei Nächten, wenn der Mond wieder abnahm, zu uns zurückkehren. Der Sprecher gab uns allerlei Amulette zu unserem ›Schutz‹ und gab uns die eindringliche Warnung, uns während ihrer Abwesenheit so weit wie möglich vom Nan-Tauach fernzuhalten. Leicht verblüfft und noch mehr amüsiert sah ich ihrem Abzug nach.
Natürlich kam unsere Arbeit ohne die Eingeborenen zum Erliegen. Daher beschlossen wir, die Tage ihrer Abwesenheit mit einer Spritztour über die südlichen Inselchen der Gruppe zu verbringen. Wir markierten verschiedene Punkte für spätere weitergehende Untersuchungen. Am Morgen des dritten Tages zogen wir dann an der östlichen Küste entlang zu unserem Lager auf Uschen-Tau, um alles für die Rückkehr unserer Arbeiter vorzubereiten.
Wir landeten dort kurz vor Einbruch der Dämmerung, waren hundemüde und sehnten uns nur noch nach unseren Feldbetten. Es war kurz nach zehn, als Edith mich weckte.
›Hör doch!‹ sagte sie. ›Leg dein Ohr dicht an den Boden.‹
Ich kam ihrer Aufforderung nach und glaubte, tief, tief unten schwach einen Gesang zu hören, der langsam höher stieg. Er nahm an Intensität zu, wurde schwächer und endete schließlich; setzte wieder ein, wurde kräftiger und dann leiser, bis nichts mehr zu vernehmen war.
›Wahrscheinlich kommt dieses Geräusch nur von Wellen, die irgendwo draußen gegen Klippen anrennen‹, erklärte ich. ›Offensichtlich befinden wir uns über einem Felsenriff, das den Schall weiterleitet …‹
›Aber wie kommt es dann, daß wir dieses Geräusch heute zum erstenmal hören?‹ entgegnete meine Frau voller Zweifel. Wir horchten noch einmal auf dem Boden. Plötzlich ertönte durch den dumpfen Rhythmus tief unten ein neues Geräusch. Es schien durch die Lagune zu schweben, die zwischen uns und Nan-Tauach lag; eine Art Musik, die sich in kleinen, klingenden Wellen bewegte. Ich kann die merkwürdige Wirkung, die diese Töne auf mich ausübten, gar nicht in Worte fassen. Hast du es nicht auch gespürt …«
»Meinst du eben auf dem Deck?« fragte ich. Throckmartin nickte.
»Ich trat in jener Nacht zum Zeltausgang und spähte nach draußen«, fuhr er fort. »Kaum stand ich dort, erschien Stanton vor seinem Zelt, trat heraus und marschierte im Mondlicht herum. Er starrte auf eines der Inselchen und lauschte angespannt. Ich rief ihn an.
›Was für ein sonderbares Geräusch!‹ rief er und lauschte weiter. ›Kristallklar! Als wenn jemand eine Milchglasscheibe bearbeiten würde, und zwar sehr vorsichtig … Wie die Kristallglöckchen am Sistrum von Isis im Dandarah-Tempel‹, murmelte er wie im Traum. Nun starrten wir beide auf das Inselchen. Plötzlich bemerkten wir auf dem Damm eine Gruppe von Lichtern, die sich langsam und rhythmisch bewegte. Stanton lachte.
›Diese Halunken!‹ rief er. »Deshalb wollten sie also fort von uns. Siehst du es, Dave, da wird irgendein Fest gefeiert. Irgendein Ritus, den sie bei Vollmond vollführen. Deshalb waren sie auch so wild darauf, uns von dort fernzuhalten!‹
Seine Erklärung erschien einleuchtend. Ich fühlte mich erleichtert, obwohl mir vorher gar nicht bewußt geworden war, wie nervös mich das sonderbare Geräusch gemacht hatte.
›Komm, wir schleichen uns hin‹, schlug Stanton vor, aber ich wollte nicht.
›Sie sind ein fremdartiger Menschenschlag‹, antwortete ich. ›Wenn wir sie bei einer ihrer religiösen Zeremonien stören, werden sie uns das sicher nicht verzeihen. Laß uns lieber darauf verzichten, zu einer Feier im intimen Kreise zu gehen, zu der man uns nicht eingeladen hat.‹
›Da hast du sicher recht‹, stimmte Stanton zu.
Der merkwürdige Rhythmus schwoll an und ab, an und ab …
›Etwas … etwas Beunruhigendes geht davon aus‹, meinte Edith schließlich besorgt. ›Ich frage mich, wie sie diese Töne erzeugen. Einerseits erschrecken sie mich halb zu Tode, und andererseits erzeugen sie in mir das Gefühl, als ob sich etwas unbeschreiblich Schönes ganz in der Nähe befinde.‹
›Verdammt unheimlich!‹ entfuhr es Stanton.
Bei seinen Worten wurde Thoras Zelt aufgerissen, und die alte Schwedin trat ins Mondlicht. Thora war unleugbar ein nordischer Typ: hoch gewachsen, mit schweren Brüsten und von der Statur der alten Wikinger. In jenem Augenblick waren ihr ihre sechzig Jahre nicht anzusehen. Sie wirkte vielmehr wie die Inkarnation einer Odin-Priesterin.
Mit weit aufgerissenen, funkelnden Augen stand sie da und sah zur Insel hinüber. Ihr Kopf bewegte sich ruckartig in Richtung von Nan-Tauach. Sie beobachtete die tanzenden Lichter und lauschte. Plötzlich riß sie die Arme hoch und vollführte eine seltsame Geste zum Mond. Eine Bewegung von archaischem Ursprung, die sie aus fernster Vergangenheit kennen mußte. Macht und eine unerklärliche Kraft gingen von dieser Bewegung aus. Zweimal wiederholte sie diese Geste … und dann verstummten die fremdartigen, klingelnden Töne! Thora drehte sich zu uns um.
›Geht!‹ sagte sie in einem ungewohnten Befehlston, und ihre Stimme schien von weit her zu ertönen. ›Verlaßt diesen Ort … und beeilt euch dabei! Geht, solange ihr das noch könnt. Es hat gerufen …‹ Sie zeigte auf die kleine Insel. ›Es weiß, daß ihr hier seid. Und Es wartet!‹ Thora begann zu wimmern. ›Es lockt … die … die …‹
Sie fiel Edith vor die Füße, und nun wehten über die Lagune wieder die sonderbaren Töne heran, klangen schneller und jubelnder … fast wie im Triumph.
Die ganze Nacht hindurch wachten wir bei Thora. Die Töne von Nan-Tauach hielten an bis etwa eine Stunde vor Monduntergang. Erst am Morgen erwachte Thora. Offensichtlich war sie wieder ganz die alte. Sie erklärte, schlecht geträumt zu haben, konnte sich aber an den Inhalt der Träume nicht mehr erinnern, nur daß sie vor Gefahren gewarnt worden war. Die Schwedin wirkte den ganzen Tag über bedrückt, und immer wieder wanderte ihr Blick halb fasziniert und halb verwirrt zu der benachbarten Insel hinüber.
Am Nachmittag kehrten die Arbeiter zurück. Und in der folgenden Nacht ertönte kein Geräusch von Nan-Tauach, und kein Licht und auch kein sonstiges Lebenszeichen ließen sich ausmachen.
Du kannst sicher nachvollziehen, Goodwin, wie diese Vorfälle unsere wissenschaftliche Neugier erregten. Natürlich wiesen wir bei der Suche nach einer Erklärung alles weit fort, was auch nur den Ruch des Übernatürlichen an sich hatte.
Die … die Symptome, wie ich sie hier nennen möchte, ließen sich allesamt sehr leicht erklären. Es steht außer Frage, daß Vibrationen, die von bestimmten Musikinstrumenten erzeugt werden, nicht ohne manchmal sogar außergewöhnliche Auswirkung auf das menschliche Nervensystem bleiben. Dies war eine einleuchtende Erklärung für die Reaktionen, die wir beim ersten Hören der ungewohnten Klänge gezeigt hatten. Thoras Nervosität verbunden mit ihrem starken Hang zum Aberglauben hatten sich so sehr gesteigert, daß sie in einen Zustand semisomnambulistischer Hysterie verfallen war. Die moderne Wissenschaft hatte keinerlei Mühe, Thoras Verhalten in der vergangenen Nacht zu erklären.
Wir kamen auch zu dem Schluß, daß die Eingeborenen einen uns verborgen gebliebenen Verbindungsweg zwischen Ponape und Nan-Tauach kennen mußten. Über den gelangten sie an den heiligen Ort, an dem sie ihre Riten abhielten. Wir nahmen uns vor, beim nächsten Auszug unserer Arbeiter nach Nan-Tauach überzusetzen. Dort wollten wir dann tagsüber Nachforschungen anstellen, während nachts Thora und Edith zum Lager zurückkehren sollten. Stanton und ich würden dann auf dem Inselchen bleiben und von einem sicheren Versteck aus das beobachten, was sich dort abspielen mochte.
Der Mond nahm immer weiter ab, war bald nur noch eine schmale Sichel am westlichen Nachthimmel und nahm wieder zu, bis er ein weiteres Mal rund und voll war. Bevor die Eingeborenen uns verließen, baten sie uns buchstäblich auf Knien, mit ihnen zu gehen. Aber ihr Flehen machte uns nur noch versessener darauf, nachzusehen, was sich auf Nan-Tauach tat. Und mittlerweile waren wir fest davon überzeugt, daß sie dort etwas vor uns verborgen halten wollten. Zumindest gab es für Stanton und mich keinen Zweifel mehr an unserem Plan. Anders hingegen Edith. Sie gab sich nachdenklich und widerstrebend.
Als die Arbeiter den Hafen verlassen hatten und außerhalb der Sichtweite waren, holten wir unser Boot heraus und fuhren auf geradem Wege zur Nachbarinsel. Bald schon ragte der gewaltige Damm vor uns auf. Wir passierten die Einfahrt mit ihren gigantischen behauenen Prismen aus Basalt und landeten neben einer halb überschwemmten Mole. Vor uns erhob sich eine Treppe mit riesigen Stufen, die direkt in einen Hof führte, der mit den Fragmenten umgestürzter Säulen übersät war. Im Zentrum des Hofs, hinter den zerborstenen Säulen, stieg eine Terrasse aus Basaltblöcken auf, die, wie ich wußte, eine weitere Umfassungsmauer verbarg.
»Und nun, Walter …« er zögerte. »Damit du besser verstehst, was … und … und … Solltest du dich später entschließen, mit mir dorthin zurückzukehren … oder falls ich dorthin … verschwinde … und du uns folgst … präge dir gut meine Beschreibung jenes Ortes ein: Nan-Tauach besteht genaugenommen aus drei Rechtecken. Das erste ist der Seewall und besteht aus Monolithen; behauene Quader, die oben sechs Meter breit sind. Um zu seiner Einfahrt zu gelangen, mußt du den Kanal befahren, der auf der Karte eingezeichnet ist und zwischen Nan-Tauach und einer Insel namens Tau verläuft. Der Eingang zum Kanal liegt hinter dichten Mangroven verborgen. Bist du erst einmal durch dieses Dickicht gelangt, erwarten dich keine weiteren natürlichen Hindernisse mehr. Wenn du dann den Seewall hinter dir hast, siehst du an der Mole die Stufen, die zum Hof führen.
Dieser Hof ist von einer viereckigen Basaltwand umgeben, die mit äußerster mathematischer Exaktheit dem Verlauf der ersten Mauer folgt. Der Seewall ist bis zu fünfzehn Meter hoch. Früher muß er wohl noch höher gewesen sein, aber teilweise ist es zu Bodensenkungen gekommen. Die erste Einfriedungsmauer ist fünf Meter breit und zwischen sechs und fünfzehn Metern hoch. Auch hier wieder ist das Land stellenweise abgesunken.
Innerhalb des Hofs stößt du dann auf die nächste Umfassungsmauer. Seine Terrasse, aus dem gleichen Basalt gefertigt wie die Mauern, ist etwa sechs Meter hoch. Zutritt verschafft man sich durch eine Vielzahl von Breschen, die die Zeit dort geschlagen hat. Das ist dann der Innenhof, das Herz von Nan-Tauach. Dort befindet sich auch das große Zentralgewölbe, das mit dem Namen des Wesens in Verbindung gebracht wird, das aus den Nebeln der Vergangenheit zu uns gekommen ist. Die Eingeborenen erklären, es sei die Schatzkammer von Chau-le-teur gewesen, einem mächtigen König, der ›lange vor den Vätern‹ geherrscht habe. Da Chau das alte ponapeanische Wort für Sonne wie für König ist, bedeutet der Name des Ortes so viel wie ›Hort des Sonnenkönigs‹. Die übriggebliebene Erinnerung an den Namen einer Dynastie der Rasse, die einst den Pazifikkontinent beherrschte und irgendwann untergegangen ist; so ähnlich wie bei den Herrschern des alten Kreta, die den Namen Minos, und den Königen des alten Ägypten, die den Namen Pharao annahmen.
Und gegenüber vom Hort des Sonnenkönigs ruht der Mondstein, der den Mondsee verbirgt.
Stanton war es, der diesen Stein entdeckt hat. Wir waren dabei, den Innenhof zu untersuchen. Edith und Thora machten sich gerade daran, das Mittagessen zuzubereiten, als ich aus dem Zentralgewölbe kam und meinen Assistenten bemerkte, wie er an einem bestimmten Teil der Terrasse stand und verwundert etwas studierte.
›Was würdest du davon halten?‹ fragte er mich, als ich ihn erreichte. Er zeigte auf die Wand. Ich folgte seinem Finger und sah einen Stein von fünf Metern Höhe und drei Metern Breite. Als erstes fiel mir die außerordentliche Exaktheit auf, mit der sich seine Kanten in die benachbarten Steinblöcke einfügten. Dann bemerkte ich, daß dieser Stein sich auch farblich etwas von den anderen unterschied. Ein besonderer Grauton war darin, und von der Glätte der Oberfläche ging etwas Beunruhigendes … etwas Tödliches aus.
›Sieht mir eher nach Kalzit als nach Basalt aus‹, antwortete ich. Ich berührte den Stein, und zog die Hand im gleichen Augenblick hastig wieder zurück. Bei dem Kontakt hatte jeder Nerv in meinem Arm gekribbelt, als hätte ich einen Stoß eiskalter Elektrizität empfangen. Das war das erste, was mir dafür einfiel: Eiskalte Elektrizität. Und das beschreibt die Empfindung genauer als alles andere. Stanton sah mich jedenfalls verdutzt an.
›Also hast du es auch gespürt‹, sagte er. ›Ich habe mich schon gefragt, ob ich wie Thora an Halluzinationen leide. Dabei wird dir sicher aufgefallen sein, daß die benachbarten Steine von der Sonne schon reichlich aufgewärmt sind.‹
Unsere Neugier war geweckt, und wir betrachteten den merkwürdigen Stein auf das genaueste. Seine Ränder waren wie von einem Diamantschleifer geschnitten. Kaum Haaresbreite war zwischen seinen Rändern und den Blöcken daneben. Sein Sockel war gekrümmt und paßte sich genauso exakt wie die Oberkante und die Seiten auf den mächtigen Blöcken an, auf denen er ruhte. Dann entdeckten wir, daß diese Blöcke ausgehöhlt worden waren und sich so der Unterseite des grauen Steins anpaßten. Eine halbkreisförmige Senke verlief von einer Seite des Steins zur anderen, und es kam einem so vor, als stünde die graue Platte im Zentrum einer flachen Tasse, aus der sie halb herausragte und deren untere Hälfte verborgen war. Diese Aushöhlung erweckte mein Interesse. Ich griff hinein und betastete sie. Obwohl die Oberfläche aller Steine hier rauh und vom Zahn der Zeit angenagt war, Goodwin, fühlte sich die Innenseite der Tasse so glatt an, als sei sie gerade eben erst poliert worden.
›Das ist eine Tür!‹ rief mein Assistent. ›Sie dreht sich in der Tasse. Deshalb ist die Oberfläche auch so glatt!‹
›Vielleicht hast du recht‹, antwortete ich. ›Aber wie zum Henker bekommt man sie nur auf?‹
Wir untersuchten die Steinplatte von oben bis unten, drückten an den Rändern und stießen gegen die Seiten. Und dabei sah ich einmal zufällig nach oben und entdeckte es: Dreißig Zentimeter über dem Sturz des grauen Steins war an jeder Ecke eine leicht konvexe Wölbung angebracht, die man nur aus meinem momentanen Blickwinkel ausmachen konnte.
Wir hatten in unserer Ausrüstung eine kleine Trittleiter, und die hatten wir rasch angebracht. Die kleinen Buckel waren wahrscheinlich nichts weiter als aus dem Stein herausgearbeitete Wölbungen. Ich berührte die, der ich am nächsten war, und zog die Hand sofort wieder zurück. Am Handballen hatte ich den gleichen Elektroschock verspürt wie vorhin. Doch ich legte meine Hand wieder auf den Buckel. Der Stoß kam von einer kleinen, kaum zweieinhalb Zentimeter breiten Stelle. Vorsichtig strich ich über die ganze Auswölbung, und sechs weitere Male erhielt ich einen Elektroschock. Sieben solcher kreisrunder Stellen befanden sich also auf dem Buckel, und von jeder einzelnen ging die gleiche Wirkung aus, wie ich sie eben beschrieben habe. Bei der Auswölbung auf der gegenüberliegenden Seite des Steins erging es mir ganz genauso. Aber weder die Berührung einer einzigen Stelle noch die unterschiedlichsten Kombinationen halfen uns in geringster Weise beim Öffnen der Platte weiter.
›Und dennoch müssen sie der Schlüssel zum Öffnen dieser Tür sein‹, erklärte Stanton im Brustton der Überzeugung.
›Wie kommst du denn darauf?‹ wollte ich von ihm wissen.
›Weiß nicht‹, erklärte er zögernd, ›es ist nur so ein Gefühl.‹ Er lachte, aber es klang humorlos, als er fortfuhr: ›Throck, der Wissenschaftler in mir kämpft gegen den Gefühlsmenschen. Der Wissenschaftler drängt mich, alles nur mögliche zu versuchen, diese Steintür aufzubekommen. Der Gefühlsmensch in mir rät mir ebenso eindringlich, nichts dergleichen zu unternehmen und so rasch wie möglich das Weite zu suchen.‹
Er lachte wieder, und diesmal trat ihm so etwas wie Schamröte ins Gesicht.
›Welcher Seite soll ich nachgeben?‹ fragte er, und ich glaubte, an seinem Tonfall zu erkennen, daß die Gefühlsseite in ihm die Oberhand gewann.
›Wahrscheinlich kriegen wir sie so nie auf … vielleicht sollten wir sie sprengen …‹ sagte ich.
›Daran habe ich auch schon gedacht‹, erklärte Stanton, ›aber es wieder verworfen, weil ich das nie und nimmer wagen würde‹, fügte er düster hinzu. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da befiel mich das gleiche Gefühl wie ihn. So als ob etwas aus dem grauen Stein ströme, das sich einem aufs Herz legte wie eine Hand auf einen vorlauten Mund. Wir wandten uns unglücklich ab und sahen, wie Thora durch eine der Breschen auf die Terrasse kam.
›Miß Edith möchte, daß Sie sofort kommen‹, begann sie und hielt augenblicklich inne. Ihr Blick fuhr an mir vorbei auf die Steinplatte, und ihr Körper wurde wie von einer Lähmung befallen. Steifbeinig ging sie dann ein paar Schritte weiter, und schließlich rannte sie geradewegs darauf zu. Die alte Schwedin warf sich mit Brust, Händen und Gesicht an die Platte, und wir hörten sie schreien, als würde ihr die Seele aus dem Leib gerissen. Dann fiel sie vor dem Stein zu Boden. Als wir sie hochhoben, bemerkte ich auf ihrem Gesicht den gleichen Ausdruck wie damals, als wir zum erstenmal die sonderbare Musik von Nan-Tauach gehört hatten … diese unfaßbare Mischung von offensichtlichen Gegensätzen!«
IVDas erste Verschwinden
»Wir trugen Thora ins Lager zurück, wo Edith auf uns wartete. Sie hörte mit ernster Miene zu, während wir von den Vorfällen und von unserem Fund berichteten. Als wir fertig waren, seufzte Thora und öffnete die Augen.
›Ich würde den Stein gern sehen‹, erklärte Edith. ›Charles, du bleibst besser hier bei Thora.‹ Wir überquerten schweigend den äußeren Hof und standen endlich vor der grauen Platte. Meine Frau berührte den Stein, zog die Hand aber ebenso rasch wieder zurück wie zuvor ich. Dann schob sie die Handfläche resolut vor und ließ sie auf der Platte ruhen. Edith machte ganz den Eindruck, als würde sie lauschen. Dann drehte sie sich um.
›David‹, sagte sie, und die Sehnsucht in ihrer Stimme schmerzte mich, ›David, würdest du sehr enttäuscht sein, wenn wir von hier wieder fortgingen, ohne weitere Nachforschungen an diesem Ding hier angestellt zu haben? Würde dir das viel ausmachen?‹
Ach, Walter, in meinem ganzen Leben wollte ich nichts so sehr wie erfahren, was für ein Geheimnis hinter dieser Steintür lag. Dennoch bemühte ich mich, mein Verlangen zu meistern und antwortete: ›Nein, Edith, nicht ein kleines bißchen, wenn du wirklich wünschst, von hier zu verschwinden.‹
Aber sie las den inneren Konflikt in meinen Augen. Sie wandte sich wieder dem Stein zu. Ich sah, wie ein Schauder über ihren Körper rann. Bedauern und Bereuen erfüllten mich.
›Edith!‹ rief ich kurz entschlossen, ›wir reisen ab!‹
Sie sah mich an. ›Die Wissenschaft ist eine besonders eifersüchtige Dame‹, witzelte sie. ›Doch wer weiß, vielleicht ist sie nur strenger als ich. Wie dem auch sei, du kannst ihr nicht davonlaufen. Nein, Dave, du machst hier weiter, und ich bleibe bei dir!‹
Es gab keine Möglichkeit mehr, sie umzustimmen. Als wir zu den anderen zurückkehrten, legte sie eine Hand auf meinen Arm.
›Dave‹, sagte sie leise, ›falls es heute nacht zu einem … nun, unerklärlichen Vorfall kommen sollte … etwas, das sich als zu große Gefahr erweist … versprichst du mir dann, gleich morgen früh zu unserer Insel zurückzukehren … insofern uns das noch möglich sein sollte … und versprichst du mir auch, dort so lange zu warten, bis die Eingeborenen wieder da sind?‹
Ich versprach ihr alles nur zu bereitwillig. Der Wunsch zu bleiben und Zeuge dessen zu werden, was in der Nacht kommen würde, brannte wie Feuer in mir.
Wir suchten uns etwa hundertfünfzig Meter von der Treppe entfernt ein Versteck.
Der Ort war gut gewählt. Wir konnten dort kaum entdeckt werden, gleichzeitig aber alles gut beobachten. Auch sonst war das Glück uns hold, denn die Nacht war klar, und viele Sterne standen am Himmel. Kurz vor der Dämmerung zogen wir dorthin um und harrten der Dinge, die da kommen sollten. Ich hatte mich im Versteck am weitesten vorgewagt. Edith war an meiner Seite, dann kam Thora, und ein Stück weiter hinten hockte Stanton.
Die Nacht brach herein, und nach einer Weile trat ein Leuchten an den östlichen Himmel. Der Mond ging auf. Rasch wurde das Leuchten heller, und dann spähte der obere Rand des Erdtrabanten aus dem Meer, erhob sich daraus und war endlich als volle, runde Kugel zu sehen. Ich warf einen kurzen Blick auf Edith und Thora. Meine Frau lauschte gespannt. Die Schwedin hingegen saß noch genauso da wie am Anfang, als wir uns in das Versteck begeben hatten: die Ellbogen auf die Knie gestützt und das Gesicht in den Händen vergraben.
Wir wurden im Mondlicht gebadet, und daraus griff eine unbezwingliche Müdigkeit auf mich über. Schlaf schien aus den Strahlen hervorzuquellen, tropfte auf meine Augen und schloß sie; schloß sie unerbittlich. Ediths Hand in meiner wurde schlaff. Stantons Kopf fiel auf die Brust, und er schwankte wie ein Volltrunkener. Ich versuchte aufzustehen und kämpfte mit aller Macht gegen den übermächtigen Wunsch nach Schlaf an, der in mir immer stärker wurde. Während ich noch rang, bewegte Thora den Kopf, so als schien sie etwas zu hören. Ihr Blick war auf den Eingang zum Hof gerichtet. Unendliche Verzweiflung stand auf ihren Zügen … und gleichzeitig so etwas wie freudige Erwartung. Ich versuchte noch einmal aufzustehen, aber eine mächtige Müdigkeitswoge überrollte mich. Während ich in ihr versank, hörte ich matt ein glockenhelles Klingeln. Mit übermenschlicher Anstrengung gelang es mir ein letztes Mal, die Lider zu öffnen.
Thora stand auf der obersten Stufe und war in Licht gebadet.
Der Schlaf übermannte mich endgültig und trieb mich mitten hinein ins Reich der Träume und des Vergessens.
Als ich wieder erwachte, wurde es schon Morgen. Wie eine Lawine kehrte die Erinnerung in mein Bewußtsein zurück. Voller Panik streckte ich eine Hand nach Edith aus. Als ich sie berührte, machte mein Herz vor Freude und Dankbarkeit einen Riesensprung. Sie rührte sich, setzte sich auf und rieb sich die schlaftrunkenen Augen. Stanton lag mit dem Rücken zu uns auf der Seite, und sein Kopf ruhte in den Armen.
Edith sah mich an und lachte. ›Großer Gott! Was für ein Schlaf!‹ Langsam kehrte ihre Erinnerung zurück.
›Was ist denn geschehen?‹ flüsterte sie. ›Wie konnte uns nur ein solcher Schlaf überkommen?‹
Stanton erwachte.
›Was ist denn mit euch los?‹ rief er. ›Ihr seht aus, als sei euch gerade ein Gespenst über den Weg gelaufen!‹
Edith griff plötzlich nach meiner Hand.
›Wo ist Thora?‹ Sie sah sich um. Bevor ich ihr antworten konnte, war sie schon aufgesprungen und rannte rufend umher.
›Thora ist entführt worden‹, war alles, was ich Stanton sagen konnte. Zusammen eilten wir zu meiner Frau, die die großen Stufen erreicht hatte und ängstlich hinauf zu dem Eingang und der dahinter liegenden Terrasse starrte. Ich erzählte den beiden, was ich kurz vor dem Einschlafen gesehen hatte. Wir liefen die Stufen hinauf, rannten über den Hof und erreichten den grauen Stein.
Die Platte war genauso verschlossen wie am Tag zuvor, und nichts ließ die Vermutung zu, daß sie zwischenzeitlich geöffnet worden sei. Wirklich nichts? Während ich noch hinsah, fiel Edith auf die Knie und griff nach etwas, das dort auf dem Boden lag. Ein kleiner Fetzen bunten Seidenstoffes. Ich erkannte ihn als Teil des Schals wieder, den Thora um den Kopf zu tragen pflegte. Edith hielt den Fetzen hoch. An einer Seite war er wie von einer Rasierklinge durchtrennt. Ein paar dünne Fäden hingen herunter bis zum Sockel der Platte … und führten darunter hindurch.
Also handelte es sich bei dem grauen Stein doch um eine Tür! Und sie hatte sich geöffnet und Thora hindurchgelassen.
Während der nächsten Minuten waren wir drei, so fürchte ich, alle nicht recht bei Sinnen. Wir schlugen mit Händen, Steinen und Stöcken gegen die Platte. Endlich besannen wir uns.
In den nächsten Stunden bemühten wir uns auf alle nur erdenkliche Weise, die Steintür zu öffnen. Der Fels widerstand unseren Bohrungen. Wir versuchten es mit Sprengstoff am Sockel. Aber die Explosion hinterließ nicht die geringste Spur auf der grauen Oberfläche, sondern wehte nur die Steine in die Luft, mit denen wir das Pulver bedeckt hatten.
Am Nachmittag hatten wir alle Hoffnung aufgegeben. Die Nacht kam heran, und wir mußten uns etwas einfallen lassen. Ich wollte nach Ponape zurück, um dort Hilfe zu holen. Aber Edith wandte ein, das würde einige Stunden in Anspruch nehmen, und davon abgesehen könnten wir keinen Eingeborenen dazu bewegen, mit uns in einer Vollmondnacht zu dem Inselchen zurückzukehren. Was konnten wir sonst noch tun? Eigentlich blieben uns nur zwei Möglichkeiten: Ins Hauptlager fahren, dort auf die Rückkehr der Arbeiter zu warten und sie dann zu überreden, mit uns nach Nan-Tauach zu gehen. Das würde allerdings bedeuten, Thora mindestens zwei Tage lang ihrem Schicksal zu überlassen. Nein, das konnten wir nicht tun. Es wäre uns zu feige vorgekommen.
Die andere Möglichkeit bestand darin, uns in der Nacht auf dem Hof zu verstecken, um darauf zu warten, daß sich die Platte wie in der vergangenen Nacht öffnen würde. Dann nichts wie hindurch und nach Thora suchen, bevor die Tür sich wieder geschlossen hatte.
Wir debattierten nicht lange. Diese Nacht würden wir auf Nan-Tauach verbringen.
Natürlich hatten wir uns auch über das Schlafphänomen Gedanken gemacht. Wenn unsere Theorie zutreffen sollte, daß die Lichter, das Klingeln und Thoras Verschwinden ihren gemeinsamen Verursacher in den religiösen Riten der Eingeborenen hatten, dann war es nur logisch, daß auch unser merkwürdiger Schlaf von ihnen hervorgerufen worden war; wahrscheinlich durch ein Gas. Du weißt doch auch, Goodwin, wie ausgezeichnet sich die Südsee-Insulaner auf solche Drogen und Mittelchen verstehen. Vielleicht war unser Schlaf aber auch nur einem Zufall zu verdanken. Ausströmungen von Gas oder von Pflanzen, die gerade in der Nähe unseres Verstecks auftraten und mit den anderen Ereignissen in keinerlei direktem Zusammenhang standen. Wir stellten einige provisorische, gleichwohl aber funktionstüchtige Gasmasken her.
Als es dunkel wurde, überprüften wir unsere Waffen. Edith war eine gute Schützin, sowohl mit dem Gewehr als auch mit der Pistole. Wir hatten beschlossen, daß meine Frau in einem Versteck bleiben sollte, während Stanton an der Treppe Posten bezog und ich mich auf der anderen Seite des Hofs verbarg. Ich war etwa sechzig Meter von Edith entfernt und konnte von dort aus immer wieder einen Blick auf sie werfen, ob sie sich in der Senke, in die sie sich gelegt hatte, auch in Sicherheit befand. Stanton und ich konnten gleichfalls bequem den Eingang zum Hof überwachen. Mein Assistent war darüber hinaus in der Lage, auch das Terrain außerhalb des Hofs im Auge zu behalten.
Ein leichtes Glühen verkündete den Mondaufgang. Stanton und ich bezogen unsere Posten. In dieser Nacht kam es mir so vor, als würde der Mond doppelt so rasch zum Himmel aufsteigen. Die leuchtende Scheibe trieb aus dem Meer und beleuchtete schon einen Moment später die Ruinen und die See.
Während der Mond höher kletterte, ertönte ein sonderbares leises Seufzen von der Innenterrasse. Stanton straffte seine Gestalt und starrte mit bereitgehaltenem Gewehr herüber.
›Kannst du was sehen?‹ rief ich ihn an. Er gab mir mit einem Handzeichen zu verstehen, daß ich den Mund halten sollte. Ich drehte mich um, um nach Edith zu sehen. Mich durchlief es eiskalt. Sie lag auf der Seite, und ihr Gesicht, das mit dem Atemschutzgerät sehr grotesk wirkte, war dem Mond zugekehrt. Edith schlief fest und tief.
Als ich wieder zu Stanton hinübersah, fuhr mein Blick über die Stufen, um dort fasziniert festzukleben. Das Mondlicht schien dort dicker zu sein. Mehr noch, es schien zu gerinnen. Und in diesem Nebel rasten kleine Funken und Adern aus glitzerndem weißem Feuer. Mattigkeit überkam mich. Es war nicht die ungeheure Erschöpfung wie in der letzten Nacht, sondern irgend etwas, das mir jeglichen Willen zur Bewegung nahm. Ich versuchte, Stanton etwas zuzurufen, aber ich hatte nicht einmal mehr die Kraft, die Lippen zu bewegen. Ich konnte nicht einmal mehr die Augen bewegen!
Stanton befand sich in meinem Blickfeld. Ich sah, wie er die Stufen hinauflief und auf die Steinplatte zurannte. Der Nebel aus geronnenem Mondlicht schien ihn zu erwarten. Mein Assistent trat, ohne zu zögern, hinein und war damit aus meiner Sicht entschwunden.
Ein Dutzend Herzschläge lang herrschte völlige Stille. Dann setzte ein Regen aus Klingellauten ein, der den Pulsschlag vor Glück zum Rasen brachte und einem gleichzeitig das Herz wie mit Eisfingern umklammerte. Und durch dieses Orchester drang Stantons Stimme. Ein lauter, ein kreischender Schrei, angefüllt mit unglaublicher Ekstase und unfaßbarer Furcht! Dem folgte wieder eine Weile der Stille. Ich kämpfte gegen die unsichtbaren Fesseln an, die mich an jeder noch so kleinen Bewegung hinderten, indes konnte ich sie nicht lösen. Selbst meine Lider schienen von Ketten gehalten zu sein. Und unter ihnen fingen meine ausgetrockneten Augen an zu brennen.
Dann, Goodwin, sah ich zum erstenmal das Ungeheuerliche! Die helle Musik schwoll an, und von meinem Platz aus konnte ich das Tor und die Basaltblöcke ringsherum sehen, wie sie verwittert und geborsten bis zu zwölf Metern hinaufragten. Eine unüberwindliche Mauer. Aus diesem Tor glitt nun ein weitaus intensiveres Licht. Immer mehr davon trieb heran, bis es sich buchstäblich aus dem Tor zu ergießen schien. Und aus diesem Strom trat Stanton.
Stanton, ja, mein Assistent Stanton … aber, bei Gott, was für ein Anblick!«
Sein ganzer Körper zitterte bei der Erinnerung. Ich wartete, wartete ungeduldig auf die Fortsetzung.
V Im Mondsee
»Goodwin«, fuhr Throck nach einigen Minuten fort, »ich kann ihn nur als reines, lebendes Lichtwesen beschreiben. Er strahlte Licht aus, war inwendig von Licht angefüllt, wurde von Licht überströmt. Eine schimmernde Wolke wirbelte um ihn herum und durch ihn hindurch, streckte Tentakel, Spiralen und Korpuskeln nach ihm aus.