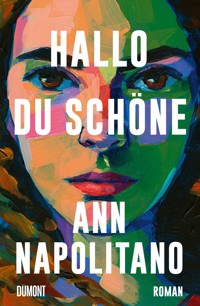11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jetzt als Serie bei Apple TV+
An einem Sommermorgen besteigen der zwölfjährige Edward und seine Familie ein Flugzeug, das sie von New York nach Los Angeles bringen soll. Auf halbem Weg über das Land, stürzt das Flugzeug ab. Edward ist von einhundertsiebenundachtzig Passagieren der einzige Überlebende. Was geschah in den Stunden davor? Wie geht sein Leben nach dem schmerzvollen Verlust weiter?
Die atemberaubende Odyssee eines Jungen, dessen einsames Herz wieder lernen muss zu lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
An einem Sommermorgen besteigen der zwölfjährige Edward und seine Familie ein Flugzeug, das sie von New York nach Los Angeles bringen soll. Auf halbem Weg über das Land stürzt das Flugzeug ab. Edward ist von einhundertzweiundneunzig Passagieren der einzige Überlebende.
Nach der Tragödie erregt Edwards Geschichte die Aufmerksamkeit der Nation. Er selbst hat das Gefühl, einen Teil von sich am Himmel zurückgelassen zu haben, etwas, das für immer an das Flugzeug und alle seine Mitreisenden gebunden sein wird. Wie soll er ohne seine Eltern, ohne seinen geliebten Bruder zurechtkommen? Wo ist sein Platz in einer Welt, in der alles verloren scheint? Was bedeutet es, nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu leben? Vorsichtig wagt er es, sich der jungen Shay anzuvertrauen. Mit ihr macht er eine unerwartete Entdeckung – eine, die zu den Antworten auf seine wichtigsten Fragen führen wird …
»Ein eindringlicher Roman über Trauer und Überleben, ein kraftvolles Buch über ein sinnvolles Leben in den schwierigsten Zeiten.«
New York Times
Ann Napolitano
DER
MORGEN
DAVOR
UND DAS
LEBEN
DANACH
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Carola Fischer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 5/2021
Copyright © 2020 by Ann Napolitano
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel
Dear Edwardbei The Dial Press, New York
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Covergestaltung: t.mutzenbach design, München
Covermotiv: © Shutterstock.com (Borja Andreu; autsawin uttisin;
poomooq; Sergey Uryadnikov; solarseven)
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-24495-8V003
www.diana-verlag.de
Für Dan Wilde, für alles
1
»Da der Tod gewiss ist, der Zeitpunkt des Todes aber ungewiss, bleibt die Frage: Was ist das Wichtigste?«
PEMA CHÖDRÖN
12. Juni 2013
07:45 Uhr
Der kürzlich renovierte Flughafen Newark Liberty International erstrahlt in neuem Glanz. Topfpflanzen an jeder Biegung der Absperrbänder sollen die Passagiere von langen Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle ablenken. Die Menschen lehnen an der Wand oder sitzen auf ihren Koffern. Sie sind alle vor dem Morgengrauen aufgestanden, jetzt schnaufen sie laut und prusten vor Anstrengung.
Als Familie Adler die Sicherheitskontrolle erreicht, legen sie ihre Computer und ihre Schuhe in die dafür vorgesehenen Behälter. Bruce Adler nimmt seinen Gürtel ab, rollt ihn auf und legt ihn ordentlich neben seine braunen Schuhe. Seine Söhne sind nachlässiger, werfen ihre Sneakers auf Laptops und Geldbeutel. Schnürsenkel hängen über den Rand des grauen Behälters. Bruce kann sich nicht zurückhalten und stopft die losen Bänder ins Innere.
Neben ihnen steht ein großes rechteckiges Schild: Brieftaschen, Schlüssel, Handys, Schmuck, elektronische Geräte, Computer, Tablets, Metallgegenstände, Schuhe, Gürtel und Nahrungsmittel müssen in die bereitgestellten Behälter gelegt werden. Flüssigkeiten und verbotene Gegenstände müssen weggeworfen werden.
Bruce und Jane Adler gehen rechts und links neben ihrem zwölfjährigen Sohn Eddie auf den Körperscanner zu. Ihr fünfzehnjähriger Sohn Jordan bleibt zurück, bis seine Familie durch den Check gegangen ist.
Jordan sagt zu dem Sicherheitsbeamtem am Scanner: »Ich geh da nicht durch.«
Der Beamte sieht ihn überrascht an. »Was hast du gesagt?«
Der Junge steckt die Hände in die Hosentaschen und sagt: »Ich möchte von meinem Recht Gebrauch machen und nicht durch den Körperscanner gehen.«
Der Beamte ruft in die Menge: »Wir haben einen männlichen Aussteiger!«
»Jordan«, sagt sein Vater von der anderen Seite des Geräts. »Was machst du da?«
Der Junge zuckt die Achseln. »Das ist ein Ganzkörper-Röntgenscanner, Dad. Das ist das gefährlichste und am wenigsten effiziente Gerät, das es auf dem Markt gibt. Ich habe einiges darüber gelesen, und ich gehe da nicht durch.«
Bruce, der einige Meter entfernt steht und weiß, dass man ihm nicht erlauben wird, zurück zu seinem Sohn zu gehen, erwidert nichts. Er will nicht, dass Jordan noch ein einziges weiteres Wort sagt.
»Geh zur Seite, Junge«, sagt der Beamte. »Du hältst die Leute auf.«
Nachdem der Junge seine Anweisung befolgt hat, fügt der Beamte hinzu: »Ich kann dir nur sagen, dass es wirklich einfacher und sehr viel angenehmer ist, durch diesen Scanner zu gehen, als sich von meinem Kollegen von oben bis unten abtasten zu lassen. Diese Leibesvisitationen sind gründlich, wenn du verstehst, was ich meine.«
Der Junge streicht sich die Haare aus der Stirn. Im letzten Jahr ist er gut fünfzehn Zentimeter gewachsen und spindeldürr. Er hat die gleichen Locken wie seine Mutter und sein Bruder, und sein Haar wächst so schnell, dass er es nicht im Zaum halten kann. Die Haare seines Vaters sind kurz und weiß. Bruce bekam mit siebenundzwanzig weiße Haare, im selben Jahr, als Jordan geboren wurde. Oft zeigt Bruce auf seinen Kopf und sagt zu seinem Sohn: Sieh nur, was du mir angetan hast. Dem Jungen ist bewusst, dass sein Vater ihn in diesem Moment durchdringend anstarrt, als wolle er ihm eine Portion gesunden Menschenverstand zuschicken.
Jordan sagt: »Ich habe vier Gründe, warum ich nicht durch diesen Scanner gehe. Möchten Sie die hören?«
Der Sicherheitsbeamte schaut amüsiert drein. Inzwischen ist er nicht mehr der Einzige, der sich für den Jungen interessiert, alle Passagiere in seiner Nähe lauschen seinen Worten.
»Ach du meine Güte«, flüstert Bruce.
Eddie Adler lässt seine Hand in die seiner Mutter gleiten, zum ersten Mal seit über einem Jahr. Der Anblick seiner Eltern, wie sie für diesen Umzug von New York nach Los Angeles packten – der Große Umbruch hatte sein Vater es genannt –, war ihm auf den Magen geschlagen. Jetzt rumoren seine Eingeweide, und er fragt sich, ob es in der Nähe eine Toilette gibt. Er sagt: »Wir hätten bei ihm bleiben sollen.«
»Er schafft das schon«, sagt Jane, mehr zu sich selbst als zu ihrem Sohn. Der Blick ihres Ehemanns ist fest auf Jordan geheftet, aber sie wagt es nicht hinzusehen. Stattdessen konzentriert sie sich auf das angenehme Gefühl der Hand ihres Sohns in ihrer eigenen. Sie hat diese Berührung vermisst. So vieles wäre leichter, denkt sie, wenn wir uns einfach nur öfter an den Händen halten würden.
Der Beamte holt tief Luft. »Schieß los, Junge.«
Jordan reckt seine Finger in die Höhe, bereit zum Zählen. »Erstens möchte ich mich so wenig Röntgenstrahlen aussetzen wie möglich. Zweitens glaube ich nicht, dass diese Technologie einen Terroranschlag verhindern kann. Drittens finde ich es widerlich, dass die Regierung Bilder von meinen Eiern machen will. Und viertens …«, er atmet tief durch, »glaube ich, dass der Untersuchte sich durch die Haltung, die man in diesem Scanner einnehmen muss – Hände erhoben, als ob man ausgeraubt würde –, machtlos und erniedrigt fühlen soll.«
Der Sicherheitsbeamte lächelt nicht mehr, er schaut sich um. Er ist sich nicht sicher, ob der Junge sich über ihn lustig machen will.
In der Nähe sitzt Crispin Cox in einem Rollstuhl und wartet darauf, dass die Kontrolleure sein Fortbewegungsmittel auf Sprengstoff untersuchen. Der alte Mann regt sich furchtbar darüber auf. Seinen Rollstuhl auf Sprengstoff zu testen! Wenn er noch etwas mehr Puste hätte, würde er sich weigern. Für wen halten sich diese Idioten eigentlich? Für wen halten sie ihn? Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass er in diesem Rollstuhl sitzen und in Begleitung einer Krankenschwester reisen muss. »In drei Teufels Namen, machen Sie endlich diese Leibesvisitation bei dem Jungen«, knurrt er.
Der alte Mann hat schon sein Leben lang Forderungen erhoben, die auch fast immer erfüllt wurden. Der Ton seiner Stimme durchbricht die Unentschlossenheit des Kontrolleurs so schnell, wie die Hand eines Schwarzgürtelträgers ein zentimeterdickes Brett. Er verweist Jordan an einen anderen Beamten, der ihm befiehlt, sich breitbeinig hinzustellen und die Arme auszustrecken. Jordans Familie sieht mit Entsetzen, wie der Beamte dem Jungen grob zwischen die Beine fasst.
»Wie alt bist du?«, fragt der Beamte, als er kurz innehält, um seine Gummihandschuhe zurechtzuziehen.
»Fünfzehn.«
Er verzieht das Gesicht. »Ich hab fast nie Kinder, die das machen lassen wollen.«
»Wen dann?«
»Meistens Hippies.« Er denkt einen Augenblick nach. »Oder Menschen, die früher einmal Hippies waren.«
Jordan muss sich zwingen, still zu stehen. Der Beamte tastet seine Taille entlang der Jeans ab, und es kitzelt. »Vielleicht werde ich ein Hippie, wenn ich erwachsen bin.«
»Ich bin fertig, Fünfzehnjähriger«, sagt der Mann. »Verschwinde.«
Lächelnd geht Jordan zu seiner Familie und nimmt die Turnschuhe entgegen, die ihm sein Bruder hinhält. »Gehen wir«, sagt Jordan. »Sonst verpassen wir noch unseren Flug.«
»Wir reden später noch darüber«, entgegnet Bruce.
Die beiden Jungen laufen voraus. Durch die Fenster des Ganges sieht man in der Ferne die Wolkenkratzer von New York City – von Menschenhand erschaffene Berge aus Stahl und Glas ragen in den blauen Himmel. Jane und Bruce können nicht anders, als mit den Augen den Ort zu suchen, wo die Zwillingstürme standen. So wie die Zunge das Loch findet, wo ein Zahn gezogen wurde. Ihre Söhne, die beide noch kleine Kinder waren, als die Türme einstürzten, akzeptieren die Skyline, wie sie ist.
»Eddie«, sagt Jordan und die beiden Jungen tauschen einen Blick aus.
Die Brüder können mühelos die Gedanken des anderen lesen. Ihre Eltern sind häufig zutiefst erstaunt, wenn sich herausstellt, dass Jordan und Eddie ein ganzes Gespräch geführt haben und zu einer Entscheidung gelangt sind, ohne ein einziges Wort miteinander gewechselt zu haben. Sie waren schon immer eine Einheit und haben immer alles gemeinsam gemacht. Obwohl sich Jordan im Laufe des letzten Jahres zurückgezogen hat. Die Art, wie er jetzt den Namen seines Bruders ausspricht, soll Eddie sagen: Ich bin immer noch da. Ich komme immer wieder zurück.
Eddie boxt seinen Bruder auf den Arm und läuft voraus.
Jane geht langsam hinterher. In der Hand, die ihr jüngerer Sohn losgelassen hat, spürt sie ein Kribbeln.
Am Gate müssen sie wieder warten. Linda Stollen, eine junge Frau, ganz in Weiß gekleidet, betritt eilig eine Apotheke. Ihre Hände sind feucht und ihr Herz pocht so wild, als wolle es aus der Brust springen. Der Flug aus Chicago ist um Mitternacht gelandet, die vergangenen Stunden hat sie versucht, im Sitzen auf einer Bank zu schlafen, die Handtasche fest an die Brust gedrückt. Sie hatte den günstigsten Flug gebucht, den sie finden konnte – daher der Umweg über Newark –, und ihrem Vater mitgeteilt, dass sie ihn nie wieder um Geld bitten würde. Er war in schallendes Gelächter ausgebrochen, hatte sich sogar aufs Knie geschlagen, als ob sie gerade den besten Witz erzählt hätte, den er je gehört hatte. Doch sie hatte es ernst gemeint. Jetzt, in diesem Augenblick, sind ihr zwei Dinge sehr klar: Erstens wird sie nie wieder nach Indiana zurückkehren, und zweitens wird sie ihren Vater und seine dritte Ehefrau nie wieder um irgendetwas bitten.
Es ist das zweite Mal in den vergangenen vierundzwanzig Stunden, dass Linda eine Apotheke aufsucht. Sie greift in ihre Tasche und tastet nach der Verpackung des Schwangerschaftstests, den sie in South Bend gekauft hat. Dieses Mal nimmt sie ein People-Magazin, eine Tüte Schokoladenkonfekt und eine Diätlimonade und geht damit zur Kasse.
Crispin Cox schnarcht in seinem Rollstuhl, sein Körper gleicht einem ausgezehrten Origami aus Haut und Knochen. Hin und wieder flattern seine Finger, wie Vögelchen, die zu fliegen versuchen. Seine Pflegerin, eine Frau mittleren Alters mit buschigen Augenbrauen, sitzt daneben und feilt sich die Fingernägel.
Jane und Bruce sitzen nebeneinander auf den blauen Flughafensitzen und streiten, auch wenn das kein Außenstehender vermuten würde. Ihre Gesichtszüge sind entspannt und ihre Stimmen leise. Ihre Söhne nennen diesen Diskussionsstil ihrer Eltern »DEFCON 4« – verteidigungsbereit, aber friedlich –, und er bereitet ihnen keine Sorgen. Ihre Eltern liefern sich ein Wortgefecht, aber sie kommunizieren mehr als dass sie kämpfen. Sie strecken die Hände nacheinander aus, sie schlagen nicht zu.
Bruce sagt: »Das war gefährlich.«
Jane schüttelt leicht den Kopf. »Jordan ist noch ein Kind. Sie hätten ihm nichts getan. Er war im Recht.«
»Du bist naiv. Er hatte eine große Klappe, und das wird in diesem Land nicht gern gesehen. Völlig egal, was in der Verfassung steht.«
»Du hast ihm beigebracht, seine Meinung zu sagen.«
Bruce presst die Lippen aufeinander. Gern würde er etwas dagegen einwenden, aber das kann er nicht. Er unterrichtet die Jungen zu Hause und hat schon immer großen Wert auf kritisches Denken gelegt. Erst vor Kurzem hat er den Jungen einen wortreichen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es ist, Vorschriften nicht kritiklos hinzunehmen. Ihr müsst alles hinterfragen, hatte er gesagt. Wirklich alles. Wochenlang hatte er sich über die hohlen Aufschneider an der Columbia University aufgeregt, die ihm eine Festanstellung verweigerten, nur weil er nicht zu ihren Cocktailpartys ging. Er hatte den Fakultätsleiter gefragt, was ein feuchtfröhlicher Schlagabtausch mit Mathematik zu tun habe. Er wünscht sich, dass seine Söhne dumme Wichtigtuer hinterfragen, aber noch nicht jetzt. Er hätte seine Ansprache folgendermaßen abändern sollen: Ihr sollt alles hinterfragen. Sobald ihr erwachsen und im Vollbesitz eurer Kräfte seid und nicht mehr zu Hause wohnt, damit ich nicht dabei zusehen und mir Sorgen machen muss.
»Sieh mal die Frau dort drüben«, sagt Jane. »An ihren Rocksaum sind Glöckchen angenäht. Kannst du dir vorstellen, ein Kleidungsstück zu tragen, das bei jeder Bewegung bimmelt?« Sie schüttelt den Kopf, spöttisch, wie sie meint, doch im Grunde bewundert sie die Frau. Sie stellt sich vor, wie es wäre, umgeben vom Klang unzähliger Glöckchen zu gehen. Wie es wäre, mit jedem Schritt Musik zu machen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Vorstellung lässt sie erröten. Sie trägt Jeans und ein Oberteil, das sie ihren »Schreibpulli« nennt. Sie hat heute Morgen etwas angezogen, worin sie sich wohlfühlt. Welche Absicht verfolgt die Frau mit ihrem bimmelnden Rock?
Die Angst und Verlegenheit, die Bruce verspürte, als er neben dem Körperscanner stand, verblassen allmählich. Er massiert sich die Schläfen und spricht leise ein jüdisch-atheistisches Dankesgebet, dass er nicht diese rasenden Kopfschmerzen bekommen hat, bei denen jeder einzelne seiner zweiundzwanzig Schädelknochen wild pocht. Als der Arzt ihn gefragt hatte, ob er wüsste, was seine Migräneattacken auslöse, hatte Bruce nur geschnaubt. Die Antwort lag klar auf der Hand: seine Söhne. Die Vaterschaft besteht für ihn aus einem Schock nach dem anderen. Als die Jungen noch Babys waren, sagte Jane immer, er trage sie herum, als wären sie lebende Granaten. Seiner Meinung nach waren sie das damals auch und sind es heute immer noch. Dem Umzug nach Los Angeles hat er hauptsächlich aus einem Grund zugestimmt – weil die Filmproduktion ihnen ein Haus mit Garten stellt. Bruce hat vor, seine Granaten in diesem eingezäunten Bereich zu platzieren und sollten sie irgendwo anders hinwollen, müsste er sie mit dem Auto fahren. In New York konnten sie einfach in den Fahrstuhl steigen und verschwinden.
Jetzt schaut er sich nach ihnen um. Sie sitzen am anderen Ende des Wartebereichs und lesen. Das ist ihre Art, zaghaft nach Unabhängigkeit zu streben. Sein jüngerer Sohn blickt im selben Moment zu ihm. Wie sein Vater macht auch Eddie sich ständig Sorgen. Sie tauschen einen Blick aus, zwei verschiedene Versionen des gleichen Gesichts. Bruce zwingt sich zu einem breiten Lächeln und versucht, auch seinem Sohn ein Grinsen zu entlocken. Plötzlich verspürt er das Bedürfnis, seinen Sohn glücklich zu sehen.
Die Frau mit dem klingelnden Rock läuft zwischen Vater und Sohn hindurch und trennt deren Verbindung. Ihre Glöckchen bimmeln bei jedem Schritt. Sie ist groß und kräftig gebaut und stammt von den Philippinen. Kleine Perlen schmücken ihre dunklen Haare. Sie singt vor sich hin. Die Worte sind leise, aber sie verteilt sie wie Blütenblätter in der Wartehalle: Ehre, Gnade, Halleluja, Liebe.
Ein schwarzer Soldat in Uniform steht am Fenster, mit dem Rücken zum Saal. Er ist fast zwei Meter groß und breit wie ein Kleiderschrank. Benjamin Stillman nimmt selbst in einem geräumigen Wartebereich viel Raum ein. Er hört der singenden Frau zu; ihre Stimme erinnert ihn an seine Großmutter. Er weiß, dass seine Großmutter ihn, ähnlich einem Körperscanner, durchschauen wird, sobald sie ihn am Flughafen von Los Angeles erblickt. Sie wird sehen, was während des Kampfs mit Gavin geschah; sie wird die Kugel sehen, die zwei Wochen später seine Seite durchschlug und den Kolostomiebeutel, der jetzt das Loch verdeckt. Wenn er ihr gegenübersteht – auch wenn Benjamin gut darin ist, Ausflüchte zu erfinden, und die Wahrheit stets vor seiner Umwelt und sich selbst verheimlicht hat –, wird das Spiel vorbei sein. Doch in diesem Moment beruhigen ihn die Bruchstücke eines Liedes.
Eine Flughafenangestellte geht mit wiegenden Schritten und einem Mikrofon in der Hand zum Eingang der Gangway. Sie bleibt stehen, die Hüften lässig zu einer Seite gedreht. Bei den anderen Mitarbeitern sieht die Uniform entweder wie ein Sack aus oder sie sitzt zu eng, doch ihre passt, als wäre sie für sie maßgeschneidert. Ihre Haare sind zu einem ordentlichen Knoten zusammengebunden, und ihr Lippenstift ist glänzend rot.
Mark Lassio hat seinem Mitarbeiter gerade per SMS Anweisungen geschickt, nun schaut er auf. Er ist zweiunddreißig Jahre alt, und in den letzten drei Jahren sind zwei Porträts über ihn im Forbes-Magazin erschienen. Er hat ein kantiges Kinn, blaue Augen, die die Kunst des durchdringenden Blicks beherrschen, und kurzes, gegeltes Haar. Das matte Grau seines Anzugs wirkt dezent und doch teuer. Mark taxiert die Frau, und sein Gehirn beginnt sich wie ein Schaufelrad zu drehen, um die Whiskey Sours des Vorabends loszuwerden. Er setzt sich in seinem Stuhl auf und schenkt ihr seine volle Aufmerksamkeit.
»Meine Damen und Herren«, spricht sie in das Mikrofon. »Herzlich willkommen zum Flug 2977 nach Los Angeles. Wir beginnen jetzt mit dem Boarding.«
Das Flugzeug ist ein Airbus A321, ein weißer Wal mit einem blauen Streifen auf den Seiten. Einhundertsiebenundachtzig Passagierplätze verteilen sich rechts und links des Mittelgangs. In der First Class befinden sich je zwei geräumige Sitze auf jeder Seite des Gangs; in der Economy Class sind es drei Sitze pro Seite. Alle Plätze auf diesem Flug sind ausgebucht.
Die Passagiere stellen sich hintereinander in der Reihe an. Kleinere Taschen mit Dingen, die zu kostbar oder unentbehrlich sind, um mit dem restlichen Gepäck aufgegeben zu werden, stoßen an ihre Knie. Das Erste, was ihnen beim Betreten des Flugzeugs auffällt, ist die Temperatur. Sie ähnelt der eines Fleischkühlraums und aus den Klimaanlagen dringt ein fortwährendes mahnendes Schhhh! Passagiere mit nackten Armen bekommen Gänsehaut und ziehen sich schnell einen Pullover über.
Crispins Pflegerin wirbelt hektisch um ihn herum, als er vom Rollstuhl auf den Sitz in der First Class wechselt. Er ist jetzt wach, und vor Verärgerung platzt ihm beinahe der Kragen. Das Schlimmste am Kranksein ist die Tatsache, dass es anderen Menschen – vollkommenen Fremden – die Erlaubnis gibt, ihn zu berühren. Die Pflegerin streckt die Arme aus, um ihre Hände um seinen Oberschenkel zu legen und seine Sitzposition zu korrigieren. Seinen Oberschenkel! Früher durchquerten seine Beine Sitzungssäle, liefen über Squashcourts und sausten auf Skiern schwarze Pisten in Jackson Hole hinunter. Jetzt meint eine Frau, die er allenfalls durchschnittlich findet, dass sie diese Oberschenkel mit ihren Händen umschließen kann. Er winkt unwillig ab. »Ich benötige keine Hilfe, um mich auf meinen Platz zu setzen«, sagt er.
Benjamin betritt das Flugzeug mit gesenktem Kopf. Nach New York war er in einer Militärmaschine geflogen, das hier ist sein erster Passagierflug seit über einem Jahr. Dennoch weiß er, was ihn erwartet, und das bereitet ihm Unbehagen. Im Jahr 2002 hätte er automatisch ein Upgrade in die First Class bekommen und alle im Flugzeug hätten applaudiert, sobald sie ihn erblickten. Jetzt fängt ein Passagier an zu klatschen, dann noch einer und schließlich stimmen noch ein paar weitere Mitreisende ein. Das Klatschen erinnert an einen übers Wasser springenden Stein, der hier und da die Oberfläche berührt, bevor er tief auf den Grund des tintenblauen Sees sinkt. Ein scheues Geräusch, in dem ein verlegener Unterton mitschwingt. »Danke für Ihren Dienst am Vaterland«, flüstert eine junge Frau. Der Soldat hebt zaghaft die Hand zum Gruß und setzt sich dann auf seinen Platz in der Economy Class.
Familie Adler trennt sich in der Nähe der Tür. Jane winkt ihren beiden Söhnen und ihrem Mann, die direkt vor ihr gehen, zu und verschwindet dann eilig mit eingezogenen Schultern in der First Class. Einen Moment lang schaut Bruce seiner Ehefrau hinterher, dann dirigiert er den schlaksigen Jordan und Eddie den Gang entlang zum hinteren Teil des Flugzeugs. Im Vorbeigehen blickt er auf die Platznummern und rechnet aus, dass sie neunundzwanzig Reihen von Jane entfernt sein werden, die eigentlich versprochen hatte, sich einen Platz bei ihnen in der Economy Class zu besorgen. Inzwischen hat Bruce begriffen, dass Jane ihre Versprechen nicht hält, sobald es um ihre Arbeit geht. Dennoch entschließt er sich jedes Mal aufs Neue, ihr zu glauben, und bleibt daher enttäuscht zurück.
»Welche Reihe, Dad?«, fragt Eddie.
»Einunddreißig.«
Die Fluggäste packen Snacks und Bücher aus und stecken diese in die Sitztaschen vor sich. Im hinteren Teil des Flugzeugs riecht es nach indischem Essen. Kochbegeisterte wie Bruce erkennen Kreuzkümmel. Jordan und Eddie streiten darüber, wer den Fensterplatz bekommt – ihr Vater besteht auf dem Gangplatz wegen der größeren Beinfreiheit – bis der Ältere erkennt, dass sie anderen Passagieren im Weg sind und plötzlich nachgibt. Er bereut sein erwachsenes Verhalten in dem Moment, als er sich hinsetzt, denn sofort fühlt er sich zwischen seinem Vater und seinem Bruder gefangen. Die Hochstimmung – die Macht –, die er nach der Leibesvisitation bei der Sicherheitskontrolle gespürt hatte, ist verflogen. Ein paar Minuten lang hatte er sich wie ein richtiger Erwachsener gefühlt. Jetzt fühlt er sich wie ein dummes Kind in einem Kinderhochstuhl. Jordan beschließt, zurStrafe mindestens eine Stunde lang nicht mit Eddie zu sprechen.
»Dad«, sagt Eddie. »Werden unsere Sachen schon in dem neuen Haus sein, wenn wir ankommen?«
Bruce überlegt, an was Eddie wohl genau denkt: Seinen Sitzsack, seine Klaviernoten oder den Plüschelefant, den er manchmal noch zum Einschlafen braucht? Seine Söhne haben ihr ganzes Leben lang in der New Yorker Wohnung der Familie verbracht. Das Apartment haben sie jetzt vermietet; wenn Jane Erfolg im Job hat und sie an der Westküste bleiben, werden sie es verkaufen. »Unsere Umzugskartons kommen nächste Woche«, sagt Bruce. »Das Haus ist möbliert, wir können also schon darin wohnen.«
Der Junge, der jünger als zwölf aussieht, nickt dem Bullauge neben sich zu. Er drückt die Fingerspitzen gegen die durchsichtige Scheibe, bis sie kalkweiß sind.
Linda Stollen fröstelt in ihrer weißen Jeans und dem dünnen T-Shirt. Die Frau rechts neben ihr scheint unglaublicherweise bereits eingeschlafen zu sein. Sie hat sich einen blauen Schal über das Gesicht gezogen und den Kopf gegen das Fenster gestützt. Linda wühlt in der Sitztasche vor ihr nach einer Decke, als die Frau mit dem klingelnden Rock in ihre Sitzreihe tritt. Die Frau ist so korpulent, dass ihr Körper über die Armlehne in Lindas Sitzbereich quillt, als sie sich auf den Gangplatz setzt.
»Guten Morgen, Schätzchen«, sagt die Frau. »Ich bin Florida.«
Linda zieht die Ellbogen eng an den Körper, um jeglichen Kontakt mit der Frau zu vermeiden. »Wie der Staat?«
»Nicht wie der Staat. Ich bin der Staat. Ich bin Florida.«
Ach, du lieber Himmel, denkt Linda. Dieser Flug dauert sechs Stunden. Ich werde die ganze Zeit über so tun müssen, als ob ich schlafe.
»Wie heißt du, Liebes?«
Linda zögert. Jetzt hat sie – unerwartet – die Gelegenheit, ihrneues Selbst auszuprobieren. Sie hat vor, sich fremden Menschen in Kalifornien als Belinda vorzustellen. Das ist ein Teil ihres Neuanfangs: eine verbesserte Version ihrer selbst, mit einem verbesserten Namen. Belinda, denkt sie, ist eine faszinierende Frau, die Selbstvertrauen ausstrahlt. Linda ist eine unsichere Hausfrau mit geschwollenen Knöcheln. Zur Vorbereitung bewegt Linda ihre Lippen. Be-lin-da. Doch sie bringt die Silben nicht hervor. Sie hustet und hört sich sagen: »Ich werde heiraten. Ich fliege nach Kalifornien, damit mein Freund mir einen Antrag machen kann. Er wird um meine Hand anhalten.«
»Sieh einer an«, sagt Florida in sanftem Tonfall. »Das ist doch toll.«
»Ja«, erwidert Linda. »Ja, ich denke schon.« In dem Moment wird ihr bewusst, wie müde sie ist und wie wenig sie letzte Nacht geschlafen hat. Das Wort Antrag klingt lächerlich aus ihrem Mund. Sie fragt sich, ob sie es gerade zum ersten Mal benutzt hat.
Florida beugt sich vor, um verschiedene Dinge in ihrer riesigen Stofftasche neu zu ordnen. »Ich war selbst ein paarmal verheiratet«, sagt sie. »Vielleicht auch öfter als ein paarmal.«
Lindas Vater war dreimal verheiratet, ihre Mutter zweimal. Mehrmals zu heiraten findet sie nicht ungewöhnlich, auch wenn sie fest entschlossen ist, selbst nur eine einzige Ehe zu führen. Sie möchte anders sein als alle anderen Mitglieder der Stollen-Familie. Sie möchte besser sein.
»Solltest du Hunger bekommen, Liebes, ich habe mehr als genügend Snacks dabei. Diesen Flugzeugfraß rühre ich nicht an. Das kann man nicht einmal Nahrung nennen.«
Lindas Magen rumort. Wann hat sie zuletzt richtig gegessen? Gestern? Sie blickt zu der Tüte Schokoladenkonfekt, die einsam aus der Sitztasche vor ihr herauslugt. Mit einem Verlangen, das sie selbst überrascht, greift sie nach der Tüte, reißt sie auf und steckt sich ein Stück in den Mund.
»Du hast mir noch nicht deinen Namen genannt«, sagt Florida.
Sie wartet, bis sie zu Ende gekaut hat. »Linda.«
Die Flugbegleiterin – dieselbe Frau, die sie am Gate willkommen geheißen hat – läuft den Mittelgang entlang, überprüft die Gepäckfächer und die Sicherheitsgurte der Passagiere. Sie scheint sich zu einer inneren Musik zu bewegen; sie verlangsamt ihren Schritt, lächelt und wechselt dann das Tempo. Männer wie Frauen beobachten sie, ihr Hüftschwung wirkt unwiderstehlich. Sie ist die Aufmerksamkeit offensichtlich gewohnt. Einem Baby, das auf dem Schoß seiner Mutter sitzt, streckt sie die Zunge heraus, und das Kleine gluckst. Dann bleibt sie neben dem Gangplatz von Benjamin Stillman stehen, geht in die Hocke und flüstert ihm ins Ohr: »Ich habe von Ihrem medizinischen Problem erfahren, weil ich die Kabinenchefin bin. Wenn Sie Hilfe benötigen, geben Sie mir bitte Bescheid.«
Der Soldat ist perplex. Er hatte aus dem Fenster auf den Horizont geblickt. Flugzeuge, Startbahnen, in der Ferne die Silhouette der Stadt, ein Highway, herumsausende Autos. Er schaut ihr in die Augen – und erkennt in dem Moment, dass er seit Tagen, vielleicht sogar Wochen, Blickkontakt mit anderen Menschen vermieden hat. Ihre Augen sind honigfarben, und man kann tief in sie hineinsehen. Benjamin nickt, immer noch erschrocken, und zwingt sich, den Blick abzuwenden. »Vielen Dank.«
In der First Class hat Mark Lassio seine persönlichen Gegenstände penibel in seinem Sitzbereich arrangiert. Sein Laptop, ein Krimi und eine Wasserflasche befinden sich in der Sitztasche auf der Rückseite des Vordersitzes. Das Handy hält er in der Hand, die Schuhe hat er ausgezogen und unter dem Sitz verstaut. Seine Aktentasche, die in dem oberen Gepäckfach liegt, enthält Dokumente aus dem Büro, seine drei besten Kugelschreiber, Koffeintabletten und eine Tüte Mandeln. Er ist auf dem Weg nach Kalifornien, um einen großen Deal abzuschließen, an dem er bereits seit Monaten arbeitet. Er wirft einen Blick über die Schulter, der lässig wirken soll. Allerdings war er noch nie besonders gut darin, lässig oder locker zu wirken. Er ist ein Mann, der am besten in einem Dreitausend-Dollar-Anzug aussieht. Er späht mit der gleichen Intensität im Blick zu dem Vorhang, der die First Class und die Economy Class voneinander trennt, mit der er seine Work-outs, seine romantischen Abendessen oder seine geschäftlichen Präsentationen verrichtet. Sein Spitzname im Büro ist »der Hammer«.
Der Grund, warum die Flugbegleiterin seine Aufmerksamkeit weckt, liegt auf der Hand, aber sie ist viel mehr als nur eine schöne Frau. Sie ist in diesem magischen, strahlenden Alter – er schätzt sie auf siebenundzwanzig –, wenn eine Frau noch mit einem Bein in der Jugend und mit dem anderen im Erwachsenenleben steht. Auf gewisse Weise ist sie beides – ein sechzehnjähriges Mädchen mit weicher Haut und eine erfahrene vierzigjährige Frau – im selben unendlichen, blühenden Moment. Und insbesondere diese Frau ist so lebendig wie ein in Flammen stehendes Haus. Es ist schon lange her, dass Mark einen Menschen gesehen hat, so prall gefüllt mit Zellen und Genen und Leben. Vielleicht ist es das erste Mal überhaupt. Ihr Körper hat die gleichen Bestandteile wie alle anderen auch, aber bei ihr läuft alles auf Hochtouren.
Als die Flugbegleiterin endlich die First Class betritt, würde Mark am liebsten seinen Sicherheitsgurt abschnallen, mit seiner rechten Hand ihre linke packen, seinen Arm um ihre Taille schlingen und Salsa mit ihr tanzen. Er kann gar nicht Salsa tanzen, aber er ist sich sicher, dass er in dem Moment, in dem sie sich berühren, die richtigen Bewegungen vollführen würde. Sie ist die Verkörperung eines Broadway Musicals, wird ihm plötzlich bewusst, wohingegen er seine Energie aus Alkohol und Salzbrezeln bezieht. Er blickt auf seine Hände, plötzlich ist er ernüchtert. Die Vorstellung, die Taille der Flugbegleiterin zu umklammern und mit ihr zu tanzen, ist in seinem Fall nicht vollkommen abwegig. Er hat solche Dinge schon früher getan, sein Therapeut nennt das seine »Schübe«. Immerhin hatte er schon seit Monaten keinen Schub mehr. Er hat ihnen abgeschworen.
Als er wieder aufschaut, steht die Flugbegleiterin vorne im Flugzeug. Sie ist bereit, die Sicherheitsanweisungen zu verkünden. Weil sie sie nicht aus dem Blick verlieren wollen, beugen sich viele Passagiere in den Gang, überrascht, dass sie dem Thema »Sicherheit im Flugzeug« zum ersten Mal seit Jahren Aufmerksamkeit schenken.
»Meine Damen und Herren«, ihre Stimme in der Luft. »Mein Name ist Veronica, und ich bin die Kabinenchefin. Sie finden mich in der First Class und meine Kollegen Ellen und Luis« – sie deutet auf eine blassere Version ihrer selbst (helleres braunes Haar, blassere Haut) und einen kleinen, kahlköpfigen Mann – »werden in der Economy Class für Sie da sein. Im Namen des Kapitäns und der gesamten Crew heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord. Bitte vergewissern Sie sich jetzt, dass Ihre Rückenlehne gerade ist und der Tisch vor Ihnen hochgeklappt. Weiterhin möchte ich Sie daran erinnern, dass alle elektronischen Geräte nun ausgeschaltet werden müssen. Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.«
Gehorsam schaltet Mark sein Handy aus. Normalerweise steckt er es einfach in die Hosentasche. Er fühlt Stolz in seiner Brust schwellen, wie man es tut, wenn man etwas für einen anderen Menschen getan hat.
Neben ihm sitzt Jane Adler und beobachtet amüsiert die verzückten Passagiere. Sie selbst war, denkt sie, ein paar Jahre ihrer Zwanziger wirklich hübsch. In der Zeit hat sie auch Bruce kennengelernt, doch sie besaß niemals auch nur annähernd so viel Sexappeal wie Veronica. Gerade führt die Flugbegleiterin den Passagieren vor, wie man den Sicherheitsgurt anschnallt und der Typ von der Wall Street benimmt sich, als habe er nie zuvor in seinem Leben etwas von einem Sicherheitsgurt gehört, geschweige denn einen benutzt.
»Dieses Flugzeug verfügt über mehrere Notausgänge«, erklärt Veronica. »Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um herauszufinden, welcher Ihrem Platz am nächsten liegt. Sollten wir das Flugzeug evakuieren müssen, werden Ihnen Leuchtstreifen am Boden den Weg zu den Ausgängen zeigen. Die Türen öffnen sich, wenn man den Griff in Richtung Pfeil bewegt. Jede Tür ist mit einer aufblasbaren Notrutsche ausgestattet, die auch abgetrennt und als Rettungsinsel benutzt werden kann.«
Jane weiß, dass ihr Ehemann, irgendwo in den hinteren Reihen, die Lage der Notausgänge bereits überprüft und entschieden hat, in welche Richtung er seine Söhne im Notfall schiebt. Ihr ist auch bewusst, dass er genervt die Augen verdreht, als die Flugbegleiterin die aufblasbaren Notrutschen erwähnt. Bruce begreift die Welt anhand von Zahlen, auf ihrer Grundlage entscheidet er, was wahr ist und was nicht. Und statistisch gesehen hat kein Mensch je mithilfe einer aufblasbaren Notrutsche einen Flugzeugabsturz überlebt. Sie sind schlichtweg ein Märchen, das den Passagieren eine Scheinsicherheit vorgaukelt. Bruce hat keinen Sinn für derlei Märchen, im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen.
Crispin fragt sich, warum er nie eine Frau geheiratet hat, die so attraktiv war wie diese Flugbegleiterin. Keine seiner Ehefrauen hatte einen sexy Hintern. Dünne Mädchen sind etwas für junge Männer, denkt er, es braucht Jahre, bis ein Mann ein weiches Kissen im Bett schätzen lernt. Er fühlt sich nicht zu dieser Frau hingezogen, sie ist so alt wie einige seiner Enkelkinder, und er hat kein Feuer mehr in den Lenden. Die Vorstellung, dass zwei Menschen sich im Bett wälzen, kommt ihm wie ein schlechter Witz vor. Ein Witz, den er lange Zeit selbst gerissen hat, als er noch jünger war. Als er jetzt die Armlehnen umklammert, weil er einen stechenden Schmerz im Bereich der Taille spürt, wird ihm bewusst, dass alle großen Kapitel seines Lebens zwischen verknitterten Bettlaken begannen und dort auch endeten. Alle seine Ehefrauen, zukünftigen Frauen, Exfrauen verhandelten ihre Bedingungen im Schlafzimmer.
Die Kinder bleiben bei mir.
Wir heiraten im Juni im Country Club.
Ich behalte das Ferienhaus.
Bezahl meine Rechnungen oder ich erzähle alles deiner Frau.
Er blickt zu Veronica, die gerade erklärt, wie man eine Rettungsweste mit dem Mund aufbläst. Wenn die Frauen, für die ichmich entschieden habe, etwas mehr auf den Hüften gehabt hätten, denkt er, wären sie vielleicht länger bei mir geblieben.
»Wir möchten Sie daran erinnern«, sagt die Flugbegleiterin und ein Lächeln umspielt ihre Lippen, »dass dies ein Nichtraucherflug ist. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an die Kabinencrew wenden. Im Namen von Trinity Airlines wünsche ich …« – sie verweilt bei dem Wort, das sie wie eine Seifenblase in die Luft schickt – »… Ihnen einen angenehmen Flug.«
Veronica verschwindet aus dem Blickfeld, und ohne die Flugbegleiterin als Fixpunkt nehmen die Passagiere wieder ihre Bücher und Zeitschriften zur Hand. Einige schließen die Augen. Die Belüftungsdüsen zischen lauter. Die Passagiere fühlen sich unwohl, zum Teil, weil das Geräusch von oben kommt, und zum Teil, weil es mit eisigen Luftstößen einhergeht.
Jane Adler zieht sich ihren Pullover fester um den Körper, um die Kälte abzuwehren, und versinkt in Schuldgefühlen, weil sie das Drehbuch nicht vor dem Flug fertiggestellt hat. Sie hasst Fliegen, und jetzt muss sie auch noch getrennt von ihrer Familie sitzen. Das ist die gerechte Strafe, denkt sie. Für meine Faulheit, mein ständiges Aufschieben, dafür, dass ich diesen verrückten Auftrag überhaupt angenommen habe. Lange Zeit hatte sie für eine Fernsehserie in New York geschrieben, auch, weil sie dann nicht unterwegs zu sein brauchte. Doch jetzt ist sie erneut ein Risiko eingegangen, hat einen neuen Job angenommen und reist dafür mit dem Flugzeug.
Ihre Gedanken folgen einem vertrauten Weg. Wenn sie Angst bekommt, lässt sie Momente ihres Lebens vor ihrem geistigen Auge aufsteigen, vielleicht, um sich davon zu überzeugen, dass sie eine eigene Geschichte besitzt. Sie hat bereits Erinnerungen schaffen können, also wird sie auch noch mehr davon haben. Ihre Schwester und sie laufen einen flachen kanadischen Strand entlang; am Küchentisch teilt sie einvernehmlich schweigend die Zeitung mit ihrem Vater; sie pinkelt in einem Park, nachdem sie auf einem College-Empfang zu viel Champagner getrunken hat; sie beobachtet Bruce, der, die Stirn in Falten gelegt und tief in Gedanken versunken, an einer Straßenecke im West Village steht; sie bringt ihren zweiten Sohn ohne Schmerzmittel zur Welt, in einer heißen Badewanne, und wundert sich über die animalischen Laute, die tief aus ihrer Lunge kommen. Sie sieht den Stapel ihrer sieben Lieblingsromane, die sie seit ihrer Kindheit wie einen Schatz hütet, ihre beste Freundin Tilly und das Kleid, das sie zu allen wichtigen Terminen trägt, denn es gibt ihr das Gefühl, schick angezogen und dünn auszusehen. Die Art und Weise, wie ihre Großmutter die Lippen kräuselte und ihr Luftküsschen schickte und sie singend begrüßte: Hallo, hallooo!
Jane arbeitet sich durch die belanglosen und die bedeutungsvollen Erinnerungen, um sich davon abzulenken, wo sie sich gerade befindet und wohin sie fliegt. Intuitiv finden ihre Finger die Stelle unter ihrem Schlüsselbein, wo sie ein Muttermal in Form eines Kometen hat, und sie drückt darauf. Diese Angewohnheit hat sie schon seit ihrer Kindheit. Sie drückt auf das Muttermal, als wolle sie eine Verbindung zu ihrem wahren Ich herstellen. Sie presst den Finger so lange darauf, bis es wehtut.
Crispin Cox blickt aus dem Fenster. Die Ärzte in New York – die besten Ärzte in New York, und sind das nicht automatisch die besten der Welt? – haben ihm versichert, dass es sinnvoll ist, sich einer Behandlung in einer Spezialklinik in Los Angeles zu unterziehen. Dort kennt man sich bestens mit dieser Krebsart aus, hatten ihm die New Yorker Ärzte gesagt. Sie werden an den Medikamententests teilnehmen können. Crispin hatte ein Leuchten in den Augen der Ärzte gesehen, das er kannte. Sie wollten nicht, dass er starb, dass er erledigt war, denn das würde bedeuten, dass auch sie eines Tages erledigt sein würden. Wenn man eine Persönlichkeit ist, kämpft man. Man gibt sich nicht geschlagen. Man brennt wie Feuer. Crispin hatte genickt, denn natürlich würde er diese lächerliche Krankheit besiegen. Das hier würde nicht sein Untergang sein. Doch vor einem Monat hatte er sich mit einem Virus angesteckt, das an seinen Kräften zehrte und ihn mit Sorge erfüllte. Eine neue Stimme in seinem Inneren sagte ihm ein schlimmes Schicksal voraus, und er begann, an seinem bisherigen Vertrauen zu zweifeln. Er überstand die Viruserkrankung, doch die Angst ließ ihn nicht mehr los. Seitdem hatte er kaum noch seine Wohnung verlassen. Als sein behandelnder Arzt ihn anrief, um vor dem Flug nach Kalifornien noch einen Termin für neue Bluttests auszumachen, behauptete Crispin, zu beschäftigt zu sein. In Wahrheit fürchtete er, dass die Bluttests widerspiegeln würden, wie er sich fühlte. Er machte nur ein einziges Zugeständnis an dieses neue Gefühl des Unbehagens: Er engagierte die Pflegerin als Begleitung auf dem Flug nach Kalifornien. Mit dem Gedanken, allein weit oben im Himmel zu sein, konnte er sich nicht anfreunden.
Bruce Adler sieht zu seinen Söhnen; der Ausdruck ihrer Gesichter lässt ihn ratlos zurück. Wie so oft schießt ihm der Gedanke durch den Kopf, dass er zu alt ist und ihm der Zugang fehlt, um ihre Mienen zu entziffern. Vor ein paar Tagen, als sie alle in einem chinesischen Restaurant auf einen Tisch warteten, beobachtete Bruce, wie Jordan auf ein Mädchen seines Alters aufmerksam wurde, das mit seiner Familie hereinkam. Die beiden Teenager blickten sich einen Moment lang an, die Köpfe zur Seite geneigt, dann erhellte sich Jordans Miene und ein breites Grinsen erschien auf seinem Gesicht. Er war bereit, diesem fremden Mädchen alles zu geben, was ihn ausmachte: seine Freude, seine Liebe, seinen Verstand, seine vollkommene Aufmerksamkeit. Er zeigte diesem Mädchen einen Ausdruck, den Bruce, der seinen Sohn jeden Tag seines Lebens genau betrachtet hatte, noch nie gesehen hatte. Den er nicht für möglich gehalten hatte.
Benjamin bewegt sich in dem engen Sitz. Er wünscht sich, er wäre im Cockpit, hinter der sicher verschlossenen Tür. Piloten sprechen auf die gleiche Weise wie Soldaten, mit verabredetem Code und äußerster Präzision. Wenn er ihnen ein paar Minuten lang bei den Vorbereitungen zum Start zuhören dürfte, würde sich das Engegefühl in seiner Brust lösen. Er mag diese Mischung aus Smalltalk und Schnarchen nicht, die ihn umgibt. Er stört sich an dem Verhalten von Zivilpersonen, das er als unkontrolliert empfindet. Die weiße Frau neben ihm riecht nach Eiern, und sie hat ihn bereits zweimal gefragt, ob er im Irak oder »in diesem anderen Land« gewesen sei.
Linda muss eine sonderbare und anstrengende Bauchübung vollführen, als sie versucht, Floridas Körpermassen so gut wie möglich auszuweichen, ohne die schlafende Mitreisende auf der anderen Seite zu wecken. Sie fühlt sich wie der schiefe Turm von Pisa. Sie wünscht sich – die Bauchmuskeln fest angespannt –, dass sie mehr Schokoladenkonfekt gekauft hätte. Sie denkt: In Kalifornien, wenn ich mit Gary zusammen bin, werde ich mehr essen. Der Gedanke muntert sie auf. Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist sie auf Diät, und sie hat noch nie daran gedacht, dieses Joch abzuschütteln – bis zu diesem Moment. Sie hat das Dünnsein stets als etwas Wesentliches betrachtet. Aber was, wenn es nicht so wäre? Sie versucht, sich ihren Körper mit weiblichen, sexy Rundungen vorzustellen.
Florida hat wieder zu singen begonnen, aber die Töne kommen so tief aus ihrer Brust und der Gesang ist so leise, dass es nur mehr ein Summen ist. Wie auf ein Stichwort starten brummend die Flugzeugmotoren. Die Eingangstür wird verschlossen. Das Flugzeug bebt und schlingert, während Florida leise singt. Sie sprudelt vor Melodien, die alle in ihrer Nähe einlullen. Linda faltet ihre Hände im Schoß. Jordan und Eddie drücken, trotz ihrer stummen Fehde, ihre Schultern aneinander, als das Flugzeug Tempo aufnimmt. Die Passagiere mit Büchern oder Zeitschriften in der Hand haben aufgehört zu lesen. Die mit geschlossenen Augen dasitzen schlafen nicht. Alle sind wach und aufmerksam, als das Flugzeug vom Boden abhebt.
12. Juni 2013
Abends
Das »Notfallteam« des National Transport Safety Board trifft sieben Stunden nach dem Absturz an der Unfallstelle ein – genau in der Zeit, die man braucht, um von Washington nach Denver zu fliegen und von dort mit dem Mietwagen bis in die Kleinstadt im Flachland von Northern Colorado zu fahren. An Sommertagen bleibt es lange hell, deshalb ist es noch nicht dunkel, als sie ankommen. Ihre richtige Arbeit beginnt am nächsten Tag bei Sonnenaufgang. Jetzt sind sie hier, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen, irgendwo müssen sie beginnen.
Der Bürgermeister der Stadt ist gekommen, um die Chefermittlerin der Verkehrsbehörde zu begrüßen. Sie stellen sich für ein Foto auf, allerdings ohne Händeschütteln, denn der Bürgermeister – der auch Buchhalter ist, denn die Stadt kann sich keine Vollzeitangestellten leisten – vergräbt seine Hände in den Hosentaschen, damit niemand sieht, dass sie zittern.
Die Polizei hat das Gebiet abgeriegelt; die Mitarbeiter des NTSB-Teams, die orangene Schutzanzüge und Gesichtsmasken tragen, klettern über die Absperrung und laufen um das Flugzeugwrack herum. Ebenes Land in jeder Himmelsrichtung, verbrannte Oberfläche, verkohlt wie ein zu lange getoastetes Brot. Das Feuer ist erloschen, doch die Luft ist glühend heiß. Das Flugzeug hat eine Baumgruppe durchschnitten und sich dann in die Erde gebohrt. Die gute Nachricht ist, so erzählen es sich die Mitarbeiter des NTSB-Teams, dass das Flugzeug nicht in einer Wohngegend abgestürzt ist. Am Boden wurden keine Menschen verletzt. Sie finden zwei zerstückelte Kühe und einen toten Vogel zwischen Sitzen, Gepäck, Metall und Gliedmaßen.
In den vierundzwanzig Stunden, die auf den Absturz folgen, treffen die Familien der Opfer per Flugzeug oder Auto ein. Das Marriott-Hotel im Ort hält mehrere Etagen für die Ankommenden bereit. Am 13. Juni um 17 Uhr fasst der Sprecher des NTSB, ein Mann mit Aknenarben im Gesicht und einer sanften Art, die Lage für die Familien und die Presse im Festsaal des Hotels zusammen.
Die Familienangehörigen sitzen auf Klappstühlen. Sie lehnen sich vor, als ob die Haut auf ihren Schultern hören könnte; sie senken die Köpfe, als ob ihre Haarfollikel die Worte mitbekommen würden, die ihre anderen Körperteile nicht aufnehmen können. Poren öffnen und Finger spreizen sich. Sie lauschen mit grimmigem Gesicht und hoffen, dass unter den bereits verkündeten Tatsachen eine bessere, weniger erdrückende Wahrheit liegt.
In einer Ecke des Saals stehen mehrere kunstvoll arrangierte Blumensträuße, die niemand weiter beachtet. Rote und rosafarbene Pfingstrosen in großen Vasen. Eine Kaskade weißer Lilien. Überbleibsel einer Hochzeitsfeier am Vorabend. Der Duft wird einige Familienmitglieder für den Rest ihres Lebens von Blumengeschäften fernhalten.
Die Presse steht während der Ansprache abseits. Wenn sie Interviews führen, vermeiden sie es, Blickkontakt mit den Angehörigen aufzunehmen. Sie entwickeln ihre eigenen Tics: Ein Mann kratzt sich am Arm, als wäre er mit Giftefeu in Berührung gekommen; eine Radioreporterin frisiert sich immer wieder von Neuem die Haare. Sie verbreiten die neuesten Nachrichten in Live-Fernsehinterviews und verschicken Presseberichte per E-Mail. Die Journalisten konzentrieren sich auf die »bekannten« Passagiere. Ein Kunststoff-Baron, der ein Imperium aufgebaut und durch Automatisierung Tausende Angestellte um ihren Arbeitsplatz gebracht hat. Ein Überflieger von der Wall Street, der geschätzte einhundertvier Millionen Dollar wert ist. Ein Offizier der United States Army, drei Collegeprofessoren, ein Menschenrechtsaktivist und eine Drehbuchautorin, die früher einmal für die Serie Law & Order schrieb. Sie füttern hungrige Mäuler mit Tatsachen. Diese Story hält die Welt in Atem. Überall im Internet ist die Rede davon.
Ein Reporter hält eine Ausgabe der New York Times in die Kamera, um die riesige Schlagzeile zu zeigen. Die Art Überschrift, die normalerweise für Präsidentschaftswahlen und Mondlandungen reserviert ist. Dort steht: 191 Tote bei Flugzeugabsturz – 1 Überlebender.
Die Familienangehörigen haben nur eine Frage, als die Pressekonferenz zu Ende geht. Alle beugen sich zu diesem einen Punkt vor, als wäre dort Licht am Ende des Tunnels: »Wie geht es dem Jungen?«
Die intakten Flugzeugteile werden zu der NTSB-Anlage in Virginia gebracht. Dort werden die Puzzleteile wieder zusammengefügt. Im Moment wird nach der Blackbox gesucht. Die sechzigjährige Frau, die das Team anführt, eine Legende auf diesem Gebiet und bekannt unter dem Namen »Donovan«, ist sich sicher, dass sie den Flugdatenschreiber finden werden.
Für jemanden mit ihrer Erfahrung stellt der Unfallort keine besondere Schwierigkeit dar. Die Trümmer liegen nicht weiter als eine halbe Meile von der Absturzstelle entfernt, es gibt keine Gewässer oder sumpfigen Grund, nur harte Erde und Gras. Hier kann nichts abhandenkommen oder verloren gehen, alles ist in Reichweite. Verkohltes Metall, in der Mitte durchgebrochene Sitze, Glassplitter. Dazwischen einzelne Körperteile, aber keine intakten Leichen. Es ist nicht schwer, an den menschlichen Überresten vorbei auf die Metallstücke zu schauen. Die Konzentration auf die Tatsache zu lenken, dass diese vielen Puzzleteile ein vollständiges Bild ergeben. Donovans Team besteht aus Männern und Frauen, die ihr gesamtes Berufsleben darauf warten, dass eine Tragödie passiert. Sie setzen sich selbst stark unter Druck, Masken verdecken die angespannten Gesichter, während sie eine Bestandsliste erstellen, Beweisstücke sammeln und in Tüten stecken.
Ein paar Tage später sind die Zimmer im Marriott-Hotel leer: Die Familien sind abgereist. Das tägliche Pressebriefing ist beendet. Das NTSB-Team hat die Blackbox gefunden und ist nach Virginia zurückgekehrt. Grundlegende Erkenntnisse werden innerhalb der kommenden drei Wochen mitgeteilt werden, in circa sechs Monaten wird es eine öffentliche Anhörung der Sachverständigen in Washington, D. C. geben.
Die Berichterstattung ist umfangreicher geworden. Es erscheinen mehrere Artikel über die Tante und den Onkel des Jungen, die aus New Jersey nach Colorado geflogen sind, um ihren Neffen zu adoptieren. Lacey Curtis, neununddreißig, ist die jüngere Schwester von Jane Adler und die einzige noch lebende Blutsverwandte des Jungen. Es gibt ein Foto von einer Frau mit hellen Haaren, Sommersprossen und runden Wangen, die zaghaft lächelt. Sie ist Hausfrau, mehr ist nicht über sie bekannt. Ihr Ehemann, John Curtis, einundvierzig, ist ein Computerfachmann, der sich auf IT-Beratung für ortsansässige Unternehmen spezialisiert hat. Das Paar hat keine Kinder.
Die Welt giert nach Informationen rund um das Flugzeugunglück, und in Fernsehen und Internet stellen selbsternannte Experten Spekulationen an. Waren die Piloten betrunken? Sind die Triebwerke ausgefallen oder hat der Bordcomputer versagt? Ist es zu einhundert Prozent erwiesen, dass dieser Absturz kein Terroranschlag war? Ist ein Passagier durchgedreht und hat das Cockpit gestürmt? Oder geriet die Maschine wegen der starken Regenfälle außer Kontrolle? Google-Statistiken zeigen, dass sich eine Woche nach dem Unglück 53 Prozent aller amerikanischen Suchanfragen auf den Absturz beziehen. »Angesichts der vielen Katastrophen in dieser schrecklichen Welt«, nörgelt ein alter Nachrichtensprecher, »stellt sich die Frage: Warum interessieren wir uns so sehr für dieses eine Flugzeugunglück und das Schicksal dieses einen kleinen Jungen?«
Er ist seit einer Woche im Krankenhaus. Eine Frau, die an Krücken geht, betritt den Raum. Sie ist die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Krankenhauses in Denver und hat die Aufgabe, die Familie über alles zu informieren, was nicht strikt in den medizinischen Bereich fällt.
»Susan«, sagt John Curtis zur Begrüßung. Er ist ein großer, bärtiger Mann, blass und schmerbäuchig wie jemand, der die meiste Zeit seines Lebens vor einem Computerbildschirm verbringt.
»Hat er heute gesprochen?«
Lacey – sie ist blass und hat einen Kaffeefleck auf ihrer Bluse – schüttelt den Kopf. »Nein, kein Wort, seit wir es ihm gesagt haben.«
»Haben Sie schon entschieden, ob er Eddie oder Edward genannt werden soll?«, fragt Susan.
John wendet sich an seine Frau, und sie tauschen einen Blick aus. Dieser Blick – erschöpft und traurig – lässt darauf schließen, dass sie seit dem Telefonanruf nicht länger als eine Stunde am Stück geschlafen haben. Das Flugzeug war ausgerechnet mitten in der Woche abgestürzt, als Lacey und John gerade nicht miteinander sprachen, weil sie einen neuen Versuch unternehmen wollte, ein Baby zu bekommen, und er dagegen war. Jetzt scheinen der Streit und das Schweigen vollkommen irrelevant. Sie sind von dem Pferd abgeworfen worden, das ihr Leben war. Ihr Neffe liegt vor ihnen im Bett, seelisch und körperlich schwer verletzt. Er ist von nun an ihre Verantwortung.
»Das richtet sich doch an fremde Menschen, richtig?«, fragt Lacey nach. »Sie kennen weder ihn noch uns. Die Presse sollte seinen Geburtsnamen verwenden: Edward.«
»Auf keinen Fall Eddie.«
»In Ordnung«, sagt Susan.
Edward – denn das ist jetzt sein Name – schläft oder gibt vor zu schlafen. Die drei Erwachsenen sehen ihn an, als nähmen sie ihn zum ersten Mal wahr. Ein Verband ist um seinen Kopf gewickelt, darunter schaut dickes, weiches Haar heraus. Seine Haut ist aschfahl, und er hat dunkle Ringe unter den Augen. Er hat abgenommen und sieht jünger als zwölf Jahre aus. Am Halsausschnitt des lockeren Krankenhausnachthemds ist eine lilafarbene Prellung auf der Brust zu erkennen. Beide Beine sind eingegipst, das rechte hat zusätzlich noch einen Streckverband. Seine Füße stecken in orangefarbenen Socken, die im Geschenklädchen des Krankenhauses gekauft wurden. Auf den Sohlen steht in weißer Schrift: DENVER!!!
Unter Edwards Arm klemmt ein weicher Plüschelefant, dessen Anblick Lacey nur schwer ertragen kann. Die Umzugsfirma, die die Habseligkeiten der Adlers quer durchs Land transportieren sollte, machte einen Tag nach dem Absturz in einem Motel in Omaha Halt. Auf dem Parkplatz luden die Mitarbeiter sämtliche Kartons aus und öffneten einen, auf dem Eddies Zimmer stand. Sie nahmen den Plüschelefanten heraus und schickten ihn mit einer Nachricht an das Krankenhaus in Denver: Wir haben uns gedacht, dass der Junge gern den Elefanten hätte.
Susan sagt: »Da er jetzt stabil ist, haben wir die Absicht, ihn in zwei Tagen per Flugzeug zu verlegen. Für die Reise wurde eine Privatmaschine zur Verfügung gestellt. Sie beide werden also mit ihm reisen können.«
»Die Menschen sind alle so freundlich!«, sagt Lacey, dann errötet sie. Die Röte lässt die vielen Sommersprossen ineinander verschmelzen. Sie hat angefangen, ihre sommersprossigen Hände zu ringen, als ob die wiederholte Bewegung diese unzumutbare Realität irgendwie ändern könnte.
»Ein paar Dinge möchte ich noch besprechen«, sagt Susan. Sie stützt sich auf ihre Krücken. »Sind Sie online gewesen?«
»Nein«, sagt John. »Eher nicht.«
»Also, nur damit Sie Bescheid wissen: Es sind mehrere Facebook-Seiten aufgetaucht, die sich entweder mit dem Flug oder mit Edward befassen. Es gab auch einen Twitteraccount, der hieß @miracleboy, mit Edwards Gesicht als Avatar. Aber der wurde geschlossen.«
John und Lacey blicken sie verständnislos an.
»Der Inhalt ist überwiegend positiv«, sagt Susan. »Beileidsbezeugungen, anteilnehmende Worte, solche Sachen. Sie beide wurden mehrfach in der Presse erwähnt, weil die Menschen neugierig sind, wer Edward aufnimmt. Ich möchte nur nicht, dass Sie überrascht sind, wenn Sie auf eine dieser Seiten stoßen.«
»Überwiegend positiv?«
»Trolle«, sagt John.
»Trolle?« Lacey hat die Augen weit aufgerissen.
»Menschen, die im Netz provokante Kommentare schreiben, um eine emotionale Reaktion zu bekommen«, sagt John. »Ihr Ziel ist es, andere Menschen aus der Fassung zu bringen. Je mehr Menschen sich aufregen, desto erfolgreicher ist ihre Trollmission.«
Lacey zieht die Nase kraus.
»Manche betrachten es als eine Kunstform«, sagt John.
Susan stößt einen kaum hörbaren Seufzer aus. »Für den Fall, dass wir vor Ihrer Abreise keine Gelegenheit mehr haben, in Ruhe miteinander zu sprechen, möchte ich Sie noch einmal an die Anwälte für Personenschaden und Luftrecht erinnern. Sie werden sich wie Geier auf Sie stürzen, tut mir leid. Aber diese Anwälte dürfen Sie erst fünfundvierzig Tage nach dem Flugzeugabsturz kontaktieren. Daher möchte ich Sie bitten, alle Leute zu ignorieren oder zu verklagen, die dies vorher versuchen. Wie Sie wissen, übernimmt die Airline sämtliche Kosten der medizinischen Behandlung. Sie müssen nichts überstürzen. Am Anfang erhalten Sie die Sozialleistungen im Sterbefall, später Geld aus einer Lebensversicherung, falls einer von Edwards Eltern eine besaß. Es wird eine Weile dauern, bis alles geregelt ist, aber lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie dringend gerichtliche Schritte unternehmen müssten.«
»Okay«, erwidert Lacey, die augenscheinlich gar nicht zugehört hat. Der Fernseher in der Ecke des Zimmers ist stumm gestellt, aber im unteren Teil des Bildes läuft ein Textband: WUNDERJUNGEWIRDINKRANKENHAUSNAHEDEMWOHNORTSEINERVERWANDTENVERLEGT.
»Menschen können wirklich grausam sein«, sagt Susan.
Edward bewegt sich im Bett. Er wendet den Kopf, und eine glatte Wange mit gelb-lila Prellungen ist zu sehen.
»Mehrere Verwandte«, spricht sie weiter, »von anderen Passagieren dieses Flugs wollten Edward gern sehen, aber das haben wir nicht erlaubt.«
»Mein Gott«, sagt John. »Warum wollen sie zu ihm?«
Susan zuckt die Achseln. »Vielleicht weil Edward der Letzte war, der ihre Angehörigen lebend gesehen hat.«
John räuspert sich leise.
»Entschuldigung«, sagt Susan und Röte steigt ihr in die Wangen. »Das hätte ich anders ausdrücken sollen.«
Lacey setzt sich auf einen Stuhl neben dem Fenster. Das hereinfallende Sonnenlicht umgibt ihr erschöpftes Gesicht mit einem Glorienschein.
»Da ist noch etwas«, sagt Susan. »Der Präsident wird anrufen.«
»Welcher Präsident?«
»Der Präsident. Der Vereinigten Staaten.«
John lacht, ein kurzes Lachen platzt in die besondere Atmosphäre dieses Raums. Eine spannungsgeladene Atmosphäre. Eine Atmosphäre, die auf die Worte des Jungen wartet. Eine Atmosphäre, die jeden Eintretenden zum Schweigen zwingt und die Menschen trennt: in diejenigen, die einen Verlust erlitten haben, und die anderen.
Lacey legt unwillkürlich ihre Hände auf ihre ungewaschenen Haare, und John sagt: »Er wird am Telefon sein, Lace. Da kann er dich nicht sehen.«
Die Krankenschwestern wecken den Jungen auf, indem sie ihm Blut abnehmen und wichtige Organfunktionen überprüfen, als der Anruf erfolgen soll.
»Ich bin hier bei dir«, sagt Lacey. »Und Onkel John auch.«
Edwards Miene verzieht sich.
Lacey spürt einen Anflug von Panik. Hat er Schmerzen? Dann erkennt sie, was sein Gesichtsausdruck bedeuten soll. Er versucht zu lächeln, um es ihr recht zu machen.
»Nein, nein«, flüstert sie. Dann sagt sie zu allen im Raum: »Sind wir bereit für das Gespräch?«
Als sie sich wieder umdreht, versucht Edward nicht mehr zu lächeln.
Neben seinem Bett wurde ein nagelneues Telefon installiert, Susan steht daneben, um die Lautsprechertaste zu drücken.
»Edward?« Die Stimme klingt tief und füllt den ganzen Raum.
Der Junge liegt flach im Bett, auf die umstehenden Erwachsenen wirkt er klein und gebrochen.
»Ja, Sir?«, sagt Lacey an seiner statt. Edward bleibt stumm.
»Junger Mann …« Der Präsident hält inne. »Ich kann kaum etwas sagen, das dich in diesem Moment trösten könnte. Niemand kann das. Ich kann mir nur vorstellen, was du gerade durchmachst.«
Eddies Augen sind weit aufgerissen und ausdruckslos.
»Ich möchte dir sagen, dass das ganze Land Anteil an deinem Schicksal nimmt. Wir drücken dir in dieser schweren Phase die Daumen. Wir drücken dir die Daumen, mein Junge.«
Lacey stupst Edward gegen den Arm, doch Edward sagt kein Wort.
Die tiefe Stimme wiederholt die Worte, diesmal langsamer, als ob sie überzeugt wäre, dass die Wiederholung einen Unterschied machen würde. »Das ganze Land drückt dir die Daumen.«
Edward schweigt auf dem Flug nach New Jersey. Er schweigt in dem Krankenwagen mit den abgedunkelten Scheiben, die verhindern sollen, dass die Presse Fotos von ihm schießt. In den zwei Wochen, die er in dem Krankenhaus in New Jersey liegt, während seine Lungen heilen und ihm der Gips am Bein abgenommen wird, beantwortet er nur Fragen zu seinem Gesundheitszustand, ansonsten spricht er kein Wort.
»Deine Verletzungen heilen wunderbar«, sagt der Arzt zu Edward.
»Ich höre ständig ein klickendes Geräusch.«
Der Gesichtsausdruck des Arztes verändert sich. In seinem Inneren beginnt eine unsichtbare Suchmaschine zu arbeiten und präsentiert den klinischen Befund. »Wie lange hörst du das schon?«
Der Junge denkt nach. »Seit ich aufgewacht bin.«
Der Neurologe wird herbeigerufen. Er ordnet neue Untersuchungen und eine Magnetresonanztomografie von Edwards Gehirn an. Er hat weiße Augenbrauen und keine Haare auf dem Kopf. Jeden Tag nimmt er Edwards Gesicht in seine Hände und starrt ihm tief in die Augen, als ob dort Informationen verborgen seien, die nur er sehen kann.
Der Neurologe spricht mit Lacey und John auf dem Flur. »Die Wahrheit ist«, beginnt er, »dass von zehn Menschen, die genau das gleiche Trauma erlitten haben wie dieses Kind – herumgestoßen, mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft geschleudert werden und ruckartig aufkommen –, jeder Einzelne verschiedene Symptome hätte.« Er zieht bedeutungsvoll seine weißen Augenbrauen in die Höhe. »Schädel-Hirn-Traumata bleiben für unsere Messgeräte meist unsichtbar, deshalb kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit sagen, was Edward gerade durchmacht oder was noch auf ihn zukommt.« Er sieht Lacey aufmerksam an. »Stellen Sie sich vor, ich würde Sie an den Schultern fassen und mit aller Kraft durchschütteln. Wenn ich Sie wieder loslasse, sind Sie streng genommen vielleicht nicht verletzt – keine gezerrten Muskeln oder Ähnliches –, doch Ihr Körper würde das Trauma spüren. Verstehen Sie? Und so ist es für Edward. Er könnte in den nächsten Monaten, sogar Jahren, unterschiedliche Symptome entwickeln. Er könnte Depressionen bekommen, Angstzustände oder Panikattacken, sein Gleichgewichtssinn könnte beeinträchtigt sein, genauso wie der Gehör- oder Geruchssinn.« Der Arzt wirft einen Blick auf seine Uhr. »Irgendwelche Fragen?«
John und Lacey tauschen einen Blick aus. Alles, auch die Sprache, scheint in tausend Scherben zersplittert zu ihren Füßen zu liegen. Irgendwelche Fragen?
Schließlich sagt John: »Im Moment nicht, danke.« Und auch Lacey schüttelt den Kopf.
Die Krankenschwester weckt den Jungen mitten in der Nacht auf, um seinen Blutdruck und seine Temperatur zu messen. Sie fragt: »Bist du okay?« Der Arzt fragt immer als Erstes: »Wie sind die Schmerzen?« Jeden Morgen, wenn seine Tante zu ihm kommt, streicht sie ihm die Haare aus der Stirn und fragt im Flüsterton: »Wie geht es dir?«
Edward ist nicht in der Lage, irgendeine dieser Fragen zu beantworten. Er kann nicht darüber nachdenken, wie er sich fühlt, es ist viel zu gefährlich für ihn, diese Tür zu öffnen. Er versucht, sich von Gedanken und Gefühlen fernzuhalten, als ob sie Möbelstücke in einem Zimmer wären, um die er herumgehen könnte. Wenn die Krankenschwester den Kindersender im Fernsehen einschaltet, schaut er die Zeichentrickserien. Sein Mund ist immerzu trocken, und mal hört er das klickende Geräusch in den Ohren, mal verschwindet es. Manchmal ist er wach, aber nicht richtig bei Bewusstsein, und die Stunden vergehen, ohne dass er es bemerkt. In einem Moment hat er ein Frühstückstablett vor sich und im nächsten wird es draußen dunkel.
Den täglichen Spaziergang mag er gar nicht. Es ist auch kein richtiger Spaziergang, schließlich sitzt er im Rollstuhl. »Du brauchst etwas Abwechslung«, sagt die Krankenschwester mit den Dreadlocks an jedem Wochentag aufs Neue zu ihm. Die Krankenschwester, die am Wochenende kommt – sie hat lange blonde Haare, die ihr bis zur Hüfte reichen –, sagt gar nichts. Sie hievt ihn in den Rollstuhl und schiebt ihn in den Flur.
Dort warten die Menschen. Der ganze Flur ist von Menschen gesäumt. Kranke Menschen, die wie er im Rollstuhl sitzen oder kraftlos im Türrahmen stehen. Die Krankenschwestern versuchen, sie zurück in ihre Zimmer zu scheuchen. »Bitte versperren Sie nicht den Gang«, ruft ein Krankenpfleger. »Das hier sind Fluchtwege. Machen Sie etwas Platz.«
Ein alter Mann bekreuzigt sich, ebenso eine dunkelhäutige Frau mit einem Infusionsschlauch im Arm. Ein rothaariger Teenager in Jordans Alter nickt ihm zu. Neugier spiegelt sich in seinem Blick, und insgesamt sind so viele Augen auf Edward gerichtet, dass die Szene wie ein Gemälde von Picasso wirkt: Hunderte von Augäpfeln und ein paar versprengte Gliedmaßen und Frisuren. Eine alte Frau streckt den Arm aus, um seine Hand zu berühren, als er an ihr vorbeikommt. »Gott hat dich gesegnet.«
Am schlimmsten sind die, die weinen. Edward versucht, nicht hinzuschauen, doch ihre Schluchzer donnern wie Orgeltöne und nehmen ihm die Luft zum Atmen. Es fühlt sich nicht gut an, dass diese Menschen ihm ihre Gefühle aufdrängen, wenn seine eigene Traurigkeit und Angst so immens sind, dass er sie vor ihnen verbergen muss. Die Tränen dieser fremden Menschen brennen auf seiner rauen Haut. In seinen Ohren tönt wieder das Klicken, und die Menschen halten sich Taschentücher vor den Mund, dann endlich sind sie am Ende des Flurs angelangt, die automatischen Schiebetüren öffnen sich, und sie sind draußen. Er senkt die Augen auf seine kaputten Beine, um nicht in den todbringenden Himmel blicken zu müssen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: