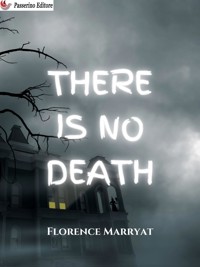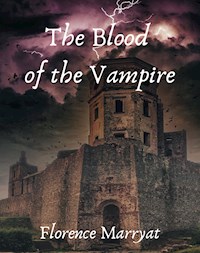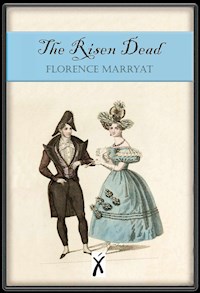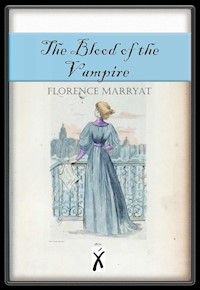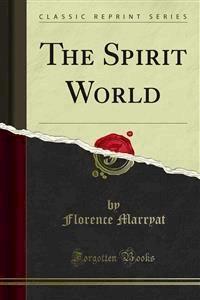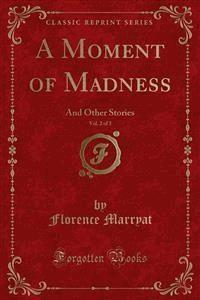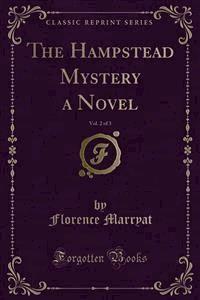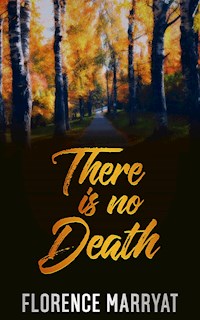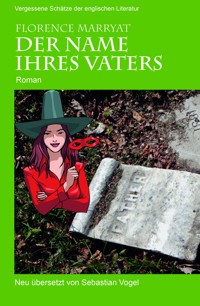
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Louis Lacoste lebt mit seiner Tochter, der in Freiheit aufgewachsenen, selbstbewussten Leona, in einem kleinen Ort nicht weit von Rio de Janeiro. Der Bösewicht Ribeiro deutet an, er wisse über Louisʼ dunkle Vergangenheit Bescheid, und fordert als Preis für sein Schweigen die Hand von Leona. Die ist darüber ebenso empört wie ihr Verehrer Christobal Valera, für den Leona allerdings nicht mehr als geschwisterliche Zuneigung empfindet. Louis Lacoste entzieht sich dem Dilemma durch Selbstmord. Leona verlässt Brasilien und erfährt, dass ihr Vater in Wirklichkeit George Evans hieß und vor vielen Jahren aus England fliehen musste, weil man ihn für einen Mörder hielt. Daraufhin leistet sie einen Schwur: Sein Name soll von dem Verdacht reingewaschen werden. Mit ihrem angeborenen Schauspieltalent scheut Leona sich nicht, sich immer wieder als Mann zu verkleiden und Dinge zu tun, die einer Frau zu ihrer Zeit verboten sind. Christobal bleibt ihr auf den Fersen, aber Leonas Herz schlägt ausschließlich für ihr Gelübde. Schließlich verschafft sie sich in England Zugang zur Familie ihres Vaters und findet nach und nach heraus, welche Verwicklungen damals zu dem falschen Verdacht geführt haben…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Florence Marryat
Der Name ihres Vaters
Florence Marryat
Der Name
ihres Vaters
Roman
Aus dem Englischen neu übersetzt von
Sebastian Vogel
Unter dem Titel Her Father’s Name
erstmals erschienen 1876.
Übersetzung © 2024 Sebastian Vogel
Umschlaggestaltung © Sebastian Vogel
Umschlagbild: pixabay.com
Verlag: Sebastian Vogel
Erikaweg 5
50169 Kerpen
www.uebersetzungen-vogel.de
Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
ISBN 978-3-759842-76-3
Inhalt
Kapitel 1:Leona im Wald
Kapitel 2:„Ich habe Sie in der Hand“
Kapitel 3.Der Brief und der Ring
Kapitel 4:Die Schnauze von Pepita
Kapitel 5:Fähig, allein für mich zu sorgen
Kapitel 6:Leonas geradliniger Schuss
Kapitel 7:Donna Anita
Kapitel 8:Der Captain der Wache
Kapitel 9:Mr. John Rouse
Kapitel 10:Leonas Schwur
Kapitel 11:Das Empfehlungsschreiben
Kapitel 12:Bedenke: drei Monate!
Kapitel 13:Das Haus in Hyde Park Gardens
Kapitel 14:Der spanische Korrespondent
Kapitel 15:Auf der Fährte
Kapitel 16:Die Misses Lillietrip
Kapitel 17:Die Scharaden werden gespielt
Kapitel 18:Lucillas Krankheit
Kapitel 19:Ein außergewöhnlicher Vorschlag
Kapitel 20:Die Einsiedlerin von Willowside
Kapitel 21:Miss Gibson
Kapitel 22:Onkel Bill
Kapitel 23:Eine Stimme aus der Vergangenheit
Kapitel 24:Diamant schneidet Diamant
Kapitel 25:Eine neue Stelle
Kapitel 26:Leona wird entlarvt
Kapitel 27:Leonas Strategie
Kapitel 28:Madame Antoine
Kapitel 29:Lucillas Geheimnis
Kapitel 30:Levitts Geständnis
Kapitel 31:Das Gelübde wird erfüllt
Kapitel 1:Leona im Wald
Weit im Süden, unter einem strahlend blauen Himmel, umgeben von fruchtbaren Tälern und sattgrünen Hügeln, liegt Rio de Janeiro.
Vor der Stadt dehnt sich die Bucht, in Farben und Landschaft schöner als Feder und Tinte sie nachzeichnen können. An ihrem Busen trägt sie die Ilha das Cobras, die Ilha das Euxadas und weiter draußen Long Island und Paquetà, beide im Schatten der blattreichen Mango- und Cashewbäume und blühend von Myrten und der olivengleichen Camarà.
Aber unser Ziel liegt jenseits von alledem.
Eingebettet in die lange Reihe der Mangroven, die hinter Paquetà die Küste säumen, oder auffällig an den grün bewachsenen Hügeln, oder auch friedlich und abgelegen versteckt inmitten der pflanzenbewachsenen Täler, erkennt man kleine Städte und Dörfer mit Häusern und Villen, Befestigungen und Kirchen, die ihr Dasein bezeugen. Unter ihren Bewohnern findet man Männer aller Nationen und Berufe: Kaufleute, Bauern, Spekulanten und vielleicht auch einige Gentlemen, die sich zur Ruhe gesetzt haben – Franzosen, Amerikaner oder Portugiesen, denen es nichts ausgemacht hat, auf ihre alten Tage nicht nur den Ort zu verlassen, an dem sie sich ihr ganzes Leben lang abgerackert haben, sondern sogar das Land, in dem sie mit Gedanken, Gebräuchen und Gefühlen zuhause waren.
In einer dieser kleinen Ortschaften vor den Toren der Hauptstadt Rio de Janeiro, vielleicht der abgelegensten und unauffälligsten von allen, spielen die ersten Szenen unserer Geschichte. Kein Himmel, wie er sich selbst am hellsten und klarsten Sommermorgen über unserer nebelumwölkten, rauchigen britischen Insel dehnt, könnte jemals auch nur die geringste Vorstellung von der strahlenden Durchsichtigkeit des hyazinthenfarbenen Firmaments vermitteln, welches sich über der kleinen Stadt wölbte, von der ich spreche. Weiße, flauschige Wölkchen schienen auf halbem Weg zwischen Erde und Himmel aufgehängt zu sein und schwebten in Abständen über sie hin, um das Auge davor zu bewahren, dass es zu lange an einer solchen unterbrochenen Farbfläche hängen blieb, und die sanftesten Sommerwinde ließen gelegentlich die Blätter der Palmen und gefiederten brasilianischen Zedern erbeben, als wäre das Schweigen zu bedrückend und als würden die Bäume untereinander flüstern.
Es war Mittagszeit. Die Ortschaft – sie bestand aus freistehenden Häusern, gebaut im Stil von Villen, Hütten, Chalets und Häuschen – schien zu schlafen. Die Fenster lagen im Schatten grüner Jalousien, die Tiere hatten sich an ihre jeweiligen Ruheplätze zurückgezogen. Das einzig Lebendige, was sich in dem schönen, sonnendurchfluteten Bild bot, waren ein paar Landarbeiter. Aber für jeden, der nach Einsamkeit suchte, war sie nur fünf Gehminuten von den geschlossenen Haustüren entfernt, und das Leben im Freien liegt jedem Brasilianer nahezu im Blut.
Die gewundene Straße grenzte an Planatagen und war von blühenden Myrtenhecken gesäumt. Sie führte von dem kleinen Ort aufs Land und lockte mit dem sanften Plätschern und silbrigen Glitzern fallenden Wassers über lebendigem Grün bis zu dem dichten Wald, der den Fuß der düsteren Berge bedeckte. Die steilen, kargen Gipfel ragten, nur von nacktem Gestein gekrönt, scharf abgegrenzt in den lachenden Himmel.
Hier, wo die Straße sich in einem schmalen Pfad verlor, der sich zwischen hohen Kiefern, Palmen und Zedern hindurchwand, wurde das betäubende Sonnenlicht erträglicher; man sah es durch das zarte Maßwerk der Schmarotzerpflanzen, die sich von Ast zu Ast schwangen und sich mit ihren Lianen verflochten, sodass sie für den Blick einen Vorhang bildeten. Im weiteren Verlauf wurden die Bäume zum idealen botanischen Garten für die luftigen Pflanzen, die sich in ihre Astgabeln schmiegten, für die hübschen, bandförmigen Farne, die von den Ästen hingen, und für die gefiederten Frauenhaarfarne, die Orchideen und Mimosen, die sich um die Stämme drängten. Hin und wieder zeigte sich eine Unterbrechung des dichten Waldes, ein grasbewachsener Hügel, der vom umgebenden Blattwerk so abgeschirmt war, dass man ihn erst sah, wenn man ihn erreichte – eine Art natürliche Laube, die von dem Hauptweg abzweigte; ihre Wände bestanden aus verwobenem Bambus und seidigen Stapelien, der Teppich aus grünem und braunem Moos, und die Sitze aus Blüten aller Farben.
An einen solchen Ort im innersten Herz des Waldes, außerhalb der kleinen Ortschaft, von der ich berichtet habe, sollst du – in der Fantasie – mich begleiten.
Zu behaupten, das Mädchen, das an dieser Stelle stand, sei schön, wäre zu wenig. Es gibt viele gut aussehende Frauen auf der Welt, und diese hier gehörte einem Volk an, das wegen seiner persönlichen Anziehungskräfte gefeiert wird. Aber sie war nicht nur schön. Sie sah ungewöhnlich aus, zog den Blick sofort auf sich, und nachdem sie ihn auf sich gezogen hatte, fesselte sie ihn. In dem kleinen Ort, in dem sie geboren und aufgewachsen war, räumte man beiläufig ein, sie sei dort die schönste Frau, aber in jedem anderen Land hätte man ihre Schönheit als bemerkenswert bezeichnet. Sie war für ihr Geschlecht mit mindestens fünf Fuß und sieben Zoll sehr groß, und ihre Gliedmaßen waren im Verhältnis zur Körpergröße ideal geformt. Ihre Gesichtszüge waren groß, aber nicht männlich; ihre Haare waren üppig dicht wie bei den meisten Frauen in Brasilien und hingen in gekräuselten Wellen hinunter bis unter die Taille. Als Erstes aber fiel jedem, der mit den Eigenschaften der Menschen ihres Landes vertraut ist, etwas Seltsames auf: Ihre Haare waren nicht schwarz, sondern von einem tiefen Kastanienbraun, und ihre Augen zeigten ein reiches Braun mit gelben Lichtpunkten; es waren Augen wie von polierter Bronze, die außer bei Tizians „Fonarina“ oder einem gefleckten, ruhenden Panther nicht ihresgleichen hatten. Im Übrigen unterschied sich ihr Erscheinungsbild nicht wesentlich von dem anderer Frauen im Süden. Sie hatte ein dunkles, cremefarbenes Gesicht, und unter der ebenso gefärbten Haut spielte ihr warmes Blut nach Belieben. Der Mund war fest und wohlgeformt; die Lippen nicht voll, sondern scharlachrot, und auf der oberen stand der weichste, schwächste, zarteste Flaum, der jemals den Mund einer Frau umspielt hatte – der bloße Schatten eines Schnauzbarts, der nur dazu diente, die Lippe stärker gebogen und spöttischer aussehen zu lassen. Aber sie war noch sehr jung. Die vollen, festen Brüste, die rundlichen Gliedmaßen und der federnde Gang hätten einen Fremden zwar zu der Annahme verleiten können, sie habe bereits die volle Fraulichkeit erlangt, aber ihr Aussehen war dem Klima geschuldet, in dem sie aufgewachsen war und erst ihr siebzehntes Jahr erreicht hatte. Ihre Kleidung war eine seltsame Mischung aus europäischer und spanischer Mode, denn die modernen Brasilianer haben die malerischen Kostüme, die sie sich bis zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts bewahrt haben, fast vollständig aufgegeben, auch wenn einige Teile davon erhalten geblieben sind. Sie trug ein weißes Gewand mit langen, locker hängenden Ärmeln, die ihre prächtigen Arme sehen ließen, sobald sie diese hob. Ein leuchtend gefärbter mexikanischer Schal war um die Taille gewunden; er hielt auf der einen Seite eine geladene Pistole und auf der anderen ein langes Messer fest. Den spanischen Überwurf aus schwarzer Seide hatte sie neben sich auf das Gras geworfen. Sie war nicht ganz allein: In ihrer Nähe lag eine große, graubraun gefärbte Ziege mit langem schwarzem Bart, kaute mit offenkundiger Befriedigung die Kräuter, die in ihrer Reichweite wuchsen, und betrachtete blinzelnd jeden neuen Energieausbruch auf Seiten ihrer Herrin (denn das Mädchen sprach mit ihr), als würde sie alles verstehen und als sei jeder Versuch, sie aufzuhalten, bevor sie fertig war, nutzlos. Der zweite Liebling des Mädchens hüpfte über die Baumstämme und suchte nach Insekten, wie es sein Herz begehrte, wobei er aber nie außer Sichtweite geriet: ein Tukan mit großem Schnabel und schwarz-orange gefärbtem Hals, ein charakteristischer Vogel des Landes, der zwar äußerst scheu und schwer zu fangen ist, sich aber mit Freundlichkeit leicht zähmen lässt und ein ausgezeichnetes, treues Haustier abgibt. Sie selbst stützte sich mit einem Arm auf den Hals eines dunkel gefärbten Maultiers, das einen altmodischen spanischen Sattel und ein schmuckes Geschirr trug; dieses war zwar aus Silber, zeigte aber durch die Auswirkungen von Alter, Nachlässigkeit und schlechter Nutzung eher das Aussehen von Blei.
In ihrer Nähe war kein menschliches Wesen. Niemand außer den drei dummen Tieren leistete ihr Gesellschaft, und doch deklamierte das Mädchen laut und heftig, als würde ihr Publikum den ganzen Wald füllen.
„Sire!“, sagte sie, wobei sie einen Arm ausstreckte, um Aufmerksamkeit zu erregen, „dies ist nicht die Zeit für Diskussionen oder Verzögerungen. Ihre Armee wurde besiegt, Ihre Städte geplündert, Ihre Frauen und Kinder durch das Schwert hingemetzelt! Die Soldaten sind demoralisiert, der Feind triumphiert – allmählich verliert das Land sein Vertrauen in Sie. In dieser Not werfe ich mich in die Bresche – bereit zu sterben, gefoltert zu werden, meinen letzten Blutstropfen für mein Land, mein Volk und meinen König zu vergießen!
Was ich Ihnen anbiete, fragen Sie? Ich biete Ihnen an, Sire, mich in die Bresche zu werfen, die durch Ihre jüngste Niederlage entstanden ist, an der Spitze Ihrer Truppen vorzurücken und diesen gemeinen, feigen Engländern den Geist einer Frau Frankreichs zu zeigen, damit sie endlich die Männer fürchten! Ich werde in die Hitze des Gefechts reiten …“
„Auf einem Maultier von zwölf Handbreit, beladen mit einem alten spanischen Sattel vom Doppelten seines eigenen Gewichts! Ha, ha, ha, ha!“, dröhnte eine Stimme aus dem umgebenden Dickicht.
Das Mädchen fuhr hoch, wurde rot vor Wut und hatte schon die Hand auf die Pistole in ihrem Gürtel gelegt, da teilten sich die Büsche und gaben einen jungen Mann frei. Er war vielleicht drei oder vier Jahre älter als sie, trug ein Gewehr in der Hand und hatte mehrere Vögel in einer Jagdtasche, die an seiner Schulter hing.
„Bravo, Leona“, rief er fröhlich aus, „ein dreifaches Hurra für die Jungfrau von Orléans. Ich höre dir schon seit einer halben Stunde zu. Das ist so gut wie im Theater.“
Der gut aussehende junge Bursche trug einen Panamahut, grobe Stulpenstiefel aus ungebleichtem Leder und ein gestreiftes Baumwollhemd. Er hatte das Mädchen auf Portugiesisch angesprochen. Anfangs antwortete sie nicht.
Ihre Hand hatte den Griff nach der Pistole gelockert, sobald sie den Neuankömmling erkannt hatte, aber das verärgerte Rot war noch nicht aus ihrem Antlitz gewichen, und sie stampfte drohend mit dem Fuß auf den Boden.
„Bist du wütend, dass ich dich belauscht habe?“, erkundigte er sich, nachdem er geistesgegenwärtig ihren Missmut bemerkt hatte.
„Das ist nicht fair von dir, Cristobal“, antwortete sie. „Es ist nicht richtig, dass du dich so hinter Menschen her schleichst und Dinge hörst, die dich nichts angehen!“
„Caramba! Wer hätte das nicht hören können? Deine Stimme ist schon aus einer halben Meile zu mir gedrungen. Und warum macht es dir etwas aus, wenn ich dich höre, Leona?“
„Es macht mir etwas aus! Du sorgst dafür, dass ich mir selbst wie ein Dummkopf vorkomme! Du hast mir für den ganzen Tag den Spaß verdorben.“
„Aber du hast es so wunderschön gemacht. Schon bevor ich etwas gesagt habe, habe ich jedes Wort von dir bewundert! Für mich bist du eine geborene Schauspielerin. Du würdest auf der Bühne dein Glück machen.“
Als er das sagte, wurde der verärgerte Blick des Mädchens weicher. Sie hatte ihre Ziege aufstehen lassen und den Vogel auf das Handgelenk genommen, als hätte sie vor, die Stelle zu verlassen, aber jetzt zögerte sie und setzte den Tukan wieder auf den Sattelknauf.
„Wer würde dich hören, Leona, und glauben, dass du deine Erziehung zum größten Teil durch die Zeitungen erhalten hast? Natürlich weiß ich, dass dein Vater dir vieles beigebracht hat, aber in dieser Einsamkeit, in die anscheinend nie etwas Neues vordringt, ist es großartig: Du weißt, was du tust, und kannst so sprechen. Das ist kein Wissen, Leona, das ist Inspiration! Bist du immer noch wütend auf deinen Tobal, urpilla chay?“
Er trat näher zu ihr und legte seine Hand auf die ihre. Sie wehrte ihn nicht ab und zuckte auch nicht vor ihm zurück. Im Gegenteil: Warm und freimütig umklammerte sie seine Hand und führte sie anmutig an ihre Lippen.
„Wir könnten uns nicht lange böse sein, Tobalito, selbst wenn wir es wollten. Wo wir doch zusammen aufgewachsen sind, seit wir kleine Kinder waren. Aber die Zeitungen, von denen du sprichst. Ich würde sie nicht gegen irgendwelche Bücher tauschen. Bücher sprechen von den Toten, Zeitungen von den Lebenden. Was die Leute vor hundert Jahren getan haben, kümmert mich nicht. Ich will wissen, was sie jetzt – genau am heutigen Tag – tun, in Paris und New York, in London und Madrid. Ach, wie beneide ich dich! Du wirst bald auf Reisen gehen und die Welt sehen. Hätte der Himmel doch aus mir einen Mann gemacht und nicht eine Stubenhockerin, eine nichtsnutzige Frau.“
„Ich selbst beneide mich nicht, Leona“, erwiderte der junge Mann, während er sie schwermütig ansah. „Ich bin zufrieden damit, in die Welt hinauszugehen, aber ich lasse so viel aus meinem Herzen zurück, dass ich nicht glücklich gehen kann. Es wird nicht lange dauern, bis ich mir wünschen werde, wieder hier zu sein.“
„Bah“, gab sie verächtlich zurück. „Was lässt du denn hier zurück im Vergleich zu dem, was du finden wirst? Deine Mutter – es stimmt, sie war eine hervorragende Mutter, aber wozu hat sie dich groß gezogen außer zu dem Zweck, sich von dir zu trennen?
„Da bis noch du, Leona.“
„Ich bin nichts außer einer Freundin, Tobal, und für einen gut aussehenden Burschen wie dich ist die Welt voller solcher Freunde. Denke doch daran, was du sehen wirst. Die riesige Stadt New York mit ihren Tausenden von Bürgern, ihren Märkten, ihren Geschäften, ihren Schiffen – und vor allem mit ihren Theatern, Tobal! Ach, wenn ich doch Flügel hätte und für einen Tag mit dir dorthin fliegen und sehen könnte, wie sie das gewaltige Schauspiel ‚Jeanne d’Arc‘ auf die Bühne gebracht haben. Es muss prachtvoll sein.“
„Du könntest ganz mit mir dorthin kommen, Leona, wenn du dazu bereit wärst“, sagte ihr Begleiter wehmütig. Aber wenn sie verstand, was es bedeutete, entschloss sie sich, es sich nicht anmerken zu lassen.
„Wie gedankenlos du redest! Soll ich vielleicht meinen Vater im Stich lassen?“, erwiderte sie knapp, während sie sich die Mantilla über Kopf und Schultern warf, den Zügel des Maultiers um ihren Arm schlang, nach der Ziege rief und auf den Waldweg einbog. Der junge Mann folgte ihr und ging an ihrer Seite.
„Geht es deinem Vater nicht besser, Leona?“
„Ich glaube nicht. Mir scheint, er wird mit jedem Tag schwächer und ängstlicher. Ach, Tobal, irgendwo im Leben meines Vaters gibt es ein Geheimnis, und das bringt ihn nach und nach um.“
„Ein Geheimnis, Leona?“
„Ja. Dir darf ich das doch sagen, oder nicht? Du würdest doch weder ihn noch mich verraten? Ich bin für dich doch wie eine Schwester?“
Er reckte sich stolz in die Höhe.
„Ich bin von spanischer Abstammung, Leona. Du weißt, dass ich kein portugiesisches Blut in meinen Adern habe, und auch wenn meine Familie durch ein unglückliches Schicksal in diese brasilianische Wildnis verbannt wurde und ich in die Dienste eines New Yorker Kaufmanns treten musste, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, bin ich der direkte Abkömmling eines Edelmannes und habe das Recht, den Titel ‚Don‘ vor meinem Namen zu tragen.“
„Das weiß ich, Tobalito. Und du bis auf dein spanisches Blut ebenso stolz wie ich auf mein europäisches.“
„Und ein Spanier verrät niemals einen Freund, Leona. Selbst wenn ich dich nicht als…als…Schwester betrachten würde, wäre das Geheimnis deines Vaters bei mir gut aufgehoben.“
„Aber es steht nicht in meiner Macht, es dir anzuvertrauen, Tobal. Ich weiß nur, dass er ein Geheimnis hat und dass es in Verbindung mit den Engländern steht. Mein Vater hasst die Engländer und mag es nicht, wenn sie auch nur erwähnt werden. Am liebsten würde er vergessen, dass es überhaupt eine solche Nation gibt.“
„Und doch hat er dir beigebracht, Englisch zu sprechen, und auch er selbst spricht es sehr gut.“
„Nicht besser als er Französisch und Portugiesisch spricht.“
„Doch, besser, denn es ist eine Sprache, die für einen Ausländer weit schwieriger zu erlernen ist. Hätte ich nicht den Unterricht von Madame Lacoste gehabt, für den ich dir gar nicht genug danken kann, ich hätte niemals eine solche Stellung bekommen, wie ich sie jetzt in New York antreten werde.“
„Und für die du uns nächste Woche verlassen wirst. Ist es nicht so?“
„Für die ich dich (zu meinem eigenen Unglück) nächste Woche verlassen muss. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass man deinen Vater überreden könnte, dieses Land zu verlassen und sich ebenfalls in New York niederzulassen!“
„Ach, Christobal, das ist aussichtslos. Ich habe ihn immer und immer wieder angefleht, mich aus dieser Wildnis herauszuholen und in eine stärker bevölkerte Gegend zu bringen – und sei es auch nur Rio –, aber er weigert sich hartnäckig. Er trifft sich nicht einmal mit Fremden, wenn sie hierher kommen, und freundet sich mit niemandem an außer mit den zwei oder drei Familien, die er schon seit Jahren kennt. Manche Leute führen das auf krankhafte Gefühle oder übermäßigen Kummer über den Tod meiner Mutter zurück, aber das glaube ich nicht. Dass er den Verlust eines hübschen, liebenswerten brasilianischen Mädchens beklagt, das für kurze Zeit seine angenehme Gefährtin war, ist nur natürlich, aber es ist nicht natürlich, dass er sich seit siebzehn Jahren von sämtlicher Gesellschaft fernhält. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Vater irgendwann einmal anders war als jetzt.“
„Ich auch nicht, Leona.“
„Schon als ich ein Kind war, hatte er graue Haare, und da konnte er noch keine fünfzig sein. Außerdem war er immer nervös und trübsinnig, und er hatte Anfälle von Niedergeschlagenheit und Melancholie. Tobalito“, fuhr das Mädchen fort, wobei sie sich näher zu ihm beugte und ihre Stimme zu einem Flüstern herabsinken ließ, „manchmal habe ich sogar gedacht, dass mein Vater ein wenig – verrückt ist.“
„Nein, nein, Leona! Das nicht! Sagʼ nicht so etwas!“, rief Christobal eilig.
Während sie sprach, war sie auf dem Waldweg plötzlich stehen geblieben. Schwer atmend, mit geschlossenen Augen, lehnte sie sich an seine Schulter. Er wandte sich um und schloss sie in die Arme. Sein ganzer Körper bebte bei der Berührung, aber ihrer blieb starr wie Marmor. Sie konnte nur an ihren Vater denken.
„Sagʼ das nicht – denke es nicht – mein Liebling“, fuhr er leidenschaftlich fort. „So schlimm kann es nicht sein, Leona. Wenn ich so etwas denken würde, könnte ich dich hier nicht mit ihm allein lassen. Ich würde alles opfern, um dir zur Seite zu stehen und dich zu beschützen.“
Zum Dank hob sie träge den Kopf und küsste ihn auf die Wange. Dann setzten sie den Heimweg fort wie zuvor.
„Ich habe mir in letzter Zeit oft gewünscht, du würdest uns nicht verlassen, Tobal. Ich werde meinen Bruder sehr vermissen. Ich fürchte aber auch noch etwas anderes, aber ich kann dir nicht sagen warum; ich meine die Vertrautheit zwischen meinem Vater und Señor Ribeiro.“
„Aber warum fürchtest du das, Leona? Dass sie miteinander vertraut sind, ist nur natürlich. Ich glaube, Monsieur Lacoste hat in letzter Zeit einige Spekulationen mit Ribeiro unternommen.“
„Und die sind schief gegangen, Tobal.“
„Es tut mir leid, das zu hören, denn er kann es sich nicht leisten, zu verlieren. Ist Ribeiro oft bei euch im Haus?“
„Ständig! Er ist so ungefähr der Einzige, den meinem Vater überhaupt einlässt. Und dann schließen sie sich stundenlang gemeinsam ein.“
„Aller Wahrscheinlichkeit nach erörtern sie, mit welchen Mitteln sie hoffentlich das Geld zurückgewinnen können, das sie verloren haben.“
„Vielleicht; aber ich misstraue Ribeiro, Tobal. Er hat einen bösen Blick.“
„Wagt er es, ihn auf dich zu richten?“, rief Don Christobal hitzig aus.
„Langsam, mein Bruder. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Die Tochter von Louis Lacoste ist nicht für Antonio Ribeiro bestimmt.“
„Für wen ist sie denn bestimmt, Leona?“, flüsterte er zärtlich.
„Derzeit für niemanden, Tobalito, außer für ihren Vater und sie selbst. Und vielleicht – nach und nach, in so weiter Ferne, dass sie es heute noch nicht erkennen kann, für die Welt; aber was in der Zukunft liegt, wissen die Heiligen allein.“
Als das Mädchen geendet hatte, zog sie einen bestickten Tabaksbeutel, ein Briefchen Zigarettenpapier und eine Schachtel Streichhölzer aus den Falten ihrer Schärpe. Lässig rollte sie eine Zigarette, zündete sie an und steckte sie sich zwischen die Lippen, als wäre Rauchen für sie das Normalste auf der Welt – was es auch war.
Christobal seufzte und ging schweigend neben ihr weiter. Er wusste aus Erfahrung, dass er bei ihr einen Punkt berührt hatte, an dem es sinnlos war, sie weiter ausforschen zu wollen. Leona hatte ein warmherziges Temperament, ein überschwängliches Gemüt und einen geschmeidigen Körper wie eine Bergkatze; aber ihr Herz blieb (so weit der äußere Anschein reichte) hart wie Stein.
Zur gleichen Zeit spielte sich innerhalb der Mauern der niedrigen, weißen Behausung, der Monsieur Lacoste als Hausherr vorstand, eine ganz andere Szene ab. Dort, in einem Zimmer, aus dem alles Sonnenlicht sorgfältig ferngehalten wurde, saß – gekleidet in ein lässiges und fast liederliches brasilianisches Gewand, mit einer Zigarre im Mund, auf dem Gesicht den Ausdruck ängstlicher Niedergeschlagenheit und körperlicher Angst, die ihm angeboren zu sein schienen – Louis Lacoste.
Man konnte diesen Mann unmöglich betrachten, ohne zu erkennen, wie gut er einmal ausgesehen hatte. Inmitten seiner dichten Haare und des Bartes, die aus irgendeinem rätselhaften Grund nahezu weiß waren, konnte man hier und da noch einen kastanienbraunen Faden erkennen, der zeigte, von wem seine Tochter die Haarfarbe geerbt hatte. Seine Augen waren braun, der Teint hell, die Hände und Füße klein und schlank – in jeder Hinsicht unterschied er sich gewaltig von dem Begleiter, der ihm gegenüber saß: Señor Antonio Ribeiro. Dieser, ein Portugiese niedrigster Herkunft, war im Aussehen beinahe abstoßend. Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, dass der Brasilianer für den Portugiesen das Gleiche ist wie der Amerikaner für den Engländer, und dass das Volk durch die Vermischung mit indianischen Blut noch energischer und verfeinerter wird. Señor Ribeiro hatte in seiner Verfassung keine solchen Vorteile. Er war rein portugiesischer Abstammung, was man an seiner großen, dicken Nase ebenso erkennen konnte wie am gelblichen Weiß seiner Augen und seinen unbeholfenen Händen und Füßen. Hinzu kam, dass er keinen Tag weniger als 40 zählte und fettleibiger geworden war, als es für die Erhaltung eines anmutigen Erscheinungsbildes wünschenswert gewesen wäre. Wie er sich so in seinem Stuhl zurücklehnte, die finsteren Blicke auf das Betragen von Monsieur Lacoste richtete und dichte Rauchwolken zwischen den dicken Lippen hervorstieß, sah er in der Tat wie ein sehr wenig wünschenswerter Bekannter aus. Das Gespräch war offensichtlich nicht von angenehmer Art gewesen. Louis Lacoste wirkte ängstlicher als gewöhnlich und Señor Ribeiro ungewöhnlich unfreundlich.
„Dass die letzte Spekulation daneben gegangen ist, lag ausschließlich an Ihrer Mutlosigkeit“, sagte er. „Wären sie in Rio an Bord des Dampfers nach New York gegangen, wie ich Sie gebeten hatte, und hätten Sie mit Joghmann selbst gesprochen, wäre alles in Ordnung.“
„Ich habe Ihnen damals gesagt, dass ich nicht Ihretwegen an Bord des Dampfers gehen würde“, erwiderte Monsieur Lacoste. „Ursprünglich war vereinbart, dass Sie mit den Spekulanten in Rio arbeiten und ich mich um die Kaufleute auf dem Land kümmere.“
„Was haben Sie dagegen, sich in Rio sehen zu lassen?“, erkundigte sich Ribeiro misstrauisch.
„Das ist meine Sache“, erwiderte sein Gegenüber; er sah dabei allerdings aus, als sei ihm nicht ganz wohl. „Ich bin gesundheitlich angeschlagen und muss mich auch um andere Geschäfte kümmern. Ohnehin war es nicht Teil meines Vertrages mit Ihnen.“
„Jedenfalls ist das Geld verloren und muss in Rechnung gestellt werden. Sie nehmen doch nicht an, dass ich die Absicht habe, für Ihren Schwindel zu bezahlen“, sagte Ribeiro heiser.
„Wenn Männer übereinkommen, gemeinsam zu spekulieren, müssen sie auch gemeinsam fallen oder steigen. Ich habe durch die Transaktion ebenso Geld verloren wie Sie. Wir müssen uns damit zufrieden geben, das Schlechte mit dem Guten zu nehmen.“
„Ich gebe mich damit aber nicht zufrieden, Lacoste. Ich habe gutes Geld in diese Spekulation gesteckt, und ohne Ihre vermaledeite Achtlosigkeit hätte sie sich ausgezahlt. Ich muss den Verlust des Gewinns verkraften, mit dem ich gerechnet hatte – aber ich lasse mich lieber hängen, als dass ich den Verlust der eingesetzten Summe verkrafte. Dass die verplempert wurde, ist Ihre Schuld, und ich erwarte, dass Sie mir das Geld erstatten.“
„Nun! Das kann ich nicht; das ist in der langen Rede kurzer Sinn.“
„Sie müssen es tun.“
„Ribeiro, es nützt nichts, wenn Sie mich anschnauzen. Ich habe das Geld nicht.“
„Dann müssen Sie es beschaffen.“
„Schulden machen, um etwas zu bezahlen, was ich nicht bezahlen muss? So etwas werde ich nicht tun.“
„Dafür werde ich schon sorgen! Glauben Sie, ich würde mich von einem Hundesohn wie Ihnen beschwindeln lassen?“
Lacoste sprang auf die Füße.
„Wie können Sie es wagen, ein solches Wort auf mich anzuwenden, Ribeiro? Dafür werden Sie mir Satisfaktion leisten.“
„Ihnen Satisfaktion leisten?“, lachte der Portugiese. „Ich werde Ihnen Satisfaktion leisten, indem ich Ihre Lebensgeschichte im ganzen Land herumerzähle, mein Lieber.“
„Was meinen Sie damit?“
Lacoste hatte die Frage in trotzigen Ton gestellt, aber als er auf die Antwort wartete, zitterte er am ganzen Körper.
„Ach – was ich damit meine? Nun, nur das hier: dass Sie sich unter uns unter falschen Vorwänden bewegen; dass Sie ebensowenig Lacoste heißen, wie Sie Ribeiro heißen; dass sie nicht mehr Franzose sind, wie Sie Portugiese sind. Ich habe Sie durchschaut, mein Freund. Ihr wirklicher Name lautet George Evans, und Sie sind Engländer!“
Kapitel 2:„Ich habe Sie in der Hand“
Bei diesen Worten lehnte Monsieur Lacoste sich zurück an die stützende Stuhllehne. Jeder Nerv seines Körpers bebte vor unterdrückten Gefühlen. Ribeiro behielt ihm gegenüber Platz und hielt seine bösen Blicke starr auf sein Opfer gerichtet, während er zwischen seinen groben, frechen Lippen weiterhin dicke Rauchwolken ausstieß.
„Wer hat Ihnen das gesagt?“, brachte Lacoste schließlich mühsam heraus.
„Was spielt es für eine Rolle, wer es mir gesagt hat? Sie wissen, dass es die Wahrheit ist. Ich laufe nicht mit geschlossenen Augen durch New York, Boston und Philadelphia, und auch nicht mit geschlossenen Ohren. Die Firma Evans and Troubridge ist in diesen Städten ebenso gut bekannt wie in Liverpool, und auch der Name Abraham Anson ist nicht ganz in Vergessenheit geraten“, fügte Ribeiro vielsagend hinzu.
Auf Lacostes Stirn standen Schweißperlen, aber er versuchte, die Sache durchzustehen.
„Ich weiß nicht im Mindesten, worauf Sie anspielen“, sagte er mit einem schwachen Lächeln.
Bisher war Ribeiro kühl und anmaßend gewesen, aber jetzt wurde er ausfallend.
„Versuchen Sie nicht, mich anzulügen“, schrie er, „sonst erzähle ich die Geschichte von Rio bis nach New York. Ein für allemal: Ich weiß alles, und wenn ich will, kann ich morgen die Justiz auf Ihre Spur bringen. Wenn Sie also klug sind, beruhigen Sie sich anstatt mich zu ärgern.“
„Aber es stimmt nicht! Es war eine Lüge – eine Verleumdung! Die Verkettung von Umständen, von denen ich unglücklicherweise eingeholt wurde…“
„Hört sich das nach einer Lüge an?“, unterbrach ihn sein gegenüber. „Seit zwanzig Jahren leben Sie unter einem angenommenen Namen und mit falscher Nationalität an diesem Ort. Sie nutzen ihn nicht wie andere als vorübergehenden Rückzugsort oder Landhaus, sondern als festen Wohnsitz, und sie weigern sich, ihn zu verlassen und auch nur in die Orte der Umgebung zu fahren. Sie haben das Leben eines Einsiedlers – oder eines Verbrechers – geführt, sich von jeder Gesellschaft ferngehalten und über Ihren bösen Gedanken gebrütet, bis Ihre Haare vor lauter Angst weiß geworden sind! Aber die Zeit der Heimlichtuerei ist vorüber, mein Freund. Sie sind entlarvt, Mr. George Evans.“
Der höhnische Ton, in dem der englische Name von den Lippen des Fremden kam, erfüllte seinen Gesprächspartner offenbar mit Todesangst. Seine zitternden Hände strichen nervös über die Fülle seiner ergrauten Haare, als wollte er einen Vorwand für sein Aussehen finden.
„Das Klima“, stammelte er. „Die Hitze…Krankheit…“
„Und die Erinnerung an einen Mord“, vollendete Ribeiro den Satz an seiner Stelle.
„Nein! Nein! Ribeiro, bei meiner Seele…bei allem, was mir heilig ist…es war ein Irrtum…eine falsche Anschuldigung…ein…“
„Setzen Sie sich“, sagte der Portugiese grob, „und machen Sie sich nicht zum Narren. Ich bin hier, um über die Angelegenheit als Freund mit Ihnen zu sprechen. Lassen Sie Brandy kommen – oder was Sie wollen, damit Ihr Zitteranfall aufhört und damit Sie zuhören können, was ich zu sagen habe.“
Während er sprach, läutete er mit einer Glocke, die auf dem Tisch stand. Währenddessen sank Louis Lacoste mehr als dass er sich setzte, in den Korbstuhl, an den er sich bisher angelehnt hatte. Auf das Läuten erschien eine dunkelhäutige Bedienstete, die ein scharlachrot und gelb gemustertes Tuch um den Kopf gebunden hatte.
„Bringʼ Brandy…Rum…irgendein geistiges Getränk“, sagte Ribeiro. „Dein Herr fühlt sich nicht wohl.“
Die Dienerin servierte das Gewünschte.
Ribeiro stellte eine starke Mischung aus Brandy und Wasser her und flößte sie Lacoste ein.
„Trinken Sie“, sagte er, „und benehmen Sie sich wie ein Mann, wenn Sie können. Sie haben Glück, dass Sie ausgerechnet mir in die Hände gefallen sind.“
Lacoste leerte das Glas und wandte sich wieder zu seinem Peiniger.
„Was wollen Sie von mir?“, fragte er in weinerlichem Ton.
„Dass Sie die Sache im richtigen Licht betrachten. Ich kenne Ihre Geschichte. Um Sie davon zu überzeugen, muss ich nichts weiter sagen. Schweigen Sie“, fuhr er fort und hob die Hand, um die Worte zu unterbinden, die auf Monsieur Lacostes Lippen standen. „Es nützt nichts. Und wenn die Anschuldigung tausendmal falsch wäre, würde sich an der Tatsache nichts ändern. Und Sie wissen am besten, ob Sie die Angelegenheit an die Öffentlichkeit bringen wollen oder nicht.“
„Wenn Sie das tun, werden Sie mich zu Grunde richten“, murmelte Lacoste.
„Sehr gut! Jetzt sind wir in der ganzen Sache an dem richtigen Punkt. Ich habe Sie in der Hand.“
„Was kann ich tun, um mich freizukaufen? Sie haben Ihren Preis, Ribeiro, wie andere Männer. Wenn Sie Geld wollen…“
„Langsam, mein Freund, langsam! Darauf kommen wir gleich. Zuallererst möchte ich festhalten, dass ich Sie in der Hand habe.“
„Sie haben mich in der Hand“, wiederholte der unglückliche Lacoste mit Verzweiflung im Blick.
„Und nur indem ich meine Stimme erhebe, könnte ich Sie wohin bringen? Na?“, sagte Ribeiro in gedehntem Ton, die für den Zuhörer die reinste Folter war. „Aber angenommen, Sie nehmen es mir aus der Hand! Angenommen, wir bringen unsere Interessen so zusammen, dass ich, wenn ich Sie zu Grunde richte, auch mich selbst zu Grunde richte. Angenommen…“
„Sie meinen Leona!“, unterbrach ihn Monsieur Lacoste.
„Ich meine Leona!“, wiederholte Ribeiro mit einem anderen Leuchten in den bösen Augen. „Und wenn ich sage, dass ich Leona meine, dann sage ich, dass ich Leona haben will…oder…oder…Mr. George Evans! Jetzt wissen Sie alles. Er nahm auf seinem Sessel eine andere Haltung ein und schlug ein Bein über das andere, als wäre die Angelegenheit damit erledigt. Louis Lacoste betrachtete verstohlen die unansehnliche Gestalt: die grobe Haarmähne, den fettigen Teint, die dicken Gliedmaßen und Gesichtszüge. Er erschauderte – nicht um seiner selbst willen. Aber seinem Gegenüber seine Gefühle zu zeigen, konnte er sich nicht erlauben.
„Leona hat Ihnen schon immer gefallen“, bemerkte er fahrig.
„Das ist vollkommen nebensächlich“, erwiderte Ribeiro. „Tatsache ist, dass ich vorhabe, sie zu heiraten. Aus dem gleichen Grund lasse ich mich auch nicht auf Fragen nach Mitteln und Wegen ein. Ich bin nicht arm, das wissen Sie (auch wenn Sie zuletzt durch Ihre Torheit alles dafür getan haben, mich ärmer zu machen). Aber selbst wenn ich der ärmste Teufel von Rio wäre, könnten Sie es sich nicht leisten, Einwände zu erheben.“
„Meine Tochter ist noch sehr jung“, sagte Lacoste.
„Pah! In einem Land, in dem die Mädchen mit vierzehn heiraten! Aber selbst wenn sie zwölf wäre, würde das keine Rolle spielen. Für mich ist sie alt genug.“
„Aber sie braucht ein wenig Vorbereitung. Es wäre besser, wenn sie aus eigenem Antrieb zu Ihnen kommt. Leona ist sehr eigenwillig.“
„Ich werde ihren Willen sehr schnell brechen.“
„Aber sie wurde noch nie in ihrem Leben zu etwas gezwungen. Sie ist mein einziges Kind“, sagte der arme Vater. Die Aussichten, die sich durch Ribeiros Worte eröffneten, ließen ihn zittern.
„Na gut“, kam die mürrische Antwort. „Behalten Sie Ihr einziges Kind. Aber dann suche ich mir meinen Ersatz.“
„Nein, nein, Señor! So habe ich das nicht gemeint. Leona hängt sehr an mir. Sie wird alles tun, was ich ihr nahe lege. Aber wissen Sie, Frauen sind manchmal launisch. Ein plötzlicher Heiratsantrag wird auf das junge Mädchen sicher eine sehr beunruhigende Wirkung haben. Auch wenn ihr natürlich bewusst war, dass er eines Tages kommen würde.“
„Sie werden so freundlich sein, ihr bewusst zu machen, dass der Tag sehr bald kommen wird, nämlich spätestens nächste Woche.“
„Nächste Woche!“, rief Lacoste.
„Nächste Woche“, wiederholte Ribeiro, wobei er sich von seinem Sitz erhob. „Ich muss nächste Woche geschäftlich nach Rio, Mr. … ich meine Monsieur Lacoste“, sagte er mit einer höhnisch-unterwürfigen Verbeugung, „und da will ich meine Ehefrau mitnehmen, um die Versuchung von mir fernzuhalten! Sie verstehen?“
Mit diesem vielsagenden Abschiedsgruß reckte sich der Portugiese, zündete sich eine neue Zigarre an, setzte sich den breitkrempigen Strohhut auf den Kopf und stolzierte hinaus ins Freie. Am Eingang zum Garten begegnete er Leona und Christobal, die ihren Heimweg beendet hatten und zum Abschied einige Worte wechselten. Ribeiro blickte den jungen Spanier mürrisch an, und der erwiderte seinen Blick mit Interesse. Die beiden hatten nichts füreinander übrig. Und Leona war über die Unterbrechung des Gespräches ebenso wenig erfreut wie Christobal Valera.
„Guten Morgen, Mademoiselle“, sagte Ribeiro mit einem anzüglichen Grinsen. „Haben Sie Ihren guten Vater für so viele Stunden meiner Gesellschaft überlassen, um der Messe beizuwohnen?“
„Gewöhnlich nehme ich mein Maultier, meine Ziege und meinen Vogel nicht mit zur Messe, Señor “, erwiderte sie gleichgültig.
„Ah ja, das stimmt! Ich hatte Ihre Lieblinge übersehen. Dann sind Sie vielleicht die Landstraße entlanggeritten?“
„Keineswegs. Die Landstraße hat für mich in der brütenden Sonne keinen Reiz. Ich war im Wald.“
„Und das ohne Schutz! Monsieur Lacoste achtet nicht so sorgfältig auf so viel Schönheit, wie er sollte, Mademoiselle. Durch den Wald laufen häufig Vagabunden. Sie hätten zu Schaden kommen können.“
„Ich bin niemals ohne Schutz, Señor Ribeiro“, erwiderte Leona, während sie eine Hand auf ihre Schärpe legte. „Ich habe meine Pistole und mein Jagdmesser, und wenn die Umstände es erfordern, weiß ich sie auch anzuwenden.“
„Madre de Dios! Ich würde lieber Bekanntschaft mit Ihrem Jagdmesser machen als mit einem Blitz aus Ihren schönen Augen.“
„Sie würden Ihre Entscheidung bereuen, Señor. Obwohl ich auch die anwenden kann, wenn ich mich dazu entschließe“, antwortete sie, wandte sich verärgert von ihm ab und führte ihr Maultier durch den Garten auf den Hof auf der Rückseite des Hauses.
Valera wollte ihr folgen, aber Ribeiro hielt ihn auf.
„Sie sind hier nicht erwünscht“, sagte er derb. „Mademoiselle hat etwas mit ihrem Vater zu besprechen.“
„Und wer hat Ihnen das Amt des Türstehers übertragen?“, gab Valera zurück, während er sich an ihm vorüberdrängte. „Bleiben Sie an Ihrem Platz, Señor, und lernen Sie, wo er ist.“
„Ihr Platz ist nicht innerhalb dieser Mauern und wird es auch nie sein“, rief Ribeiro, wobei er immer noch versuchte, dem anderen in den Weg zu treten.
„Was fällt Ihnen denn ein?“, sagte Christobal mit ehrlicher Überraschung, als er das Betragen des anderen sah. „Haben Sie getrunken?“
„Mir fällt ein, Ihnen eines ganz klar zu sagen. Ich werde nicht zulassen, dass ein Halbblut in Mademoiselle Lacostes Nähe ist. Dies war Ihr letzter Besuch in diesem Haus“, erwiderte der Portugiese.
„Halbblut!“, rief Valera. Bei der Beleidigung schoss sein ganzes spanisches Blut in sein hübsches Gesicht. „Halbblut, du verd… Portugiese, du weißt genau, dass ich es verabscheuen würde, den Schlamm zu besitzen, der in deinen Adern die Arbeit von Blut erfüllt. Caramba! Dass ich mir von einem Schwein wie dir solche Wörter anhören muss! Nimm das…und das…und das…damit du einen Don erkennst, wenn du das nächste Mal einen triffst.“
Während er das sagte, schoss er auf den fetten Ribeiro zu und schickte ihn mit drei wohlgezielten Fausthieben, die eines Engländers würdig gewesen wären, zu Boden. Dann richtete er sich schweigend auf und folgte Leona auf den Hof.
Der Portugiese rappelte sich aus dem Staub auf, griff nach seinem Panamahut, klopfte sich die lockere Leinenhose ab und ging schimpfend und fluchend davon.
„Das war das erste und das letzte Mal“, murmelte er. „Bis morgen wird Mademoiselle begriffen haben, was vor ihr liegt, und dann werden wir keine Unbotmäßigkeiten von ihr oder ihrem Hund von einem spanischen Verehrer mehr erleben, oder Antonio Ribeiro müsste sich sehr irren – wirklich sehr irren.“
Christobal war Leona nur zu dem Zweck gefolgt, ihr Maultier dem Bediensteten zu übergeben, der es in seiner Obhut hatte. Als das erledigt war, wusste er nur allzu genau, dass brasilianische Damen die Gewohnheit haben, zu dieser Stunde des Tages zu baden und Siesta zu halten, sodass er sich ihr nicht länger aufdrängen durfte. Dennoch blieb er noch einen Augenblick unter ihrer mit Lianen geschmückten Veranda stehen und erzählte ihr von seiner Begegnung mit dem Portugiesen.
Leona lächelte nicht über den Bericht; sie runzelte die Stirn.
„Wenn ich dabei gewesen wäre“, sagte sie, wobei sie den Griff ihres Jagdmessers umklammerte, „hätte er nicht so mit dir gesprochen.“
„Dann bin ich froh, dass du nicht dabei warst“, lachte ihr Kamerad. „Du bist zu schnell mit diesem Messer bei der Hand; eines Tages wirst du damit noch in Schwierigkeiten geraten.“
„Dann wird es mich ebenso leicht aus den Schwierigkeiten wieder befreien“, erwiderte sie gelassen. „Möchtest du, dass ich ängstlich bin, Tobal?“
„Ich möchte nicht, dass du anders bist als jetzt, Leona – ein schöner Panther in Frauengestalt. Aber sei gnädig gegenüber der armen Maus, die du zwischen deinen Pranken hast, urpilla chay.
„Tigerin und Turteltaube“, lachte sie leise. „Ich muss schon eine seltsame Kombination sein, Tobal. Adios, Bruder, bis heute Abend. Ich gehe zu meinem Vater und meiner Mittagsruhe.“
Während sie sprach, entschwebte sie. Er blieb stehen und sah der Wellenbewegung ihres weißen Kleides zu, bis es verschwunden war. „Entschweben“ ist der beste Ausdruck, wenn man beschreiben will, wie Leona ging. Dieses Mädchen hatte keinen leichten, elastischen Gang. Alles, was sie tat, tat sie langsam, feierlich und doch ungeheuer anmutig. An nichts anderes erinnerte sie so stark wie an das Tier, mit dem Valera sie verglichen hatte: dem Panther, einem Geschöpf von Stärke und Anmut, Schönheit und Sanftmut, bis es gereizt wird. Wenn das geschieht, ist die Rache zwar schnell und der Sprung tödlich, aber es ist immer noch schön, und das vielleicht im Zorn sogar noch stärker als im Spiel. Aber wenn es einem Mann endlich gelungen ist, eines dieser scheinbar unzähmbaren Geschöpfe zu zähmen, wie viel treuer, liebevoller und gefügiger wird es dann im Vergleich zu dem bescheideneren Tier, das gegenüber jedem katzbuckelt.
Leona ging zu ihrem Vater. Lacoste saß immer noch da, wo Ribeiro ihn alleingelassen hatte; seine Hände lagen nervös auf den Knien, der Kopf war nach vorn auf die Brust gesunken. Bei diesem Anblick wurde der edelste Teil ihres Wesens – der weibliche Teil – aufgewühlt. Sie ging zu ihm und kniete neben ihm nieder. Dabei fiel ihr gewelltes, kastanienbraunes Haar fast bis auf den Fußboden.
„Vater, bist du krank – oder schlimmer – hat irgendetwas dich beunruhigt?“
Beim Klang ihrer Stimme blickte er auf und sah sie liebevoll und flehentlich an. Der Kontrast zwischen den beiden hatte etwas ungeheuer Berührendes: der Mann so schwach, zusammengekauert und voller Angst, die Frau so stark, energisch und kühn.
„Ich habe einen großen, einen großen Schrecken erlitten, Leona. Ich möchte mit dir reden, mein Kind.“
„Hier bin ich, lieber Vater. Sage mir alles.“
Sie war es gewohnt, ihn während seiner Anfälle zu sehen, die nicht nur aus entsetzlicher Niedergeschlagenheit bestanden, sondern hin und wieder auch aus unerklärlicher Angst. Auch jetzt dachte sie nur, irgendein Traum, eine alte Erinnerung oder eine seltsame Laune sei in ihm aufgestiegen und würde ihn beunruhigen. Von echter Gefahr hatte sie keine Vorstellung.
„Ich möchte mich nicht von dir trennen, Leona“, begann er zitternd.
„Natürlich nicht, Vater. Auch ich habe nicht die Absicht, mich jemals von dir zu trennen. Wir werden aneinander hängen, bis der Tod uns scheidet.“
„Aber möglicherweise ist es notwendig. Frauen können nicht immer allein bleiben. In diesem Land ist das eine Schande.“
„Was kümmern uns die Sitten dieses Landes, Vater? Du bist kein Brasilianer, sondern Franzose“, sagte sie stolz.
„Aber ich bin nicht stark, Leona, und der Tod kann uns jeden Tag trennen; und ich könnte nicht zufrieden sterben, wenn ich dich ohne Beschützer zurücklassen würde!“
„Ohne Beschützer“, gab das Mädchen zurück, „wo ich doch mich selbst habe, meine Waffen und Tobal.“
„Du liebst Cristobal doch nicht, mein Mädchen?“, erkundigte Lacoste sich ängstlich.
„Doch – sogar sehr! Er ist nach dir, Vater, der beste Freund, den ich habe. Wenn Tobal mein Bruder wäre, ich könnte ihn nicht höher schätzen.“
„Aha! Diese Art von Liebe meine ich nicht, Leona. Ich meinte die Liebe, die zur Ehe führt.“
„Auf diese Weise liebe ich niemanden“, gab seine Tochter zurück. „Ich will auch niemanden auf diese Weise lieben. Ich habe keinen Wunsch nach einer Ehe – keine Absicht, zu heiraten. Ich habe nie einen Mann gesehen, dem ich meinen Willen unterwerfen würde, und ich rechne auch nicht damit.“
„Aber, Leona, wie deine innersten Gefühle auch aussehen mögen, aus Sicht der Öffentlichkeit ist es angebracht, dass du über eine Ehe nachdenkst. Eine Frau ohne Ehemann wird in allen Nationen gering geschätzt; in diesem Land wird sie zu einem Nichts und fast zu einer Schande.“
„Dann ziehe ich es vor, ein Nichts und eine Schande zu sein.“
„Aber um meinetwillen, Leona – um meine Angst zu lindern – um mich glücklich zu machen“, sagte er flehend.
Das Mädchen erhob sich, stellte sich ihm gegenüber und blickte auf ihn herab. Sie blickte herab in jedem Sinn des Wortes; im Ton ihrer Antwort lag Verachtung, auch wenn sie sich alle Mühe gab, es sich nicht anmerken zu lassen.
„Wie kann es dein Glück steigern, wenn du mich unglücklich machst, Vater?“
„Wie kannst du so sicher sein, dass es dich unglücklich machen wird?“
„Wenn ich mir selbst nicht sicher bin, kann kein anderer an meiner Stelle sicher sein. Ich bin vollkommen entschlossen, Vater. Ich werde niemals heiraten. Ehe ist Sklaverei, und ich bin frei geboren. Ich werde nie eine solche Närrin sein, dass ich mein Geburtsrecht gegen irgendeinen Mann eintausche.“
„Aber ich will, dass du heiratest, Leona“, sagte Lacoste in kläglichem Ton. „Es gibt da einen Mann, einen guten Mann, einen reichen Mann – er kann dir ein Haus in Rio geben, und eine Kutsche, und Pferde, und alle Annehmlichkeiten – und er liebt dich, Leona und …“
„Wer ist es?“, fragte sie neugierig.
„Er ist sehr bekannt und wohlhabend, mein Kind. Als seine Ehefrau würdest du beneidet, und für mich wäre er ein Freund. Es steht in seiner Macht, mir zu helfen, und …“
„Wie heißt er?“, fragte sie noch einmal in dem gleichen Ton.
„Ich weiß, er ist nicht sehr jung und vielleicht nicht das, was ein Mädchen als gut aussehend bezeichnen würde“, fuhr Lacoste fort. Der Gedanke, zur Sache kommen zu müssen, machte ihn nervös. „Aber er ist in Rio und New York als wohlhabender Kaufmann bekannt …“
„Ist es Ribeiro?“
Sie stellte die Frage in einem so vollständig verblüfften, ungläubigen Ton, dass es schwierig war, sie bejahend zu beantworten. Ihr Vater tat es mehr durch Bewegungen von Kopf und Hand als mit dem zitternden „Ja“, das ihm über die Lippen kam.
„Ribeiro!“, wiederholte sie ungläubig. „Du würdest mich – mich, Leona Lacoste – in die Arme dieses Schweins treiben – dieser Bestie, dieses ordinären, geldgierigen portugiesischen Schwindlers! Mich! Dein Kind, das du angeblich liebst! Vater, wenn das stimmt, würde ich mir wünschen, ich wäre nie geboren worden!“
„Nein, nein, Leona, sag’ so etwas nicht.“
„Ich würde lieber nicht leben als den Tag zu erleben, an dem du mich so verkaufst. Ich würde dieses Messer nehmen und meinem Dasein ein Ende machen, bevor es soweit kommt. Das Verbrechen würde über deinem Haupt schweben, Vater, aber für mich wäre es eine Gnade, es dabei zu belassen. Besser ist dein Gewissen mit dem Mord an meinem Körper belastet als mit dem Mord an meiner Seele.“
„Kein Wort! Leona – kein Mord! Oh Gott, halte mich davon fern!“, rief der armselige Mann, während er das Gesicht mit den Händen bedeckte.
„Warum schlägst du mir dann etwas vor, was mich dazu treiben würde? Du weißt, wie ich bin – temperamentvoll und willensstark. Ich habe vor niemandem Angst – und vor nichts. Einsamkeit, Armut, Tod machen mir keine Angst; aber ich werde mich nicht an einen Mann verkaufen, und von allen in der Welt am wenigsten an diese schäbige, wollüstige Bestie Ribeiro!“
„Sagʼ nichts mehr, mein Kind, jedes Wort von dir trifft mich wie ein Schwert.“
„Versprichst du mir, dieses Thema mir gegenüber nie mehr zu erwähnen, Vater?“
„Ich verspreche es, Leona.“
„Du wirst auch dieser – dieser Kreatur, die es gewagt hat, mich anzusehen – mitteilen, was ich gesagt habe.“
„Ich werde es ihm mitteilen.“
„Du wirst ihm befehlen, nie wieder einen Fuß in dieses Haus zu setzen. Ach, ich weiß, was du sagen willst. Wir schulden ihm Geld. Vater, wir werden ihm sein Geld bezahlen, und wenn ich in Rio betteln gehe, um es zu beschaffen; aber seine Gegenwart hier wäre eine Beleidigung, und ich könnte mir selbst nicht trauen, ob ich sie nicht rächen würde.“
„Wenn er seine Antwort hat, wird er nicht wiederkommen!“, erwähnte ihr Vater leise – seine Stimme war so leise und so voller Verzweiflung, dass Leona an seine Seite kam und wie zuvor niederkniete.
„Und du wirst mich nicht hassen, Vater! Du wirst nicht wütend auf mich sein, weil ich mich nicht bereit erklären kann, dich für irgendeinen anderen Mann zu verlassen! Was würdest du denn ohne mich machen? Wer würde all deine seltsamen Stimmungen und Windungen verstehen und damit so viel Mitgefühl haben wie ich? Du hast meine Mutter geliebt, Vater! Du hättest sie nicht gegen ihren Willen von deiner Seite verstoßen. Stell dir vor, ich wäre sie! Sie hat nur achtzehn Monate mit dir gelebt. Ich bin seit meiner Geburt deine Gefährtin. Würdest du dich von mir leichter trennen als du dich von ihr getrennt hast?“
„Nein, nein! Kind, beruhige dich! Du sollst nicht diejenige sein, die geht! Aber wenn sie dir in den kommenden Jahren jemals sagen sollten, dein Vater habe schlimme Verbrechen begangen, glaube ihnen nicht, Leona. Ich habe ein gedankenloses und ausschweifendes Leben geführt, aber kein verbrecherisches – kein verbrecherisches!“
„Wer sollte es wagen, mir so etwas zu sagen?“, fragte das Mädchen mit verblüfften Blick. „Aber dir geht es heute nicht gut, lieber Vater! Du wirst einen dieser seltsamen Anfälle von Niedergeschlagenheit bekommen, und hinterher bist du schwach und erschöpft. Möchtest du dich nicht hinlegen? Die Sonne steht sehr hoch, und der Schlaf wird dir gut tun – Epiphania soll dir unter den Bäumen im Garten deine Hängematte aufhängen, und ich mische dir ein Sorbet und bringe es dir!“
„Nein! Nicht in den Garten – nicht in den Garten!“, sagte Lacoste mit einem Ausdruck unbestimmter Beunruhigung, „damit mich dort niemand sieht. Aber ich werde mich hinlegen, Leona. Ich werde mich hinlegen!“
Während er noch sprach, erhob er sich, und sie stützte ihn zärtlich. Sie war an solche wilden, unzusammenhängenden Äußerungen von Seiten ihres Vaters gewöhnt. Was seine geistige Gesundheit anging, waren sie die Ursache einiger Befürchtungen, die sie Valera mitgeteilt hatte.
„Wenn du dich ausgeruht hast, geht es dir sicher besser“, sagte sie tröstend.
„Ja, ja“, murmelte er. „Eine lange Ruhe! Eine lange Ruhe! Aber glaube nichts von dem, was sie gegen mich vorbringen, Leona. Dein Vater ist ehrlich, denke daran! Töricht – aber ehrlich!“
„Ich weiß, dass er ehrlich ist“, erwiderte sie und lächelte ihm ins Gesicht.
Er nahm das ihre zwischen seine zitternden Hände.
„Ein gutes Gesicht. Ein aufrichtiges, tapferes Gesicht. Ein wunderschönes, mutiges Gesicht. Ein besseres Gesicht als meines. Ich bin froh, dass Ribeiro es niemals das seine nennen wird.“
„Darauf kannst du dein Leben verwetten, Vater“, warf sie ein.
„Ich werde mein Leben darauf verwetten“, murmelte er. „Ich werde mein Leben darauf verwetten.“
Sie führte ihn vorsichtig in sein Zimmer, sah zu, wie er sich auf das Bett legte, und dann, nachdem sie die Kammer abgedunkelt hatte, brachte sie ihm eine erfrischende Limonade.
„Du musst jetzt schlafen, lieber Vater“, sagte sie, während sie im Begriff stand, hinauszugehen.
„Ich werde jetzt schlafen“, wiederholte er langsam, „und denke daran, Leona, dein Vater war ehrlich!“
Wehmütig hob er den Blick zu ihr; sie glättete seine Haare, küsste ihn auf die Stirn, als wollte sie ein quengelndes Kind beruhigen, und überließ ihn dann seiner Erholung.
Als sie sich entfernte, fühlte sie sich seinetwegen stärker beunruhigt als sonst. Wenn seine seltsamen Launen noch einmal in eine solche Richtung gingen, würde es ihr sehr schwer fallen, nicht nur dagegen anzukämpfen, sondern auch Ribeiros dreiste Avance abzuwehren. Bei diesem Gedanken begann das Herz des Mädchens unregelmäßig zu schlagen, und eine Wallung färbte ihre olivfarbene Haut dunkelrot. Sie rief die Dienerin Epiphania, damit sie ihr die Hängematte zwischen den Ästen einer ausladenden Zeder aufhängte, und sobald sie ihr mittägliches Bad genommen hatte, hüllte sie sich in ihrer ganzen Größe in die schmalen Falten und schwang in ihrer grünen Laube hin und her. Die warme, weiche Luft spielte in ihren losen Locken und hob das durchsichtige Tuch, das ihre geschmeidigen Gliedmaßen umhüllte. Von ihrem Liegeplatz aus konnte sie die prachtvoll gezeichneten Schmetterlinge sehen, und auch die winzigen Kolibris, die im hellen Sonnenlicht schwelgten und von Blüte zu Blüte schossen – hier versenkten sie sich in den Kelchen von Fuchsien und Lilien, da verbreiteten sie den Duft der Orangenblüten in der ohnehin schon üppig geschwängerten Luft. Aber Leona brachte es nicht über sich, zu schlafen. Zu stark war ihre Wut angestachelt; ihr Stolz war durch das Ansinnen ihres Vaters so plötzlich erschüttert worden, dass sie es selbst ihm nicht sofort vergeben und vergessen konnte.
Monsieur Lacostes Worte waren für sie unerklärlich – so weit sie wusste, hatte er nie versucht, sie zur Handlangerin für die Lösung seiner Probleme zu machen. Und dann auch noch auf diese Weise! Schon der Gedanke ließ sie bei aller Stärke erschaudern und ihr tapferes Gesicht erblassen.
Was war nur geschehen, dass ihr Vater den Gedanken an ein solch entsetzliches Opfer gehegt hatte, und sei es auch nur für einen Augenblick? Er musste sehr tief in Ribeiros Schuld stehen, wenn er auch nur daran denken konnte, die Ehre seines Kindes als Preis für seine eigene Befreiung zu bezahlen.
Wie konnte er diese Schuld angehäuft haben – und wofür? Sie wusste nur von der fehlgeschagenen Spekulation, auf die er zuvor angespielt hatte; dabei waren beide Parteien bis zu einem gewissen Grade Verlierer, aber das war nicht unabänderlich.
Leona lag in ihrer Hängematte und grübelte über das Rätsel, bis die warme brasilianische Brise und die lebhaften brasilianischen Insekten sie in den Schlaf summten.
Wie lange sie geschlafen hatte? Später hatte sie keine Gelegenheit mehr, sich daran zu erinnern, denn sie wurde von einem durchdringen Schrei aus ihrer Siesta gerissen. Er hallte durch die Zimmer des kleinen Hauses, drang in die Winkel ihres belaubten Unterstandes und rief sie mit einem Gefühl des Entsetzens zu den Angelegenheiten des Lebens zurück.
Kapitel 3.Der Brief und der Ring
Ihr Vater! Das war Leonas erster Gedanke. Sie sprang mit der Behendigkeit einer Katze aus der Hängematte und eilte ins Haus. Auf der Türschwelle kam ihr Epiphania entgegen. Die Dienerin rang die Hände und schrie.
„Oh, zum Herrn kommen, Missy! Zum Herrn kommen! Er wirklich sehr krank.“
Leona ging schnell an ihr vorüber in seine Kammer. Ein Blick reichte. Ihr Vater lag entweder im Sterben – oder er war tot.
„Holʼ Doktor Linton!“, rief sie. Damit meinte sie einen alten englischen Chirurgen und Naturforscher, der sich seit einigen Monaten in ihrer Kleinstadt aufhielt und nur wenige Yards von ihnen entfernt wohnte.
Wenige Minuten später war er an ihrer Seite.
„Ach, Doktor Linton!“, rief sie, „was hat das alles zu bedeuten? Was hat er sich angetan? Warum riecht es im Zimmer so stark nach Mandeln?“
Monsieur Lacoste lag offensichtlich so im Bett, wie seine Tochter ihn zurückgelassen hatte. Aber sein Gesicht war dunkelviolett, die Fingernägel blau und die Hände ineinander verkrallt. Seine Augen standen weit offen, traten hervor und glänzten, was Leona in den Glauben versetzt hatte, er habe einen Anfall. Um den geschlossenen Mund erkannte man einen Ring aus Schaum. Doktor Linton untersuchte die Augäpfel, legte eine Hand auf das Herz und sah dann das Mädchen, das neben dem leblosen Körper kniete, mitfühlend an.
„Ist es ein Anfall, Doktor Lacoste? Sollte er ein warmes Bad nehmen?“
„Das ist kein Anfall, Mademoiselle.“
„Was dann? Ist er wahnsinnig geworden? Ach Doktor, sagen Sie das nicht! Ich habe es schon lange befürchtet.“
„Sie müssen es jetzt nicht mehr fürchten. Aber nehmen Sie Ihren Mut zusammen und machen Sie sich auf einen großen Schrecken gefasst. Ihr armer Vater ist tot.“
„Tot! Und das so schnell! Aber woran ist er denn gestorben? Was hat ihn umgebracht?“
„Ich fürchte, das hier“, erwiderte der Arzt, während er dem steifen Griff eine kleine Flasche entwand.
„Das! Was ist das?“, fragte leone zitternd.
„Das ist Gift, Mademoiselle. In dieser Flasche war Blausäure.“
„Und Sie meinen, er hätte sich damit umgebracht? Mein Vater hätte Selbstmord begangen? Sie meinen, er hätte mich zurückgelassen, damit ich allein durch die Welt gehe?“
„Pst, pst, Mademoiselle, ganz ruhig, beruhigen Sie sich. Fallen Sie nicht in Ohnmacht, ich flehe Sie an!“
„Ich falle nicht in Ohnmacht, Doktor, dafür habe ich zu viel europäisches Blut in mir. Aber das hier – ich kann es einfach nicht glauben! Ach! Wollen Sie nicht noch etwas versuchen, bevor Sie alle Hoffnung aufgeben? Gibt es keine Arzneien, keine Medizin, nichts, was ihn retten könnte?“
„Meine liebe junge Dame, er ist schon seit mindestens zwei Stunden tot! Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber nichts wird Ihren armen Vater in diese Welt zurückholen.“
„Er hätte doch noch warten können“, sagte das Mädchen mit wehmütiger Stimme. „Er hätte um meinetwillen ein wenig länger kämpfen können. War ich nicht da, um seine Last mit ihm zu teilen? Warum hatte er kein Vertrauen in mich?“
„Vermutlich konnte er bei seinem Geisteszustand nicht begreifen, wie tief Ihre Zuneigung war. Sagen Sie mir, Mademoiselle, hatten Sie in letzter Zeit irgendeinen Grund zu der Annahme, dass Ihr Vater eine solche Handlung in Erwägung ziehen könnte?“
„Nicht den geringsten – jedenfalls nicht mehr als gewöhnlich.“
„War er demnach häufig in gedrückter Stimmung?“
„Manchmal sehr, und dann hat er oft gesagt, er wäre am liebsten tot. Aber dabei habe ich mir wenig gedacht. Mein Vater hatte kein glückliches Leben.“
„Hatte Monsieur Lacoste in jüngster Zeit Schwierigkeiten, die seinen Geist vielleicht beunruhigt haben?“
„Er hatte einige finanzielle Verluste, aber ich glaube, die waren nicht schwerwiegend.“
„Und heute oder gestern zum Beispiel ist nichts geschehen, was in Ihnen den Verdacht geweckt hat, dass er mehr leidet als sonst?“
„Nichts außer – heilige Jungfrau! Das kann doch nicht so schlimm gewesen sein!“
„Worauf spielen Sie an, Mademoiselle?“
„Da war nur ein Gespräch, das er und ich vor einigen Stunden geführt haben. Darin hat mein Vater mich zu einer Handlungsweise gedrängt, gegen die ich viel einzuwenden habe. Er schien durch meine Weigerung verletzt zu sein, aber er hat nichts gesagt…nichts…was mich auf den Gedanken gebracht hat…was mich fürchten ließ…“ Leonas Bericht brach in einem Anfall von Schluchzen ab.
„Trösten Sie sich, Mademoiselle, und seien Sie versichert, dass keine gewöhnliche Enttäuschung Ihren Vater zu dieser unbedachten Tat getrieben hat. Ich habe selbst viele Eigenarten an ihm beobachtet und deshalb wenig Zweifel, dass der Samen des Wahnsinns, der in letzter Zeit von ihm Besitz ergriffen hat, schon vor vielen Jahren gesät wurde. Was kann ich jetzt für Sie in dieser traurigen Notlage tun?“
„Nichts, Doktor, außer mich mit ihm allein zu lassen.“
„Aber das ist nicht das Richtige für ein Mädchen von Ihren Jahren.“
„So lange ich denken kann, waren wir immer allein, und ich möchte meine letzte Pflicht für ihn mit niemandem teilen. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Er war das Einzige auf Erden, was ich geliebt habe. Ich kann es noch gar nicht glauben – dass er fort ist!“
„Denken Sie nach, Mademoiselle. Gibt es niemanden, den Sie gern bei sich hätten? Keine Freundin…
„Ich habe keine Freundin. Aber warten Sie, da ist Tobal. Ja! Sagen Sie Don Christobal Valera, dass mein Vater tot ist und dass ich möchte, dass er kommt und mit mir weint.“
Jetzt wandte sie ihre ganze Aufmerksamkeit dem Toten zu. Doktor Linton staunte darüber, welche Tapferkeit und Fassung sie an den Tag legte. Er ließ sie mit dem Leichnam ihres Vaters allein.
Wenn er sie gesehen hätte, als sie tatsächlich allein war, er hätte nicht so über ihre Tapferkeit und Fassung gestaunt. Ihr erser Kummer brach sich in einem wilden, ungezügelten Schrei der Verzweiflung Bahn. Aber wie es die Art solcher Ausbrüche ist, erschöpfte er sich, und nun wurde sie still und resigniert. Die verschiedenen Anweisungen, die notwendig waren, erteilte sie mit der Festigkeit und Entscheidungsstärke einer Frau.
Wie in allen warmen Klimazonen, so werden Beisetzungen auch in Brasilien so bald wie möglich nach dem Tod vollzogen, und so lag der Körper des armen Lacoste schon am gleichen Abend, bedeckt mit allen möglichen Blumen von der Hand seiner liebenden Tochter, in seinem Sarg. Am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang sollte er abgeholt werden. Ihr Freund Christobal war für Leona an diesem Wendepunkt von größtem Nutzen gewesen, hatte er ihr doch alle geschäftlichen Angelegenheiten abgenommen. Aber als der Abend hereinbrach und alle Vorbereitungen für den nächsten Morgen getroffen waren, wurde sie sogar seines Mitgefühls überdrüssig und bat ihn, sie noch einmal mit ihrem Kummer allein zu lassen.
So saß das arme Kind, ohne von der immer dichter werdenden Düsternis Notiz zu nehmen, neben dem Bett, auf dem der Sarg ihres Vaters ruhte. Den müden Kopf hatte sie auf das Kissen gelegt.
Plötzlich verdunkelte ein Schatten die offene Tür. Träge blickte sie auf. Es war Ribeiro. Im nächsten Augenblick war Leona auf den Beinen.
„Was haben Sie hier zu suchen, Señor?“, fragte sie kühl.
Der Portugiese verbeugte sich respektvoll.
„Ich komme, wie es sich für einen Freund gehört, um Mademoiselle angesichts des erlittenen Verlustes meines aufrichtigen Mitgefühls zu versichern und einen letzten Blick auf die Züge meines armen Kameraden Lacoste zu werfen.“
„Sie sollen ihn nicht anrühren! Sie sollen ihn nicht einmal sehen!“, rief Leona und warf ein weißes Laken über das Gesicht des Toten. „Ihre Gegenwart hier, Señor, ist eine Aufdringlichkeit und eine Beleidigung. Ich befehle Ihnen, das Haus sofort zu verlassen!“
„Gemach, Gemach, Mademoiselle“, sagte Ribeiro. „Solche Worte ziemen sich wohl kaum in Gegenwart des Toten.“
„In Gegenwart des Toten, den Sie mit Ihren teuflischen Forderungen in den Tod getrieben haben!“, schrie das Mädchen in höchster Erregung. „Eines sage ich Ihnen, Señor: Wenn Sie es wagen sollten, den Leichnam meines Vaters mit Ihren heimtückischen Händen zu berühren, wird er aus seinem Sarg aufstehen und Sie zur Rede stellen.“
„Sacristi! Ein modernes Wunder! Das würde ich gern sehen, Mademoiselle! Gestatten Sie mir wenigstens, meine Macht zu erproben.“
„Wenn Sie noch einen Schritt näher kommen, steche ich Sie ins Herz“, rief Leona leidenschaftlich, während sie ihr Messer zog.
Ribeiro wich einen Schritt zurück.
„Aber nicht doch, Mademoiselle, ein Mord an einem Tag, das reicht doch sicher. Aber ich bewundere Ihre Begeisterung. Die haben Sie zweifellos von Ihrem Vater geerbt. Sie sind das, was die Engländer einen ‚harten Brocken‘ nennen.“