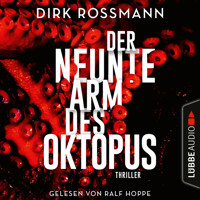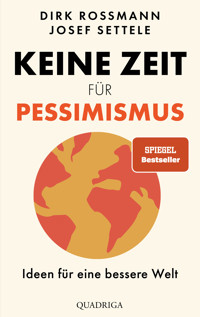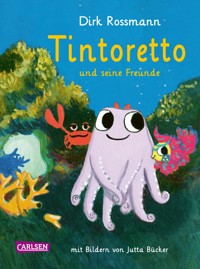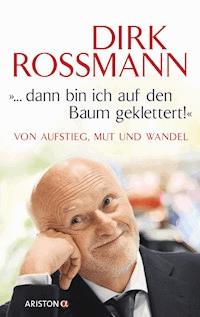9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Oktopus-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Klima-Allianz - unsere letzte Chance?
Der Klimawandel - eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes steht uns bevor. Verändert unsere Erde. Verändert unser aller Leben. Das Fiasko scheint unaufhaltsam. Bis die drei Supermächte China, Russland und die USA einen radikalen Weg einschlagen. Doch wird diese starke Klima-Allianz das Ruder noch herumreißen?
Die Maßnahmen der Allianz greifen gravierend in das Leben der Menschen ein, und nicht jeder will diese neue Wirklichkeit kampflos akzeptieren. Alle Mittel sind den Gegnern recht, um ihre ökonomischen und machtpolitischen Interessen zu verteidigen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, und plötzlich liegt das Schicksal der Erde in den Händen eines schüchternen Kochs und einer unscheinbaren Geheimagentin.
"Das ist Hammer. Super spannend. Respekt!" Udo Lindenberg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungTextauszugPrologDienstag, 16. Oktober 2018Dienstag, 29. Januar 2019Montag, 3. Mai 2100Freitag, 19. April 2019Drittes Jahrtausend, drittes Jahrzehnt in der Geschichte der MenschheitSamstag, 27. April 2019Montag, 3. Mai 2100Sonntag, 28. April 2019Montag, 3. Mai 2100Sonntag, 28. April 2019Montag, 3. Mai 2100, am AbendDonnerstag, 24. September 2020Dienstag, 22. Juni 2021Freitag, 11. November 2022Donnerstag, 17. November 2022Montag, 21. November 2022Montag, 21. November 2022Montag, 21. November 2022Dienstag, 22. November 2022Freitag, 9. Dezember 2022Dienstag, 4. Mai 2100, am VormittagDienstag, 13. Juni 2023Dienstag, 4. Mai 2100Dienstag, 13. Juni 2023Mittwoch, 14. Juni 2023Mittwoch, 14. Juni 2023Mittwoch, 14. Juni 2023Mittwoch, 14. Juni 2023Donnerstag, 15. Juni 2023Donnerstag, 15. Juni 2023, am AbendDonnerstag, 15. Juni 2023Dienstag, 4. Mai 2100Freitag, 16. Juni 2023Samstag, 5. Oktober 2024Mittwoch, 20. November 2024Donnerstag, 09. Januar 2025Montag, 20. Januar 2025Montag, 20. Januar 2025Dienstag, 21. Januar 2025, kurz nach MitternachtDonnerstag, 23. Januar 2025Montag, 17. Februar 2025Dienstag, 25. Februar 2025Donnerstag, 6. März 2025Freitag, 7. März 2025Dienstag, 4. Mai 2100, am AbendMontag, 17. März 2025Mittwoch, 19. März 2025Samstag, 5. April 2025Samstag, 12. April 2025, am AbendSamstag, 12. April 2025, zur gleichen ZeitSonntag, 13. April 2025Montag, 14. April 2025Montag, 14. April 2025, am späten AbendDienstag, 15. April 2025Mittwoch, 16. April 2025Mittwoch, 16. April 2025Donnerstag, 17. April 2025Samstag, 19. April 2025, am NachmittagSamstag, 19. April 2025, 19:30 UhrSamstag, 19. April 2025, 21:00 UhrSamstag, 19. April 2025, 23:00 UhrIn der Nacht zum Mittwoch, 6. Mai 2100Sonntag, 20. April 2025, 13:10 UhrSonntag, 20. April 2025, 14:05 UhrSonntag, 20. April 2025, 14:22 UhrSonntag, 20. April 2025, 14:30 UhrSonntag, 20. April 2025, 16:05 UhrSonntag, 20. April 2025, 16:45 UhrSonntag, 20. April 2025, 17:08 UhrSonntag, 20. April 2025, 17:10 UhrSonntag, 20. April 2025, 17:12 UhrSonntag, 20. April 2025, 17:20 UhrSonntag, 20. April 2025, 18:40 UhrSonntag, 20. April 2025, 21:02 UhrMontag, 21. April 2025, am nächsten MorgenMontag, 21. April 2025, 09:00 UhrMittwoch, 23. April 2025Mittwoch, 5. Mai 2100, am VormittagDonnerstag, 24. April 2025AbspannEpilogDienstag, 8. Mai 2018DanksagungÜber dieses Buch
Eine Klima-Allianz – unsere letzte Chance?
Der Klimawandel – eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes steht uns bevor. Verändert unsere Erde. Verändert unser aller Leben. Das Fiasko scheint unaufhaltsam. Bis die drei Supermächte China, Russland und die USA einen radikalen Weg einschlagen. Doch wird diese starke Klima-Allianz das Ruder noch herumreißen?
Die Maßnahmen der Allianz greifen gravierend in das Leben der Menschen ein, und nicht jeder will diese neue Wirklichkeit kampflos akzeptieren. Alle Mittel sind den Gegnern recht, um ihre ökonomischen und machtpolitischen Interessen zu verteidigen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, und plötzlich liegt das Schicksal der Erde in den Händen eines schüchternen Kochs und einer unscheinbaren Geheimagentin.
Über den Autor
Dirk Rossmann, geboren 1946, gründete 1972 den ersten deutschen Drogeriemarkt mit Selbstbedienung. Heute betreibt die Unternehmensgruppe ROSSMANN 4.100 Filialen in Deutschland und sieben Auslandsgesellschaften. Seine 2018 erschienene Autobiografie »… dann bin ich auf den Baum geklettert!« platzierte sich bereits kurz nach Erscheinen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und schaffte es Anfang 2019 auf Platz 1. Dirk Rossmann setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein. Dass der Klimawandel eine Bedrohung für die Menschheit, unsere Kinder und Kindeskinder ist, beschäftigt ihn nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Vater und Großvater. Als Mitbegründer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung engagiert sich Dirk Rossmann seit 1991 für eine zukunftsfähige Bevölkerungsentwicklung. Der Autor ist verheiratet mit Alice Schardt-Rossmann und hat zwei Söhne, die ebenfalls im Unternehmen tätig sind.
DIRK ROSSMANN
THRILLER
LÜBBE
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Der Abdruck der Textpassagen aus dem Buch »Rendezvous mit einem Oktopus« von Sy Montgomery (übersetzt aus dem Amerikanischen von Heide Sommer) erfolgt mit freundlicher Genehmigung des mareverlags, Hamburg (© 2017 by mareverlag, Hamburg)
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Kartenillustration: Markus Weber, Guter Punkt München
Einbandmotiv: © plainpicture/NOI Pictures/Dominic Blewett
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0747-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Mit Dank an A. und R.Und an Prof. Fritz Schardt
Das Hirn eines Oktopus besteht aus – je nach Spezies und Zählmethode – fünfzig bis fünfundsiebzig verschiedenen Bereichen, aber die meisten Neuronen eines Oktopus sind nicht im Gehirn angesiedelt, sondern sitzen in den Armen. Die extremen Multitasking-Anforderungen, mit denen Oktopoden konfrontiert sind, mögen zu dieser Entwicklung beigetragen haben: Er muss alle seine Arme koordinieren, Farbe und Form verändern, er muss lernen, denken, entscheiden und sich erinnern – und zur gleichen Zeit die Flut an Geschmacks- und Tastinformationen, die sich von jedem Zentimeter Haut in sein System ergießen, verarbeiten und darüber hinaus das Wirrwarr visueller Reize sortieren, die seine gut entwickelten, den menschlichen sehr ähnlichen Augen liefern.
(Aus: Sy Montgomery, »Rendezvous mit einem Oktopus«)
Prolog
Und so begann es: Der Planet Erde, den wir gerne »unseren« Planeten nennen, entstand vor etwa 4,4 Milliarden Jahren.
Und wir Menschen sind darauf eine sehr, sehr neue und vielleicht auch flüchtige Erscheinung. Wie unbedeutend wir sind, wie demütig wir darum vielleicht sein sollten, das lässt sich mit einem kleinen Rechenspiel veranschaulichen.
Hätte sich die Geschichte des Planeten Erde in einem einzigen Jahr, also in 365 Tagen, abgespielt, so würde ein Monat 375 Millionen Jahren entsprechen. Ein Tag wären 12 Millionen Jahre, eine Stunde des Modelljahres wären 500 000 Jahre, eine Minute wären 8 500 Jahre, eine Sekunde wären 140 Jahre.
Am Neujahrstag, dem 1. Januar, beginnt die Erdentstehung. Es existiert die Sonne, und in ihrer Umgebung entstehen Planeten im Urzustand.
Im Januar erhitzt sich die Erde, die Erdkugel wird flüssig, vorhandenes Eisen sinkt in den Erdkern.
Im Februar bildet sich eine Kruste, die Erde ist von Wasser bedeckt. Die chemische Evolution beginnt.
Anfang März entstehen die ersten Kontinente. Als erste biologische Lebensformen entstehen Blaualgen und Bakterien. Beim Stoffwechsel der Algen wird Sauerstoff freigesetzt. Die Umwandlung der Atmosphäre beginnt.
Im August gibt es genügend Sauerstoff für die einfachsten Tiere, wie zweischalige Krebse.
Im Oktober wird bei gewaltigen Lavaergüssen der gesamte Nordosten Kanadas mit einer Lavaschicht überzogen. Es beginnt eine Eiszeit.
Am 16. November unseres Modelljahres beginnt ein neuer Abschnitt der Erdgeschichte – das Kambrium.
Etwa am 17. November beginnt die zweite Vereisung.
Am 19. November entstehen innerhalb weniger Stunden die Baupläne für sämtliche Lebewesen.
Am 27. November entwickeln sich die ersten Pflanzen an Land.
Am 3. Dezember kriechen die ersten Tiere auf das Festland.
Am 4. Dezember beginnt das Karbonzeitalter. Es entwickeln sich aus Reptilien die ersten Säugetiere, Vögel, Riesenechsen und die Saurier.
Am 8. Dezember, dem Ende des Karbonzeitalters, beginnt eine neue große Eiszeit, die bis zum 12. Dezember anhält.
Beim Zusammenstoßen des Nord- und des Südkontinents am 11. Dezember falten sich in Nordamerika die Appalachen und in Nordafrika das Atlasgebirge auf. Alle Kontinente bilden noch einen einzigen Festlandsblock.
Zwischen dem 14. und 17. Dezember zerbricht der Urkontinent in vier große Platten:
Nordamerika, Europa/Asien, Südamerika/Afrika, Indien/Australien und die Antarktis.
Die Saurier sind die beherrschende Lebensform auf der Erde bis zum 25. Dezember, an dessen Nachmittag die Karriere der Säugetiere beginnt.
Am 27. und 28. Dezember entstehen bei Zusammenstößen kontinentaler Schollen alle heutigen Hochgebirge. In Asien rammt am 28. Dezember Indien gegen Tibet, der Zusammenstoß führt zur Auffaltung des Himalaya-Gebirges.
Erst am Abend des 31. Dezember finden sich erste Spuren früher Menschentypen in Ostafrika.
Um 23:50 Uhr, in einer Zwischen-Warmzeit, ist eine Höhle im Neandertal unweit von Düsseldorf bewohnt. Um 23:52 Uhr beginnt der vorläufig letzte Vorstoß von Eismassen und bedeckt auch Teile Norddeutschlands.
Um 23:56 Uhr, während der Eiszeit, erscheint der anatomisch moderne Mensch, der Homo sapiens, in Europa.
Um 23:59 Uhr tauen die Gletscher in Norddeutschland und Skandinavien.
In dieser letzten Minute des Modelljahres, erdgeschichtlich im Holozän, beginnt die eigentliche Kulturgeschichte der Menschheit.
Um 23:59 Uhr und 28 Sekunden wird in Ägypten die Cheops-Pyramide errichtet. 22 Sekunden vor Mitternacht lebt Abraham als Begründer des Judentums.
20 Sekunden vor Mitternacht werden die Bücher Moses und Homers »Ilias« und »Odyssee« geschrieben. 14 Sekunden vor Mitternacht wird Jesus Christus geboren, 10 Sekunden vor Mitternacht der Prophet Mohammed.
Drei Sekunden vor Mitternacht sucht Kolumbus den Seeweg nach Indien und stößt auf Amerika.
In den letzten zwei Sekunden des Jahres steigt die Anzahl der auf dem Planeten Erde lebenden Menschen von einer auf acht Milliarden.
In der letzten Sekunde unseres Modelljahres, erdgeschichtlich nun im Anthropozän, also erstmals einer Zeit, die maßgeblich vom Menschen beeinflusst wird, verbraucht die Menschheit einen Großteil aller Kohle-, Öl-, Gas- und Erzvorräte, die fossilen Brennstoffe mittels Verbrennung.
Dadurch gerät die Spezies Mensch in Gefahr, die Umwelt zu vernichten und die Erde unbewohnbar zu machen.
Wie werden unsere Kinder auf uns zurückblicken? Oder wird es keine mehr geben?
[Inspiriert durch einen Vortrag von Alvo von Alvensleben (1970): »Erde und Weltraum – ein Streifzug durch Raum und Zeit«. Mit Ergänzungen von Wolfgang Beyer und Udo von Barckhausen]
Dienstag, 16. Oktober 2018
Jamal-Halbinsel, Nordwestsibirien, Russland
Die meisten Menschen mögen die Kälte nicht, Gennadi Schadrin liebte sie. Sein Mantel bestand aus zwei Schichten Leder, das hielt den Wind ab. Ein Futter aus Rentierfell sorgte für Wärme, ebenso wie der Fellbesatz am Kragen und an den Ärmeln. Gennadi war gerüstet für die Kälte Sibiriens.
Aber es wurde nicht kalt.
Schon der vergangene Winter war zu milde gewesen, der davor ebenfalls. Aber jetzt war es noch wärmer geworden, und das machte Gennadi Schadrin Sorgen. Die Erde war zu feucht und der Wind zu warm. Seine Rentiere würden auf den weichen Böden nicht vorankommen, sie brauchten den Frost.
Eigentlich hätte Gennadi längst zu den nährstoffreichen Wäldern im Süden aufbrechen müssen, aber wie sollten sie es schaffen, vierhundert Kilometer über den viel zu weichen Boden? Gennadi war ein Hirte, so wie seine Eltern Hirten gewesen waren, seine Großeltern und alle Ahnen, über die ihm je berichtet worden war. Er und seine Familie lebten mit und von den Rentieren. Sie aßen das Fleisch und tranken ihr Blut. Aus den Fellen nähten die Frauen Mäntel und Decken, aus den Knochen fertigten sie Ruten, Messer und Haken für die Zelte, die Sehnen wurden zum Nähen verwendet.
Doch das ganze Wissen seiner Vorfahren half Gennadi nicht bei der Beantwortung einer einfachen Frage: Was tun, wenn der Frost nicht kommt?
In Gennadis Sprache bedeutete Jamal »die große Weite«. Und tatsächlich war die Halbinsel über Jahrhunderte ein abgelegener Ort im Permafrost gewesen, von der Welt nicht weiter beachtet. Als Gennadi geboren wurde, lebten in seiner Heimat, dem autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, gerade mal 80 000 Menschen. Dann wurden hier die größten Gasvorkommen der Erde gefunden. Als Gennadi vierzig Jahre alt war, gab es in seinem Land schon über eine halbe Million Menschen. Wie viele es heute waren, in seinem einundfünfzigsten Lebensjahr, konnte er nicht sagen.
Was er aber wusste: Den meisten von ihnen war das Land nicht mehr wichtig. Sie verdienten Geld in den Fabriken und Bohranlagen. Sie schlugen ihre Trassen durch das Weideland der Rentiere, sie vergifteten das Wasser. In einem einzigen Jahr flossen über den Fluss Ob 125 000 Tonnen Rohöl in das Nordpolarmeer.
Gennadi ahnte, dass er seine Familie nicht mehr lange schützen konnte.
In dieser Nacht wachte Gennadi plötzlich auf, weil er ein Wimmern hörte. Sergei, sein jüngster Sohn, der gerade vier Jahre alt geworden war, fieberte. Er hatte seit zwei Tagen kaum etwas gegessen, nicht einmal von den Beeren, die sie im Sommer gesammelt hatten. Jetzt lag der Junge bleich und schwitzend auf dem Fell. Er zitterte. Gennadis Frau, die beiden Töchter und der ältere Bruder knieten vor dem Kind, die Mutter streichelte seinen Kopf. Gennadi stieg in die Fellschuhe und lief los.
Er brauchte Jorak, den Schamanen.
Die Nenzen heilten mit dem, was die Natur ihnen gab. Der Schamane kannte Kräuter, er konnte aus Weidenzweigen eine Milch pressen, die bei Fieber half, er kannte die Beschwörungsformeln gegen den Schmerz. Aber er war auch modern genug, um zu wissen, wann seine Magie nicht mehr half.
Jorak legte Gennadi die Hand auf die Schulter. »Ihr werdet Sergei begraben müssen, mein Freund, so tief wie ihr könnt. Ein Fluch ist zurück, eine uralte Krankheit.«
Sergei, der kleine Junge, atmete flach. Sein Fieber stieg, die Milch aus Weidenruten würde ihm nicht helfen. Jorak strich ihm über die Stirn. »Der Frost hatte uns vor dem Fluch der Krankheit geschützt. Doch nun, wo alles taut, wächst die Gefahr. Wahrscheinlich ist eines deiner Tiere befallen, vielleicht auch mehrere.«
Am nächsten Tag begrub Gennadi seinen jüngsten Sohn, direkt danach brach die Familie auf. Am Abend holte das Fieber die beiden Töchter, sie starben zwei Tage später. Als Katharyna starb, seine Frau, war Gennadi schon zu schwach, die Leiche zu vergraben. Dann war die ganze Familie tot, eine Sippe der Jamal-Nenzen erloschen.
Als kurze Zeit später eine andere Familie die verwaisten Rentiere fand, starben in kurzer Zeit fünfzehn weitere Menschen sowie die komplette Herde. Alles, was von ihnen blieb, war eine winzige Notiz auf einer unbedeutenden russischen Nachrichtenseite im Netz: »Tote im Permafrost: Kommt der Milzbrand-Erreger zurück?«
Dienstag, 29. Januar 2019
Datscha des Präsidenten der Russischen Föderation
Nowo-Ogarjowo, Odinzow-Bezirk bei Moskau
»Freunde, die Nachrichten sind nicht gut«, sagte Setschin. »Wir haben neue Lecks. Siebenundzwanzig Fälle sind in den letzten Wochen aufgetaucht, alles neue Risse und Absackungen an den Pipelines. An zwei Stellen sind Wohnblocks eingestürzt.« Igor Iwanowitsch Setschin, Vorstandsvorsitzender bei »Rosneft«, blickte in die Runde. Erst zu Alexei Borissowitsch Miller, dann zu Gerhard Schröder, dann zu Wladimir Putin.
Draußen schneite es seit Tagen, ein Schneepflug hatte den Weg zur Datscha erst frei räumen müssen, links und rechts der Einfahrt türmten sich die Schneemassen. Vom Kaminzimmer aus konnte man normalerweise die Fahrer beobachten, wenn sie vor dem Garagenhaus rauchten und auf ihre Chefs warteten. Aber jetzt waren die Flocken viel zu dicht. Keine fünf Meter weit konnte man sehen. Es war schwer vorstellbar, dass ein ausbleibender Winter ein Problem sein könnte.
Putin schwieg. Er blickte in den Kamin. Seine Datscha war ein Landhaus mit Konferenzsälen, Nebenhäusern, Sporthalle, zwei Küchentrakten, einem Fernsehstudio und einer Bunkeranlage im dritten Tiefgeschoss. Und das Kaminzimmer sah nur auf Fotos heimelig aus: Dort, wo üblicherweise die Hausfotografin stand, blieb der Raum schmucklos getäfelt.
Putin sah auf. »Noch mehr so beschissene Nachrichten?«, fragte er.
Miller streckte sich. »Fünfundvierzig Prozent unserer Anlagen und Pipelines liegen in den gefährdeten Gebieten.« Die gesamte Infrastruktur seiner »Gazprom« würde leiden, wenn die Böden weiter so schnell und tief tauten. Manchmal entzündeten sich Gashydrate unter den Eishügeln, niemand konnte sagen, wo und wann es Explosionen geben könnte. Die Lage war ernst, offenkundig.
Dazu kamen die Waldbrände in Sibirien: mehr denn je zuvor und größer denn je zuvor. Sie ließen den Boden schneller tauen, was wiederum für mehr Methan sorgte und den Klimawandel beschleunigte. Das alles war prognostiziert – aber mit welcher Wucht die Vorhersagen eintreffen würden und dass Russland eines der ersten Opfer des Klimawandels werden sollte, das änderte alles.
So wie es jetzt lief, das war den Männern klar, würde es nicht weitergehen können.
Es hörte nicht auf zu schneien. Am späten Nachmittag, es war bereits dunkel, endete das kleine, inoffizielle Treffen. Die Fahrer manövrierten ihre Autos durch das Schneeflockengrau, Miller und Setschin verschwanden im Getümmel der Flocken. Bevor Schröder sich verabschiedete, kramte er in seiner Tasche. Er zog ein Buch hervor.
»Das wollte ich dir noch geben«, sagte er. Putin zog die Augenbrauen zusammen. »Du weißt doch, dass ich keine Zeit habe, Bücher zu lesen. Und jetzt erst recht nicht.«
»Ich dachte, du willst mit deinem Deutsch im Training bleiben?«, entgegnete Schröder.
»Hm«, sagte Putin.
»Du musst auch nicht das ganze Buch lesen«, sagte Schröder. »Ich habe dir drei Seiten markiert. Es geht um Oktopoden in Boston.«
Putin nahm das Buch entgegen, einen Anflug von Spott in seinen Augen. »Oktopoden. Ah ja.«
»Du wirst verstehen, warum!«, sagte Schröder und stapfte zu seinem Wagen. Putin hob die Hand, winkte, ging zurück in seine Datscha und schlug das Buch auf.
Montag, 3. Mai 2100
Hagenburg am Steinhuder Meer, nahe Hannover, Deutschland
Gundlach schlägt die Augen auf, er ist sofort wach. Früher konnte er allmählich aus dem Schlaf in den Tag hinübergleiten, sich noch ein wenig räkeln und strecken. Aber nun ist da diese künstliche Intelligenz, diese Roboterfrau: Krankenschwester, Sekretärin, Gouvernante – in einer Maschine. Und natürlich bemerkt Tracy, so heißt das Ding, sofort, dass Gundlach nicht mehr schläft.
»Guten Morgen, Maximilian. Es ist sechs Uhr zwanzig.« Tracy hat eine warme, sinnliche Stimme. Sie hat am Fußende des Bettes gewartet, nun dreht sie ihren weiß glänzenden Kopf. Sie lässt es hell werden im Zimmer, schaltet Musik ein. Ein Klavierstück aus den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts, »Song for Guy«, Elton John, eine wehmütige Melodie über einer Handvoll Akkorde. »Du hast schlecht geschlafen. Ich möchte deine Vitalwerte messen.«
»Ach, Tracy«, murmelt Gundlach. »Lass mich doch erstmal aufstehen.«
Doch die Roboterdame hat seine Hand schon ergriffen.
»Blutdruck einhundertzehn zu sechzig«, entgegnet sie. »Mangel an Eisen, Vitamin D und B12. Säureüberschuss im Magen. Medikation wie immer.« Sie hält Gundlach ihre weiße Hand entgegen, öffnet sie und gibt den Blick auf eine purpurfarbene Pille in ihrer Handfläche frei. Gundlach nimmt die Tablette. Tracy lächelt und schickt einen Befehl in die Küche. Es soll ein eiweiß- und eisenhaltiges Frühstück sowie einen grünen Matcha geben. Von der Küche dringt ein Summen herüber.
Gundlach ist müde. Ja, er schläft schlecht. Und sein Magen schmerzt. Langsam erhebt er sich und tritt vor den Kleiderschrank.
»Drei Tage wird das Treffen dauern …«, seine Stimme klingt flach.
Tracy rollt heran mit einem Bambuskoffer. »So steht es in deinem Kalender«, sagt sie und räumt Hemden, Anzug, Unterwäsche und Socken in den Koffer.
»Danke«, sagt Gundlach.
Gundlach ist froh über Tracy. Sie ist angenehm un-menschlich, keines dieser chinesischen Robo-Produkte mit Human-Emotionen. Sein alter Freund Seitz, der Soziophysiker, hatte ihm so etwas aufschwatzen wollen. Aber Gundlach ist Witwer, nach sechsundachtzig Jahren Ehe wäre eine Humanoide ihm wie Verrat vorgekommen. Nein, Tracy ist einfach da, sie hilft im Alltag, aber sie versucht nicht, irgendjemanden zu ersetzen.
Gundlach hat inzwischen geduscht, jetzt betrachtet er sein Gesicht im Spiegel. Einige Falten erscheinen ihm tiefer als sonst. Er ist einhundertfünf Jahre alt. Man kann nicht immer siebzig sein, denkt er, da helfen kein Sport, kein Cardio-Studio, keine Vorlesungen und keine Reisen zu Konferenzen. Gute Ernährung hilft.
Sein Küchenroboter, eine Maschine ohne Namen, pflückt mit einem Arm frischen Salat und Kräuter aus der Aquaponik-Anlage, in der Tilapia-Buntbarsche gezüchtet und Nutzpflanzen kultiviert werden. Ein anderer der insgesamt vier Service-Arme verrührt eine weiße, zähe Flüssigkeit in der Pfanne, während zwei Scherenfinger die Kräuter zerkleinern. Ein weiterer Arm streut Gewürze dazu.
»Gerührtes Mungobohnen-Ei an Algen-Spinat-Salat mit Dill«, sagt eine männliche Stimme. »Guten Appetit!«
Gundlach setzt sich in die Nische zwischen Aquaponik-Anlage und Herd. Er wäre gern etwas besser bei Kräften, um die Tage in Paris genießen zu können. Denn eigentlich gehört das Treffen mit den sechs anderen zu den besten Terminen im Jahr. Er ist gespannt darauf, die neuen Spielzeuge in der Wohnung von Michelle zu sehen. Als Agrarwissenschaftler und Ingenieur teilt er ihre Faszination für nachhaltige Alltagstechnik, insbesondere im Bereich Öko-Design. Mit Sicherheit hat die Produktdesignerin wieder ein paar interessante neue Möbel zu präsentieren. Und natürlich freut er sich auf Seitz. Ein brillanter Denker. Es wird hervorragendes Essen geben und beste Weine. Wie immer werden sie bis tief in die Nacht diskutieren.
In diesem Jahr wollen sie über ein historisches Thema reden, über die Jahre der Entscheidungen, damals um 2025, und warum es so kommen musste, wie es kam. Und ob es damals anders gelaufen wäre, wenn nicht Menschen regiert hätten, sondern Algorithmen. Gundlach wird besonders viel beitragen müssen, er ist der einzige Zeitzeuge. Von den sieben Teilnehmern war nur er damals dabei.
Über Computerintelligenz wird er bereitwillig debattieren, denkt Gundlach. Aber über die Erlebnisse vor siebzig, achtzig Jahren redet er nicht gern.
Er trinkt den Tee aus. Der Magen brennt schon etwas weniger.
Tracy rollt den Koffer zur Tür. »Die Reisezeit in der Magnetschwebebahn beträgt zweiundvierzig Minuten und sechzehn Sekunden. Es bietet sich an, eine Meditation zu realisieren.«
»Ja, eventuell.« Gundlach muss lächeln.
Tracy schließt die Augen. »Eine gute Reise, Maximilian.«
Freitag, 19. April 2019
São Paulo/Vila Madalena, Brasilien
Ricardo da Silva interessierte sich nicht für Sex, er hatte keine Freundin, er las keine Bücher, war nicht religiös, er hatte kaum Freunde, trieb keinen Sport, sah nicht gut aus, tanzte nicht gern, hörte keine Musik, interessierte sich nicht für Politik, Autos, Geld, Ruhm, Kunst, Wirtschaft, Filme, Mode – Ricardo da Silva, zweiunddreißig Jahre alt, hatte eigentlich nur eine Leidenschaft in seinem Leben: Er kochte.
Ricardo da Silva, klein, etwas rundlich, Diplomatensohn, Kindheit in China, wollte, solange er denken konnte, nichts anderes sein als ein Koch.
Und dass er eines Tages die Welt retten müsste, daran hätte er im Traum nicht gedacht.
Drittes Jahrtausend, drittes Jahrzehnt in der Geschichte der Menschheit
Das Jahrzehnt zwischen den Jahren 2020 und 2030 war die entscheidende Dekade. Niemals zuvor hatte der Mensch vor einer so schicksalhaften Weichenstellung gestanden. Vor einigen hunderttausend Jahren hatte er seine Karriere begonnen, vom kleinen, schutzlosen, ängstlichen Säugetier zum Herrscher der Erde. Seine Vormachtstellung schien, zu Beginn des dritten Jahrtausends, unantastbar. Aber das war ein Irrtum.
Die Globalisierung war keine neue Erscheinung, sie hatte vor mindestens einem halben Jahrtausend eingesetzt mit der Eroberung und Erschließung der Meere und Kontinente durch Spanier und Portugiesen; doch noch nie waren die Vorgänge auf dem Planeten derart systemisch vernetzt. Noch nie zuvor hatte das, was auf der einen Seite der Erde geschah, so direkte Folgen auf eine Region, ein Land, einen Kontinent – die scheinbar weit entfernt waren.
Die Klimakatastrophe kannte keine Ländergrenzen, keine politischen Autonomien, keine Ideologien.
Nach dem Bericht des Weltklimarats von 2018 würde sich die Erde, selbst wenn alle Regierungen sämtliche im Pariser Abkommen beschlossenen Maßnahmen umsetzten, dennoch bis 2100 um etwa 3,2 Grad aufheizen. Indes war 2019 kein einziges Industrieland annähernd auf dem Weg, seine Klimaziele zu erreichen. Bei einer Erwärmung von drei Grad würden Hunderte Großstädte überflutet, etwa Shanghai, Miami, Hongkong. Die Waldbrände in den USA würden sechsmal so viel Waldland verwüsten.
Würde, nach einer pessimistischen oder vielleicht sogar realistischen Studie der Vereinten Nationen, die Erde sich bis 2100 um acht Grad aufheizen, wären die Folgen kaum vorstellbar.
Feuerstürme würden die Wälder versengen. Zwei Drittel aller Städte auf der Welt würden überschwemmt. Tropische Krankheiten würden wüten. Der Permafrostboden der Arktis, der derzeit noch bis zu schätzungsweise 1,8 Billionen Tonnen Kohlenstoff gleichsam festhält, würde tauen, das CO2 in die Atmosphäre gelangen, die Erde zusätzlich aufheizen.
Die Polarkappen würden immer schneller schmelzen, das Wasser der Ozeane um etwa 1,2 bis schätzungsweise 2,4 Meter steigen, Bangladesch würde versinken, der Markusdom würde versinken, das Weiße Haus würde untergehen, die chinesische Stadt Shenzhen, mit mehr als zwölf Millionen Menschen, würde überflutet.
Und dann würde die Nahrungsproduktion einbrechen, Hunger und Kriege wären die Folge. Das Süßwasser würde knapp werden – knapp in einer Form, die man sich nie vorzustellen gewagt hätte. In einer heißeren, trockeneren Welt würden Aggressionen und Konflikte rapide zunehmen.
Sicherlich würden Menschen überleben, hier und dort. Doch unter welchen Bedingungen? In welcher Science-Fiction-Dystopie würden sie leben müssen? Die Zivilisationen, mit ihrer Schönheit und ihrem Glauben an Vernunft und Zukunft, würden ausgelöscht.
Anfang des 21. Jahrhunderts erlebte das Religiöse eine Renaissance, ausgelöst vor allem durch den Islam, leider auch in seiner verblendeten Erscheinungsform als islamistischer Terror. Aber insgesamt schien, obwohl das atheistische Denken offenbar alle Vernunft auf seiner Seite hatte, die Sehnsucht nach einem Gott zuzunehmen. Nach einem Gott, der sich einschaltet, der den Menschen mit größter, nämlich göttlicher Autorität erklärt, was sie zu tun und zu lassen haben.
Doch dieser Gott zeigte sich nicht, jedenfalls stieg er nicht herab, um die Klimakatastrophe zu verhindern.
Die – nach Gott – mächtigsten Kräfte auf diesem Planeten waren die Weltmächte: China, Russland, die USA. Die Macht, etwas zu entscheiden, konzentrierte sich in den Staatsapparaten – alles in allem waren es einige hundert Männer und einige Frauen, die über das Schicksal der Schöpfung entscheiden konnten.
*
Und unter den Menschen, die in die Zukunft blickten, mit Angst und Grausen, waren einige, die dachten, eine Allianz der Supermächte sei die letzte Chance zur Umkehr.
Samstag, 27. April 2019
Kongresshalle, Peking, VR China
Mistkerle, dachte die Senatorin. Sie war beeindruckt und belustigt. Auf jeden Fall können sie’s besser als wir.
Das Ganze war perfekt organisiert: Jede Limousine mit einer Motorrad-Eskorte in genauer Keil-Formation. Die Polizisten am Straßenrand standen stramm und lächelten. Der Grünstreifen, in einem Bilderbuchgrün, chartreuse, war exakt geschnitten. Wahrscheinlich Rollrasen, sie sindeinfach effizient, unsere chinesischen Freunde und Konkurrenten.
Sie empfand einen Anflug von Neid, lächelte, schüttelte den Kopf.
Es war kaum eine Bewegung, doch ihr Assistent, John Chang, der neben ihr saß, hatte es registriert.
»Alles in Ordnung, Frau Senatorin?«, er sprach mit gesenktem Blick, höflich, besorgt. Die Chinesen waren immer besorgt, dass irgendwas nicht in Ordnung wäre.
»Nein, alles wunderbar. Ich sah nur auf den Straßen die Wide-Screens und die Fahnen und die Banner und dachte: Wow! Wenn wir in Sacramento oder L.A. so eine Konferenz veranstalten, da würde einiges schiefgehen, schätze ich, und es wäre chaotischer, schmuddeliger …«
»Nun, es ist natürlich der Ehrgeiz der überaus weisen Staatsführung und des Volkes, unseren Gästen den besten Eindruck zu vermitteln«, sagte Chang.
Es klingt, als wenn er ein Gedicht aufsagt. Sein Englisch war beinahe akzentfrei.
Er legte seine Hände auf die Knie, parallel. Die Fingernägel waren makellos, wahrscheinlich manikürt.
Sie lächelte ihn an. »Das haben Sie schön gesagt, Mr Chang.«
Er senkte bescheiden den Kopf.
John Chang war ihr von der Botschaft zugeteilt worden, aber mit dem Hinweis: Vermittelt vom chinesischen Außenministerium, wir empfehlen Zurückhaltung. Mit anderen Worten: Chang würde jeden Abend einen Bericht verfassen, ans Außenministerium, an diverse Geheimdienste.
Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien und John Chang, ihr »Assistant On Time«, sozusagen ihr Leih-Assistent für die drei Tage der Konferenz, saßen auf dem Rücksitz einer dunkelblauen Mercedes-S-Klasse, die im Konvoi auf der freigemachten und von Polizisten gesäumten Spur zügig vom »Pangu-Hotel« zur Kongresshalle rauschte. Dass Peking eine versmogte Millionenstadt war, davon merkte man nichts. Der Fahrer war durch eine abgedunkelte Scheibe getrennt. Im Wagen duftete es dezent nach Blumen und Leder. Die Sitze waren weinrot.
Eindeutig eine Sonderbehandlung, dachte die Senatorin. Wie auch das Upgrade im »Pangu«, eine De-luxe-Suite mit Aussicht auf das Geglitzer der Riesenstadt. Das Badezimmer war doppelt so groß wie ihr Büro in Sacramento.
Aber warum?
Die Senatorin war zwar eine auffällige Erscheinung: Mitte fünfzig, lebhaft, schlank, blitzende Augen, ehemalige Staatsanwältin, Tochter einer Tamilin und eines jamaikanischen Wirtschaftsprofessors, Demokratin. Aber in der informellen Hierarchie des internationalen Konferenzbetriebs war sie ein eher kleines Licht.
Der April war sonnig und klar. Die Senatorin blickte aus dem Fenster. Noch mehr Banner, noch mehr Fahnen. Und da war auch schon die Kongresshalle. Die Limousine rollte weich aus. Livrierte Konferenz-Guides und Security-Beamte eilten heran. Die Tür auf ihrer Seite wurde geöffnet, die Senatorin stieg aus. Sie trug ein marineblaues Kostüm, eine Handtasche in demselben Farbton. Sie bemerkte, dass die Limousinen der meisten anderen Konferenzteilnehmer, die vor- oder abfuhren, etwas weniger elegant waren als ihr Wagen.
Sie blickte auf die Männer, die sie in Empfang nehmen sollten und sich in respektvoller Distanz, genau drei Meter vor ihr, verbeugten, und sie sagte sehr laut: »Nin hau!« Kaum hatte sie den Morgengruß ausgesprochen, hoben sich etliche Köpfe, hier und da sah sie ein vorsichtiges Lächeln.
Na also, auch wenn uns die Chinesen in Sachen Wirtschaftsleistung und Organisation inzwischen den Rang ablaufen – aber das immerhin können wir Amerikaner: Wir können nett sein.
Die Konferenz war auf drei Tage angesetzt, Thema: »Die neue Seidenstraße«, das geliebte Großprojekt des Staatspräsidenten Xi Jinping, seit sechs Jahren arbeiteten die Chinesen bereits daran. Neue Handelswege zwischen Asien und Europa, neue Schienenverbindungen, Straßen, Kreditvergaben für Länder auf dem Weg oder abseits, Infrastrukturprojekte. Nach Jahrzehnten des Aufholens und der Konzentration auf die innere Entwicklung nahm China nun den Rest der Welt in den Blick. Immerhin war das Reich bis Anfang des 19. Jahrhunderts die Nummer eins gewesen, so sahen es jedenfalls die Chinesen. Und würde es wieder sein.
Daher die Konferenz. Sie war der Begegnung, den Arbeitskreisen gewidmet – aber vor allem einer Botschaft: Wir treten an, wir streben nach ganz oben.
Vertreter aus hundert Ländern, darunter fast vierzig Staats- und Regierungschefs. Eine einfache Senatorin aus Kalifornien gehörte eigentlich eher zum Konferenz-Fußvolk und verdiente keine Sonderbehandlung; aber offenbar wussten die Chinesen etwas, was nicht viele wussten.
Vor den Sicherheitskontrollen, Körperscans, Taschenscans gab es einen leichten Stau. Die Senatorin sah arabische Delegierte in ihren blütenweißen Dischdascha-Gewändern, afrikanische Politiker in ihren langen, buntgemusterten Hemden, und da war auch die Prinzessin von Tonga, gewandet in eine Art traditionelles, mit Muscheln besetztes Südseekleid, lächelnd nach allen Seiten. Tonga, der polynesische Inselstaat, lag zwar nicht wirklich an der Seidenstraße, eigentlich überhaupt nicht – aber hierin waren die Chinesen nicht kleinlich. Die Senatorin sah einige Bekannte: Da war dieser italienische Diplomat, den sie von anderen Konferenzen kannte, er hatte ständig mit ihr flirten wollen. Dort stand der ehemalige deutsche Bundespräsident, groß, blond, freundlich, den sie sympathisch fand, sie winkte ihm zu, er winkte zurück.
Die Haupthalle war im zweiten Stock. Die Senatorin legte jetzt ihre Handtasche auf das Scanner-Band. Sie merkte, dass sie tatsächlich etwas aufgeregt war.
Montag, 3. Mai 2100
15 Quai de la Tournelle, 5. Arrondissement, Paris, Frankreich
Diese Frau weiß, wie man Gäste beeindruckt, denkt Gundlach, als er Michelles Wohnung in Paris betritt.
Ein Baum, mitten im großen Empfangszimmer, bedeckt mit hellgelben und mintfarbenen Flechten. Auf dem Tisch, groß, aber nicht wuchtig, wahrscheinlich Kunstholz, liegen Früchte, blutrot, veilchen- oder fliederfarben – alles so, als läge es in zufälliger Ordnung und die Farben würden nur aus Versehen perfekt zueinander passen. Pflanzenfasern auch an den Wänden, neben den Sesseln und Sofas stehen weiße Behälter mit Tomatenstauden und Paprika. Kleine alte Kulturpflanzen, wie sie früher überall wuchsen.
Dann sieht Gundlach das Aquarium. Es ist so groß, dass man es im ersten Moment für eine Fensterfront halten könnte oder für eine Monitorwand. Darin: ein Oktopus. Knapp einen Meter lang, auf der Haut ein hellrot-weißes Streifenmuster, unterbrochen von einer Art Gitterstruktur aus gleichmäßig verteilten hellen Punkten und dunkleren Partien. Am Kopf des Tieres sitzen mit weitem Abstand voneinander rechts und links die Augen, deren Lider geschlossen sind. Sie müssen gut zehn Zentimeter messen. Direkt darunter beginnen die schlanken, sich bis zum Ende verjüngenden acht Arme.
Michelle steht am Tisch. »Maximilian Gundlach!«, ihre Stimme klingt noch heller, als er es in Erinnerung hatte, und als er in Michelles Gesicht blickt, kann er es kaum glauben. Die Vitamin-Infusionen allein können es nicht sein.
»Du siehst aus, als hättest du gerade dein Abitur gemacht, Michelle! Unglaublich!«
Die Französin trägt ein indigofarbenes Seidenkleid, das an einer Seite nur bis zur Mitte der Oberschenkel reicht und an der anderen bodenlang ist. In ihrem Ausschnitt blitzt es hellrot, echte Mars-Steine.
Michelle ist Direktorin der Pariser Hochschule für Nachhaltige Ästhetik. Ihre Arbeiten im Bereich konvivialer Technik – attraktive lebensfreundliche Alltagsgegenstände – haben sie berühmt gemacht.
»Darf ich dir Lionel vorstellen?«, fragt sie.
Für einen Augenblick glaubt Gundlach, dass Michelle tatsächlich einen Mann gefunden haben könnte, der ihrer Perfektion standhalten könnte. Er verkneift sich aber einen spöttischen Satz.
Michelle lächelt. »Lionel ist vorgestern eingezogen!«, sagt sie, legt ihre Hand an das Becken. Der Oktopus tastet mit einem Arm von innen an ihr entlang. Michelle hakt sich bei Gundlach ein, wendet sich an die anderen im Raum. »Nun wird es aber ernst, ihr Lieben«, ruft sie. »In fünf Minuten beginnt die Führung!«
Erst jetzt nimmt Gundlach die anderen wahr. Er geht hinüber zu Robert Glass und Ann Georgii, die mit Tassen in den Händen an der Tafel stehen. Er begrüßt die beiden und gibt sich Mühe, nicht zu väterlich zu wirken. Immerhin ist er doppelt so alt, ungefähr. Gundlach gratuliert Robert zu seiner Auszeichnung. Er muss sich immer wieder klarmachen, dass auch Menschen um die fünfzig bereits Top-Leistungen abliefern. Robert, der Deutsch-Amerikaner, hat gerade den »Next Green Leadership«-Award für sein Engagement in der Förderung nachhaltiger High-Speed-Start-ups gewonnen. Robert berät junge Absolventen aus Wirtschaft und Technik, er bewegt Menschen tatsächlich zu erstaunlichen Leistungen. Immer geht es um die Verbindung von Sozialem und Technik. Seine Berufsbezeichnung: Wirtschaftsphilosoph.
Die Schwedin Ann ist ebenso erfolgreich. Sie hatte den weltweit größten Veränderungsprozess eines Gesundheitssystems begleitet, eine virtuelle Hochschule für Change Management im Gesundheitswesen gegründet und nebenbei eine Arbeit über vollständig abbaubare Impfstoffe fertiggestellt. Obwohl sie noch keine vierzig ist, wirkt Ann mit ihrem schlichten hellgrauen Kostüm fast älter als ihre Kollegen. Sie ist klein, schmal, still, aufmerksam.
An der anderen Seite der Tafel stehen Anjana Tiwari und Ilyana Lubalka und sehen so aus, als hätten sie die Phase des freundlichen Smalltalks bereits verlassen und wären beim Streit angekommen. Es wäre nicht das erste Mal, und stets geht es um das gleiche Thema: Wie sehr darf das Gehirn eines Menschen digitalisiert und verbessert werden – und wie viel Macht darf so ein Gehirn haben? Diese Diskussion war eigentlich für etwas später vorgesehen.
Ilyana, hager, strenger Blick, bis zur Humorlosigkeit sachlich, eine russische Neurologin und Kognitionsforscherin. Sie hat ein Verfahren entwickelt, das die technische Erweiterung neuronaler Netzwerke im Gehirn durch Computerchips vereinfacht. Zudem arbeitet sie an der Optimierung des »Mind Uploading«, bei dem ein Back-up des Bewusstseins auf einem externen Medium gespeichert wird. Für sie ist klar: Bei den meisten Prozessen ist künstliche Intelligenz den Menschen längst hoffnungslos überlegen. Aber wenn man das Gehirn unkompliziert upgraden kann, dann würden die Menschen wenigstens den Anschluss halten.
Ilyana ist vor drei Jahren in den medizinischen Fachausschuss der Weltregierung berufen worden, und bei der ersten Ausschusssitzung hatte sie den anderen Mitgliedern und Gästen, darunter immerhin zwei Ministerinnen, eine Spritze gezeigt, die mit einer bläulichen Flüssigkeit gefüllt war. »Meine Damen und Herren«, hatte sie gerufen, »diese Spritze ist etwa so groß wie ein durchschnittlicher Hippocampus, das ist der wichtigste Teil in Ihrem Gehirn. Und dieser Tropfen« – dabei drückte sie ein wenig Flüssigkeit aus der Spritze – »ist nur die Kühlung für einen Chip, den Sie nicht erkennen können. Aber der ist klüger als wir alle hier zusammen.« Sie blickte zu den Ministerinnen: »Es stellt sich also die Frage, warum Sie beide hier Entscheidungen fällen, und nicht dieser Tropfen.«
Anjana hatte den Auftritt damals verfolgt, sie ist aber prinzipiell anderer Meinung. Als Juristin stellt sie andere Fragen, grundsätzlichere: Wer darf Recht schaffen, und zu welchem Zweck?
Anjana stammt aus Indien, sie gehört seit einigen Jahren dem »Internationalen Komitee für Migration und Minderheitenrechte« an. Die Geschichte ihrer Familie ist die Geschichte von Ungleichheit, vom Kampf um Gerechtigkeit.
»Was sagt ihr zu Michelles neuem Mitbewohner?« fragt Gundlach. »Ist er nicht ein erstaunliches Geschöpf?«
Die beiden Frauen halten inne, Anjana lächelt. Ihre Haut ist glatt und ohne jede Falte, ihre Haare noch immer natürlich pechschwarz. Anjana schaut hinüber zum Oktopus und nickt.
»Ja, absolut. Und zum Glück ist er auch eigensinnig genug«, sagt sie. »Mit dem wird sich Michelle sicher nicht so schnell langweilen.« Ilyanas Miene bleibt ernst. »Die Frage ist wohl vielmehr, ob er sich nicht bald mit ihr langweilt.« Die Russin wendet den Blick nach unten. Auf ihrer Handinnenfläche wird eine projizierte Tastatur sichtbar, die von ihrer Kontaktlinse gesteuert ist. Sie beginnt zu tippen.
»Es deutet manches darauf hin, dass Tintenfische uns intellektuell in einigen Bereichen überlegen sind«, sagt Ilyana beiläufig. »Insbesondere im konstruktiven Umgang mit zunehmend komplexen Realitäten …«
Jetzt unterbricht Michelle. »Na, seid ihr schon hungrig? Dann folgt mir unauffällig!« Michelle schreitet durch einen hellen Gang, Robert und Ann, Anjana und Ilyana schließen sich an.
Dann folgt Gundlach. Aus einem anderen Raum tritt plötzlich Seitz neben ihn. Der Soziophysiker verzichtet wie immer auf die Begrüßung. Dass er neben Gundlach geht, gilt für seine Verhältnisse bereits als Herzlichkeit. Gundlach kann sich gerade noch zurückhalten, dem jungen Kollegen auf die Schulter zu klopfen. Für Seitz ist Körperkontakt unnötig, Smalltalk überflüssig.
Seitz untersucht digitale Methoden zur Erreichung gesellschaftlicher Ziele, soziale Kompetenzen künstlicher Intelligenz und die Vorhersagbarkeit von Gruppenprozessen. Der Vierunddreißigjährige lehrt in Oxford, Chicago und am »Massachusetts Institute of Technology« – in virtuellen Vorlesungen von seiner Wohnung aus, die sich im fünfzehnten Stock eines Züricher Hochhauses befindet. Es hat den Vorteil, dass er echte Kontakte vermeiden kann.
Sie betreten die Küche, die geradezu steril wirkt, ganz anders als der Salon. Es riecht nicht einmal nach Küche. Nur ein paar Lebensmittel liegen auf dem Tisch, daneben steht eine Maschine, die wie ein überdimensionaler Mixer aussieht. »Die Küche ist übrigens zu hundert Prozent aus Bestandteilen der Sonnenblume gefertigt«, erklärt Michelle und streicht mit der Hand über die hellgrau marmorierte Arbeitsplatte. »Die Möbel bestehen aus gepressten Rindenfasern des Stiels, die mit einem Lack aus Sonnenblumenkernen imprägniert werden«, erläutert sie. Dann geht sie auf Ilyana zu und hält eine Art rechteckigen Stab in die Luft, in dessen Mitte sich Lichtstreifen in verschiedenen Farben befinden. »Würdest du meine Freiwillige sein, Ilyana?«, fragt sie die Russin.
»Solange es der Wissenschaft dient«, entgegnet diese.
Die Gruppe lacht.
Ilyanas Haar leuchtet im weißen Licht der zahlreichen Deckenlampen.
Michelle übergibt ihr eine winzige Tablette und ein Glas Wasser.
»Bitte schlucken!«
Ohne Zögern folgt die Neurologin der Anweisung.
Nach einigen Momenten der Stille scannt Michelle mit dem Stab ganz langsam den Bauch der Kollegin. Es piept, und Michelle verkündet das Ergebnis: »Verehrte Frau Lubalka, Sie benötigen jetzt eine Mahlzeit mit 48,6 Prozent vollwertigen Kohlenhydraten, 27,3 Prozent Eiweiß und 24,1 Prozent Fett aus möglichst dreifach ungesättigten Fettsäuren. Darin sollten 2 700 Milligramm Kalium, 865 Milligramm Calcium, 11 Milligramm Eisen und 98 Milligramm Vitamin C enthalten sein. Weitere Inhaltsstoffe lesen Sie bitte hier im Detail.« Michelle gibt Ilyana den Stab.
Michelle steigt auf eine kleine Treppe neben der Maschine. Sie zieht eine Schublade auf und holt kleine eckige Glasbehälter hervor. »Das sind Konzentrate, die meine Maschine aus Lebensmitteln gewinnt«, erläutert sie. Sie hält ein Glas mit tiefroter Substanz in die Höhe: »Rote Beete«; dann eines mit dunkelgrünem Inhalt: »Alge«; und schließlich eines mit einer weißlichen Füllung: »Mehlwurm«.
Gundlach dreht sich weg. Mehlwurm und Heuschrecken gehören zu den modernen Grundnahrungsmitteln, die ihm auch nach Jahren noch fremd sind.
Michelle steigt wieder herunter, tippt unten an der Küchenmaschine etwas ein. Es summt, Wasserdampf steigt auf, Zutaten gleiten auf eine Platte. Keine zwei Minuten später holt Michelle einen dampfenden Teller aus dem Kochfach: Auf hellgrünem Schaum gebettet liegen zwei Hälften einer melonenhaften Frucht, darüber ein hauchdünnes Netz aus gelben Fäden. Michelle reicht Ilyana den Teller und einen kleinen Löffel.
»Nicht schlecht«, sagt die Russin, »geschmacklich intensiv, neuartige Konsistenzen, reife Ästhetik.«
»Und das Beste ist«, fährt Michelle fort, »hier handelt es sich um eine Zero-Waste-Produktion, vollkommen abfallfrei.«
Michelles Wohnung ist ein Musterhaus. Abfälle werden verstromt oder zu Dünger für Gemüse, Obst und Fasern verarbeitet. Gas aus der Vergärung treibt wiederum die Küchenmaschine an; was dann doch übrig bleibt, wird zu Farbpigmenten zermahlen und von Michelle beim Malen benutzt. Denn zu allem Überfluss malt sie auch noch.
»Das System ist eine Kooperation unserer Hochschule mit den Kollegen von der technischen Fakultät der Uni Beijing und dem makrobiotischen Institut in Melbourne. Ihr habt die Ehre, die Anlage mit mir einzuweihen. Der Nächste bitte!«
Später, beim ersten Wein im Salon, wird es offiziell. »Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass ihr mich dieses Jahr hier in Paris beehrt«, sagt Michelle. »Es ist unser siebtes Treffen, und es war längst an der Zeit, dass ich euch hier empfange. Und keine Sorge, wir werden nicht jeden Abend in meiner Versuchsküche essen.«
Glück gehabt, denkt Gundlach.
»Unten im Haus liegt das wunderbare Restaurant ›La Tour d’Argent‹. Es existiert seit dem Jahr 1582. Dort habe ich den Tisch reserviert, an dem schon Bismarck, Zar Alexander II. und der preußische König, Wilhelm I., der spätere deutsche Kaiser, gemeinsam dinierten.«
Sie hebt das Glas: »Auf eine gute Zeit! Santé! Ich übergebe an unseren Moderator. C’est à toi, Robert.«
Robert erhebt sich und prostet der Runde ebenfalls zu.
»Die Freude ist ganz auf unserer Seite, Michelle. Merci beaucoup!« Alle erheben die Gläser und prosten erst Robert und Michelle zu und dann in Richtung des Aquariums.
Robert fährt fort: »Wie angekündigt, werden wir uns bei unserem Treffen der wahrscheinlich wichtigsten Frage unserer Zeit widmen und dabei selbstverständlich auch einen Blick in die Geschichte werfen. Insbesondere auf die Zeit, die die Menschheit revolutionierte, wie kaum eine andere.« Der Wirtschaftsphilosoph ist jetzt in den Vorlesungsmodus gewechselt. »Eine Zeit, in der diese Welt, wie wir sie heute erleben und schätzen, um ein Haar zerstört worden wäre. Wir kümmern uns vor allem um zwei Fragen: Wie entscheidend war es, dass einige wenige Regierungen die Führerschaft übernahmen und die Welt unter sich vereinigten? Und welche Entscheidungen hätte eine künstliche Intelligenz früher oder besser getroffen?«
Robert wendet sich an Gundlach: »Du warst damals dabei, als Einziger von uns. Wie war das? Man wusste doch, wie es um die Welt stand, oder?«
Gundlach zögert. »Ja natürlich. Die Fakten waren ja klar. Waldbrände in Russland, Australien, Smog in China – das war der Klimawandel, der auch nach Europa kommen würde. Jeder wusste das. Und trotzdem verbrauchten wir fossile Energien und heizten die Erde auf. So kehrten auch Krankheiten zurück, die lange Zeit als ausgestorben galten …«
Gundlach stellt jetzt sein Glas auf den Tisch, er braucht beide Hände zum Gestikulieren. »Wir hatten von den Tropenwäldern gelesen. Wir wussten, dass kein vernünftiges Wesen sich die Lunge herausreißen würde und dass Amazonien die Lunge unseres Planeten war. Aber was sollten wir tun, wenn jedes Land und jede Regierung immer nur an sich dachte?«
Pause.