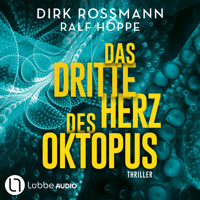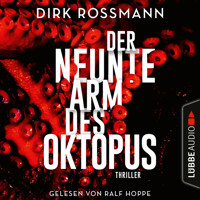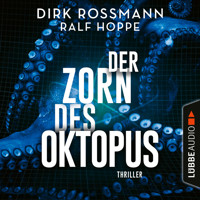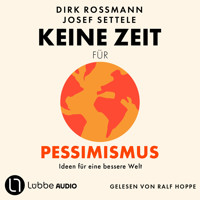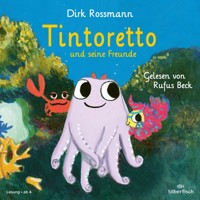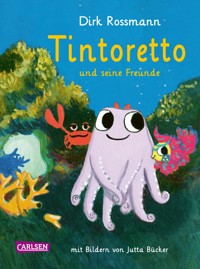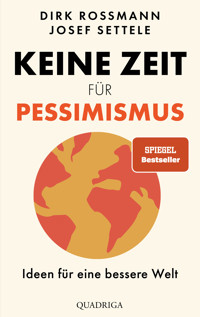
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Ein Insektenforscher und ein Unternehmer schreiben gemeinsam ein Buch? Großartig! Seitenweise kreative Lösungen. Zeit zum Lesen, Staunen und Handeln.« Dr. Eckart von Hirschhausen
Der Kampf gegen den Klimawandel wird nebenan geführt. Erfinderinnen und Denker, Wissenschaftler und Ingenieurinnen machen mit ihren Ideen und Projekten Mut. Dirk Rossmann und Josef Settele haben sie für dieses Buch besucht, mit ihnen gesprochen und ihre Geschichten aufgeschrieben.
Entstanden ist daraus eine beeindruckende Erzählung über Helden zum Anfassen. Eine Erzählung über ihre Innovationen, ihre Zähigkeit, ihre klugen Einfälle, aber auch über ihren Alltag, ihre Normalität.
Die Autoren machen Hoffnung. Und diese ist, neben aller Tatkraft und allen Ideen, von absoluter Wichtigkeit. Nur mit ihr hat unser aller Einsatz für unsere Lebensgrundlagen Aussicht auf Erfolg.
»Ein Buch aus den Händen dieser Autoren ist eine inspirierende und wichtige Hoffnungsquelle.« Maria Furtwängler
»Bewegende Geschichten über Erfindungen von riesiger Bedeutung. Ein großes Lesevergnügen.« Prof. Dr. Hans-Werner Sinn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorenTitelImpressumZeit für OptimismusMikroplastik – Der Blasen-FlüstererTiny Forests – Die WaldmacherErsatz für Palmöl – Der Palmöl-ErfinderSchule & Lernen – »Es hieß, das ist der Sexclub von der Rasfeld.«Kreislaufwirtschaft für Plastik – Die gute NachrichtInsekten als Proteinquelle – Die Herrin der FliegenNeue Antibiotika – Die DNA-DetektiveKupfer sparen in Batterien – Zwei Männer, ein GedankeTransformation – »Natürlich darf man hoffen!«Moore als Kohlendioxidspeicher – Die Liebe zum MoorEnergieeffizienz IT – Der ProblemlöserNachhaltigkeit – Was macht eigentlich Rossmann?Erhalt der Lebensgrundlagen – Was macht eigentlich Settele?AnmerkungenDanksagungTafelteilÜber dieses Buch
Der Kampf gegen den Klimawandel wird nebenan geführt. Erfinderinnen und Denker, Wissenschaftler und Ingenieurinnen machen mit ihren Ideen und Projekten Mut. Dirk Rossmann und Josef Settele haben sie für dieses Buch besucht, mit ihnen gesprochen und ihre Geschichten aufgeschrieben.
Entstanden ist daraus eine beeindruckende Erzählung über Helden zum Anfassen. Eine Erzählung über ihre Innovationen, ihre Zähigkeit, ihre klugen Einfälle, aber auch über ihren Alltag, ihre Normalität.
Die Autoren schüren Hoffnung. Und diese ist, neben aller Tatkraft und allen Ideen, von absoluter Wichtigkeit. Nur mit ihr hat unser aller Einsatz für unsere Lebensgrundlagen Aussicht auf Erfolg.
Über die Autoren
Dirk Rossmann, geboren 1946, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Schriftsteller, unter anderem Mitgründer der »Deutschen Stiftung Weltbevölkerung«. Bisherige Veröffentlichungen: »… dann bin ich auf den Baum geklettert!« (2018) und »Der neunte Arm des Oktopus« (2020). Seine Autobiografie wie auch der Thriller erreichten Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Dirk Rossmann setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein.
Josef Settele – Der Agrarökologe, geboren 1961, ist Departmentleiter am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und Professor für Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seit 2020 ist er Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU). Josef Settele beschäftigt sich mit der biologischen Vielfalt und deren Schutz und Nutzung. Er hat insgesamt über 500 Fachartikel und Bücher veröffentlicht.
D I R K R O S S M A N NJ O S E F S E T T E L E
KEINE ZEIT
FÜR
PESSIMISMUS
Ideen für eine bessere Welt
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an:[email protected]
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Ralf Hoppe, Dominique Pleimling
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Einband-/Umschlagmotiv: © FinePic®, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-7596-0
luebbe.de
lesejury.de
Zeit für Optimismus
Ralf Hoppe
Ich habe einen Freund, der immer alles anders macht als alle anderen Leute: Wenn alle nach links rennen, dann schiebt er die Hände in die Hosentaschen und pfeift sich eins und schlendert nach rechts. Wenn die anderen erfolgreichen Damen und Herren seines gesetzten Alters den wohlverdienten Ruhestand antreten und zum Beispiel Rosen züchten, dann sagt er: Ach was, jetzt geht’s erst richtig los! Wenn alle anderen ein und derselben Meinung sind, dann denkt er kurz nach und sagt: Ich seh das ganz anders.
Dieser seltsame Freund – es ist Dirk Rossmann, einer der beiden Autoren dieses Buches, aber das war jetzt auch nicht so schwer zu erraten – kennt keinen Stillstand. Irgendwas treibt Dirk immer um, interessiert ihn, fesselt ihn, ruft nach Umsetzung. Und dass er dabei eine glückliche Hand hätte, das kann man getrost als Untertreibung durchgehen lassen. Er ist in den Erfolg verliebt – und der Erfolg in ihn. Er gründet eine kleine Firma, und es wird gleich ein Konzern daraus, mit 65.000 Mitarbeitern. Er schreibt eine Biografie und drei Klima-Thriller, zwei davon mit mir, und es werden gleich Bestseller, in viele Sprachen übersetzt, mit Millionenauflage. Er spricht vor Publikum, und obwohl er das nie gelernt, geübt hat, liebt das Publikum ihn.
Ich weiß noch, wie Dirk von den Zuschauern gefeiert wurde, bei einer Lesung im Hamburger Schauspielhaus, mit Standing Ovations, und das hat seinen Grund: Er ist, so unkonventionell er auch denkt und handelt, ein Menschen-Mensch, er trifft den Ton, er versteht Menschen, weil er sie mag.
Dies ist ein persönliches Vorwort, und man mag es mir verzeihen, wenn ich erstmal meine persönliche Freundschaft zu Dirk angesprochen habe – und mein Bild von ihm. Denn dieses Bild ist wichtig, um über dieses Buch zu sprechen, »Keine Zeit für Pessimismus«.
Weil dieses Buch nicht irgendein Buch ist.
Dirk hat also nachgelegt, wieder im Team, aber diesmal mit einem großartigen Wissenschaftler, Insektenforscher und Biodiversitätsexperten, nämlich Prof. Dr. Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Die beiden haben das Buch geschrieben, gemeinsam natürlich, es ist ein Sachbuch, bei dem Prof. Settele aus seiner Arbeit beim IPCC, dem Weltklimarat, beim IPBES, dem Weltbiodiversitätsrat, und als Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung seine Expertise selbst bei komplexen Sachverhalten beisteuerte. Während Dirk, als Unternehmer, Bestsellerautor, das Konzept verantwortete – und immer ein Auge darauf hatte, was Leserinnen und Leser gerne lesen würden. Und wie man es erzählt. Es ist zwar ein Sachbuch, aber es steckt mehr Plot und Spannung und Thrill darin als in vielen Krimis. Und vor allem ist die Idee originell.
»Keine Zeit für Pessimismus«, so haben die beiden Autoren das Buch betitelt. Und das ist nicht rhetorisch gemeint. Sondern die Autoren wenden sich mit Engagement gegen ein Klima der Resignation und Schwarzmalerei. Wie eingangs beschrieben: Wenn Dirk sieht, dass alle in die eine Richtung laufen, in Richtung Verdruckstheit und Pessimismus und Kopf-hängen-lassen, dann marschiert er genau gegen den Trend, in diesem Fall gemeinsam mit seinem Co-Autor Josef Settele.
Und was ist das Gegenteil von Pessimismus? Nun, das ist keine sehr schwierige Frage. Optimismus, Zuversicht, die Bereitschaft, sich anzustrengen, zu kämpfen. Natürlich sieht es beileibe nicht gut aus auf der Welt: Die Veränderungen, die der Klimawandel zeitigt, werden spürbar, die Ökosysteme des Planeten sind unter Druck, Kriege und politische Krisen aller Couleur beherrschen die Politik und halten uns ab von den dringenden Problemen der Menschheit. Da kann man schon pessimistisch gestimmt sein. Und wo soll der Optimismus herkommen?
Scheinbar schwierige Frage, dabei gibt’s eine einfache Antwort, die Autoren geben diese Antwort: aus uns selbst. Nur wir Menschen, die wir den Schlamassel, um ein mildes Wort zu gebrauchen, angerichtet haben, können die Probleme auch wieder lösen. Und das müssen wir, für die künftigen Generationen. Kein grünes Männchen wird vom Himmel schweben, um uns den Weg zu weisen. Wir müssen das selbst hinkriegen, dazu müssen wir uns verständigen, einigen, Strategien entwickeln, umsetzen.
Zum Glück gibt es einige Zeitgenossen unter uns, die dazu Ideen haben, die dazu forschen, die als Unternehmer Mut zeigen, Verantwortung übernehmen, Macher sind. Es sind besondere Menschen, zugegeben; vielleicht (oder wahrscheinlich sogar) sind sie ein wenig klüger, kämpferischer, mutiger als du und ich. Trotzdem sind sie nicht vom Himmel gefallen, sondern Menschen von nebenan.
Von ihnen handelt dieses Buch.
Es ist eine Sammlung von Porträts, Begegnungen, Interviews mit Frauen und Männern, die man zwar bei der Fleischtheke in Essen trifft oder die man in ihrem winzigen Büro in Eberswalde besucht, deren Lebensentwürfe und deren Wirken aber für das Wohl der Gesellschaft, der Menschheit gedacht sind – und womöglich entscheidend. Da gibt es zum Beispiel den Professor Klankermayer, Chemiker, den wir kennenlernen, der in Aachen mit einem Team eine völlig neue Recyclingtechnologie entwickelt. Da gibt es eine Margret Rasfeld, die an Konzepten feilt, wie Schülerinnen und Schüler besser, selbstwirksamer und glücklicher lernen. Da gibt es einen gewissen Stefan Scharfe, Forstwirt aus Eberswalde, der mit seinen Kollegen »Tiny Forests« in den Städten pflanzt, »Urwälder«, die das Leben in den Metropolen gesünder, schöner machen, die außerdem für Biodiversität ungemein hilfreich sind. Da gibt es Pierre Stallforth aus Jena, Biochemiker auch er, der einen Weg findet, um neue und dringend benötigte Antibiotika herzustellen – aus Bakterienresten in den Zähnen von Neandertalern. Oder Dr. Manfred Danziger, der gemeinsam mit seinem Partner Dr. Karl Gerhold eine Technik auf den Weg bringt, die die Batterien billiger, rohstoffsparender, effizienter macht.
Wir lernen in diesen Begegnungen auch die Menschen kennen, wir lesen, was sie antreibt, woher sie kommen, wer sie sind. Das ist spannend, denn es sind Einblicke in die Lebensläufe besonderer Menschen.
Und nebenbei lernt man auch noch eine ganze Menge darüber, wie kniffelig und aufreibend diese Arbeit ist. Wir lernen, wie ein DNA-Puzzle eines Bakteriums aus dem Zahn eines Neandertalers zusammengesetzt wird. Wir lernen auch, wie eine Lithium-Ionen-Batterie wirklich funktioniert, ja, wir tauchen ins Innere einer Batterie und sitzen neben den Lithiumionen gleichsam auf dem Sofa, verrückt genug – wir erfahren aber auch, warum man das wissen sollte, wenn man eine Batterie neu erfindet.
Das Buch ist also eine Wundertüte: Hier fischt man ein Stückchen Information, dort trifft man eine faszinierende Frau, hier einen großartigen Mann. Zwölf kurze Kapitel, nicht ganz anspruchslos, und alle zusammen ergeben »Sesamstraße für Erwachsene«, ein Ausdruck, den Dirk mag, frei nach dem Titelsong: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum – wer nicht liest, bleibt dumm. Wer aber dieses Buch liest, wird unterhalten und lernt dazu.
Und man tankt sogar Optimismus. Gut so. Können wir gebrauchen.
Ralf Hoppe war viele Jahre Journalist (u. a. Der Spiegel, Die Zeit), er wurde für seine Reportagen aus Kriegs- und Krisengebieten und Essays vielfach ausgezeichnet. Mit Dirk Rossmann verfasste er gemeinsam zwei der Thriller aus der Oktopus-Trilogie. Ralf Hoppe lebt in der Lüneburger Heide.
Mikroplastik
Der Blasen-Flüsterer
Bad Lippspringe
Die folgende Geschichte ist recht ausführlich, das Thema verdient es. Aber die Geschichte lässt sich auch in einem einzigen Satz zusammenfassen; einem ziemlich einfachen Satz, bestehend aus sieben Worten. Mit einem Namen, einer Stadt, einem Verb, einem Substantiv, und das ist dann auch schon alles.
Der Satz lautet: Roland Damann aus Paderborn bekämpft das Mikroplastik.
Und davon handelt diese Geschichte.
*
Der Satz ist, wie erwähnt, recht simpel, und doch steckt dahinter eine Lebensaufgabe – ein wahrhaft herkulisches Projekt ist damit verbunden, ein Projekt, dem dieser ungewöhnliche Mann sich verschrieben hat, mit Leib und Seele. Es ist wirklich kein Wunder, dass er ein sehr besonderer Typ ist, dieser Roland Damann; er schuftet für diese Mission, er bringt vierzig Jahre Erfahrung ein, er schultert Risiken, obwohl er nicht mehr jung ist, obwohl er es auch gar nicht nötig hätte, jedenfalls finanziell nicht, er könnte von morgens bis abends Golf spielen oder Champagner trinken und aus dem Fenster gucken, doch das will er gar nicht.
Denn er hat nun mal diesem Zeug, dem Mikroplastik, den Krieg erklärt. Und um das zu erzählen, muss man ein wenig ausholen. Erste Erkenntnis: Der Gegner, den Damann sich erkoren hat – dieser Gegner ist tückisch, unsichtbar und überall.
*
Mikroplastik – jeder und jede hat das Wort schon mal gehört, inzwischen. Es ist winzig, leicht, körnig, wie Sand oder Staub, aber mit weniger Masse, kommt von allen Seiten, findet sich an sehr unerwarteten Stellen, es wird – zum Beispiel – von Kunstrasen-Sportplätzen aufgewirbelt, es wird vom Wind davongetragen, »äolisch«, sagen die Fachleute. Es landet, vom Winde verweht, vom Regen hinabgespült, auf Walmdächern von Neubausiedlungen, es senkt sich auf Kinderspielplätze, Marktstände und Schwimmbäder, es wird vor allem natürlich von Auto- und Flugzeugreifen abgeschmirgelt, denn Reifenabrieb ist der hauptsächliche Verursacher für Mikroplastik. Jedes Jahr gelangen pro Bundesbürger etwa 1,2 Kilogramm Reifenabrieb in die Umwelt. Rund ein Kilo: Das entspricht etwa einem ordentlich gefüllten Suppenteller.
Mikroplastik wird außerdem von Schiffstauen an Kaianlagen verrieben und verraspelt und rieselt ins Hafenbecken, es wird von Duschpeelings und Möbelpolituren und Handreinigungspasten in den Abfluss geschwemmt, in Kläranlagen gespült – und es landet sodann auf Feldern und zu einem großen Teil in den Ozeanen und Seen, an Stränden und in Flussmündungen.
Ja, sogar in einer der tiefsten Regionen der Erde wurde Mikroplastik entdeckt, im Marianengraben, östlich der Philippinen, etwa 7000 Meter unter dem Meeresspiegel, in ewiger Dunkelheit und grausiger Kälte: Dort fanden die Australier Alan Jamieson und Johanna Weston von der Universität Newcastle einen Flohkrebs, eine bislang unbekannte Gattung. Das Tierchen ist etwa vier Zentimeter lang, schuppig, eher stumpfsinnig, nicht sehr ansehnlich, vor allem aber hatte es eine Plastikfaser in seinem Dickdarm, bestehend aus Polyethylenterephthalat, kurz: PET. Dieses PET wird für Kunststoffflaschen verwendet, für Folien und Sportkleidung. Wie der kleine Bursche, der Krebs am Ende der Welt, diese Faser verschlucken konnte, lässt sich natürlich nicht klären. Die Forscher tauften das Geschöpf Eurythenes plasticus.
Weniger überraschend – aber vielleicht sogar bestürzender – ist es hingegen, dass auch wir Menschen, die den Kunststoff in die Welt setzten, inzwischen Plastik im Körper haben: etwa im Blut. Ein Forscherteam der Vrije Universiteit Amsterdam untersuchte 22 Blutproben bei menschlichen Versuchspersonen, davon waren 17 Proben deutlich mit Mikroplastik kontaminiert, PET, Polystyrol, Polyethylen. 17 von 22 Proben, das sind 77 Prozent.
Und auf den ganzen Planeten bezogen?
Wie viel Mikroplastik gelangt in die Umwelt, jeden Tag, jede Minute? Die Schätzungen differieren, das ist nicht überraschend, weil Definitionen und Messmethoden oft sehr unterschiedlich sind. Nach Schätzungen der Weltnaturschutzunion (IUCN) sind es zwischen knapp zwei und fünf Millionen Tonnen jährlich – nur an Mikroplastik. Und nach einer Studie des WWF aus dem Jahr 2019 nimmt jeder Mensch auf dem Planeten im Schnitt und pro Woche fünf Gramm Mikroplastik auf.
Das wäre ungefähr eine geschredderte, zermahlene Kreditkarte. Ein gehäufter Teelöffel etwa. Jede Woche. Natürlich wird es zum größten Teil ausgeschieden, mit Kot und Urin; aber wahrscheinlich nicht alles. Und hier gibt es noch viele Fragen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viel von dem ausgeschiedenen Mikroplastik abermals »zurückkommt«, wieder aufgenommen wird. Zum Beispiel im Urlaub, wenn wir am Ostseestrand entlangschlendern, wenn wir in Italien ins Mittelmeer springen.
Nach seriösen Schätzungen gelangen jedes Jahr etwa zehn Millionen Tonnen Mikroplastik in die Ozeane; wo etwa 1300 Tierarten von Plastikmüll aller Art »beeinträchtigt« sind. Was wiederum »beeinträchtigt« bedeutet, ist ebenfalls ein weites Feld; die Spanne geht von der Anreicherung im Körper zum Hungertod bei Wasservögeln, weil die aufgenommene Menge an Plastik ihnen suggeriert, sie seien gesättigt.
Das Wasser ist einfach ein sehr wichtiger oder gefährlicher Träger, vielleicht der gefährlichste. Vor allem im Wasser wird Mikroplastik gespeichert, transportiert, uns nahegebracht: im Trinkwasser, im Industriewasser, unter der Dusche, in der Kanne, sobald wir uns einen Kräutertee aufbrühen. Siebzig Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt, und Wasser ist schlechterdings das perfekte Medium für die fast unsichtbare Mikroplastikseuche. Und so schweben, tanzen und schwimmen die Partikel – »unkaputtbar«, wie einst der Brausekonzern Coca-Cola prahlerisch für seine PET-Flasche warb – in den Mündungen, in den Flüssen, Ozeanen, Staubecken, Swimmingpools, Bergbächen, Fischteichen, Waldseen; und im Wasser sind sie, so scheint es, für immer, einfach nicht mehr herauszufiltern.
Das aber will – und hier kommt er ins Spiel – Roland Damann nicht zulassen. Und er hat dazu auch eine Idee, nein, eigentlich ist es mehr als nur eine Idee. Er hat einen Plan. Und dazu kommen wir gleich.
*
Als »Mikroplastik« gilt per definitionem alles, was kleiner ist als fünf Millimeter; die mittlere Größenordnung darüber gilt als »Mesoplastik« oder, eine Liga größer, als »Makroplastik«. Bleiben wir jedoch beim Mikroplastik. Wie allgegenwärtig dieses Zeug ist – als feines Granulat oder als Abriebprodukt von Kunststoffen aller Art –, das ist fast nicht vorstellbar, weil wir uns, in einer Zeitspanne von nur zwei Generationen, völlig an Kunststoffe gewöhnt haben. Und wie.
Unsere Abhängigkeit ist umfassend. Nicht Nikotin oder Alkohol, nicht Heroin oder Crack sind die Drogen unserer Zeit, sondern Plastik. Und das Mikroplastik ist so etwas wie die Nebenwirkung – durch seine schiere Präsenz. Weil Mikroplastik nicht verschwindet, sich kaum zersetzt oder auflöst, weil es einfach bleibt und bleibt und bleibt. Um es mit Beispielen zu sagen: Zigarettenfilter (ja, auch die enthalten Mikroplastik!) bleiben uns und der Umwelt rund fünf Jahre erhalten, Plastiktüten 20 Jahre, Plastikflaschen oder Windeln aus Kunststoff sogar 450 Jahre. Allgegenwärtig, das Wort trifft es also.
Aber muss das so sein? Können wir uns nicht einfach freimachen von allen Kunststoffen, falls sie denn solch eine Pest sind?
Vielleicht sollte man sich das Wort »allgegenwärtig« mal auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht mit einem kleinen Gedankenspiel. Stellen wir uns einen magischen Schalter vor, einen roten Zauberschalter, den wir – will sagen: »wir«, die Menschheit – kurzerhand umlegen könnten. Einfach so. Es wäre eben ein magischer Schalter. Und alle wären dafür. Sobald dieser Schalter umgelegt würde, würde es kurz blitzen und donnern, und wie durch Zauberei würden mit einem Schlag alle Kunststoffe vom Antlitz der Erde verschwinden. Alles aus Polyethylen, Polypropylen, Aminoplaste, Polyurethan, alle Additive, zum Beispiel Flammschutzmittel, Wärmestabilisatoren, Weichmacher oder Antioxidationsmittel: weg, puff, verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Die Müllberge, die sich zu Gebirgen auftürmen, am Stadtrand von Kairo ebenso wie in Bantar Gebang, vor der indonesischen Metropole Jakarta, mit Flächen so groß wie 200 Fußballplätze und Plastikbergen, die bis an den Himmel reichen – ausgelöscht. Der »Great Pacific Garbage Patch«, der größte Müllstrudel der Welt, eine Plastikinsel im Nordpazifik, zwischen Hawaii und Kalifornien, etwa von der vierfachen Größe der Bundesrepublik, wäre – weg, wusch! Der Mount Everest, auf dem die Bergsteiger in ihren Basiscamps einen abscheulichen Unrat aus Dosen, Plastikflaschen, Fäkalien und Schlafsäcken hinterlassen haben, wäre wieder jungfräulich sauber. Schöne neue Welt: Der Planet Erde würde sich erholen. Die Pelikane würden wieder Fische fangen, statt nichtsahnend Verschlüsse von Plastikflaschen an ihre Jungen zu verfüttern. Delfine würden sich nicht mehr in Plastiknetzen verheddern und qualvoll ersticken. Denn es gäbe ja kein Plastiknetze mehr, es gäbe ja kein Plastik.
Aber wir – die Menschheit – würden uns irgendwo im 19. Jahrhundert wiederfinden. In den Zeiten von Napoleon, der Ära des Biedermeiers oder des Kanzlers Otto von Bismarck. Und das wäre sehr seltsam. Und wir hätten alle Zeit der Welt, uns darüber zu wundern.
Ja, wir hätten Zeit, denn wir könnten nirgendwo rasch hinfahren oder hinlaufen, es gäbe keine Autos, keine Züge, keine E-Roller, auch keine Fahrräder, Skateboards, Turnschuhe, Trekking-Sandalen. Und wenig Ablenkung: Wir könnten keine Popmusik hören, kein einziges Telefonat führen, morgens keine Kaffeemaschine anwerfen, der Winter käme für viele von uns mit Heulen und Zähneklappern, mit Kälte, Dunkelheit, Tod und Hunger, denn es gäbe keine Winterparka, keine Knöpfe, keinen Strom, keine Taschenlampen, Heizungen oder Kraftwerke. Es gäbe auch keine Wasserversorgung, Präservative, Strumpfhosen, Zahnbürsten, auch keine Zahnarztpraxen – ein kariöser Zahn müsste mit einer primitiven Eisenklaue aus dem Kiefer gebrochen werden, keine ersprießliche Vorstellung. Es gäbe nämlich keine Zahnarztbohrer, keine Betäubungsspritzen, auch keine Kettensägen, künstliche Herzklappen, Mülleimer, Silikonbrüste, Einwegspritzen, Operationen, Blutkonserven, Fast-Fashion, wo man Bling-Bling-Klamotten kauft, die man nach dreimaligem Anziehen auf den Müll wirft. Es gäbe kein Finanzsystem, wie wir es kennen, keine Computer und kein Netflix, übrigens auch keinen Beweis, dass je ein Mensch den Mond betreten hat, denn die legendären Fahnen, die die Astronauten aufstellten, Aldrin und Armstrong als Erste, am 20. Juli 1969, bestanden aus Nylon. Wahrscheinlich hatte sie ein NASA-Mitarbeiter aus einem Regierungskatalog bestellt, für fünf Dollar und fünfzig Cent. Von diesen Fahnen – und von Amerikas Ruhm – bliebe nichts übrig.
Allerdings wären alle Kriege, wie wir sie kennen, schlagartig beendet; zunächst jedenfalls, denn ohne Logistik, ohne Kommunikation, ohne Drohnen und Granaten, wo überall Kunststoff verbaut ist, wären die Generäle und Tyrannen dieser Welt, wie wir sie kennen, erstmal aufgeschmissen. Aber es würden wohl bald andere Tyrannen kommen, ziemlich schnell schon. Denn alle Systeme, Staaten, Gemeinden, Länder, Polizei, Wasserversorgung, Müllabfuhr – sie würden zusammenbrechen. Wir wären zurückgeworfen, trotz unseres Wissens, auf Materialien des Mittelalters, auf Holz, Kupfer, Eisen, Schilf, Sand, Horn, Ziegenleder. Fußlappen statt Nylonstrümpfen.
Anarchie, Verzweiflung und unsägliches Leid wären die Folge. Was bedeutet das? Das Gedankenspiel lehrt uns, dass Kunststoffe nicht des Teufels sind, nicht per se; sie haben uns, zumindest einem großen Teil der Menschheit, zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen historisch nie geahnten Wohlstand, Gesundheit und Bequemlichkeit beschert. Und das in kürzester Zeit; denn der Siegeszug und unaufhaltsame Vormarsch der Kunststoffe begann erst Mitte des vorigen Jahrhunderts.
*
Seither wächst die Abhängigkeit exponentiell: In knapp achtzig Jahren hat der Plastikkonsum eine steile Kurve hingelegt, auf mehr als acht Milliarden Tonnen, achttausend Millionen Tonnen, gerechnet bis zum Jahr 2017. Würde man das bisher produzierte Plastik in kleine Container packen, mit einer Höhe und Breite und Seitenlänge von einem Meter, und diese Container hintereinander aufreihen, käme man, je nach Berechnung, eine Strecke von sechzehnmal Erde-Mond, achtmal hin und zurück.
Und es hört ja nicht auf, es geht weiter. Seit Beginn dieses Jahrtausends hat sich die jährlich produzierte Menge verdoppelt. Die Kunststoffküchen dieser Welt spucken alljährlich mehr als 460 Millionen Tonnen aus. Wir leben, nach der Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit, jetzt in der Plastikzeit. Die langen Molekülketten, aus denen sich das PET oder das PVC zusammensetzt, waren, als Erfindung gesehen, wie gute Geister, die wir selbst geschaffen hatten und die unser Leben ungemein verbesserten.
Aber mit Geistern ist es so eine Sache.
*
»Die ich rief, die Geister/Werd ich nun nicht los …«, heißt es in Goethes Gedicht vom Zauberlehrling. Als die Kunststoffe in die industrielle Produktion gingen, etwa 1950, damals noch mit sehr bescheidenen Stückzahlen, da war das neuartige Material so verblüffend, dass es beinahe an Magie grenzte – pure Alchemie aus den Wunderküchen der Materialingenieure. Doch wie beim Zauberlehrling in Goethes Ballade kommt die Magie als Bumerang zurück, als Sturzflut, die alles unter sich zu begraben droht. Gut möglich, dass unsere Urenkel einen Planeten erben, der von Plastik so bedeckt ist, dass er zu ersticken droht.
Tun wir mal so, als würde die Menschheit an einem Strang ziehen in dieser wichtigen Frage, weil alle gleichermaßen einsichtig sind. Konfrontieren wir uns mit ein paar einfachen Wahrheiten: Wir können, wie zuvor beschrieben, nicht mehr zurück, nicht auf Kunststoffe verzichten, das ist ausgeschlossen. Wir könnten jedoch dreierlei, so sieht es Damann, der Mann aus Paderborn.
Erstens: Wir könnten die Produktion reduzieren, indem wir unseren Konsum umstellen – je nachhaltiger und radikaler, desto besser. Wir können zum Beispiel auf überflüssige Verpackungen verzichten. Wir können reparieren, vielfach nutzen, bewusst nutzen.
Zweitens: Wir könnten deutlich besser recyclen, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern in ein integriertes Abfallmanagement investieren, die vorhandenen Kunststoffe intelligenter nutzen, daran wird vielerorts gearbeitet (dazu mehr ab Seite 89). Wir könnten nebenbei auch dafür sorgen, dass Granulate – der transportierbare Rohstoff, aus dem Kunststoffe gemacht werden – während der diversen Transporte nicht über Bord der Containerschiffe fallen, verwehen oder irgendwie verloren gehen. Was möglicherweise häufiger vorkommt, als man ahnt und beweisen kann; ein Beispiel: Erst im Dezember 2023 rutschte vor Portugals Küste ein Container mit Plastikpellets von einem Transportschiff ins Meer, millionenweise wurde das Zeug an die Küsten Galiziens und Asturiens geschwemmt, es waren bizarre Bilder, eine hanebüchene Umweltkatastrophe.
Das sind also schon zwei Strategien. Sie erfordern Opfer und Umdenken.
Und darüber hinaus?
»Und darüber hinaus gibt es noch eine dritte Strategie«, sagt Damann. »Denn wir können das Zeug, das bereits im Wasser ist, durchaus auch wieder rausholen. Und das genau ist mein Anliegen.«
Er fährt fort: »Ich hatte vor einigen Jahren in China, in der Chengdu-Provinz, und in Vietnam, im Mekongdelta, Flüsse gesehen, die nicht mehr als Flüsse zu erkennen waren. Es waren große Gewässer, die aber nur noch etwas Wasser und vor allem Plastik führten. Man nennt sie auch so: Plastikflüsse. Als ich das sah, war ich erschüttert. Wenn das nur der Anfang war! Und so war mein erster Gedanke: Damann, du bist gefragt, du bist dran, mach was, unternimm was dagegen! Mein zweiter Gedanke war allerdings: Wenn ich mich jetzt dem Thema widme, dann bin ich schneller pleite, als ich das Wort ›Wasserreinigung‹ aussprechen kann.« Er macht eine Pause. »Und trotzdem ließ mich der Gedanke nicht los – dass ich der richtige Mann für dieses Problem bin.«
Womit wir wieder bei seiner Idee sind. Und bei Themen wie der Finanzierung, seiner Firma, bei dem Versuch, ein technisch gelungenes Verfahren erst zu entwickeln, ferner: es skalierbar zu machen, die Größenordnung zu vertausendfachen, die Skala zu vergrößern. Denn das ist die Gretchenfrage, der sich jeder Erfinder und Start-up-Unternehmer stellen muss: Wie hältst du’s mit der Skalierbarkeit?
Doch zunächst zu der Idee.
*
Roland Damann, muss man dazu wissen, schaut nicht wie unsereins auf einen See. Oder er blickt nicht wie unsereins auf eine Bucht und sieht nur die glitzernde Wasseroberfläche oder die hübsch sich kräuselnden Wellen oder das schilfbewachsene Ufer. Nein, Damann sieht das ganze Bild, den gesamten »Wasserkörper«, wie er es nennt, er sieht das Wasser als Element, die Reibungsschichten im Wasser, die Verunreinigungen, die Schwebteilchen, das mögliche Koaleszenzverhalten von Gasblasen, wenn sich kleine Blasen zu größeren Blasen fügen, er untersucht oder registriert die Strömungen, die Temperaturschichten, die Keimspektren, den Salz-, Säure-, Basengehalt, er hat vor Augen, wie man den Wasserkörper behandeln müsste, wenn man ihn verändern wollte, wo man ein Wasserpolster einbringen könnte, mit wie viel bar man Gase einleiten müsste, welche Entspannungsventile man wo und wie einsetzen müsste.
Wie der Ton für den Töpfer, das Fichtenholz für den Tischler, ist für Damann das Wasser sein Material, das er formt, modelliert. Und um im Bild zu bleiben: Sein »Werkzeug«, mit dem er das Material behandelt, sind nicht Töpferscheibe oder Hobel, sondern die diversen Gase, in Bläschenform zumeist; winzige Blasen, gefüllt mit Gasen wie Sauerstoff oder Kohlendioxid.
Damann, der Wasser-Kenner, der Blasen-Flüsterer.
Verraten Sie Ihren Trick, Herr Damann?
»Würde ich ja gerne! Aber es gibt keinen Trick. Es gibt nur eine zentrale Idee. Und die zentrale Idee daran ist, dass einige Feststoffe, winzige Festkörper, die sich im Wasser befinden, hydrophob sind. Das Wort ist griechischen Ursprungs. Hydro ist Wasser, Phobos bedeutet Angst. Das heißt, die Teilchen sind zwar im Wasser gelandet, aber sie fliehen das Wasser, um es einfach auszudrücken. Sie nutzen die erstbeste Flucht- oder Mitfahrgelegenheit, um das Wasser zu verlassen. Mitfahrgelegenheit – das ist natürlich nur eine Metapher für einen physikalischen Prozess, der auch chemische Eigenschaften hat.«
Und diese ›Mitfahrgelegenheit‹, wie Sie es ausdrücken?
»Die Mitfahrgelegenheit liefere ich, biete sie den Festkörpern gleichsam an – in Form von Gas, in Form von Blasen, eher Bläschen, denn die Größe spielt eine wichtige Rolle. Die Feststoffe, etwa Mikroplastik, setzen sich an den Bläschen fest, werden nach oben getragen, können dort abgefischt werden.« Er macht eine Pause, dann: »Das Prinzip ist einfach, die Crux liegt im Detail, da hilft es, wenn man vierzig Jahre Erfahrung hat. Ich mache das schließlich mein ganzes Leben lang …«
Tatsächlich?
»Oh ja, tatsächlich …«. Er lacht.
Und wie hat es begonnen, Herr Damann?
»Auf einem Geburtstag. Ich war eingeladen, da war ich 25 oder so. Es begann alles mit einer Sektflasche.«
*
Jawohl, es begann mit einer Sektflasche, berichtet Damann. Eine Geburtstagsparty also, Mitte der 80er, ganz harmlos, bei Freunden in Paderborn, eine Pulle Sekt wurde geköpft, Gläser klirrten, man sang etwas schief Happy Birthday, aber Damann war mit seinen Gedanken ohnehin woanders. Wieso sprudelte eigentlich der Sekt? Wie kamen die Blasen in die Flüssigkeit? Wieso perlten sie auf in dem Moment, da die Flasche geöffnet wurde? Warum hatten sie unterschiedliche Größen? Eigentlich sollte er es wissen; er hatte Verfahrenstechnik studiert, Grundlagen der Physik gehörten dazu. Aber er wusste es nicht. Er ging nachdenklich heim und las die nächsten Tage alles, was er über Gase, Flüssigkeiten und Drucksättigung finden konnte. Er las immer wieder alles über Partialdruck und Flaschengärung und das Dalton-Gesetz und Gassättigungen in Flüssigkeiten.
Flaschengärung – so heißt das Phänomen hinter dem sprudelnden Sekt. Es wirkt natürlich auch in allen anderen Schaumweinen, vom Rotkäppchen-Sekt bis zur Magnumflasche Veuve Cliquot. Das Prinzip ist simpel: Die Hefe erledigt den Job.
Vier bis sechs Wochen dauert es, bis die Hefe den im abgefüllten Wein enthaltenen Zucker in Alkohol und das Gas Kohlendioxid umgewandelt hat. Dieses Gas kann wegen des fest verankerten Verschlusses jedoch nicht aus der Flasche entweichen. So baut sich während der Gärung ein Druck von rund sechs bar auf. Das ist das Sechsfache des Normaldrucks in der Atmosphäre. Und es entspricht etwa dem Druck eines prall aufgepumpten Reifens bei einem schicken Rennrad. Unter diesem Druck von sechs bar löst sich – ganz getreu dem Gesetz der beiden Naturforscher William Henry und John Dalton – das Kohlendioxid im Wein. Je höher der Druck, desto mehr Gas löst sich in der Flüssigkeit und bildet Kohlensäure. Doch in der mit Korken und Drahtgeflecht verschlossenen Sektflasche lassen sich keine sprudelnden Blasen beobachten. Denn der Sekt steht noch immer unter Druck, das Kohlendioxid ist im Sekt gelöst und kann nicht entweichen.
Aber dieser Zustand ändert sich schlagartig, sobald der Korken knallt, die Sektflasche geöffnet wird. Plötzlich fällt der Druck von drei bis sechs bar auf nur noch ein bar ab – dem Druck der Umgebung. Nur ein Bruchteil des Gases, gerade einmal fünf Prozent, reicht aus, um den Korken aus dem Flaschenhals zu katapultieren, mit dem beliebten Peng. Der große Rest des Kohlendioxids lässt sich etwas mehr Zeit. Er bildet kleine Blasen, mit einem Umfang von einem bis drei Millimetern. Gießt man den Sekt in ein hohes Glas, blubbern jede Sekunde bis zu dreißig dieser Blasen an die Oberfläche. Sie transportieren Aromastoffe, prickeln in der Nase und verleihen dem Sekt so seinen untrüglich edlen Geschmack.
Aber nichts währt ewig. Auch das perlende Sprudeln nicht. Das in einer Sektflasche gelöste Kohlendioxid reicht gerade mal etwa für achtzig Millionen Bläschen. Danach schmeckt das Getränk nur noch fad und schal.
So also die Geschichte und Wirkungsweise der Sektflasche, die Roland Damann inspirierte. Nach dem Vorbild der Sektflasche erfand er sein Verfahren, bei dem allerdings – eine wichtige Modifikation! – das Sprudeln, das Aufsteigen von kleinen Bläschen nicht endet, nicht ausklingt. Damanns Gerät schaffte es, den Moment des »Öffnens«, der Bläschenbildung also, beliebig in die Länge zu ziehen – für Minuten, Stunden, ganze Tage.
Die kleinen Bläschen aus Damanns Maschine ermöglichten viele Anwendungen – Lachsfarmen, Abwasserreinigung, Mikroplastik. Aber eins nach dem anderen. Bleiben wir bei Damanns Lebensweg.
Damann war nach dem Studium in die Firma seines Vaters eingestiegen, sie hatten medizinische Geräte gebaut, Damann hatte also eine Werkstatt zur Verfügung. Er war ein passionierter Bastler, hatte Verfahrenstechnik studiert, also suchte er sich Schläuche, Ventile und Schrauben zusammen und baute einen Apparat, ohne recht zu wissen, warum. Er baute einen Apparat, der Blasen erzeugt und in Wasser einleiten kann, und er nannte das Ding »Aquatector«. Dann bastelte er sich einen Flyer mit Letraset-Buchstaben und fuhr damit nach Norwegen, nach Trondheim, auf eine Industriemesse für Lachszucht. Alles auf gut Glück.
Lachse wurden damals bereits seit einigen Jahren kommerziell in Aquafarmen gezüchtet. Norwegen war darin ein Vorreiter, vor allem wegen der Fjorde, wo man die Farmen gut und strömungs- und windgeschützt anlegen konnte. Damals war Lachs gerade in Mode gekommen, Lachshäppchen galten als fürchterlich vornehm und en vogue. Auch waren die Lachsfarmen noch nicht so in der Kritik wie heute, galten noch nicht als »Brutanstalten« und »Mastfarmen«, die Nachfrage zog also kräftig an.
Gleichwohl hatten die Züchter erhebliche Probleme, die sie nicht an die große Glocke hängten. Vor allem, weil das Wasser in den unterseeischen Käfigen nicht genügend sauerstoffreich war. Es fehlte ihnen an Erfahrung, die komplizierten Zyklen eines Wildfischs zu simulieren. Lachse suchen sehr sauerstoffreiches Wasser für ihre Laichperiode auf, daher ihre Wanderungen stromaufwärts. Damanns Apparat war für die Züchter der wahre Segen. Die Anreicherung mit Sauerstoff steigerte die Überlebensquote der Eier von bis dahin etwa 30 Prozent auf nahezu 100 Prozent, erzählt Damann. Die heranwachsenden Lachse erreichten die doppelte Größe in der halben Zeit. Damann verdiente gut, sehr gut. Einer der Züchter hatte Deutsch gelernt und wünschte Damann und sich eine »langweilige Zusammenarbeit«.
»Er meinte aber eine ›langlebige‹ Zusammenarbeit«, sagt Damann. Er lächelt bei der Erinnerung.