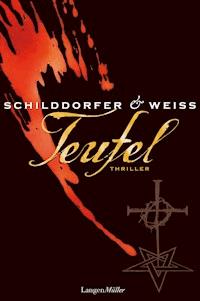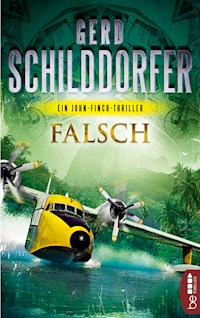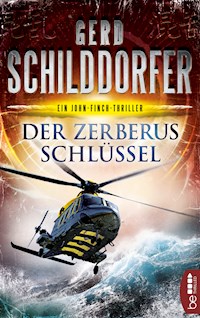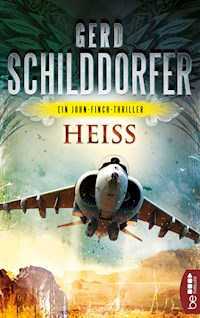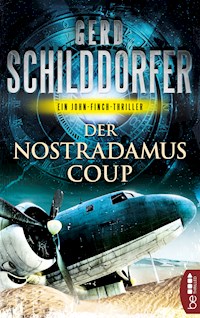
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Finch
- Sprache: Deutsch
Wenn aus alten Prophezeiungen blutiger Ernst wird ...
Dem raubeinigen Piloten John Finch fällt ein Notizbuch mit verschlüsselten Texten und der Fotografie eines Gemäldes in die Hände. Anfangs ahnt er nicht, dass es ihn auf die Spur der rätselhaften Prophezeiungen des Nostradamus führt. Und dass diese ein Geheimnis bergen, das so spektakulär und atemberaubend ist, dass John sich bald auf einer gefährlichen Verfolgungsjagd quer durch Afrika und Europa befindet. Denn die Aufzeichnungen sind gar keine Voraussagen, sondern eine Schatzkarte zu einem der legendärsten Schätze der Geschichte - mitten in Europa ...
Die John-Finch-Reihe - eine explosive Mischung aus Abenteuerroman und Verschwörungsthriller:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 884
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitate
1 – CODE GREEN
2 – DER ERSTE ALARM
3 – ET IN ARCADIA EGO
4 – EIN ALTER BEKANNTER
5 – DIE SCHATTEN DES TERRORS
6 – DAS ATTENTAT
7 – DER GANG
8 – DAS ARCHIV
9 – DIE »CENTURIEN«
10 – DER SCHATZ
Epilog
Nachwort
Weitere Titel des Autors
Die John-Finch-Reihe:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
Über dieses Buch
Wenn aus alten Prophezeiungen blutiger Ernst wird …
Dem raubeinigen Piloten John Finch fällt ein Notizbuch mit verschlüsselten Texten und der Fotografie eines Gemäldes in die Hände. Anfangs ahnt er nicht, dass es ihn auf die Spur der rätselhaften Prophezeiungen des Nostradamus führt. Und dass diese ein Geheimnis bergen, das so spektakulär und atemberaubend ist, dass John sich bald auf einer gefährlichen Verfolgungsjagd quer durch Afrika und Europa befindet. Denn die Aufzeichnungen sind gar keine Voraussagen, sondern eine Schatzkarte zu einem der legendärsten Schätze der Geschichte – mitten in Europa …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Gerd Schilddorfer wurde 1953 in Wien geboren. Als Journalist arbeitete er bei der Austria Presse Agentur und danach als Chefreporter für verschiedene TV-Dokumentationsreihen (Österreich I, Österreich II, Die Welt und wir). In den letzten Jahren hat er zahlreiche Thriller und Sachbücher veröffentlicht. Gerd Schilddorfer lebt und arbeitet in Wien und Stralsund, wenn er nicht gerade auf Reisen für sein neues Buch ist.
Gerd Schilddorfer
DERNOSTRADAMUS-COUP
Ein John-Finch-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/dani3315; shutterstock/Filip Fuxa; shuttestock/Carlos Amarillo
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1758-8
be-ebooks.de
lesejury.de
Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Albert Einstein
Geh nicht nur die glatten Straßen.
Geh Wege, die noch niemand ging,
damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.
Antoine de Saint-Exupéry, Flieger und Autor
Ich will lieber aufrecht sterben, als auf Knien zu leben.
Stéphane Charbonnier (»Charb«),
Chefredakteur von »Charlie Hebdo«
How many roads you’ve traveled
How many dreams you’ve chased
Across sand and sky and gravel
Looking for one safe place …
Mark Cohn, aus seinem Album »Live«
I feel like Garbo in this late night grande hotel
Cause living alone is all I’ve ever done well.
Nancy Griffith, aus ihrem Album »Late Night Grande Hotel«
1CODE GREEN
Prolog
13. JULI 1781, STRAßENACH CAMBRON, ÖSTERREICHISCH-HABSBURGISCHES FLANDERN
»Halt Er hier an!« Graf Joseph von Falkenstein, den man in eingeweihten französischen Kreisen auch den »illustren Reisenden« nannte, beugte sich vor und klopfte energisch gegen die tapezierte Holzwand der Kutsche. »Wir machen eine kurze Pause im Wald.«
Während die Kutsche langsamer wurde und Falkenstein sich den Schweiß von der Stirne wischte, sah er seinen Mitreisenden, Fürst Charles de Ligne, aus den Augenwinkeln an. De Ligne sah beneidenswert frisch aus … Die Kleidung makellos, selbst auf dem Gesicht des Fürsten war kein Schweißtropfen zu sehen.
Vielleicht wäre es doch besser gewesen, in dessen nahe gelegenem Schloss Belœil bis zum Abend abzuwarten und sich erst dann auf den Weg zu machen, dachte Falkenstein. Selbst nach der kurzen Fahrt war es heiß in der Kutsche, unerträglich heiß, und der warme Sommerwind, der durch die offenen Fenster strich, hatte in der vergangenen Stunde kaum Linderung gebracht.
De Ligne erwiderte Falkensteins Blick unbewegt und nickte dann etwas gedankenverloren, erneut vertieft in seine Reisenotizen. »Ja, in der Tat, ein guter Einfall, bevor wir im eigenen Saft sieden …«
Der hochgewachsene Fürst mit seiner ungebändigten grauen Mähne galt nicht nur als ausgezeichneter Militärexperte und einfallsreicher Diplomat, sondern wurde von vielen als geistvoller und aufgeklärter Denker, Essayist und Biograf geschätzt. Für Falkenstein, der ausgedehnte Reisen durch Europa unternahm, war er der ideale Reisegefährte, der ihn leider viel zu selten begleitete. Der Fürst stand in regem Gedankenaustausch mit den geistigen Größen seiner Zeit, wie etwa Voltaire, Rousseau oder Goethe, war europaweit mit einflussreichen Männern von Kirche und Staat befreundet und aufgrund seiner Intelligenz, seines elegant-gewandten Auftretens und seiner manchmal spitzen Zunge in den höchsten Kreisen sehr beliebt.
Als die Tür aufschwang und einer der Diener den Schemel unter den Ausstieg stellte, drang erfrischend kühle Waldluft ins Innere der Kutsche, und Falkenstein atmete auf.
»Ich habe uns einen Korb mit kühlen Getränken einpacken lassen.« De Ligne lächelte wissend und steckte seine Notizen ein. »Champagner aus Epernay, einen jungen Rosé aus dem Elsass und kaltes Wasser aus der Schlossquelle. In dieser Reihenfolge, Exzellenz?«
»Beginnen wir einfach mit dem Wasser«, erwiderte Falkenstein und atmete auf, als er den moosigen, kühlen Boden unter seinen Sohlen spürte. Zwei Bedienstete wollten eine schwere Decke darauf ausbreiten, aber der Graf winkte ab. »Es wird nur eine kurze Rast«, meinte er, »wir haben noch ein ordentliches Stück Weg vor uns.«
Sofort trat ein weiterer Diener mit Tablett, Karaffe und Gläsern vor, doch der Fürst kam ihm zuvor.
»Darf ich Euch einschenken?«, erkundigte sich de Ligne und ergriff die beschlagene Kristallflasche.
»Nur zu«, Falkenstein nickte, »schließlich seid Ihr es, der mich durch diesen unglaublich heißen wallonischen Sommer treibt. Und mir dabei Geheimnisse vor die Nase haltet wie eine Möhre dem störrischen Esel.« Dankbar ergriff er das dargebotene Glas mit Wasser, leerte es in einem einzigen Zug. »Aah, das war gut! Wollt Ihr Euch nicht ein wenig mehr erklären? Dies wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mein Freund.«
De Ligne blickte sich vorsichtig um, nachdem er sein Glas auf das Tablett zurückgestellt hatte. »Kommt, gehen wir ein wenig spazieren«, meinte er schließlich nach einem Augenblick des Nachdenkens und wies auf einen ebenen Weg, der sich durch die Bäume ins dunkelgrüne Unterholz schlängelte.
Falkenstein sah sich etwas ratlos um. »Aber warum? Hier sind nur Eure Diener und sonst weit und breit niemand.«
»Manchmal hat sogar der Wald Ohren …«, antwortete de Ligne, verschränkte die Hände hinter seinem breiten Rücken und ging ohne weitere Bemerkung los.
Falkenstein sah ihm kurz nach, zuckte mit den Schultern und schloss sich schließlich dem als geistreichen Kosmopoliten bekannten Fürsten an. Seine Neugier hatte erneut über seine Bequemlichkeit gesiegt.
Und der kühle Wald war verlockend.
»Was sagt Euch der Name ›Cambron‹?«, begann de Ligne leise, als Falkenstein zu ihm aufgeschlossen hatte.
»Klingt wie eine Ortschaft«, erwiderte der Graf nachdenklich. »Sollte es sich etwa um das Ziel unserer heutigen Fahrt handeln?«
Der Fürst nickte und verjagte mit der Hand einige Fliegen, die summend um seinen Kopf schwirrten. »Genauer gesagt handelt es sich um den Namen eines Klosters, das ursprünglich als Abtei ›Notre Dame de Cambron‹ bekannt geworden war. Von den Zisterziensern im Jahr 1148 gegründet.«
Falkenstein sah ihn erstaunt an. »Ihr kennt mich nun schon so lange und wollt mich in ein Kloster führen? Alte Mauern, in denen unnütze und untätige Mönche ihre Gebete herunterleiern?«
De Ligne lächelte verschmitzt. »Vergebt mir, Exzellenz, aber Ihr werdet gleich verstehen. Cambron ist … anders, war von Beginn an etwas Besonderes. Zwölf Mönche erschienen hier in der Gegend mit einem Mal im Jahr 1148, direkt vom Kloster Clairvaux und seinem berühmten Abt, dem heiligen Bernhard, gesandt.«
»Bernard de Clairvaux?«, stieß Falkenstein erstaunt nach.
»Genau, der berühmte Bernard de Clairvaux. Vehementer Unterstützer der Kreuzzüge, erbitterter Gegner der Katharer, Teilnehmer am berühmten Konzil von Troyes 1129. Unter seiner Ägide gelang es Bernard, die Statuten des Templerordens, an deren Erstellung er maßgeblich beteiligt war, vom Konzil und damit von der Kirche anerkennen zu lassen. ›Der Orden der bewaffneten Mönche‹, wie einige die Templer bezeichneten, dessen Aufgabe im Schwingen des Schwertes und im Vergießen von heidnischem Blut bestand. Dieser Orden war damit institutionalisiert, anerkannt von Kirche und Papst. Eines der Gründungsmitglieder, André de Montbard, war übrigens der Onkel des heiligen Bernhard.«
Falkenstein schwieg und ging nachdenklich neben de Ligne her.
»Damit war der Begriff ›Heiliger Krieg‹ zum ersten Mal, aber für immer in der offiziellen Begriffswelt der katholischen Kirche eingeführt, wenn ich Euch daran erinnern darf.« Der Fürst blieb stehen und sah sein Gegenüber durchdringend an. »1130 ist es Bernard, der in einem Brief an die Templer erklärt, sie hätten disziplinierte Gotteskrieger zu sein, die zwar den Tod bringen würden, ohne jedoch Hass und Stolz zu zeigen. Er war es auch, der der katholischen Kirche 1145 einen neuen Papst gab, Eugen III., seinen eigenen Schüler, dessen wichtigster Berater er auch blieb. Er hatte also sowohl den obersten Hirten der Kirche inthronisiert als auch dessen bewaffnete Truppe aufgestellt. Auf seinem Weg durch den Süden Frankreichs im selben Jahr, einer bekannten Hochburg der Katharer, meinte er nur lakonisch: ›Ergreift sie und haltet nicht inne, bevor sie nicht alle vernichtet sind, denn sie haben bewiesen, dass sie lieber sterben, als sich zu bekehren.‹ Damit stand er am Ursprung des Kreuzzuges gegen die Albigenser und die Katharer, der Zehntausenden das Leben kostete und der schlussendlich die kirchliche Inquisition hervorbrachte.«
»Und drei Jahre später lässt genau jener Bernard de Clairvaux das Kloster Cambron gründen, eine Abtei unweit Eures Schlosses.« Falkenstein war mit einem Mal interessiert.
»Ein Stück Land am Fluss Dendre wurde ihnen sofort zur Schenkung gemacht, die Zisterzienser genossen damals überall hohes Ansehen. War nicht Papst Eugen III. einer der ihren? Das Kloster und seine Errichtung waren nur mehr eine reine Formsache.«
Für einige Minuten gingen die beiden Männer schweigend nebeneinander, jeder in Gedanken versunken. Sie überquerten vorsichtig ausgetrocknete Furchen, die von den schweren Rädern der Holzfällerfuhrwerke in den Boden gegraben worden waren und den Weg umpflügten.
»Doch weiter in der Geschichte, die uns interessiert, wenn Ihr erlaubt«, fuhr de Ligne fort. »Am 14. September 1307 wurde, wie Ihr wisst, der Haftbefehl Philipps IV. ausgefertigt, der alle Templer ohne Ausnahme betraf und der pflichtbewusst am 13.Oktober 1307 – also einen Monat später, und das ist äußerst wichtig – von den Schergen des Königs ausgeführt wurde. Seitdem spricht man abergläubisch von Freitag, dem 13., als einem Unglückstag.«
»Mein Aberglaube hält sich in Grenzen«, warf Falkenstein leichthin ein und sah hinauf zum Sommerhimmel, der sich über einer Kuppel aus grünen Zweigen spannte. »Wir schreiben heute den 13. Juli, und es ist ein Freitag.«
Irgendwo tief drin im Wald schrie ein Käuzchen.
»Also an einem Tag wie heute?«
De Ligne nickte und blickte düster drein. »An einem Tag wie heute«, bestätigte er. »Im Frühjahr 1312 jedenfalls löste Papst Clemens V. den Templerorden auf und beendete mit seiner Bulle fast zweihundert Jahre Ordensgeschichte. Zwei Jahre später, am 18. März 1314 schließlich, wurde der Großmeister Jacques de Molay zusammen mit Geoffroy de Charnay auf dem Scheiterhaufen in Paris verbrannt.« Der Fürst machte eine Pause, bevor er leise fortfuhr. »Euer Exzellenz werden sich fragen, was das alles mit Cambron, dem Ziel unserer Fahrt, zu tun hat? Nun, wartet ab. Ich habe Euch ein wahrhaft königliches Geheimnis versprochen, und Ihr sollt es bekommen.«
Die beiden Männer erreichten eine kleine Lichtung, und de Ligne blieb stehen.
»Zurück in den Hennegau, nach Cambron. Im Jahre 1322 ereignete sich etwas Seltsames in der Zisterzienserabtei. Wie man aus einigen noch erhaltenen Dokumenten ersehen kann, wurde eine Statue der Jungfrau Maria durch Beschädigung entweiht, Genaueres ist nicht bekannt. Weder der Verursacher noch der Grund der Profanation wurden jemals ermittelt. Aber das Vorkommnis musste etwas ausgelöst haben, denn im selben Jahr begann der Prior des Klosters, ein gewisser Yves de Lessines, an einem Text zu schreiben.« De Ligne machte eine effektvolle Pause. »An einem langen Text, Exzellenz, denn es dauerte ganze sechs Jahre, bis er damit fertig war.«
Falkenstein runzelte die Stirn und überlegte kurz. »Lasst mich raten, denn ich kenne Eure Begeisterung für die Vergangenheit und die Literatur, mein Teurer. Dieser Lessines schrieb eine geheime Geschichte des Templerordens, die in den Jahrhunderten verloren ging und die Ihr nun wiedergefunden habt.«
»Falsch, Exzellenz, ganz falsch«, versicherte ihm de Ligne energisch und blickte sich erneut um. Doch bis auf das Vogelgezwitscher blieb alles ruhig im Wald, sie waren die einzigen Menschen weit und breit. »Der Text des Priors verschwand angeblich nach der Fertigstellung und tauchte erst rund zweihundert Jahre später wieder auf, jedoch in einem anderen Teil Europas. Ab da allerdings begann sein Siegeszug. Ja, man möchte fast sagen, seitdem spricht die ganze Welt davon.«
Der Graf sah ihn verwirrt und fragend an.
»Man zitierte ihn seither tausendfach in den vergangenen Jahrhunderten, er wurde zur Legende, und doch …« De Ligne zögerte einen kurzen Moment, dann beugte er sich zu Falkenstein, bis sein Mund nur mehr Zentimeter von dessen Ohr entfernt war. Atemlos flüsterte er: »… und doch kennt man ihn heute unter einem ganz anderem Namen. Man nennt die Verse allgemein die ›Centurien des Michel de Nostredame‹, besser bekannt als Nostradamus.«
19. Juli 2014
VIA CARONA, LUGANO, TESSIN/SCHWEIZ
Noch vierzehn Minuten und zwanzig Sekunden.
Die Sonne war längst hinter der Bergkette des Monte Tamaro verschwunden, und der fast violette Himmel mit den ersten Sternen im Osten spiegelte sich im Luganer See. Die Landschaft an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz, mit ihren Palmen vor der beeindruckend schönen Bergkulisse, wurde zu dieser Stunde in ein fast unwirkliches Licht getaucht. Einige Boote zogen noch ihre silbernen Linien auf das Wasser, in dessen leichten Wellen sich die Lichter der Uferpromenade spiegelten.
Nach und nach nahm der See die Farbe tiefblauer Tinte an.
Doch für dieses sommerliche Naturschauspiel, das Abend für Abend Hunderte Schaulustige an die Riva Vincenzo Vela lockte, hatte der Mann auf dem kleinen Parkplatz neben der Standseilbahn keinen Blick übrig. Er hatte seit mehr als einer Stunde ein rostrotes, vierstöckiges Haus mit großzügigen weißen Balkonen beobachtet, das sich auch auf den zweiten Blick nicht von den anderen Neubaublöcken in Lugano unterschied.
Vier Etagen, Flachdach, großzügige Balkone. Apartments für Reiche.
Nun war er auf die Rücksitzbank des schwarzen Mercedes-Busses umgezogen und blickte konzentriert auf einen kleinen Bildschirm, der in der Mitte eines tragbaren Pults angeordnet war. Auf dem Display waren Glastüren zu sehen, überraschend deutlich, in denen sich die Berge und die Lichter der Stadt spiegelten, und dahinter ein elegantes Wohnzimmer.
Behutsam nahm der Mann einen Hebel zwischen Daumen und Zeigefinger und drückte ihn nach links. Die Bilder wechselten rasch, die Kamera bewegte sich auf die Fensterfront zu. Bald konnte man erkennen, dass eine der Balkontüren ein paar Zentimeter offen stand und ein Mann im dunklen Anzug sich anschickte, sie zu schließen.
»Hast du die Autoschlüssel?«, erkundigte er sich, und der Mann an den Kontrollhebeln des Steuerpultes zuckte ein wenig zusammen. Die ausgezeichnete Qualität der Ton-Übertragung überraschte ihn immer wieder.
»Aber klar, Giovanni, und ich fahre auch«, antwortete eine weibliche Stimme aus den Tiefen des Raumes. »Wir nehmen meinen Wagen. Damit finden wir leichter einen Parkplatz als mit deinem Schlachtschiff.«
Der Spalt zwischen Tür und Rahmen begann sich zu schließen, und die Kamera schoss im letzten Moment hindurch, vorbei an Giovanni, einem distinguiert aussehenden Mann in den Sechzigern, und hinein in den weitläufigen Salon.
»Ich glaube, wir haben gerade eine Biene eingesperrt«, erklang die tiefe Stimme etwas irritiert.
»Macht nichts, die kann gleich meine Azaleen bestäuben.« Die weibliche Stimme lachte im Hintergrund. »Lass sie ja in Frieden!«
Der Mann im Mercedes stieß erleichtert den Atem aus. Das war knapp gewesen!
Geschickt lenkte er die Kamera in die dunkleren Regionen des großen Raumes, weg von dem Paar, das sich zum Ausgehen bereit machte. Dann leitete er einen 360-Grad-Schwenk ein. Eine schlanke, dunkelhaarige Frau in Dessous und High Heels kam ins Blickfeld, die sich gerade ein kurzes schwarzes Abendkleid überstreifte, während sich ihr Begleiter eine Zigarette anzündete.
Die roten Ziffern der Stoppuhr auf dem Kontrollpult glühten im Dunkel.
Noch zwölf Minuten und acht Sekunden.
Die Kamera schwenkte weiter. Über Wände voller Gemälde, über dekorativ platzierte moderne Möbel mit alten Uhren und geschmackvollen Blumenarrangements, Designerteppiche und eine lange, riesige Fensterfront, die einen atemberaubenden Blick auf den Luganer See bot.
»Ich werde noch kurz Sergio anrufen, ob er schon auf dem Weg ist«, meinte der Hausherr und zog ein Handy aus seiner Tasche, »oder ob er vor der Mattscheibe eingeschlafen ist.«
»Ich bin fast fertig, also mach schnell«, forderte ihn die Dunkelhaarige auf, die ihrer Frisur vor einem venezianischen Spiegel mit Bürste und Haarspray den letzten Schliff gab. »Wir sind sowieso schon spät dran. Und wir müssen nicht immer die Letzten sein, weil du wieder einmal nicht aus dem Haus kommst!«
Meine Worte, dachte der Mann am Kontrollpult bitter und schwenkte die Kamera auf die Bilder an den Wänden. Ihr hättet schon vor drei Minuten in den weißen Mini-Cooper einsteigen und in Richtung Innenstadt verschwinden sollen.
»Ciao Sergio!«, tönte es durch den Kopfhörer. »Come va? Tutto bene? Bist du schon unterwegs zu Antonia?«
Zielsicher steuerte die Kamera an den Bildern vorbei, und der Mann im Mercedes konzentrierte sich voll auf die Meisterwerke, blendete die Unterhaltung aus. Matisse, Renoir, dazwischen ein paar holländische Maler. War das ein Roy Lichtenstein? Sieht ganz so aus, dachte er, als plötzlich das Bild verschwamm und ein ohrenbetäubender Krach in seinen Ohren tönte. Die Gemälde schienen nach oben zu rasen, obwohl er vergebens an den Kontrollhebeln zog.
»Tut mir leid, Sergio, aber wir haben hier eine Biene, die nervt!«, hörte er aus nächster Nähe die Stimme von Giovanni. »Hab sie knapp verfehlt!«
»Jetzt lass die Biene in Ruhe!« Die Dunkelhaarige klang verärgert. »Und mit Sergio kannst du von mir aus stundenlang reden, wenn wir da sind. Andiamo!«
Das Bild auf dem kleinen Bildschirm stabilisierte sich, und der Mann im Mercedes atmete auf. Versuchsweise drückte er den Hebel nach links und rechts. Die Kamera sprach an, reagierte allerdings etwas verzögert.
Nach rechts ging gar nichts mehr!
Noch neun Minuten und zwanzig Sekunden.
Der Schlag des Hausherrn musste den vermeintlichen fliegenden Störenfried tatsächlich nur knapp verfehlt oder zumindest gestreift haben, und der Mann am Kontrollpult versuchte, die genauen Schäden zu erfassen.
»Ich muss noch mal zur Toilette«, sagte Giovanni, als er sein Gespräch beendet hatte. »Gruß von Sergio, er ist gerade bei Antonia eingetroffen.«
»Nur wir kommen wieder mal nicht aus dem Haus. Und da heißt es immer, Frauen seien langsam! Ihr Männer seid noch viel schlimmer, und du ganz speziell! Ich geh schon vor zum Wagen und hol ihn aus der Garage. Und bitte beeil dich, Giovanni! Du bist eine wahre Schnecke!«
»Ich mach ja schon«, grummelte der Hausherr halblaut und trabte aus dem Zimmer.
Noch acht Minuten und fünfzehn Sekunden.
Der Mann im Mercedes stabilisierte die Kamera, ergriff sein Kontrollpult und stieg aus. Die Luft war warm, und es duftete nach Rosen. Der Verkehrslärm aus der Stadt drang nur gedämpft hier herauf.
Keine schlechte Gegend zum Wohnen, dachte er und holte aus dem Kofferraum eine große, flache Tasche, die er sich umhängte. Dann klemmte er sich die zusammengelegte Staffelei unter den Arm. Als er den Wagen absperrte, fiel sein Blick auf die Reihe von Garagen, die das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses bildeten. Eines der strahlend weißen Tore schwang auf, gelber Lichtschein fiel auf den Vorplatz, und schließlich rollte der Mini heraus.
»Na endlich«, flüsterte er, verließ den Parkplatz neben der Seilbahn und schlenderte ohne erkennbare Eile über die Straße. Im Licht der Straßenlaterne leuchteten seine kurz geschnittenen blonden Haare auf. Er war schlank, mittelgroß, trug ausgebleichte Jeans und ein verwaschenes T-Shirt und sah mit seiner Umhängtasche, der Staffelei und dem kleinen Kästchen in der Hand aus wie ein Maler, der tagsüber die Schönheit des Tessin auf seine Leinwand gebannt hatte und nun nach getaner Arbeit heimwärts strebte.
Die Lenkerin des Mini hupte ungeduldig drei Mal.
Noch sieben Minuten und zehn Sekunden und noch immer keine Spur von Giovanni.
Erneutes Hupen.
»Ich bin ja schon da, jetzt nerv nicht!«
Drüben, vor dem rostroten Haus, stieg nun auch Giovanni etwas umständlich in den kleinen Wagen, der sofort anrollte und aus der Hauseinfahrt auf die Straße abbog. Durch die offenen Fenster des Minis erklang »Sunrise« von Norah Jones und verwehte rasch, als die Fahrerin in Richtung Stadt beschleunigte.
Der blonde Mann verlor keinen Augenblick, überquerte die Fahrbahn und ging zielstrebig zum Hauseingang, drückte auf alle Klingelknöpfe zugleich und sagte einfach: »Expresssendung für Signore Bartholdi!«, in die Gegensprechanlage.
Licht flammte auf, beleuchtete sein Gesicht. Er war Mitte vierzig, braungebrannt, mit blauen Augen und einem leicht spöttischen Zug um den Mund, unauffällig, vertrauenserweckend.
Einen Augenblick später ertönte der Summer des Türöffners, und während er alle Rückfragen der Hausparteien aus dem Lautsprecher ignorierte, drückte der Mann die schwere Eingangstür aus Metall auf, stand auch schon im erleuchteten Flur, ließ die Treppen links liegen und setzte ohne Zögern seinen Weg tiefer ins Haus fort, in Richtung des Kellers und der Garagen. Dann hielt er an und wartete.
Wenige Augenblicke später verstummten die Stimmen im Hausflur, Türen schlugen zu, und das Licht verlöschte wieder.
Ruhe kehrte ein.
Noch fünf Minuten und fünf Sekunden.
Diesmal würde es knapp werden, dachte er, drehte sich rasch um, lief zu den Treppen, nahm jeweils zwei Stufen auf einmal und eilte ungestört hoch bis in den letzten Stock. Die Straßenbeleuchtung, die durch die Gangfenster hereinfiel, spendete genügend Licht, und so konnte er die beiden Mahagonitüren gut erkennen, die sich gegenüberlagen. Das Messingklingelschild der rechten verkündete in geschwungenen Lettern »Familie Bartholdi«.
Der Mann in Jeans lauschte kurz. Auf diesem Absatz war alles ruhig, während aus den unteren Wohnungen ab und zu Musik oder der Ton einer bekannten Quizshow erklang.
Abendverblödung, dachte er, lehnte behutsam die Staffelei in eine Ecke und aktivierte das kleine Kontrollpult. Giovanni hatte in der Eile offenbar vergessen, eine der Stehlampen im Salon auszuschalten. Das Bild auf dem Display war klar, wackelte aber etwas und zeigte eine unruhige Ansicht der Wand mit den Gemälden.
Die Kamera schien stärker zu schwanken, und er hatte Mühe, sie zu stabilisieren.
Nicht gut, dachte der Mann, gar nicht gut.
Mit einer kurzen Fingerbewegung lenkte er die Kamera weiter nach rechts, entlang der Wand, bis er die Tür erreicht hatte und in den Flur einbog. Je weiter er sich vom Salon entfernte, umso dunkler wurde es, und so musste er wohl oder übel die eingebaute LED einschalten. Wieder eine Minute weniger. Er korrigierte rasch den Timer, der die Zeit herunterzählte.
Nun waren es nur noch zwei Minuten und zwanzig Sekunden.
Die Kamera zeigte einen langen, modernen Schuhschrank, auf dem eine Armbanduhr, eine Brieftasche und etwas Kleingeld lagen, Drucke und Grafiken, einige Wandhaken mit Garderobe. Rasch schwenkte er auf die gegenüberliegende Wand, drehte die Kamera in einem großen Schwenk durch den Flur. Er vermeinte, das Summen auf der anderen Seite der Wohnungstüre hören zu können.
Da war es!
Das Kontrollfeld der Alarmanlage.
Strahlend rote Leuchtdiode neben dunkler grüner, zehn glänzende Metalltasten mit Ziffern von Null bis Neun. Sie spiegelten im starken Licht der LED; das machte es schwierig, die Zahlen abzulesen. Und er durfte keine Zeit mehr verlieren.
»7918« lautete der Code, und der Mann steuerte, sein Blick gebannt auf dem Display, die Kamera auf die Sieben zu. Nach rechts konnte er nicht mehr korrigieren, also musste er jedes Mal sein Ziel genau anfliegen und treffen.
Noch eine Minute und vierzig Sekunden.
Als die Mini-Drohne gegen die Taste mit der Sieben prallte, klickte es vernehmlich. Über das Display zuckten ein paar Lichtblitze, dann wurde das gestörte Bild wieder klar, die Verbindung aufs Neue hergestellt, und die Kamera zeigte eine Großaufnahme des Teppichs im Flur.
Ein paar Hebelbewegungen brachten die bienengroße Drohne erneut in die Luft.
»Links herum!«, ermahnte er sich leise und leitete einen neuen Anflug ein.
Täuschte er sich, oder reagierte die Drohne noch schwerfälliger als zuvor?
Die Taste mit der Neun wurde immer größer auf dem Display, und wieder klickte es.
Als das Bild der Kamera erneut stand, erkannte er, dass die Drohne diesmal auf einen niedrigen Schrank unter dem Kontrollfeld gefallen war.
Noch genau eine Minute, dann würden die Batterien des kleinen Flugobjekts endgültig erschöpft sein.
Diesmal gab es keine Reaktion auf die Hebelbewegungen am Steuerpult, das Bild der Kamera veränderte sich nicht.
Hatte er die Drohne zu heftig auf die Taste aufprallen lassen?
Mit fliegenden Fingern schaltete er die Steuerung aus und wieder ein, bewegte den Hebel. Los jetzt! Das kleine Flugobjekt reagierte, hob endlich ab!
Noch vierzig Sekunden, und zwei weitere Tasten musste er treffen!
Keine Zeit mehr für Flugfehler, dachte er sich und steuerte die Taste mit der Eins an. Doch diesmal erwischte er sie nur am Rand, war sich nicht sicher, ob er den Impuls überhaupt ausgelöst hatte. Die Tonübertragung schien nicht mehr zu funktionieren, weil kein Klick zu hören gewesen war.
Und die Drohne?
Die lag erneut auf dem Teppich, abgestürzt.
Unerbittlich verrann die Zeit, und die roten Leuchtziffern der Uhr begannen hektisch zu blinken.
Noch zwanzig Sekunden.
Und die Drohne bewegte sich nicht!
Das Bild der Kamera funktionierte noch, aber ansonsten schien nichts mehr auf seine Steuerbefehle zu reagieren.
Einschalten. Ausschalten. Tief durchatmen.
Nichts.
Der blonde Mann fuhr sich mit der Hand über die Narbe auf seiner Stirn. War alles umsonst gewesen?
Erneut schaltete er die Steuerung aus und wieder ein. Vom Stockwerk unter ihm hörte er, wie ein Schloss aufgesperrt wurde, die Tür aufschwang und Stimmen lauter wurden. »Sollen wir dich zur Haustür hinunterbegleiten?«
Genau in diesem Moment bewegte sich das Bild auf dem Display wieder. Die Drohne hatte noch Strom und reagierte auf die Steuerbefehle!
Noch zehn Sekunden.
Träge, fast wie in Zeitlupe hob die Drohne vom Boden ab. Das Summen schien immer leiser zu werden, tiefer. Die Batterien waren an ihrem Ende angelangt, der kleine Flugkörper hielt sich nur mehr mühsam in der Luft, taumelte ein wenig. Entschlossen visierte der Mann die Taste mit der Acht an, hielt darauf zu und schaltete die LED aus. Vielleicht schenkte ihm das ein paar Milliwatt mehr, nur einige Sekunden …
Das Display wurde schlagartig finster. Der Flur lag im Dunkel.
Oder war die Kamera bereits ausgefallen?
Oder die Drohne abgestürzt, ohne die Taste überhaupt zu erreichen?
Egal, dachte der blonde Mann und schaltete die Fernsteuerung aus.
No risk, no fun.
Auf zum zweiten Teil!
Er öffnete eines der beiden Flurfenster und schwang sich hinaus. Das schmale weiße Sims, das entlang der Hauswand zu den Balkonen verlief, war schmäler und abschüssiger, als es von unten ausgesehen hatte. Mit einer raschen Handbewegung entriegelte der Mann die Staffelei, klappte die Streben auf und hakte eine der geschwungenen Fußplatten in die Regenrinne des Flachdaches ein. Dann zog er probeweise dran. Es knirschte ein wenig, hielt aber.
Wenige Augenblicke später stand er sicher auf dem Balkon der Familie Bartholdi und atmete tief durch. Was für ein Panoramablick! Für einen Moment nahmen ihn die Lichter und der blauschwarze See, die Berge, deren Gipfel im letzten Tageslicht leuchteten, gefangen. Dann wandte er sich um. Drinnen, im Salon, warf die Tischlampe einen gelben Schein durch die Vorhänge und beleuchtete matt die Gemälde an der Wand.
Zwei Türen, drei Fenster – eine einzige große Glasfront zum See. Zielstrebig ging der Mann zur zweiten Tür, einer Schiebetür, und wollte vorsichtig an der üblichen Stelle einen Keil zwischen Rahmen und Tür treiben, da bemerkte er, dass sie gar nicht verschlossen war, sondern sich frei zurückschieben ließ.
»Das kommt von der Eile, mein lieber Giovanni!« Er lächelte, während er den schweren Flügel weiter aufschob.
Die Vorhänge bauschten sich etwas im Abendwind – und der Eindringling hielt den Atem an.
Alles blieb ruhig. Kein Alarm ertönte.
Er holte tief Luft und nahm die Tasche von seiner Schulter, zog seine Handschuhe an.
Beim ersten Schritt in den Raum könnte die Hölle losbrechen … War die Anlage auf Grün geschaltet, oder stand sie immer noch auf Rot?
Dann betrat er den Salon und sah sich rasch um, lauschte auf verdächtiges Schrillen oder auf das Kreischen der Sirenen. Doch noch immer war kein Laut zu hören. Handelte es sich vielleicht um einen stillen Alarm über eine direkte Leitung zur Polizei?
Mit großen Schritten eilte er zum Flur, warf einen Blick zur Wohnungstür und der Kontrolltafel daneben. Die Leuchtdiode der Alarmanlage schimmerte beruhigend grün im Dunkel. Zufrieden zog er eine winzige Taschenlampe hervor und begann, nach der kleinen Drohne zu suchen, bis er sie schließlich unweit der Kontrolltafel, zwischen zwei Herrenschuhen, auf dem Teppich fand und sie sorgsam in die Tasche steckte.
Die Türen, die vom Flur abgingen, führten in die Küche, in die Gästetoilette und ins Schlafzimmer. Rasch kontrollierte er jeden Raum, ließ den Kegel der Taschenlampe über die Wände wandern. Überall hingen zahlreiche Gemälde, teilweise wild zusammengewürfelt, moderne Kunst neben alten Meistern, oft ohne Rahmen.
Wo zum Teufel war der Picasso?
Als er zurück in den Salon ging, bemerkte er zu seiner Rechten eine Tapetentür, die er vorher übersehen hatte. Vorsichtig stieß er sie auf und leuchtete in den dahinterliegenden Raum. Es war ein Rauchsalon, mit dunklen Möbeln und Regalen voller Bücher, Lehnstühlen und einigen halbleeren Cognac-Flaschen neben übervollen Aschenbechern.
Da!
Zwischen zwei Bücherregalen, halbversteckt hinter einem alten, zurückgeschlagenen Vorhang, hing der Picasso. »Taube mit grünen Erbsen«, gemalt 1912, aus der kubistischen Periode des spanischen Malers.
Der Mann in Jeans lehnte sich gegen den Türrahmen und atmete auf. Bingo! Er nahm die kleine Taschenlampe zwischen die Zähne, trat zu dem Gemälde, holte es vorsichtig von der Wand und betrachtete es kurz. Ocker-, Grau- und Brauntöne, eine etwas verzerrte, kantige Taube, Erbsen in ihrer Kralle.
Schätzwert derzeit 23 Millionen Euro.
Gestohlen aus dem Pariser Museum für Moderne Kunst am 20. Mai 2010.
Nicht versichert.
Der blonde Mann griff in die mitgebrachte Tasche und holte eine exakte Kopie des Picasso heraus, die er anstelle des Originals an die Wand hing. Dann zog er den Vorhang halb drüber, zupfte so lange, bis er zufrieden war, verstaute das wertvolle Originalgemälde Picassos in seiner Tasche und verließ den Rauchsalon.
Als er wieder im Flur stand, kam ihm eine Idee. Er ging zur Wohnungstür und drückte probeweise die Klinke. Offen.
»Wie nachlässig«, murmelte der Eindringling kopfschüttelnd. »Frauen können manchmal ganz schön überzeugend sein – vor allem wenn sie ungeduldig hupen …«
Erleichtert eilte er zum Balkon, holte seine Staffelei, zog die große Schiebetür zu und vergaß nicht, die Alarmanlage wieder scharf zu stellen, bevor er leise die Eingangstür der Wohnung hinter sich schloss und ungesehen das Haus verließ.
Kaum zehn Minuten später parkte er den schwarzen Mercedes-Bus mit dem französischen Kennzeichen nahe des Bahnhofs und legte die Schlüssel auf den rechten Hinterreifen. Dann warf er seinen Seesack über die Schulter und verschwand in der Dunkelheit.
*
Die beiden Männer, die um Mitternacht aus einem Taxi stiegen, schienen von einem Fest zu kommen und ein wenig angetrunken zu sein. Sie lachten und stützten sich gegenseitig, schwankten ein wenig und trotteten schließlich einträchtig Arm in Arm davon. Als sie in die Via Montarinetta einbogen und den schwarzen Mercedes Viano vor sich stehen sahen, wurden sie offenbar schlagartig nüchtern. Sie liefen zu dem Bus, holten die Schlüssel aus ihrem Versteck und drückten die Taste der Zentralverriegelung. Dann rissen sie die Heckklappe auf und sahen sich an. Die Umhängetasche lag vor ihnen, eine Staffelei mit seltsam geformten Füßen daneben.
»Wenn sie jetzt leer ist?«, gab der Kleinere von beiden zu bedenken und wies auf die schwarze Tasche.
Der andere schüttelte nur stumm den Kopf. Dann griff er zu und öffnete sie vorsichtig. Im Licht der Innenraumbeleuchtung sah er die Signatur, erkannte die Taube.
»Und?«, stieß sein Begleiter atemlos hervor.
»Man sollte ihn nicht unterschätzen«, antwortete der Größere ruhig, »niemals.« Er zog eine Lupe aus seiner Jackentasche und untersuchte das Gemälde kurz, nickte dann zufrieden. »Der Picasso ist hiermit wieder im Besitz des Museums. Ruf den Direktor an!«
20. Juli 2014
FLUGHAFEN GHAD, IM SÜDWESTENDER PROVINZ FESSAN/LIBYEN
»Du scherzt, oder?« Amber Rains schob die Sonnenbrille hoch und warf einen zweiten Blick auf die alte DC-3, die zwischen zwei Hangars wie ein Relikt aus lang vergangener Zeit parkte.
Ein paar Mechaniker in kurzen Hosen, T-Shirts und Basecaps waren dabei, einen der Turboprop-Motoren wieder einzubauen. Sie hatten dazu jede Menge Schraubenschlüssel und einen simplen Flaschenzug zur Verfügung. Der Motor lag vor dem Flügel auf etwas, das dem übergroßen Einkaufswagen eines Baumarkts ähnelte.
»Seh ich so aus?« John Finch blieb stehen, stemmte die Hände in die Hüfte und blickte ebenfalls zu den Männern hinüber, die inzwischen lautstark diskutierten. »Das ist die beste Mechaniker-Crew, die es hier für Geld zu kaufen gibt.«
»Sag bloß…« Die schlanke, drahtige Frau in Fliegerjacke und Cargo-Hose lehnte ihren Seesack gegen das sandgestrahlte Wellblech und runzelte die Stirn. »Lass mich raten. Es stand gerade keine andere zur Verfügung …«
John klopfte ihr auf die Schulter. »Deswegen habe ich dich ja mitgenommen. Jetzt bist du da, und das potenziert den Qualitätslevel des lokalen Trupps gleich um den Faktor zehn.«
Die Frau mit den kurz geschnittenen dunkelblonden Haaren und dem schmalen Gesicht, in dem große braune Augen etwas skeptisch in die Welt blickten, sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Das war also der Haken an deiner Geschichte«, murmelte sie und beobachtete die Männer, wie sie die Ketten an den Motorbefestigungspunkten festmachten.
Amber Rains, eine begnadete Mechanikerin und begeisterte Pilotin, war vor etwas mehr als fünfzig Jahren in London zur Welt gekommen. Ihre Eltern, weitgereiste Diplomaten im Dienst der Krone, hatten es keineswegs als lustig empfunden, als sich ihre Tochter lieber einen Werkzeugkasten als ein Puppenhaus zu Weihnachten wünschte und nach der Bescherung sofort Anstalten machte, den familieneigenen Mini in alle Einzelteile zu zerlegen. Nachdem sie ihn wieder fehlerfrei zusammengebaut hatte, dachte ihr Vater, damit sei die technische Neugierde seiner heranwachsenden Tochter befriedigt und man könne zu Schulabschluss, Studium und diplomatischer Laufbahn übergehen.
Doch weit gefehlt.
Der geniale Sturkopf Amber beendete die Schule ein Jahr früher als vorgesehen und dachte trotzdem nicht daran, sich an der Universität einzuschreiben. Viel lieber trampte sie nach Duxford, dem einstigen Flugfeld der Royal Air Force nördlich von London, und sah den alten Mechanikern bei der Restaurierung von Lancaster Bombern und Sternmotoren über die Schulter. Zudem war sie hartnäckig, aufgeweckt und hübsch genug, um rasch auf die andere Seite der Absperrung in den Werkshallen zu gelangen.
Bald waren ihre Hände schwarz vom Öl, ihre Nägel abgebrochen und sie glücklich.
Anders ihr Vater.
Sir Arthur Rains war »definitely not amused«, drohte mit Enterbung und sprach von Jugendflausen, die er seiner Tochter rasch austreiben würde. Was damit endete, dass einige Tage später Amber ihre Koffer packte, aus dem Haus in Mayfair aus- und in eine kleine Pension in Duxford einzog, jeden Tag an den alten Maschinen schraubte und bald in einem der angeschlossenen Restaurierungsbetriebe als Lehrling aufgenommen wurde. Ihr Chef merkte nur zu schnell, dass er ein Naturtalent vor sich hatte, und unterstützte sie mit allen Kräften. Er bezahlte ihr sogar die Pilotenausbildung, die sie in Rekordzeit absolvierte und mit Bravour bestand.
Die Folgen waren weitreichend – zumindest was die Familie betraf. Ihr Vater sprach nicht mehr mit ihr, ihre Mutter versuchte, sie zu verstehen, und überwies Amber jeden Monat ein wenig Geld. Als ihre Eltern eines schönen Tages an die Botschaft nach Algier versetzt wurden, machte Amber ihre Gesellenprüfung und – aufgrund ihrer außergewöhnlichen Begabung – wenig später ihren Meister.
Dann ging auch sie nach Afrika – einerseits, um mit diesem Schritt ihren Vater zumindest ein wenig zu versöhnen und näher bei ihren Eltern zu sein, andererseits, weil Amber nach einer missglückten Beziehung und den damit verbundenen tränenreichen Szenen ein Wechsel des Landes reizvoll erschien.
So lief eines Tages eine blasse, übernächtigte Amber Rains in Kairo, an der Bar des legendären Continental-Savoy, einem gewissen John Finch über den Weg. Der, nach etlichen Flaschen Sakkara-Bier und einigen Gläsern Islay Single Malt Whisky in leichter Schräglage, suchte für einen Flug tags darauf nach Gabun einen Copiloten. Amber wiederum machte ihm klar, dass er ihn gerade gefunden hatte, und John willigte schulterzuckend ein. Später behauptete er immer wieder wenig charmant, dass er in diesem promilleträchtigen, illuminierten Zustand selbst einen Gorilla engagiert hätte.
Ab da waren beide unzertrennlich, flogen mit einer alten DC-3, die John gekauft hatte und die Amber in der Luft hielt, bis nach Kapstadt und Tansania, transportierten Waffen und Flüchtlinge, Diamanten und Soldaten, Schmuggelgut oder auch die Lebensmittelhilfe der Vereinten Nationen. Sie waren ein eingespieltes Team, am Boden und in der Luft. Für einige Jahre waren sie ein Paar, doch dann entschloss sich Amber spontan – nach einem der unzähligen schiefgegangenen Versuche, sich mit ihrer Familie auszusöhnen – wieder nach Duxford zurückzukehren.
John akzeptierte ihren Entschluss und legte ihr nichts in den Weg. Er wusste selbst am besten, wie schwer es war, den Virus Afrika loszuwerden.
Und sich im engen England wieder zurechtzufinden …
Wenige Jahre später, die zum Ende hin ein einziges emotionales und wirtschaftliches Fiasko gewesen waren, kehrte auch Finch Afrika den Rücken und ging nach Brasilien, an die Ufer des Rio Negro, um eine private Charterfluglinie zu eröffnen. Doch das war nun auch schon ein paar Jahre her …
Ein glühend heißer Wind wehte von Osten her, aus der Sahara und dem Akakus-Gebirge, das die Eingeborenen respektvoll den »Berg des Teufels« nannten. Der gelbe Sand der Dünen, der manchmal wie ein wütender Derwisch zwischen den Flughafengebäuden in der Luft tanzte, überzog alles mit einem feinen, allgegenwärtigen Staub, der in jede Ritze eindrang und einem den Atem raubte. Er hatte auch die ehemals rot-gelbe Bemalung der DC-3 fast zur Gänze abgeschliffen. Ein unermüdlicher, natürlicher Sandstrahler unter der sengenden afrikanischen Hitze.
»Ich frage mich ja, wie du diese fliegenden Antiquitäten immer wieder auftreibst.« Amber wunderte sich. »Die findet man doch nicht bei Ebay, Rubrik ›gebrauchtes Fluggerät‹. Hier ist der Arsch der Welt. Bis vor einem halben Tag wusste ich nicht einmal, dass es diesen Flughafen überhaupt gibt. Das Grenzgebiet zwischen Algerien und Libyen ist nicht gerade ein Hotspot der Tourismus-Industrie, sondern selbst nach internationalen Standards lebensgefährlich. Hierher gibt niemand eine Reiseempfehlung aus. Eher eine Fluchtempfehlung …«
»Was ist los?«, unterbrach John sie. »Hast du deinen Badeanzug vergessen und deshalb schlechte Laune?«, stichelte er weiter. »Ghad war seit jeher ein wichtiger Umschlagplatz für Karawanen, eine bedeutende Station des Transsahara-Handels.«
»Ach ja? Lass mich raten. Das war vor gefühlten tausend Jahren? Sieh dich um! Wenn ich einen Kreis ziehen würde von – sagen wir – einem Radius von fünfhundert Kilometern, dann hätte ich was genau abgedeckt? Eine Million Dünen, zehntausende Kamele, eine Hand voll Tuareg, dafür jede Menge Quadratkilometer an heißer, öder, menschenfeindlicher Landschaft?«
»Immerhin gibt es im Zentrum des Kreises einen Flughafen mit zwei asphaltierten Lande- und Startbahnen.«
»Und weißt du auch, warum?« Amber hatte sich in Rage geredet. »Weil wir genau zwölf Kilometer von der algerischen Grenze entfernt sind und Oberst Gaddafi damals einen strategisch günstig platzierten Nachschub-Flughafen auf dem Weg nach Süden einrichten wollte. Das ist ein Geisterflugplatz mitten in der Wüste, John. Kein Taxi, kein Bus, kein Hotel. Nein, ich möchte auch keinen Ausflug in die Metropole Ghad unternehmen. Mir reicht schon der Flughafen. Und eine einzige Verbindung jeden Tag von und nach Tripolis würde ich jetzt nicht unbedingt einen ausgefüllten Flugplan nennen.«
»Korrekt, aber da ist noch die alte Lady …«
Er wies auf die DC-3. Der Motor hing am Haken und war auf dem Weg nach oben. Der Pilot hielt die Luft an, als das provisorische Gestell mit dem Seilzug bedrohlich schwankte.
»Wie charmant«, fuhr Amber unbeirrt fort. »Wenn meine Crew in Duxford den Vogel sehen würde, dann gäbe es Daumen runter und eine einhellige Meinung: Streichholz!«
Nachdem sie von Kairo nach England zurückgekehrt war, hatte Amber Rains die ARC gegründet, die sich in wenigen Jahren zum größten Unternehmen in Duxford entwickelt hatte und sich mit dem Service und der Restaurierung von Flugzeugen beschäftigte. Doch auch das hatte ihren Vater nicht darüber hinweggetröstet, dass seine Tochter völlig aus der Art geschlagen war. Er war mit seiner Frau am Ende seines aktiven Dienstes von Ägypten nach London zurückgekehrt und hatte sich hartnäckig geweigert, auch nur ein einziges Mal nach Duxford zu fahren.
»Streichholz? Ja, um die Feiertagszigarre anzuzünden«, gab John trocken zurück. Er fuhr sich mit der Hand über die grauen, kurz geschnittenen Haare und fragte sich zum ersten Mal, ob er nicht einen Fehler gemacht hatte, als er sich entschieden hatte, die betagte Douglas DC-3 einem Waffenhändler abzukaufen, der im Zuge des Umsturzes in Libyen rasch aus dem Land verschwunden war. »Die trockene Luft hier hat sie perfekt konserviert. Fast so gut wie in Arizona.«
»Hä?« Amber fuhr herum und funkelte ihn an. »Du bist und bleibst ein unverbesserlicher Optimist, John Finch. Nur hast du ganz nebenbei vergessen, dass es in Arizona keinen Sand gibt, der tonnenweise durch die Luft fliegt, wie in diesem natürlichen Sandstrahler hier. Weiß Fiona überhaupt, dass wir hier sind?« Amber Rains schaute ihm aufmerksam in die Augen.
Fiona Klausner, Johns Freundin, war vor einigen Tagen aus beruflichen Gründen nach Zürich geflogen. Nach ihrem letzten gemeinsamen Abenteuer in Nordafrika hatte sie mit Finch erst einmal einen Monat Urlaub im altehrwürdigen Hotel Cecil in Alexandria gemacht. Es hatte ihrer Beziehung gutgetan.
Fiona und John hatte im Jahr davor eine kurze, aber heftige Affäre verbunden. Nachdem Wilhelm Klausner, Fionas Großvater, am Rio Negro bei der Sprengung von Johns Wasserflugzeug, der Albatross, ums Leben gekommen war, hatte Fiona dem Wunsch ihres Großvaters entsprechend eine Stiftung gegründet und deren Vorsitz übernommen. In dieser Aufgabe war sie um die ganze Welt geflogen, und so war auch die Liebesgeschichte zwischen John und Fiona im Sand verlaufen, mangels Zeit und Nähe.
Doch der Urlaub im Cecil hatte alles geändert. Die Suite mit dem Blick aufs Mittelmeer hatte den beiden so gut gefallen, dass John sie, einer alten Tradition folgend, nun schon fast drei Jahre mit Beschlag belegt hatte.
»Fiona? Gute Frage, nächste Frage«, konterte Finch. »Ein alter Freund von mir würde sagen – no need to know.«
»Auch dein alter Freund lügt manchmal, wenn es ihm in den Kram passt. Und das letzte Mal ist doch noch nicht so lange her, wenn ich genauer darüber nachdenke … Ich nehme doch an, du sprichst von Peter Compton, der grauen Eminenz der britischen Geheimdienste.«
Der Pratt-&-Whitney-Sternmotor hatte seinen Platz am Flügel erreicht, und die Mechaniker machten sich daran, ihn auszurichten und die ersten Bolzen einzusetzen.
Amber sah genauer hin, dann stürmte sie mit einem lauten: »Herrjeh! Nein! Doch nicht den zuerst!«, los.
John sah ihr lächelnd nach. Amber war die beste Mechanikerin, die er sich wünschen konnte. Gerade bei alten Flugzeugen kam es auf Intuition, Geschick und viel Erfahrung an. Und wann die DC-3 das letzte Mal überprüft worden war, das stand in den Sternen. Die beiden nicht gerade leistungsstarken Motoren mussten auf jeden Fall einwandfrei funktionieren, denn die Gegend zwischen Ghad und Tunis war keineswegs für Not-, sondern nur für Bruchlandungen geeignet.
In einem hatte Amber recht gehabt, musste sich John allerdings eingestehen und runzelte die Stirn: Hier gab es nur Sand, Felsen und Einsamkeit, so weit das Auge reichte. Selbst auf dem kürzesten Weg nach Tunesien, entlang der Grenze, war gerade mal ein einziger offener Ausweichflughafen eingezeichnet. Das war einer der Gründe, warum er Fiona nichts von seinem Vorhaben erzählt hatte. Sie wäre keineswegs begeistert gewesen und hätte darauf bestanden, dass John sie nach Zürich begleitete. So hätte sie ihn unter Kontrolle gehabt …
Unwillkürlich musste John lächeln. Er war nicht leicht zu kontrollieren, war es nie gewesen. Seine Entscheidungen waren immer spontan gewesen, sein ganzes Leben lang. Überraschend war, dass er fast nie auf die Nase gefallen war.
Fast nie …
Nachdenklich betrachtete er die Douglas DC-3 mit seinen grüngrauen Augen, die von Lachfalten umrahmt waren. Amber gab inzwischen lautstarke Kommandos in einem Mischmasch aus verschiedenen Sprachen, von dem John nur einen Bruchteil verstand. Durch das Cockpitfenster konnte er Sparrow erkennen, den Papagei, der ihn vor zwei Jahren in Südamerika adoptiert hatte und seither nicht von seiner Seite wich. Aufgeregt trippelte er auf dem rissigen Armaturenbrett hin und her und wartete auf den Abflug.
Die alte Propellermaschine erinnerte John an seine Jugendtage, damals in Kairo, als Afrika noch sein Abenteuerspielplatz war, wie er es immer bezeichnete. John Finch, geboren und aufgewachsen in Crawley, im Süden Englands, war 1962 nach Kairo gekommen, gerade einmal achtzehn Jahre alt.
Dank seines Vaters hatte er damals bereits zehn Jahre lang in Flugzeugcockpits gesessen. Erst auf dem Schoß des berühmten Jagdfliegers der Royal Air Force, dann daneben. Der alte Martin Finch hatte nie viel von Vorschriften gehalten. »Die Freiheit da oben gehört dir«, hatte er immer zu seinem Sohn gesagt, »lass sie dir nicht von Kleingeistern vermiesen.« Dann hatte er John den Steuerknüppel in die Hand gedrückt und demonstrativ die Augen geschlossen. Und so hatte John seinen Vater geflogen, durch Gewitterfronten und Regenschauer, Luftlöcher und Sturmböen. Hatte neben dem schweigsamen Fliegerass gesessen und sich gefragt, ob sein Vater hin und wieder blinzelte … So hatte John Fliegen gelernt wie andere Jungs Radfahren. Instinktiv, wie selbstverständlich, unter den aufmerksamen, geschlossenen Augen seines Vaters.
Nur das eine Mal war er nicht dabei gewesen … Jenes eine Mal, das sein ganzes Leben verändern sollte.
Als John an dem Wrack angekommen war, während die Rettungsmannschaften noch verbissen arbeiteten und seinem Vater doch nicht mehr helfen konnten, da wurde ihm klar, dass er ab nun alleine würde fliegen müssen.
Sein Vater hatte die Augen für immer geschlossen.
Er hatte lange dagestanden, an der Absturzstelle, stundenlang. Die Hände tief in den Taschen vergraben, den Kopf gesenkt, die Gedanken in den Wolken.
Erst waren die Rettungsmannschaften abgezogen und hatten die Leiche seines Vaters mitgenommen, dann die Beamten der Untersuchungsbehörde. Zuletzt hatten sie die Reste des Flugzeugs abtransportiert und mit ihnen Johns heile Welt und alles, woran er glaubte.
Die Nacht war gekommen, und er hatte immer noch dagestanden.
Endlich, lange nach Einbruch der Dunkelheit, hatte er sich vor Kälte zitternd umgedreht und geschworen, entweder bald genauso zu sterben oder zum Andenken an seinen Vater noch besser zu werden.
Am Limit zu fliegen und trotzdem zu überleben.
An die nächsten Tage konnte sich John nicht mehr erinnern. Sie waren ein Wirrwarr aus Emotionen und Verzweiflung, aus Trotz und Angst. Er wusste nicht, wo er gewesen war. Irgendwann war er wieder nach Hause gekommen.
Die Behörden hatten seiner Mutter den Tascheninhalt ihres Mannes ausgehändigt, darunter einen Silberdollar von 1844. Es war das einzige Erinnerungsstück an seinen Vater, das John einsteckte und mitnahm – auf die Reise seines Lebens.
Wortlos packte er seinen kleinen Koffer, hängte sich seine Fliegerjacke um die Schultern und stopfte das wenige Geld, das er gespart hatte, in die Tasche. Nachdem er seine Mutter flüchtig umarmt hatte, machte er sich auf den Weg zum Bahnhof, zu Fuß, durch den strömenden Regen.
So sah niemand seine Tränen.
Er wollte weg, nur weg.
Weg aus dem engen, kalten und nassen England, weg von den Erinnerungen an sein einziges Idol, weg von seinem bisherigen Leben.
Früh genug musste er erkennen, dass man nicht vor allem davonlaufen konnte.
Einiges trug man im Herzen bis ans Ende aller Tage.
Doch diese Erkenntnis kam erst in Afrika.
Am Bahnsteig angekommen, schlenderte er ziellos auf und ab. Der Regen hatte nachgelassen, und Windböen trieben Zeitungsfetzen über den feuchten Asphalt. John hatte noch immer keine Ahnung, wohin er fahren sollte.
Der nächste Zug? Fuhr nach London …
Auch gut, sagte sich John und steuerte die einzige Bank unter dem Vordach an, auf der eine alte Frau trotz der Kälte vor sich hin döste. Da fiel ihm plötzlich ein verblasstes Plakat ins Auge, das neben einem zerschrammten Zigarettenautomat hing und im Wind flatterte. Es machte Werbung für das Continental-Savoy Hotel in Kairo. Im Schattenriss thronte die Sphinx vor drei Pyramiden unter einem heißen Himmel, umgeben von Sanddünen und beschienen von einer glutroten Sonne.
Plötzlich wusste John, wohin ihn sein erster Weg führen würde.
So geschah es, dass ein blasser, junger Mann einen Tag später durch die Drehtür mit den geschliffenen Gläsern ging und zum ersten Mal das ehrwürdige Hotel an der Shareh Gomhouriah in der ägyptischen Hauptstadt betrat.
Nach einem Blick auf die Zimmerpreise beschloss er, mit dem Schicksal zu pokern. Seine Ersparnisse reichten nämlich gerade mal für sieben Nächte. Danach war er entweder pleite, oder er hatte einen Job, der ihm sein Leben im Hotel finanzieren würde.
Vier Tage später verlängerte er seine Zimmerbuchung auf unbestimmte Zeit und flog seinen ersten Auftrag. Der Algerienkrieg tobte, und man suchte junge, unerschrockene Männer, die Geld brauchten, nichts zu verlieren hatten und flogen wie der Teufel. Man stellte keine Fragen und erwartete auch keine. Fluglizenz? Erfahrungen? Nebensächlichkeiten.
»Bring die Kiste heil wieder zurück, und du bekommst den nächsten Auftrag«, hieß es. »Brauchst gar nicht duschen gehen, kannst gleich wieder starten.«
So war John ins Cockpit gestiegen, immer und immer wieder, und in den folgenden Jahrzehnten zu einer Legende geworden. Er flog für alle und jeden, der genug bezahlte und das Glück hatte, ihn auf dem Boden zu erwischen. Er war fast immer unterwegs, flog durch Wüstenstürme und Bürgerkriege, in der Dunkelheit über Grenzen oder schlüpfte unter dem feindlichen Radar hindurch. Er schmuggelte Goldbarren aus Südafrika, Sklaven aus Nigeria oder Diamanten aus den Minen von Botswana, schaffte Soldaten nach Äthiopien und holte Söldner aus schwarzafrikanischen Krisenherden. Er wurde in Dollar oder ägyptischen Pfund bezahlt, manchmal auch mit Taschen voller Maria-Theresien-Taler.
Das Leben war ein großes Abenteuer, und John genoss es in vollen Zügen, auch wenn in der Zwischenzeit seine Schläfen bereits grau und die Lachfalten um seine Augen tiefer geworden waren.
Und nun? Nun stand er auf einem verlassenen Flughafen an der libysch-algerischen Grenze und fragte sich, ob er die fünfzig Jahre alte DC-3 jemals in die Luft bekommen würde. Und dann über Tunis heil zurück nach Kairo gelangen würde.
Aus dem heißen Griff der Wüste hinaus aufs blaue Mittelmeer.
Zwei Stunden später spuckten die Motoren der alten Propellermaschine lautstark, stießen Qualmwolken aus, stotterten und spotzten und husteten und zögerten noch einmal. Dann sprangen sie schließlich an.
»Freu dich nicht zu früh«, warnte Amber und steckte ihren Kopf aus dem Cockpitfenster, um besser zu sehen und zu hören. »Das klingt bescheiden. Den Kaufpreis für dieses fliegende Wrack musst du aus der Portokasse bezahlt haben.«
Während sich draußen vor der Maschine die Mechaniker lachend und begeistert auf die Schulter klopften, betrachtete Amber mit gerunzelter Stirn die Skalen der Anzeige-Instrumente, lauschte den Motoren und drückte Knöpfe. John ging die Steuerung durch, die Ausschläge der Ruder, kontrollierte den Funk und die Kanäle, bevor er aufstand, aus der Maschine auf den heißen Beton sprang, um die Reifen und das Fahrwerk samt Hydraulik auf Lecks hin zu überprüfen.
Die Motoren liefen nun regelmäßiger, und als Amber die Drehzahl erhöhte, blies es auch die letzten Zylinder frei.
John, der sich bereits auf einen etwas längeren rustikalen Aufenthalt in einem der Hangars eingerichtet hatte, atmete auf. Nachdem die Propeller wieder zur Ruhe gekommen waren, begannen die Mechaniker nach einer letzten Sichtkontrolle die Motorabdeckungen zu montieren.
»Weißt du, dass du mehr Glück als Verstand hast?« Amber, Sparrow auf ihrer linken Schulter, trat zu Finch unter die DC-3 und schob ihre Ray-Ban auf die Stirn. »Ich habe in den Unterlagen einen D-Service-Report gefunden, der rund ein knappes Jahr alt ist. Da haben sie den Vogel in Algier komplett durchgecheckt.« Sie hob die Augenbrauen und fixierte den Piloten. »Ob die Bodencrew ihre Arbeit verstanden hat, steht nicht drin. Aber es gibt einem zumindest ein besseres Gefühl vor dem Abheben.« Ihr schelmisches Lächeln beruhigte John allerdings nicht im Mindesten. »Oder sollte ich sagen – vor dem Ableben?«
»Dir vielleicht«, meinte John trocken. »Bleibt die Frage, warum sie die DC-3 dann wieder nach Libyen zurückbrachten, nachdem sie schon im Ausland war.« Er löschte die Taschenlampe und sah Amber eindringlich an. »Das wäre, als würden die Ratten aufs sinkende Schiff zurückkehren«, meinte er leise. »Gefällt mir ganz und gar nicht. Vielleicht sollten wir so rasch wie möglich von hier verschwinden.« John warf einen letzten misstrauischen Blick auf die Reifen.
»Was ist so Merkwürdiges daran, die DC-3 wieder von Algier nach Libyen zurückzufliegen nach der Durchsicht?« Amber lehnte sich gegen die Motorabdeckung und schaute John fragend an.
Sparrow kreischte: »Alle Mann an die Kanonen!«, und flatterte auf Johns Schulter.
»Wenn du in Zeiten einer Staatskrise ein Flugzeug im Ausland hast, dann lässt du es da«, erwiderte Finch ungerührt. »Selbst als reicher, libyscher Waffenhändler. Wozu sollte es gut sein, es in ein umkämpftes, halb zerstörtes Land zurückzubringen, in dem das politische Chaos herrscht?« Er warf einen vorsichtigen Blick in die Runde. »Egal. Von mir aus können wir starten, und angesichts des sehr überschaubaren Flugaufkommens sollte die Startfreigabe jetzt gleich auch kein größeres Problem darstellen.«
»Ist der Tower überhaupt besetzt?«, erkundigte sich Amber misstrauisch und sah einer kleinen Sandhose nach, die zwischen den Hangars im heißen Wind tanzte, während sie Plastiktüten und Papierfetzten vor sich her trieb. »Irgendwie gespenstisch hier. Zu ruhig für einen internationalen Flughafen. Zwei verlassene Startbahnen in einer menschenleeren Gegend.«
Die Mechaniker verabschiedeten sich einer nach dem anderen mit Handschlag, kassierten ihren Lohn und verschwanden eilig in einem rostigen, japanischen Kleinbus, eingehüllt in eine hellgelbe Staubwolke. John sah ihnen nach und fragte sich, wo und wann sie das nächste Mal einen Flugzeugmotor reparieren würden. Oder kehrten sie alle in irgendwelche Autowerkstätten der Umgebung zurück und hämmerten eifrig wieder Beulen aus Motorhauben? Oder dengelten Kotflügel aus Ölfässern?
»Kümmerst du dich um den Papierkrieg? Ich bereite alles für den Start vor«, riss ihn die Stimme Ambers aus den Gedanken. Sie kletterte erneut in die DC-3, ohne eine Antwort abzuwarten.
John nickte stumm und sah den Runway hinunter.
Die Hitze flimmerte Wellen in den Asphalt. Es war höchste Zeit zu verschwinden.
Die Büros im Tower waren tatsächlich besetzt, und der Papierkrieg nicht einmal ein Scharmützel. John hatte den Eindruck, dass die wenigen gelangweilten Mitarbeiter nur sehnlichst darauf warteten, ihn mitsamt der DC-3 starten und zwischen den träge dahintreibenden Kumulus-Wolken verschwinden zu sehen. Dann würde der Flughafen erneut in einem Dornröschenschlaf versinken, zumindest bis zur nächsten, fast leeren Maschine aus Tripolis am nächsten Tag.
Mit den nötigen Papieren bewaffnet warf John die Tür der DC-3 zu, setzte Sparrow auf eine der Sitzlehnen und verriegelte den Einstieg sorgfältig. Amber hatte erneut die beiden Motoren gestartet und ließ sie warmlaufen. Ihr gleichmäßiges Brummen hatte etwas Vertrauenserweckendes. Doch das flaue Gefühl in Johns Magen blieb. Der Gedanke an den ehemaligen Besitzer der alten Dame ließ ihn nicht los. Ein Waffenhändler auf der Flucht, der sein Flugzeug nach der Durchsicht und Wartung wieder in das krisengeschüttelte Libyen zurückkehren ließ?
Seltsam …
John blickte durch das Fenster der Tür nach draußen. Weit und breit war niemand zu sehen. Nur Steinwüste und tanzender Sand und die Berge des Teufels am Horizont …
Der Pilot schüttelte den Kopf und ging den leicht ansteigenden Mittelgang nach vorne zum Cockpit. Noch ein paar Stunden länger in dieser Steinwüste, und er würde anfangen, Geister zu sehen.
»Machen wir, dass wir wegkommen!«, rief er Amber zu und wollte sich durch die enge Tür ins Cockpit zwängen, da bemerkte er eine schattenhafte Bewegung in der vordersten Sitzreihe zu seiner Linken.
»Ich bin ganz Ihrer Meinung, Mr. Finch. Sie haben Verspätung.«
Der schlanke, hochgewachsene Mann im Tarnanzug, mit dem schwarzen Béret auf dem Kopf, war bis an die Zähne bewaffnet. Sein modernes Sturmgewehr hatte er auf den grauen Klapptisch vor sich gelegt, die Desert Eagle, deren Lauf auf John zeigte, hätte mit einem Schuss selbst die Motoren der DC-3 in die ewigen Jagdgründe befördern können.
»Und ich hoffe, Sie machen heute Ihrem Namen alle Ehre«, fuhr er fort. »Man behauptet ja von Ihnen, dass Sie jede Fracht rasch und zuverlässig an ihr Ziel bringen. Und meines ist Tunis.«
»Normalerweise schießt meine Fracht nicht auf mich«, entgegnete John mit einem Blick auf die großkalibrige Pistole. »Damit können Sie mich nicht beeindrucken. Wenn Sie mit der hier herumknallen, dann fliegen wir nirgendwo mehr hin.«
Mit einem schmallippigen Lächeln, das seine Augen nicht erreichte, schwenkte der Mann, der etwas über dreißig Jahre alt sein mochte, den Lauf der Waffe in Richtung der dünnen Verbindungswand zum Cockpit, hinter der Amber Rains im Pilotensessel Platz genommen hatte und die Skalen der Anzeigeinstrumente überwachte. »Glauben Sie mir, Mr. Finch, im Ernstfall fliegen Sie diese Maschine doch auch allein, oder? Wer braucht schon eine Copilotin?«
John beobachtete den Unbekannten, taxierte ihn, suchte den Blick seiner dunkelbraunen Augen. Die kurz geschnittenen schwarzen Haare und die Ausrüstung sprachen für einen Soldaten, aber die weichen Lippen und der etwas unsichere Zug um die Mundwinkel erzählten noch eine ganz andere Geschichte.
»Sie haben jetzt die Wahl«, fuhr der Uniformierte fort. »Entweder Sie bringen mich nach Tunis, und da trennen sich unsere Wege. Sie haben mich nie gesehen und setzen Ihren Flug nach Kairo fort.«
»Oder?«, fragte John lauernd.
»Oder Ghad wird der letzte Flughafen auf Ihrer langen Reise von England durch die Welt. Ich war in diesem Land zu Hause und kenne mich aus. Hier verschwindet man in den politischen Wirren schneller als ein Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte. Niemand wird jemals Ihre Leichen finden …«
»… und Sie sitzen hier fest«, lächelte John grimmig, »mit einer alten DC-3 ohne Piloten, auf einem Flughafen im Nirgendwo, von der eine einzige Maschine jeden Tag startet. Und Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie ein Ticket auf diesem Linienflug buchen, ohne einen Volksauflauf zu verursachen. Patt!«
Ein wachsamer Ausdruck trat in die Augen des Unbekannten, doch der Lauf der Desert Eagle zeigte unverwandt auf die Zwischenwand und Amber. Mit einem lauten Klick entsicherte er die Waffe. »Dann lassen Sie es einfach drauf ankommen«, grinste er. »Frauen in diesem Alter sind sowieso zu nichts mehr zu gebrauchen …«
»Ich kenne Sie von irgendwoher«, murmelte Finch nachdenklich, ohne den Einwurf zu beachten. Er verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich gegen die Trennwand zum Cockpit. »Wenn ich Sie schon ausfliegen soll, dann möchte ich zumindest Ihren Namen wissen. Sonst geht von hier kein Flug für Sie nach draußen.«
Für einen Moment arbeitete es in dem Gesicht des Uniformierten. Dann lächelte er überheblich. »Mein Name ist Khamis Al-Gaddafi, Sohn von Muammar Al-Gaddafi, und ehemaliger Kommandeur einer Eliteeinheit, der 32. Brigade. Leutnant Umar, mein Begleiter, leistet gerade Ihrer Copilotin Gesellschaft. Und jetzt, Mr. Finch, bewegen Sie Ihren Arsch ins Cockpit, und bringen Sie uns nach Tunis. Ich habe bereits vier Mal meinen Nachruf in den internationalen Medien gelesen und nichts mehr zu verlieren. Offiziell bin ich bereits lange tot.«
VERSCHIEBEBAHNHOF »PORTA NUOVA«, TURIN/ITALIEN
Der Güterzug stand nun schon seit Stunden in der prallen Juli-Sonne. Neben einem halben Dutzend fast neuer Containerwagen und zwei Agip-Tankwagen bestand er ausschließlich aus gedeckten Waggons, die im Laufe der Jahre rostbraun und fleckig geworden waren. Nur die Laufzettel hinter ihrem dünnen Gitter leuchteten weiß, als wären sie soeben aus dem Drucker gekommen.
Als die Diesellok der italienischen Staatsbahnen sich vor den ersten Wagen setzte, ging ein Ruck durch den gesamten Zug. Puffer stießen aneinander, Kupplungen quietschten. Ein Junge, der über den Sottopassagio Lingotto gelaufen war, beugte sich neugierig über das Brückengeländer und schaute hinunter. Er liebte Züge, den Geruch nach Öl und Metall und Diesel. Fast ein wenig sehnsüchtig betrachtete er den Bahnarbeiter in der orangen Warnweste, der geschickt die Kupplung des ersten Wagens mit der Lokomotive verband, bevor er mit einem Handzeichen an den Lokführer bedeutete, dass alles in Ordnung sei.
»Ciao, Roberto!«, rief der Mann vom Führerstand herunter, winkte zurück und verschwand im Inneren.
*
Im vierten Waggon hinter der Lokomotive, inmitten von Paletten mit Badezimmerarmaturen und Kisten mit sizilianischem Wein, streckte sich ächzend ein blonder Mann, den der Ruck und der Lärm aufgeweckt hatten. Trotz der Hitze war er eingeschlafen, und so blickte er als Erstes auf seine Armbanduhr.
12.22 Uhr. In drei Minuten sollte es weitergehen.
Planmäßig – und das war überraschend genug bei den italienischen Eisenbahnen, dachte er schmunzelnd und zog das verschwitzte T-Shirt über den Kopf. Dann stand er auf, balancierte zwischen Paletten und Kistenstapeln zur Tür und zog sie einen Spalt weit auf. Frische Luft strömte herein.
Noch eine Stunde …
Es war wie immer: Einerseits war er traurig darüber, dass die Reise zu Ende ging, andererseits tat es gut, wieder nach Hause zu kommen.
Nach Hause …
Gab es das für ihn überhaupt? Wo war er eigentlich zu Hause auf dieser Welt? Er beobachtete den Bahnarbeiter mit seiner orangen Weste, wie er über die Gleise zu den nächsten Zügen lief. Stand da nicht immer ein nächster Zug, ein neuer Waggon auf einem anderen Gleis, wartete nicht immer jemand auf dem nächsten Bahnhof?
Zu Hause? Er schüttelte den Kopf. Vielleicht eher eine vorübergehende Bleibe. Irgendwo endgültig ankommen, so weit war er lange noch nicht. Bis dahin lag noch ein Stück Weg vor ihm.