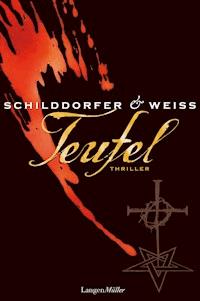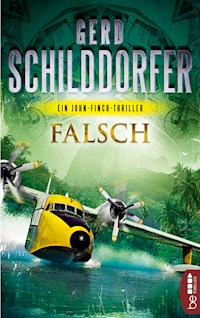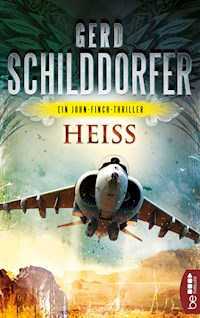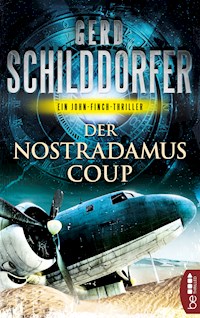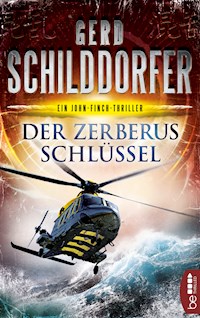
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Finch
- Sprache: Deutsch
Alte Rivalitäten zwischen Ost und West und ein gnadenloser Wettkampf um Leben und Tod!
Ein mumifizierter Erhängter in einem verlassenen Haus, geheimnisvolle chinesische Schriftzeichen, drei erdrosselte Männer - der Berliner Kommissar Calis steht vor einem Rätsel. Dann taucht eine geheimnisvolle Todesliste auf, und mit einem Mal befindet sich Calis' alter Freund John Finch auf einer Jagd nach Geheimnissen aus der Kolonialgeschichte. Denn die Verbrechen der Gegenwart führen in die dunkelsten Ecken der Vergangenheit und zu einem Grab, das keiner öffnen möchte. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Die John-Finch-Reihe - eine explosive Mischung aus Abenteuerroman und Verschwörungsthriller:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 914
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Zitate
Prolog I
Prolog II
Kapitel 1
Mittwoch, 28. August 1940
Montag, 14. Juni 1971
Donnerstag, 2. Juni 2016
Kapitel 2
1. September 1940
Mittwoch, 16. Juni 1971
Donnerstag, 2. Juni 2016
Mittwoch, 16. Juni 1971
Donnerstag, 2. Juni 2016
Freitag, 3. Juni 2016 Am frühen Morgen
Kapitel 3
18. Oktober 1940
Freitag, 3. Juni 2016
Kapitel 4
25. November 1940
Samstag, 4.Juni 2016
Sonntag, 5. Juni 2016
Kapitel 5
Sonntag, 5.Juni 2016
Kapitel 6
Montag, 6. Juni 2016
Kapitel 7
Osterwochenende, 25./26. März 1967
Montag, 6. Juni 2016 Spätabends
Dienstag, 7. Juni 2016 Frühmorgens
Dienstag, 7. Juni 2016 Morgens
Kapitel 8
Dienstag, 7. Juni 2016 Frühabends
Mittwoch, 8. Juni 2016
Kapitel 9
Mittwoch, 8. Juni 2016
Kapitel 10
8. Juni 2016 Später Nachmittag
Donnerstag, 9. Juni 2016
Epiloge
I.
II.
III.
Nachwort
Weitere Titel des Autors
Die John-Finch-Reihe:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
Über dieses Buch
Alte Rivalitäten zwischen Ost und West und ein gnadenloser Wettkampf um Leben und Tod!
Ein mumifizierter Erhängter in einem verlassenen Haus, geheimnisvolle chinesische Schriftzeichen, drei erdrosselte Männer - der Berliner Kommissar Calis steht vor einem Rätsel. Dann taucht eine geheimnisvolle Todesliste auf, und mit einem Mal befindet sich Calis' alter Freund John Finch auf einer Jagd nach Geheimnissen aus der Kolonialgeschichte. Denn die Verbrechen der Gegenwart führen in die dunkelsten Ecken der Vergangenheit und zu einem Grab, das keiner öffnen möchte. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Gerd Schilddorfer wurde 1953 in Wien geboren. Als Journalist arbeitete er bei der Austria Presse Agentur und danach als Chefreporter für verschiedene TV-Dokumentationsreihen (Österreich I, Österreich II, Die Welt und wir). In den letzten Jahren hat er zahlreiche Thriller und Sachbücher veröffentlicht. Gerd Schilddorfer lebt und arbeitet in Wien und Stralsund, wenn er nicht gerade auf Reisen für sein neues Buch ist.
Gerd Schilddorfer
DERZERBERUS-SCHLÜSSEL
Ein John-Finch-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/dani3315; shutterstock/Filip Fuxa; shuttestock/Carlos Amarillo
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1758-8
be-ebooks.de
lesejury.de
Im Leben geht es nicht darum zu warten,dass das Unwetter vorbeizieht,sondern zu lernen, im Regen zu tanzen.Zig Ziglar, amerikanischer Autor
Wer auf Rache aus ist,der grabe zwei Gräber.
Prolog I
10. NOVEMBER 1989, KAISERIN-AUGUSTA-ALLEE,BERLIN-CHARLOTTENBURG/BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Harald Gärtner überlegte fieberhaft, wie er weiterleben sollte.
Was tun? Seit mehr als fünfzehn Stunden hatte er den Fernseher in seinem Wohnzimmer nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Er hatte kaum geschlafen, nichts gegessen, und die fettigen Haare hingen ihm wirr ins Gesicht. Mit einer fahrigen Handbewegung streifte er sie zurück und drückte eine weitere Chesterfield in einem überquellenden Aschenbecher aus.
Er konnte einfach nicht glauben, was er sah.
Jubelnde Massen, offene Grenzübergänge, untätige Volkspolizisten und Grenzer, die beisammenstanden und diskutierten, statt zu kontrollieren.
In den Medien überschlugen sich die Nachrichten.
Ein stammelnder Schabowski vor Pressevertretern.
Peinlich. Nur peinlich.
Tausende Menschen turnten auf der Mauer herum wie auf einem überdimensionalen Klettergerüst auf einem Kinderspielplatz, wurden hinaufgezogen von Begeisterten, die bereits oben standen und jubelten. Einige reichten ihre Kleinkinder hinauf, damit sie ins Fernsehen kommen, andere schoben ihre Ehefrauen auf die Mauerkrone.
Ein Fest der deutsch-deutschen Verbrüderung.
Gärtner traute seinen Augen noch immer nicht, als er wieder und wieder die Berichte in den Nachrichtensendungen von ZDF und ARD verfolgte. War das tatsächlich Realität? Um den Druck der Massen zu mindern, hatten die Posten am Grenzübergang Bornholmer Straße um 21.20 Uhr tags zuvor die ersten DDR-Bürger nach West-Berlin ausreisen lassen. In einem letzten skurrilen Akt von Bürokratie hatte der Leiter der Passkontrolleinheiten die Pässe ungültig stempeln lassen, was einer Ausbürgerung der ahnungslosen Inhaber gleichgekommen war.
Doch das war nur der Anfang vom Ende gewesen.
Gegen 23.30 Uhr war der Ansturm der Menschen so groß geworden, dass selbst der Leiter der Passkontrolle, noch immer ohne offizielle Dienstanweisung, kapituliert und den Schlagbaum endgültig geöffnet hatte. Die Masse war in Bewegung geraten, in Richtung Westen geschwappt, getragen von Begeisterung und Überraschung, und nichts hatte sie mehr aufhalten können.
Die Bilder, die seit Mitternacht über die Bildschirme der ganzen Welt flimmerten, waren unglaublich und unerhört. In der Stunde nach der Grenzöffnung waren rund 20000 Menschen ohne Kontrolle über die Bösebrücke in den Westen gelangt. Gärtner schüttelte ungläubig den Kopf. Was um Gottes willen ging hier vor? Schlief die Stasi? War sie überhaupt noch aktiv?
In den Sondersendungen der Fernsehanstalten jagte ein unglaubliches Bild das nächste. Nach und nach waren in Berlin auch die anderen innerstädtischen Grenzübergänge im Verlauf des gestrigen späten Abends geöffnet worden.
Die Mauer war gefallen.
Nun würde zusammenwachsen, was zusammengehörte.
»Scheiße!«, rief Gärtner verzweifelt und drückte den roten Knopf auf der abgegriffenen Fernbedienung. Kurz zuvor noch hatte die unsichere Stimme von ZK-Sekretär Günter Schabowski das Wohnzimmer erfüllt.
»Diese Nulpe«, zischte Gärtner und zündete sich eine Zigarette an. Wie hatte er der versammelten Presse verkündet? »Ein Visum für Privatreisen mit Rückkehrrecht werde künftig ohne besondere Voraussetzungen und Wartezeiten ausgestellt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.«
Gärtner war fast vom Stuhl gefallen.
Die Szene hatte sich in sein Gehirn eingebrannt. Schabowski, herumeiernd wie eine Jungfrau vor dem ersten Mal, schlug in irgendwelchen Papieren nach, die er sowieso nicht fand. Dann stammelte er: »Die Regelung gilt nach meiner Kenntnis sofort, unverzüglich.«
»Und mir wird schlecht«, murmelte Gärtner und schenkte sich trotz der Tageszeit einen doppelten Cognac ein, den er in einem Zug hinunterstürzte. Dann trat er ans Fenster und lehnte die Stirn gegen die kühlen Scheiben. Durch die Jalousien konnte er auf die graue und neblige Kaiserin-Augusta-Allee sehen, deren Bäume bereits alle kahl waren. Und was nun? Der gedrungene Mittdreißiger in dem etwas fadenscheinigen Morgenmantel und den altmodischen Pantoffeln war ratlos. Auf diesen Fall hatte man ihn nicht vorbereitet. Davon hatte keiner etwas gesagt.
Gärtner fühlte sich, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. In seinem Bauch rumorte es. Was jetzt, Herrschaftszeiten? Unten auf der Straße gingen die Passanten wie jeden Tag einkaufen, der Laden von Feinkost König war voll. Alltag im bald vereinten Deutschland. Die Nervosität krampfte seinen Magen zusammen.
Sollte er verschwinden? Sich absetzen? Wohin? Mit diesem verdammten Gorbatschow in Russland, mit Glasnost und Perestroika und einer Aufbruchsstimmung, die jeden standhaften Kommunisten in die Verzweiflung treiben musste, war der Osten auch kein sicherer Hafen mehr.
Nein, ostwärts war keine Option.
Selten in seinem Leben war er so ratlos gewesen. Und überrascht.
Nein, es war ganz und gar kein Trost, dass er damit nicht alleine war. Denn trotz der Demos in Leipzig und Dresden war die ganze Welt vom Fall der Mauer überrascht worden.
Nicht nur Harald Gärtner.
Er öffnete das Fenster, spürte die kalte Luft, die sofort ins Zimmer strömte. Mit einer unwirschen Handbewegung drückte er die Zigarette am Fensterbrett aus und ließ den Stummel auf die Straße fallen. Rasch blickte er die Augusta rauf und runter. Ein Mann, der sich in einen Hauseingang drückte, eine Zeitung unter den Arm geklemmt, fiel ihm auf.
Waren sie schon da?
Nein, unmöglich, so schnell konnte niemand die Listen … Gärtner zuckte instinktiv zurück und schloss rasch das Fenster. Verdammt, dachte er, die Listen! Wie lange noch, bis sie die Zentrale in Lichtenberg durchsuchen würden?
Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dann wäre er dran, und nicht nur er …
Mit großen Schritten eilte er ins Schlafzimmer und riss den großen Reisekoffer vom Schrank. Es war sinnlos, noch länger zu warten. Worauf auch? Auf das Klopfen an der Tür, auf die endlosen Verhöre, die spöttischen Mienen, auf das Ende? Wie das aussehen würde, das konnte er sich vorstellen: eine Kugel in den Kopf, irgendwo im bewaldeten Berliner Umland.
Hastig griff er nach Hemden und Pullovern, nach Hosen und Wäsche in den Fächern, stopfte sie in den Koffer. Zum ersten Mal bedrückte ihn die Stille in der Wohnung. Er hätte doch den Fernseher laufen lassen sollen.
Wohin? Wohin? Wohin?
Wie Paukenschläge hämmerte es in seinem Kopf. Die einzige Antwort, an die er denken konnte, war – nur weg.
Weg von Berlin, weg aus Deutschland.
Spurlos verschwinden.
Er eilte ins Badezimmer, kniete sich hin und öffnete das Metalltürchen am Fuß der verfliesten Badewanne. Dann begann er den Hohlraum leer zu räumen. Pistole? Mitnehmen. Munition? Sowieso. Das dicke Bündel D-Mark im sorgsam gehüteten Kuvert würde ihn sicher ans andere Ende der Welt bringen. Dann tastete er weiter. Das Gewehr … schade drum, das musste hierbleiben. Er fühlte den kühlen Stahl, das starke Zielfernrohr, die Päckchen mit den Vollmantelgeschossen. Mit einem Ruck zog er die Hand zurück, verschloss die kleine verchromte Metalltür wieder und lief zurück ins Schlafzimmer. Dort zog er zweitausend Mark in Hundertern aus dem Kuvert, den Rest verstaute er im Koffer, gemeinsam mit der Beretta und der Munition.
Dann – Deckel zu, plötzlicher Schlussstrich unter ein Leben. Gab es noch ein anderes, weiteres für ihn?
Autoschlüssel, Reisepass, Geld.
Er stand im Flur, den Koffer auf dem billigen IKEA-Flickenteppich, und überlegte, tastete seine Taschen ab. Schritte kamen die Treppen herauf, und Gärtner hielt den Atem an. Tapp, tapp, tapp. Doch sie zogen ruhig vorbei, entfernten sich wieder, hinauf in die nächste Etage. Irgendwo im Haus schrie ein Baby, und der Geruch nach gedünstetem Kohl zog vom Gang herein. Instinktiv sah Gärtner auf die Uhr.
11.17 Uhr. Noch fünf Minuten, dann war er weg.
Reisefreiheit …
Würden sie an den Grenzübergängen noch stehen? Das konnte ihm im Prinzip egal sein, aber spurlos in den Westen verschwinden …
Plötzlich schrillte das Telefon, und Gärtner zuckte zusammen.
»Nicht hingehen«, flüsterte eine innere Stimme eindringlich, »du bist schon weg.«
Einmal läutete es, zweimal, dreimal.
Dann verstummte der schwarze Apparat, und Gärtner runzelte die Stirn. Er zog die Beretta aus dem Hosenbund und kam sich mit einem Mal lächerlich vor, wie er so dastand, in der leeren Wohnung, mit gezogener Waffe. Der Verkehrslärm von der Augusta drang durch die Fenster. Ein Bus öffnete zischend seine Türen, und jemand hupte, im Stakkato, ärgerlich.
Da läutete das Telefon erneut.
Einmal, zweimal.
Erneut Stille.
Gärtner steckte die Beretta weg und ließ sich auf das durchgesessene Sofa sinken, gleich neben dem Telefontischchen.
Da war das Läuten wieder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Aufatmend riss er den Hörer von der Gabel und damit beinahe das Telefon von dem kleinen Tisch.
»Ja?« Er schrie es fast ins Telefon. Dann wiederholte er nach einem Augenblick ruhiger: »Ja?«
»Sie bleiben, wo Sie sind.« Der Mann am anderen Ende der Leitung klang ruhig und bestimmt. Die unbeirrbare Besonnenheit tat Gärtner gut.
»Ich …« Gärtner schaute sich um. Konnte ihn sein Gesprächspartner sehen? Woher wusste er …?
»Nur nicht die Nerven verlieren«, fuhr der Anrufer mit tiefer Stimme fort. »Haben Sie genug Geld übrig?«
»Ja … selbstverständlich …«, stammelte Gärtner und strich sich die Haare aus der Stirn. »Aber …«
»Dann igeln Sie sich ein, leben Sie ein normales Leben, wie bisher. Sie verlassen auf keinen Fall die Stadt, haben Sie mich verstanden?«
»Ich weiß nicht …«, versuchte es Gärtner verwirrt.
»Aber ich weiß es«, antwortete der Anrufer bestimmt. »Keine Bravourstücke, keine unüberlegten Schritte, keine Flucht in den Westen. Sie sind sicher. Wenn man Sie an einer Grenze schnappt, dann ist alles vorbei.«
»Aber ist es das nicht sowieso?«, stieß Gärtner nach und ließ sich zurück aufs Sofa fallen. »Man wird die Listen finden, früher oder später. Wahrscheinlich früher …«
»Gar nichts wird man finden«, beruhigte ihn der Anrufer. »Die Reißwölfe laufen bereits Tag und Nacht. Akten, Notizen, Geheimdienstberichte, Befehle. Alles muss verschwinden. Die sensibelsten Schriftstücke zuerst …« Der Anrufer überlegte kurz, bevor er weitersprach. »Sie bleiben an Ort und Stelle, das ist ein Befehl. Was immer auch passiert, leben Sie unauffällig weiter, wie bisher. Gehen Sie aus, lernen Sie eine Frau kennen, heiraten Sie endlich. Legen Sie das Geld bei verschiedenen Banken an, teilen Sie es auf oder verstecken Sie es. Werden Sie zum Schläfer.«
»Und dann?« Gärtners Stimme klang rau, und er räusperte sich, während er auf die graue Mattscheibe des Fernsehers starrte.
»Und dann nichts.« Die Stimme sprach ruhig weiter. »Wer weiß, was die Zukunft bringt? Seilschaften verschwinden nicht, lösen sich nicht spurlos auf, vergessen Sie das nie. Sie verschwinden vielleicht im Untergrund, wechseln den Namen, organisieren sich neu und tauchen unter anderen Bezeichnungen wieder auf. Haben Sie Ihre Ausbildung bereits vergessen? Man wird sich an Sie wenden, wenn es an der Zeit ist.«
Beide Männer schwiegen. Nur ein leises statisches Rauschen war in der Leitung zu hören.
»Alle im Westen sind im Freudentaumel«, fuhr der Anrufer schließlich nachdenklich fort. »Die Begeisterung wird bestimmt noch einige Zeit anhalten und sich wie eine Decke über viele Dinge legen. Auch über Sie. Schlafen Sie gut, Dornröschen. Sie werden den Prinzen erkennen, wenn er kommt.« Damit legte er auf.
Gärtner ließ den Hörer sinken. Tut, tut, tut, tönte es leise durchs Zimmer. Das Baby schrie noch immer. Schließlich legte er auf, griff zur Fernbedienung und schaltete den Fernseher wieder ein. Bilder vom Brandenburger Tor und der Mauer davor, besetzt von Tausenden von West- und Ostbürgern.
»Die Aufrufe der Polizei, die Mauerkrone zu verlassen und den Platz wieder freizumachen, verhallten ungehört«, meldete der Kommentator. »Mit der wirtschaftlichen Misere in ihrem Heimatland werden die DDR-Bürger bei ihrem ersten Besuch im Westen unmittelbar konfrontiert: In langen Schlangen warten sie in Sparkassen, Banken und Ämtern auf die Auszahlung des Begrüßungsgeldes in Höhe von hundert D-Mark, um sich irgendetwas kaufen zu können.«
Mit einer verzweifelten Geste riss Gärtner die Beretta wutentbrannt aus dem Hosenbund und schleuderte sie mit voller Kraft auf den Fernseher. Die Bildröhre implodierte mit einem lauten Krach, Glassplitter flogen umher, es zischte, und Rauch stieg auf.
Dann ließ er den Kopf in die Hände fallen. Sie würden ihn finden und liquidieren, das war so sicher, wie das Amen im Gebet. Früher oder später. Irgendeiner würde reden, dachte er sich, einer redet immer.
Schläfer oder Träumer?
Er stand auf und ging wieder zum Fenster. Der Mann im Hauseingang war verschwunden.
Schläfer.
Er wandte sich ab und schloss die Augen. Nun würden die Albträume kommen, ihn um den Schlaf bringen, wach halten, nächtelang.
Sie würden ihn nie mehr loslassen.
Bis ans Ende seines Lebens, wann immer das auch sein würde.
Prolog II
3. AUGUST 2010, CARL-STORCH-STRAßE, STADTTEIL AIGEN,STADT SALZBURG/ÖSTERREICH
Das kleine weiße Haus in dem verwilderten Garten mit der angebauten Garage sah verlassen und unbewohnt aus. Die Gitter vor den schmutzigen Fenstern, ihrer Form nach aus den Fünfzigerjahren, waren rostig, der Verputz des bescheidenen Hauses grau und an manchen Stellen abgebröckelt. Aus dem Dach wuchsen Moose, und eine kleine Birke, die in der Dachrinne siedelte, wiegte sich im leichten Wind.
Der Mann, der nachdenklich an dem niedrigen Gartentor lehnte und in den fast lilafarbenen Abendhimmel blickte, war schlank und durchtrainiert. Seine verwuselten blonden Haare leuchteten im Licht der nahen Straßenlaterne. Alexander Reiter mochte Mitte vierzig sein, mittelgroß, mit grün-braunen Augen, die stets etwas belustigt in die Welt blickten. Er trug ausgebleichte Jeans und ein verwaschenes T-Shirt und sah mit seiner Umhängetasche aus wie ein spätberufener Student.
Doch Reiter war alles andere als das.
Nach einem letzten Blick auf das Haus, den völlig ungepflegten Garten, die grasbewachsenen Gehwege und das herabhängende Vordach sprang er über den niedrigen Zaun und war einen Augenblick später zwischen den dichten Büschen verschwunden.
Wie ein Schatten, der sich einfach in nichts auflöste.
Niemand hatte ihn kommen gesehen, niemand würde ihn gehen sehen.
Die hölzerne Haustür begann bereits, sich in ihre Bestandteile aufzulösen. Die Bretter, eher schwarz als braun, wölbten sich, und von der Messingleiste, die früher den unteren Teil der Tür schützte, waren nur mehr einige Metallfetzen übrig.
Reiter warf einen schnellen Blick in die beiden Mülltonnen, deren Deckel mit Blättern bedeckt waren. Leer. Er schnüffelte. Nichts zu riechen. Das Haus war bereits seit längerer Zeit verlassen.
Da alle Fenster vergittert waren, blieb ein einziger Weg – durch die marode Haustür. Reiter zog einen Dietrich aus der Tasche, und das altersschwache Schloss hielt keine dreißig Sekunden stand, bevor die Tür quietschend in den trockenen Angeln nach innen schwang. Vorsichtig schob sich Reiter durch den Spalt ins Haus und drückte hinter sich die Tür wieder zu. Das war einfacher gegangen, als er es erwartet hatte.
Die dünne Taschenlampe, die er aus seiner Umhängetasche zog, verbreitete einen kalten Schein. Der scharf abgegrenzte Lichtkegel huschte über Wände mit fadenscheinigen Tapeten, Stühlen aus den Siebzigerjahren, Spannteppiche in allen Stadien der Auflösung, einem Abreißkalender von 1981.
In jedem Raum schien sich Müll zu stapeln. Reiter stieg über Berge leerer Verpackungen, gefüllten Mülltüten, zerfledderten Kartons. Warum hatte sie niemand in die leeren Mülltonnen bei der Einfahrt entsorgt?
Chaos, dachte er, hier herrscht das totale Chaos.
Er stieß die nächste Tür auf und warf einen Blick in die Küche. An Essenkochen war hier nicht mehr zu denken. Reiter ließ den Strahl der Taschenlampe über die schmutzigen Schränke wandern, die mit Müll und Essensresten überfüllten Arbeitsplatten, die Ameisen bereits vor längerer Zeit für sich entdeckt und besetzt hatten.
Der Lichtkegel riss stapelweise Packungen mit Fertigknödeln aus dem Dunkel. Offenbar aß der Hausherr sie ungekocht aus der Tüte …
Als Reiter weiter ins Haus vordrang, bemerkte er, dass alle Fensterscheiben mit Zeitungsseiten beklebt worden waren, damit niemand einen Blick ins Haus werfen konnte.
Zum ersten Mal fragte sich Reiter, ob ihm sein Informant nicht einen Bären aufgebunden hatte.
Er stieß die Tür zum nächsten Zimmer auf. Eine Bibliothek? Die Bücher in den Regalen waren schon vor langer Zeit der Feuchtigkeit im Haus zum Opfer gefallen und begannen, sich zu zersetzen. Schimmel hatte den Rest besorgt. Aus dem Lehnsessel hatten Mäuse die Polsterung gerissen, der Stoff hing in Fetzen herunter. Ein alter Aschenbecher machte Werbung für das Österreich der späten Sechzigerjahre.
Es war totenstill. Reiter schien es, als hielte das Haus den Atem an. Er konnte Wohnungen und Häuser lesen wie andere Artikel in der Zeitung. Sie erzählten ihm ihre Geschichte, verrieten ihm, was er wissen wollte. Über die Bewohner, die Besucher, die Vergangenheit. Oft wie Komplizen, manchmal wie Diven. Aber sie sprachen stets zu ihm. Was ihm jedoch dieses Haus verriet, wollte er eigentlich gar nicht wissen.
Nach einem letzten Rundblick machte er sich auf den Weg nach oben, über den dünnen Läufer, der die Stufen bedeckte. Spinnweben hingen vor den Fenstern, verstaubte Gardinen vor den Zeitungen; alles verbreitete eine bedrückende Atmosphäre der Trostlosigkeit.
Am ersten Treppenabsatz war eine Decke über eine Kiste oder ein paar Schachteln gebreitet, und Reiter ging in die Hocke, hob sie an und leuchtete mit seiner Lampe darunter.
Unter einer dünnen Schicht von Schimmel und Staub erkannte er lächelnd das Gemälde Montagne Sainte-Victoire von Paul Cézanne und wusste mit einem Mal, er war an der richtigen Stelle. Vorsichtig nahm er die Taschenlampe zwischen die Zähne und hob behutsam die Decke ab. Rund zwanzig Bilder lehnten an der Wand.
Monet, Pissaro, Renoir. Verstaubt, schmutzig, teilweise von schwerem Schimmelbefall gezeichnet.
Kopfschüttelnd deckte Reiter die Kostbarkeiten wieder zu. Dann stieg er weiter die Treppe hinauf, zog eine Liste aus seiner Tasche und überflog sie kurz. Als er die nächste Tür aufstieß, verschlug ihm der Anblick den Atem. Zwischen Müll und alten Zeitungen waren im gesamten Raum Stapel von Bildern verteilt, lehnten an den Wänden, lagen auf den Möbeln.
Hunderte Werke weltbekannter Maler zwischen leeren Schachteln von Fertigknödeln …
Reiter erkannte Bilder von Max Liebermann, Edvard Munch, die Radierung Tête de femme von Picasso. Auf einer Anrichte stand eine Bronzeskulptur von Auguste Rodin. La Danaide, die Liegende Frau auf dem Felsen. Als er einige der Mappen aufschlug, die auf einem Tisch lagen, erkannte er Aquarelle von Pablo Picasso, durch die sich bereits die Würmer gefressen hatten.
Reiter spürte, wie die Wut in ihm hochstieg. Gier und Dummheit machten ihn immer wieder zornig. Er klappte die Mappen wieder zu und ging ins nächste Zimmer. Erneut ein Raum voller Gemälde, Bilder überall. Selbst auf dem Bett waren sie gestapelt. Der Zustand der meisten war beklagenswert.
Es tat Reiter in der Seele weh.
Rasch zog er einen Fotoapparat aus seiner Umhängetasche und begann zu fotografieren. Die wenigen Bilder auf seiner Liste, insgesamt fünf, stellte er beiseite, als er sie nach und nach unter dem Abfall entdeckte.
Nach etwa zwei Stunden hatte er das Haus vom Dachboden bis zum Keller durchkämmt und alle Bilder erfasst. Insgesamt zählte er 239 Meisterwerke plus der fünf, wegen denen er gekommen war. Schließlich zog er zwei dünne Riemen aus seiner Tasche, band die fünf Bilder zusammen und schlug sie in eine Decke. Das Bündel war handlich und erstaunlich klein.
Aber millionenschwer.
Dann verließ Alexander Reiter das kleine weiße Haus im Stadtteil Aigen wieder und verschloss die Tür. Alles war ruhig, Garten und Straße lagen verlassen da. Es war dunkel geworden, und die Straßenlaternen warfen ein gelbliches Licht auf den Asphalt. Das noble Wohngebiet im Süden Salzburgs bereitete sich darauf vor, seine Bewohner ins Bett zu schicken.
Sein dunkler Mercedes-Bus stand in der nächsten Seitenstraße unter einem Baum. Reiter verstaute das Bündel im Laderaum und ließ sich auf den Fahrersitz fallen. Dann holte er ein Handy aus dem Handschuhfach, legte eine brandneue Prepaid-Karte ein und wählte eine Nummer in Tel Aviv, die er aus früheren Zeiten kannte. Als der Teilnehmer sich mit einem vorsichtigen »Hallo?« meldete, begann Reiter zu sprechen.
»Mein Name tut nichts zur Sache, nennen Sie mich einfach Rebus. Hören Sie gut zu, ich werde Ihnen diese Geschichte nur einmal erzählen und nichts wiederholen. Stellen Sie keine Fragen, sonst lege ich sofort auf. In der Salzburger Carl-Storch-Straße in Österreich gibt es ein verlassenes weißes Haus. Es gehört dem Sohn eines der bedeutendsten Kunsthändler des Dritten Reichs, Hildebrand Gurlitt. Der war damals einerseits damit beauftragt, die aus deutschen Museen beschlagnahmte sogenannte ›Entartete Kunst‹ ins Ausland zu verkaufen, zum anderen war er nach Beginn des Zweiten Weltkriegs als einer der Haupteinkäufer für das Hitler-Museum in Linz am nationalsozialistischen Kunstraub beteiligt. Vor allem in Frankreich. Doch zurück zu dem Haus in Salzburg. Da liegen mehr als zweihundert Meisterwerke, unter anderem von Picasso, Renoir, Monet und Cézanne und verrotten. Ich denke, das sollte für eine fundierte Recherche des Instituts reichen. Und Ihre Kontakte zu den deutschen und österreichischen Behörden sind sicherlich von gegenseitigem Wohlwollen geprägt. Shalom.«
Damit legte er auf und nahm grinsend die Karte aus dem Handy, knickte sie in der Mitte und ließ sie in den nächsten Kanal fallen. Dann legte er das Mobiltelefon vor den linken Vorderreifen, startete den Bus und rollte darüber.
Wer mit dem Mossad telefonierte, konnte nicht vorsichtig genug sein.
*
Wenig später steuerte Reiter den Bus über die Tauernautobahn Richtung Süden, durch Tunnels und über Brücken und rollte zwei Stunden später nördlich an Villach vorbei, bevor er die Abzweigung in Richtung Tarvis und Udine nahm. Die ehemalige Grenzstation zu Italien war verwaist. Nicht einmal ein einsames Polizeifahrzeug parkte in einer der dunklen Zufahrten.
Im Radio sang Gianna Nannini Bello e impossibile, und Reiter sang mit. Wenig später querte die Autobahn das erste Mal den Fluss, und das breite steinige Bett des Tagliamento oberhalb von Udine leuchtete im Mondlicht fast blendend weiß.
Die roten Digitalziffern der Uhr am Armaturenbrett sprangen auf 03.55 Uhr, als Reiter die Stadtgrenze von Triest überquerte und die abschüssige Straße zum Hafen hinunterrollte. Wenig später erreichte er die Piazza Giotti, wo sich die Umrisse der großen jüdischen Synagoge der Stadt gegen den Morgenhimmel abzeichneten. Triest, die alte österreichische Hafenstadt, schlief noch, und die Straßen waren bis auf ein paar geschäftige Putzkolonnen der Stadtverwaltung menschenleer.
Reiter stieg aus und atmete tief durch. Die Luft war warm, roch nach Meer und Seetang, nach Schiffsreise und Urlaub im Süden. Er blickte die Fassade der Synagoge hoch, die ein wenig an eine Trutzburg mitten in der Stadt erinnerte. Bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts hatten sich Juden in Triest angesiedelt, und sie waren gekommen, um zu bleiben. Geschützt von einem Toleranzpatent von Kaiser Joseph II. gründeten sie in Triest Versicherungen und Schifffahrtsgesellschaften, wie die Generali oder den Österreichischen Lloyd. Doch die Spuren der großen Familien aus Habsburger Zeiten waren lange verweht. Geblieben waren eine jüdische Gemeinde von rund sechshundert Menschen, die im Laufe der Jahrzehnte aus aller Herren Länder nach Triest gekommen waren, und eine prächtige Synagoge.
Vorsichtig löste Reiter die Riemen und zog einen kostbar gestalteten Rahmen heraus, der ein fein gezeichnetes, koloriertes Blatt enthielt. Es zeigte eine chinesisch wirkende Parkanlage mit einer Brücke über einen See und einem Pavillon mit Pagodendach im Hintergrund. Er legte es beiseite und verschnürte die übrigen Bilder erneut. Mit dem Bündel auf der Schulter überquerte er die Via Guido Zanetti und suchte nach einer ganz bestimmten Tür unter den Arkaden der Synagoge. Dann drückte er auf den Klingelknopf und wartete.
»Sai che ore sono?« Der Hausmeister sah den frühen Gast verdattert an und tastete gleichzeitig nach seiner Brille in der Tasche seines Schlafrocks.
»Es tut mir leid, Sie geweckt zu haben, aber dies hier gehörte einmal der Familie Vivante. Ich bin mir sicher, Sie werden es an die richtigen Stellen weiterleiten.« Damit lehnte er das Bündel an die offene Tür, drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit, bevor der Hausmeister seine Brille aufgesetzt hatte.
»Signore! Aspetta … un momento …!«, hallte es über die Straße, doch Reiter lief bereits zu seinem Bus, startete den Motor und beschleunigte wenige Augenblicke später die Via Zanetti hinunter in Richtung Hafen.
»Und jetzt nach Antwerpen«, murmelte er lächelnd.
*
Das Telefonat, das Reiter mit dem israelischen Geheimdienst in jener Nacht führte, brachte die sogenannte »Affäre Gurlitt« ins Rollen. Vier Wochen später wurde Cornelius Gurlitt im Zug von Zürich nach München von deutschen Zollfahndern kontrolliert. Er hatte neuntausend Euro bei sich, und obwohl diese Summe unter die gesetzliche Zehntausend-Euro-Grenze fiel, ließen die Beamten aus bisher unbekannten Gründen nicht locker und leiteten Ermittlungen ein. Gurlitt, der als Heimatadresse München angab, war da jedoch weder gemeldet, noch hatte er eine deutsche Bankverbindung oder eine Sozialversicherung. Mehr als ein Jahr später wurde seine Kunstsammlung beschlagnahmt. Im November 2013 gab der ermittelnde Staatsanwalt an, dass die Bilder in München und Salzburg kein Zufallsfund gewesen seien. Man habe »im Zusammenhang mit den steuerstrafrechtlichen Ermittlungen gezielt gesucht«.
Doch das Telefongespräch hatte noch weitere Folgen. Der Mann in Tel Aviv hatte sich eine Notiz gemacht, in die Ecke einer Schreibtischunterlage. Sie bestand aus drei Worten: Rebus – Gemälde – Cobra.
Kapitel 1
DERVERSCHWUNDENESPION
Mittwoch, 28. August 1940
SÜDLICHVON BENNETT ISLAND/OSTSIBIRISCHE SEE
Der Wind frischte auf und entwickelte sich zum Sturm. Das Wetter sah ganz und gar nicht gut aus, und die Voraussage war noch schlechter. Kapitän Robert Tyssen betrachtete nachdenklich die Seekarten, bevor er einen Blick aus der Brücke auf den vor ihnen stampfenden Eisbrecher der sowjetischen Marine warf. Grau-schwarze Wolken drängten von Norden heran, tief hängend und bedrohlich. Heftige Böen pfiffen über die Aufbauten des Hilfskreuzers.
Es roch nach Schnee.
Hoffentlich ist die Arado gut verzurrt, dachte Tyssen und beugte sich vor, um das brandneue Aufklärungsflugzeug besser sehen zu können, das vor der Brücke mit Seilen und Gurten an Deck befestigt worden war. Alles schien in Ordnung zu sein …
Aber in Wahrheit war nichts in Ordnung auf dieser vermaledeiten Reise.
Die ersten Regentropfen platschten laut gegen die Scheiben, und Tyssen verzog das Gesicht. Gischt spritzte hoch auf, wehte über das Schiff und gefror in der eisigen Luft.
Wenig später begann es zu schneien.
»Auch das noch …«, murmelte der Kapitän und versuchte, die grau-weiße Wand aus Nebel und Schneefall vor dem Schiff zu durchdringen. Die Komet, deren Umbau vor drei Monaten beendet worden war, befand sich mit 254 Mann Besatzung auf ihrer ersten großen Fahrt. Nicht vor die Haustür, in den Skagerrak oder in den Atlantik, nein. Es würde eine Fahrt ans andere Ende der Welt werden, und keiner auf der Komet wusste, ob er jemals wieder nach Hause kommen würde.
Wenn sie denn jemals überhaupt ihr Ziel erreichen würden.
Tyssen, mit seinen achtundvierzig Jahren ein Veteran in den arktischen Gewässern und dienstältester Kapitän der deutschen Hilfskreuzer-Flotte, war kein Risiko eingegangen und hatte das 115 Meter lange Schiff genau nach seinen Vorstellungen umrüsten lassen. Der Rumpf war verstärkt und zusätzliches Material an Bord gebracht worden, mit dem das Schiff rasch getarnt werden konnte. So war es auch Tyssen gewesen, der ihr den Namen gegeben hatte.
Komet.
War Nomen auch in diesem Fall Omen?
Als Ems war sie 1937 an den Norddeutschen Lloyd ausgeliefert worden und zwei Jahre lang zwischen Hamburg und Brasilien gefahren, bevor die Kriegsmarine sie beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmt, umgebaut und schwer bewaffnet hatte.
Nachdem die Russen versichert hatten, einen ihrer großen Eisbrecher zu schicken, um der Komet die Fahrt durch arktische Eisfelder und das Packeis zu ermöglichen, war der Hilfskreuzer am 3.Juli 1940 aus Gotenhafen ausgelaufen und mit Kurs Norwegen in See gestochen.
Schon kurz danach waren die ersten Probleme aufgetaucht – »so unvermittelt wie diese verdammten englischen U-Boote, die in letzter Zeit überall zu sein scheinen«, hatte Tyssen zu seinem Ersten Offizier gesagt. Begleitet von ihrem Versorgungstanker Esso war die Komet am 8. Juli in Bergen eingelaufen, hatte 400 Tonnen Diesel und 200 Tonnen Trinkwasser gebunkert und ein letztes Mal die Speisekammern bis zum Rand aufgefüllt. Beim Auslaufen dann war es geschehen: Die Esso war vor Bergen auf Grund gelaufen und dabei so schwer beschädigt worden, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war.
Schon gar nicht an eine Fahrt durch die Nordost-Passage.
Der erste Teil von Tyssens Vorhaben war gescheitert, bevor die Reise noch richtig begonnen hatte. Hätte er das Schiff doch nicht umbenennen sollen? Ein jahrhundertealter Aberglaube besagte, dass genau das mit Sicherheit Unglück über Schiff und Besatzung brachte.
Doch Tyssen war Realist und kein abergläubischer Träumer, und so hatte er sich nicht entmutigen lassen. Dutzende von Fässern waren mit zusätzlichen Lebensmitteln, Treibstoff und Wasser befüllt und geladen worden, bevor der Kapitän den Befehl gegeben hatte, die Komet in das russische Frachtschiff Deynev zu verwandeln. Die Aufbauten wurden verändert, der Schornstein mittels spezieller Teile verlängert, die Silhouette des Schiffs an die der Deynev angepasst. Nicht perfekt, doch immerhin täuschend echt auf die Distanz einiger Seemeilen.
Gut genug, um den Feind zu täuschen.
Aber wieder ein anderer Name, tuschelte man in der Besatzung. Das konnte kein Glück bringen …
Doch das war es nicht, was Tyssen seit dem Auslaufen aus Bergen Sorgen bereitete.
Es war der Mann, der im Hafen an Bord gekommen war und der weder mit der Mannschaft noch mit den Offizieren Kontakt suchte. Er war alleine gekommen, und er blieb auch alleine, nahm die Mahlzeiten in seiner Kabine ein und grüßte nie, wenn er in einem der langen Gänge des Schiffes jemandem über den Weg lief. Das Begleitschreiben, das er mit einem Ausdruck von Überheblichkeit aus der Jackentasche gezogen und vorgewiesen hatte, trug die Unterschriften des Reichsführers-SS Heinrich Himmler und des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heydrich.
»Noch Fragen?«, hatte sich der Mann mit der schwarzen Uniform und den stechend grünen Augen kurz erkundigt, und Tyssen hatte – einen bitteren Nachgeschmack im Mund und eine dunkle Vorahnung zurückdrängend – nur den Kopf geschüttelt.
SS-Hauptsturmführer Werner Reichert war definitiv niemand, den man zum Feind haben wollte.
Zum Freund allerdings auch nicht.
Doch Tyssen hatte sich fügen müssen. Selbst eine diskrete Anfrage an die Seekriegsleitung, ob man den ungebetenen Gast nicht kurzerhand an einer der nächsten Inseln an Land bringen könnte, war mit einem diplomatischen Schulterzucken und einem inoffiziellen, nichtssagenden Dreizeiler beantwortet worden. Nach dem Motto: »Ihr Problem, Kapitän.«
Was Tyssen allerdings noch mehr geärgert hatte als der Unfall der Esso. Er kam sich mit einem Mal sehr alleingelassen vor, ohne Rückendeckung, was ihm niemals zuvor in seiner ganzen Karriere passiert war.
Diese Fahrt steht unter keinem guten Stern, dachte er und kontrollierte erneut den Kurs. Der anfängliche Regen war nach einigen heftigen Schneeschauern zu einer Mischung aus Gewitter und Schneesturm geworden.
Die Sicht war miserabel, der Nebel wurde noch dichter. Tyssen holte seine alte vergilbte Meerschaumpfeife aus der Tasche und begann, sie zu stopfen, wie immer, wenn die Situation haarig wurde. Es war ein Ritual, ein Opfer des Realisten Tyssen an den Gott des Meeres, Neptun. Während die ersten blauen Tabakschwaden durch die Brücke zogen, versuchte der Steuermann der Komet, in der eisfreien Fahrrinne des russischen Eisbrechers zu bleiben.
Beiden Männern kam es vor, als würde sie mit jeder Minute schmäler …
Nach dem Auslaufen aus Bergen und dem Unfall der Esso war die Reise ähnlich katastrophal weitergegangen. Am 12. Juli 1940 hatten sie das Nordkap passiert, nur um zu erfahren, dass der Weg ostwärts noch immer versperrt war. Das Angebot der Russen, Murmansk anzulaufen und auf bessere Bedingungen zu warten, hatte Tyssen kategorisch abgelehnt. Die Gefahr, von den Aufklärern der Alliierten entdeckt zu werden, schien ihm zu groß. Also hatte er kurzerhand befohlen, die Komet auf offener See treiben zu lassen, in den eisigen Fluten der Barentsee vor Nowaja Semlja, mit den Strömungen, um Diesel zu sparen.
Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen …
Schließlich einen ganzen Monat.
Die Stimmung an Bord hatte sich mit jeder weiteren Woche auf See verschlechtert. Reichert, einsilbig und verschlossen, war mit seinem elitären und rüden Auftreten sogar einmal in einen Raufhandel verwickelt worden, den der Erste Offizier jedoch schnell schlichten konnte. Bestraft wurde niemand. Tyssen konnte es jedem nachfühlen. Er hätte am liebsten den SS-Mann eigenhändig über Bord geworfen und zugesehen, wie er in den grün-blauen Fluten des Eismeers versank.
Abgesehen davon nutzte der Kapitän die unerwartete freie Zeit dazu, um seine Mannschaft auf ihre Rolle als Kaperfahrer vorzubereiten, als »Piraten des Führers«. So lautete der offizielle Auftrag dieser Fahrt ans andere Ende der Welt, auch wenn Tyssen sich oft genug gefragt hatte, was sich in dem verschlossenen Kuvert befand, das im Schiffssafe lag und auf dem stand: »Vom Kapitän zu öffnen – beim Überqueren des einundfünfzigsten Breitengrads.«
Doch so weit war es noch lange nicht. Vorher galt es, die feindliche See zu besiegen.
In der zweiten Augustwoche war es dann endlich so weit. Eine Passage durch das Packeis öffnete sich, und die Komet hatte per Funk den Befehl erhalten, so rasch wie möglich ostwärts zu laufen, auf einer Reise, die Geschichte schreiben sollte: durch die Karasee, die Laptewsee, die Ostsibirische See bis zur Beringstraße, der Meerenge zwischen Sibirien und Alaska.
Mit zwei russischen Lotsen, die an Bord gekommen waren, schien vorerst alles gut zu gehen, doch auch sie konnten das Eis, das sich plötzlich entgegen aller Vorhersagen vor der Komet auftürmte, nicht zum Schmelzen bringen. So war der Hilfskreuzer immer langsamer geworden, bis die Eisschollen ihn gestoppt hatten und sich herausstellte, dass keiner der russischen Eisbrecher nahe genug war, um zu Hilfe zu eilen.
Schließlich musste Tyssen zähneknirschend das Kommando zum Wenden geben.
So viele Pfeifen hatte er auf keiner seiner bisherigen Reisen geraucht.
Es schien wie verhext: Die Komet musste tatsächlich in ihrer eigenen Fahrrinne mehr als zweihundert Seemeilen zurücklaufen, um wieder zu warten.
Tyssen versuchte erneut die Tage halbwegs konstruktiv zu nutzen, um die Komet sicherheitshalber wieder einmal umzubauen, diesmal in einen deutschen Frachter mit dem klingenden Namen Donau. Die Mannschaft meinte inzwischen scherzend und kopfschüttelnd, das sei keine Kaper-, sondern eine Tischlerkreuzfahrt. An Bord sägte, nagelte und verstärkte man, strich Balken und Bretter, und Reichert, der die Arbeiten an Bord skeptisch betrachtete und sie als reine Zeitverschwendung bezeichnete, stellte in einem Nebensatz anlässlich einer seiner seltenen Unterhaltungen sogar den Mut und die Kompetenz Tyssens infrage.
»Warum suchen Sie sich dann nicht einfach ein anderes Schiff?«, hatte ihn der Kapitän zur Rede gestellt. »Oder sind Sie vom letzten wegen inkompetenter Äußerungen runtergeflogen?«
In einem Augenblick war Reichert auf dem Sprung gewesen, wie ein gefährliches Raubtier, und für einen Moment hatte es so ausgesehen, als würden beide Männer hier und jetzt aneinandergeraten. Dann war der SS-Mann mit eisigem Gesicht aufgestanden und wortlos in seine Kabine verschwunden.
»Sie sollten ihm nicht den Rücken zukehren«, hatte der Erste Offizier gemurmelt. »Reichert ist ein hungriger Wolf mit einem Freibrief von ganz oben.«
Am 19. August war endlich die erlösende Nachricht über Funk gekommen: Das Eis sei dünner geworden, und man habe einen Kurs ausgemacht, auf dem die Komet weiter ostwärts laufen könne. Tatsächlich gelang es dem Hilfskreuzer, seinen Weg durch das dünner werdende Eisfeld zu brechen und drei Tage später das offene Wasser zu erreichen.
Wem bisher noch nicht bewusst gewesen war, dass der Auftrag der Komet ein besonderer sein musste, dem musste es spätestens dann klar geworden sein, als am Morgen der stärkste Eisbrecher der Welt, die Lenin, wie ein riesiges Gespenst aus dem Nebel auftauchte und begann, den deutschen Hilfskreuzer in arktische Gewässer zu begleiten.
Doch damit nicht genug.
Als die beiden Schiffe das Kap Tscheljuskin passiert hatten, waren sie vom Flaggschiff der sowjetischen arktischen Flotte, dem Eisbrecher Stalin, erwartet worden. Nachdem sich die anfängliche Überraschung gelegt hatte, gingen die drei Schiffe längsseits und wurden Rumpf an Rumpf vertäut. Nach einer Nacht des Feierns und der Verbrüderung war der Konvoi schließlich in den frühen Morgenstunden aufgebrochen.
SS-Sturmbannführer Reichert war die ganze Zeit über in seiner Kabine geblieben.
Niemand hatte dies bedauert.
Als die Lenin Abschied genommen hatte und zurückgekehrt war, hatte sich die Stalin vor die Komet gesetzt und begonnen, einen Weg durch das dicke Packeis zu pflügen.
Das war heute Morgen gewesen.
»Wir müssten eigentlich jeden Moment offenes Wasser erreichen.«
Der Erste Offizier Hans Strübner versuchte mit dem Feldstecher, den dicken Nebel zu durchdringen, der in weißen Schwaden die Komet umwaberte. Selbst die Stalin war nun hinter der weißen Wand verschwunden, und nur die eisfreie Fahrtrinne verriet ihre Anwesenheit. Hin und wieder krachte eine besonders große Eisscholle an die Bugwand der Komet.
Es klang jedes Mal wie ein Paukenschlag in einer Wagner-Oper. Götterdämmerung im Eis.
»Müssten, sollten, dürften«, brummte Tyssen schlecht gelaunt und legte die Pfeife zur Seite. Zu viel Wodka und zu wenig Schlaf waren eine verteufelte Kombination. »Wir müssten schon längst durch die Beringstraße sein, sollten keinen mysteriösen SS-Heini an Bord haben, dürften uns nicht jeden Tag mit diesem beschissenen Wetter herumschlagen, das uns nur aufhält. Es ist Sommer, verdammt noch mal, selbst in der Arktis. Nur weiß das scheinbar keiner da draußen!«
»Den Wetterfröschen nach ist es heuer in ganz Europa zu kalt für August.« Strübner nickte.
»Das Wetter im Rest der Welt ist mir scheißegal«, bellte Tyssen und wies anklagend auf das Weiß, in dem Eis und Nebel ineinander überzugehen schienen. »Aber wenigstens hier könnte die Sonne scheinen.«
Plötzlich flog die Tür zur Brücke auf, und Reichert stürmte herein, mit wehendem Ledermantel, eine Pistole in der Hand. Sein Gesicht war rot, und er wedelte aufgeregt mit einem Blatt Papier. »Wir müssen sofort umkehren!«, rief er.
Tyssen sah ihn an, als habe er den Verstand verloren. »Erst mal weg mit der Pistole, Sie Komiker«, sagte er ruhig und gab dem Ersten Offizier einen Wink. »Das ist mein Schiff, meine Brücke, und hier bestimme ich, wer Waffen trägt. Und Sie gehören nicht dazu.«
Doch Reichert ging nicht darauf ein. Im Gegenteil. Er hob die Waffe und zielte auf Tyssen. »Wir müssen umkehren, sofort!«
»Darf ich fragen, wie Sie zu dieser überraschenden Erkenntnis kommen?«, erkundigte sich Tyssen kopfschüttelnd. »Wir laufen hinter einem russischen Eisbrecher her, die Fahrtrinne ist schmal und wird hinter uns wieder zufrieren. Sieht also schlecht aus, und das sollte selbst ein Süßwassermatrose wie Sie begreifen.«
»Dann geben Sie der Stalin den Befehl zu wenden!«, beharrte der SS-Mann und hielt dem Kapitän das Blatt Papier vor die Nase. »Die letzten Informationen aus Ihrem Funkraum. In der Beringstraße wimmelt es nur so von amerikanischen Kriegsschiffen.«
Tyssen ignorierte das Papier und die Waffe, wandte sich Reichert zu und streckte kampflustig das Kinn vor. »Was hatten Sie überhaupt im Funkraum zu suchen? Sind Sie noch ganz bei Trost? Was fällt Ihnen ein?«
»Es ist eine Nachricht vom Reichssicherheitshauptamt, an mich gerichtet.« Reicherts Augen blitzten überheblich.
»Und wenn sie vom Führer persönlich ist, mit Bild und handschriftlicher Widmung!«, entgegnete Tyssen erregt. »Mir scheißegal. Es gibt Regeln auf diesem Schiff, und die gelten auch für Passagiere, die keiner eingeladen hat. Und jetzt runter von der Brücke. Und wenn ich Sie noch einmal auch nur in der Nähe des Funkraums erwische, dann können Sie auf dem Vordeck der Stalin weiterreisen.« Er senkte den Kopf wie ein kampfbereiter Stier. »Es braucht Sie hier niemand, es hat Sie niemand eingeladen, und Sie werden niemandem fehlen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Raus hier! Sonst wenden Sie alleine, und zwar auf der nächsten Eisscholle!«
Der SS-Mann hob die Waffe, und der Lauf zeigte nun genau auf den Kopf von Tyssen. »Sie Wichtigtuer«, stieß Reichert zwischen den Zähnen hervor und legte mit dem Daumen den Sicherungshebel um. »Dieses Schiff ist nur deshalb unterwegs, weil ich darauf bin. Wer, glauben Sie, hat den Russen die 130000 US-Dollar überwiesen für ihre Eisbrecher? Wer hat den Treibstoff und die Lebensmittel bezahlt? Glauben Sie tatsächlich, das ist eine Vergnügungsfahrt zur Selbstverwirklichung von Kapitän Tyssen? Eben mal eine kleine Kaperfahrt auf die andere Seite der Welt, um die Karriere bei der Kriegsmarine ein wenig aufzuputzen? Sie lächerlicher Träumer! Sie haben ja keine Ahnung.«
Er streckte den Arm aus. Die Mündung der 08 war nur mehr Zentimeter von Tyssens Schläfe entfernt.
»Der einzige Mann, der auf diesem Schiff entbehrlich ist, sind Sie! Meine Befehle sind klar und eindeutig. Eliminieren Sie alle und jeden, der Ihnen bei der Erreichung des Zieles im Wege steht. Leider trifft das jetzt hundertprozentig auf Sie zu.« Reichert spannte mit unbewegtem Gesicht den Hahn. »Adieu, Kapitän Tyssen, das Eismeer ist groß. Beim Sturm über Bord gegangen. Man wird Ihren Körper nicht mehr finden, aber ein Platz auf irgendeiner Ehrentafel wird sich schon auftreiben lassen. Hiermit ernenne ich den Ersten Offizier zum Kapitän, wegen plötzlichem Ableben desselben.«
Sein Finger krümmte sich um den Abzug.
In diesem Moment peitschten zwei Schüsse durch die Brücke. Reichert wurde von der Wucht der Einschläge nach vorn geschleudert, prallte mit dem Ausdruck völligen Unverständnisses gegen das Steuerpult, stöhnte auf und brach zusammen. Seine 08 schlitterte über den blanken Holzboden, bis der Erste Offizier seinen Stiefel draufsetzte.
»Der war mir von Anfang an suspekt.«
Der Maschinist Wolfgang Krüger in seiner fleckigen Montur stand in der offenen Tür und ließ die schwere Luger sinken. »Geschniegelt, gestriegelt und hochnäsig. Himmlers Heini. SS vom Übelsten. Pfui Teufel!« Er drehte den Kopf und spuckte eine Prise Kautabak in den arktischen Wind. »Alles in Ordnung, Kapitän?«
Tyssen nickte erleichtert. »Danke, Krüger, das war knapp.« Dann sah er den Ersten Offizier an, der die Hand noch am Alarmknopf hatte. »Das wäre Ihr erstes Kommando gewesen, nehme ich an«, grinste er dünn.
»Verzichte dankend«, antwortete Strübner kopfschüttelnd und entspannte sich. Dann hob er die Pistole auf und händigte sie Tyssen aus. »Würde beim Rasieren auch morgen noch gerne in den Spiegel sehen können, Käpt’n.«
Tyssen sah den leblosen Körper kalt an. »Er wollte wenden, wenn ich mich recht erinnere. Nun, vielleicht ist er mit einem stationären Aufenthalt in der Arktis auch zufrieden. Kälte konserviert bekanntlich. Über Bord mit ihm. Krüger hilft Ihnen dabei. Sonst zu niemandem ein Wort.«
Wenige Minuten später stürzte ein dunkler Körper schwer auf die Eisschollen an Backbord. Zuerst sah es so aus, als würde er ins dunkle Wasser rutschen, doch dann verhakten sich zwei Schollen, hielten sich gegenseitig gerade und drifteten gemeinsam wie ein Floß in die Fahrtrinne zurück.
Bald waren sie im eisigen Nebel verschwunden.
Montag, 14. Juni 1971
BARDES CONTINENTAL-SAVOY-HOTELS, KAIRO/ÄGYPTEN
Die Klaviermusik schwebte wie ein Vorhang melodischer Noten durch den weiten Raum mit den hohen Fenstern, der von einigen dezent platzierten Lampen zusätzlich erleuchtet war. Der Barkeeper mit dem schnurgerade gezogenen Seitenscheitel in den pomadisierten Haaren sah den jungen Mann auf der anderen Seite der Bar mit schräg gelegtem Kopf an. Er kannte John Finch nun bereits seit fast zehn Jahren, aber es erstaunte ihn immer wieder, wie viel der junge drahtige Engländer mit der militärisch kurzen Frisur, den graublauen Augen hinter der Ray-Ban-Sonnenbrille und dem ansteckenden Lächeln vertragen konnte. Während er zum hundertsten Mal über die spiegelnde Fläche der Theke wischte, fiel der Blick des Barkeepers auf die beeindruckende Batterie leerer Flaschen Sakkara-Bier, die halbvolle Flasche Single Malt Whisky, das Glas mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit auf der hochglanzpolierten Theke und die Stapel blinkender Maria-Theresien-Taler gleich daneben.
»Lassen Sie alles so, wie es ist, Karim. Einfach alles so, wie es ist.« Der junge englische Pilot blickte gerade einer Gruppe von Touristinnen nach, die in leichten Sommerkleidern und einer Wolke Parfum vorbeischwebten.
»Es ist noch nicht einmal fünf Uhr nachmittags, Mr Finch«, meinte Karim schließlich mit einem leisen Vorwurf in der Stimme.
»Sie klingen wie meine Mutter, Karim, und glauben Sie mir, das möchten Sie nicht«, kam prompt die Antwort. »Und irgendwo ist immer fünf Uhr nachmittags.«
»Yes, Sir«, nickte der Barkeeper grinsend. Er mochte den englischen Piloten, der zwar Unmengen in sich hineinkippte, aber stets stocknüchtern seine Einsätze und Aufträge flog.
Und selbst dann wieder erfolgreich zurückkam, wenn alle anderen schon aufgegeben hatten und abgedreht waren.
»Hat sich Ihr Besuch verspätet?«, wollte der Barkeeper wissen, und Finch riss endlich seinen Blick von den schlanken Beinen unter den kokett schwingenden Röcken los.
»Beten wir, dass er noch etwas länger auf sich warten lässt«, meinte der junge Pilot trocken und zugleich erschreckend nüchtern. »Es gibt Aufträge, die bringen Ruhm und Ehre, es gibt solche, die bringen viel Geld, und solche, an die man sich gerne zurückerinnert.«
Karim sah ihn erwartungsvoll an und wartete, während er wie mechanisch weiter die Theke polierte.
»Dann gibt es noch eine letzte Kategorie. Aufträge, die nichts einbringen, die man am liebsten sofort wieder vergessen würde und nach denen man sich jedes Mal vornimmt, so etwas nie wieder anzunehmen. Um wenig später doch wieder schwach zu werden.«
Karim wiegte abwartend den Kopf.
»Sie fliegen doch so gerne, Sir«, meinte er schließlich versöhnlich. »Es ist Ihr Leben.«
»Wer fliegt, der kann auch abstürzen, Karim, auch wenn man nicht daran denkt und es verdrängt. Afrika ist riesig, die Wüste einsam, der Urwald gierig. Und der Teufel, der schläft nie.«
»Nein, Sir, da haben Sie recht, der Schaitan schläft niemals.« Karim brachte neue Eiswürfel in einer silbernen Schale und stellte sie neben die Maria-Theresien-Taler.
»Der Schaitan …«, wiederholte Finch geistesabwesend und nickte. »Und jetzt, jetzt sitze ich hier und warte auf ihn.« Finch stapelte einige der Silbermünzen zu einem kleinen Turm und schob sie über die Theke. »Verkaufte nicht Judas Jesus und seine Seele für dreißig Silberlinge, bevor er sich auf den Weg in die Hölle machte?«
»Wenn Sie es sagen, Sir.« Der Barkeeper lächelte nachsichtig. »Religion ist nicht so meine Sache, wissen Sie.«
»Ein gutes Prinzip, Karim«, nickte der junge Pilot, »behalten Sie es bei.«
*
John Finch war 1961, mit achtzehn Jahren, nach Kairo gekommen. So unglaublich es klang, damals hatte er bereits zehn Jahre lang in Flugzeugen gesessen. Erst auf dem Schoß seines Vaters, des berühmten Jagdfliegers der Royal Air Force, dann daneben. John konnte früher fliegen als Rad fahren.
Der alte Peter Finch hatte nie viel von Vorschriften gehalten. Der Krieg hatte ihn zu einem sarkastischen Anarchisten der Lüfte gemacht.
»Die Freiheit da oben gehört dir«, hatte er immer zu seinem Sohn gesagt, »lass sie dir nicht von Kleingeistern vermiesen.« Dann hatte er regelmäßig seinem Sohn den Steuerknüppel in die Hand gedrückt und demonstrativ die Augen geschlossen. Und so hatte John seinen Vater geflogen, über die grünen Wiesen Englands, hinaus aufs Meer, durch Gewitterfronten und Regenschauer, Luftlöcher und Sturmböen. War neben dem schweigsamen Fliegerass der Luftschlacht um England gesessen und hatte sich gefragt, ob sein Vater hin und wieder blinzelte …
Doch das hatte er nie herausgefunden.
Denn das eine Mal, das letzte Mal, da war John nicht dabei gewesen.
Jenes eine Mal, das sein ganzes Leben verändern sollte.
Als John an dem Wrack angekommen war, während die Rettungsmannschaften noch verbissen arbeiteten und seinem Vater doch nicht mehr helfen konnten, da war ihm klar geworden, dass er ab nun alleine würde fliegen müssen.
Hellwach, mit offenen Augen, ohne Hilfe und doppelten Boden. Und ohne seinen Vater auf dem Nebensitz.
So war er lange dagestanden, an der Absturzstelle. Stundenlang, die Hände tief in den Taschen vergraben, die Schultern vorgebeugt. Erst waren die Rettungsmannschaften abgezogen und hatten die Leiche mitgenommen, dann die Beamten der Untersuchungsbehörde. Zuletzt hatten sie die Reste des Flugzeugs abtransportiert, verknülltes Aluminium, und mit ihnen Johns heile Welt und alles, woran er glaubte.
Endlich, lange nach Einbruch der Dunkelheit, hatte John sich vor Kälte zitternd umgedreht und geschworen, entweder bald genauso zu sterben oder zum Andenken an seinen Vater noch besser zu werden.
Sein Leben lang am Limit zu fliegen und trotzdem zu überleben.
An die nächsten Tage konnte sich John nicht mehr erinnern. Irgendwann hatten die Behörden seiner Mutter den Tascheninhalt ihres Mannes ausgehändigt, darunter einen Silberdollar von 1844.
Es war das einzige Erinnerungsstück an seinen Vater, das John für sich reklamierte. Als er von der Beerdigung nach Hause gekommen war, an der die besten Flieger Englands Spalier gestanden hatten, war er mit der Vergangenheit, seiner Jugend und der kleinen Welt in Crawley fertig. Er packte wortlos seinen kleinen Koffer, hängte sich seine Fliegerjacke um die Schultern und stopfte das wenige Geld, das er gespart hatte, in die Tasche. Nachdem er seine Mutter flüchtig umarmt hatte, machte er sich auf den Weg zum Bahnhof, zu Fuß, durch den strömenden Regen.
So sah niemand seine Tränen.
Er wollte weg, nur weg.
Weg aus dem engen, kalten und nassen England, weg von den Erinnerungen an sein einziges Idol, weg von seinem bisherigen Leben. Früh genug musste er erkennen, dass man nicht vor allem davonlaufen konnte.
Aber diese Erkenntnis kam erst viele Jahre später, irgendwo über Afrika, in den Ausläufern eines Sandsturms.
Am Bahnsteig angekommen, schlenderte er ziellos auf und ab. Der Regen hatte nachgelassen und Windböen trieben Zeitungsfetzen über den feuchten Asphalt. John hatte noch immer keine Ahnung, wohin er fahren sollte.
Der nächste Zug?
Fuhr nach London.
Auch gut, sagte sich John und steuerte die einzige Bank unter dem Vordach an, auf der eine alte Frau trotz der Kälte vor sich hin döste. Da fiel ihm plötzlich ein verblasstes Plakat ins Auge, das neben einem zerschrammten Zigarettenautomaten hing und im Wind flatterte. Es machte Werbung für das Continental-Savoy-Hotel in Kairo. Im Schattenriss thronte die Sphinx vor drei Pyramiden unter einem heißen Himmel, umgeben von Sanddünen und beschienen von einer glutroten Sonne.
Plötzlich wusste John, wohin ihn sein erster Weg führen würde.
So geschah es, dass ein blasser junger Mann einen Tag später durch die Drehtür mit den geschliffenen Gläsern zum ersten Mal das ehrwürdige Hotel an der Shareh Gomhouriah in der ägyptischen Hauptstadt betrat und nach einem Blick auf die Zimmerpreise beschloss, mit dem Schicksal zu pokern.
Seine Ersparnisse reichten nämlich gerade mal für sieben Nächte. Danach war er entweder pleite, oder er hatte einen Job, der ihm sein Leben in diesem alten Grandhotel finanzieren würde.
Vier Tage später verlängerte er sein Zimmer auf unbestimmte Zeit und flog seinen ersten Auftrag. Der Algerienkrieg tobte, und man suchte junge unerschrockene Männer, die Geld brauchten, nichts zu verlieren hatten und flogen wie der Teufel … Man stellte keine Fragen und erwartete auch keine. Fluglizenz? Nebensächlichkeiten.
»Bring die Kiste heil wieder zurück, und du bekommst den nächsten Auftrag«, hieß es. »Brauchst gar nicht duschen gehen, kannst gleich wieder starten.«
Wie lange war das jetzt schon her? Zehn Jahre? Es kam John wie eine kleine Ewigkeit vor.
Er drehte sich um, ließ seinen Blick über die Besucher der Bar schweifen und dachte an seinen Vater. Der Silberdollar aus der abgestürzten Maschine begleitete ihn noch immer, wie eine eiserne Reserve für seine Himmelsreisen, den letzten Zoll an der allerletzten Grenze.
To pay the ferryman …
Wer würde die Münze einmal aus seiner Tasche ziehen? Wann und wo?
Nach seinem allerletzten Flug …
Dann würde der alte Silberdollar wohl seinen Mythos verloren haben, seine Kraft und sein Geheimnis. Denn nach ihm würde niemand mehr kommen, der ihn zu seinem Talisman machen würde.
John steckte die Silbermünze nachdenklich und sorgsam wieder ein. Er erinnerte sich mit einem Mal an seine ersten Wochen im Continental-Savoy, damals, als er die Suite 101 gleich für einen ganzen Monat gemietet hatte. Nun, mehr als zehn Jahre später, war er noch immer da, gleiche Suite, ganze neunundzwanzig Jahre alt und hungrig nach Abenteuern. Das Grab seines Vaters hatte er niemals besucht, England war weit weg, und zu seiner Mutter hatte er keine enge Beziehung gehabt. Und nun? Nun waren die Flugzeuge sein Zuhause, Kairo sein Stützpunkt und Afrika seine große Leidenschaft, Frauen wie Kometen, die vorbeirauschten und verglühten.
So war er in seiner Zimmerflucht im Continental-Savoy geblieben, hatte sich häuslich eingerichtet und war doch immer auf dem Sprung.
Afrika zwischen Beirut und Dakar, Kairo und Kapstadt, das war nun seine Bühne, sein Abenteuerspielplatz, seine neue Heimat.
Finch flog mit allen Flugzeugen, ob alt oder neu. Hauptsache, sie schafften es in die Luft und wieder heil herunter. Die alte DC-3, die er vor wenigen Wochen beinahe einer ägyptischen Fluglinie abgekauft hätte, steckte noch mitten in der Renovierungsphase. Doch irgendwann würde er endlich sein eigenes Flugzeug haben.
Bis dahin hatte es sich der junge Pilot zur Regel gemacht, für alle zu fliegen, die genug bezahlten und das Glück hatten, ihn auf dem Erdboden zu erwischen.
Also in der Bar des Continental-Savoy … dem Büro mit dem niemals endenden Nachschub an Sakkara-Bier, Islay-Whisky und jungen Touristinnen.
Doch meist war Finch ständig in der Luft, flog Nachschub durch Wüstenstürme und Waffen in Bürgerkriege, Söldner nach Nigeria und gestürzte Potentaten in ein sicheres Exil. Er transportierte Goldbarren aus Südafrika, Sklaven aus Gabun oder Diamanten aus den Minen von Botswana, schaffte Soldaten nach Äthiopien und holte Söldner aus den schwarzafrikanischen Krisenherden heraus. Seine Flüge im Algerienkrieg waren der Stoff, aus dem Piloten ihre Legenden strickten. Man bezahlte ihn in Dollar oder ägyptischen Pfund und manchmal auch mit Taschen voller Maria-Theresien-Taler. Finch war es gleich. Geld war nicht wichtig. Es war nur ein Mittel zum Zweck, der Treibstoff zum Horizont.
Finch war überall und doch nirgends zu Hause, ein fliegender Abenteurer in den Weiten Afrikas. Sein Motto: Hauptsache nur nicht zu lange am Boden. Wenn er von einem Auftrag zurückkam, dann verschwommen die Nächte zu einem Kaleidoskop von Erinnerung an heiße, endlose Stunden bei Bier und Whisky, in Gesellschaft reicher Engländer, vorsichtiger Deutscher und zwielichtiger Mädchen mit tiefen Dekolletées, denen die Gier aus den Augen leuchtete.
»Ein paar Nüsse, Sir?« Karim unterbrach seine Gedanken und räusperte sich. Finch blickte auf. Der Mann, der mit großen Schritten durch die Bar auf ihn zukam, war groß, massig und hatte streng nach hinten gekämmtes Haar über einem grobschlächtigen Gesicht. Die elegante, randlose Brille in seinem gebräunten Gesicht diente nur seiner Tarnung, wie John in Erfahrung gebracht hatte. Fensterglas. Sein Besucher trug trotz der sommerlich heißen Temperaturen einen makellosen Anzug, einen hellen Zweireiher, das zur Krawatte passende Einstecktuch und einen Panamahut.
»Wenn man vom Teufel spricht.« Finch grinste und nickte seinem Gast zu, bevor er Karim ein Zeichen gab. »Bringen Sie Herrn Schuhmann ein kaltes Bier für den Anfang. Er kommt direkt aus der Hölle von Mosambik.«
»Aber um Gottes willen kein Sakkara«, wandte der Untersetzte entsetzt nach einem Blick auf die leeren Flaschen vor Finch ein und ließ sich ächzend auf dem Barhocker neben dem Piloten nieder. »Wie halten Sie es bloß so lange in dieser heißen, stinkenden, lärmenden, staubigen Stadt aus? Ich bin noch keine drei Wochen in Afrika und habe schon Sehnsucht nach Leipzig.«
John machte eine umfassende Handbewegung, schloss die Bar, den Barkeeper, den jungen Pianisten an seinem Flügel und die zahlreichen Besucher mit ein.
»Das Continental-Savoy ist eine Oase im quirligen Leben Kairos. Willkommen in meinem Wohnzimmer, meinem Büro und auf meinem Stützpunkt in Afrika. Perfekt klimatisiert, eisgekühlte Getränke freundlich serviert, wechselnde Gäste, junge Touristinnen, außerdem der wichtigste Nachrichtenumschlagplatz zwischen Beirut und Casablanca. Denn hier in der Bar des Continental-Savoy treffen sich alle. Die Reichen und die Schönen von Kairo, Engländer mit viel Geld und Deutsche mit noch mehr Vergangenheit. Nichts für ungut. Man macht dubiose Geschäfte und lebt auf großem Fuß, auch wenn manchmal der Schuh drückt.«
»Dieses Hotel ist tatsächlich weltbekannt.« Schuhmann nickte nachdenklich und putzte ein imaginäres Stäubchen von seinem Revers. »Ich habe Erkundigungen eingezogen, bevor ich Sie hier getroffen habe. T.E. Lawrence wohnte im Continental-Savoy, als er das erste Mal im Dezember 1914 nach Kairo kam. Lawrence of Arabia stieg am Ende des Ersten Weltkriegs hier als illustrer Gast ab, Lord Carnarvon starb 1923 in einer der Suiten nach einem Insektenstich, den er sich in Luxor zugezogen hatte, angeblich der Fluch des Pharaos, während 1941 ein gewisser Major Wingate zwei Mal versuchte, sich durch einen Messerstich in seinen Nacken umzubringen. Und überlebte. Während in den Unruhen von 1952 die Konkurrenz des Continental-Savoy niedergebrannt wurde, überstand das alte Hotel die Ausschreitungen unbeschädigt. Und dann erzählt man sich da noch so einige legendäre Geschichten über Sie und Ihr Stehvermögen hier in der Bar des Continental Savoy in Kairo.«
John Finch winkte ab. »Schamlose Übertreibungen.«
Mit einem »Santé!« stellte der Barkeeper eine Flasche Heineken und ein eisgekühltes Glas vor Schuhmann auf den Tresen, während der Pianist As Time Goes By anstimmte.
»Und Ihre halsbrecherischen Flüge in den Algerischen Bürgerkrieg, auch alles Übertreibungen?«, stieß Schuhmann nach.
»Sie sind gut unterrichtet.« John runzelte die Stirn.
»Ich weiß gerne, mit wem ich fliege«, erwiderte Schuhmann kalt.
Finch zuckte gleichgültig mit den Schultern. Für einen Moment versanken die Bar und die Musik in einem Strudel von Erinnerungen, der John mitriss. Die Versorgungsflüge nach Algier, der Terror in den Straßen, die Wut und die Grausamkeit der Kämpfenden.
»Algerien. Einer der grausamsten Konflikte in Nordafrika.« Der junge Pilot nickte und nahm einen großen Schluck Whisky. »Ich flog damals für eine Frachtfluglinie Versorgungsgüter nach Algier, beinahe jeden Tag. Das Land war nach acht Jahren erbarmungslosem Krieg ausgeblutet, fast alle Ausländer waren entweder geflüchtet oder ermordet worden, ihre Güter verwüstet, ihre Arbeiter erschlagen. Gruppen von marodierenden Anhängern der FNL zogen mordend durch die Straßen, mit Macheten und Knüppeln bewaffnet. Sie machten Jagd auf Harkis und deren Familien, auf Kollaborateure, wie sie es nannten, auf alles, was auch nur im Entferntesten an den verhassten Kolonialstaat und die Franzosen erinnerte. Die Stadt brannte an allen Ecken und Enden, ein Terrorregime feierte seine Revanche und nahm blutige Rache. Niemand flog damals gern nach Algier, also nahm ich den Auftrag an. Er war gut bezahlt und ich noch neu in Afrika.«
»Er bezahlte nicht nur Ihre Suite im Continental-Savoy«, erinnerte ihn Schuhmann.
»Sie wissen verdammt gut Bescheid. Aber was habe ich von einem Sonderbeauftragten im Dienste des MfS anderes erwartet?«, erwiderte John trocken. »Dann kam der Tag, an dem plötzlich ein alter Mann in Algier neben dem Flugzeug stand, ein kleines Mädchen an der Hand. Er war Anwalt gewesen, glaubte an eine algerische Zukunft in Blau-Weiß-Rot und wurde bitter enttäuscht. Schließlich verlor er von heute auf morgen alles, auch seinen Glauben an das Gute. Seine Frau war bereits bei der Geburt seiner einzigen Tochter gestorben, wie er mir später mitteilte, und so hatte er nichts mehr, was ihn in Algier hielt. Er hatte sich zum Flughafen durchgeschlagen, ohne den FNL-Patrouillen in die Hände zu fallen. Ganz gelang ihm das nicht. Zwei Anhänger erkannten ihn und prügelten auf ihn ein, bis er sich losreißen konnte. Und da stand er dann, starrte mich an, während ihm das Blut über die Wange rann. Die Hitze war unerträglich, und Fliegen schwirrten um seinen Kopf. In seinen Augen spiegelten sich Verzweiflung und Todesangst.«
»Also hatten Sie Mitleid«, schloss Schuhmann und nahm noch einen großen Schluck Bier. »Sie haben ein weiches Herz, Mr Finch, das hätte Sie das Leben kosten können. Es war bei Todesstrafe verboten, Passagiere aus Algier mitzunehmen.«