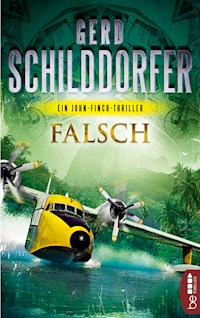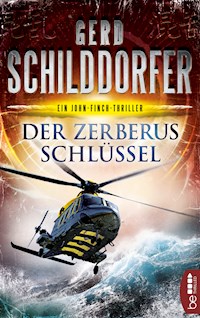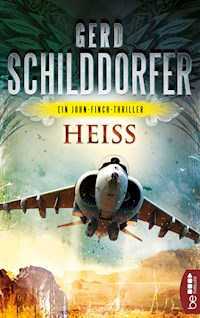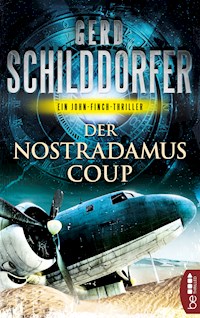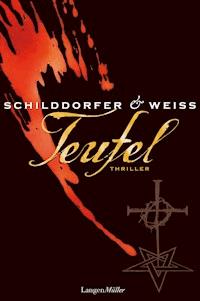
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Zwei Leichen, eingemauert in ein Kriegerdenkmal an der österreichisch-tschechischen Grenze, sind nur der skurrile Anfang eines Alptraums. Reporter Paul Wagner und Historiker Gerg Sina sind einem Geheimnis auf der Spur, das am Fundament der katholischen Kirche rüttelt. Gesucht wird ein brisantes Archiv, das in den letzten Kriegstagen von Himmlers Wewelsburg in die Alpenfestung transportiert werden sollte, jedoch nie dort ankam. Irgendwo in Österreich ist es verschwunden... Der vatikanische Geheimdienst und eine geheimnisvolle Bruderschaft sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, dieses Wissen wiederzuerlangen - und eines wird schnell klar: Alle, die je mit dem Archiv zu tun hatten, sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Doch da ist noch etwas Älteres... viel Gefährlicheres ... seit Urzeiten ein Spiel spielend ... Als Sina und Wagner das erkennen, ist es schon fast zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1053
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gewidmet unseren Freunden, die schon vorausgegangen sind:
Paul Rusch 2.12.1954 –14.8.2009 Nous prendrons la route vers l’horizon encore une fois ensemble, mon vieux! Promis! Attends-moi …
Gerhard Schweiger 20.10.1977–18.2.2003 Von Bruder zu Bruder Der Eure bis in den Tod.
Besuchen Sie uns im Internet unterwww.langen-mueller-verlag.de
© 2011 by LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Wolfgang Heinzel unter Verwendung einer Illustration von Stefanie Bemmann Einbettung der Schrift LinLibertine nach Richtlinie der GPL eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7844-8064-0
PrologI
21. Januar 2010, Burg Grub, Waldviertel/Österreich
Es hatte fast eine Woche lang Tag und Nacht geschneit. Der Schnee türmte sich in meterhohen Schichten auf den Häusern der kleinen Ortschaften und hatte sich wie ein Leichentuch über die Landschaft gelegt. Er verschluckte Bäume, kleine Bäche, Straßen und jedes Geräusch.
Der Mann, der nach Mitternacht mit dem steilen Anstieg zur Burg Grub kämpfte, versank bis zu den Hüften in der eisigen weißen Flut. Rund um ihn war es stockdunkel, kein Licht drang aus den Fenstern des kleinen Ortes, den er gerade hinter sich gelassen hatte.
Alles schlief.
Der schwere, schwarze Rucksack drückte ihn immer wieder tiefer in den Schnee. Trotzdem, wie von einer unsichtbaren Kraft getrieben, strebte er unbeirrt dem Gipfel des steilen Hügels zu, auf dem die Burg hochragte. Die rohen, dunklen Steinmauern, auf denen dick und schwer der Schnee lastete, wuchsen schroff und abweisend in die Nacht. Irgendwo in der Ferne heulte ein Hund.
Der Mann war an einer Weggabelung angelangt, die durch eine tief verschneite Buche gekennzeichnet war. An den Stamm war ein Kruzifix genagelt. Der Heiland trug eine Krone aus Schnee. Mit einem schiefen Lächeln blickte der Unbekannte auf. Die Wolken teilten sich und gaben mit einem Mal den Blick auf den kalt strahlenden Abendstern frei, das Gestirn des Teufels. Die Wolkendecke schloss sich erneut, wie von Geisterhand. Der Mann schüttelte leicht den Kopf und wandte sich dann nach rechts. Durch die Wand aus Schneeflocken glaubte er die Umrisse einer Zugbrücke zu erkennen. So tastete er sich weiter.
Mühsam pflügte er durch den Schnee, immer näher an die Burg und damit an sein Ziel heran. Als er schließlich am Rand des Grabens stand, setzte er den Rucksack ab und holte tief Luft. »Verfluchter Schnee«, murmelte er und wischte sich den Schweiß vom Gesicht.
Dann warf er einen Blick auf seine Armbanduhr. Es war genau 1.30 Uhr. Er war im Zeitplan.
Die Zugbrücke war heruntergelassen. Meterhoher Schnee, der unter seinen Schritten knirschte, lag auf den Planken. Je näher er den Mauern kam, umso höher erschienen sie ihm. Eine Eigernordwand aus Eis, Schnee und einigen vorspringenden Steinen.
Als er mit den Handflächen über das raue Holz des Tores glitt, überlegte er seine nächsten Aktionen. Sollte er versuchen, das Schloss aufzubrechen? Oder würde ihm der Weg über die Mauer nicht erspart bleiben?
Seine Augen suchten nach einem Schloss. Doch es gab keines. Das Tor war eine massive Fläche aus dicken Holzbohlen. Da war kein Ansatzpunkt, kein Schlüsselloch. Die beiden Flügel fügten sich fast nahtlos aneinander.
Er blickte hoch zur Mauerkrone und fluchte. Dann griff er in seinen Rucksack, nahm das schwarze Seil mit dem Wurfhaken heraus und wog es in seiner Hand. Nach einigen Schritten zurück über die Brücke wandte er sich um und warf. Mit einem leisen Zischen entrollte sich das Seil. Der Haken prallte von der Mauer ab und fiel wieder zurück.
Nach dem fünften Versuch verhakte er sich endlich. Der Mann riss versuchsweise am Seil, es hielt. Zufrieden schulterte er den Rucksack und begann zu klettern.
Professor Georg Sina war in seinem Lehnsessel eingeschlafen, eine Tasse mit einem kalten Teerest noch in der Hand. Das Feuer im Kamin war auf Glutnester heruntergebrannt, und es war kühl geworden in der großen Wohnküche der Burg. Auf Sinas Schoß lag ein aufgeschlagenes Buch über die Michaelskirchen in Niederösterreich. Eine Mappe mit dem Titel »Il Diavolo in Torino« und einem seltsamen Zeichen auf dem Umschlag lag auf einem kleinen Tischchen neben dem Lehnstuhl. Die Kerzen in dem alten Messingleuchter flackerten nur noch schwach. Vom Sofa her kam wohliges Stöhnen. Tschak, der kleine tibetische Hirtenhund, träumte von langen Spaziergängen durch die winterliche Landschaft und von flüchtenden Hasen.
Die Träume seines Herrchens waren weit weniger erfreulich. Eine grinsende Fratze, deren Züge sich ständig wandelten, materialisierte sich aus dem Nichts, huschte über rohe Wände, verwandelte sich in einen Zwerg, der, auf einen Stock gestützt, dem Wissenschaftler höhnisch ins Gesicht lachte. Doch plötzlich war die kleine Gestalt verschwunden, und an ihre Stelle traten drei gackernde Hühner, die bedrohlich wirkten und sich wie auf ein unhörbares Kommando in Bewegung setzten. Sie kamen direkt auf ihn zu und wurden größer und größer …
Keuchend zog sich der Unbekannte auf die breite Mauerkrone und ließ sich in den Schnee fallen. Es schneite unvermindert. Die dicken Flocken tanzten vor seinen Augen. Der Gedanke an den Abstieg auf der anderen Seite über die rutschigen Steine war kein erfreulicher. Doch dann sah er genauer hin. Da stand ein massives Eisengerüst, das fast bis zur Mauerkrone reichte.
Der Mann grinste und richtete sich auf. »Herzlichen Dank, Professor«, murmelte er, »für das verspätete Weihnachtsgeschenk.«
Die Planken unter seinen Füßen waren rutschig und trügerisch. Als er gegen etwas stieß, das laut klappernd in der Tiefe verschwand, hielt er den Atem an. Vielleicht war das Gerüst doch keine so gute Idee gewesen.
Zwei Etagen später geschah es. Sein Rucksack blieb an einer der Querstreben hängen und riss ihn zurück. Er verlor das Gleichgewicht, stolperte über eine Schubkarre voller Werkzeug und schlug der Länge nach hin. Mit Getöse stürzten Hämmer, Steine, Haken, leere Bierflaschen in die Tiefe. Der Lärm hätte Tote geweckt.
»Verdammt, verdammt, verdammt«, zischte der Unbekannte und schaute über den Rand der Planke in den Burghof. Ein helles Quadrat aus Licht erschien auf der unberührten Schneefläche. Dann schoss ein kleiner Hund bellend aus der Tür und verschwand sofort bis zur Schwanzspitze im Schnee.
Ein verschlafener Professor Sina lugte um die Ecke. Der Eindringling blieb regungslos liegen. Er schob sich etwas vom Rand des Gerüsts zurück, näher in den Schatten der Mauer. Dabei stieß er eine Kelle an, die scheppernd an den Stützen entlang zu Boden fiel.
Das Geräusch schallte durch die Nacht und weckte Sina vollständig. Er stürzte in die Wohnküche zurück, griff nach seinem Bogen und riss eine Handvoll vorbereiteter Pfeile aus dem bereitstehenden Köcher.
Seit ihm am Neujahrsmorgen ein steter Touristenstrom den letzten Nerv geraubt hatte, war er für den Ernstfall gerüstet. Er war schließlich in die Einschicht gezogen und wollte nicht als Geheimtipp in einschlägigen Reiseführern enden.
Aber wer oder was war da draußen auf dem Gerüst?
Georg schnappte sich drei Brandpfeile, hielt sie in die Glut des Kamins und rannte auf den Burghof. Mit einem fauchenden Geräusch zog der erste Pfeil seine Lichtspur durch die Nacht und blieb in einem der Holzbretter des Gerüsts stecken.
Sina versuchte etwas zu erkennen, dann schickte er den nächsten Pfeil hinterher.
Mit großen Augen beobachtete der Eindringling den halb bekleideten Mann mit dem Bogen. »Der ist ja völlig irre«, flüsterte er entsetzt, als die Brandpfeile in seine Richtung rasten und wenige Meter von ihm entfernt im Holz stecken blieben. »Der fackelt noch das ganze Gerüst ab…«
Bevor er weiter darüber nachdenken konnte, war Sina bereits wieder verschwunden. An ein unentdecktes Eindringen war nicht mehr zu denken. Sein eigentliches Ziel, die Akte des Balthasar Jauerling, schien mit einem Mal unerreichbar. Der Unbekannte überlegte, sich wieder über die Mauerkrone zurückzuziehen. Oder sollte er es doch auf einen Kampf ankommen lassen? Und wo war der Hund?
In diesem Augenblick erschien Sina wieder auf dem Burghof, mit einem entschiedenen Gesichtsausdruck und einer Handvoll lodernder Pfeile. Von irgendwoher unter dem Gerüst ertönte gedämpftes Bellen.
Der Angreifer kramte kurz in seinem Rucksack, zog eine Handgranate hervor und entsicherte sie. Nach einem kurzen Moment entschied er sich für einen offenen Angriff. Er richtete sich auf und sah Sina im tiefen Schnee stehen und den nächsten Pfeil auf die Sehne legen.
»Das würde ich nicht tun, Herr Professor«, rief er, und seine Stimme brach sich an den Burgmauern. Georg erstarrte. Er sah eine dunkle Gestalt auf dem Gerüst kauern, eine Hand erhoben.
»Wir können uns wie zwei zivilisierte Menschen unterhalten, oder diese Handgranate wirft Sie bei der Renovierung dieser Ruine um mindestens drei Monate zurück.« Die Stimme des Mannes klang spöttisch. »Und von Ihrem Hund können Sie sich gleich verabschieden.«
»Diese Mauern haben bereits andere Kugeln gesehen und schlimmere Explosionen überstanden. Selbst Friedrich III. hat Monate gebraucht, um die Burg zu erstürmen«, gab Sina zurück und spannte ungerührt den Bogen. »Ich bin schneller in Sicherheit als Sie. Was Tschak betrifft, der ist längst im nächsten Hof. Werfen Sie!«
Stille senkte sich über den Hof. Fast lautlos stieg der Angreifer in Richtung Mauerkrone das Gerüst empor. Die Handgranate ließ er dabei nicht los. Er wollte weg von den Brandpfeilen, deren Flammen seine Position verraten könnten.
Sina sah die schemenhafte Bewegung im Dunkel und überlegte nicht lange. Mit einem Zischen schnellte ein schwarzer Jagdpfeil von der Sehne und raste durch die Nacht.
Als die breite, geschmiedete Spitze seinen Unterarm mit einem hässlichen Geräusch durchbohrte und am Knochen abprallte, jagte eine Schmerzwelle durch den Körper des Angreifers. Erschrocken ließ er die Handgranate fallen. Sie polterte das Gerüst hinab und verschwand im Schnee. Sekunden später zerriss eine Explosion die Stille, Feuerzungen schossen das Gerüst empor, die Streben knickten ein, und die Konstruktion stürzte kreischend in sich zusammen.
Im letzten Augenblick hielt sich der Eindringling am Mauerhaken fest und zog sich ächzend hoch. Ein weiterer Pfeil, der ihn nur um Zentimeter verfehlte, verriet ihm, dass Sina es persönlich genommen hatte. Nun galt es, so schnell wie möglich zu verschwinden.
Wütend griff er mit der unverletzten Hand nach dem Seil und schwang sich über die Mauerkrone, während zwei weitere Pfeile über ihn hinwegzischten.
Auf der Hälfte des Abstiegs entglitt ihm das Seil.
Er stürzte ins Dunkel.
Prolog II
Kenet-el-Jalil, Provinz Galiläa/ Römisches Reich unter Kaiser Tiberius
In dem kleinen Ort Kenet-el-Jalil in der römischen Provinz ging es hoch her. Drei Tage lang dauerte das Fest bereits, und der Lärm der Feiernden drang weit über den Buschwald in die staubige Ebene hinaus. Es schien, als wollten die gute Laune, das Lachen und das Tanzen gar kein Ende nehmen.
Die schneeweißen Lehmziegelhäuser, die nun im hereinbrechenden Abend ganz rosa leuchteten, schmiegten sich an den Hang des Hügels, und der heiße, trockene Wind trug Gelächter und Musik über die Haine und Gärten. Im Westen dämmerte die Nacht herauf, und der Abendstern strahlte hell über den steinigen Hügeln und den knorrigen Olivenbäumen. Auf dem kleinen Marktplatz tummelte sich ein buntes, zusammengewürfeltes Völkchen. Nomaden und Kaufleute kochten Tee im Staub der Lagerplätze, während Frauen an den Zisternen ihre Krüge mit Wasser füllten. Zwei Geschichtenerzähler saßen unter einem ausgebleichten Vordach und hatten eine große Schar von Zuhörern um sich versammelt. Manchen kam es so vor, als seien die beiden Männer in ihren staubigen Burnussen schon immer da gesessen, seit ewigen Zeiten.
Die ersten Feuer flammten auf. Einige der Reisenden, die mit ihren Waren und Herden auf der Straße nach Tiberias oder Jerusalem unterwegs waren, hoben ihre Köpfe in Richtung des hell erleuchteten Hauses an der Stirnseite des Platzes und lächelten. Eine Hochzeit war etwas Besonderes, dachten sie, als sie die geschmückte Chuppa im Hof stehen sahen, und sie klatschten gelegentlich den Takt der Musik mit. Der geschmückte Hochzeitsbaldachin vor dem Haus machte jetzt einen verlassenen Eindruck, nachdem sich alle Aktivitäten ins Innere verlagert hatten. Blütenblätter fielen vertrocknet von den Girlanden zu Boden, aber das tat der Feierlichkeit, die er ausstrahlte, keinen Abbruch. Einige der Männer am Marktplatz schwelgten in Erinnerungen und bei einigen weckte der Baldachin auch die Sehnsucht auf einen Neubeginn.
»Heirate oder heirate nicht, beides wirst du bereuen«, scherzte ein römischer Händler und stieß seinem arabischen Sitznachbarn am Lagerfeuer mit dem Ellenbogen in die Seite. Dann zog er den Mantel fester über seiner Tunika zusammen, und seine Gedanken wanderten zu seiner Frau, seinem warmen Haus und seinen Sklaven daheim.
Der Nomade schmunzelte in sich hinein, sah zu der ausgelassenen Feierlichkeit hinüber und nickte nachdenklich. »Wer hat das gesagt?«, fragte er dann.
»Sokrates!«, sagte der Römer. »Ein hellenischer Philosoph.«
»Na, der musste es ja wissen, mit seiner Xanthippe daheim«, antwortete der Araber, und alles begann zu lachen.
Auf dem Fest, bei dem gerade das Abendessen zu Ende gegangen war, schwankten Braut und Bräutigam zum wiederholten Mal auf zwei Stühlen über die lachenden Köpfe der Feiernden hinweg. Alle riefen aus voller Kehle ihre Segenswünsche und prosteten den jungen Leuten so begeistert zu, dass der Wein über die Ränder ihrer Becher schwappte. Wie eine Insel im Sturm der Fröhlichkeit stand eine Gruppe älterer Schriftgelehrter etwas abseits und beobachtete ihrerseits den jungen Kohen, den Priester, der die Trauung begleitet hatte.
»Gelobt, Du Ewiger, der erfreut Bräutigam und Braut!«, rezitierte der junge Geistliche laut den letzten der sieben Segenssprüche. Die Menge brach in Jubel aus, und die älteren Kohanim nickten sich zufrieden zu.
»Bis jetzt macht er seine Sache gut«, kommentierte einer der Männer.
»Ja, das finde ich auch«, bestätigte der älteste seiner Kollegen. »Er hat weder beim Gottesdienst noch beim Verlesen des Ehevertrages einen Fehler gemacht, noch etwas Unerhörtes getan. Der Junge hat immerhin im Tempel studiert! Er hat seine Studien der Thora auch nur für diese Feier unterbrochen. Ich verstehe daher das dumme Gerede nicht, dass er die Trauung…« Der Alte wollte seinen Satz noch zu Ende bringen, wurde aber jäh unterbrochen. Ein kleiner Tumult, eine ziemlich laute Unterhaltung ganz in seiner Nähe ließ ihn verstummen. Er ging rasch zu den Streitenden hinüber.
»Das ist eine Katastrophe…«, japste die Frau und starrte ihren Diener fassungslos an.
»Was ist denn eine Katastrophe, Rebekka?«, lächelte der alte Priester und berührte beruhigend die Schulter der Frau, die den Tränen nahe war. Rebekka wandte sich um, und ihr Haussklave nutzte blitzschnell die Gelegenheit, sich nach einer kurzen Verbeugung aus dem Staub zu machen.
»Es ist mir so unglaublich peinlich…«, schluchzte sie. »Ich weiß gar nicht, wie ich das meinem Sohn… Wo es doch sein großer Tag ist…«
»Aber Rebekka, bei einer so festlichen Chuppa wird es doch kein Problem geben, das die gute Stimmung verderben könnte«, beruhigte sie der Priester und legte den Arm um ihre Schulter.
»Danke, Onkel Jakob«, presste Rebekka hervor, aber sie konnte das Lächeln des alten Mannes nur mit Mühe erwidern. »Der Wein ist uns ausgegangen«, gestand sie schließlich.
Jakob zog die Brauen zusammen. »Das ist allerdings nicht gut… Nein, das ist gar nicht gut«, brummelte er und überlegte bereits, wie er seiner Nichte aus dem Schlamassel helfen könnte. Aber es wollte ihm nichts Vernünftiges einfallen.
»Was ist gar nicht gut, Onkel Jakob?« Wie aus dem Nichts war eine Frau neben dem alten Priester aufgetaucht. Ihre Stimme war autoritär und ihre Augen neugierig. »Was ist mit Rebekka los an diesem Freudentag für ihr Haus?« Die dunklen Pupillen in ihrem Gesicht musterten fragend die Verzweifelte und bekamen einen sanften Ausdruck.
»Mirjam«, wandte sich der Alte freundlich an sie. »Stell dir vor, alle Krüge sind geleert, der Wein im Haus ist verbraucht.«
»Tja, das ist bitter«, gab Mirjam knapp zur Antwort und lächelte dünn. »Die Gäste trinken aber auch wie die Kamele…« Sie ließ ihre Augen über die Feier wandern, über die lauten Gruppen der Singenden und Tanzenden, und schüttelte dann den Kopf. »Nun ja, es ist heiß… Die Leute haben Durst, und der Wein steigt ihnen zu Kopf…« Sie wandte sich ihrer Cousine zu. »Für die Bewirtung ist der Bräutigam zuständig. Hast du schon mit ihm darüber geredet?«
»Nein!«, stieß Rebekka krächzend hervor. »Nur das nicht! Gerade heute kann ich das nicht… Wie steht er denn, wie stehe ich dann vor seinen Freunden da?«
»Also gut, dann werde eben ich gehen!« Mirjam drehte sich entschlossen um und wollte loslaufen, aber ihre Cousine hielt sie am Arm fest.
»Nein, das wirst du nicht! Mein Sohn darf das nicht erfahren. Niemand soll mir nachsagen können, ich wäre eine schlechte Gastgeberin«, fauchte Rebekka, und ihre dunklen Augen funkelten.
»Aber Rebekka…«, schaltete sich Jakob beschwichtigend ein. »Der Weinvorrat ist zu Ende. Das ist nach drei durchzechten Tagen auch nicht anders zu erwarten. Niemand wird dir das verübeln.« Er lächelte verständnisvoll. »Sag ihnen doch am besten ganz einfach die Wahrheit. Ein jedes Ding hat seine Zeit, lehrt uns die Schrift. Und wenn der Wein getrunken ist, so muss auch diese Feier einmal enden, wie alles in der Welt.«
»Nein!« Rebekka stemmte die Fäuste in die Hüften. »Wir werden mit Wasser strecken, was noch da ist! Die sind alle viel zu betrunken, um den Unterschied zu schmecken.« Sie war fest entschlossen und wollte ihren Plan sofort umsetzen. Mit einer Handbewegung rief sie den Sklaven zurück. »Wie viel Wein haben wir noch?« Der Mann blickte seine Herrin ängstlich an und schaffte es nur, den Kopf zu schütteln.
Mirjam sah es und verdrehte die Augen. »Rebekka, es ist gar nichts mehr da, und du kannst nichts mehr verdünnen«, stellte sie dann lakonisch fest. »Hast du das immer noch nicht begriffen?« Sie sah der anderen fest in die Augen und wartete auf ihre Antwort.
Rebekka begann zu schluchzen und verbarg ihr Gesicht an der Brust ihres Onkels, der ihr ratlos und halbherzig auf den Rücken klopfte, während er Hilfe suchend zu Mirjam schaute. Aber die ließ nur ein verächtliches Schnaufen hören. »Dann sollen sie doch zu feiern aufhören«, murmelte sie, aber ein Blick auf Rebekka und Jakob zeigte ihr, dass dies keine Option war. »Also gut, ich rede mit meinem Sohn. Der wird das Problem schon lösen.« Sie drehte sich auf dem Fleck um und ging energisch auf den jungen Kohen zu.
Rebekka schniefte und sah ihr nach. »Verstehst du das, Onkel Jakob? Was soll dieser Bücherwurm schon groß ausrichten?«, fragte sie den alten Priester. Doch Jakob bedeutete ihr zu schweigen und beobachtete Mirjam, die sich ihren Weg durch die Feiernden bahnte und direkt auf ihren Sohn zueilte. Sie unterbrach ihn, ohne die üblichen Höflichkeiten auszutauschen, und riss ihn aus einem Gespräch. Jakob beobachtete, wie der junge Kohen gehorsam und respektvoll aufstand und seiner Mutter zuhörte, wie es sich für einen Mann geziemte, der sein Leben Gott geweiht hatte. Er überragte seine inzwischen heftig gestikulierende Mutter fast um zwei Köpfe und hatte breite Schultern. Seine dunklen, aufmerksamen Augen waren konzentriert auf Mirjam gerichtet. Doch nach und nach, im Verlauf des Gesprächs, legte sich ein Schatten auf sein Gesicht. Schließlich schüttelte er so heftig den Kopf, dass der Pferdeschwanz, den er zum Zeichen seines Gelöbnisses trug, hin und her schaukelte. Dann hob er den Arm und bedeutete seiner Mutter mit dem Zeigefinger, sie solle sich entfernen. Und seiner zornigen Miene nach ziemlich schnell.
»Unerhört…«, flüsterte Rebekka. »Er ist und bleibt ein Rabauke, er weiß nicht, dass er Vater und Mutter ehren soll, wie das Gesetz es verlangt.« Sie machte ein empörtes Gesicht. »Wer ist er denn schon?«, fuhr sie fort. »Ja, wer ist denn überhaupt sein Vater? Ich frage mich, warum mein Sohn unbedingt einen römischen Bastard als Rabbi auf seiner Hochzeit…«
»Hüte deine Zunge, Rebekka!«, unterbrach sie Jakob streng. »Wir wissen, wer sein Vater ist. Und zwar Mirjams Ehemann. Auf das dumme Gerede gebe ich nichts. Tiberius Julius Abdes Pantera ist tot, gefallen im fernen Germanien. Gott ist gerecht!« Der alte Priester wollte gehen, aber er drehte sich doch nochmals zu Rebekka um. »Und du solltest besser deine Zunge im Zaum halten. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deine Nächsten. Auch das ist Gesetz, vergiss das nicht, mein Kind.« Dann kehrte er an seinen Platz bei den anderen Schriftgelehrten zurück und verfolgte von dort aufmerksam das weitere Geschehen.
Nachdem seine Mutter gegangen war, hatte sich der junge Kohen mit einigen schnell hingeworfenen Worten bei seinen Freunden entschuldigt. Eine Zeit lang schlenderte er noch zwischen den Tischen umher und rieb sich mit den Fingern seine schlanke Nase, in Gedanken versunken. Dann fuhr er sich über den Bart, so als hätte er eine Entscheidung gefällt, und verschwand mit großen Schritten ins Freie.
Er sieht überhaupt nicht wie ein Römer aus, dachte Jakob beim Anblick seines dunkelhaarigen Verwandten. Er ist Jude, so wie ich. Er hat sich gut entwickelt, hat den Weg seiner Väter eingeschlagen, aber kann sich noch nicht unterordnen oder zur rechten Zeit seinen Mund halten. Ein Lächeln spielte um die Lippen des alten Mannes. Dieser Überschwang, Vorrecht der Jugend! Ach was, aus dem Jungen wird noch einmal ein guter Priester werden, wie auch sein Großvater einer gewesen ist. Jakob streckte die müden Knochen und ließ seine Blicke über die Hochzeitsgesellschaft schweifen, entdeckte auch Mirjam in der Menge, die wiederum ihren Sohn nicht aus den Augen ließ. Sie hatte zufrieden gelächelt und genickt, als er das Fest verlassen hatte. Nun plötzlich drehte sie überraschend den Kopf und zwinkerte Jakob zu, der sich ertappt fühlte, wie ein kleiner Junge, der durch ein Schlüsselloch geblinzelt hatte.
Nach einiger Zeit kam der junge Priester wieder zurück. Er sah ein wenig erschöpft aus, ging zu seinem Tisch und leerte den Becher auf einen Zug. Aus den Augenwinkeln beobachtete er noch, wie die Domestiken sechs Krüge in den Saal trugen, dann wandte er sich wieder an seine Freunde und stimmte in ihr Lachen und Scherzen ein, als wäre nichts geschehen.
»Lechajim!«, riefen junge Männer dem Bräutigam zu und fielen ihm ausgelassen um den Hals. Gierig stürzten sie den Wein hinunter.
»Eines musst du mir aber erklären…«, lallte einer von ihnen, dem die Tropfen des Rebensaftes im Bart glitzerten. »Warum hast du den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben, du Gauner?«
Alle lachten lauthals, nur der Bräutigam sah sich fragend nach seiner Mutter um.
Rebekka zuckte mit den Achseln. Da spürte sie plötzlich Mirjam neben sich.
»Habe ich dir nicht gesagt, mein Jeschua hat eine Lösung?«, fragte Mirjam nicht ohne Triumph in ihrer Stimme. »Er ist ein guter Junge, auch wenn er öfters ziemlich halsstarrig sein kann.« Sie machte eine kurze Pause, rückte etwas näher an die andere Frau heran und fügte eindringlich hinzu: »Aber das ist ja eine Eigenart unseres Volkes, seit den Tagen mit Mose in der Wüste. Und, Rebekka, ich kann dich beruhigen: Er ist ganz sicher kein Römer! Ich muss es schließlich wissen, ich bin seine Mutter.«
Mirjam unterdrückte ein Lachen über das entsetzte Gesicht ihrer Cousine, klopfte ihr zum Abschied auf den Arm und verschwand zufrieden zwischen den Tanzenden.
Dies geschah in dem kleinen Ort Kenet-el-Jalil, der bei den Hebräern Kana heißt, damals, als C. Fufius Geminus und L. Rubellius Geminus Konsuln von Rom waren und Tiberius Iulius Caesar Augustus als Kaiser über das riesige Reich herrschte.
Prolog III
8. März 1790, Herberge »Tre Galline«, Turin/Piemont
Die Abenddämmerung war früh über Turin hereingebrochen. Auffrischender Wind jagte Wolkenfetzen tief und schwarz über die norditalienische Stadt mit ihren zahllosen Kirchen und rechtwinkeligen Straßen. Der bedrohliche Himmel und die zunehmende Kälte trieben die Passanten rasch in ihre warmen Stuben, während der Sturm um die alten Häuser heulte, durch jede Ritze und in die hintersten Kammern drang. Er ließ selbst die Kerzen in der holzvertäfelten, separaten Stube des Gasthauses »Tre Galline« unweit des Turiner Domes flackern. Die Flämmchen zitterten und die Dochte zischten leise, als die Windsbraut durch die Schankräume schlich, Vorhänge und Wandbehänge bauschte.
Außer dem einzelnen Reisenden aus dem weit entfernten Wien befand sich niemand in der Extrastube des alteingesessenen Wirtshauses. Der einsame Gast, kaum mehr als vier Fuß groß, war vornehm gekleidet, doch wer ihn genauer beobachtete, der sah hinter der eleganten Fassade einen verzweifelten Menschen. Balthasar Jauerling zitterte vor Todesangst, zum ersten Mal in seinem Leben. Sein Magen verkrampfte sich, und Schmerzwellen rasten durch seinen Körper. Um sich Abkühlung von der quälenden inneren Hitze zu verschaffen, hatte er seine gepuderte Perücke abgelegt und sie vor sich auf dem Tisch drapiert. Mit einem Taschentuch, gesäumt mit Brüsseler Spitze, wischte er sich immer wieder den Schweiß vom Gesicht. Aufgrund seiner schwarzen, kurz geschorenen Haare und den dunkelbraunen Augen hätte man ihn so ohne Weiteres für einen Sizilianer oder Neapolitaner halten können. Wäre da nicht seine blasse Hautfarbe gewesen, die unter seiner verwischten Schminke zum Vorschein kam.
Misstrauisch blickte er sich immer wieder um, wenn die alten Fußbodenbretter knarrten oder irgendwo im Haus eine Türe zuschlug. Er sah die Schatten vor den Fenstern vorbeihuschen wie die Schemen aus seinen Albträumen, und sein Magen krampfte sich in einer dunklen Vorahnung wieder und wieder zusammen.
Von den Gipfeln der Haute-Savoie im Westen kroch die klirrende Kälte immer tiefer in die Stadt, beflügelt von Sturmböen, so unerbittlich wie ein Tross unbarmherziger Husaren, der alles überrannte, was sich ihm in den Weg stellte.
Für Jauerling waren es die Reiter der Apokalypse, und ihnen folgte der Tod auf seinem fahlen Pferd. Er hätte nicht hierherkommen dürfen, niemals. Es war ein völlig wahnsinniges Vorhaben und trotzdem … Er war immer noch Balthasar Jauerling, der Leiter des kaiserlichen Geheimdienstes, des berüchtigten Schwarzen Bureaus, und Geheimer Rat des vor wenigen Tagen verstorbenen Kaisers Joseph II. Doch er war sich auch bewusst, dass er weit weg war von den zivilisierten höfischen Szenen und den manierierten, in ihrer Strenge erstarrten Gesten der Hofschranzen, die das Zeremoniell am Wiener Kaiserhof bestimmten. Niemand dort wusste, wohin er gereist war, nachdem er bei dem prunkvollen Staatsbegräbnis dem einfachen Kupfersarg des Monarchen bis zur Kapuzinergruft gefolgt war. Mit jenen kurzen, trippelnden Schritten, die so typisch für ihn waren, wie immer gestützt auf seinen Stock. Jauerling lächelte und drehte den Knauf zwischen seinen Fingern. Er spürte beruhigt die zwei ineinander verschlungenen Figuren, die, aus Silber gegossen, einen ewigen Reigen tanzten und über das Geheimnis des Stocks wachten.
Jauerling erinnerte sich mit Wehmut an diesen düsteren Tag, an dem der einstmals hoffnungsvolle, junge Kaiser und seine Reformen zu Grabe getragen worden waren. Der Zwerg, ganz in Schwarz, war von einem Unbekannten flankiert worden, einem Mann, den es eigentlich nicht geben durfte.
Aber das war eine andere Geschichte.
Dann, noch am Tag des Begräbnisses, war Jauerling untergetaucht, verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Er hatte inkognito eine Kutsche gemietet und davon profitiert, dass er in der Öffentlichkeit völlig unbekannt war. Jeder im Reich fürchtete das Schwarze Bureau und seine Agenten, und Jauerling, der Krüppel, der es zu etwas gebracht hatte, stand an dessen Spitze. Er und nur er war dem Kaiser persönlich Rechenschaft schuldig. Sein Name wurde hinter vorgehaltener Hand geflüstert, mit angstvoll aufgerissenen Augen. Alle hofften, dass sie ihm und seinen Leuten nie begegnen würden. Aber sie kannten keine Gesichter, konnten nicht mit dem Finger auf Personen aus Fleisch und Blut zeigen, nur auf geisterhafte Schatten, die sich in der Dunkelheit auflösten wie Nebelschwaden.
Das Schwarze Bureau hinterließ keine Spuren und erst recht keine Zeugen.
So war Jauerling überstürzt, aber nicht unvorbereitet aufgebrochen. Er hatte sich westwärts gewandt, war durch das Fürsterzbistum Salzburg und die Grafschaft Tirol gereist, dann über den Brenner nach Verona und schließlich nach Turin, in die Hauptstadt des Herzogtums Savoyen. Die Pferde wurden auf der Reise nicht geschont, mussten oft gewechselt werden, der Fahrgast hatte es eilig gehabt, sehr eilig sogar.
Und nun? Nun saß der kleine große Mann in Turin, im Gasthaus zu den drei Hühnern, und zweifelte. War er am Ende seiner Reise angelangt oder erst an ihrem Anfang?
Er hatte all die Strapazen auf sich genommen, nur um gegen horrende Summen von Bestechungsgeld einen Fetzen uraltes Leinen zu betrachten. Ein Stück Stoff, auf dem schemenhaft die Umrisse eines bärtigen, nackten Mann zu erkennen waren. War dieser Schatten eines geschundenen Körpers wirklich, wie es der heilige Karl Borromeo behauptet hatte, das wahre Grabtuch mit dem Abbild von Jesus Christus? Eingebrannt im Moment seiner Auferstehung?
Das Haus Savoyen glaubte es.
Jauerling glaubte es nicht.
Zwar hatte auch er sich dem Zauber, der von dieser besonderen Reliquie ausging, nicht gänzlich entziehen können. Aber weder das Bild auf dem Leinen noch das Brimborium, das die Beamten und Priester im Palast gegen klingende Münze darum gemacht hatten, hatten ihn überzeugen können. Jauerling erinnerte sich, dass es in der Region schon zu viele Grabtücher gegeben hatte. Alle, jedes einzelne, hatten sich bei näherer Betrachtung als Fälschung, als plumpe Pinseleien entpuppt. Warum sollte es gerade bei diesem anders sein?
Er nahm einen tiefen Zug aus dem geschliffenen Glas mit dem schweren sizilianischen Rotwein, den ihm der Wirt so ans Herz gelegt hatte, bevor er mit glänzenden Augen den Mariatheresientaler eingesackt und sich mit zahllosen Verbeugungen rückwärts aus der Stube gedienert hatte. Vor Jauerling lagen mehrere Blätter über den Tisch verteilt, einige eng beschrieben, die meisten aber noch leer. Er hatte die Zeit genutzt, während der holprigen Fahrt nachgedacht, sein messerscharfer Verstand hatte die Ergebnisse der monatelangen Recherchen analysiert, hin und her gewendet, verknüpft. Das Ergebnis jagte ihm eine unsägliche Angst ein, vor allem, seit er begonnen hatte, das Unaussprechliche aufzuschreiben. Nur der Kaiser war unbeeindruckt geblieben und hatte begonnen, Klöster aufzulösen und Kirchen zu schleifen, hatte es sogar gewagt, den Papst zu brüskieren. Doch dann wurde er krank, siechte bis zum Tod, und alles ging wieder verloren …
Der Leiter des Schwarzen Bureaus fuhr sich mit der Hand über die schweißnasse Stirn. Irgendetwas in ihm war gestorben auf dieser Reise. Wo einmal sein Glauben gewohnt hatte, war jetzt ein gähnendes Loch. An Gott zu glauben, an den einen, der diese Welt geschaffen hatte, das war für ihn niemals ein Problem gewesen und war es auch heute in Turin nicht. Das hatte er schon mit der Muttermilch aufgesogen, bei der Amme, die sich seiner erbarmt hatte. Er, die Missgeburt, hätte in diesem zugigen österreichischen Waisenhaus ohne viel Aufsehen krepieren sollen. Aber sie hatte es nicht zugelassen, hatte diesen ständig vor Hunger brüllenden Kümmerling mitgenommen und ihm ein Leben geschenkt. Sie hatte ihn gegen alle Widerstände vor der Bosheit und dem Aberglauben der Leute beschützt, ihm eine gute Erziehung und Bildung ermöglicht.
Jauerling erinnerte sich mit Wehmut an seine Ziehmutter. An ihre Nähe, ihre Umarmungen und ihre allabendlichen Geschichten am Herdfeuer. Sie hatte ihm einen Glauben mitgegeben, der viel älter gewesen war als das Geschwätz der Pfaffen von der Kanzel. Sie hatte an die Ahnen, die Gottesmutter Maria und an den Vater im Himmel geglaubt, wie es bei ihr daheim schon Generationen vor ihr getan hatten. Ein einfacher Glaube, fest verwurzelt in Tradition und Alltag.
Aber wer war Jesus, dieser angebliche Sohn Gottes?
Ein Mensch wie du und ich.
Gekreuzigt, gestorben und begraben.
Daran konnte auch ein Bild auf einem Tuch für Jauerling nichts ändern.
Die Feder in seiner Hand zitterte, und er wusste, es war nicht die Kälte. Er, der nüchterne Taktierer auf dem politischen Parkett, der Verwalter des Schreckens, die dunkle Seite der Macht, wie ihn Joseph II. einmal genannt hatte, der geniale Krüppel mit dem untrüglichen Instinkt, er hatte einen schweren Fehler gemacht. Er war ein einziges Mal in seinem Leben zu neugierig, zu vermessen gewesen.
Als er den Auftrag erhalten hatte, dieser unglaublichen Fährte nachzuspüren, einer jahrtausendealten Spur zu folgen, hatte er zum ersten Mal Hoffnung gespürt. Doch nun lag genau diese Hoffnung mumifiziert in einem Kupfersarg in der Kapuzinergruft. Der tote Kaiser hatte sich nicht, wie all die anderen vor ihm, von Legenden und Märchen blenden lassen oder sich Macht von einer verschollenen Reliquie versprochen, sondern die Freiheit von der Knute und dem Joch der römischen Kirche sowie von der Unvernunft. Und Jauerling war voller Idealismus aufgebrochen und hatte nicht bemerkt, dass er auf seiner Spurensuche einen Verfolger hinauf ins Licht gelockt hatte, der besser weiter in der Finsternis geschlafen hätte.
Es gibt Dinge, die sollte man nicht einmal denken, schoss es ihm durch den Kopf.
Aus der Gaststube drangen laute Stimmen, und Jauerling horchte auf, lauernd, wie ein wildes Tier, das sein Versteck in Gefahr wusste. Er umklammerte seinen Stock fester und schob langsam den Daumennagel in den feinen Spalt zwischen Knauf und Holz. Seine Gedanken rasten. Hatte er alle Optionen bedacht? In seinem dicken Wintermantel und dem seidenen Schal, mit den ledernen Spangenschuhen und der voluminösen Tasche, die nun neben seinem Dreispitz auf der langen hölzernen Bank der Stube lag, sah er aus wie Hunderte andere Reisende auch, die um diese Jahreszeit nach Turin kamen, in diesem viel zu kalten Frühling.
Aber er war kein gewöhnlicher Reisender.
Er war ein Suchender.
Vielleicht würde die Hauptstadt von Savoyen, die Stadt »am Fuße der Berge«, für ihn zur Endstation werden, so oder so.
Der meistgefürchtete Mann des Reiches runzelte die Stirn. Er musste mit einem Mal an seinen weit entfernten Heimatort denken, an das kleine Nussdorf im Traisental bei Stift Göttweig, unweit von Krems, von dem aus man die Donau und ihre Nebenarme wie glitzernde Bänder sah, die sich im flachen Tal durch die Auwälder wanden. All das erschien ihm plötzlich, angesichts des nahen Todes, wie ein längst verlorenes Paradies. Vergessen waren die krähenden Jungen, die Pferdeäpfel nach ihm schmissen, und der bigotte Pfarrer, der ihm das Sakrament der Kommunion verwehrte.
Jauerling schloss die Augen. Er hörte schon das Lied des lustigen Pfeifers, spürte seine knöchernen Finger in seiner Hand. Bald würde er sich ihm anschließen, im ewigen Reigentanz über den Kirchhof.
Die Schatten kamen näher.
Nur einen falschen Schritt vom bewährten Pfad abgekommen, einen einzigen Irrtum zugelassen, sagte er sich immer wieder verzweifelt, und schon war alles vorbei.
»Ich bin mit meinen künstlichen Flügeln höher und höher gestiegen. Aber ich bin durch meinen Stolz und meine Vermessenheit der Sonne zu nahe gekommen. Ihre Hitze hat das Wachs zwischen den Federn meiner Schwingen geschmolzen, und gleich dem Ikarus stürze ich jetzt in die Tiefe… in die pechschwarze Nacht…«, philosophierte er halblaut. Ganz in Gedanken verloren stocherte er mit dem Federkiel im Wachs der Kerze vor ihm auf dem Tisch. »Von ganz oben kann es nur mehr bergab gehen«, murmelte er noch. Dann stützte er erneut den Kopf in die Hand, und seine Augen irrten über die Notizen, die er in den letzten Stunden wieder und immer wieder überarbeitet hatte. Einzelne Worte und manchmal sogar ganze Sätze waren durchgestrichen, überschrieben, mit kühnen Strichen zerfetzt worden. Die tiefrote Tinte ergoss sich wie aus Dutzenden kleiner Wunden über die Seiten.
Das Papier schien unter seinen Federstrichen zu bluten.
Jede Station auf seinem Weg zur Erkenntnis hatte nicht nur ihm einen tiefen Schnitt versetzt. Jede dieser Kerben war ein Schlag gegen den letzten gemeinsamen Stützbalken, der die christliche Welt zusammenhielt. Diese christliche Welt, die gerade dabei war, den Planeten zu erobern.
Doch Glaube hin oder her, die feinen Herren im bestickten Diplomatenfrack lauerten nur darauf, sich im nächsten Augenblick gegenseitig auf den Schlachtfeldern zu zerfleischen, am besten weit weg von ihren gepflegten Parks und beheizten Schlössern. Das Sterben beim Spiel um die Macht war Sache des einfachen und blöden Volkes, unter der Knute gehalten durch ein Lügenkonstrukt, das Jauerling nur allzu gern beim Teufel wüsste.
»Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht…«, zitierte Jauerling flüsternd das Neue Testament. Dann verfinsterte sich seine Miene und ein bösartiges Lächeln erschien darin. »Wegfegen werde ich beides, ein für alle Mal! Jesus ist tot! Und ich werde es beweisen…«
Der Sturm hatte noch einmal an Stärke zugelegt. Draußen war es vollends dunkel geworden. Es klopfte an der Tür. Drei Mal und dann noch einmal.
Der Kopf des Zwerges fuhr herum. Mit einer instinktiven Handbewegung, seit Jahren in Fleisch und Blut übergegangen, drehte Jauerling rasch die obersten Blätter um, wollte laut und selbstsicher »Herein« rufen. Doch seine Stimme war nur ein Krächzen, das beinahe vom Heulen des Windes übertönt wurde.
»Benötigen Exzellenz noch etwas?« Der Wirt stand in der Tür und sah den seltsamen, vornehm gekleideten Besucher besorgt und neugierig an. Er spürte die Angst, die in der Luft lag. War der kleine Mann etwa auf der Flucht? War er ein Hofzwerg, der wegen eines Ehrenhandels das Reich verlassen musste? War diese kleine Monstrosität etwa einer widernatürlich veranlagten, adeligen Mätresse zu nahe getreten? War er deshalb in das Herzogtum gekommen, um über die Pässe in den Schutz der französischen Fürstentümer zu gelangen? Oder war er gar ein Venediger? Einer dieser geheimnisumwitterten Zwerge, die für die Venezianer in den Alpen nach Goldadern suchten, der das gefundene Vermögen nun nicht bei seinen Auftraggebern abliefern wollte?
Die Augen des Mannes, der zu Mittag aus der staubigen Kutsche ausgestiegen und direkt in die Gasträume des »Tre Galline« geeilt war, musterten ihrerseits misstrauisch den untersetzten Wirt. Stämmig, mit blütenweißer Schürze und roten Bäckchen, seine Hände an einem blauen Tuch abtrocknend, erwiderte der Mann ruhig seinen forschenden Blick.
»Darf es für Ihro Gnaden Kehle vielleicht noch etwas mehr von diesem Sizilianer sein? Oder ein warmer Punsch, um sich die kalten Knochen zu wärmen?« Der Wirt bekam keine Antwort. Es war nicht die offensichtliche Nervosität des Zwerges, es war der Besucher selbst, der dem Gastgeber Kopfzerbrechen bereitete. Der Wirt wollte keinesfalls mit der Stadtgarde Probleme bekommen, das war ihm keiner seiner Gäste wert. Durchsuchungen und überraschende Besuche der Polizei waren keine gute Empfehlung für sein Lokal.
Andererseits waren die Silbertaler, mit denen der Unbekannte nicht geizte und von denen er offenbar eine ausreichende Reserve in seiner bestickten Börse mitführte, eine große Verlockung für jeden geschäftstüchtigen Gastwirt.
»Oder verlangt es Euren Gaumen nach etwas Handfestem, Exzellenz? Unsere Küche ist weit über die Stadtgrenzen hinaus berühmt«, ließ der Wirt nicht locker. »Darf ich Euch etwas Pasta a l’olio e Parmeggiano oder frisches Kalbfleisch aufwarten?«
»Sorge Er nur dafür, dass ich in Ruhe arbeiten kann!«, gab der Zwerg unwirsch zurück. »Oder warte Er… das Kalbfleisch wäre vielleicht kein schlechter Gedanke. Aber erst in etwa einer Stunde. Und jetzt schick Er sich!«
Der Wirt verneigte sich und verschwand.
Jauerling machte sich erneut an die Arbeit.
Als sich zum vereinbarten Glockenschlag die Türe öffnete und der Gastwirt mit dampfenden Tellern und Schüsseln mit Beilagen den Raum betrat, fand er den Zwerg am Boden liegend, von Krämpfen geschüttelt. Er war schweißüberströmt, vom Fieber gepackt.
Rasch bettete man ihn auf die Bank, und der Wirt gebot der Magd, sie sollte den Medico holen, der um die Ecke ordinierte, als im gleichen Augenblick ein Doktor mit einer großen Arzttasche das Lokal betrat. Man bat ihn sofort um Hilfe, und ohne einen Augenblick zu zögern, eilte der blonde, elegant gekleidete Mann zu dem Kranken. Seine blauen Augen blickten nachdenklich, als er Jauerling untersuchte und rasch eine allgemeine körperliche Erschöpfung in Verbindung mit einer schweren Erkältung diagnostizierte. Er bestellte eine Hühnerbouillon sowie eine weitere Flasche sizilianischen Rotweins zur Stärkung für seinen Patienten und etwas Piccata für sich selbst. Er bot an, Jauerling zur Ader zu lassen oder ihm ein Klistier zu verabreichen, aber der winkte nur schwach ab.
»Helft mir bitte aufzustehen«, forderte der Zwerg den Arzt auf und reichte ihm seine kleine Hand. Nach nur wenigen Schritten ließ er sich schwer in den Stuhl am Tisch fallen. Der Raum schien kleiner zu werden, nahm ihm die Luft.
Die Schatten rückten näher.
Während er seine Serviette über seinem Schoß entfaltete, sah der Arzt den Patienten neugierig an. »Ihr solltet Euch ausruhen und schonen, Messere«, meinte er dünn lächelnd und füllte die Gläser. »Zu dieser Jahreszeit spaßt man nicht mit seiner Gesundheit. Der Tod ist in der Stadt.«
Jauerling, den Teller dampfende Bouillon vor sich, sah erschrocken auf, und sein Löffel mit der kräftigen Suppe stockte, ein paar Zentimeter von seinem Mund entfernt.
»Wie meint Ihr das, Medicus?«, fragte er mit gerunzelter Stirn und lehnte sich ein wenig zurück.
Der Arzt sah ihn nachsichtig an. »Ihr seid nicht von hier, das merkt man. Wenn die eisigen Winde von den Bergen wehen, so wie heute, dann kommen die schweren Krankheiten mit ihnen, dann zieht der Tod in Turin ein. Menschen erfrieren, andere werden vom Fieber dahingerafft.« Er schien kurz nachzudenken. »Und es gibt mehr Selbstmorde als gewöhnlich.«
Jauerling glaubte, ein ironisches Lächeln um die Mundwinkel des Arztes spielen zu sehen. Der Medicus zog eine kleine rote Pille aus seiner Brusttasche, brach sie entzwei und ließ eine Hälfte in das Rotweinglas Jauerlings fallen. »Das wird Euch helfen, die Stürme zu überleben, Eure Erkältung zu kurieren und Euren Magen zu beruhigen.«
Das Misstrauen Jauerlings flammte auf wie ein Strohfeuer.
Der Arzt spürte den Zweifel und griff nach Jauerlings Glas. »Soll ich es für Ihro Gnaden leeren?«, fragte er ironisch.
»Nein, nein, es ist nur…« Jauerling schüttelte schwach den Kopf, und seine Stimme versagte fast. Dann hatte er sich wieder im Griff und nahm das Weinglas in die Hand.
Der Arzt hob sein Glas. »Salute! Auf Eure Gesundheit, den guten Ausgang Eurer Reise und ein ewiges Leben, Exzellenz«, prostete er dem Reisenden leise zu, sah dem Mann auf der anderen Seite des Tisches in die Augen und trank den Großteil des schweren Rotweins in einem Zug.
Jauerling zögerte, fühlte eine unbestimmte Gefahr. Sein Instinkt hatte ihn noch nie getrogen … Aber dann setzte er das Glas an die Lippen und tat es dem Medicus gleich. Er leerte es bis auf den Grund.
Meine Aufzeichnungen sind vollendet, dachte er dabei und warf einen flüchtigen Blick auf seine Reisetasche. Jetzt musste er sich nur noch Gewissheit verschaffen. Und den Kampf auf Leben und Tod irgendwie überstehen.
Denn eines wusste er: Gewinnen konnte er ihn nicht.
Der erste Kreis –
LASST JEDE HOFFNUNG,WENN IHR EINGETRETEN
25.5.2010
Unterretzbach, Weinviertel/Österreich
Das ist nicht dein Ernst!« Kommissar Berner legte den Kopf in den Nacken und schaute auf das kaputte Dach mit den fehlenden Schindeln, den abblätternden Verputz, die zerbrochenen Fenster und die breiten Risse in den Mauern. Sein Blick blieb schließlich an seinem Kollegen Burghardt hängen, der sich in einem schmutzigen, vor langer Zeit einmal weißen T-Shirt aus einer der Fensterhöhlen im ersten Stock lehnte und erwartungsvoll auf ihn herunterblickte.
»Und deshalb holst du mich aus Wien hierher ins Nirgendwo? Heruntergekommene Mauern hätte ich an einem attraktiveren Platz auch besichtigen können. Etwa in Italien.« Berner verzog das Gesicht und fragte sich nach einem Blick über das halbverfallene Ensemble, ob Burghardt den Verstand verloren hatte.
»Hast du dafür auch noch etwas bezahlt?«, rief Berner hinauf zu seinem Freund. »Oder kam gerechterweise ein gut gefülltes Sparbuch mit dem hochherrschaftlichen Besitz? Oder haben sie dich etwa glücklich lächelnd im Schnellverfahren in den Gemeinderat aufgenommen, nachdem sie erfahren haben, dass du dich jetzt auf den Wiederaufbau von Ruinen im Ortsgebiet spezialisiert hast?«
Der Kommissar sah sich nochmals um, betrachtete die schmalen, geduckten Nachbarhäuser, die anlehnungsbedürftig und wie in stiller Komplizenschaft Mauer an Mauer standen, und beschloss, so schnell wie möglich wieder heim nach Wien zu fahren. In seiner neuen Wohnung, die er sich seit einigen Monaten mit seinem ebenfalls pensionierten Kollegen Gerald Ruzicka teilte, wartete nach seinem Griechenland-Urlaub jede Menge unerledigter Arbeit auf ihn. Die hatte er bisher erfolgreich vor sich hergeschoben, aber alles war besser als das.
Burghardt schaute beleidigt zu ihm herunter und schwieg demonstrativ, was Berner ziemlich unbeeindruckt ließ.
»Das ist kein Lebenswerk, das ist eine gemauerte Zumutung«, brummte der Kommissar, zog seinen Mantel aus und warf ihn mit einer verzweifelten Geste auf den Rücksitz seines Wagens. Irgendein sentimentales Gefühl der Freundschaft und eine angeborene Hartnäckigkeit sagten ihm, dass er Burghardt nicht mit diesem Haufen loser Steine alleine lassen konnte. Auch wenn die Mauern des alten Presshauses nur noch vom Willen des neuen Besitzers und jahrhundertelanger Gewohnheit zusammengehalten wurden.
»Ach komm, Bernhard, so schlimm ist es doch nicht«, wagte Burghardt zögernd einen schüchternen Einwurf von seiner luftigen Position im ersten Stock herab. Berner stand mitten auf der Straße, hatte die Hände in die Hüften gestemmt und schaute vorwurfsvoll zu ihm hinauf. Genau in diesem Augenblick löste sich das Fensterbrett, auf das sich Burghardt stützte, aus seiner Verankerung und krachte mit zwei Lagen Ziegel zwei Schritte vor dem Kommissar auf die Fahrbahn. Um ein Haar hätte Burghardt die Balance verloren und wäre dem Konglomerat aus Steinen, Stroh, Lehm und Holz kopfüber in die Tiefe gefolgt.
»Danke, dass du mich jetzt auch noch umbringen willst«, rief Berner ungerührt dem blass gewordenen Burghardt zu, der sich krampfhaft an dem übrig gebliebenen Fensterstock festhielt. »An deiner Stelle würde ich Schadenersatz vom Verkäufer verlangen, aber der hat sich sicher auf einem besonders schnellen Boot nach Indonesien eingeschifft«, lästerte der Kommissar. »Ab sofort ist er nämlich auf der Flucht, mit deinem Geld und sorgenfrei.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!