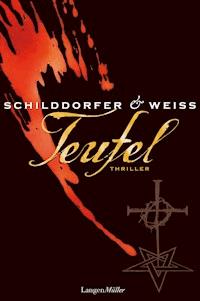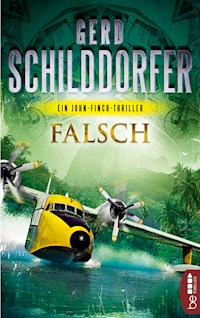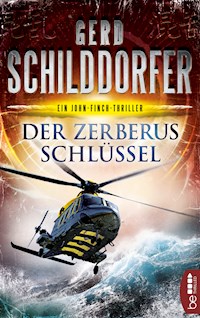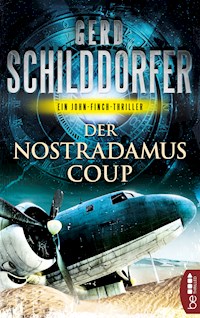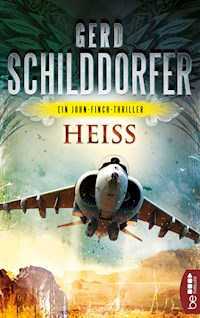
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Finch
- Sprache: Deutsch
Grausame Morde, eine gewagte Rettungsaktion und ein altes Geheimnis, das schon viele Abenteurer in den Tod gelockt hat ...
Ein alter, weiser Künstler im Hindukusch: grausam ermordet. Eine schöne Archäologin: niedergestochen in Alexandria. Ein Berliner Nachtwächter: durchgeschnittene Kehle. Die Spuren dieser Morde führen alle zu einem sagenumwobenen Grab in der Sahara, seit Jahrhunderten bewacht von tödlichen Skorpionen. Es birgt ein kostbares Geheimnis, für das schon viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Auch John Finch ist ihm auf der Spur. Und schon bald mittendrin in einer mörderischen Jagd nach dem größten Geheimnis der Antike ...
Die John-Finch-Reihe - eine explosive Mischung aus Abenteuerroman und Verschwörungsthriller:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel des Autors
Die John-Finch-Reihe:
Band 1: Falsch
Band 2: Heiß
Band 3: Der Nostradamus-Coup
Band 4: Der Zerberus-Schlüssel
Über dieses Buch
Grausame Morde, eine gewagte Rettungsaktion und ein altes Geheimnis, das schon viele Abenteurer in den Tod gelockt hat …
Ein alter, weiser Künstler im Hindukusch: grausam ermordet. Eine schöne Archäologin: niedergestochen in Alexandria. Ein Berliner Nachtwächter: durchgeschnittene Kehle. Die Spuren dieser Morde führen alle zu einem sagenumwobenen Grab in der Sahara, seit Jahrhunderten bewacht von tödlichen Skorpionen. Es birgt ein kostbares Geheimnis, für das schon viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Auch John Finch ist ihm auf der Spur. Und schon bald mittendrin in einer mörderischen Jagd nach dem größten Geheimnis der Antike …
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Gerd Schilddorfer wurde 1953 in Wien geboren. Als Journalist arbeitete er bei der Austria Presse Agentur und danach als Chefreporter für verschiedene TV-Dokumentationsreihen (Österreich I, Österreich II, Die Welt und wir). In den letzten Jahren hat er zahlreiche Thriller und Sachbücher veröffentlicht. Gerd Schilddorfer lebt und arbeitet in Wien und Stralsund, wenn er nicht gerade auf Reisen für sein neues Buch ist.
Gerd Schilddorfer
HEISS
Ein John-Finch-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2013 by Gerd Schilddorfer
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © Javietc/shutterstock.com; © Atlaspix/shutterstock.com; © Alexxxey/shutterstock.com; © Andrew Repp/shutterstock.com; © intueri/shutterstock.com; © Max Meinzold
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-1762-5
be-ebooks.de
lesejury.de
Sail away, sail away,three sheets to the wind
Live hard, die hard,
This one’s for him.
Kenny Chesney, Hemingway’s Whiskey
Es ist Winter,
geh nicht in die Berge,
steig nicht hinauf,
wo die Feen Dich holen werden.
Volkslied der Kalash
Die Hölle ist leer,
alle Teufel sind hier.
William Shakespeare
PROLOG
9. November 1965
ADRAR-PLATEAU / MAURETANIEN
Sand und Geröll rutschten nach, mit der Unerbittlichkeit einer Dampfwalze und dem Geräusch einer zornigen Kobra. Die ganze Welt schien erfüllt von einem Zischen und Rumpeln, das immer lauter wurde. Es hörte sich an, als wäre der halbe Berg in Bewegung.
Mit dem Gewicht der Steine kam der Tod, die tonnenschweren Blöcke verschoben sich wie die Bauklötze eines Kinderspiels. Die Falle war genial und tödlich zugleich. Selbst nach Hunderten von Jahren war sie noch immer so gefährlich wie am ersten Tag.
Nur diesmal schnappte sie zu.
Ali Ben Assaid, der sich gerade durch den schmalen Zugang in die große Höhle retten wollte, riss instinktiv den Kopf zurück, als er ein knirschendes Geräusch hörte.
Keine Sekunde zu früh.
Über ihm löste sich ein Steinquader, schien einen Augenblick zu zögern und fiel schließlich, dem Gesetz der Schwerkraft und dem brillanten Plan der Erbauer folgend, mit einem ohrenbetäubenden Knall an seinen vorbestimmten Platz. Damit war der erste der Eingänge verschlossen und die große Fackel unter dem riesigen Block zerquetscht und ausgelöscht. Mit einem Schlag war es stockdunkel bis auf das fahle Licht seiner Stirnlampe.
Assaid fluchte laut und lief tiefer in den unterirdischen Komplex hinein. Doch er hatte sich die Position der anderen Zugänge nicht gemerkt und wusste, dass es eine sinnlose Reaktion war. Einfach nur das simple Bestreben, irgendetwas zu tun und nicht tatenlos dazustehen und zu warten, bis er lebendig begraben wurde.
Was hatte er bloß übersehen?
Und wo waren die Aufzeichnungen, die Kisten, die Reichtümer eines Königs, von denen das Dokument berichtet hatte?
Von allen Seiten drangen die gleichen Geräusche in die runde, unterirdische Kammer. Es war, als würden nacheinander Dutzende Türen zugeworfen. Als verschränkten sich zwei überdimensionale Muschelhälften nahtlos ineinander, knirschend, endgültig. Gänge wurden blockiert, Räume des weitläufigen unterirdischen Komplexes verschlossen.
Wo war der Auslöser gewesen, den er unbewusst betätigt hatte?
Was um Allah willen hatte die Falle zum Zuschnappen gebracht?
Und wie hatten es alle anderen vermieden, hier lebendig begraben zu werden?
In seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken. Während er rannte und versuchte, nicht über herabstürzende Steinbrocken zu stolpern oder von ihnen erschlagen zu werden, überlegte Assaid fieberhaft, was er falsch gemacht hatte. Mit einem Mal jedoch stutzte er, blieb stehen und legte den Kopf schief, um besser zu hören.
Die riesige Kammer, die wie eine flache Trommel geformt war, stöhnte unter dem Ansturm der Geröllmassen. Ein lautes, unheimliches Geräusch, das dem Ägypter alle Haare zu Berge stehen ließ. Selbst die sieben monumentalen Steinfiguren, die in einem weiten Kreis um das Zentrum der Kammer standen, wankten im irrlichternden Kegel seiner Lampe.
»Was zum Teufel …«, murmelte der schlanke, junge Mann mit dem dichten Schnurrbart und den stechenden Augen verzweifelt, als er den feinen Schotter durch unzählige quadratische Löcher wie unaufhaltsame Wasserstrahlen herabschießen sah. Auch das Zischen war wieder zu hören, lauter denn je. Mit erschreckender Schnelligkeit begann sich der runde Raum mit Geröll zu füllen.
Assaid quetschte sich zwischen den Figuren der Wächter durch, hörte den Stoff seines Hemdes reißen und spürte einen stechenden Schmerz an seiner Schulter. Im fahlen Lichtschein seiner Lampe sah er den Sarkophag, gläsern und unberührt. Er war bis zum Rand gefüllt mit einer gelblichen, dickflüssigen Substanz, in der ein einbalsamierter Körper wie eine Mücke in Bernstein schwebte.
An den langen Seiten des reich mit Figuren und Blumenornamenten verzierten Steinsockels, auf der das Wunderwerk stand, führten Treppen ins Dunkel. Wenigstens waren im Notfall nicht alle Wege versperrt, hatte Assaid gedacht, als er sie das erste Mal erblickt hatte. Nun schickte er ein inbrünstiges Stoßgebet zu Allah. Die beiden Gänge waren sein letzter Ausweg, und er hasste die Endgültigkeit letzter Optionen.
Und er hasste Skorpione.
Bevor er die schmale Treppe betrat, sah der Ägypter genauer hin, und die Stirnlampe folgte seinem Blick. Die Stufen schienen sich zu bewegen, eine schwarze Masse, die hin und her wogte. Tausende von schwarzen Skorpionen bewachten dicht gedrängt den Eingang in die Unterwelt. Hatte die Seele des Toten im Glassarg diesen Pfad vor ihm genommen, vor Tausenden von Jahren?
Assaids Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Das Zischen und Rumpeln erfüllte die Luft wie eine massive Wand aus Schall. Panik schüttelte seinen Körper, seine Hände zitterten unkontrolliert.
Bald wird die Kobra der Berge zustoßen, fuhr es dem schmächtigen Mann durch den Kopf, und ich werde sterben. Allein, begraben in einem Berg, inmitten einer Landschaft, die wie aus einer anderen Welt schien. Schroff, wasserlos, rotbraune Erde ohne jede Vegetation.
Ein Berg inmitten von Hunderten anderen Bergen, die alle gleich aussahen.
Unauffindbar, für immer verschollen in der Steinwüste, wie William »Bill« Lancaster und so viele andere namenlose Piloten, Karawanen oder Patrouillenreiter.
Mit den Tonnen von glühend heißem Stein kam die Hitze in die riesige runde Gruft, ein Zeichen dafür, dass loser Oberflächenschotter nachrutschte.
Assaid brach der Schweiß aus. Unwillkürlich hielt er sich am Sarkophag fest, als er in den dunklen Abgang hinunterblickte, seine Überlebenschancen abwog.
Erschrocken riss er die Hand wieder zurück.
Das Glas war kalt, eiskalt.
Verwirrt sah Assaid zuerst auf seine Handfläche und dann auf das kunstvolle Gebilde aus Glas. Erneut legte er seine Hand auf den Sarkophag und hatte das Gefühl, einen tiefgekühlten Quader zu berühren. Das ist unmöglich, sagte ihm sein Gehirn, aber es blieb ihm keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Kleine Ströme von Sand schlängelten sich zwischen den Sockeln der Figuren hindurch, wurden schnell breiter und höher, bewegten sich auf die letzte Ruhestätte des geheimnisvollen Unbekannten zu.
Dann kamen die größeren Steine …
Was, wenn die beiden Abgänge nur zu einem kleinen Kultraum unter dem Sarkophag führten? Der junge Mann wagte es nicht, daran zu denken. Er verfluchte seine Besessenheit, die ihn beharrlich bis in die Mauretanische Wüste geführt hatte.
Und direkt in den Tod.
Rasch ergriff er eine der Fackeln, die er noch an seinem Gürtel hängen hatte, und entzündete sie. Ihre rußende Flamme loderte hell auf, und der Sarkophag schien in dem flackernden Licht zu leuchten. Assaid sah genauer hin, und der Atem stockte ihm. Fremdartige Zeichen erschienen im Glas, wie von Geisterhand gezeichnet. Es war, als schwebten sie rund um die einbalsamierte Leiche, eine magische Barriere aus unbekannten Buchstaben und Symbolen, dazu bestimmt, den Toten zu beschützen.
Und alle zu verfluchen, die ihm zu nahe kamen.
Der junge Ägypter riss seinen Blick von dem mysteriösen Körper los und leuchtete in den linken Abgang. Die Stufen der engen Treppe verloren sich in der Dunkelheit, die Luft roch schal und abgestanden. Farbige Malereien in Ocker und Königsblau bedeckten die Wände des Ganges.
Die Skorpione schienen das flackernde Licht der Fackel nicht zu mögen. Sie versuchten der Flamme zu entkommen, wichen zurück, kletterten aufeinander, stapelten sich schließlich an der Wand übereinander. Sie wurden aggressiver, richteten die Stacheln auf, doch die lebendige schwarze Masse wusste nicht, wohin sie ausweichen sollte.
Einzelne Tiere zogen sich zurück, krabbelten über die Stufen weiter hinunter in die Tiefe, aufgescheucht und angriffslustig, aber ihr Instinkt schien sie vor der Steinflut zu warnen.
Die ersten Sandströme erreichten die beiden Abgänge links und rechts des Sarkophags, und dünne Fäden rieselten über die obersten Treppenstufen. Das scheuchte die Skorpione noch mehr auf. Ahnten sie das drohende Unheil?
Assaid leckte sich über seine trockenen, aufgesprungenen Lippen. Es blieb ihm nicht mehr viel Zeit für Entscheidungen. Oder besser gesagt, er hatte keine Wahl: Der Tod war hinter ihm, neben ihm und vor ihm. Assaid kam das Bild einer Sanduhr in den Sinn, aber er konnte nicht einmal mehr darüber lächeln.
Die Skorpione wichen ihm aus, als er sich hinabbeugte, den Kopf einzog und – die Fackel vor sich erhoben – die erste Stufe betrat. Das unentwegte Zischen des hereinströmenden Gerölls in seinem Rücken trieb ihn zur Eile an.
Wie hatte sein Freund John Finch, der blutjunge Pilot aus Peterborough, zu ihm gesagt, als er erfahren hatte, dass Assaid in die westliche Sahara reisen wollte? »Lass es bleiben. Die Wüste ist ein Ort ohne Erwartungen.« Da hatten sie an der klimatisierten Bar des Hotels Continental-Savoy in Kairo gesessen, vor drei Wochen.
Assaid kam es vor wie eine Ewigkeit.
Jetzt verwünschte er sich dafür, dass er Finch nichts von Chinguetti verraten hatte, von dem Dokument und von allem anderen. War seine Vorsicht nicht fast krankhaft gewesen? Eine übertriebene Geheimniskrämerei angesichts der unglaublichen Entdeckung, die der Zufall ihm in die Hand gespielt hatte? Oder hatte er im Grunde seines Herzens die wirre Erzählung des alten Mannes, der ihn in die Bibliothek geschickt hatte, doch nicht recht geglaubt? Wie sollte man auch eine Fata Morgana, das Ergebnis einer überhitzten Fantasie, rational erklären?
Nach anfänglichen Zweifeln hatte bei Assaid die Neugier gesiegt, und er war der vorgezeichneten Spur gefolgt. Oder war es die Gier gewesen, die ihn getrieben hatte? Alles war eigentlich ganz einfach gewesen.
Zu einfach, wie sich jetzt herausstellte.
Der Geschichtenerzähler auf dem Marktplatz der alten Karawanenstadt Atar, eine zusammengesunkene Figur in einem fleckigen hellblauen Burnus, hatte es gewusst. Er hatte ihm tief in die Augen gesehen, als Assaid vor zwei Tagen am Ende seiner Erzählung aufgestanden war und sich bedankt hatte. Es war ihm vorgekommen, als könne der unrasierte Alte mit dem stechenden Blick bis tief in seine Seele schauen, als er den Zeigefinger gehoben und nur gemeint hatte: »Le sable mange tout!«
Dass der Sand alles auffrisst, das bekam Assaid nun am eigenen Leib zu spüren. Der Alte hatte seine Zukunft gesehen – und sein Ende.
Doch noch war es nicht so weit, und er stieg weiter in die Tiefe. Der erste Skorpion zerplatzte unter den Sohlen seiner Stiefel mit einem ekligen Geräusch, dann der nächste. Der Ägypter stolperte nach unten. Wie in einem Kaleidoskop zogen an den Wänden links und rechts von ihm seltsame Malereien vorbei, eine Abfolge von Wandbildern, über deren Alter und Entstehung der Abenteurer nur spekulieren konnte. Sie sahen völlig anders aus als die Höhlenmalereien im Tassili n’Ajjer im Herzen der Sahara, die er im letzten Jahr besucht hatte. Diese hier stammten definitiv aus einer anderen Epoche.
Bei jedem Schritt tiefer in den Fels hinein änderte sich auch der Stil der Malereien, bis sie schließlich ganz aufhörten. Die Steinstufen waren einem ungleichmäßigen Boden aus Fels, Sand und Steinen gewichen, der sanft, aber stetig bergab führte. Der Tunnel, dem Assaid nun gebückt folgte, war niedrig und schmal. Stellenweise schien er von Menschenhand geschaffen, aus dem rohen Fels geschlagen, dann wieder führte er streckenweise durch höhlenartige, unregelmäßige Hohlräume, wand sich durch den Untergrund wie ein ausgetrockneter Bachlauf.
Und dann war er mit einem Mal zu Ende.
Assaid stand keuchend vor einem rötlichen Felsen, der die gesamte Breite des Ganges einnahm.
Kein Weg führte daran vorbei.
Der schmale Tunnel endete in einer Sackgasse. Frustriert schlug der junge Ägypter mit der Faust gegen den Stein, drehte sich um und eilte zurück. Hatte er den falschen Abgang gewählt? War der Weg auf der rechten Seite des Sarkophags der ›rechte Weg‹ und der andere führte Grabräuber und unerwünschte Eindringlinge ins Verderben? Gab es eine Abzweigung, die er übersehen hatte?
Assaid fluchte, während er die Flamme der kleinen geteerten Fackel in seiner Hand beobachtete, die immer schwächer wurde. Er hastete zurück. Kein einziger Gang zweigte ab, da war nichts als massiver Fels. Dann kam er zurück zu den Wandbildern, die Malereien schienen im flackernden Licht zum Leben zu erwachen. Primitiv gemalte Kühe grasten, Giraffen hatten ihre Köpfe in Bäumen, Menschen mit runden Köpfen ritten auf Kamelen. Dann erkannte Assaid die ersten Übermalungen. Seltsame Kopfbedeckungen … Er wandte sich ab und hastete weiter. Die Stufen mussten bald beginnen.
Doch an die Stelle der massiven, in den Stein geschlagenen Stufen war eine schräge Wand aus Sand und Schotter getreten, der unaufhörlich nachrieselte.
Dann erlosch die Fackel, und Assaid schaltete mit fiebrig-tastenden Fingern die Stirnlampe ein. Im gelben matten Licht der kleinen Glühbirne sah er, wie sich überall Skorpione aus dem Sand hervorwühlten.
Es war, als schien sie der Sand auszuspeien. In Strömen bewegten sie sich langsam auf ihn zu, ein schwarzer Teppich aus dünnen Beinen und kampfbereit erhobenen Stacheln.
Assaid drehte sich um und rannte los.
Zwei Stunden später waren die Batterien seiner Stirnlampe leer, und das letzte Licht erlosch. Undurchdringliche Schwärze umgab ihn. Es war totenstill, selbst das Zischen des rieselnden Sandes war verklungen. Nur noch die Leuchtziffern seiner Armbanduhr waren Assaid geblieben. Am Ende des Ganges, am Fuße des schwarzen Felsens zusammengekauert, wartete er auf die Ankunft der Skorpione.
Er würde sie nicht sehen können, aber vielleicht hören.
Dann würde alles sehr schnell gehen.
Kapitel 1DIE SCHATTEN DER VERGANGENHEIT
Ostermontag 2011
AEG-TURBINENFABRIK, BERLIN-MOABIT / DEUTSCHLAND
Die Huttenstraße in Berlin-Moabit war wie ausgestorben. Der Abend war hereingebrochen, und der kühle Nordwind hatte nach einigen fast schon sommerlichen Tagen die Terrassen der Cafés und Bars wieder geleert. Dunkle Wolken, aus denen von Zeit zu Zeit ein wenig Regen fiel, zogen über die Hauptstadt.
»Bleib aufrecht, ich bin dann mal weg!«, winkte einer der beiden Portiers der Sicherheitsmannschaft seinem Kollegen zu, bevor er die schwere Glastür hinter sich zuzog und sich auf den Heimweg machte. Das Siemenswerk lag dunkel und verlassen da. Der Ostermontag war einer der wenigen Tage im Jahr, an denen in dem Werk und der Turbinenhalle daneben nicht gearbeitet wurde. 1909 von der AEG erbaut, war sie ein Denkmal des Fortschritts und der Größe des Unternehmens nach der Jahrhundertwende. Im Zweiten Weltkrieg war sie trotz zahlreicher Bombenangriffe auf Berlin nicht zerstört worden und existierte mehr als hundert Jahre später nach wie vor – eines der wenigen Industriebauwerke, die noch immer ihre ursprüngliche Bestimmung erfüllten. Siemens montierte nach wie vor Turbinen in der historischen Halle, nun allerdings moderne Gasturbinen.
Der schlanke Mittfünfziger in seinem hellblauen Hemd und einer dunkelblauen Hose packte seine Tasche auf den Gepäckträger des Fahrrads und schielte misstrauisch zum Himmel. Dann zog er nach einigem Überlegen seufzend doch eine Plastikpelerine hervor, streifte sie über und schwang sich aufs Rad.
Nachdem er die ersten Meter auf dem Gehsteig gefahren war, schwenkte er nach links und zögerte kurz. Kein Fußgänger war zu sehen, und auf der Fahrbahn der Berlichingenstraße war ebenfalls kein Verkehr. So schlängelte er sich zwischen den schräg geparkten Wagen durch und trat in die Pedale. Auf der Straße würde er schneller vorankommen. Bis nach Hause waren es immerhin 35 Minuten, und er wollte einen guten Teil der Strecke zurückgelegt haben, bevor es anfing zu regnen.
Der dunkle Golf, der aus der Parklücke herausschoss, traf ihn völlig überraschend. Er versuchte im letzten Moment auszuweichen, aber es gelang ihm nicht. Ein stechender Schmerz durchzuckte sein linkes Bein, dann wurde er nach rechts abgedrängt, prallte erneut gegen den VW und hörte Glas und Knochen brechen, bevor er auf das Pflaster stürzte.
Die beiden Männer, die aus dem Golf sprangen, trugen schwarze Tarnanzüge und sprachen kein Wort. Während der eine sich umsah und zufrieden feststellte, dass kein Mensch zu sehen war, beugte sich der andere zu dem Verletzten hinunter, der leise stöhnte, sein Bein hielt und gleichzeitig versuchte, sich unter dem verbeulten Rad herauszuwinden.
Doch der Mann wollte dem Gestürzten nicht helfen. Blitzschnell zog er ein Messer aus der Tasche und schnitt dem Radfahrer mit einer geübten Handbewegung die Kehle durch. Als ein Schwall Blut auf das Straßenpflaster spritzte, trat er seelenruhig zwei Schritte zurück und wartete einen Augenblick. Dann riss er die Tasche vom Gepäckträger, öffnete sie, schaute hinein, suchte ein wenig und nickte schließlich befriedigt.
Ohne sich umzublicken, zog er die Tür des Golfs auf, schleppte den Toten bis zum Wagen, hievte ihn auf den Beifahrersitz und deckte ihn mit einer vorbereiteten Decke zu. Danach löste der andere Mann die Handbremse und ließ den dunklen Wagen wieder lautlos in die Parklücke zurückrollen. Aus dem Kofferraum holte er schließlich ihre Ausrüstung, schloss die Türen des Wagens ab und warf die Schlüssel des gestohlenen Golfs durch das nächste Kanalgitter. Dem heftigen Rauschen nach zu urteilen, würde es nur wenige Minuten dauern, bis sie in die Spree gespült würden und auf Nimmerwiedersehen verschwanden.
Die Berlichingenstraße war noch immer ruhig und menschenleer, niemand hatte den Vorfall bemerkt.
Nur wenige Minuten später standen die Männer im toten Winkel des Eingangs zur Siemens AG und warteten, unsichtbar im Schatten der hohen Bäume. Es dauerte nicht lange, und ein Jogger bog pfeifend um die Ecke der Turbinenhalle, seinen Walkman im Ohr. Er lief an den beiden Männern vorbei und bog dann unvermittelt zur Pförtnerloge ab. Vor der schusssicheren Scheibe mit dem kleinen, runden Klappfenster blieb er stehen. Der Nachtwächter, ein untersetzter dunkelhaariger Mann mit Dreitagebart, sah ihn fragend an. Im Hintergrund dudelte Radio Paradiso.
»Guten Abend!«, sagte der Jogger freundlich, »ich habe die wunderschöne alte Turbinenhalle aus AEG-Zeiten bewundert und wollte Sie fragen, ob es darüber irgendwelche Informationen gibt. Ich bin Fotograf und würde gerne im Inneren Bilder machen, wenn das möglich ist.«
Der Pförtner lächelte kurz und öffnete das kleine Fenster. »Ja, warten Sie, wir haben ein kleines Merkblatt über den Bau und den Architekten. Ich muss es nur finden!«
Er stand auf, ging zu einem Wandschrank und begann zu suchen.
Der Jogger winkte den beiden Männern zu, die blitzschnell herbeieilten, sich bückten und unterhalb des Fensters am Empfang vorbeihuschten. Der eine stellte sich vor eine Glastür mit der Aufschrift »Für Unbefugte Zutritt verboten«, wo ihn der Pförtner nicht sehen konnte, während der andere in die Hocke ging, einen kleinen Zylinder aus seiner Tasche zog und einen dünnen Schlauch unter der Tür durchführte. Dann nickte er dem Jogger zu und öffnete das Ventil.
»Sie müssen wissen, ich interessiere mich seit Jahren für Industriearchitektur, und diese Halle ist einfach unglaublich gut erhalten«, rief der Jogger dem Pförtner zu, der noch immer nach dem Prospekt suchte. »Läuft eigentlich die Produktion noch immer in den alten Mauern, oder ist es nur noch eine leere Hülle?«
Der Nachtwächter, der inzwischen die untersten Fächer des Wandschranks erreicht hatte, richtete sich mit triumphierender Miene wieder auf. »Ich wusste ja, wir haben da etwas …« meinte er, hielt eine dünne Broschüre in die Höhe, kam zu der großen Glasscheibe zurück und reichte sie durch die Öffnung. »Da steht alles drin, was Sie interessiert. Die Halle ist ein Industriedenkmal ersten Ranges in einer Stadt, die nach den Bomben des Krieges nicht mehr so viele davon hat. Ich glaube allerdings nicht, dass Sie drinnen fotografieren können, die Produktion läuft noch immer, und ich bin sicher, die Geschäftsleitung hätte etwas dagegen.« Er lächelte entschuldigend und zuckte die Achseln.
»Trotzdem vielen Dank!«, rief ihm der Jogger zu und winkte kurz. Dann lief er weiter und verschwand in der Dunkelheit.
Das Betäubungsgas wirkte Minuten später. Der Wachmann gähnte und lehnte sich in seinem Sessel zurück, schließlich fiel sein Kopf schwer auf die Brust.
Einer der Schlüssel vom Bund seines toten Kollegen öffnete die massive Glastür, und die beiden Männer in den schwarzen Tarnanzügen betraten den kleinen Raum. An einer der Wände hing ein Dutzend Monitore, die zwischen den Bildern der Überwachungskameras auf dem Siemens-Gelände hin und her schalteten. Die Männer beachteten den Bewusstlosen nicht, sondern wandten sich der Elektronik zu und blickten nicht einmal auf, als der Jogger wieder zurückkehrte und wortlos seinen Sportanzug abstreifte. Darunter trug er ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Hose. Er hievte den Wachmann aus seinem Sessel, zog ihn außer Sichtweite und ließ sich auf den Stuhl fallen. Dann begann er das Kreuzworträtselheft zu studieren, das unter der Leselampe lag.
»Die Verbindung zu den Kameras in der Halle ist unterbrochen«, murmelte einer der beiden Männer in Schwarz, bevor er mit seinem Kollegen aus dem Raum lief und über den Hof rannte. Wenige Minuten später standen die beiden vor einem hohen Tor, das elektronisch gesichert war. Einer der beiden zog einen kleinen Zettel aus seiner Tasche, las den Code ab und tippte ihn ein. Mit einem leisen Klicken sprang die Tür auf, und die Männer betraten die riesige, mehr als zweihundert Meter lange Halle, deren Metallkonstruktion mit ihren grün gestrichenen Nieten und Trägern an ein Bahnhofsgebäude erinnerte. Durch die meterhohen Fenster zur Berlichingenstraße hin fiel das Licht der Straßenbeleuchtung herein.
Die beiden Männer orientierten sich kurz, dann liefen sie los, zählten die Pfeiler. Bei der siebten Metallstrebe hielten sie an und zogen zwei kleine Leuchtdioden-Lampen aus einer Tasche ihres Tarnanzugs.
»Die siebte Niete von unten«, murmelte einer von ihnen.
»Da sind Doppelnieten, jeweils ein Paar. Welche?«
»Wohl kaum die rechte«, antwortete sein Partner mit einem ironischen Unterton. »Beginnen wir also mit der linken.« Dann zog er ein scharfes Stemmeisen und einen Hammer aus seiner Sporttasche, setzte das Eisen an und schlug zu. Mit einem singenden Ton prallte die Klinge ab.
Der Nietenkopf hatte sich keinen Millimeter bewegt.
»Falsch geraten, also doch die andere«, meinte der Kleinere der beiden und trat zur Seite. Der nächste Schlag traf die rechte Niete und sprengte den Kopf ab. Dahinter kam ein Hohlraum zum Vorschein, der einen Durchmesser von etwa drei Zentimetern hatte. Der kleinere Mann leuchtete hinein und zog dann eine große Pinzette aus seiner Brusttasche, mit der er zupackte. Ein dünner, aber langer Zylinder kam zum Vorschein, der mattsilbern im Licht der Straßenlaternen glänzte. Wortlos steckte der Mann ihn ein. Dann suchte er kurz nach dem abgesprengten Nietenkopf, während sein Partner eine kleine Tube Klebstoff aus der Tasche zog und die dickflüssige, durchsichtige Paste dünn um den Rand des Lochs verteilte.
Als der Kopf wieder an seinem Platz war, blickten die Männer auf ihre Armbanduhren und warteten. Genau eine Minute später zog der Größere der beiden einen kleinen Tiegel mit Farbe und einen Pinsel aus seiner Tasche. Geschickt übermalte er die Spuren des Meißels. Niemand würde bei Arbeitsbeginn etwas bemerken, selbst aus nächster Nähe nicht.
Nachdem sie die Tür der Halle wieder sorgsam verschlossen hatten, liefen sie zurück zum Eingang.
»Setzt den Portier zurück auf seinen Sessel, die Kameras habe ich wieder eingeschaltet. Sollte jemand etwas bemerken, dann werden alle an einen kurzen Ausfall glauben«, forderte der Jogger sie auf und streckte sich. »Ich laufe dann weiter.«
Als der Nachtwächter wenige Minuten später wieder zu sich kam, blickte er verwundert auf und schüttelte den Kopf. Er runzelte die Stirn, stand auf, kontrollierte die Glastür, die fest versperrt war, warf einen Blick auf die Elektronik, die mit regelmäßig flackernden grünen Leuchtdioden ihre fehlerfreie Funktion meldete, kontrollierte die Bilder auf den Monitoren und zuckte schließlich die Schultern.
Es war ihm schon lange nicht mehr passiert, dass er im Dienst eingeschlafen war.
Zum Glück war niemand da, der ihn beobachtet haben könnte. Peinlich, peinlich, dachte er sich und beschloss, niemandem davon zu erzählen. Der Job hier war viel zu gut bezahlt, um ihn aufs Spiel zu setzen.
Kopfschüttelnd wandte er sich wieder seinem Kreuzworträtselheft zu, das er vom Frühdienst übernommen hatte. Eines der Silbenrätsel auf der Seite war bereits gelöst. In großen Blockbuchstaben stand da ein Aphorismus: »Misstrauen kommt nie zu früh, aber oft zu spät.«
»BABYLON CAFÉ«, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RIO NEGRO / BRASILIEN
John Finch war betrunken.
Böse Zungen hätten behauptet, sternhagelvoll. Oder zumindest so gut wie.
Noch war er klar genug im Kopf, um feststellen zu können, dass außer ihm noch jemand aus der Flasche Laphroaig Islay Quarter Cask Whisky getrunken haben musste.
Aus der einen Flasche? Oder auch die anderen drei Flaschen, die nun leer vor ihm standen?
Drei Flaschen?
Er kratzte sich stirnrunzelnd am Kopf. Allein konnte er unmöglich drei Flaschen an einem Abend geleert haben. Vor dreißig Jahren vielleicht, ja, aber nicht heute. Selbst nicht zur Feier seines Abschieds vom Arsch der Welt, und das war São Gabriel nun einmal. Am Ufer des Rio Negro gelegen, rund achthundert Kilometer stromaufwärts von Manaus, war der kleine Ort für mehr als vier Jahre John Finchs Heimat gewesen. Der Pilot hatte mit seiner Albatross, dem legendär robusten Wasserflugzeug, die unmöglichsten Aufträge geflogen und versucht, vom Ersparten und den mageren Einnahmen zu überleben. Er hatte Abenteurer in den Urwald gebracht, Arbeiter und Manager zu den Bauxitminen, Angler zu den Fischgründen der Nebenarme des Rio Negro. Bis zu dem Tag, an dem jemand sein Flugzeug in kleine Stücke gesprengt hatte, mitsamt den Passagieren. Das lag nun fast ein halbes Jahr zurück. Aber das war eine andere Geschichte … ein Auftrag, bei dem gleich von Anfang an alles schiefgegangen war und den er nur mit knapper Not überlebt hatte.
John Finch spürte immer noch den Zorn in sich hochsteigen, wenn er an das Bild der Leichen und der völlig zerstörten Albatross dachte.
»Roberto, du verschlafener Fuselverwalter«, Finch winkte den Barkeeper zu sich, »wie viele Löcher hast du in meine Whisky-Flaschen gebohrt, während ich nicht hingeschaut habe?«
Der Barkeeper wischte weiterhin seelenruhig mit einem speckigen Lappen die Gläser ab, während er John Finch mit einem nachsichtigen, ein wenig herablassenden Ausdruck anschaute.
»Du solltest wissen, wann du Lokalrunden wirfst, alter Mann«, erwiderte Roberto ungerührt und sah sich in dem fast leeren Lokal um. »Selbst an schlechten Tagen hängt hier zumindest ein Dutzend Kampftrinker herum, die sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich endlich einmal anständiges Zeug hinter die Binde zu kippen.«
John Finch nickte langsam. Das erklärte die drei leeren Flaschen.
Wenn er seinen Kopf bewegte, kippte die Bar nach rechts wie in einer scharf geflogenen Linkskurve. Er erinnerte sich mit einem Mal an die Tage im Hotel Continental-Savoy, damals, in den sechziger Jahren in Kairo, als er die Suite 101 gleich für einen ganzen Monat gemietet hatte. Ein Jahr später war er noch immer da gewesen, in derselben Suite, ganze neunzehn Jahre alt und hungrig nach Abenteuern. Damals war er für alle geflogen, Hauptsache er blieb nie zu lange am Boden. Die Erinnerung an die heißen, endlosen Nächte, bei Sakkara Bier und Whisky, in Gesellschaft reicher Engländer, vorsichtiger Deutscher und zwielichtiger Mädchen, denen die Gier aus den Augen leuchtete, begleitete ihn noch heute, im Dschungel des Amazonas.
Nein, es war höchste Zeit zu gehen, zurück nach Nordafrika.
Wäre nicht das »Baby« gewesen, er hätte seine Zelte schon vor Monaten abgebrochen und wäre verschwunden. Aber so … Das Babylon Café war eine der letzten Spelunken alten Zuschnitts zwischen Valparaíso und Beirut, die alle Fährnisse der Zeit überlebt hatten. In den zwanziger Jahren nach dem Vorbild der Oper in Manaus erbaut und nach vielen Jahrzehnten ein verstaubtes, heruntergekommenes Theater, war das Babylon in den fünfziger Jahren nach und nach in eine einzige Bar umgewandelt worden – erst einer der beiden Pausenräume, dann das gesamte Parkett und schließlich das komplette Haus.
Das »Baby«, wie es bei den Eingeweihten und Stammgästen hieß, war zu einem schäbigen Etablissement verkommen, das sich an seine besten Zeiten nicht mehr erinnern konnte. Schon als Theater war es zu groß für São Gabriel gewesen, als Bar war es das nach wie vor. Das Babylon litt unter dem Einwohnerschwund entlang des Rio Negro wie alle anderen Geschäfte. Es erinnerte an einen halb toten, hungrigen Kraken, der mit letzter Kraft und sicherem Griff stets neue Opfer an die längste Bar des Rio Negro holte.
Die Glücksritter waren schon lange weg, nur die zerstörten Illusionen waren hiergeblieben, verlangten nach einem Tribut aus billigem Fusel. Und der floss im Haus am Rio Negro in Strömen.
Theater wurde im Babylon schon lange nicht mehr gespielt. Die Logen waren verwaist, und die roten Samttapeten verrotteten in der feuchten Luft des Amazonasgebiets. Einige Plakate der letzten Aufführungen, fleckig und verblasst, waren als Reminiszenz an alte Zeiten hängen geblieben. Die meisten der einst komfortabel gepolsterten Sitze waren vor langer Zeit an Tischen aufgereiht worden, in den ehemaligen Garderoben der Sänger und Schauspieler hatten sich Huren eingemietet, die für wenige Real ihre Dienste auf den durchgelegenen Matratzen feilboten. Meist standen sie, nur leicht bekleidet, in den schmalen Gängen herum, warteten auf Kundschaft und nippten an Cocktails.
Seltsamerweise hatten alle Besitzer des »Babylon« die Bühne unangetastet gelassen. Man munkelte, dass die Kulissen von 1943, dem Jahr der letzten Aufführung, noch immer hoch unter der Decke hingen. Gesehen hatte sie niemand. Nur ein völlig Verrückter hätte es gewagt, den komplizierten Mechanismus der Laufrollen und Hebewerke in Gang zu setzen und dabei Gefahr zu laufen, von dem schweren, rostigen Gestänge erschlagen zu werden.
Über die gesamte Breite des Parketts, wo sich einst der Orchestergraben erstreckt hatte, stand nun die Bar. Riesig, überdimensioniert und respekteinflößend, war es ein Ungetüm aus Holz, das sich wie eine satte Schlange durch den Raum wand. Darüber, stets in Zigarettenrauch gehüllt, baumelten die Lampen mit den grünen Glasschirmen an ihren meterlangen Kabeln und standen nie still. Sie schwangen stets leicht im Luftzug, und die gelben Lichtinseln wanderten in ihrem ganz eigenen Rhythmus über die zerkratzte Platte aus schwarzem Marmor, der angeblich aus Italien mit dem Schiff bis zur Amazonas-Mündung und dann den Rio Negro hinauftransportiert worden war.
John Finch registrierte dankbar, dass Roberto den letzten Rest Whisky in sein Glas kippte. Dann drehte er das Glas in seiner Hand, um den Laphroaig anzuwärmen. Er saß an seinem Stammplatz, ganz am linken Ende der Bar. Mitternacht war lang vorbei, es war spät geworden, oder besser gesagt früh, und das Babylon hatte sich geleert bis auf ein paar Unverdrossene, die nicht mehr nach Hause gehen wollten oder konnten.
Auf der halbdunklen Bühne, von einem einzelnen Scheinwerfer in ein mystisches Zwielicht getaucht, quälte ein Mann in schwarzen Hosen und weißem Hemd eine Ziehharmonika. Weil sich niemand beschwerte, machte er unbeirrbar weiter.
»Es ist also wahr? Du gehst zurück nach Afrika?«, erkundigte sich Roberto müde. »Wir werden dir fehlen.«
»Träum weiter«, gab Finch grinsend zurück, »es gibt Dinge, denen weint man nicht nach. Die versucht man, so schnell wie möglich zu vergessen.«
»Red dir den Abschied nur schön«, gab der Barkeeper zurück und nahm ein weiteres Glas in Angriff, dem er hingebungsvoll Schlieren verpasste. »Eine Bar wie das Baby wirst du in der Wüste bei den Wilden nicht finden.«
»Zum Glück«, erwiderte Finch trocken. »Die haben dort Geschmack.«
»Kochen die da noch immer über Kameldung?«, erkundigte sich Roberto mit unschuldiger Miene. »So viel zum Geschmack …«
Finch verdrehte die Augen und leerte sein Glas. Eine wohlige Wärme breitete sich in seinem Magen aus. War es die Vorfreude auf seine alte Heimat oder nur der Laphroaig? Wie auch immer, dachte er und lehnte sich vor. »Du warst es doch, der dieses Kaff als Arsch der Welt bezeichnet hat, von dem aus es nirgends mehr hin geht. Wenn ich mich recht erinnere, dann hast du mir zugeredet wie einem kranken Pferd, endlich meine Sachen zu packen und zu verschwinden.«
»Ach was, das ist wie bei den Frauen«, winkte Roberto ab. »Man sagt vieles, wenn die Nacht lang ist. Das ist doch eine alte Geschichte.«
Ja, alte Geschichten, dachte John Finch, hielt sich vorsichtshalber an der Theke fest und blickte zur stuckverzierten Decke, die sich gelblich verfärbt hatte. Dieses Haus war voll davon. Sie hatten sich in allen Ecken und Nischen eingenistet, wie Schwalben, die nie mehr südwärts fliegen wollten. Hemingway sei einmal hier gewesen, so munkelte man, habe alle unter den Tisch getrunken und dann die Zeche geprellt. Evita Perón habe eines Abends plötzlich auf der Bühne gestanden und eine flammende Rede gehalten, eine Lanze fürs Frauenwahlrecht gebrochen.
Und Caruso erst …
Alte Geschichten.
Je später der Abend, desto abenteuerlicher wurden sie. Was tatsächlich stimmte, das blieb für immer das Geheimnis der ätherischen Jugendstil-Engel auf der Empore, die mit unbewegter Miene nun seit fast einem Jahrhundert über die Besucher wachten.
Er würde sie vermissen, diese Geschichten, die Patina und die Atmosphäre von Dekadenz und Verfall. Sonst nichts und niemanden, außer Fiona vielleicht, aber auch das war noch nicht geklärt.
John Finch schob sein Glas über die Theke, fuhr sich mit der flachen Hand über die kurz geschnittenen grauen Haare und rutschte vom Hocker. »Zeit zu verschwinden, diesmal für immer. Bleib anständig und trink ab und zu einen auf mich.«
»Wann geht dein Flug?«
»Morgen, erste Maschine nach Rio, dann Direktflug nach Kairo«, antwortete Finch.
»Du hast noch zwei Flaschen bei mir gut«, erinnerte ihn Roberto.
»Heb sie auf, wer weiß? Zahlst du Zinsen? Vielleicht werden drei daraus mit den Jahren«, sagte Finch lächelnd und streckte die Hand über die Theke. »Es wird Zeit, die Bar zu wechseln.«
»Das hast du vor sechs Monaten schon einmal gesagt«, erinnerte ihn der Barkeeper. »Und doch hat dich das Baby wieder zurückgeholt.«
»Diesmal ist es ernst«, gab Finch zurück. »Ich bin schon weg.«
Roberto stieß sich vom Flaschenregal ab, hängte sich das fleckige Tuch über die Schulter und schüttelte dem Piloten die Hand. »Ich wiederhole mich ungern, aber pass auf dich auf, alter Mann«, sagte er lächelnd, »und schreib eine Ansichtskarte. Ich hab noch immer einen Magneten auf meinem Kühlschrank frei.«
Finch winkte grinsend ab. »Angeber, du hast gar keinen eigenen Kühlschrank.«
»Touché«, gab Roberto zurück und widmete sich wieder seinen Gläsern, »aber wie du siehst, arbeite ich daran jeden Tag bis spät in die Nacht.«
HOCHTAL RUMBUR, NAHE CHITRAL, NORDWESTLICHE GRENZPROVINZ / PAKISTAN
Der alte Mann mit den wachen blitzblauen Augen legte seine Axt beiseite, zündete sich eine Zigarette an und zog die gestrickte Mütze vom Kopf. Während er sich den Schweiß von der Stirn wischte, blickte er nachdenklich von seiner Hütte auf den kleinen Ort hinunter. Graue Steinhäuser, sauber und adrett angelegt, gruppierten sich um eine Brücke über den Fluss, der im Frühjahr gefährlich anwuchs und das Schmelzwasser von den zahlreichen Berggipfeln bis in das Tal von Chitral beförderte. Nun spielten Kinder an den Ufern und scheuchten lachend ein paar Ziegen durch die Gegend.
Shah Juan von Rumbur lebte trotz seines Alters von fast fünfundachtzig Jahren den Sommer über in seiner Hütte am Rand eines der großen Eichenwälder. Mit der Schneeschmelze und den ersten warmen Sonnenstrahlen zog es ihn auf den Berg, in das roh gezimmerte Häuschen mit der großen Feuerstelle, dem blanken Fußboden und den stummen, lebensgroßen Wächtern. In der kleinen Ansiedlung unten im Tal war es ihm zu eng, und als einer der bekanntesten Künstler seines Volkes, der viel bewunderte monumentale Holzskulpturen mit jahrtausendealten Symbolen erschuf, genoss er die Nähe der Natur.
Der Wald war sein Freund, die Bäume seine Vertrauten.
Und die reglosen Figuren mit den seltsamen Kopfbedeckungen waren seine Gefährten.
Juan wandte den Kopf und blickte hinauf zu den Bergen, die den Abschluss des Tales und zugleich die Grenze nach Afghanistan bildeten. Die meisten ragten über fünftausend Meter hoch in den azurblauen Himmel, wie steinerne Wächter im Norden, die beschlossen hatten, nie wieder fortzuziehen und sich für immer hier niederzulassen.
Die drei Täler, in denen sein Volk, die Kalash, lebte, waren seit jeher fruchtbar und von der Natur verwöhnt. In einer kargen, steinigen und lebensfeindlichen Berglandschaft waren die »Drei Paradiese«, wie man sie auch nannte, bekannt für ihre überreichen Ernten an Trauben, Nüssen, Äpfeln und Aprikosen. Die warmen Sommer in der Hochgebirgsregion und die oft harten und kalten Winter, das glasklare Wasser der zahlreichen großen und kleinen Flüsse und der Fleiß der Kalash hatten das Gebiet zu dem gemacht, was es heute war: ein friedlicher, geschützter Ort an einer gefährlichen Grenze. Denn trotz der Abgeschiedenheit und des einfachen Lebens, des Versuchs, die Traditionen zu bewahren und ihrer altertümlichen Religion lebten die Kalash keineswegs hinter dem Mond. Auch in ihrem kleinen Gebiet wurde der Druck durch die Taliban immer größer, die Übergriffe der islamistischen Tablighi Jamaat häufiger, die Parolen extremistischer, die Stimmung aggressiver.
Die Grenze zu Afghanistan war nahe, die alten Schmugglerpfade waren unkontrollierbar und nur den Eingeweihten bekannt. Sie boten eine rasche Rückzugsmöglichkeit in ein Gebiet, das die pakistanische Regierung schon seit langem als unüberwachbar eingestuft hatte. Der Hindukusch war eine einsame, raue Region, in der andere Regeln galten.
Ältere, ja oft archaische Regeln.
Zwei kleine Falken zogen ihre Kreise am frühen Nachmittagshimmel, und Juan sah den Vögeln zu, wie sie geschickt ihren Flug an die aus dem Tal aufsteigende warme Luft anpassten. Dann wandte er sich wieder dem großen Stück Holz zu, das unter einem Vordach im Schatten lag. Die Kalash, die Ungläubigen, sprachen ihre eigene Sprache, aber sie konnten sie nicht schreiben. So gab es keine Aufzeichnungen, und es hatte auch nie welche gegeben. Alles wurde mündlich weitergegeben, von Generation zu Generation, sorgfältig bewahrte Geschichten aus dem Dunkel der Zeit; Geheimnisse aus längst vergangenen Jahrhunderten.
Das war einer der Gründe, warum der Arbeit des Shahs so große Bedeutung zukam. Er hatte sein ganzes Leben damit zugebracht, den Alten zuzuhören und ihre Erzählungen in Symbolen festzuhalten. Die Geschichte der Kalash, die keiner glaubte, aus einer Vergangenheit, die viele belächelten, die jedoch die Wissenschaftler verunsicherte. Weil sie nach langen Untersuchungen gestehen mussten, dass die alten Legenden wahrscheinlich stimmten.
Juan lächelte versonnen und strich über sein immer noch volles, etwas angegrautes dunkelblondes Haar. Nach der Annexion der Chitral-Region durch Pakistan war er es gewesen, der sich selbstsicher für die Respektierung der Kalash als nicht-islamische Minorität durch die neue Regierung eingesetzt hatte. Es hatte nicht wenige verwundert, dass er mit seinem Vorhaben Erfolg hatte. Die Behörden hatten sein Volk von Anfang an unterstützt und respektiert, das Ansehen des bescheidenen, aber wortgewandten Shahs Juan war stetig gewachsen. Er traf regelmäßig mit einflussreichen Politikern und Persönlichkeiten zusammen, um an die Kultur und die Traditionen der Kalash zu erinnern. Ob Prinzessin Diana oder Benazir Bhutto, Präsident Musharraf oder General Zia-ul-Haq – Juan hatte allen die Hände geschüttelt und eloquent die Sache der Kalash vertreten. Sein Urteil wurde von den lokalen Clans ebenso bedingungslos akzeptiert wie von der Distriktregierung, seine Klugheit weithin geschätzt.
Gewalt war für den großen, weisen Mann der Kalash nie eine Option gewesen, sondern nur ein Weg ins Verderben. Die Entwicklungen in Pakistan und die verlustreichen Kriege in Afghanistan hatten ihm recht gegeben. Frustriert von der Unbelehrbarkeit der Mächtigen dieser Welt hatte er sich immer öfter in die Wälder zurückgezogen, wo er schweigen und doch Zwiesprache halten konnte mit all dem, was ihm heilig war, fern vom Trubel der großen Politik und den Fernsehkameras.
Der alte Mann fuhr fast zärtlich mit der Hand über das Holz, aus dem sein wichtigstes Werk entstehen sollte. Er hatte lange darüber nachgedacht, abgewogen und überlegt, fast drei Jahre hatte er sich dafür Zeit genommen. Waren seine Symbole und Figuren bisher verständlich für alle gewesen, die sich mit der Geschichte der Kalash beschäftigt hatten, so musste er nun vorsichtiger sein. Juan wollte nicht zu viel verraten, das würde er sich niemals verzeihen. Nein, dieses Werk musste subtiler sein, unterschwelliger, und durfte seine Botschaft nur den Eingeweihten offenbaren.
Selbst wenn die Sprache der Kalash irgendwann in naher Zukunft ganz verstummen sollte.
Die fünf Männer in ihren schmutzigen, traditionellen Umhängen und ausgebleichten Turbanen lagen hinter einigen Felsbrocken in Deckung. Zwei von ihnen beobachteten durch Feldstecher die kleine Hütte am Waldrand, während die anderen drei die Umgebung sicherten, den Finger am Abzug ihrer Kalaschnikows. Ehemals rote Tücher, die durch den jahrelangen Gebrauch in den Bergen des Hindukusch ockerbraun geworden waren, verhüllten ihre Gesichter bis auf die Augen.
Auf ein Zeichen ihres Anführers sprangen sie auf, schnelle, lautlose Schatten zwischen den Steinen. Der Hang senkte sich gleichmäßig zur Talsohle hin, in der Ferne konnte man den kleinen Ort am Fluss erkennen und ein paar Frauen, die unbekümmert plaudernd beisammen standen. Doch die Entfernungen täuschten in der klaren Luft der Berge. Bis ins Tal war es ein Fußmarsch von mehr als sechs Stunden.
Doch die Männer hatten ein ganz anderes Ziel.
Als sie im dichten Wald unter den Zweigen der ersten Bäume angelangt waren, atmeten die fünf auf. Der schwierigste Teil ihres Einsatzes war geschafft. Die großen Eichen boten einen hervorragenden Schutz gegen Entdeckung, das karge Moos dämpfte ihre Schritte.
Niemand sollte sie kommen sehen.
In diesen Bergen war es zwar wahrscheinlicher, einem Schneeleoparden zu begegnen als einem anderen Menschen. Aber gerade bei den Kalash, den Kindern der Natur, musste man vorsichtig sein. Sie verstanden es, Spuren zu lesen und die Warnrufe der Vögel zu deuten. Sie waren eins mit der Natur.
Ein leiser Pfiff ertönte, und die vier Männer wandten die Köpfe. Ihr Anführer hatte aus einer Tasche seines Umhangs ein hochmodernes GPS-Ortungssystem gezogen und die Route zur Hütte berechnet. Nun wies er stumm in den Wald und trabte los. Es war nicht mehr weit.
Sie konnten die Axtschläge schon hören, bevor sie die Lichtung sahen. Gebückt, jede Deckung ausnutzend, näherten sich die fünf Männer vorsichtig der Hütte. Zwischen den Zweigen der Büsche erkannten sie den alten Mann, der auf ein Stück Holz einschlug und ihm so eine bestimmte Form gab. Gruppen von großen, dunklen Figuren mit Pferden und mützenartigen Kopfbedeckungen standen um die Lichtung, wie eine Einheit von stummen und unbeweglichen Wächtern, die von den Waldgeistern verwünscht worden waren und nun jahraus, jahrein den Gezeiten trotzen mussten.
Der Anführer steckte das GPS-Gerät wieder in seine Tasche und holte seinen Feldstecher hervor. In aller Ruhe beobachtete er den Bildhauer, verglich im Geiste dessen Gesicht mit den Fotos, die er vor fünf Tagen in einem Hotel erhalten hatte. Kein Zweifel, der alte Mann war Shah Juan.
Doch noch erhob er sich nicht, sondern wartete geduldig. Er wollte ganz sichergehen, dass der Alte allein war. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnten, waren Zeugen, das hatte ihm sein Auftraggeber unmissverständlich klargemacht. Alles musste schnell, glatt und erfolgreich verlaufen, bevor sie mit den richtigen Informationen wieder zurückkehrten.
Auf der Lichtung vor der Hütte machte Shah Juan eine kurze Pause, wischte sich den Schweiß von der Stirn und begutachtete den Fortschritt seines Werkes. Erstmals beschlichen ihn Zweifel. War es tatsächlich richtig, das größte Geheimnis der Kalash dem Holz anzuvertrauen? Sollten bestimmte Dinge nicht für immer verborgen bleiben, ein getuschelter Lufthauch am abendlichen Lagerfeuer, unhörbar für die Uneingeweihten?
Ein Geräusch unterbrach seinen Gedankengang. Er schaute auf und sah eine Gruppe von fünf Männern aus dem Wald treten, mit umgehängten Gewehren und den traditionellen, schweren Krummdolchen am Gürtel. Ihre Gesichter waren verborgen, und Juan erkannte sie nicht an ihrem Gang. Es mussten also Fremde sein, vielleicht auf den schmalen Fußwegen über die Berge aus Afghanistan gekommen.
Der alte Mann lehnte sich auf seine Axt und sah ihnen ruhig entgegen. »Seid willkommen im Tal der Kalash«, begrüßte er die Männer, doch keiner der fünf antwortete. Sie kamen näher, blickten sich um, fixierten dann Shah Juan. Plötzlich und ohne Vorwarnung sprangen zwei von ihnen vor, zerrten den alten Mann von der Axt weg und schoben ihn in Richtung Hütte. Der Shah wehrte sich heftig, riss einem der beiden das ockerfarbene Tuch vom Gesicht und erstarrte. Sein Angreifer war Europäer, ohne Zweifel, mit weißer Haut und graugrünen Augen. Unter dem Turban lockte sich rötlich-blondes Haar.
»Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir?«, rief Juan verwirrt. »Was macht ihr überhaupt hier?«
Blitzschnell verhüllte der Angreifer wieder sein Gesicht und stieß den alten Mann durch die Tür in die Hütte. Währenddessen ging der Anführer fast gemächlich zu der kleinen Axt hinüber, die nach wie vor in dem großen Holzblock steckte. Er ergriff sie mit einem dünnen Lächeln, wog sie in der Hand und trat dann in die Hütte. In einer fremden Sprache, die der Shah nicht verstand, gab er seinen Männern, die den Alten festhielten, einen kurzen Befehl. Juan wurde auf den Rücken gedreht und mit ausgestreckten Armen auf den blank polierten Boden gedrückt.
Nachdem er auf die auf Englisch gebrüllten Fragen der Angreifer nicht antwortete, stellte der Anführer seine Füße auf die Unterarme des alten Mannes und hackte ihm mit gezielten Schlägen beide Hände ab, ohne sich um die Proteste und die hastig hervorgestoßenen Fragen seines Opfers zu kümmern.
Erst die linke und dann die rechte.
Ostermontagabend
KLEINGARTENANLAGE »SONNTAGSFRIEDEN«, BERLIN / DEUTSCHLAND
Thomas Calis verfluchte seine Tante Louise an diesem Abend bereits zum hundertsten Mal.
Mindestens.
Als er erschöpft den drei Männern hinterherblickte, die mit einem herablassenden Lächeln die quietschende Gartentür öffneten, das Grundstück verließen und sich dabei einen wissenden Blick zuwarfen, schickte er noch einen besonders saftigen Fluch himmelwärts und hoffte, dass Tante Louise ihn da oben hören möge. Das Gremium der Kleingartenanlage »Sonntagsfrieden«, bestehend aus Vorsitzendem, Kassenwart und einem greisen Ehrenmitglied, das bestimmt noch Bismarck persönlich gekannt hatte, bog entschlossen auf den schmalen Verbindungsweg zwischen den Gärten ein. Dann, wie auf ein unhörbares Kommando, wandten sich die drei Männer auf dem gepflegten Kiesweg nochmals um und warfen einen misstrauischen Kontrollblick zurück. Er wartete nur darauf, dass sie erneut einen Zollstock zücken würden, um die Höhe der Fliederhecke nachzumessen. Der Schlag sollte sie treffen und seine Tante Louise noch dazu!
Aber der zweite Teil des Wunsches hatte sich bereits erfüllt.
Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Kurz nach Weihnachten war Tante Louise – oder Louischen, wie sie im Kreise der Familie hieß – im Alter von 84 Jahren sanft entschlafen. Ihr riesiges Appartement am Ku’damm, das sie seit mehr als fünfzig Jahren allein bewohnt und bis an die Decke mit, ihrer Ansicht nach, Sammelnswertem vollgestopft hatte, war der regelmäßige Treffpunkt für Familienfeste aller Art gewesen. Denn eines hatte Tante Louise perfekt beherrscht – sie konnte kochen wie ein französischer Küchenchef.
Louise kochte gern, ausgezeichnet und viel, was ihr in der Familie eine unbestrittene Beliebtheit sicherte. Dazu kam, dass ihr erster und einziger Gemahl, der die Ehe mit der quirligen Louise nur neun Monate lang überlebt hatte, sein beträchtliches Vermögen in blinder Liebe seiner damals blutjungen Frau vermacht hatte. So konnte Louischen sich den Luxus erlauben, nicht zu arbeiten, ihr plötzliches Vermögen zu vermehren und ansonsten Gegenstände anzuhäufen, die ihr in die Finger kamen.
Sie ging es systematisch an. War eines der hohen Zimmer vollgeräumt, dann wurde es einfach abgeschlossen und die Sammlung im nächsten fortgesetzt. Da ihre Wohnung den gesamten ersten Stock eines Patrizierhauses beim Olivaer Platz einnahm, konnte Louise in Ruhe jahrzehntelang ihrer Leidenschaft frönen, bevor sie sich platzmäßig einschränken musste. Bevor sie, von Altersschwäche gezeichnet, die letzte Woche ihres Lebens im Krankenhaus verbrachte, hatte sie nur mehr in der Küche und einem kleinen Kabinett gehaust. Der Rest der Wohnung, angefüllt mit Schätzen aller Art, war kaum mehr betretbar gewesen.
Die Erben rieben sich angesichts der traurigen Mitteilung vom Ableben der etwas spleenigen alten Dame erwartungsvoll die Hände, und Thomas Calis musste sich eingestehen, dass auch er keine Ausnahme bildete. Als er hörte, dass seine Lieblingstante das Zeitliche gesegnet hatte, war er mit einem Gefühl freudiger Erwartung zu Frank Lindner, seinem Chef, gegangen, hatte sich einen freien Tag genommen und war schließlich beschwingt zur Testamentseröffnung geradelt.
Die Enttäuschung war umso größer gewesen, als der Notar das Schriftstück verlesen hatte und Thomas Calis’ Name nicht gefallen war. Louise hatte alle bedacht, ihn aber offenbar vergessen! Die Sammlung alter Meister ging an ihren jüngeren Bruder Leon, die Bibliothek an Cousine Marianne und die Biedermeier- und Jugendstilmöbel an Tante Sophie, der Schmuck an Rosemarie, der Inhalt des Kabinetts an ihren Neffen Walter … und so ging es weiter.
Seitenlang.
Als der Notar das Testament endlich verlesen hatte, griff er gierig nach einem Glas Wasser, das auf dem modernen Schreibtisch stand, leerte es mit einem Zug und holte danach tief Luft. »Ach ja, da haben wir noch einen Zusatz«, murmelte er, als er einen angehefteten und gestempelten kleinen Zettel entdeckte, der dem Testament beigefügt war. »Meinem Neffen Thomas Calis vermache ich den Kleingarten in Berlin-Charlottenburg, den mein seliger Mann damals nach dem Krieg erworben hat. Ich weiß, dass er somit in die besten Hände kommt.«
Der Notar blickte suchend auf und schaute direkt in die verständnislosen Augen des völlig vor den Kopf gestoßenen Erben.
»Kleingarten?«, hörte Calis sich krächzen, »Laubenpieper? Is’ nicht wahr …«
Niemand aus der Familie hatte ihm gratuliert.
Kein bisschen Neid hatte sich in den Augen der Angehörigen abgezeichnet, nur stummes Mitleid. Bis dato hatte niemand gewusst, dass Louischen ein Grundstück in einer Kleingartenanlage mit dem bezeichnenden Namen »Sonntagsfrieden« am Goslarer Ufer ihr eigen nannte. Nun war es also in die treusorgenden Hände von Lieblingsneffen Thomas Calis übergegangen.
Geschah ihm recht.
Mit der schüchternen Frage: »Gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Erbschaft auszuschlagen?«, war Calis schließlich völlig zum Paria geworden. Die entrüsteten Blicke der übrigen Verwandtschaft, verbunden mit einem entsetzten, kollektiven Kopfschütteln, hatten ihn an den Sessel genagelt.
Von diesem Zeitpunkt an hatte ihn keines der übrigen Familienmitglieder mehr beachtet.
So hatte Thomas Calis alles verdrängt: die Testamentseröffnung, Tante Louise, den Kleingarten, die Akte Sonntagsfrieden. Er hatte sich in die Arbeit gestürzt, war mit Alice, seiner neuen Freundin, auf einen Kurzurlaub nach Marienbad gefahren und hatte bei seiner Rückkehr einen knallgelben Zettel mit einer Telefonnummer auf seinem Schreibtisch vorgefunden. »Dringender Rückruf«, stand darauf, dann eine Nummer und »unverzüglich!«.
Was dann kam, sollte er nicht so schnell wieder vergessen. Ein entrüsteter Vorsitzender des Kleingartenvereins »Sonntagsfrieden« hatte ihm im Laufe eines eher einseitig geführten Gesprächs ein klares Ultimatum gestellt: »Der Garten mit der Nummer 9 / 54, den Sie von Ihrer Tante geerbt haben, muss bis zur Eröffnung der Saison 2011 am Ostermontagabend auch tatsächlich einer zivilisierten Grünfläche ähnlich sehen und nicht einer zugewachsenen Deponie mit einem halb verfallenen Haus. So etwas ist unserer Gemeinschaft unwürdig! Hier gibt es Regeln und Pflichten, Richtlinien und Satzungen! Wir haben mit Rücksicht auf den angegriffenen Gesundheitszustand Ihrer Tante und des hohen Alters beide Augen zugedrückt, aber nun ist die Schonfrist vorbei. Sie glauben wohl, nur profitieren zu können?«
»Wovon?«, hatte Thomas Calis halbherzig eingewandt, war aber auf völliges Unverständnis gestoßen.
»Laut Paragraph 24b der Kleingartenordnung können wir die Parzelle 9/54 jederzeit neu vergeben, sollte sie ungepflegt, vernachlässigt und offensichtlich ungenutzt sein oder den Vorschriften nicht entsprechen«, hatte der Vorsitzende ihn kühl wissen lassen. »Sie haben noch genau zwei Wochen Zeit.«
Das war das Ende des Gesprächs gewesen und der Beginn eines Wettlaufs gegen die Zeit, des Kampfs gegen Unkraut und Wildwuchs, überbordende Stauden und die verwitterten Holzbalken einer ehemals weiß gestrichenen Gartenlaube im Miniformat. Vom Haus, das direkt aus einer Modellbahnlandschaft zu stammen schien, gar nicht zu reden.
Das volle Ausmaß der Katastrophe war Thomas Calis klar geworden, als er das erste Mal vor einem windschiefen, rostigen Eisentor stand und versuchte, durch das überbordende Gestrüpp irgendetwas zu erkennen. Auf dem Grundstück links von ihm zog ein kleiner Japaner unter ständigem Gemurmel seinen Rechen durch Kubikmeter von Kies und legte komplizierte Muster um Bonsai-Bäumchen an. Rechts tuckerte laut pfeifend eine Modelleisenbahn durch exakt rechtwinkelig gezogene Blumenrabatten, begleitet vom offensichtlichen Gejohle einer Kolonie Gartenzwerge mit weit aufgerissenen Mündern.
Thomas Calis ließ den Kopf hängen und schloss verzweifelt die Augen.
»Hallo Nachbar!«, ertönte es aus der japanischen Enklave. »Haben Sie eine Machete mitgebracht? Oder sprengen Sie sich den Weg frei, Mastel Blastel?«
Eine arbeitsreiche Woche später – das Osterwochenende und damit der alles entscheidende Termin rückten unerbittlich näher – war Alice ihm in den Rücken gefallen.
»Ich nehme nicht an, dass du unseren Kurzurlaub auf Sylt vergessen hast«, hatte sie spitz bemerkt. »Abreise Karfreitagnachmittag in meinem neuen Cabrio. Ich möchte Ostern nicht in Berlin festsitzen, während alle meine Freundinnen sich zwischen Garmisch und Kiel beim fröhlichen Eiersuchen im eleganten Rahmen vergnügen.«
»Hmm, daraus wird leider nichts«, hatte Calis gemurmelt und war dabei in Gedanken durchgegangen, was im Schrebergarten noch alles zu tun war. »Ich bin es Tante Louise schuldig.«
»Pah! Du bist ihr gar nichts schuldig!« Alice’ erboster Kommentar hatte die Eröffnung der Feindseligkeiten signalisiert. Das erbitterte Wortgefecht, an dessen Ende die Anwältin wütend die Tür hinter sich zugedonnert hatte, war das Letzte, das Thomas Calis seitdem von seiner Freundin gehört hatte.
Als er sich am Karsamstagabend auf seine Schaufel stützte und nachdenklich das erste Beet betrachtete, das er im Schweiße seines Angesichts angelegt hatte, fiel ihm Alice wieder ein. Wahrscheinlich drängte sie sich bereits kurzberockt an der Theke der Sansibar in Rantum, schlürfte Austern mit ein paar Verehrern im Schlepptau, die sich um die Bezahlung der Zeche stritten und dabei ihren Hintern nicht aus den Augen ließen.
Während er Regenwürmer belästigte …
»Nicht schlecht für einen Anfänger«, bemerkte die japanische Fraktion gönnerhaft mit breitem Grinsen, während der Zugmagnat auf der anderen Seite offenbar beschlossen hatte, den neuen Nachbarn zu ignorieren und stattdessen außerplanmäßig einen besonders langen Sonderzug einzuschieben.
Die Gartenzwerge johlten glücklich.
Montags war dann pünktlich um neunzehn Uhr wie angedroht das Dreigestirn am Osterhimmel aufgetaucht, Zollstock, Klemmbrett und Lageplan in der Hand. Das oberste Gremium der Kleingartenanlage »Sonntagsfrieden« ließ keinen Zweifel daran, dass es ihm todernst war. Nach einer kurzen Begrüßung, die eher einer Kriegserklärung ähnelte, begannen sie die »Begehung des Grundstückes«, wie sie es nannten, schauten, maßen, schritten ab. Ihren wachsamen Blicken entging nichts. Die Höhe der Hecken, die Breite der Bäume, die Lage der Beete, der Abstand der Sträucher von der Grundgrenze, der neue Anstrich des Gartenhauses, die Art der gepflanzten Blumen. Hundertfünfzig Jahre Erfahrung in Kleingärtnerei trafen erbarmungslos auf pures Anfängertum.
Thomas Calis ertappte sich plötzlich dabei, wie sich seine Mordgelüste kaum noch zurückdrängen ließen. Er fühlte sich wie bei einer Prüfung, von der seine Zukunft abhing. Für einen Moment durchzuckte ein mörderischer Gedanke nach dem anderen sein Gehirn. Sprengung, Totschlag mit der Schaufel, heimliches Verbuddeln der Leichen im Tulpenbeet. Doch als er seinen japanischen Nachbarn sah, der neugierig über den Zaun glotzte und an einer übel riechenden Wurzel kaute, wurde ihm klar, dass es mit Heimlichkeit und Privatsphäre in einer Kleingartenanlage nicht weit her war.
Wenn hier einer furzte, dann litten drei andere.
Nach fast einer Stunde aufreibender und fast wortloser Kontrollarbeit war das Gremium wieder abgezogen, und Calis hätte wetten können, dass ein kollektives Aufatmen durch die Nachbarschaft ging. Es war bereits dunkel geworden, und aus einem der Gärten zog der Duft von Grillwurst und Rippchen durch die Abendluft.
Alice hatte sich das ganze Wochenende lang nicht gemeldet. Wahrscheinlich, nein, ganz sicher sogar war sie bereits mit einem ihrer Sylter Verehrer in medias res gegangen, wie sie es nannte.
Juristen unter sich … oder unter einander …
Mit einem allerletzten Fluch an die Adresse von Tante Louise zog er eine kalte Flasche Bier aus der Kühltasche und ließ sich seufzend ins Gras sinken. Seine Hände waren voller Blasen, zerkratzt und wund, seine Schultern und sein Rücken schmerzten. Die kurz geschnittenen, strohblonden Haare standen nach allen Seiten ab, der Staub brannte in seinen Augen und die schmutzige Brille war zu einem Weichzeichner geworden, der die Welt gnädig ein wenig erträglicher erscheinen ließ. Thomas Calis war weichgeklopft, aber siegreich aus dem Kampf mit der Natur hervorgegangen.
Er war ein wenig stolz auf sich und genoss den Augenblick des Triumphs.
Das Pils zischte und verdampfte auf dem Weg in den Magen. Er atmete genüsslich auf und setzte die Flasche erneut an. Während er noch überlegte, danach sofort eine weitere Buddel zu köpfen, hörte er irgendwo drinnen im Gartenhaus sein Handy klingeln.
»Vergiss es«, murmelte er kopfschüttelnd, aber dann dachte er an Alice und rappelte sich ächzend hoch. Durch seine verschmierten Brillengläser sah er das Display nur verschwommen leuchten, und so meldete er sich unverbindlich mit einem hoffnungsvollen »Ja?«
»Kommissar Calis? Wir haben einen Toten in der Berlichingenstraße in Moabit, ganz in Ihrer Nähe. Der Chef möchte, dass Sie sich die Sache ansehen. Natürlich nur, wenn Sie sich von Ihrer neuen Gartenleidenschaft losreißen können, wie er so richtig meinte …«
HOCHTAL RUMBUR, NAHE CHITRAL, NORDWESTLICHE GRENZPROVINZ / PAKISTAN
Shabbir Salam sah sich aufmerksam um. Irgendetwas war seltsam hier.
Während seine drei Untergebenen von der Border Police, die an der Grenze zu Afghanistan eingesetzt und in der kleinen Provinzhauptstadt Chitral stationiert waren, den umliegenden Wald durchsuchten, war Chief Inspector Salam zurückgeblieben, am Platz vor der Hütte, wo es nach Asche und verbranntem Fleisch stank. Er würgte. Sie waren zufällig auf Patrouille durch das Hochtal gewesen, als eine Rauchsäule am Berghang ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Zuerst hatten sie gedacht, jemand würde altes Holz verbrennen, aber als sie einer Gruppe von Frauen der Kalash begegnet waren, die ängstlich in Richtung des Feuers deuteten und sie drängten anzuhalten, änderten sie ihre Meinung rasch.
»Da oben liegt die Hütte von Shah Juan von Rumbur«, hatte eine der jungen Frauen erregt ausgerufen. »Irgendetwas muss passiert sein. Wir haben schon überlegt, hinaufzusteigen und selbst nachzuschauen, aber …« Sie war verstummt.
»Gibt es einen befahrbaren Pfad?«, hatte sich Salam erkundigt, und die Frau hatte eifrig genickt und sofort angeboten, der Grenzpolizei den Weg zu zeigen.
Nun stand der Chief Inspector vor den Resten der Hütte, die fast zur Hälfte verbrannt war und versuchte, sich ein Bild zu machen. Salam, einstiger Elitesoldat der Pakistanischen Armee, war bereits vor Jahren auf eigenen Wunsch von den Polizeikräften rekrutiert und in den Hindukusch abkommandiert worden. Das sensible Gebiet im Nordwesten Pakistans verlangte bedächtiges Handeln, gute Kontakte mit der Bevölkerung und ein gesundes Misstrauen gegenüber allen extremistischen Bewegungen. Es war Salams Verdienst, dass die Krisenregion halbwegs stabil war und das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizeikräfte ständig wuchs. Salam und Shah Juan waren befreundet gewesen, hatten sich vertraut und geschätzt. Beide hatten sie versucht, Toleranz und Mäßigung dem ständig wachsenden Druck der Extremisten und Taliban entgegenzusetzen. Es sah so aus, als hätten sie damit Erfolg.
Aber nun?
Salam, ein untersetzter grauhaariger Mann in einer untadeligen Uniform, ging tief in Gedanken versunken zu einem Holzblock unter einem kleinen Vordach hinüber, an dem der Bildhauer Juan offenbar bis zuletzt gearbeitet hatte. Tiefe Axthiebe hatten die weichen, fließenden Linien und die geheimnisvollen Symbole, die so typisch für Juans Stil waren, völlig zerstört. Es schien, als habe jemand wütend auf den Block eingeschlagen, immer und immer wieder.
Doch wo war die Axt?
Der Inspektor hörte in der Ferne seine Männer im Unterholz. Sie arbeiteten sich langsam den Hang hinauf, suchten nach Hinweisen. Alle drei Polizisten, von Salam selbst vor Jahren rekrutiert, waren erfahren und hier geboren. Sie kannten die Berge des Hindukusch seit ihrer Kindheit, konnten Spuren deuten und das Wetter vorhersagen, verstanden die Rufe der Tiere. Darüber hinaus hatte Salam darauf bestanden, dass alle seine Mitarbeiter lesen und schreiben konnten, ein Mindestmaß an Bildung hatten und eine Familie. Väter und Ehemänner waren verlässlicher und besonnener als Junggesellen.