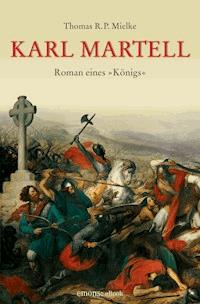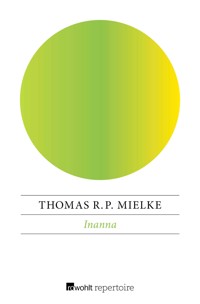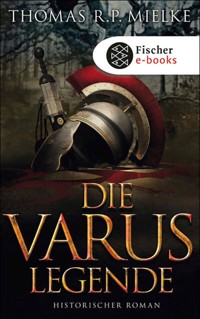6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der mächtigste Palast der Christenheit wird gebaut: als Versteck für die geheimen Zeichen der Templer? Abenteuer und Entscheidung für Bertrand de Comminges: Er ist der Einzige, der noch den Schlüssel zu den Geheimnissen der Templer und zu ihrem Schatz besitzt. Jetzt, im Jahre 1348 setzen ihn weltliche und geistliche Mächte unter Druck. Kann er sein Wissen aus dem Tempel Salomonis in Jerusalem durch den Bau des mächtigen Papst-Palastes von Avignon bewahren? Oder gerät auch er - wie nahezu alle anderen Wissenden zuvor - in die Fänge der Inquisition?
Mit Der Palast von Avignon von Bestseller-Autor Thomas R. P. Mielke (u. a. Das Sakriversum, Gilgamesch, König von Uruk) legt der Apex-Verlag den triumphalen Abschlussband der großen Avignon-Trilogie vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
THOMAS R. P. MIELKE
Der Palast von Avignon
Dritter Roman der AVIGNON-Trilogie
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
DER PALAST VON AVIGNON
Kapitel 1: Gebet und Feuer
Kapitel 2: Im Zeichen der Walnuss
Kapitel 3: Der Papst im Turm
Kapitel 4: Die Friedhofsbank
Kapitel 5: Festmahl des Prinzen
Kapitel 6: Geheime Keller
Kapitel 7: Besuch des Schottenpriesters
Kapitel 8: Hôtel La Mirande
Kapitel 9: Die Nonne
Kapitel 10: Der Gral
Kapitel 11: Falsche Hostien
Kapitel 12: Trompe-l'œil
Kapitel 13: Heiltrunk
Kapitel 14: Die Römer kommen
Kapitel 15: Die Judasfalle
Kapitel 16: Aufruhr im Fondaco
Kapitel 17: Fontaine de Vaucluse
Kapitel 18: Das Feigenbäumchen
Kapitel 19: Cour d’Amour
Kapitel 20: Inquisition
Kapitel 21: Katakomben der Macht
Kapitel 22: Zur Schatzkammer
Kapitel 23: Privat-Audienz
Kapitel 24: Die Katakomben
Kapitel 25: Das Allerheiligste
Kapitel 26: Die Brücke von Avignon
Epilog
Dramatis Personae anno 1342
Das Buch
Der mächtigste Palast der Christenheit wird gebaut: als Versteck für die geheimen Zeichen der Templer? Abenteuer und Entscheidung für Bertrand de Comminges: Er ist der einzige, der noch den Schlüssel zu den Geheimnissen der Templer und zu ihrem Schatz besitzt. Jetzt, im Jahre 1348, setzen ihn weltliche und geistliche Mächte unter Druck. Kann er sein Wissen aus dem Tempel Salomonis in Jerusalem durch den Bau des mächtigen Papst-Palastes von Avignon bewahren? Oder gerät auch er - wie nahezu alle anderen Wissenden zuvor - in die Fänge der Inquisition?
Mit Der Palast von Avignon von Bestseller-Autor Thomas R. P. Mielke (u. a. Das Sakriversum, Gilgamesch, König von Uruk) legt der Apex-Verlag den triumphalen Abschlussband der großen Avignon-Trilogie vor.
Der Autor
Thomas R. P. Mielke, Jahrgang 1940.
Thomas R. P. Mielke ist ein deutscher Schriftsteller, der bevorzugt in den Bereichen Science Fiction, Krimi und historischer Roman tätig ist.
Mielke war hauptberuflich Texter, Konzepter sowie drei Jahrzehnte lang Kreativdirektor in internationalen Werbeagenturen. Er war für Slogans wie Berlin tut gut oder Mach's mit der ersten Anti-AIDS-Kampagne zuständig; überdies gilt er aus seinen Jahren in der Generaldirektion von Ferrero in Pino Torinese/Italien als Miterfinder des Kinder-Überraschungseis.
Parallel zu seiner Tätigkeit als Werbemanager schrieb er Krimis, Science Fiction und historische Romane. Sein erster SF-Roman Unternehmen Dämmerung erschien 1960 unter dem Pseudonym Mike Parnell. Es folgten einige Dutzend weitere unter den Pseudonymen Michael C. Chester (u.a. Ihre Heimat ist das Nichts, 1966), Bert Floorman, Henry Ghost, Roy Marcus, Marc McMan, Marcus T. Orban (u.a. New York 2019, 1983), John Taylor u. a.
In den 1960er Jahren schrieb er diverse Romane für verschiedene Verlage, u.a. für die gemeinsam mit H. G. Francis und Rolf W. Liersch konzipierten Serien Rex Corda und Ad Astra.
Zusammen mit Rolf W. Liersch entwickelte Mielke Mitte der 1970er Jahre das Konzept der alternativen Science-Fiction-Serie Die Terranauten, die in den Jahren 1979 bis 1987 im Bastei-Verlag erschien (und die aktuell im Apex-Verlag wiederveröffentlicht wird).
1983 wurde Mielkes Roman Das Sakriversum mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet; sein Werk Gilgamesch, König von Uruk belegte 1988 den zweiten Platz bei der Verleihung desselben Preises.
1985 erhielt er den Literaturpreis des Science-Fiction-Club Deutschland e.V. für die Politvision Der Tag an dem die Mauer brach über einen unerwarteten friedlichen Mauerfall und die Wiedervereinigung. Der Stern schrieb dem Autor dazu: »Die Berliner Mauer ist kein Thema – und wird es in den nächsten 25 Jahren auch nicht werden.«
Weitere herausragende Science-Fiction-Romane Mielkes sind Grand Orientale 3301 (1980), Der Pflanzen-Heiland (1981) und Die Entführung des Serails (1986).
Seit 1990 wandte sich Mielke verstärkt dem historischen Roman zu. So veröffentlichte er seither u. a. Inanna (1990), Karl der Große – der Roman seines Lebens (1992) und die Avignon-Trilogie (2004 – 2006).
2010 erschien sein vom Goethe-Institut-Preisträger Dr. Nabil Haffar ins Arabische übersetzter Roman Gilgamesch, König von Uruk in Syrien und anderen arabischen Ländern und kehrte damit zu seinem Ursprung zurück.
Gemeinsam mit Astrid Ann Jabusch (www.annjabusch.de) schrieb Mielke unter dem Titel Orlando Furioso eine Neu-Erzählung des Mittelalter-Bestsellers Der Rasende Roland; der Roman, erschienen im Emons-Verlag, wurde 2016 mit dem Deutschen Fantasy-Preis ausgezeichnet.
Thomas R.P. Mielke lebt und arbeitet in Berlin.
DER PALAST VON AVIGNON
»Schon sah ich Reiter aus dem Lager zieh’n,
Die Must’rung machen, in die Feinde brechen...
Sah Festturnier und große Lanzenstechen;
Drommeten hört’ ich, Trommeln, Glockenton,
Sah Rauch und Feuer auch als Kriegeszeichen,
Und fremd’ und heimische Signale schon...
Mit zehen Teufeln ging ich, voll Verdruss,
Doch wußt’ ich, daß man Säufer in den Schenken
Und Beter in den Kirchen suchen muß,
Auch war aufs Pech gerichtet all mein Denken,
Um ganz des Orts Bewandtnis zu erspäh’n.
Und welche Leut’ in diese Glut versänken.«
- Dante Alighieri, Göttliche Komödie,
Die Hölle, 22. Gesang
Kapitel 1: Gebet und Feuer
Es war die Hölle! Nein, nicht einmal Dante, der große Meister der italienischen Dichtkunst, konnte eine Vision von einem derartigen Inferno gehabt haben. Nicht von dieser Hölle, diesem Feuer! Aber er hatte es beschrieben – ganz genau so, wie Bertrand de Comminges es urplötzlich vor sich sah.
Die Flammen schossen wie aus einem speienden Vulkan vom Innersten der Erde nach oben. Sie loderten an der glänzenden, mit schierem Blattgold ausgekleideten Nordwand seines über die Jahre mit Büchern angefüllten Studierzimmers aufwärts, verdrehten sich wie austrocknende Rosenblätter vor seiner Sammlung von geheimen Kostbarkeiten, verpufften noch im Aufstieben an den vergoldeten Deckenbalken und verloren dort ihre Höllenglut.
Das Schlimmste aber... das Schlimmste war der Spieß mit dem Schwein, das sich langsam unter einem hohen, nach oben spitz zulaufenden und erst halb fertigen Kamin an seinen Ketten drehte. Die Schwarte glänzte bereits, und an den abgehackten Beinen brutzelte braun gegrilltes Fleisch. Bertrand spürte, wie grässliche Flammen innen wie außen seine Glieder peinigten und sie zugleich betäubten.
Das Maul des Schweins war mit goldenem Drahtgeflecht über Zweigen aus verbranntem Rosmarin und einer bitteren Orange so zugebunden, dass es im Feuerschein hämisch zu grinsen schien. Auch zwischen beiden Hinterschinken steckte ein Büschel Würzkräuter wie ein verkohlter Blumenstrauß im Leib des unnatürlich schlanken und gespreizt wirkenden Tieres.
Bertrand wollte nicht sehen, was er sah. Er wehrte sich gegen das grauenhafte Bild inmitten einer Feuerwand, die nicht wahr sein durfte. Aber er konnte sich nicht abwenden, nicht fliehen und nicht schreien. Alles in ihm war Ohnmacht und kribbelnde Erstarrung. Und dann erkannte er voller Entsetzen Kopf und Gesicht des Grillschweins.
Das Schwein im Flammenbild hieß Fisch.
Pierre Fisch – oder auch Poisson – aus Mirepoix in der Nähe der alten Festungsstadt Carcassonne. Angekleidet und nicht in Flammen schmorend, war er Herr über achthundert Maurer und Steinmetze, Schmiede und Zimmerleute, Handlanger und Fuhrknechte am großen neuen Papstpalast mitten in Avignon. Und in den vergangenen sieben Jahren oberster Baumeister und Geheimnisbewahrer des frommen Heiligen Vaters Benedikt XII.
War er schon tot? Wer war schon tot? Der Baumeister mit dem ungewöhnlichen, falsch klingenden Namen? Papst Benedikt? Oder er selbst, der angesehene Kaufmann und Eigentümer der ehemaligen Komturei des aufgelösten Templer-Ordens?
Hatte er nur deshalb noch Namen und Erinnerung, weil Fisch oder er sich noch nicht ganz in Dantes Hölle, sondern erst in ihrem Vorhof befanden? Im Fegefeuer, das er stets für eine kindische Erfindung von Ablassmönchen und Wanderpredigern gehalten hatte, die nicht einmal Latein konnten?
Er konnte den Kopf mit seinem immer noch dichten blonden Haarschopf nicht wenden, doch zu beiden Seiten der Flammen entdeckte er wie auf einem halb aufgeklappten Altarbild schemenhafte Gestalten. Rechts und links vom gegrillten Schwein tauchten zwei andere Männer aus dem Papstpalast wie Skizzen aus braunem Eisenpulver im frischen, noch feuchten Mörtel einer Freskowand auf.
Es zerriss Bertrand fast, als ihn die Ahnung überkam, wen die erst angefangenen Gesichter einmal darstellen sollten. Die beiden Wände mussten feucht bleiben, durften nicht mit der Flammenwand in Berührung kommen, nicht schneller trocknen, als die Maler die Farben auftragen konnten.
Die beiden Gesichter wurden immer deutlicher erkennbar. Das eine gehörte dem Dichterkönig Francesco Petrarca, dem erst im vergangenen Jahr vor dem Senat in Rom der Lorbeer aufs Haupt gesetzt worden war. Das andere Gesicht blieb vage, verwaschen. Es gehörte dem Künstler, den Benedikt XII. aus Viterbo nach Avignon geholt hatte und der seit 1336 als päpstlicher Hofmaler für die malerische Ausstattung des neuen Palastes zuständig war.
Francesco Petrarca aus Arezzo und Matteo Giovanetti aus Viterbo – zwei ungewöhnliche Italiener in Avignon. Dazu der Baumeister des Palastes und er selbst, der Kaufmann, der schon den drei vorangegangenen Päpsten höchst zuverlässig und verschwiegen gedient hatte. (Einst verheiratet mit dem wunderbaren Judenmädchen Miriam und nach ihrem Tod mit Catherine, der aufmüpfigen, schwarzhaarigen Tochter des französischen Admirals und späteren Seeräubers Rainier Grimaldi von Monaco.)
Vier Männer wie die vier Balken des Kreuzes, das im Herzen und in der Rose als geheimes Zeichen der Tempelritter verborgen war. Ein fünftes, schemenhaftes Gesicht tauchte auf. Bertrand bemühte sich, die Gesichtszüge deutlicher zu erkennen. Für einen Moment dachte er, er würde Clemens VI., den neuen und starken Papst, erkennen, dann wieder erinnerte ihn eine Art Spott in der Zeichnung an seinen Schwager Seder Ben Ariel.
Bertrand verstand nicht, was die Schrecken vor ihm bedeuteten. Verbrannte er innerlich? War diese schreckliche Flammenwand eine Spiegelung... eine Art Fata Morgana?
Und noch eine andere Gestalt stieg schemenhaft im lodernden Feuer auf. Bertrand erinnerte sich, dass Gott selbst in vielen Berichten der Bibel aus Feuer und Licht zu den Menschen gesprochen hatte. Doch diese Gestalt war nicht Gott, kein Erzengel und keiner der vielen grauen, schwarzen und weißen Büßermönche in Avignon. Die Kapuze der Gestalt hinter den Flammen hatte keine Augenschlitze wie bei den Penitents.
Schon glaubte Bertrand, seinen alten Freund, Lebensretter und Beichtvater Mel Comyn zu erkennen. Ihm schien, als wäre Comyns hageres Gesicht vom vielen allzu scharf schmeckenden Patrickswasser inzwischen lederartig verdorrt und nur noch eine Fratze auf einem Hals aus dürrem, sturmgepeitschtem Holz. Dann wieder verwandelte sich das Flammenbild des greisen und noch immer rothaarigen schottischen Priesters in einen Dominikaner.
Für einen schrecklichen Moment erkannte Bertrand den schwarzweißen Habit eines Inquisitors. Und sein Gesicht sah aus wie der Tod.
Nur ein, zwei Steinwürfe entfernt klang wunderschöner Männergesang aus einem tempelartigen Rundbau. Es war, als würden himmlische Cherubim gegen Geschrei und Lärm der überfüllten Stadt ansingen. Es war noch hell, als die Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Avignon nach dem Ende der Freitagsarbeiten in ihrer Synagoge am Place Jerusalem zusammengekommen waren. Die Psalmen fünfundneunzig bis neunundneunzig und der Psalm sechsundzwanzig waren bereits gesprochen. Der Kantor wollte gerade seinen schönsten Gesang über die Sabbatbraut am Vorabend des wöchentlichen Feiertages beenden. Er hob zur letzten Strophe an, und alle standen auf.
»Kommt, meine Freunde, der schönen Braut entgegen«, sang der Kantor, »zieh ein in Freud und Fröhlichkeit unter uns Getreue und wahrhaft Gläubige, die Gott zu seinem Volk erwählt hat.«
Die Gemeindemitglieder hatten sich die ganze Zeit nach Osten zum Podium des Vorlesers gewandt. Hinter ihm lag das gerollte Buch der Thora in der Heiligen Lade, und in derselben Himmelsrichtung befand sich weit entfernt Jerusalem mit der Klagemauer und den Überresten des Tempels Salomos, des weisen Königs.
Nun aber drehte sich die Gemeinde zum Synagogeneingang. Alle verbeugten sich in höflicher Erwartung – ganz so, als würde nicht der Sabbat, sondern eine lebendige und königlich geschmückte Braut erwartet.
»Zieh ein, du gottgewollte Braut«, sang der Kantor. Im selben Augenblick sprangen hoch über ihnen zwei der bunten Fensterflügel auf. Für einen endlos langen Augenblick schien es, als würde nur die Sonne früher als erwartet untergehen. Dunkelheit legte sich vor die Fenster, dann quoll stinkender Rauch durch die halb geöffneten Fenster am oberen Rand der Synagoge. Unsicher sang der Kantor noch ein paar Töne weiter, dann brach er ab und hustete.
Die Schwaden wallten wie böse Vorzeichen eines Pogroms über die Köpfe der Gläubigen hinweg. Aber sie rochen nicht so typisch nach Weihrauch wie bei den bösartigen Ausschreitungen in den vergangenen Jahren, wenn auch noch Mönche und Priester die Menge aufhetzten und ihre Glutkessel zum Unrecht schwenkten.
Viele der Älteren hatten plötzlich wieder die unheilvolle Mischung aus Leid und Unterwürfigkeit in ihren Gesichtern. Sie wussten, dass sie niemals sicher sein konnten – nicht in der neuen Papststadt und im Comtat Venaissin, in dem sie offiziell unter dem Schutz des Papstes standen. Nicht in Carpentras, der ein paar Meilen östlich gelegenen Hauptstadt der kleinen Grafschaft, die schon vor der Übersiedlung der Kurie von Rom nach Avignon zum Kirchenstaat, zur Provence, zum Königreich Neapel und damit auch zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Und erst recht nicht auf der anderen, der französischen Seite der Rhône, auf der Juden und Leprakranke noch immer tödlich bedroht waren. Seit hundert Jahren trugen auch die Juden von Avignon und Carpentras den Ring aus gelbem Filz auf ihrer Kleidung, wie er bereits beim Laterankonzil von 1215 päpstliche Vorschrift geworden war. Dennoch hatten sie hier sicherer leben können als bei den Franzosen.
»Gott, der Herr wird uns vergeben«, rief der Rabbiner. Er eilte zu den Thorarollen, um sie vor der hereinbrechenden Gefahr zu bergen. »Wir können unseren Sabbat nicht mehr so begrüßen, wie es Brauch und Vorschrift ist! Keinen Psalm, kein Abendlob mehr... keinen Wein für die Königin der Woche, kein Kiddusch-Gebet!«
Bertrand blickte regungslos auf die Figuren und Gesichter in der Flammenwand. Wo auf seinen weiten Handelsreisen hatte er schon einmal ähnliche Missgeburten und Albträume in Stein gehauen an den Friesen von Kathedralen gesehen? In Metz, Châlons oder Troyes etwa? Irgendwo dort war ein Schwein zu sehen, das auf einer Fiedel musizierte... ein Symbol für den Heiligen Antonius, der die hermetischen Geheimnisse Ägyptens kannte und der als Schutzpatron der Antoniter-Mönche galt.
Ein schrecklicher Gedanke überfiel ihn.
War er vielleicht vergiftet? Hatte er irgendetwas gegessen oder getrunken, das ihn durch das Antoniusfeuer unter Schmerzen und lähmenden Visionen vom Leben in den Tod beförderte?
Für welches der vielen kleinen Vergehen in seinem reichen und bei Gott nicht immer christlichen Leben, der lässlichen oder auch Todsünden bekam er jetzt die große Abrechnung im Kontobuch des Allmächtigen? Wer war es, der ihn nach all den Jahren in fast täglicher Gefahr auch noch mit schlimmen Höllenbildern peinigte? Und wer war hinter ihm, dem Baumeister oder beiden zusammen her? Erboste Händler oder Beauftragte von irgendeinem Fürsten, die er weiß Gott wann über den Tisch gezogen hatte? Geldgierige Mörder, gedungen von streitenden römischen Adelsfamilien, Engländern, Franzosen oder dem exkommunizierten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches in München? Erbitterte Gegner im Klerus? Franziskaner oder die Dominikaner, diese in überzeugtem Glauben zu jeder Folter und Gemeinheit fähigen »Hunde des Herrn«?
Während die Augen das Entsetzliche so deutlich sahen und sein ganzer Körper die Offenbarung der Hölle erwartete, hörte der sonst so furchtlose und unerschütterliche Kaufmann nicht einen Laut, kein Flammenknistern, kein Bersten der Balken seines großen Studierzimmers und kein Geschrei der bis in alle Ewigkeit Verdammten.
Er konnte immer nur auf das Schwein im Feuer starren. Die unsichtbaren Fesseln ließen ihm gerade noch ein wenig Luft zum Atmen, machten ihn bewegungslos – aber sie schützten ihn gleichermaßen.
Und dann verspürte er wie nie zuvor in all den siebenundvierzig Jahren seines Lebens Durst. Nicht, dass er wegen der Hitze des Feuers vor ihm trinken wollte. Es war ein gänzlich anderer Durst, mehr ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Gedanke, an dem er sich verzehrte.
Er sah die feuchte Rote Johannisbeere wie eine Perle in einer durchsichtigen Austernschale direkt vor sich. Nein, nicht in einer Auster – eher in einer bleichen Jakobsmuschel aus Marmor, wie sie nur von großen Künstlern in Carrara und Florenz aus dem Stein geschlagen werden konnte.
Sein gesamtes Verlangen konzentrierte sich auf die einzelne Johannisbeere in jener unerklärbaren Blase mitten in der steif gewordenen Luft um ihn herum. Mit rauer Zunge leckte er sich über seine längst ausgedörrten Lippen. Jetzt endlich hörte er etwas. Es klang wie knochentrockene Holzkohle, wenn sie schon heiß ist, aber noch keine Flammen zeigt. Gleichzeitig wusste er, dass es vorbei sein würde, sobald das Trugbild der kleinen roten Frucht vor ihm zerplatzte oder der Hauch des Feuers dem trockenen Knistern folgte.
Und plötzlich erkannte er in all der Qual den schmalbrüstigen Inquisitor. Orlando di Anagni war ein begnadeter Meister seines Fachs. Er wurde »Scintilla« genannt, weil er es schaffte, selbst aus den kleinsten Fünkchen eines Zweifels, den er nicht einmal selbst haben musste, eine lodernde Anklage der Ketzerei zu entfachen. Der hohlwangige, wie Bruder Tod wirkende Dominikaner, den nur die schwarzweiße Kutte samt der Kapuze aufrecht zu halten schien, hielt sich selbst eher für einen begnadeten Koch, für den einzelne Wörter die alles enthaltenden Zutaten und Schmerzenslaute die Gewürze waren. Er wollte ein magister coquine sein, der ein gebackenes Wild mit feinsten Schnitten zerlegen und so wieder zusammensetzen konnte, dass es auf den Servierplatten wie lebend aussah. Er war so feinschnittig in seinen Fragen und Einwänden, dass nicht einmal das Opfer selbst bemerkte, was ihm entlockt worden war.
»Zu viel, Smaragdus!«, stieß Bertrand de Comminges innerlich aufschreiend und tonlos hervor. Er wusste nicht einmal, ob das die Worte des Inquisitors oder seine eignen waren. »Du weißt zu viel von den Geheimnissen, dem wahren Schatz der Templer... du hast zu viel von Himmel, Hölle, von der Weisheit Salomos und des Allmächtigen entdeckt... und du musst alles beichten...«
»Nein!«, schrie er tonlos zurück. »Ich will und werde nichts verraten! Selbst wenn ich brennen sollte oder die Haut von meinem Leib gezogen würde... wie bei den Templern, die lieber starben, als zu reden!«
Zur selben Zeit hob ein breitschultriger und stolz wie ein König wirkender Mann den Kopf und schnupperte angewidert.
»Avignon stinkt!«, stieß er abfällig hervor. »Stinkt nach dem Kot der Sünder, die sich in dieser Stadt in ihrer Angst vor dem Ende der Welt zusammenrotten wie Ratten auf einem sinkenden Schiff. Stinkt einfach gotteslästerlich nach Lügnern, Heuchlern, Heidenpack und Juden!«
Er stand am halb geöffneten Fenster des päpstlichen Arbeitszimmers in dem erst kürzlich fertig gestellten Studierturm des riesigen Papstpalastes und beugte sich, so weit es ging, nach vorn. Direkt unter ihm lag der Garten, den sein frommer Vorgänger noch kurz vor seinem Ableben angelegt hatte. Dahinter sah er die flachen roten Dächer der Häuser, die nicht für den gewaltigen Bau gekauft und abgerissen worden waren. Der Papstturm mit seinem kleineren Anhang des Studierturms bohrte wie der Rammbug eines steinernen und überirdisch großen Schiffes vom Rocher des Domes herab bis fast in die Mitte der Altstadt. Für die Bewohner von Avignon und ihre Gäste konnte der neue Palast mit der Kathedrale an seiner Bergseite wie eine Arche Noah des christlichen Glaubens in einer bedrohten, versündigten Welt gelten.
Clemens VI. blickte bis zum breiten Band der Rhône hinab, die einen weiten Bogen um den zum Fluss hin steil abfallenden Kreidehügel und die Stadt an seiner Südflanke machte. Für ihn gab es noch eine dritte Deutung für das eigenartige, schon schmerzhaft unsymmetrische Bauwerk. Und plötzlich hatte er das Gefühl, nicht nur in einem Palast, sondern direkt über einer großen, geheimnisvollen Wunde in Fels und Gestein zu stehen, die sein Vorgänger, der fromme Papst Benedikt XII., und wahrscheinlich schon die beiden ersten Päpste der alten Stadt Avignon geschlagen hatten...
Zum ersten Mal, seit Pierre Roger de Beaufort vor siebzehn Tagen zum Papst gewählt worden war, konnte er unbeobachtet von Kardinälen und Bischöfen, Prälaten und Kammerdienern durchatmen. Es hielt weder von den einen noch von denen anderen besonders viel. Doch auch die Luft, nach der es ihn ohne die dichten Schwaden von Weihrauch in allen Räumen begehrte, taugte nichts mehr am neuen Sitz der Päpste.
Für einen Augenblick zweifelte er an seiner Entscheidung, die Wahl zum Oberhirten der Heiligen römischen Kirche anzunehmen. Aber sofort bat er Gott den Allmächtigen um Verzeihung für seine Schwäche und gelobte, fürderhin stark zu sein.
Er wusste, dass er dankbar und bescheiden sein sollte, denn eigentlich stammte er aus nicht sonderlich begütertem südfranzösischen Adel und hatte mehr erreicht, als selbst dem größten Kanzelredner zukam. Der gerade Einundfünfzigjährige war auf der Burg Maumont in Corréze geboren und schon in jungen Jahren als Novize bei den Benediktinern eingetreten. Sein Studium in Paris hatte er als Doktor der Theologie abgeschlossen. Zielstrebig und ohne Umwege war er Prior, Abt, Bischof von Arras, Erzbischof von Sens und dann von Rouen geworden.
Er war Kanzler des französischen Königs gewesen und stand noch immer in besten Beziehungen zum französischen Hof. Wie zur Bestätigung war der französische Kronprinz Johann mit einem Haufen von mehr als hundert Rittern und Edlen samt Gefolge direkt von den Kämpfen im Erbkrieg gegen die Engländer aus der Normandie nach Avignon gekommen. So viel Bestätigung setzte ein Zeichen für alle anderen Fürstenhöfe des Abendlandes, war aber gleichzeitig eine Bedrohung, die Clemens VI. keinesfalls dulden durfte.
Er wusste genau, was er tat, als er in diesem Augenblick gleich drei einsame Entschlüsse fasste. Zum einen wollte er ablehnen, zum großen Ehrenfestmahl zu gehen, das Kronprinz Johann am Sonntag außerhalb des Palastes veranstalten wollte. Zum anderen blieb er bei dem Verbot jeglicher Turniere in und um Avignon. Und zum dritten beschloss er, seinem Meister der Inquisition noch mehr Vollmachten zur Erforschung der Wahrheit über seinen neuen Palast zu geben.
Er war kein Schwächling, kein ängstlicher Beter und kein Geißler, der sich Wunden zufügen musste, um seine Angst vor dem Allmächtigen, der Hölle und dem Fegefeuer zu übertünchen. Gott war ihm bisher gnädig gewesen trotz all seiner Intrigen und schwerwiegenden Verfehlungen. Und doch war ihm die Wahl zum Hohepriester der Heiligen römischen Kirche einen Lidschlag am Auge Gottes zu schnell gekommen. Sie hatten ihn gewählt, obwohl gerade erst vier Jahre vergangen waren, seit ihn Benedikt XII. zum Kardinal und Kardinalpriester der Titularkirche der beiden Eunuchen und Märtyrer Nereo und Achilleo in Rom erhoben hatte.
Nicht umsonst hatte er sich sofort seinen eigenen Kardinalspalast auf der westlichen, der französischen Seite des Flusses erbauen lassen. In Villeneuve roch es noch nicht so sehr nach Urin, Schweiß und Überfüllung wie in Avignon. In gewisser Weise bedauerte er den Wechsel vom beschaulichen Luxus als Kardinal an die Spitze der Heiligen römischen Kirche.
Das Konklave nach Benedikts Tod, an dem nur siebzehn der neunzehn Kardinäle teilgenommen hatten, war schon nach zwei Tagen beendet worden, und nach der kurzen Sedisvakanz von vierundzwanzig Tagen bis zur Krönung trug er als bereits vierter Papst in Avignon die Tiara. Zu schnell und eigentlich zu unerwartet. Er hatte damit gerechnet, dass zwischen Benedikt und ihm ein Kardinal mit größerer Seniorität und einer starken Hausmacht in Paris und Rom gewählt würde. Vielleicht sogar der alte Mordbube und Drahtzieher Stefan Colonna, um damit zugleich auch die streitenden Familien in der Ewigen Stadt zu besänftigen.
Seine Wahl zum Pontifex maximus kam Clemens noch immer unwirklich vor, zumal er nie verhehlt hatte, was er von den anderen Kardinälen hielt. Darüber hinaus war durch ihre Entscheidung ein anderes Vorhaben, an dem er schon seit vielen Jahren arbeitete, wesentlich schwieriger geworden. Zu viele Augen und Ohren achteten jetzt ganz genau darauf, was er unternahm.
Er stöhnte leise, als er daran dachte, wie dicht er dem größten aller Geheimnisse seiner Vorgänger auf der Spur gewesen war. Gut sieben Jahre lang hatte er jeden Bauplan und jede noch so nachlässig hingeworfene Skizze des Baumeisters heimlich kopieren lassen. Viel hätte ihm nicht mehr gefehlt, um zu erkennen, welchen geheimen Plan Baumeister Pierre Fisch für den Palast von Avignon wirklich verfolgte. Denn dieser Mann war einfach nicht genial genug, um selbst die neue Festung der Christenheit zu ersinnen. Er und sein Auftraggeber Benedikt XII. mussten von Anfang an über ganz andere Quellen verfügt haben. Und über ein geheimes Wissen, das nur die Templer und vielleicht Eingeweihte in Avignon besessen haben konnten!
Clemens VI. konnte nur hoffen, dass er mit seiner Wahl zum Papst einen gewaltigen Schritt näher an den Nachlass und das Erbe der Armen Ritter vom Tempel Salomonis zu Jerusalem gekommen war. Jetzt ging es nur noch darum, die wilden lauten Jubeltage anlässlich seiner Krönung klug zu nutzen. Solange noch trunkenes Chaos auf den Straßen der Stadt herrschte, konnte er unentdeckt und unauffällig seinen Plan verfolgen.
»Maximal zehn Tage Zeit«, stieß er hervor, und seine Augen blitzten entschlossen. »Aber vielleicht auch nur noch drei bis vier, nach denen sich entscheiden wird, ob wir zu den klugen oder den törichten Jungfrauen gehören.«
Er schob die Lippen vor, nickte und dachte an den Mann, den er als Wächter für die Tage seines Triumphes und seinen großen Plan nach Avignon bestellt hatte.
»Zeig, was du kannst, Scintilla! Sei Funke für das Öl der Inquisition! Wir wollen, dass unsere Lampen mit dem Wissen der letzten Eingeweihten von Avignon gefüllt werden, auf dass endlich ein großer Papst über alle Könige und Fürsten dieser Welt leuchten und herrschen kann.«
Kapitel 2: Im Zeichen der Walnuss
Der Kantor erwachte aus seiner Erstarrung. Jedermann sah, wie sehr er zitterte. Er hatte noch die letzte, grausame Vertreibung aus dem Langue d’Oc miterlebt, als die Christen sogar ihre eigenen, getauften Glaubensbrüder auf den Scheiterhaufen verbrannten.
Zusammen mit dem Rabbiner schob er die wertvollen Schriftrollen in ihr reich verziertes Futteral. Dann drehte er sich wieder um, blickte zum dunklen Rauch unter der Kuppel hinauf, dann zum Haupteingang.
»Nicht durch das Tor der Sabbatbraut!«, rief er mit bebender Stimme. »Verlasst die Synagoge durch den Keller mit unserem alten Backofen für das ungesäuerte Brot... aber verschließt die Augen, Verstand und die Herzen vor allem, was ihr nicht versteht und nicht deuten könnt...«
Noch in seiner flehentlichen Beschwörung warf er einen verstohlenen Blick zum überall bekannten Fernhändler Seder Ben Ariel und seinem unter der Kappe blondgelockten Neffen Elias. Es war, als wünschte der Rabbi, dass diese beiden Männer niemals aus Andalusien in die heimatliche Provence zurückgekommen wären. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass er schon viele Jahre mit Rebecca, der Nichte Seders, eine der beiden älteren Zwillingsschwestern von Elias de Comminges, äußerst glücklich in Carpentras lebte.
Nur langsam löste sich die unheimliche Erstarrung unter den Gläubigen. Einige wollten noch immer in Richtung Portal tappen, andere blickten verstört am Rabbiner vorbei auf die kleine Tür, hinter der die Stufen zum uralten Ofen darunter begannen. Der Kellerraum war längst eine Art inneres Heiligtum und in vergangenen Zeiten auch ein geheimer Fluchtweg bis zur Rhône für die jüdische Gemeinde gewesen.
Einige Männer schienen zu glauben, dass der scharfe Geruch wie von verbranntem Brot von dort unten kam. Aber nur der Rabbi Moche Amar vom Rabbinat von Avignon, Carpentras und der Grafschaft Venaissin und seine beiden angeheirateten Verwandten ahnten plötzlich, was wirklich im Carrière, dem alten Judenviertel von Avignon, geschah.
Keine zwei alten Männer hätten unterschiedlicher aussehen können als die beiden Vogelscheuchen am Rand des ehemaligen Kleriker-Friedhofs vor der alten Stadtmauer. Der Gottesacker war nur auf seiner Nordseite in Richtung Stadtmauer noch gepflegt und prächtig. Der Südteil war bereits zu einem wildbewachsenen Friedhof der Allerärmsten verkommen.
Wie zumeist taten die beiden ungleichen Alten so, als beobachteten sie das Treiben zwischen den Gräbern, das bisher von allen Päpsten strengstens untersagt worden war. Nur der neue Papst hatte sich noch nicht zum Friedhofslustgarten geäußert.
Wer sie zum ersten Mal sah, hätte den knapp siebzigjährigen, noch immer schwarzbärtigen ehemaligen Waffenschmied Antonio Brazzi für jünger gehalten als den rothaarigen Priester Mel Comyn. In Wahrheit war er zehn Jahre älter. Brazzis bärtiges Gesicht verfügte über ebenso viele winzige Falten und Narben von glühenden Funken wie seine uralte glänzende Lederschürze, aber sowohl seine fleischige Nase als auch seine Lippen wirkten gesund.
Der andere dagegen sah wie ein halb verhungerter Eremit aus, der nach langer Fastenzeit gerade noch dem heißen Sand afrikanischer Wüsten entkommen war. Sein Gesicht unter den zerzausten roten Haaren wirkte straff, aber vollkommen eingetrocknet. Seine Nase war schmal, und seine durstigen Lippen schrien ständig nach einigen Tropfen aus seinem kleinen hölzernen Pilgerfässchen am Gürtel, um sie zu befeuchten.
Wie schon bei ungezählten Zusammentreffen in den vergangenen Jahren hockten sie mit gebührendem Abstand auf einer langen Steinbank zwischen den beiden Friedhofshälften. Vor ihnen plätscherte Wasser in die moosbedeckte Steinschale eines kleinen Vogelbrunnens. Er gehörte zur Grabanlage, die Kardinal Pierre Godin vor fast dreißig Jahren angelegt hatte. Die Gruft war leer geblieben, weil die Dominikaner den Leichnam ihres großen Inquisitors in ihr Kloster westlich der Stadt geholt hatten.
Die beiden alten Männer zählten zu den wenigen Eingeweihten, die das Geheimnis des Vogelbrunnens vor dem leeren Grab des Kardinals kannten. Sie kümmerten sich nicht darum, was Tag und Nacht hinter den Friedhofshecken geschah. Nur an den Freitagen vor dem letzten Sonntag im Monat fühlten sie sich verantwortlich für die winzigen Schiffchen, die sie selbst ins Wasser des Vogelbrunnens gesetzt hatten. Kein Unbefugter sollte sich im Vorbeigehen eine der leeren Walnussschalen nehmen dürfen. Genau dafür hielten sie Wacht.
»Drei leere Walnussschalen diesmal«, sagte Mel Comyn mit einem Blick auf das plätschernde Nass. »Getrocknet, damit sie lange im Wasser schwimmen können.«
»Und mit dem Rillenmuster, das es nur von einem einzigen Baum in der ganzen Provence gibt...«
»Das Kreuz im Herzen«, flüsterte der Schottenpriester andächtig, doch ohne seine Lippen zu bewegen. »Vom Walnussbaum im Hof der Templer-Komturei. Und für die Eingeweihten sogar der Plan der rechten Wege durch die Katakomben unter dem Rocher des Domes.«
»Vor vielen Jahren mitgebracht und immer weiter gezüchtet durch die Ritter vom Tempel Salomonis«, bestätigte der Schmied. »Aber schon bei den Griechen als Speise der Götter berühmt.«
»Ohne die echte Schale mit den einmalig gewachsenen Einkerbungen vom Baum im Fondaco vorzuzeigen, darf mittlerweile niemand mehr an einem Cour d’Amour teilnehmen.«
»Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob Elena zuerst auftaucht oder ob die Hunde des Herrn vorher zubeißen...«
Es roch nach Rauch, beißendem Rauch, der nicht von Herden, Spießbraten oder gar Scheiterhaufen stammte.
Der neue Papst lachte trocken. Da stand er nun und hatte mehr erreicht als alle seine Neider. Hinter sich und nur durch einen schmalen schrägen Gang mit dem studium verbunden wusste er den gewaltigen quadratischen Papstturm mit seinen fünf Stockwerken, durch den Benedikt XII. sich ein fast schon gotteslästerliches Denkmal gesetzt hatte. Auch die gewaltigen Gebäuderiegel, die den Turm mit dem alten Kloster und den Neubauten über dem ehemaligen Bischofspalast bis zur Kathedrale von Notre Dame verbanden, waren das Werk seiner Vorgänger Benedikt XII. und Johannes XXII.
Clemens VI. beobachtete, wie die Abendsonne die langgestreckte Insel zwischen den beiden Flussarmen der Rhône in sanft glühendes Licht tauchte. Für einen Augenblick kam es ihm vor, als brenne die Insel, ja selbst das Wasser im Fluss. Dabei kam der stinkende Rauch nicht von dort, sondern eindeutig aus dem Judenviertel. Er knurrte und wischte den Gedanken beiseite. Er kannte sich noch nicht aus an der neuen Stätte seines Wirkens, aber es war schon eigenartig, welche Empfindungen und sogar Trugbilder ihn in den zwölf Tagen überfallen hatten, die er im neu erbauten Palast von Avignon lebte. Ganz gleich, ob er in den großen Sälen oder in den kleinen, von Künstlern aus Siena ausgemalten Kapellen weilte – stets schien ihn irgendetwas in den bunten Fresken zu narren. Es war, als wären überall grinsende Teufel und kleine Dämonen versteckt, die sich sofort den Blicken entzogen, wenn man sie genauer als aus den Augenwinkeln suchen wollte.
Papst Clemens VI. presste die Lippen zusammen. Er würde noch mehr Härte und Kraft zeigen müssen als bisher, wenn er sich in den Schuhen von Petrus, dem Fischer, und als Stellvertreter Christi auf Erden beweisen wollte.
Der große Mann in seiner weißen Soutane spitzte die Lippen, dann spuckte er durch das Fenster aus dem Studierturm. Sogleich fühlte er sich besser. Er hatte befohlen, jene Männer in den Palast zu holen, die nicht zu den Klerikern der Kurie und doch zu den Geheimnisträgern der vorangegangenen Päpste gehört hatten. Er wollte sie befragen lassen – einen nach dem anderen. Er war kein Dominikaner wie der erste Papst in Avignon, auch kein Zisterzienser wie sein Vorgänger, sondern Benediktiner.
Genau deshalb hatte er den besten und gnadenlosesten von allen Inquisitoren herangeholt. Er kannte ihn bereits aus seiner Zeit als Kardinal mit Wohnsitz in Villeneuve-les-Avignon. Er hätte auch direkt die Dominikaner über ihren Ordensgeneral mit der Suche nach den richtigen Antworten beauftragen können. Aber er befürchtete, dass die »Hunde des Herrn« in wenigen Tagen Folter und Inquisition statt der Wahrheit über die Geheimnisse der Templer und des Palastes nur das Leben aus den vermutlich mehr oder weniger Eingeweihten herauspressen würden.
Orlando di Anagni war von ganz anderer Qualität. Der in mehreren Sprachen belesene Mönch hatte sich als mitleidloser Rezensent großer Dichter wie Dante und Petrarca einen Namen gemacht. Seine Fragen und Geistesblitze konnten Gerechtigkeit bewirken oder das Tor zur Hölle öffnen.
Das ursprünglich für die Verhöre der Dominikaner vorgesehene Palais von Kardinal Pierre Godin hatte der fromme Papst Benedikt XII. abreißen lassen, als er seinen eigenen Palast zu bauen begann. Angeblich brauchte er den Platz ebenso wie den von vielen anderen Häusern an der flachen Südflanke des Rocher des Domes. Clemens VI. hatte sich noch keine großen Gedanken darüber gemacht. Ihm war aufgefallen, wie weit entfernt Godins Palast vom eigentlichen Bauplatz gestanden hatte. Selbst mit einem doppelt so großen Festungsbauwerk hätte das abgerissene Palais stehen bleiben können. Auch das gehörte zum bisher unerklärbaren Erbe seiner Vorgänger, das ihn von Anfang an beunruhigt hatte.
Clemens war lange genug Kanzler des Königs von Frankreich gewesen. Er kannte die Gefahren und Bedrohungen, die von der Eigensinnigkeit und sturen Unvernunft der eigenen Ritter und Barone ausgehen konnte. Frankreichs König Philipp VI. hatte bei den Abwehrschlachten gegen die Engländer mit ihren Bogenschützen und den walisischen Messerbauern bitter erfahren müssen, was geschah, wenn jeder machen konnte, was er wollte. Zu viele Edle Frankreichs waren einfach davongeritten, statt zu kämpfen.
Der neue Papst war fest entschlossen, bei seinen eigenen Fürsten mit aller Härte durchzugreifen. Nur so konnte er verhindern, dass in seinem Hofstaat Feuertöpfe ausgelegt und unbemerkt gezündet wurden. Dazu gehörte auch, dass er so schnell wie möglich Licht in das geheimnisvolle Dunkel der letzten drei Jahrzehnte in Avignon brachte.
Er lächelte mit zusammengepressten Lippen. Vielleicht war es ja ein gutes Omen für ihn, dass sein neuer Inquisitor Orlando di Anagni den gefürchteten Beinamen »Scintilla« oder auch »Funke« trug. Benedikt XII. hatte in seinem Palast keine Verhörkeller vorgesehen.
Clemens empfand plötzlich das Bedürfnis, sich jene Räume anzusehen, in denen sein Inquisitor arbeiten sollte. Für die dringendsten Befragungen hatte Scintilla gleich nach seiner Wahl Kellerräume im noch nicht fertigen Nordostturm des Palastes sperren lassen. Direkt neben dem Latrinenturm und dem Küchenturm wurde Tag um Tag schreiendes Vieh geschlachtet, gebraten und gekocht, Wein ausgegeben, Brot verteilt und ziemlich laut mit Töpfen, Pfannen und gewaltigen Geschirrplatten hantiert. Eine gute Umgebung für Befragungen, bei denen es ebenfalls Lärm und Geschrei geben konnte...
Clemens beschloss, danach noch einmal in die Kathedrale Notre Dame des Domes gehen, in der seine beiden Vorgänger Johannes XXII. und Benedikt XII. beigesetzt worden waren. Die alte Bischofskirche von Avignon befand sich zwischen dem neuen Papstpalast und dem Kreidefelsen, auf dem bereits die Römer eine Festung über dem Fluss und die Gallier auf der anderen Seite errichtet hatten.
»Also los dann!«, sagte er halblaut. »Du, Clemens, kannst die Schuhe des Fischers nur tragen, wenn du in ihnen gehst.«
»Das ist nun endgültig die Strafe für deine Vermessenheit, Smaragdus!«, wollte er herausschreien, obwohl er nicht in der Lage war, seine Zunge und auch nur die Lippen zu bewegen. »Jetzt haben sie dich doch noch zu ewigen Höllenqualen verdammt...«
Bertrand de Comminges bemerkte, dass er sich wieder mit dem Namen nannte, der ihn schon vor seiner Ankunft in Avignon vor vielen Jahren gezeichnet hatte. Smaragdus – das zehnjährige Kind, das einst einen fliederfarbenen Amethyst im Ring eines Bischofs nicht von einem lichtgrünen Smaragd unterscheiden konnte!
Auch jetzt wusste er nicht mehr, ob die Bilder vor ihm real waren oder bereits himmlische Visionen wie auf den Bildern der italienischen Künstler, die er viele Jahre lang ebenso gehandelt hatte wie gefälschte Reliquien und für alle Laien verbotene Bücher wie das Alte und das Neue Testament.
In den wie aufwärts fließendes Wasser lodernden Flammen sah Bertrand ein Inferno, in dem die Verdammten mit ihren Zungen an den Feuerbäumen der Hölle hingen, Unbußfertige in Feueröfen verschmorten und Ungläubige in Schwaden aus Schwefel und stinkendem Rauch erstickten.
Der illegitime Sohn des ersten Papstes in Avignon bezweifelte nicht, dass er nunmehr den Tod erleiden und danach wie die Mehrheit aller Menschen auf ewig schmoren musste. Schon der große Kirchenvater Augustinus hatte gesagt, dass nur wenige gerettet, viele aber verdammt sein würden.
Doch warum sah er Feuer, das sich wie aufsteigendes Wasser bewegte? Verbarg sich in den Flammen ein ganz anderes Bild, eine andere Erinnerung?
Seit er von Häschern der Inquisition verfolgt mit neunzehn Jahren zum ersten Mal nach Avignon gekommen und von Juden aus dem Hochwasser der Rhône gerettet worden war, wusste er, dass sein Leben fortan wie das Zünglein an der Waage zwischen den Welten des Glaubens und des Geldes hin und her pendeln würde.
»Geh nach Avignon, falls der letzte Großmeister der Templer brennen sollte«, hatte ihm sein Lehrer, der große Meister Eckhart, damals aufgetragen. »Und füge dort aus den Botschaften über den gleichen Zeichen in drei verschiedenen Steinen wieder ein Ganzes zusammen. Das erste Zeichen im Stein stammt vom Vater, das zweite wird vom Sohn bewahrt und das dritte hat seine Kraft aus dem Heiligen Geist! Nur wenn du schneller bist als der Tod und die Dämonen aus der Unterwelt, kannst du das Geheimnis der Armen Ritter Christi vom Tempel Salomonis zu Jerusalem retten...«
Wie jung und naiv war er damals gewesen! Und wie viele neue Aufgaben waren in all den Jahren hinzugekommen, nachdem er die ersten, noch ganz einfachen Schlüssel zu den Schätzen und den großen Geheimnissen der Templer gefunden hatte. Zu den Zeichen im Stein waren weitere Symbole gekommen, die entschlüsselt werden mussten: Goldene Rosen mit mechanischen Deckeln über Duftkissen und Blütenblättern, die das Zeichen des Drudenfußes, des teuflischen Pentagramms, ergaben. Dazu kaum verhüllte Hinweise auf die Wege ins Paradies und zur Weisheit Gottes in der jüdischen Thora, im Koran, in arabischen Dichtungen und in der »Göttlichen Komödie« von Dante.
Sogar vor dem letzten, entscheidenden Mosaiksteinchen war er in Spanien nur einen winzigen Schritt entfernt gewesen: vom Original des Buches mit dem Titel »Spiegel der einfachen, vernichteten Seelen, die nur im Wunsch und in der Sehnsucht nach Liebe verharren«. Er hatte gesehen, wie die Verfasserin Marguerite Porète als Relapsa, eine rückfällige Ketzerin, anno 1310 in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war...
Er war Christ geblieben wie Bertrand de Goth, sein leiblicher Vater, der sich nach seiner Wahl zum Papst den Namen Clemens V., der Nachsichtige, gegeben hatte. Es hatte ihn nur noch wenige Tage vor seinem qualvollen Tod gesehen. Inzwischen war er längst davon überzeugt, dass sein Vater ebenso wenig wie seine drei Vorgänger von Gott dem Allmächtigen abberufen worden, sondern durch mörderische Intrigen umgekommen war.
Feuer und Wasser.
Seit seiner letzten großen Reise mit dem Poeten Francesco Petrarca nach Neapel und Rom wünschte Bertrand de Comminges nichts anderes mehr, als dass sich seine eigene Sehnsucht nach Liebe doch noch erfüllte. Viele Jahre lang hatte er sich damit abgefunden, dass er von seiner zweiten Ehefrau Catherine verlassen worden war. Doch dann war er auf den Gedanken gekommen, dass unter den Schätzen der Ritter vom Tempel Salomos vielleicht auch die richtigen Hinweise aus dem Hohelied zu finden waren, die bisher nur die Troubadoure zu kennen schienen. Immerhin sollte der legendäre König nicht nur die Weisheit Gottes, sondern auch magische Fähigkeiten sowie siebenhundert Hauptfrauen und dreihundert Nebenfrauen gehabt haben.
Vielleicht entdeckte er ebenfalls das Geheimnis der Liebe und konnte dadurch Catherine zurückgewinnen.
Nur eine Hand voll Menschen außer ihm wussten, wo der Schatz und das Wissen der Templer und König Salomos verborgen waren. Monsignore Mel Comyn gehörte dazu, der alte Tonio Brazzi, Seder Ben Ariel und dann diese verruchte Tochter eines Seeräubers, die eines Nachts das gemeinsame Ehebett verlassen hatte und mit ihren beiden Söhnen auf ihre Felsenburg Monaco zurückgekehrt war. Eigentlich hatten Bertrand und die anderen bereits vor Jahren beschlossen, nicht weiter in die Katakomben im Rocher des Domes vorzudringen. Anschließend hatte er damit begonnen, ein riesiges Grabmal des Vergessens über dem errichten zu lassen, was er noch immer »Das Kreuz im Herzen« nannte.
Doch dann war der letzte, der stille und fromme Papst Benedikt gestorben, der nicht nach ihrem Templerwissen gefragt hatte. Der neue Pontifex maximus hatte keine Stunde gezögert. Unmittelbar nach seiner Krönung war die Aufforderung an Bertrand de Comminges ergangen, sich am fünften Tag vor der Inquisition zu verantworten, um sein gesamtes Wissen vor Gott zu offenbaren.
Nicht mehr und auch nicht weniger.
Es hieß, der Heilige Vater wolle noch vor dem Ende der Krönungsfeierlichkeiten über alle Einzelheiten informiert sein, um den in Avignon erschienenen Delegationen entsprechende Forderungen und Ansprüche für ihre Signorien, Fürsten und Könige mitzugeben.
Bertrand stöhnte verzweifelt auf.
War er bereits befragt, verhört und gefoltert worden? Hatten sie ihm krügeweise gallig brennenden Kräutersud zum Lösen der Zunge und seines Widerstandes eingetrichtert? Wo war er gewesen, ehe die Flammen auftauchten?
Nein, nicht im Handelshof in der Rue St. Agricol, den inzwischen sein Sohn Elias führte. Auch nicht in Carpentras bei seinem Schwager Seder Ben Ariel oder seiner Tochter Rebecca. Nicht in Villeneuve-les-Avignon auf der anderen Seite der Rhône in einem der Palais, die sich einige der Kardinäle mit seiner Hilfe und den Beziehungen zu den besten Herstellern von Möbeln und Gemälden, Tuchen und Wandteppichen in Florenz und Flandern eingerichtet hatten.
Wo aber dann?
Er hatte plötzlich das Gefühl, als müsse er sofort und augenblicklich aufhören zu denken, wenn er nicht sterben wollte. Jeder weitere Gedanke konnte ihn verraten. Und zugleich der letzte sein, den er durch den neuen Papst noch hatte.
Elias de Comminges und sein Onkel Seder Ben Ariel standen mitten unter den anderen Männern der jüdischen Gemeinde, die sich, dem Kantor folgend, zur Kellertreppe drängten. Während die meisten Männer im Rund der Synagoge ergeben warteten, bis sie dran waren, sahen sich die beiden kurz an. Sie konnten sich nach all den gemeinsam verbrachten Jahren in Spanien auch ohne große Worte verständigen.
»Du denkst, was ich denke?«, fragte Elias dennoch. Seine Stimme klang hart und hell.
»Wir hätten in Carpentras zum Gebet gehen sollen«, knurrte der gut fünfzigjährige Jude zustimmend. »Oder gar nicht erst aus Spanien zurückkehren...«
»Das beklagst du schon seit einem Jahr«, antwortete sein jüngerer, auffällig blondhaariger Begleiter, »seit dem Tag, an dem wir wieder aus Córdoba zurück sind.«
Er trug keinen Spitzhut, sondern ebenso wie der Ältere eine bestickte braune Kappe, wie sie im Ghetto von Córdoba üblich war. »Wir müssen raus... komm schnell, es wird zu eng an der Kellertreppe. Lass uns die große Pforte nehmen!«
Ohne zu zögern, wandte der Blonde sich ab und lief zum Haupteingang der Synagoge. Sein Onkel wollte ihn aufhalten, konnte ihn aber nicht mehr erreichen. Mit einem Ruck riss der Jüngere das große Portal auf. Die beiden unvorsichtigen Männer taumelten nach draußen. Vor ihnen auf der kleinen Place Jerusalem rannten Menschen in Gruppen nach allen Seiten auseinander.
»Da brennt schon wieder ein Haus!«, stieß eine junge Frau auf den Stufen vor der Synagoge aus.
»Wie oft denn noch in dieser unheiligen Stadt?«, kreischte eine andere. Elias und Seder sahen sich an. Ohne ein weiteres Wort stürzten sie aus der Synagoge – hinein in den Pulk kreischender Menschen, die schon seit Tagen die ganze Stadt verstopften. Sie fraßen und soffen, prügelten und stahlen. Sie waren auf Beute aus.
Es war die Hölle nach dem Pfingstfest. Die große, schon seit dreißig Tagen andauernde Feier zum Abschied des frommen und aufrichtigen Papstes Benedikt XII. und zur Inthronisation des neuen Heiligen Vaters mit dem Namen Clemens VI. hatte die gesamte Stadt in einen nicht mehr endenden Strudel gestürzt.
Papst Clemens VI. verließ das kleine, heimelige Studierzimmer im Türmchen, das im Nordwesten wie ein mehrstöckiges Nest an den großen Papstturm angefügt war. Hier kam der Lärm der Stadt auf der anderen Seite nur wie ein fernes Rumoren an. Auch die dudelnde französische Musik der Drehleiern von der großen Insel im Fluss klang eher wie ein Spiel des Windes.
Wie stark die Mauern seiner neuen Residenz tatsächlich waren, wurde Clemens wieder bewusst, als er sechs Schritte benötigte, um durch den schmalen Durchbruch bis in sein Gemach innerhalb des großen Turms zu gelangen.
Dort warteten bereits zwei Würdenträger, die inzwischen für ihn besonders wichtig waren. Kardinal Jean-Raymond de Comminges war Erzbischof von Toulouse, Bruder jener adligen Dame, mit der der erste Papst in Avignon einen Sohn gezeugt hatte, und zweimaliger Träger der Goldenen Papstrose. Der strenge Kirchenmann und unnachsichtige Verfolger aller Ketzer in seiner Diözese war von Johannes XXII. zwar ausgezeichnet, aber zugleich aus Avignon verbannt worden. Dem neuen Papst erschien der nach unten harte und nach oben geschmeidige Kirchenfürst eine ideale Besetzung als »Meister des Palastes«.
Der zweite Kirchenmann im Papstgemach war das auffällige Gegenteil des Kardinals. Johannes de Coiardano, der leutselige Bischof von Avignon, kannte sein Land und seine Schäfchen. Er war auch für die Gelder des verstorbenen Papstes ein kluger und zugleich vorsichtiger Thesaurar gewesen. Clemens bemerkte sofort eine eigenartige Spannung zwischen den beiden. Ihm war, als wüssten sie, dass sie sich brauchten, aber einander nicht vertrauen konnten.
»Zehn Jahre lang«, sagte der Kardinal, der inzwischen zum Subdekan des Heiligen Kollegiums aufgestiegen war, »zehn Jahre lang habe ich mich von diesem weltfremden Müllersohn Benedikt wie ausgestoßen und exkommuniziert gefühlt. Er war für nichts zugänglich, keinen Ablasshandel, keine Erhöhung der Abgaben und nicht einmal für ordentliche Gebühren bei den Benefizien.«
»Dann ist jetzt auch für dich die Zeit der Lese im großen Weinberg des Herrn gekommen«, meinte Clemens VI. mit einem feinen Lächeln. Es klang wie ein großzügiges Angebot der Teilhabe. »Wir wollen schnell dafür sorgen, dass die Dekade völliger Verarmung des Heiligen Stuhls zu Ende geht und möglichst viele zuverlässige Männer aus unseren Familien den Gläubigen einpauken, was mit Römer 13, Vers 7 wahrhaftig gemeint ist.«
»So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid«, mischte sich beinahe vergnügt der Schatzmeister ein, »Steuer, wem Steuer gebührt; Zoll, wem der Zoll gebührt; Furcht, wem die Furcht gebührt, und schließlich Ehre, wem Ehre gebührt.«
Der Heilige Vater schob die Lippen vor. Die Worte des Thesaurars schienen ihm vorzüglich zu schmecken.
»Und uns von alledem mehr als jedem weltlichen Fürsten«, sagte er, und seine Augen blitzten genüsslich. Für eine Weile hingen alle ihren Gedanken nach. Es war, als wüssten sie, dass es die gleichen waren.
»Wir wollten eigentlich ein paar Schritte allein gehen«, sagte der Papst nach kurzem Überlegen. Dann aber legte er einen Finger an die Lippen und musterte den rundlichen Schatzmeister. »Aber zuvor sollten wir vielleicht erstmals in deine Hölle des schnöden Mammons in diesem Turm hinabsteigen, Johannes... oder hättest du Bedenken gegen eine derart unerwartete Visitation?«
Kardinal de Comminges hob erwartungsvoll die Brauen. Er öffnete den Mund und schien nur darauf zu warten, wie sich der Bischof aus der Schlinge zog. Der aber nickte freudig.
»Mein kleiner Krämerladen kann jederzeit besichtigt werden.«
Kapitel 3: Der Papst im Turm
»Der wahre Tempel Salomos ist seit der babylonischen Verbannung des Volkes Israel verloren«, hörte Bertrand seinen Vater mit leiser Stimme sprechen. Das war vor mehr als achtundzwanzig Jahren gewesen. Er tupfte ihm mit einem weingetränkten Wollbausch die faltigen Lippen ab. Sie wussten beide, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Papst Clemens V. würde es nicht mehr bis zur Kirche von Uzerzes schaffen, in der er begraben werden wollte. Sie hatten die Sänfte mit seinem vom Krebs oder auch Gift zerfressenen Leib heimlich in der Nacht aus dem Palais des Bischofs herausschaffen und über die Brücke nach Frankreich bringen können. Aber auch hier war der Heilige Vater nicht sicher. Wohl oder übel hatte Bertrand daher entschieden, dass die kleine Prozession nicht direkt über Nimes und Montpellier ziehen, sondern einen Umweg nach Norden machen sollte.
Er wusste, dass sie nicht weit kommen würden. Niemand in ihrer Begleitmannschaft hatte noch Hoffnung.
»Der Tempelberg ist ebenfalls verloren«, sagte der sterbende Papst. Er hielt die Augen geschlossen, doch seine Augäpfel bewegten sich unter den beinahe durchsichtigen Lidern. »Jerusalem und das Heilige Land gehören wieder dem Halbmond... und den ungläubigen Sarazenen...«
Bertrand richtete sich erstaunt auf, als er das Wort hörte. Jeder Moslem in Frankreich, in der Provinz oder im Süden Spaniens sah eine Beleidigung in der verächtlichen Bezeichnung für alle Ungetauften aus Nordafrika und dem Orient.
»Wir haben überall verbreitet, dass die Armen Ritter vom Tempel Salomonis zu Jerusalem trotz ihrer Größe, ihres Geldes und aller Besitztümer von Schottland bis nach Sizilien nutzlos geworden seien«, sagte Clemens V. mühsam. »Doch das ist nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit waren sie eine ungeheure Gefahr!«
»Das alles mag ja sein, aber das berechtigte König Philipp von Frankreich nicht, diesen großartigen Ritterorden in einer Nacht- und Nebelaktion vor sieben Jahren einfach auszulöschen.«
Der alte Mann schob schon fast vorwurfsvoll die Lippen vor. »Sie hätten überleben, bekennen und zu den Johannitern übertreten sollen!« Ein schwaches Husten hielt ihn auf. »Ich selbst habe dem Großmeister Jacques de Molay angeboten, ihn und den Orden freizusprechen... von allen Beschuldigungen der Blasphemie, Sodomie und der Verehrung des Götzensymbols Baphomet...«
»Das ist doch geschehen, nach dem jahrelangen Prozess.«
»Ja«, sagte der todkranke Papst. Seine Kiefern arbeiteten, als würden sie immer noch an etwas kauen. »Doch Molay war ein echter Templer. Männer wie er haben sich schon im Königreich Jerusalem lieber bei lebendigem Leib die Haut vom Leib ziehen lassen, als ihr Geheimnis zu verraten. Auch die Ketzerin Marguerite Porète wählte als eine der wenigen Wissenden den Flammentod auf dem Scheiterhaufen.« Er schnaubte leise, ehe er fortfuhr. »Die Porète wollte nicht widerrufen, obwohl sie schon einmal all ihre Sünden bekannt hatte. Und Molay, dieser Starrkopf, verhielt sich ebenso wie diese Relapsa, als er bereits Gestandenes dann doch noch leugnete.«
»Ich verstehe deinen Zorn, Vater«, sagte Bertrand. »Rückfälligkeit von Ketzern ist nun einmal das schlimmste aller Vergehen, für das es nur noch den Tod als Sühne gibt.«
»Kein Zorn, mein Sohn, nur Enttäuschung...«
»Ich denke, der Großmeister der Templer musste sterben, weil er bei seiner Weigerung blieb, die Templer mit den Johannitern zu vereinen und alles Eigentum auf den anderen Orden zu übertragen.«
Der alte Papst lachte abfällig. »Ach, Bertrand! Darum ging es doch zu keinem Augenblick!«
Die Stimme des Papstes hatte plötzlich einen empörten, fast schon strafenden Ton. Bertrand wartete geduldig, aber sein Vater verschluckte alle weiteren Erklärungen. Es war, als würde er die ganze Zeit mit einem unsichtbaren Gegner in seinem Kopf und seiner Seele kämpfen.
»Trotzdem verstehe ich nicht, warum du deine Macht als Papst und Schirmherr des Ordens nicht eingesetzt hast«, sagte Bertrand schließlich. »Wer sonst, wenn nicht diese im Kampf gegen die Heiden geübten Ritter und Mönche hätten dein stärkstes Schwert werden können?«