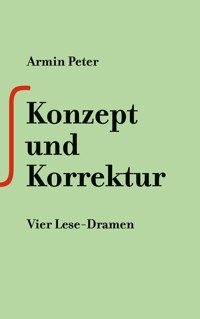Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die demokratische Öffentlichkeit macht sich nicht recht klar, dass primär rund eine Million Mitglieder der Parteien die Gatekeeper aller Parlamente sind und erst in zweiter Linie die Wählenden. Der Weg vom Artikel 21 des Grundgesetzes - "Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit" - zum Staatsamt "Der Bundeskanzler" (Art. 63) ist uns nicht immer bewusst. Wer ist vertraut mit den Nominierungspfaden im Vorfeld von Parlamentswahlen? Sie werden farbig beleuchtet und in vielen Episoden anschaulich geschildert von einem Verfassungspatrioten. Wer nicht Mitglied einer demokratischen Partei ist, könnte durch das Buch eines langjährigen Parteimitglieds angeregt werden, über einen Beitritt nachzudenken. Wer bereits Parteimitglied ist, findet gewiss Erfahrungen, die er teilt, oder Ansichten, denen er widerspricht. Auf jeden Fall gilt die Überschrift eines Kapitels in der Mitte des Buches: "Der Parteibürger platziert den Kanzler."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Eine Schlüsselszene
Ein halbes Jahrhundert dabei – warum?
Typen des Mittendrin
Die Guten ins Töpfchen
Gatekeeper der Parlamente
Nicht jedes Jahr ist Willy-Jahr
Hospitant im Parteienbetrieb
Parteilicher Dreiklang: Meinung, Wille, Wahl
Helle Köpfe für die Parteien: Macht hoch die Tür
Kipppunkte
Persönlich informiert, menschlich motiviert
Der Parteibürger platziert den Kanzler
„Mann der Arbeit, aufgewacht“
Der demokratische Plusfaktor
Exkurs: Dem neuen Mitglied auf der Spur
Im Aktivstatus
Die Bürgerführer
Die Langlebigkeit der Worte
Democracy light
Beinfreiheit – wer tritt wen?
Vom Rang der Parteiverfassung
Wahlkampf mit Störfeuer
Das Privileg der Parteibürger
Eine Schlüsselszene
Als Olaf Scholz nach dem mörderischen Überfall der Russen auf die Ukraine die „Zeitenwende“ sah und 100 Milliarden Euro locker machte, um die Bundeswehr vor der Ohnmacht und sein Land gegen künftige imperiale Frechheiten zu sichern, dachte Pitt an die 100 Tausend Euro, die derselbe Mann, fast dreißig Jahre jünger, locker gemacht hatte, um ihn aus einer bedrohlichen Lage zu retten.
Wie das?
Natürlich hat er das Geld nicht „locker“ gemacht, um jemand aus Menschenliebe zu helfen, und es war auch nicht sein Geld, das er darangeben wollte, Pitt aus den Spannungen, in denen er lebte, zu befreien. Auf Motive kommt es überhaupt nicht an, immer kommt es auf die Wirkungen einer Entscheidung an. Jedenfalls im politischen und wirtschaftlichen Leben. Der junge Olaf Scholz war damals schon ein Politiker, der sich in seiner Partei die ersten Startlöcher gegraben hatte, und beruflich war er Syndikus eines Verbandes, in dem es um wirtschaftliche Interessen ging.
Der junge Justitiar Scholz und Pitt, der Geschäftsführer eines kleinen, zu einer großen Genossenschaftsgruppe gehörenden Verlages, waren Sozialdemokraten. Doch mit der gemeinsamen Parteimitgliedschaft hatte der Einsatz eines trotz seiner Jugend profilierten Anwalts für einen gescheiterten Geschäftsführer nichts zu tun.
Nur vom Hörensagen kannten sie sich. Pitt hatte den Karrierestart des Jungsozialisten gesehen, und Scholz kannte ihn, einen Pressesprecher, als den Hiobsboten aus den Medien, die das kritische Protokoll des Scheiterns der großen, traditionsreichen co op Handelsgruppe geliefert hatten. Das musste den Justitiar interessieren, denn der Verband, für den er tätig war, hatte einen kleinen Kern nach wie vor erfolgreicher Konsumgenossenschaften wie auf der Warft einer Hallig abgeschottet gegen die Sturmfluten, in dem der größere Teil der Gruppe untergegangen war.
Den politischen Start des Jungsozialisten Olaf Scholz hatte der zwanzig Jahre Ältere schon aufmerksam verfolgt. Der junge Hamburger war in der Juso-Leitung regional und bundesweit aufgefallen, nicht zuletzt durch eine wortstarke antikapitalistische Stimmungsmache, die Pitt gar nicht gut gefiel, hatte sich dann jedoch aus den Tumulten, in denen er sich einen Namen gemacht hatte, zurückgezogen, sich auf sein Studium der Rechtswissenschaften konzentriert und in lokaler Kärrnerarbeit für die Partei das Ein-Meter-Brett für den Sprung ins tiefere Wasser gebaut, mit dem man anfangen muss, wenn man einmal aus zehn Metern Höhe vom Turm springen will. Und das wollte er sicherlich, immer, mit Hilfe seines einzigen Kapitals, des Intellekts und des Muts.
Pitt arbeitete in Frankfurt, hatte aber lange in Hamburg gelebt, war dort in die Partei eingetreten, und zwar im größten Hamburger Kreis, in Wandsbek, und dort hatte er aus der Distanz noch viele Kontakte. Der junge Olaf Scholz wurde von den Genossen in den Gremien der Wandsbeker Sozialdemokraten, zu denen auch Pitt einmal gehörte, nicht sehr geliebt, denn er galt als Radikaler, und die Älteren haben manchmal Schwierigkeiten, der Jugend das Recht auf Radikalität zuzugestehen. Pitt hörte von Hamburger Genossen amüsante Geschichten über die Anträge, die Scholz & Friends einbrachten und die unter Getöse in dem Parteikreis unter dem Vorsitz eines Majors der Bundeswehr abgelehnt wurden.
Pitt hatte noch einen zweiten Grund, das Wirken des jungen Genossen zu beobachten. Der Syndikus Scholz war schon vor seiner Tätigkeit im Verband Partner einer auf das Arbeitsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei, die er nach seinem Studium etabliert hatte, um sich seine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu sichern. Denn politische Karrieren beruhen, wie alle, nicht nur auf Können, sondern auch auf Konstellationen, die wenig planbar sind. In Pitts Unternehmen, einem Konzern mit fünfzigtausend Beschäftigten, gab es natürlich immer wieder mal arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, die den Arbeitgeber auch vor Hamburger Arbeitsgerichte führten. Es gab an der Konzernspitze einen Rat an die Personalleiter der Tochtergesellschaften: „Klagt nicht in Hamburg. Dort verliert ihr immer.“ Das lag auch an Kanzleien wie die von Scholz und Partnern, die Arbeitnehmerrechte überaus erfolgreich vertraten.
In dieser Woche im April 1993 ging es in Hamburg nicht darum, dass der Anwalt Scholz Arbeitnehmerrechte verteidigte, sondern er war Vertreter eines Arbeitgebers, eben seines Verbandes. Und Pitt war nicht schützenswerter Arbeitnehmer, sondern Geschäftsführer eines kleinen Verlages, der um seinen Kopf und einiges mehr bangen musste. Ein bisschen verkehrte Welt aus der Sicht beider Manager, die als Arbeitnehmer in Leitungsfunktion Kollegen waren .
Die Causa war etwas kompliziert, kann aber auf einen Kern gebracht werden. Der Genossenschaftsverlag war durch den von strafrechtlichen Vorwürfen begleiteten Zusammenbruch des Konzerns, in den er wirtschaftlich integriert war, in krasse Liquiditätsnot geraten. Pitt hatte als nebenamtlicher Geschäftsführer zusammen mit einem hauptamtlichen Kollegen bewusst (vorsätzlich, sagen die Juristen) versäumt, beim Hamburger Amtsgericht Vergleich oder Konkurs anzumelden, weil er Fakten nicht als unumstößlich angesehen hatte. Damals gab es für Insolvenzen noch Gesetze, die unbarmherziger waren als in unserer Zeit, in der man versucht, ein Unternehmen auf der Intensivstation am Leben zu halten. Das Pflichtversäumnis konnte eine Gefängnisstrafe zur Folge haben oder – da die fallierte Gesellschaft wirtschaftlich nicht sehr bedeutend war – eine Geldstrafe. Die Gefängnisstrafe war das Damoklesschwert für Pitt, nicht die Geldstrafe. Denn Pitts Frau, Waltraut, hatte ihn getröstet: sie wolle eine Hypothek auf ihr geerbtes Häuschen aufnehmen, wenn ihm die Schmach einer schmerzhaften Strafe nicht erspart bliebe.
Der Tag der Zahlungsunfähigkeit war für den Verlag auf den Tag genau abzusehen gewesen. Auch standen Forderungen im Raum, die das Vermögen überstiegen. Die ungedeckten Pensionsrückstellungen für den hauptamtlichen Geschäftsführer spielten ebenfalls eine leidige Rolle. Warum hatte Pitt gezögert, den Ruin amtlich zu machen und den Gläubigern so ihre Rechte zu sichern? Darauf zu dringen wäre seine Pflicht gewesen, auch gegen das Zögern des Ko-Geschäftsführers, für den materiell viel auf dem Spiel stand. Der Verlag war ein von Pitt geliebtes Traditionsunternehmen, hundert Jahre alt, das ideelle Zentrum einer einstmals am Markt erfolgreichen Genossenschaftsgruppe mit ihrer verbraucherpolitischen und gemeinwirtschaftlichen Ideologie, deren Sprachrohr ein angesehenes Handelsmagazin war, in dem die Großkopfeten der Genossenschaften und die Koryphäen der Branche gern schrieben. Die Gruppe hatte ihr seit über hundert Jahren erfolgreich betriebenes Geschäftsmodell im Wettbewerb verloren und war in den Sog einer spektakulären Teilliquidation geraten. Pitt hatte die Hoffnung, dass sich aus den Trümmern einer einst starken sozialen Bewegung neue Unternehmenserfolge zimmern lassen könnten und dass der Verlag mit seinen Diensten und seinem Magazin dabei eine konstruktive Rolle spielen würde. Ideologisch etwas verblendet, wollte er nicht der formelle Totengräber einer stolzen Idee sein. Es waren sentimentale Gründe, die ihn seine Pflicht versäumen ließen.
Als nebenamtlicher Geschäftsführer war er von seinem Konzern eingesetzt, der ein Viertel des Stammkapitals vertrat. Der Verband, den RA Scholz vertrat, besaß drei Viertel der Anteile. Wenn der Verband im Interesse der genossenschaftlichen Gruppe, die größer als der krängende Konzern war, bereit wäre, seiner Verlagstochter ein Darlehen von 100 Tausend € (zweihundert nach Mark-Rechnung) zu geben, wäre der Verlag zwar nicht nachhaltig zu retten, doch am Leben zu erhalten gewesen. Vielleicht hätte er illusionäre Zukunftschancen, die sich aus der neuen wirtschaftlichen Einheit Deutschlands, in der die ostdeutschen Konsumgenossenschaften noch eine scheinbar starke Wurzel hatten, nutzen können.
Von der Verbandsspitze waren nur ablehnende Signale zu hören gewesen. Zur Aktivierung von Hoffnungen war niemand bereit. Auch gab es von lang her Spannungen zwischen dem Verband und dem gescheiterten Konzern, der vor zwanzig Jahren gegen die Grundüberzeugungen des Verbandes auf die Schienen gestellt worden war. Der genossenschaftliche Geist hatte dem kapitalistischen des Konzerns in der Rechtsform der Aktiengesellschaft schon immer misstraut. Eine tüchtige Prüferin des Verbandes hatte Pitt schon den Wink gegeben, keine Hilfe erwarten zu können, ja, dringend geraten, den Vergleich oder Schlimmeres anzumelden, um seinen Kopf aus der sich zuziehenden Schlinge zu befreien. Die Konkursuhr tickte. Unter ihrer Drohung flüchtete der Kollege in eine Krankheit, zermürbt von den Sorgen seines Betriebes und der Last fragwürdiger Entscheidungen, von denen Pitt, dessen Schreibtisch nicht im Verlag stand, nichts wusste.
Jetzt der Freitag im April 1993: eine außerordentliche Gesellschafterversammlung in einem Gebäude, das Alte Wache heißt, an der Konrad-Adenauer-Allee. Pitt saß zwei Verbandsgeschäftsführern, ihrem Betriebswirt und einem Treuhänder gegenüber und einem schweigsamen, zuhörenden Olaf Scholz, der seinen dunklen Schopf über ein Aktenstück senkte. Gegen eine Mauer spürbarer Ablehnung hielt er sein Plädoyer für die Zukunft des Verlages.
Es gab ein starkes Argument, auf dessen Wirksamkeit Pitt hoffte. Wie würde es in der Öffentlichkeit aussehen, wenn das Tochterunternehmen eines angesehenen Verbandes in den Konkurs gehen würde? Nun hatten in der Gruppe schon eine Reihe bedeutender Unternehmen Vergleiche angemeldet und abgewickelt – auf einen weiteren Fall von geringer Bedeutung käme es wohl nicht an. Lohnte sich die Rücksichtnahme auf eine öffentliche Meinung um den hohen Preis von 200 Tausend Mark? Was ging den Verband der Milliardenverlust an, den Banken erlitten hatten, weil sie einem Konzern, der nicht seinen Segen hatte, vertraut hatten?
Als ihm nach seinem wortreichen Vortrag alle Felle weggeschwommen waren, fragte Pitt ratlos in die Runde: „Bitte, meine Herren, was soll ich tun?“ Die Verbandsleitung schwieg, der Betriebswirt klopfte noch einmal mit dem Finger auf die Bilanz. RA Scholz blickte Pitt eine Weile prüfend an und sagte: „Gehen Sie in Ihren Verlag, schreiben Sie dem Verband einen Brief mit der Mitteilung, dass Sie bis Freitag, dem 30. April, 12 Uhr, Konkurs anmelden werden, wenn die Liquiditätsfrage bis dahin nicht geklärt ist.“
Und wenn der Verband am Freitag, wie heute und schon oft angekündigt, nicht bereit sei, die Frage zu klären? Ob er dann nicht gewärtigen müsse, strafrechtlich wegen einer offensichtlichen Konkursverschleppung belangt zu werden, fragte Pitt. Konnten vage Erwartungen auf Rettung und mündliche Erörterungen von Möglichkeiten das Abwarten rechtfertigen? Das volle, freundliche Gesicht des Anwalts zeigte schmale Lippen, die sich kaum öffneten, als Pitt hörte: „Folgen Sie meinem Rat. Das rate ich Ihnen.“ Der erste Satz hatte streng geklungen, der zweite verständnisvoll. Eine Galgenfrist von einer Woche, doch der Antrag auf Begnadigung sollte geprüft werden.
Was Pitt nicht wusste: am Tag vor dem Fristablauf tagte der Verbandsrat in Bonn. Und gleichgültig, wie sich die Verbandsleitung in der Darlehensfrage entscheiden würde, sie würde den Verbandsrat fragen müssen. In ihm, das wusste Pitt, saßen keine Freunde seines so ruhmlos, unter lauter öffentlicher Kritik auf Grund gelaufenen Konzerns, dessen mühsam, mit Hilfe hoher verlorener Bankkredite freigeschleppter Rumpfbetrieb auch nicht bereit war, Geld für eine verlorene kleine Tochter in die Hand zu nehmen.
Im Verlagsbüro diktierte Pitt seinen Brief. Die Sekretärin sagte: „Ich kenne den Olaf aus dem Distrikt in Altona. Der hat Ihnen einen guten Rat gegeben, verlassen Sie sich darauf.“ Er brachte den Brief aus dem Büro an der Kurt-Schumacher-Allee hinüber zum Verband an der Konrad-Adenauer-Allee. Er trug ihn in der Hand wie ein Dokument an der Passkontrolle. Er fühlte sich ein wenig als Erpresser („Geld oder Rufschaden“), der seine blackmail-Botschaft verstohlen in den Briefkasten wirft. Die Verbandsspitze fand er in einem Sitzungszimmer, und als er es verließ, sah er, dass RA Scholz den Brief in einer unförmig wirkenden Aktentasche versenkte. Es war offenbar dieselbe, die der Kanzler mit beiden Händen am Griff trägt, bewacht wie er von drei Personenschützern, die ihm nicht beim Tragen seines Tresors helfen dürfen.1
Die beiden Geschäftsführer des Verlages suchten Rat bei Oswald Paulig, dem ehemaligen Vorsitzenden des Verbandes, der auch zehn Jahre lang der Vorsitzende der Hamburger Partei gewesen und noch als ihr Schatzmeister tätig war. Konnte er bei einem Syndikus, der zwar ein Genosse, aber nicht mehr sein leitender Mitarbeiter war, Gutwetter machen für die Gescheiterten? Würde er das Argument aufgreifen, dass der Verlag nie rein kommerzielle Interessen verfolgt, sondern sich als ein ideeller Dienstleister einer genossenschaftlichen Gruppe gesehen habe, was auch seine Satzung betonte? Pitt war in wichtigen Jahren sein Assistent gewesen, hatte jedoch seinen Groll erfahren müssen, als er sich für den im Verband nicht geliebten Konzern, der in Frankfurt mit einem Sanierungsauftrag für eine kränkelnde große Gruppe entstanden war, entschieden hatte. Die beiden betrübten Geschäftsführer luden den angesehenen Nestor zu einem Essen in das „Thai“ am Kurt-Schumacher-Haus. Wäre sein Rat ein Thai-Essen wert? Der Verlag und die Partei durften die Spesen nicht übernehmen, und so zahlte Pitt als ein Privatmann, der weder beim Verband noch beim Verlag auf der payroll stand.
High noon. Die entscheidende Gesellschaftsversammlung war kurz, noch hätte der Zwölf-Uhr-Termin eingehalten werden können. Es kann einer auch perplex sein, wenn sich seine Hoffnung erfüllt. Der Syndikus Scholz sagte: „Wir konnten den Verbandsrat überzeugen, dass die Option Fortführung des Verlages mit Hilfe der Gesellschafter zweckmäßig ist.“ „Wir“ klang in dieser Entschiedenheit eher nach „ich“.
Für Erleichterung blieb bei den Geschäftsführern wenig Raum. RA Scholz sagte: „Die beiden Geschäftsführer sind abberufen. Mit sofortiger Wirkung. Ich trete zur Abwicklung und Liquidation als Alleingeschäftsführer in den Verlag ein. Sofort.“ Der Treuhänder, der für den Verband die Anteile am Verlag verwaltete, ergänzte: „Halten Sie sich Herrn Scholz zur Verfügung und begleiten Sie uns in Ihre Büros.“
Der Vertreter des Konzerns erinnerte an seine beträchtliche Forderung aus Geschäften mit dem Verlag. Doch der neue Geschäftsführer blickte nicht ihn, sondern – nur kritisch, oder abschätzig? – Pitt an, dessen Nachfolger er geworden war, und sagte: „Wenn sich der Konzern rechtzeitig um seine Forderung gekümmert hätte, müssten wir die Frage nicht hier diskutieren.“ Beschämend für Pitt, denn natürlich wäre es sein Job gewesen, sich um die Forderungen seines Arbeitgebers vorrangig zu sorgen.
Wieder wunderte sich Pitt über die etwas unförmige dunkle Aktentasche, die Olaf Scholz trug, als er gemeinsam mit dem Treuhänder und den beiden eben geschassten Geschäftsführern den kurzen Weg zum Verlag ging. Wozu brauchte er die im Verlag?
Die beiden Ex-Verleger mussten sich wie bei einer Festnahme fühlen. Sie mussten die Schlüssel abgeben, für Türen, Tresor, Schreibtische, für das Lager und das von Pitt so geliebte große Archiv mit der Bibliothek, das längst in einen fernen Keller ausgelagert war, und der neue Inhaber der Schlüsselgewalt versenkte sie in seiner Aktentasche. Auch einige relevante Dokumente wanderten dorthin, alle Vollmachten wurden kassiert. Pitt schickte sich an, seine Frau in Frankfurt von der Abberufung, die für ihn ja ein Glücksfall war, zu informieren – o nein, für Privatgespräche war das Telefon schon tabu. Er durfte nur mit der Bank telefonieren, die ihn während der Krankheit seines Kollegen jeden Tag wegen fehlender Kreditsicherheiten verfolgt hatte.
Die Ironie des Schicksals kann grausam sein. Noch während der demütigenden Schlüsselübergabe kam der 90jährige frühere Geschäftsführer des Verlages in die vertrauten Räume. Er war – was er gelegentlich tat – unangemeldet mit seiner wunderbaren Frau und Assistentin in das geistige Reich gekommen, dessen Herr er vor Jahrzehnten gewesen war, Dr. Erwin Hasselmann, ehemaliges Vorstandsmitglied des Verbandes, nebenbei Verlagsleiter, sozusagen ein Vorgänger Pitts (wobei das Wort „Vorgänger“ für ihn, den Autor großer Bücher über das Genossenschaftswesen und international anerkannte Autorität, absolut unangemessen ist). Er wollte sich bedanken für die zu seinem 90. Geburtstag vom Chefredakteur geschriebene Laudatio im Magazin „Der Verbraucher“, dessen Herausgeber, ja Namensgeber er gewesen war. Diese Würdigung war im letzten Heft des „Verbraucher“ vor seiner endgültigen Einstellung erschienen, und das Magazin war exakt so viele Jahre erschienen, wie der Jubilar Lebensjahre hatte.
Dr. Hasselmann reagierte mit erstaunlicher Gelassenheit auf das Ende seines Verlages. Er hatte die Entwicklung der gesamten Gruppe mit großer, analytisch begründeter Skepsis verfolgt und war nicht überrascht. „Dann kann ich ja auch nicht mit meinem letzten Honorar rechnen?“ – er hatte Hunderte von Artikeln für seine Zeitung geschrieben, und als früherer freier Mitarbeiter internationaler Blätter, der sich ab 1933 als Emigrant mühsam in England mit seiner Familie durchbringen musste, hatte er immer Wert auch auf das kleinste symbolische Groschenhonorar gelegt. Sollte Pitt den neuen Geschäftsführer bitten, das Honorar anzuweisen? Er griff in ein Regal und gab dem Autor für sein verlorenes Honorar zwei Wörterbücher: sie hatten keinen Marktwert, waren dem in vielen Sprachen arbeitenden Autor aber für seine große Bücherburg in Wellingsbüttel willkommen. Korrekt, das war klar, war die Transaktion nicht, denn er hatte im Verlag gar nichts mehr zu verschenken. Ob der neue Geschäftsführer ihren dubiosen Charakter erkannt hatte? Nein, der – das stellte sich bald heraus – stellte nur Fragen, wenn sie notwendig waren.
Dreißig Jahre nach diesem Ereignis hat Pitt für den 8. Band der Hamburgischen Biografie eine kleine Lebensgeschichte Erwin Hasselmanns geschrieben.2 Er konnte in ihr erwähnen, dass eines seiner Kinder, mit denen er 1933 emigriert war, gerade den Nobelpreis für Physik für bahnbrechende Kassandra-Arbeiten zum Klimawandel erhalten hatte.
Für den hauptamtlichen Kollegen war die persönliche Situation viel schwieriger als für Pitt, der ja von einer Last befreit war, denn er musste an der Schwelle zum Ruhestand finanzielle Einbußen fürchten. In seiner verständlichen Panik machte er einen Fehler. Er beauftragte einen Anwalt, der seinem Standeskollegen Paroli bieten zu können glaubte, indem er behauptete, die Bestellung des neuen Geschäftsführers sei unwirksam. Oh, wenn du geschwiegen hättest!
Schon zwei Tage später las Pitt einen brieflichen Fragenkatalog des RA Scholz an die Ex-Geschäftsführer, der aber auf den Hauptamtlichen zielte. Er erschrak, denn die Blätter machten deutlich, dass er von seinem Kollegen bei manchen Entscheidungen, die auch ihn hätten voll haften lassen, übergangen oder in Unkenntnis gelassen worden war. Das harte Stakkato der vermuteten Verfehlungen, die erbarmungslose Aufzählung von Versäumnissen – sie zeigten, dass der neue Geschäftsführer sich in kürzester Zeit in die ihm fremde Verlagsmaterie eingearbeitet hatte.
Die Fragen machten ihm das Maß seines eigenen Fehlverhaltens bewusst. Er hatte gewusst, dass der Verlag keine Zukunft haben könnte. Sein Grundpfeiler war das Magazin „Der Verbraucher“, waren seine Anzeigenerlöse und – im kleineren Umfang – die Einnahmen aus den Abonnements. Kaum eine Mediaabteilung der Lebensmittelindustrie sah noch einen Sinn darin, in die rasant bröckelnden Umsätze einer stark schrumpfenden Handelsgruppe zu investieren, deren Image zudem desaströs verfallen war. Ein veräußerbarer Aktivposten war das Medium nicht mehr. Es wäre die Aufgabe Pitts gewesen, seinen Ko-Geschäftsführer und mit ihm den Verband zu überzeugen, das Leuchtfeuer, das in dem Magazin für die Genossenschaften der Gruppe eine Orientierung geboten hatte, rechtzeitig zu löschen. Sie hatten nicht getan, was sie illusionslos hätten tun müssen.
Der Ko-Geschäftsführer, dessen berufliche Existenz am Verlag hing, hatte sich mit allen Kräften an das leckgeschlagene sinkende Boot geklammert, und als Rettungsring sah er manche Aktion, deren Fragwürdigkeit Pitt in ziemlich blinder Komplizenschaft und in kollegialem Vertrauen nicht gesehen hatte. Die aber der RA Scholz jetzt brutal auflistete. In sechzehn prägnant formulierten, keine Ausflucht duldenden Fragen.
Ja, es war richtig: Die Geschäftsführung hatte den Gesellschaftern nicht das Gefahrensignal gesandt, dass die Hälfte des Vermögens verbraucht und die Überschuldung sichtbar war. Welche Rechnungen wurden seit Jahresbeginn nicht bezahlt und wie ist die Buchhaltung mit Mahnungen verfahren? Die Sozialversicherungsbeiträge! – dieses absolute Muss darf nicht verletzt werden. Provisionen aus dem Verkauf eines kommerziellen Kundenmagazins waren verzögert oder unvollständig an die Handelsunternehmen weitergeleitet worden. Wegen unregelmäßiger Mietzahlung stand eine Kündigung der Verlagsräume ins Haus (das zu wissen hätte Pitt in Alarmzustand versetzt: das historische Archiv, die Bücherberge!). Wo sind die gerichtlichen Mahnbescheide, ja, die arbeitsgerichtlichen Mahnungen geblieben? – in der Aktentasche des neuen Geschäftsführers waren sie nicht gelandet. Der Ausklang jeder Frage: „Warum haben Sie keine erforderlichen Dispositionen getroffen?“ Irgendwann, meinte der Fragesteller, müsste es der Geschäftsführung wie Schuppen von den Augen gefallen sein: die Zahlungsunfähigkeit war da! „Ich bitte um Angabe des genauen Datums.“ Die Entscheidung, nicht zu zahlen, sei „ja schließlich nicht zufällig gefallen.“ Dass der Ko-Geschäftsführer dem Verlag den von ihm gefahrenen Dienst-Pkw, an dem noch Reparaturen und Reifenwechsel vorgenommen worden seien, abgekauft hat – das hätte Pitt, der kein Autofahrer ist, gewiss hellhörig gemacht, auch wenn er wohl zugestanden hätte, dass es sich dabei um eine Liquiditätshilfe für den Verlag gehandelt hatte. Aber wo war der Beschluss? Die Abgeltung von Urlaubsansprüchen zu erlauben, war nicht Pitts Sache, sondern die der Gesellschafter gewesen. Was er wusste und gebilligt hatte, war die Zahlung von Abfindungen an ausscheidende Mitarbeiter, die noch nicht fällig waren – was der in diesen Fragen besonders versierte Justitiar monieren musste. Und all die vermeidbaren Fixkosten, die mit den wackeligen Mietverträgen zusammenhingen? „Stellungnahme bis zum 12. Mai 1993, 10 Uhr.“
Nach dem Ablauf der Frist wurde der Treuhänder zum zweiten Geschäftsführer neben RA Scholz bestellt, eine fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages des früheren Ko-Geschäftsführers ausgesprochen, womit eine Abfindung für eine langjährige Beschäftigung entfiel. Später wurde das Ausscheiden in den üblichen Floskeln der Einvernehmlichkeit geregelt, was den Anspruch auf die betriebliche Rente sicherte. Für Pitt bedeutete das alles keinen geldwerten Verlust, aber den moralischen hat er immer als Last empfunden.
Manchmal betrachtet er einen Artikel in der Enzyklopädie Wikipedia über einen späteren Geschäftsführer des Verbandes, der auch einmal Partner in der Kanzlei Olaf Scholz’ gewesen ist. Dr. Burchard Bösche, ein Genossenschafter und Historiker vom Rang eines Erwin Hasselmann, ist dort abgebildet vor der stattlichen Reihe der gebundenen Jahrgänge des Magazins „Der Verbraucher“, eines Schmuckstücks des Hamburger Genossenschaftsmuseums, dessen Gründer und Bewahrer Bösche bis zu seinem Tod im Jahre 2019 gewesen ist. Und Pitt denkt: Es gibt Dinge, die in Irrtum und Schuld vergehen, und sie haben doch Bestand.
1 dpa-Foto, „Alle Schranken offen“, Frankfurter Allgemeine v. 1. 7. 2023
2 Artikel „Erwin Hasselmann“, Hamburgische Biografie, Bd. 8., Göttingen 2023
Ein halbes Jahrhundert dabei – warum?
Ein Vierteljahrhundert später schrieb Olaf Scholz einen zweiten Brief an Pitt, an den Parteibürger: eine Einladung zum Kaffeetrinken.
Der sitzt im März 2016, 77 Jahre alt, im großen Saal des Kurt-Schumacher-Hauses an der Hamburger Kurt-Schumacher-Allee. Langgestreckte, mit blinkenden Gedecken und Blumen geschmückte Tafeln, an denen sich wohl hundert Silber- und Grauköpfe reihen. Die Ehrung der Jubilare ist angesagt, der Parteimitglieder, die ihrer Partei vierzig, fünfzig und mehr Jahre die Treue gehalten haben. Als er diese Zeilen tippt, wurde in seinem SPD-Distrikt Farmsen gerade die hundertjährige Lilo Baden für 75 Jahre Parteimitgliedschaft vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher geehrt.
Die Jubilare hatten den brieflichen Glückwunsch des Hamburger Parteivorsitzenden Olaf Scholz schon pünktlich zum Eintrittstag erhalten, sie sind bereits in ihren Distrikten geehrt worden mit einer von Scholz in seiner Hakensignatur unterschriebenen Urkunde, einer Nadel oder Brosche und einer Dankesrede der oder des Vorsitzenden des Distrikts (so heißen in Hamburg die Ortsvereine) und oft auch von der regionalen Parteiprominenz der höheren Ebene, aus den Kreisen, der Bürgerschaft und manchmal auch aus dem Senat, wenn das Mitglied sich in besonderer Weise für Karrieren anderer eingesetzt hat. Vom Zustand der lokalen Parteikasse hängt es ab, ob es auch ein Geschenk gibt. Pitts Genossinnen und Genossen, zum Beispiel, haben ihm einen schönen Druck von Günter Grass geschenkt – das Bild eines krähenden Hahnes auf dem Mist –, und das war eine freundliche Anspielung darauf, dass Pitt sich wie der große GG in der Werbearbeit und in Wahlkämpfen engagiert hat.
Er nimmt an, dass sich jedes Mitglied über diese Ehrungen freut. Die meisten Mitglieder sind in vielen Jahren in weitgehend anonymer Anhänglichkeit ihrer Partei gefolgt, und nun stehen sie für ein paar schöne Minuten im Mittelpunkt einer herzlichen Aufmerksamkeit. Sind sie profiliert oder gar prominent, ist die Ehrung eine Selbstfeier der Partei. Als Lilo Baden in Farmsen für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden war, hatte sie ihre goldene Ehrenbrosche zerbrochen, was nicht heißt, dass die aus minderwertigem Material war. Sie war traurig darüber, und Pitt hatte ihr eine neue Brosche besorgt, und die wurde ihr in der allgemeinen Jubilarehrung im Kurt-Schumacher-Haus vor vier Jahren von Olaf Scholz angesteckt, doch nicht ohne eine Gegengabe der so regelwidrig Geehrten: sie schenkte dem Parteivorsitzenden August Bebels Superbestseller „Die Frau im Sozialismus“, den der Großvater ihrer Mutter 1916 zum 18. Geburtstag geschenkt hatte.
Jetzt spielen die Haberlandt-Sisters Ingrid und Erika auf ihren Akkordeons schmissige Volks- und Arbeiterlieder und singen manchmal dazu, mit einer unglaublich fröhlichen Kraft in ihren Stimmen, die auf Mikrophone nicht angewiesen sind. Olaf Scholz spricht nicht so laut, er braucht den Verstärker am Podium. Er ist der Parteichef in Hamburg und ehrt die Mitglieder jenseits aller Orts- und Gremiengrenzen. Pitt hat etliche Parteivorsitzende erlebt, und er ist sicher, dass keiner unter ihnen die symbolische Handlung als ein Pflichtpensum betrachtet. Das ist eine Sache des Herzens, immer. Wenn die Mitglieder das nicht spüren, fällt der Redner durch. Und irgendwie der Vorsitzende auch.
Olaf lässt spüren, dass sein Herz für die alten Mitglieder schlägt. Und nicht nur für die Alten: Als er sieben Jahre später als Bundeskanzler auf dem Parteitag der Hamburger Partei in Wilhelmsburg den 280 Delegierten gegenübersteht, deren Vorgänger ihn einmal zum Vorsitzenden gewählt hatten, sagte er: „Es ist schön, in eure Gesichter zu blicken. Ich kann mich gar nicht sattsehen.“ Pitt war froh, nicht mehr als Delegierter, sondern nur noch als greiser Gast dabei zu sein, denn sonst hätte er einfallen müssen in das rhythmische Klatschen, diese manipulative Form des Beifalls, die er immer verabscheut hat, selbst in emotionalen Momenten.
Ahnt Olaf Scholz schon in dieser Feierstunde, dass es die letzte Ehrung sei, die er in Hamburg „durch gute Reden begleiten“3 will? Er erzählt von einigen Problemen, die mit den Hamburger Highlight-Vorhaben der letzten Jahre verbunden waren – Elbphilharmonie, das geplante Hochhaus an den Elbbrücken (fünf Jahre später wurde die Boden platte gegossen), den bundesweit beachteten Fortschritt seines Wohnungsbau-Paktes. Und er erzählt die Geschichte des Bürgermeisters Otto Stolten, eines hanseatischen Sozialisten, der 1919, nach der auch in Hamburg gelungenen Revolution, als Parteivorsitzender mit einer Mehrheit im Rücken den Zugriff auf das Amt des Ersten Bürgermeisters gehabt hätte, aber aus Klugheit einem bewährten Senator aus dem so genannten bürgerlichen Lager den Vortritt gelassen hatte, als 2. Bürgermeister angetreten war und seine politischen Erfahrungen im Reichstag für das ganze Land genutzt hatte. Scheute der Autodidakt mit seiner Volksschulbildung, der erste Bürgerschaftsabgeordnete der SPD nach Abschaffung des Klassenwahlrechts, vor der Größe der qualifizierten Aufgabe? Wie ja Lord Ralf Dahrendorf, Sohn eines dieser autodidaktisch hochgebildeten Sozialisten und Enkel eines Hamburger Hafenarbeiters, in einem berühmten Buch geschrieben hat: Manche deutschen Politiker seien erschrocken gewesen, in historischer Stunde Macht übernehmen zu sollen und zu erkennen, dass sie niemanden mehr über sich haben.4 Opferte der Bürgermeister Stolten vielleicht persönliche Ambitionen einer höheren Vernunft, die ihm sagte, für Vaterstadt und Vaterland sei es besser, dass die siegreichen Sozialisten die Bürgerlichen mit ihren kaufmännischen Netzwerken ins hanseatische Schiff holten?
Wie immer auch, die Geschichte passte wunderbar in diese Stunde – so ein bisschen werden auch einfache Parteimitglieder („chargenlose“, wie Robert Michels sagt5) mit der Bürgermeister-Stolten-Medaille, die in Hamburg die höchste genuine Auszeichnung ist, geehrt. Und dazu der kleine Stolz des Laudators: in Olafs Amtsperiode haben 600 neue Mitglieder die Mitgliederzahl in Hamburg auf über 10.000 angehoben. Wer je Mitgliederwerbung betrieben hat, kann das Gewicht dieser Zahl und die Mühe, die hinter ihr steckt, würdigen. Beifall!
Pitt sitzt neben Fritz Sch.: Er war in Potsdam (dort würde Olaf Scholz in paar Jahren wohnen) zu 15 Jahren Haft wegen verbotener Parteimitgliedschaft verurteilt und 1969 von Herbert Wehner von den Gierdespoten freigekauft worden. Der Nachbar zur Linken ist Klaus K., er hat 15 Monate gesessen wegen seiner Kritik am Mauerbau. Aus den Erinnerungen, die quer über die Tische ausgetauscht werden, erfährt er, dass die Parteijahre für viele der Anwesenden ein Gewicht haben, in dem sein eigenes Leichtgewicht nicht auszumachen ist.
Der Gastgeber geht durch die Reihen, hört zu, spricht mit den Gästen seiner Kaffeetafel, lächelnd, betroffen, ernst, lachend, auf besonders temperamentvolle Ansprache in sprechender Mimik und launiger Erwiderung reagierend. Schräg über den Tisch stellt Pitt ihm in ziemlich anmaßender Selbstermächtigung die beiden Nachbarn mit ihrem Namen und mit Stichworten zu ihrem Parteischicksal vor – und irgendwie hat er das Gefühl, dass der Vorsitzende erleichtert ist, nicht mit ihm sprechen zu müssen. Olaf erkundigt sich in gespannter, neugieriger Haltung nach den Verhängnissen, die Sozialdemokraten in der DDR erleben mussten. Am Tisch verstummen alle Gespräche, nur die Worte der Zeitzeugen sind zu hören.
Auch einige prominente Parteimitglieder sind im Saal, die drängen sich ein bisschen vor, um zu erzählen, wie und unter welchen besonderen Umständen sie in die Partei eingetreten sind oder von wem sie persönlich geworben oder unter die Fittiche genommen worden sind. Pitt blickt ein bisschen finster auf Freimut Duve, der bei Rowohlt viele Jahre eine beachtete politische Reihe herausgegeben hat. Oh, er ist alt geworden und steht ein wenig verloren im Raum, ehe er Olaf die Hand schüttelt. Musste er mit seiner publizistischen Brillanz unbedingt dem verdienten, doch glanzlosen Sozialpolitiker Eugen Glombig das Bundestagsmandat abjagen, mit einer Stimme Mehrheit im innerparteilichen Casting für die Liste? ( Johannes Kahrs hat den MdB Glombig später „gerächt“ und Duve das spätere Direkt-Mandat abgenommen).
Die Parteiveteranen tauschen lebhaft über Tisch und Stühle hinweg ihre Erinnerungen an Kämpfe in der Partei und an Highlights der jüngeren Parteigeschichte und ihre Leit- und Reizfiguren. Sie lassen das Altmitglied Pitt in seiner langweilenden Normalität mit seinen Versuchen, sich in das Gespräch zu klinken, links liegen. Merkwürdig: von all den Jubilaren aus den wohl hundert Distrikten kennt er niemanden, er erinnert sich dunkel an Gesichter, die er auf Kreis- und Landesparteitagen oder in den Kreis-Vollversammlungen in Wandsbek, die Aktive aus mehreren Ebenen vereinigen, gesehen hat.
Er lässt seine Blicke über alle die Gesichter der Frauen und Männer schweifen – die Journalisten nennen oft die Delegierten von Parteitagen die „Basis“, was natürlich Unsinn ist, die Basis ist ein Stockwerk tiefer, hier im Saal zum Beispiel. Und wieder wie schon so oft taucht vor seinem Auge die Frage auf: Warum sind die Frauen und Männer hier im Raum und überall, wo er ihnen begegnet, Mitglieder der Partei geworden, dieser und einer Partei überhaupt? Warum wird überhaupt ein Mensch, der Bürger eines demokratischen Staates, Mitglied einer Partei? Warum zahlt er seinen kleineren oder größeren Beitrag dafür, so viele, viele Jahre lang, warum hat er, vielleicht, viele Stunden seines Lebens darangegeben, einer Partei zu helfen, dem politischen Leben einen Stempel aufzudrücken.
Er weiß natürlich: letztlich ist diese Frage nach dem wahren Grund einer Parteimitgliedschaft – um mit seinem Lieblingsdichter Gottfried Benn zu reden – überwältigend unbeantwortbar. Die Jubilare, von den Laudatoren befragt, erzählen oft, sie stammten aus einer sozialdemokratischen Familie, erzählen von familiärem Widerstand und Verfolgung, von Hoffnungen und Illusionen, von konkreten Anlässen, die einen Beitrittsimpuls ausgelöst haben, vom attraktiven Charme von Persönlichkeiten.
Und warum sind sie der Partei so viele Jahre treu geblieben, trotz mancher Enttäuschung, von der sie auch erzählen. In dieser Generation spielen Klassenlagen und Kampftraditionen nicht mehr eine große Rolle, vielleicht noch das Bewusstsein, zu den „kleinen Leuten“ zu gehören. Das Gefühl, Teil einer solidarischen Gemeinschaft zu sein – ist das nicht doch eher eine Sache der Haberlandt-Sisters mit ihrer inbrünstigen Fröhlichkeit?
Noch auf der Fahrt mit der U-Bahn zu diesem auch für ihn wichtigen Event hatte er auf seinem E-Book in den Moskauer Tagebüchern von Walter Benjamin gelesen (ein Riesenwerk auf einer kleinen Mattscheibe!). Der Kulturphilosoph gilt ja als ein Alleserklärer, und Pitt hatte sich daran erinnert, bei ihm, diesem hochreflektierten, auf politische Wirkung erpichten Geist Gedanken über eine mögliche Parteimitgliedschaft gelesen zu haben. Er hatte sich durch seine eingefärbten Notizen auf dem Schirm geklickt, ja, der linke Kopf hatte in den 1930er Jahren in Moskau ernsthaft überlegt, der Partei beizutreten – die ja viele Intellektuelle in unbegreiflicher Weise für demokratisch gehalten haben. In der K.P.D., die das Leben monopolistisch organisiert, werde wohl, so denkt er, „von früh bis spät nach Macht“ gegraben, wie es die Goldgräber in Klondyke taten. Und wenn es in einer Partei, die ja tatsächlich überall nach Macht strebt, eine verführerische Teilhabe an der Macht gäbe, wäre dann nicht auch der Drang da, aus den „zugigen Zuschauerräumen“ zu einer Rolle zu gelangen, wenn auch einer kleinen, auf der „dröhnenden Bühne“?
Tagelang traktierte Benjamin sein Tagebuch6 mit seinen Erwägungen, in die Partei zu gehen. Als entscheidenden Vorzug sieht er: „feste Position und ein, wenn auch nur virtuelles Mandat. Organisierter, garantierter Kontakt mit Menschen.“ Aber bliebe im Anspruch der Partei, zumal einer totalitären, die „private Unabhängigkeit“ nicht auf der Strecke?
Träte man nicht die „Aufgabe, das eigene Leben zu organisieren, sozusagen an die Partei ab?“ Verstohlen blättert der von seinen Nachbarn an den Rand gedrängte Pitt auf seinem E-Book die „Notizen“ durch, in denen er Benjamins Skrupel eingeschwärzt hat. Der Kampf des differenzierenden Intellekts um spezialisierte Ziele – muss er nicht mit dem Eintritt in die Partei enden, auch wenn er nur „ein experimenteller“ ist? Kann eine Partei „im Rhythmus meiner Überzeugungen“ schwingen? Nein, ein Walter Benjamin ist als Parteimitglied – whereever, whenever – absolut untalentiert. Die Genossinnen und Genossen jedes Parteidistrikts, die seiner beantragten Aufnahme, jedenfalls in der deutschen SPD, zustimmen sollen, würden ihm bei diesen Reflexionen mit Misstrauen begegnen müssen.
Hier an der Kaffeetafel von Olaf Scholz ist keine „dröhnende Bühne“. Hier sitzen hundert reife Menschen, die wissen, dass ihre Entscheidung, der Partei beizutreten, gut gewesen ist. Für sie gilt Hegels Satz, dass das Wirkliche das Vernünftige sei. Sie sind mit sich im Reinen, sie sind mit der Partei im Reinen – „im Großen und Ganzen“, versteht sich, und wenn sie je „experimentell“ dachten, hat sie ihr Experiment so befriedigt, dass sie andere Menschen getrost einladen können, es zu wiederholen.
Heute las Pitt die Einladung der Hamburger Parteivorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland an die Neumitglieder – zu einer traditionsreichen Willkommensveranstaltung, die gleichzeitig ein kleines Proseminar der Parteiarbeit ist. Er überlegte, ob er sich in sie hineinmogeln könnte, um noch einmal die Spannung des Anfangs zu erleben. Er, der am rechten Fuß des Regenbogens steht, würde gern noch einmal auf dem linken stehen. Unfug! Jeder hat seinen Blickwinkel auf den Regenbogen.
3 Schiller, Die Glocke
4 Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1965, S.297
5 Robert Michels, Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie – Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Stuttgart 1989, Seite 105. (Das Buch ist 1910 zum ersten Mal erschienen).
6 Walter Benjamin, Gesammelte Werke: Essays, Aufsätze, Satire, Kritiken, Autobiografische Schriften, e-artnow 2014, Aufzeichnungen 1906–1932, Das Moskauer Tagebuch, Pos. 84346
Typen des Mittendrin
Als der Volkswirt Pitt 1964 gerade in seinem Genossenschaftsverband angetreten war, überreichte der Vorstand seinem Chef, dem Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung, das gerade erschienene Buch von Ulrich Lohmar über die innerparteiliche Demokratie.7 Dr. Werner Gebauer hat es nicht gelesen, denn sein Sinn stand mehr nach philosophischen Dingen. Er gab es seinem neuen Mitarbeiter mit dem Auftrag, den Inhalt für ihn markant zusammenzufassen, damit er mit seinem Chef darüber pflichtschuldig reden könne. Das Buch musste interessant sein, denn es war in einer soziologischen Schriftenreihe erschienen, die von Professoren herausgegeben wurde, von denen Pitt einige an seiner Hamburger Uni gehört hatte. Und ihr Verfasser war einer der jüngeren Bundestagsabgeordneten, bestimmt attraktiver als der biedere Bundestagsabgeordnete Herbert Kriedemann, der den Verband in agrarpolitischen Fragen beriet und einen Nimbus hatte, weil er zu Kurt Schumachers Startmannschaft in Hannover-Linden gehört hatte.
Warum kam ihm gerade hier an der Kaffeetafel Olaf Scholz’ diese Erinnerung an ein Buch, das er gerade so flüchtig angeschaut hatte, um den Auftrag seines Chefs abhaken zu können? Er war in dem Buch auf Passagen über Parteimitglieder gestoßen, die alle Vorurteile, die ihm wie vielen Menschen im Kopf spukten, bestätigt hatten. Nachdem er zu Hause Waltraut über Olafs Kaffeetafel berichtet hatte, ging er in seine Garage, die ihm, dem passionierten ÖPNV-Nutzer, als Ablagebibliothek dient, suchte den Lohmar und las noch einmal die Passagen über die Parteimitglieder, die sich vor einem halben Jahrhundert in sein Gedächtnis eingenistet hatten.
Wer sind die Menschen, hatte der dort ohne heftigen Widerspruch zitierte Ahnherr der Parteienforscher, Robert Michels, gefragt, die regelmäßig an den Veranstaltungen der Parteien teilnähmen? Es seien die „Pflichtbewussten und Gewohnheitsläufer“, und ihre Motive – und das hatte Ulrich Lohmar wohl als empirisch gesichert betrachtet – seien „sachliches Interesse, Bildungsdrang, Ehrgeiz, Neugierde und Langeweile“. Und Michels hatte noch einen Gemeinplatz draufgesetzt: die Mitglieder interessierten sich für „gegenwartspolitische, sensationelle und sentimentale Themen“8. Wie kann ein oft zitierter Soziologe nur solche Plattitüden in die Welt setzen.
Hatte Ulrich Lohmar seine Studie mit Hilfe Michels’ etwa als teilnehmender Beobachter geschrieben und deshalb seine beeindruckende Karriere als Bundestagsabgeordneter, als Chefredakteur eines einst bedeutenden Politmagazins und später als profilierter Bildungspolitiker gemacht? Eine Parteiveranstaltung als Talkshow oder boulevardeskes Event? Michels allerdings muss man zugutehalten, dass er seine Beobachtungen vor dem Ersten Weltkrieg gemacht hat, als die meisten Parteien noch nicht eine ausgebaute Mikrostruktur der Mitliederorganisation gehabt haben, sondern hauptsächlich als Organisatoren fluider Massenveranstaltungen unterwegs gewesen sind.
Wer die Verfassungswirklichkeit untersucht, misst das Faktische am Normativen, und im Widerstreit vom Soll und Ist verliert immer das Ist. Da eine Partei kein Mechanismus ist, sondern ein menschlicher Verband, sind in ihr alle Motive und alle Verhaltensweisen, die menschlich sind, präsent. Das ist die Eigenart des Politischen. Eine Wissenschaft, deren Beobachtungen trivial sind, oder eine kritische Theorie, die alles Praktische und Pragmatische für unzulänglich hält, ist für das Verständnis von Wirklichkeit nicht sehr hilfreich.
Pitt war froh darüber, dass er das Buch Ulrich Lohmars erst nach Olaf Scholz’ Kaffeetafel – ihm wie Michels galt dies wohl als „Geselligkeit“ und Entartungsform des Parteilebens – gründlich gelesen hatte. Aber Bücher, die aus Dissertationen entstanden sind, werden in der Regel gesponsert und an wenige, meist unwillige Leser verschenkt, und so wird ihre demotivierende Wirkung auf ein Parteiengagement nicht groß gewesen sein. Denn das Resümee aller faktischen Befunde war eindeutig: Die Parteien werden den Anforderungen, die eine Verfassung an ihre Funktion und ihre Arbeitsweise stellt, in desillusionierender Weise nur schwach gerecht.
Aber macht die Verfassung den Parteien überhaupt Vorschriften, wie sie zu sein haben? Und ist das nicht Sache der Parteien allein, wie sie sein wollen – wenn sie den spärlichen grundgesetzlichen Rahmen ausfüllen. Parteien sind lebendige Gebilde im Wandel und gehorchen nicht dem Design des Wünschbaren.
Jenseits aller soziologischen Analysen hat Pitt immer das Empfinden gehabt, die Anziehungskraft von Parteien sei unabhängig von Klassenlagen, Schichtenzugehörigkeit oder „Weltanschauungen“ der institutionelle Ausdruck tiefliegender irrationaler Grundströmungen, die wie geologische Formationen die terrestrische Oberfläche tragen und sie dynamisch hier und dort ausstülpen und topographisch formen.
Was ist das Motiv für das „dabei sein“, das „mitten drin“ in einer Partei, wie erklärt sich dieses „Inter-esse“? Dass ohne Interesse an einer Sache für oder gegen sie entschieden oder gehandelt wird, ist nicht vorstellbar. Das abstrakteste Motiv für eine Parteimitgliedschaft ist das Interesse.
Das politische, wirtschaftliche und soziale Leben, ja, sogar das kulturelle, wird von Interessen bestimmt. Sie sind die treibende Kraft, die alles Geschehen bewegt, im Individuellen, im Staatlichen, im Gesellschaftlichen. Das ist eine schlichte Wahrheit, der jedoch von den früheren Moralphilosophen und Prä-Politologen ein immenser definitorischer, logischer und systemischer Scharfsinn gewidmet wurde, von der Erbsündentheologie des Augustinus über den brutalen Politstrategen Machiavelli zu den fabelhaften französischen Moralisten, vom pragmatisch-listigen Adam Smith und seinen großen Nicht-Versteher Marx bis hin zu Clausewitz. Von den faschistischen Zynikern, die der sprachlich anspruchsvollen Analyse nur selten fähig sind, zu schweigen. Albert O. Hirschman hat die Genese von bewegenden Interessen lehrreich dargestellt.9
Zu seiner eigenen Orientierung hat Pitt das Interesse als Generalnenner der Parteilichkeit in handliche Motivgruppen zu ordnen versucht. Denn das Interesse ist natürlich ein zu grobschlächtiges Motiv für eine Parteimitgliedschaft. Die Phänomenologie der Parteimitgliedschaft ist hoch differenziert und befriedigt nicht unseren Ordnungssinn, der ja verlangt, die Fülle der Erscheinungen in überschaubaren Komplexen zu bündeln.
Der Parteivorsitzende Olaf Scholz im Kurt-Schumacher-Haus spricht die Anwesenden mit „Liebe Genossinnen, liebe Genossen“ an. Stünde er im Konrad-Adenauer-Haus, würde er wahrscheinlich „Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde“ sagen, im Thomas-Dehler-Haus wohl „meine Damen und Herren“, im Heinrich-Böll-Haus müsste er eigentlich „Brüder und Schwestern“ sagen, aber weil das zu christlich klingt, wird es wohl eher „Liebe Freundinnen, liebe Freunde“ heißen. Im Karl- Liebknecht-Haus werden wieder wegen der sozialistischen Ahnentafel die Genossen angesprochen. „Liebe Mitglieder“ wird nur der oder die Vorsitzende eines Vereins sagen (allerdings: bei den Gewerkschaften, die auch Vereine sind, sind es „Kolleginnen und Kollegen“, die angesprochen werden, und „Genossen“ gibt es nicht in den Genossenschaften, denn dort werden „Genossenschaftsfreunde“ angesprochen). Pitt würde am liebsten nur Mitglieder adressieren, wie sie alle rechtlich organisierten Vereine haben, denn das ersparte ihm auch das leidig-umständliche Gendern, das in jeden Satz Stolpersteine und Atemblockaden einbaut; denn Mitgliederinnen gibt es (noch) nicht.
Menschen schließen sich in einer Partei zusammen. Sie bilden eine Verbandsstruktur. Pitt möchte vorschlagen zu sagen: Menschen, die politisch handeln wollen, schließen sich zusammen unter einem Sinn, einem Ziel, einem Zweck oder einem Vorteil. Diese vier Begriffe sollen aber nur helfen, die persönliche Motivation für eine Mitgliedschaft in einem Verein zu charakterisieren.
Pitt will ihnen noch eine Folie mit den zentralen Begriffen des wunderbaren Ferdinand Tönnies unterlegen, nämlich „Gesellschaft“ und „Gemeinschaft“. Der erste deutsche Soziologe, der noch nicht in betörenden Theorien, sondern in Anschauungen dachte, betont in seinem Begriff „Gesellschaft“ die Rationalität menschlicher Organisation, in „Gemeinschaft“ die Emotionalität und den mentalen Kitt, blickt einmal auf die äußeren Bindekräfte, zum anderen auf die inneren.10 Die Abgrenzung ist fließend, und manchmal kann man die Idealtypen mischen wie mittels eines stufenlosen Reglers am Heizungsventil – wobei das Bild treffend ist, denn nach Friedrich Nietzsche kennt niemand den „Grad seiner Erhitzbarkeit“, der ihn zu einem Engagement mobilisieren könnte.
Heutzutage ist der von den Nazis ge- und missbrauchte Gemeinschaftsbegriff leider schwer beladen von allen Missverständnissen zwischen faschistischer Anmaßung und dem Pathos von Sonntagsreden. Doch schöne und wahre Begriffe können nie besudelt werden, ihr Goldglanz wird immer wieder durchscheinen. In seinem Buch „Wir ungläubigen Christen“11, einer Bittschrift, die gegen einen Gemeinschaftsverlust gerichtet ist, hat Pitt den unverlierbaren Tönnies’schen Begriff dankbar benutzt. Wer von „Parteien“ spricht, ist sich bewusst, dass das Wort für den „Teil“ steht und dass jeder Teil ein Stück des Ganzen ist, und jeder, der „Partei“ denkt, denkt auch an das Ganze. Oder er sollte es tun, nicht nur aus sprach logischen Gründen, sondern auch in bürgerlich-demokratischer Loyalität.
Die vier Motivgruppen, die Pitt als rein operationale vorschlägt, haben keine Rangordnung. Sie stehen als Motivformen gleichberechtigt nebeneinander, keine ist wertvoller als eine andere, denn eine Priorität führte in eine hier unangebrachte Moralphilosophie, die Pitt den Weltweisen überlassen muss.
Und wenn er von einem Streben nach einem Nutzen oder einem Vorteil spricht, muss er ein Missverständnis vermeiden. Jede Frau und jeder Mann als Parteimitglied kann oder sollte sogar den zentralen Vorteil sehen, den er gegenüber anderen Menschen außerhalb von Parteien hat, nämlich die Chance, durch Vertrauen und Wahl ein Mandat zu erringen, das ihm den Einfluss verleiht, politisch verantwortlich mitgestalten zu können. Er kann auch die Chance nutzen, in der Partei eine riskante Entscheidung für die „Politik als Beruf“ (Max Weber) zu treffen. Schon mancher Studierende hat durch eine frühe politische Karriere die akademische überholt und sich entschlossen, ohne Examen in ein Berufsleben zu starten (das Abenteuer erfahren oft Politiker und Journalisten, die sich in vielem verwandt sind).
Dieses persönliche, den Parteien inhärente Machtstreben wird in der Öffentlichkeit, vor allem den Sensationsmedien, oft als Vorteilsstreben missdeutet. Ob jemand ein Mandat gewinnt, kann er beim Eintritt in die Partei nicht wissen. Ihm wird in Parteien eine Chance gegeben, die er nach seinem persönlichen Potenzial nutzen kann, so wie wir durch Charakter, Bildung und Erfahrung unsere Attraktivität entwickeln und nutzen sollten.
Nur wo ein Mensch die Partei als ein Vehikel ansieht, persönliche, wirtschaftliche, berufliche, gewerbliche Chancen und Ambitionen realisieren zu können, spricht Pitt von einem Vorteilsstreben in Parteien. Der Fall ist natürlich nicht selten, lässt sich aber durch Profiler schwer abgrenzen. Der unvergleichliche Martin Walser hat in einem Roman erzählt, wie alle Kommilitonen des infantilen Helden in Berlin zur „SPD gepilgert“ seien: sie „betrieben ihre Karriere jetzt unter Mitwirkung dieser Partei, die auch den Bürgermeister Reuter stellte.“12
• Der Sinn der Partei wird klar und knapp durch unser Grundgesetz beschrieben: Parteien wirken an der politischen Willensbildung der Bevölkerung mit (Artikel 21). Das ist ein Satz von erhabener Einfachheit und äußerster Reduktion, der die Komplexität des Sachverhalts nicht beschreiben kann. Bürgerinnen und Bürger, die Mitglied einer demokratischen Partei werden, um diesen Satz, der ein Verfassungsauftrag ist, mit Leben zu erfüllen, könnten Mitglieder des Typs V (wie Verfassung) genannt werden.
Die Organisation des politischen Lebens einer demokratischen Gesellschaft ist ohne Parteien praktisch nicht möglich. Sie wandeln persönliche, in Riesenkollektiven diffus verschwimmende Meinungen in politische Entscheidungen und Handlungen um. Sie verwandeln Meinungsfreude und -stärke, die bei vielen Menschen ausgeprägt ist, in ein Wollen und eine Verantwortungsfreude.
Natürlich gibt es auch Vereinigungen, die politischen Einfluss ohne den Artikel-21-Satz und die aus ihm abgeleiteten parteirechtlichen Regeln gewinnen. Doch auch z. B. die eher ephemeren Wählervereinigungen, die keine Partei sein wollen, finden früher oder später zu stabilen Regularien. Die vielzitierten „Bewegungen“, die sich oft etwas hochtrabend als Nicht-Regierungs-Organisationen bezeichnen, sind lediglich Zweckgemeinschaften, PR-Vereinigungen oder mehr oder minder druckvolle Lobbyverbände, die Einfluss anstreben, aber keine politische Gestaltungsmacht gewinnen, es sei denn, ihre Anhänger übernähmen persönlich die Mitgliedschaft in einer Partei. Das scheuen sie jedoch oft, weil sie einen Horror vor sog. „Ochsentouren“ haben und ihnen der „Gang durch die Institutionen“ zu langwierig oder zu mühselig ist; sie bevorzugen die direkte Aktion (die in ihrem Kern einen faschistischen Ursprung hat). Ihre politischen Aktionen müssen spektakulär sein, weil sie ihre Anhänger und Spender, nicht immer auch Mitglieder, nur auf diese Weise gewinnen können. Es handelt sich hier um eine unausgereifte Form politischer Partizipation, weil sie sich nur im Vorfeld politischer Entscheidungen bewegt.
Die praktische Funktionsfähigkeit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist für Parteimitglieder des Typs V der Grund für ihre Parteimitgliedschaft. Das gilt übrigens auch für das Wahlverhalten. Mancher mag – aus Frust oder Überdruss – überhaupt keiner Partei seine Stimme geben wollen, er tut es aber dennoch in dem Wissen: ohne Parteien und ihre Meinungs- und Stimmenbündelung geht es nicht.