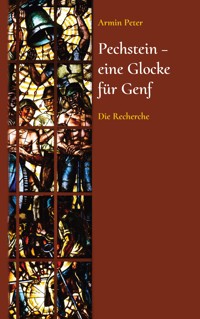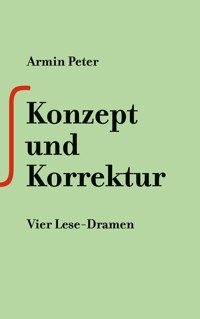Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den frühen 1950er Jahren führen die 8. Klassen einer Volksschule - einer mittlerweile ausgestorbenen Schulform - ein Theaterstück auf. Es folgt im Geist der Zeit einer simplen pädagogischen Idee: Ordnung und Sauberkeit sollen in einem "Gläsernen Haus" gelernt werden. Der Autor beschreibt die Aktiven des Spiels in Darstellung und Technik. Er skizziert in lebhaften Farben ihre Persönlichkeit und ihr Talent und befragt ihren "Genius", ob er ihnen ein Wegweiser in die Zukunft sein konnte. Porträts von Lehrerinnen und Lehrern fehlen nicht. Die Erinnerungen an die Theater AG werden geweckt durch die Freiluft-Aufführung einer heiteren Haydn-Oper vor einem Wasserschloss, in dem der kreative Erzieher Friedrich Fröbel Hauslehrer gewesen ist. Da auch Goethe im Schlösschen gegenwärtig war, kommt er mit den Erfahrungen seiner "theatralischen Sendung" zu Wort. Die Geschichte ist ein Patchwork, bunt und abwechslungsreich wie der Vorhang, den die Kinder für ihre Schulbühne schaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Kindheit der Kunst
Lambert Petri
Im Holzhausenschlösschen „auf der Öde“
Wolfgang Böhmer
Der Pelikan von Lambarene
Harald Jacoby
Das Wort „Volksschule“
Hermann Hundt
Die Schule
Sigrun Engelskirchen
„Ich danke Dir
Kurt Schumacher
Der Genius des Regierens
Helga Goebel
Die Kastanienallee
Nikolaus Hartmann
Der blonde Sopran
Werner Köhler
Leben
Elisabeth Bergmann
Am Fenster des Ateliers
Ekkehard Müller
Die jungen Künstler
Roswitha Grimm
Die öffentliche Empörung
Helmut Schatz
Goethes Erfahrungen
Pitt
Der Freiherr von Holzhausen
Gerda Pape
Aesculus hippocastanum
Ulrich Martin
Der Genius
Albert Abelmann
Die Kastanien
Elke Ebeling
Louis Remy de la Fosse
Fräulein Perschke
Ariadne
Kurt Maaß
Eine Familienrechnung
Isolde Musehold
In der Komödie der Verwandlungen
Rektor Titze
Die Genialität der Kindlichkeit
Severin Donath
Goethit
Hausmeister Kurlbaum
Von einer Hexe und einem Henker
Knud Fischer
Ein gläsernes Haus
Jürgen, Joachim und Christa Schrödel
Der Flickenteppich
Die Kindheit der Kunst
wurde in der Kastanienallee vor der Kulisse des Holzhausenschlösschens von jungen Musikern und Sängern gefeiert. Ihre Freude am Spiel flackerte bunt hinter Büschen und Zweigen. Man gab Haydns Untreue lohnt sich nicht. Die Oper weckte in Pitt die Erinnerungen an die Schule der Genien, in der – lange ist es her – kindliche Geister eine theatralische Sendung erfahren und viele Talente entfalten durften. Auch Pitt hatte auf der Bühne der Kinder eine kleine Rolle gespielt, wenn auch nur als Zaungast wie in seiner Loge über der Straße, diesseits des Rampenlichts.
Die Frankfurter Kammeroper hatte die stille Straße zwischen der Schlossbrücke und dem mächtigen schmiedeeisernen Schlosstor am Hindemithplatz in ein Theater verwandelt. Der Jubel der Stimmen stieg mit den Strahlen der Schweinwerfer hinauf zum Blättergewölbe der Freilichtbühne, hinauf auch zur Loge eines nicht zahlenden Zuhörers. Der saß am offenen Fenster, hoch im vierten Stock des Hauses, an dem sich die Fürstenbergerstraße und die Justinianstraße treffen. Das Schloss jenseits der Kronen der Kastanienbäume verwandelte sich in seinem hellen Schimmer in das gläserne Haus, das vor vierzig Jahren, in den frühen 1950er Jahren, in einem hannoverschen Schulhof gestanden hatte.
Die Klassen 8 a und 8 b hatten das Spiel Das gläserne Haus aufgeführt. Das Haus stand unter einem von den Kronen stattlicher Kastanienbäume gebildeten Blätterbaldachin auf dem weitläufigen Hof der Kirchroder Volksschule am Wasserkamp. Wer hat das Stück geschrieben? Pitt hatte den Namen des Autors, der dem Vierzehnjährigen nichts bedeutete, vergessen. Aber die Namen aller Darsteller in den Haupt- und Nebenrollen, aller, die in Dramaturgie, Regie und Requisite, an Beleuchtung und Bühnenbild mitwirkten, die Namen der Musikanten und aller Helfer hatte Pitt auf einem unsichtbaren Theaterzettel vor seinen Augen. Bis heute. Und da waren der Widerklang und der Widerschein, in denen das gläserne Haus an der Schule magisch neu erstand. Als alternativer Schauplatz bei Regenwetter hatte die Bühne der Turnhalle bereitgestanden. Würde vielleicht, dachte der Mann am Fenster, die Kammeroper ins Schloss einziehen, wenn es regnen sollte?
Pitt war der nicht-künstlerische Gehilfe der Intendanz der Schulhofbühne. Seine Rolle war wichtig: Er war – wie die jungen Leute im kleinen Zelt, das in der Kastanienallee als Kassenraum diente – für die Organisation des Kartenverkaufs, also für Vorverkauf, Abendkasse, Einlasskontrolle zuständig gewesen. Auch hatte er – nicht kreativ, sondern technisch – an der Handzettel- und Plakatwerbung mitgewirkt, und es war ihm gelungen, in hannoverschen Zeitungen PR-Botschaften zu platzieren.
Viele Tage war in der Kastanienallee geprobt worden, an je drei Abenden an zwei Wochenenden wurde die Oper aufgeführt. Pitt verfolgte besorgt die Wettermeldungen und tastete nachmittags das Firmament nach Wolkenschatten ab, beruhigt allerdings durch die Erfahrung, dass zwischen Main und Nidda das Wetter stabil regenärmer ist als zwischen Harz und Heide, im wetterwendischen Hannover, wo, vor vierzig Jahren, bei drei Aufführungsabenden ein einziges Mal das ganze gläserne Haus mitsamt dem Inventar halsüberkopf demontiert und in die Turnhalle transportiert werden musste, und all die Bänke dazu.
Pitt hatte trotz seiner nachbarschaftlichen Neugier auf das Spektakel versäumt, sich Karten für die Haydn-Premiere zu besorgen. Doch die jungen Leute im Zelt hatten dem Pittpaar Einlass in die ausverkaufte Kastanienallee gewährt, als es mit seinen Klappstühlen vom Balkon im Kassenzelt erschienen war und um einen gut bezahlten Standplatz für ihre Sperrsitze gebeten hatte.
Als Pitt die schöne Frankfurter Dichterin mit dem weiß leuchtenden Gesicht unterm Kleopatrahaar („gemäßigter Existentialismus, viel Schwarz, lange Hemden“, schreibt sie in ihren Memoiren) an seinem Klappstuhl vorbei durch den Mittelgang zur ersten Reihe schreiten sah, erkannte er in ihr seinen Lehrer für Deutsch und Zeichnen (ja, der Vater der Dichterin war auch ein Bühnenbildner). Unter seinen streng-freundlichen Blicken war das gläserne Haus entstanden, unter seiner mild-liberalen Aufsicht. Doch er verstand an der langen Leine heftig zu rucken, wenn sich die Spielschar Nachlässigkeiten erlaubte. Dabei warf er die volle dunkle Dirigentenmähne, die in den frühen fünfziger Jahren in einer vorstädtischen Volksschule ein Blickfang war, mit ausdrucksvoll leidender Miene zurück.
Der mächtigste Kastanienbaum stand nicht in der Allee, sondern auf einem verwilderten Grundstück an der Fürstenbergerstraße unterhalb der Balkonloge. In einem Holzschuppen in der Nähe des Stammes lagerten Säulenschäfte, Kapitelle, Gesimse und Steine wie im Funduskeller eines Theaters. Die barocken Trümmerteile waren ein Dutzend Jahre nach dem Opernereignis nicht in das Gebäude eingefügt worden, das neben der Kastanie entstanden ist, mit Luxuswohnungen, deren hohe, breite Fenster Pitt wieder an sein fernes gläsernes Haus erinnerten.
Ein prachtvolles Monument aus vergangener Zeit: so hatte der blühende Solitär an der Ecke gestanden, als das Pittpaar vor zwanzig Jahren – „im Holzhausenviertel wollen viele wohnen“, hatte der Makler den etwas nörgeligen Neufrankfurtern gesagt – die Wohnung im vierten Stock gefunden hatte. Das auf charmante Weise heruntergekommene Eckhaus ist mittlerweile in einer Residenz mit Luxusetagen verschwunden. Das schwebend zarte April grün der Kastanienblätter schien den Schimmer seiner Frische auf die weiße Fassade geworfen zu haben. Der Weißbinder, den Norddeutschen als Maler geläufig, war beauftragt worden, dem Schlafzimmer diesen Hauch des zartesten transparenten Grüns zu geben, was ihm jedoch misslang, und das hatte für das in seine chimärische Farbe verliebte Pittpaar die Folge, jahrelang in einer dunkelgrünen Höhle schlafen zu müssen.
Auf dem Schulhof am Kirchroder Wasserkamp hatte inmitten des von Ligusterhecken und Kastanien gerahmten Gevierts auch ein so urtümlicher Riese gestanden, der die ABC-Schützen mit seinen Kerzen begrüßte. Im Herbst war er von einem Sperrseil umgeben, damit herabprasselnde Kastanien – das Wegschlagen der Früchte war strengstens verboten – die Kinder nicht verletzten.
Wie konnte Haydns Musik, wie das glockenhell klingende Duett den Zaungast in seiner Loge an das Spiel um das gläserne Haus erinnern? Das Spiel auf dem Schulhof war ein pädagogisches Stück in einer kräftig gezeichneten Tendenz. In ihm verwandelte sich das Haus, der zentrale Schauplatz, im Gang der Ereignisse über Nacht in ein gläsernes Haus: es stellte die schlampige Hausfrau, die nicht fegte, nicht putzte, den Abwasch und die Wäsche liegen ließ und die Betten nicht machte, am Morgen einem kritischen Dorfpublikum in ihrer ganzen desaströsen Unhäuslichkeit zur Schau – ein Prangerstück voller Pein und Scham. Pitt erinnerte sich schwach: doch die jäh hereingebrochene Durchsichtigkeit hatte wohl dazu geführt, dass es der unreifen jungen Hausfrau wie Schuppen von den Augen gefallen war und sie fortan mit ihrem Mann bis zur Gnadenhochzeit in mustergültiger häuslicher Ordnung hinter festen undurchdringlichen Mauern leben konnte.
Irgendwann, so hoffte Pitt, würde er die Geschichte des Gläsernen Hauses wiederfinden. Nicht lange nach der Haydn-Performance vor der Schlossfassade hatte er im Fernsehen, im ersten Programm, wohl 1994, einen Psychothriller mit der so sensibel verschreckten Katja Riemann und dem bedrohlich-tapsigen Vadim Glowna gesehen. Das Gläserne Haus hieß der Film von Rainer Bär, und er hatte ihn sich angeschaut, weil er hoffte, dem Spiel seines Schultheaters auf die Spur zu kommen. Ja, auch hier stand das Glas für Transparenz: die schwangere Heldin und ihr iranischer Arztmann, den nicht Glowna spielte, wurden in ihrem Haus am Stadtrand von Leipzig durch fremdenfeindlichen Terror bedroht. Katja Riemanns Entsetzen war nicht größer als das der jungen Hausfrau, die sich in ihrem Schaufenster den hämischen Blicken der ordnungsliebenden Dorfgenossen so jäh ausgesetzt sah. Die erhobenen Zeigefinger würden, dachte Pitt, auch jenseits der Jahrhundertwende zu sehen sein, und vielleicht würde dann wieder ein eifriger Vierzehnjähriger dem Pensionär Pitt seine Eintrittskarten für ein pädagogisches Verwandlungsstück verkaufen. Das Billett würde im perfekten Computer-Design für eine brillante Aufführung werben, nicht mit dem verschmierten, in die Kartoffel geschnittenen Stempel, auf dem die Farben Rot, Blau, Grün für die Preisstufen standen.
Aber warum sollte die Geschichte wiedergefunden werden? Kam es auf die Geschichte an? Das Theaterspiel mit seinen Worten, Farben, Bildern, Klängen, Formen, mit der Energie, die in ihm steckte, seinen kühnen Gesten, seinem Geist, der es zum Strahlen bringt, seinem Witz, der es in Bewegung hielt – das geht der Erinnerung nicht verloren. Die Blitze der Genien, die dem Leben Lichter aufstecken, vor einem faszinierten Publikum: sie können nicht vergessen werden.
Wohin haben euch, ihr Genien, die Flügel des Spiels getragen?
Den Führer des Genienreigens am gläsernen Haus hat Pitt, viel später, einmal getroffen, im hannoverschen Theater am Ballhof, dem Ziel eines Heimwehtrips. Er hat nicht mit ihm gesprochen. Alles war grau an ihm geworden, die immer noch schüttelbar volle Dirigentenmähne, der schlabbrige Anzug, das Hemd mit dem Priesterkragen, das Gesicht, in dem nicht nur graue Warzen an das Antlitz des alten Franz Liszt erinnerten. Neben ihm hatte eine junge Frau gestanden, als deren Doppelgängerin Pitt die Dichterin in der Kastanienallee erkannt hat, vielleicht die Musagetin neuer Genienscharen. Wo sind sie geblieben, die Genien, die Sie einmal, Herr Abelmann, um das gläserne Haus versammelt haben, wissen Sie noch, die Klassen 8 a und 8 b, 1953? Leuchten die Kerzen der Kastanie noch?
Pitt hätte sich als ehemaliger Schüler zu erkennen geben können, wenn auch nicht als Mitspieler, denn er war ja nur der musenfremde Kartenverkäufer gewesen. Aber da gab es eine unüberwindbare Barriere der Scheu: für den Albert Abelmann war Pitt ein hoffnungslos amusischer Fremdling in seinem Kreis gewesen. Er hatte ihn einmal, ein unvergessliches Desaster, im Zeichenraum mit einer deftigen Ohrfeige auf den Rand des Tischkastens geworfen, in dem die Viertklässler gerade die Topographie des Leinetals in Sand nachgebildet hatten, so dass die stützende Hand einen der sieben Berge, den Himmelberg, zerstören musste. Pitt konnte nicht zeichnen, und er hatte sich verzweifelt-lügenhaft eine künstlerische Urheberschaft angemaßt, indem er eine Zeichnung seines begabten Bruders abgeliefert hatte. Er hatte begriffen, dass die Ohrfeige nicht künstlerisch, sondern moralisch motiviert war, aber sie hatte jenseits aller Gründe geschmerzt. Den alten Lehrer jetzt erinnerungsselig zu begrüßen, hätte bedeutet, ihm die andere Wange hinzuhalten.
Wäre es nicht doch klüger gewesen, dem Lehrer Abelmann in seinem gewiss von rüstiger Geistigkeit geprägten Ruhestand einen Brief zu schreiben und ihn zu fragen: wer hat Das gläserne Haus geschrieben? Eine Frage kann uns viele, viele Jahre beschäftigen, und wir versuchen sie loszuwerden durch Nachforschung in den Büchern und im Internet und durch eine immer wache diffuse Aufmerksamkeit gegenüber allen Assoziationen, die sich einstellen, wenn etwas „gläsern“ ist, ein Sarg, ein Pantoffel, ein Engel. Die Lektüre des Stückes könnte Pitt helfen, Gesicht, Stimme, Haltung der Protagonisten und Chargen und aller Helfer, die das Stück auf die Bühne gebracht haben, in die beschwörende Stunde zurückzurufen.
Der materielle Nutznießer der Aufführung auf der Wasserkamp-Bühne war zu einem kleinen Teil der Tierschutzverein „Der Pelikan von Lambarene“ und zum größeren sein Pate, der Urwalddoktor. Sie war natürlich eine Benefizveranstaltung gewesen. Lucie Kriester war die in Kirchrode wohnende Präsidentin des Tierschutzvereins und eine gute Bekannte, ja Freundin des weltberühmten, in seiner Popularität jeden Filmstar überstrahlenden Albert Schweitzer in seinem Lambarene, wo er den Besuch seiner Freundin oft empfangen hatte. Am Schluss der letzten Aufführung überreichte Rektor Titze seiner Kollegin, der Rektorin der Albert-Schweitzer-Schule, den Reinerlös als Spende für den Schutz der Tiere unterm Zeichen des Pelikans und für das afrikanische Hospital. Auch Pitt, durch dessen Hände ja alle die Gelder gegangen waren, durfte unter artiger Verbeugung einen Handschlag der Schweitzerfreundin entgegennehmen: überwältigend, die Hand einer Frau drücken zu dürfen, in der die Hand Albert Schweitzers gelegen hatte. Pitt hütet einen Brief von Lucie Kriester als seinen Schatz, denn er ist der Beweis dafür, dass Pitt auch als Kartenverkäufer – Kunst geht nach Brot – einen Platz am Rande des Reigens der Genien gehabt hat.
Lambert Petri
führte, den Kopf unter dem fallenden Blondhaar schräg haltend, die weiße und die farbige Kreide mit weitgestrecktem Arm so leicht, in einem so anmutigen Schwung durch seine Bilder, als löste sie sich in der Berührung mit dem dunklen Schiefer auf und legte sich als Blütenstaub auf die dunkle Wand der Tafel. Er hatte für den Bühnenbildner Wolfgang Böhmer die künstlerische Lösung für die Verwandlung eines spießig soliden Steinhauses in ein gläsernes Haus gefunden. Auf Bettlaken hatte er ein Ziegelwerk aus Rot und Rotbraun aufgetragen, auch ein Regenrohr in plastisch wirkender Kupferpatina fehlte nicht, nicht der Fensterrahmen zwischen hellgrünen Laden, die geblümten, löcherigen Gardinen über Kästen mit teils blühenden, teil verwelkten Geranien auf dem Fensterbrett. Wenn sich die Wände in Glas verwandeln sollten, wurde das Mauergewebe hochgerafft: und makellose Glaswände aus einem Guss, ein Nichts aus dem Nichts, waren entstanden. Wenn Lambert Petri Glas zur Verfügung gestanden hätte, die große Schaufensterscheibe vielleicht, wie sie gerade in Bollmanns hochmodernen Bolljenladen am Feuerlöschteich eingesetzt worden war, hätte er den Widerschein des Morgenrots, in dem der Bäckerjunge sich den Kopf an der Glaswand stößt, auf sein zerbrechliches Material gezaubert.
Pitt hatte einen Drachen, der durch Lamberts Ingenium zum Luftschiff wurde. In einer Comic-Serie der Hannoverschen Presse erlebten der kleine Käpt’n Kopp und sein Maat Jan Tag für Tag ihre Seeabenteuer. Der pfiffige Kommandant und sein dickdümmlicher einziger Matrose, dem er nur bis zur Hüfte reichte, schipperten mit ihrer Dampfbarkasse – wie hieß sie doch? – auf immer abenteuerlicher Fahrt auf den Meeren, doch Lambert hob die beiden Helden mit ihrem unverwüstlichen Schiff, das einem Schlepper im Hamburger Hafen ähnelte, in die Lüfte, indem er alle drei auf Pitts Drachen, auf das knatternde dünne Papier malte. (Pitt wollte die Comic-Bücher des genialen niederländischen Künstlers Marten Toonder antiquarisch erwerben, aber o weh, ihr Preis ist horrend).
Da standen sie, der kleine Käpt’n Kopp unter seiner riesigen Kapitänsmütze und Maat Jan mit Südwester, Vollbart und Pfeife, hoch in der Atmosphäre und schauten auf die Schwarzbunten am Bombentrichter auf der Weide herab, auf der Pitt und seine Freunde in rhythmischer Bewegung an der Schnur zogen und riefen „Hallo, Käpt’n Kopp, wie fühlen Sie sich in Ihrem Luftschiff bei Windstärke 10?“ Mit den Seebären an Bord hat Pitts Luftschiff nie Schiffbruch erlitten. Was hat Pitt mehr bewundert, die Meisterschaft der Konterfeis oder die Idee der seemännischen Luftfahrt oder beides, den grandios-originellen Effekt? Ist Kunst nicht immer die Fähigkeit, Erscheinungen, die nicht zueinander gehören, zusammenzubringen?
Für die Feier der Schulentlassung hatte Lambert die dunkelgrüne Tafel, die auch in der kleinen Aula nicht fehlte, in ein Landschaftspanorama verwandelt. Zwischen Bergen, Tälern, Blumenwiesen schlängelte sich ein Weg, der in einer Gabelung endete, und vor ihr, dieser schicksalhaften Zwille, stand, wie auf einem Gemälde Caspar David Friedrichs mit dem Rücken zum Betrachter, ein sinnender Wanderer, und Rektor Titze sprach über das Scheiden, die Scheidewege und die Entscheidungen.
Welchen Weg bist du gegangen, Lambert? Hast du den richtigen Weg gewählt? Konntest du überhaupt wählen? Und wenn nicht, hast du jemanden gefunden, der dir den richtigen Weg gezeigt hätte, und wenn du den falschen gegangen bist, war er ein Umweg, der jenseits des Horizonts doch mit dem richtigen zusammengelaufen ist? Der Beruf des Technischen Zeichners, in den man ihn, den Charakter seines Talents verkennend, drängte, war nicht die richtige Wahl: er brach die Lehre ab und verdingte sich im Atelier eines Schildermalers. Pitt – er wohnte nicht mehr in Kirchrode – hat den bewunderten Künstler einmal vor dem Lichtspieltheater Germania in der Tiergartenstraße, dem Ort unvergesslicher Kinoereignisse, getroffen. Er befestigte gerade sein hochbreites Plakat über dem Eingang: kantiges Cowboygesicht, Pferdekopf, blondes Haar, volle Lippen, hoher Busen vor einer Kette blauer Berge, eine Kaktee. Dem Betrachter auf der Straße verborgen, das feingezeichnete Raster der Quadrate, das dem Maler hilft, seine Vorlage auf die Riesendimensionen des Plakats zu übertragen. „Meinen Käpt’n Kopp hast du freihändig auf den Drachen gemalt.“
Er verdiene sich das Geld, um eine graphische Ausbildung in der Schweiz zu beginnen, hatte Lambert Petri gesagt. Wenn Pitt durch die Galerien geht oder die Kunstmessen durchstreift, sucht er immer die Signatur: L. P. Die stand auf dem Drachen, an der unteren Spitze, wo der Schwanz befestigt war, der die Luft wie ein Schraubwasser moussieren ließ. Wie hoch können Drachen aus Papier steigen?
Im Holzhausenschlösschen „auf der Öde“
hat Goethe die Sammlung der alten deutschen Meister, die von der Familie von Holzhausen in Generationen zusammengetragen worden ist, besucht. Er ist zweimal durch die Kastanienallee gegangen, am 22. September 1814 und am 12. September 1815. Er wird wohl mit der Kutsche durch das hohe schmiedeeiserne Tor am Oeder Weg zur Brücke am Schlossteich gefahren sein.
Dichtung und Wahrheit: „Wir können die kleinen Geschöpfe, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Vergnügen und Bewunderung ansehen: denn meistens versprechen sie mehr, als sie halten, und es scheint, als wenn die Natur unter anderen schelmischen Streichen, die sie uns spielt, auch hier sich ganz besonders vorgesetzt, uns zum besten zu haben.“
Wer immer etwas schreibt, verfolgt auch eine Absicht. Pitt will bei der Frankfurter Bürgerstiftung, die das Holzhausenschlösschen nach dem Ende seiner Epoche als Archiv und Museum und seinem radikalen Umbau zum gehobenen Clubheim in ihre Obhut genommen hat, dafür eintreten, dass eine Inschrift am Brückenpfosten an die Besuche Goethes erinnert. Dort ist schon eine, die das Wirken Friedrich Fröbels, Hauslehrers im Schlösschen, vergegenwärtigt. Natürlich: viele Frankfurter Häuser müssten solche Plaketten tragen. Das Schloss verdient das erinnernde Graffito tausendmal mehr als die vielen Gasthöfe und Bürgerhäuser im ganzen Land, in denen Goethe ein einziges Mal übernachtet hat. Auf geheimnisvolle Weise ist Goethe mit dem genius loci des Wasserschlosses verbunden. Pitt hat einmal Martin Walser, der dort aus seinem Roman über Goethes letzte schmerzliche Liebe, Ein liebender Mann, las, aufklären dürfen, dass er auf einem Boden stand, den der Fuß des in seinem Roman Beschworenen betreten hatte.
„Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies.“ Ob Goethe bei seinen Besuchen im Holzhausenschlösschen auch die jungen Leute kennengelernt hat, die dort, ein paar Jahre zuvor, der Führung Friedrich Fröbels anvertraut waren? Jedenfalls hat Goethe nicht gewusst, dass er auf seinem Weg durch die Kastanienallee den ersten Kindergarten der Welt betreten hat.
Dichtung und Wahrheit: „Aber das Wachstum ist nicht bloß Entwickelung; die verschiedenen organischen Systeme, die den einen Menschen ausmachen, entspringen auseinander, folgen einander, verwandeln sich ineinander, verdrängen einander, ja zehren einander auf, so dass von manchen Fähigkeiten, von manchen Kraftäußerungen nach einer gewissen Zeit kaum eine Spur mehr zu finden ist.“ Doch kann sich das ungeheure Potential in diesen inneren Kämpfen ins Nichts verflüchtigen? „Kaum eine Spur“ ist eine Spur. Die geniale Anlage, die irgendwann in ein für andere musterhaftes Tun mündet, das die Entwicklung aller um eine Stufe erhöht, wird nie verloren gehen. Denn wir lernen voneinander, alle, unaufhörlich. Und es gibt tausend Berufe und Berufungen, Gaben und Begabungen in einer unendlich differenzierten Abstufung, in denen die Spur sichtbar bleibt.
Heute ist Pitt wieder am Holzhausenschlösschen gewesen. Die Fassade war über und über mit Sonnenblumen geschmückt. Sie leuchteten, im Wettbewerb mit einem realen Sonnenschein, den Hunderten von Kindern, die in der bunten Spiel- und Spaßstraße, in die sich die Justinianstraße auf ihrer ganzen Länge verwandelt hatte, vielerlei kreativen Beschäftigungen nachgingen: dem Basteln, Malen, Kneten, Schminken, Verkleiden, Musizieren (wenn sie es nicht vorzogen, mit einem Traktor den Oeder Weg entlangzuschuckeln oder in blumengeschmückten Fahrradrikschas durch den Park kutschiert zu werden). Väter und Mütter, solo oder paarweise, hatten sich diskret an die Gartentische zurückgezogen. Die Frankfurter Bürgerstiftung feierte ihr internationales Kinderfest. Ein Fröbel-Festival, dachte Pitt. Er war, mit seinem Rollkoffer im Schlepp, auf dem Weg zum Bahnhof und konnte nicht auf die Stars des Festivals warten, auf Olga & Pierino, die Ballerina und den stillen Clown. Wie gern hätte er sie gesehen!
„Wer wäre imstande, von der Fülle der Kindheit würdig zu sprechen?“
Wolfgang Böhmer
war der Bühnenbildner, der das gläserne Haus geschaffen hatte, mit Sträuchern und Blumen in Kübeln als Gärtchen, das im Hintergrund auf die natürlichste Weise von der Maulbeerhecke des Schulhofs begrenzt wurde. Er hätte alles sein können, Autor, Regisseur, Schauspieler, denn er war ein Puppenspieler. Der Vater, ein Malermeister, hatte in seinem Garten eine Werkstatt, eigentlich nur ein Lager für Leitern, Kanister, Pinsel, Tapetenrollen. Und dort stand das Marionettentheater, dessen Meister Wolfgang war.
Viele Nachmittage hat Pitt mit seinen Freunden vor der Bühne gesessen, auf langen, von Farbeimern getragenen Gerüstbrettern, bei Märchen und Kasperklamauk. Zwei tiefe Rillen haben sich ins Gedächtnis der Sinne gegraben: das berauschende ätherische Amalgam aus Farben, Terpentin, Ölen, Leim und die magisch attraktive Tiefe des Bühnenbildes, vor dem der Alleinunterhalter, der nur manchmal von seiner Schwester Erika unterstützt wurde, seine Puppen in Bass und Diskant agieren ließ.
War der perspektivische Schein, der die Zuschauer hineinzog in Licht und Schatten eines Waldes oder der Gassenflucht einer kleinen Stadt, nur die Wirkung einer handwerklich geschickten Bastelei mit Pappe, Pergament und Pastellfarben? Oder verzauberte nicht doch der Effekt eines künstlerischen Kalküls, wie es die barocken Meister für ihre Schlossgärten und Schlosshallen ersonnen hatten? Ein schwebendes Wunder! In staunender Hochachtung betrachtete Pitt seinen Klassenkameraden, der in seine Puppen vernarrt war, aber jedes Lob seiner bühnenbildnerischen Kunst abwies: „Da muss mal wieder ´ne neue Tapete rein.“
Wenn Pitt vor kalt-kargen, gleißend flackernden oder düsteren Bühnenräumen in den postdramatischen Theaterhöllen sitzt, wartet er auf Wolfgang Böhmers Genie. Wäre Wolfgang nach seiner Malerlehre nicht ins väterliche Geschäft eingestiegen, hätte ein lenkender Zufall oder ein Wink der Natur ihm den „schelmischen Streich“ gespielt, ihm den Weg zu den Bühnen zu weisen: welche Tapete für den lebendigsten Raum unseres Lebens hätte er entwerfen und kleben können! Pitt war sehr traurig, als er hörte, dass Wolfgang Böhmer mit vierzig Jahren gestorben ist.
Die Böhmersche Malerwerkstatt ist in Pitts Erinnerung die „Kammer“, die er ein paar Jahre später in Wilhelm Meisters Theatralischer Sendung kennen lernte. Diese Kammer war am Christabend durch einen grünen Teppich als „mystischen Vorhang“ von der Wohnstube getrennt gewesen. Mit einem Pfiff war der Vorhang in die Höhe gerollt und hatte die staunend-überraschten Blicke der Kinder in einen Tempel gelenkt, in dem das biblische Schauspiel von David und Saul, Samuel und Jonathan seinen mörderischen Verlauf nahm.
Der nüchterne Malersaal des Malermeisters Böhmer, das unbequeme Hocken auf Farbeimern, gekippten farbbeklecksten Leitern und rissigen Gerüstbrettern waren nicht schuld daran, dass die Illusion so kurzlebig war, auch nicht die zum Husten reizende, von Terpentin, Ölen und Lacken gebeizte Atmosphäre. Wie in der Stube der Familie Meister stellte sich nach Wolfgangs in höchster stimmlicher Beweglichkeit aufgeführtem Spektakel ein gewisses Ungenügen ein. Ihm hatte der kleine Wilhelm noch in seinem Bett nachgesonnen, „unbefriedigt in seinem Vergnügen, voller Hoffnung, Drang und Ahnung“. Jede Bühne gibt, für die Akteure wie für die Zuschauer, ein Vorspiel des ins Dunkel gehüllten Lebens.
Der Pelikan von Lambarene,
der weise Vogel vom Ogove, war ein Gesprächspartner des Urwalddoktors. Dass es Menschen gibt, die sich mit allen und allem, mit Mensch, Tier, Pflanze und Mineral verständigen können! Albert Schweitzer und Anne Wildikann hatten, mit vielen aufregenden Fotos, die Autobiografie des urweltlichen Vogels erzählt: ein Pelikan erzählt aus seinem Leben. Wenn Pitt das Pelikanabzeichen seines Tierschutzvereins am ledernen Träger seiner Lederhose betrachtete, meinte er den Vogel sprechen zu hören. In welcher Sprache hatte der Doktor sich mit dem Vogel unterhalten – im Elsässisch-Alemannischen, in Krächzlauten der Natur? Wer Weiser, Musiker, Arzt, Seelsorger, Menschenfreund ist, vermag wohl in der gemeinsamen Vatersprache aller Geschöpfe, in der Muttersprache der Natur zu sprechen. In der Ehrfurcht des Zuhörens entfaltet sich die universale Kommunikation.
Wenn der Kirchroder Vorstand des „Pelikans von Lambarene“ bei Lucie Kriester in der Steinbergstraße zu Gast war, ging es nicht nur um die organisatorischen und akquisitorischen Aufgaben des Tierschutzvereins, für die sich Pitt, nicht untalentiert, am meisten interessierte. Für Lucie Kriester hatte der Tierschutz eine pädagogische, eine symbolische Bedeutung: er wies über den Schutz der dem Menschen unterlegenen Kreatur hinaus auf den Schutz des Lebens. Dem Leben beistehen. Das Leben, in welcher Gestalt es sich rege, beschützen. Albert Schweitzer sei seit seiner frühesten Jugend der Tierschutzbewegung zugetan gewesen. Doch das sei nur ein Weg in das große Geheimnis des Lebens gewesen. Wer das Recht des Tieres ehre, sei ein Verteidiger alles Lebendigen. Auch Pitts ängstliche Frage, ob er barbarisch handele, wenn er zuließe, dass sein das ganze Jahr über gut gefüttertes und gehegtes Kaninchen zu Weihnachten geschlachtet werde, wurde von Lucie Kriester beruhigend beantwortet. Auch der Doktor Schweitzer habe jeden Tag eine Menge Fische getötet, um einen jungen Fischadler, den er aus den Händen gleichgültiger Eingeborener habe retten wollen, am Leben zu erhalten, der Doktor sei nicht sentimental, er wisse, dass sich das eigene Leben wie alles Leben nur auf Kosten von anderem Leben erhalten könne. Die Gedankenlosigkeit im Umgang mit dem Lebendigen, das sei das Verwerfliche.
Ein Philosoph des Lebendigen war auch der Autor von Dichtung und Wahrheit, der zweimal Gast im Holzhausenschlösschen gewesen war. Und wer weiß, ob er nicht in seiner Kindheit, in der er noch nicht sein Tagebuch führte, nicht schon einmal hinausspaziert war auf die Öde, auf der das Schlösschen lag, denn der Apfelgarten seiner Eltern war nicht weit von ihr entfernt. Einen besonders schönen Satz in der elementaren Sprache des Lebens hat er nicht für Dichtung und Wahrheit geschrieben, sondern ihn im Entwurf einer Vorrede versteckt: „denn man lebt mit Lebendigem.“ Das sei die Aufgabe einer Lebensbeschreibung: das Leben darzustellen, wie es an und für sich und „um sein selbst willen“ da sei. Auch Autoren verstecken manchmal ihre besten Sätze in Entwürfen und Skizzen, wie es die Kinder tun, die ihre sich „andeutenden“ Talente in ihrem selbstvergessenen Tun verstecken.
Vom Frühling hat Goethe gesprochen, wie ihn Pitt in der Kastanienallee, wie er ihn auf dem Schulhof am Wasserkamp viele Jahre erlebt hat: die Kastanienbäume im Kerzenglanz. Das sind die Lichterbäume des Frühlings. Die „Herrlichkeit des Frühlings“, die Kindheit, die Jugend: das ist das Thema von