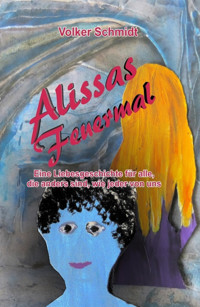5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
15. Jahrh. - eine Gruppe von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Ausbildung begleiten Heinrich den Seefahrer, der die Lande südlich des Äquators erkunden will. Neue Handelsbeziehungen und weitere Kolonien sind der scheinbare Antrieb Portugals. Doch dies ist nur ein Vorwand für eine ganz andere Suche - die Suche nach der göttlichen Macht. Sie beginnt in England und führt bis ins aksumitische Reich. 800 v. Chr. begann die Geschichte Aksums mit dem Reich der Sabäer und ihrer salomonischen Dynastie. Es wurde gegründet durch Menelik, dem Sohn von König Salomon und der Königin von Saba. Sogar noch heute wird in der Kebra Negast - einem altäthiopischen Werk, ähnlich der Bibel - behauptet, dass diese Dynastie in direkter Linie zu den Stammvätern Abraham und David steht und sie damit die direkten Nachkommen von Jesus Christus sind. Sogar einige der vermissten heiligen und sakralen Gegenstände aus dem alten und neuen Testament sollen sich hier wiederfinden lassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Volker Schmidt
Der Physicus
- Das salomonische Erbe -
Roman
© 2020 Volker Schmidt, Prof. Dr.
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-06611-3
Hardcover:
978-3-347-06612-0
e-Book:
978-3-347-06613-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Erster Teil:
Kapitel I - Die Heilerin
Avignon, ehemaliger Sitz des Papstes und Residenz des Königs
1448 anno Domini, Winter
Es hatte erst vor kurzem geschneit und über den Dächern von Avignon lag eine dichte Decke aus schimmernden Schneeflocken. Zierlich weiß schoben sich ab und zu kleine unscheinbare Wölkchen vor den Sternenhimmel und verdeckten dabei die Sicht auf die hell leuchtenden Sternzeichen. Manchmal sah man schlierenartig das Wetterleuchten am Himmel, was in letzter Zeit doch immer häufiger zu sehen war. In dieser Gegend - soweit südlich - war das eigentlich ungewöhnlich. Wenn man ganz genau hinschaute, konnte man sogar sehen, wie die Engel die Sterne zum Glänzen brachten, weshalb dessen hellgelbes Licht dabei ständig zu Flackern schien. Sie funkelten besonders hell und schön in eiskalten Nächten und derer waren es zuletzt sehr viele. Herrlich gemütlich kam dann der Duft von Eichenholz aus den Kaminen und hüllte die Stadt in einen angenehm warmen Dunst.
Der Fluss - die Durance - war zum Teil schon zugefroren, was das Arbeiten zwar wahrlich nicht leichter machte, doch der Anblick von bunten sich im Eis spiegelnden Häusern war Entschädigung genug für den Mehraufwand, den die Kälte mit sich brachte. Wären die Zeiten nicht so brutal real gewesen und hätten die Bewohner zuletzt nicht ständig frieren müssen, weil das Brennholz mal wieder knapp war, dann hätten sich in der heutigen Nacht vielleicht sogar ein paar warme Träume erfüllt. Träume, wie sie kleine Kinder manchmal haben. Träume, die sie forttragen in die Gegenden eines Zauberreiches mit bunten Gnomen und fliegenden Feen. Doch heute saßen die Kinder in Avignon nur vor den Fenstern und sie schauten hinaus auf den verschneiten und eisigen Fluss. Das träumen war ihnen in dieser Woche schnell vergangen, denn allzu eilig kam mal wieder die eiskalte Nacht. Eng aneinander gedrängt schliefen die Familien in einem kargen Bett aus Stroh und Laken, das Feuer in Gang haltend und ständig versuchend ein Auge zuzumachen und etwas Schlaf zu bekommen. Doch der frostige Winter war in diesem Jahr übermächtig geworden. In dieser Nacht war an Schlaf nicht zu denken.
Auch Julie saß nur still an ihrem Tisch und aß ohne einen Gedanken ihr Abendbrot. Für Holz hatte sie gestern noch gesorgt, so dass das Feuer herrlich warm loderte. Sie lebte alleine, ohne Mann, in einem kleinen Haus, in das sie sich vor etwa drei Jahren eingemietet hatte. In ihrem kargen Raum mit Kamin und Bett, lagen neben ihr auf der Sitzbank drei große Haufen mit weißer Wäsche. Es war schon spät am Abend - vielleicht um Mitternacht - sie hatte gerade das Bettzeug von drei betuchten Familien fertig zusammengelegt, da überkam sie ein Anfall von Müdigkeit. Am liebsten wäre sie gleich hier, an Ort und Stelle, eingeschlafen, auf dem Stuhl, auf dem sie saß. Doch sie musste etwas essen, bevor der nächste Tag wieder nur noch mehr neue Arbeit bringen würde. Eine Feier stand an und der Domprobst hatte zur Hochzeit seiner Tochter geladen. Da war Arbeit in Hülle und Fülle vorhanden.
Ohne Appetit zwängte Julie sich gerade einen kleinen Happen in den Mund, dabei dachte sie an ihren Vater, als plötzlich die Tür aufflog und eine kleine Frau, völlig außer Atem, in ihr Haus trat. Es war eine Dirne - das war unschwer zu erkennen - ihre Aufmachung verriet dies und ganz offenbar hatte sie es nicht nötig, anzuklopfen.
»Schnell, Madame« rief sie. »Kommt bitte schnell mit. Mein Mann liegtim Sterben.« Die Frau schloss die Tür von innen - ziemlich hektisch - wartete dann aber geduldig ab, was die Julie ihr antworten würde.
Julie schaute etwas ärgerlich drein, denn wieder einmal hatte sie vergessen, ihre Eingangstür abzusperren. »Wo?« fragte sie und zog sich ihren Umhang enger um ihre Beine, weil die hereingelassene Kälte bereits bis zu ihren Füßen vorgekrochen war.
»Er liegt in meiner Wohnung. In der Rue de la Vaucluse. Das alte Fachwerkhaus am Torbogen. Gleich neben der Kirche. Zweiter Stock. Schnell, Madame. Bitte helfen sie ihm« flehte die Dirne. »Er stirbt … glaube ich.«
»Ich komme. Gehen sie vor« sagte sie, stand auf und zog sich ihren Mantel über. Ihr Abendmahl ließ sie stehen, stattdessen griff sie nach ihrer Tasche und einer Öllampe. Die beiden Frauen rannten hinaus, durch die Gassen von Avignon, an der Durance entlang, hoch bis zur Rue de la Paris und von dort über eine Brücke, über den Domplatz und hinein in die Rue de la Vaucluse. Direkt hinter dem Torbogen stand ein armseliges Fachwerkhaus, das schon lange einzustürzen drohte. Die Frau öffnete die Tür und rannte den Treppenaufgang hinauf bis in den zweiten Stock. Julie folgte ihr einfach, ohne weitere Fragen zu stellen. Dann wurde die Wohnungseingangstür geöffnet und heraus kam ein ekelerregender Geruch. Die Dirne ging zuerst hinein, als ob ihr der Gestank nichts ausmachen würde. Julie dagegen hätte sich fast übergeben und blieb deshalb eine Zeit lang vor der Tür stehen. Sie wendete sich ab und zog dann eine Salbe aus ihrer Tasche, die sie auf ihre Oberlippe rieb, direkt unter ihre Nasenöffnungen. Kurzzeitig verzog sich dabei ihr Gesicht zu einer grotesken Fratze, doch dann lockerte sie ihre Züge wieder, und trat ebenfalls in die Wohnung hinein.
Eigentlich war es gar keine Wohnung. Genauso wie bei Julie selbst, handelte es sich eher um ein kleines Zimmer, in der eine winzige Kochnische und ein Bett untergebracht waren. Im Letzteren lag ein Mann Mitte Vierzig, der sich kaum noch bewegte. Julie stellte ihre Lampe auf den Beistelltisch, ging zum Fenster, riss die Vorhänge auf und öffnete es. Dann erst ging sie zu dem Kranken ans Bett. Sie setzte sich neben ihn und fühlte seine glühende Stirn, dann seinen Puls, der kaum noch zu spüren war. Er lag im Fieber und drehte seinen Kopf hin und her, als er von ihr untersucht wurde. »Er zeigt noch Regung. Dann ist noch nicht alles verloren« stellte sie fest und zog vorsichtig die Bettdecke auf. »Allmächtiger« rief sie, sprang von der Bettkante weg und bekreuzigte sich.
Julie hatte nicht nur den Korpus des Mannes aufgedeckt, sondern gleich auch noch sein halbes Inneres. In seiner Bauchdecke klaffte ein Loch, so groß wie eine Rummel. Das war damals das althergebrachte Wort für eine Futterrübe, für Menschen kaum genießbar. Sie wurde normalerweise angebaut, um die Schweine damit zu füttern, aber ab und zu auch um den eigenen Magen zu füllen, wenn mal wieder das Geld knapp wurde.
Julie untersuchte die Wunde. Der Magen und Teile des Darms lagen mehr oder weniger frei und waren überströmt von gelblichem Eiter. Die Wunde brannte, wodurch natürlich auch das Fieber ausgelöst wurde. Die Säfte verteilten sich schon in der Bauchhöhle. »Wie kann er noch leben?« fragte sie sich insgeheim, als sie den Bauchraum vorsichtig abtastete und sich sämtliche Flüssigkeiten über ihre Finger ergossen. »Es ist wie ein Wunder. Solch eine Verletzung überlebt man normalerweise nicht lange« dachte sie und schaute sich die entzündeten Organe an. Es musste schon ein paar Stunden her sein, so wie der Innenraum aussah. »Wie ist das nur passiert?« fragte sie. »Nein. Sagen sie nichts. Ich will es gar nicht wissen« schob sie gleich hinterher. »Besser, ich weiß es nicht« dachte sie. Sehr wahrscheinlich hätte sie sich mit jeder zusätzlichen Information über diesen Unfall, oder was es auch immer war, nur noch mehr Ärger eingehandelt. Dass sie für das hier Ärger bekommen würde, stand eigentlich schon jetzt fest. »Gerade läuft alles noch gut, und dann …« dachte sie »… und dann kommt sowas.«
Allein die Tatsache, dass sie bereits in das Haus der Dirne mitgekommen war und nun hier saß, reichte für Heiler meist schon aus, diese anzuklagen.
Es gab eigentlich immer nur drei mögliche Ausgänge, aus solchen Situationen, die aber alle fast immer aufs Gleiche hinausliefen. Wenn der Mann sterben würde, was in diesem Fall mehr als wahrscheinlich war, würde sie von seiner Frau angeklagt, ihn umgebracht zu haben. Das war eigentlich der Normalfall, wenn einer der Kinder oder Ehepartner unter ihrem Messer starb. Wenn er es widererwartend doch schaffen würde, dann spräche sich das sehr schnell herum, und manch einer würde ihre Künste für Schwarze Magie halten. Und selbst wenn sie jetzt einfach nur heimgehen würde, ohne noch irgendetwas für den Sterbenden zu tun, würde sie sich wahrscheinlich dem Zorn der Dirne ausliefern, die ihr dann übel Nachreden würde.
Der Mann musste es schaffen, das war die einzige einigermaßen sichere Möglichkeit diese Situation selbst unbeschadet zu überstehen. Trotzdem, Überlebende waren nur manchmal dankbarer als Tote, weshalb sie ihrer Bestimmung nur versteckt und sehr heimlich nachgehen konnte, so wie es auch schon ihr Vater und dessen Vater getan hatten. Von den beiden hatte sie alles gelernt und nichts tat sie lieber, als ihrer wahren Bestimmung nachzugehen. Aber leider war das meist etwas gefährlich. Denn ein Medicus war sie nicht, aber gebraucht wurde sie umso mehr, denn die Wenigsten hatten genug Geld um sich einen professionellen Heiler leisten zu können. Und so tat sie, worum sie gebeten wurde. Es war eben ihre Bestimmung die Hilflosen medizinisch zu versorgen.
»Ich bin nicht sicher, ob ich hier noch viel ausrichten kann«, versuchte Julie die Dirne auf den Tod vorzubereiten.
»Bitte, tun sie etwas. Wenn er stirbt, bin ich auch so gut wie tot« flehte sie Julie an. »Er gibt mir Schutz vor den Freiern, und ein Dach über dem Kopf. Er darf nicht sterben.«
»Ich verstehe.« sagte sie. »Trotzdem gibt es nur wenig Hoffnung, aber wenigstens die will ich ihnen geben.« Julie stand vom Bett auf, und holte Papier, Feder und ein Tintenfass heraus. Dann setzte sie sich an den Tisch, schrieb etwas auf den Zettel und gab es der Frau. »Geh’ zum Medicus und gib ihm dieses Papier.«
»Aber ich kann nicht lesen«, entgegnete die Dirne.
»Das wird auch nicht nötig sein, gib ihm nur den Zettel. Er wird dir einige Dinge mitgeben. Bring’ sie zu mir«, sagte Julie.
»Aber das kann ich mir nicht leisten, so viel Geld habe ich nicht« erwiderte die Dirne abermals.
Julie schaute mit verzogener Miene zur Dirne und kramte dann in ihrer Tasche »… hier, nimm das. Das sollte ausreichen. Für den Rest kaufe Brandwein … und schicke mir eine deiner Kolleginnen hinauf. Am besten eine, die nicht gleich umkippt und was vertragen kann. Sie soll mir zur Hand gehen, bis du wieder zurück bist. Aber beeile dich, wir haben nicht viel Zeit.« Die Dirne wollte gerade das Zimmer verlassen, als Julie noch einmal nachfragte. »Noch etwas … wo bekomme ich hier sauberes Wasser?«
»Sauberes Wasser? Nur am Fluss. Ich werde jemanden danach schicken« sagte sie, drehte sich um und ging hastig die Treppe hinunter.
Kurze Zeit später kam eine stämmige Frau die Treppe hinauf. Sie hatte sehr kräftige Oberarme und doppelt so dicke Schenkel. Ihr Hintern und ihre Brüste waren mächtig ausstaffiert und kaum zu übersehen. Die Frau war tatsächlich eine Kollegin der Dirne, denn ihr rot gefärbtes Haar fiel lässig auf ihre breiten Schultern, während ihre Brüste ein wenig über das enganliegende Kleid hinausragten. Und diese hier übte ihr Geschäft schon etwas länger aus, denn ihr Gesicht glich mehr einem runzligen Apfel als einem pelzigen Pfirsich.
Die Alte hatte einen Eimer mit Wasser in der Hand, den sie gleich am Kamin abstellte. »Ihr braucht mich?« fragte sie hart und blickte auf den Bauch des Mannes. Gleichzeitig nahm sie einen kräftigen Atemzug, hielt sich am Rand des Kaminsimses fest, senkte den Kopf vorneüber und übergab sich in hohem Bogen in die Ecke.
»Gut« sagte Julie. »Das hätten wir also auch schon erledigt. Dann kannst du mir ja jetzt helfen.«
»Verzeiht mir« erwiderte die Alte verlegen.
»Du musst dich nicht grämen, das geht vielen so. Und jetzt brauche ich heißes Wasser. Schnell« sagte Julie, die dem Mann gerade im Bauch herumwühlte und die Därme zu ordnen versuchte. »Mach Feuer und leg‘ zwei Zähne zu.«
Die beleibte Dirne legte Holz nach, fachte das Feuer neu an und hing einen Topf an den Schwenkarm, den sie zuvor mit Wasser gefüllt hatte. Dann schob sie diesen über die Feuerstelle und hängte ihn wie befohlen zwei Zähne tiefer. »Kann ich noch etwas tun, Madame?« fragte sie und blickte ehrfürchtig zu Julie.
»Allerdings. Ich brauche Tücher, saubere«, antwortete sie und suchte dabei aufgeregt in ihrer Tasche herum. »Hier, nimm… .«
»Ich werde welche besorgen« sagte die Dirne schnell und verschwand sogleich aus dem Zimmer. Nach zehn Minuten kam sie wieder und hatte weiße Bettlaken dabei, die sie ganz offenbar einer Waschfrau von der Leine gestohlen hatte. »Wird das gehen?« fragte sie Julie, die sie daraufhin äußerst misstrauisch anschaute.
»Von welcher Leine hast du sie genommen?« greinte Julie verärgert, aber die Dirne antwortete ihr nicht, sondern schaute nur verlegen in ihr Gesicht.
»Ich denke, es wird gehen. Zerreiße die Laken in dünne Streifen und bade sie im heißen Wasser.« Die ertappte Alte tat, was ihr gesagt wurde und verließ das Haus erst, als ihre Freundin wieder vom Medicus zurück war.
»Ich glaube, ich habe alles bekommen, was ihr aufgeschrieben habt, auch den Brandwein. Soll ich ihm den jetzt geben?« fragte sie.
»Nein. Um Gottes Willen. Er darf nichts trinken und schon gar nichts essen. Nicht vor morgen Abend, wenn er dann noch lebt, was ich bezweifle« sagte Julie hastig. »Und jetzt stell das hier neben mir ab … komm, setz dich zu mir.« Julie sah der Dirne tief in die Augen und nahm dann ihre Hände und legte sie in ihre eigenen. »Es wird jetzt etwas unangenehm, aber es lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen ihn reinigen … von innen und dabei den Wundbrand stillen.« Dabei suchte sie in den Augen der Dirne nach einer Reaktion. Tiefe Furcht und ungläubiges Staunen blickte ihr entgegen. »Schaffst du das, oder soll deine Freundin es machen?«
Die Dirne schüttelte den Kopf. »Nicht nötig, ich schaffe das.«
Julie war überzeugt, dass der Mann sterben würde, aber auch wenn er diese Prozedur überlebte, wäre es in jedem Fall das Beste, wenn die Dirne dabeistehen und mithelfen würde. Auf diese Weise wäre sie jederzeit im Bilde und die Wahrscheinlichkeit für eine fälschliche Unterstellung, Schwarze Magie angewendet zu haben, schien deutlich geringer. Nur so bestand Hoffnung noch einmal heil aus der Sache herauszukommen.
Nachdem sich Julie ihr bedingungsloses Vertrauen gesichert hatte, gingen die beiden ans Werk. Zunächst hielt die heimliche Heilerin dem Mann ein Fläschchen mit einer rotgelben Substanz unter die Nase, wodurch er augenblicklich die Besinnung verlor und sich nicht mehr rührte. »Das ist Mohn und etwas Binsenkraut, vermischt mit Mandragora. Du kennst es als Alraune. Es wächst hier überall und es hilft bei Schmerzen und lässt Kranke schlafen. Er wird nichts spüren und es hat nichts mit Magie zu tun, verstehst du?« Die Alte nickte. »Nimm jetzt einen der Wäschestreifen und leg es deinem Mann auf Nase und Mund.« Die Frau tat, was ihr aufgetragen wurde und Julie träufelte noch etwas von der Substanz auf das benetzte Tuch.
»Bist du bereit?« fragte Julie die Dirne noch ein letztes Mal und sie nickte stillschweigend. »Sieh dir gut an, was ich jetzt tue« ermahnte die Heilerin, und versicherte sich so noch einmal der Loyalität der Dirne.
Julie griff in den Bauch hinein und nahm den Darm in die Hände, säuberte in und legte Teile davon an die Seite. Neben den Gedärmen, die jetzt teilweise außerhalb des Mannes lagen, strömte auch überall Eiter, Blut und Brandsaft in dem Bauchraum. Julie versuchte das wässrige Gemisch mit den heißen Tüchern aufzusaugen und so die Entzündung zu lindern. »Jetzt kommt das Schwierigste. Wir müssen den Darm reinigen, die Holzsplitter entfernen und die Wunden nähen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er das nicht überleben wird« sagte sie und die Dirne blickte voll Furcht in Julie’s tiefblaue Augen. »Gib diese Kräuter in den Topf mit Wasser und koche sie gründlich. Dann tunke die Tücher noch einmal darin und umwickle den Darm damit. Das wird die Entzündung etwas lindern. Ich werde derweil versuchen die Splitter zu entfernen.«
Julie konnte sich keinen Reim darauf machen. Ein so großes Loch im Bauch und dann auch noch überall diese Splitter. »Wie um Himmels Willen kann so etwas passieren?« fragte sie sich, als sie die Wunden im Darm zu schließen versuchte. Es musste eine äußerst stumpfe Waffe - vielleicht ein Holzbalken - gewesen sein, der ihm mit großer Gewalt in den Magen gerammt worden war - der war nämlich ebenfalls mit Splittern durchsetzt und mit Blutergüssen überzogen. Zum Glück war er nicht gerissen. Das hätte niemand überlebt.
»Ein Turnier vielleicht« dachte sie. Sie hatte schon mal davon gehört, dass ab und zu auch Bauern Turniere veranstalteten, dann meist auf einem Esel oder einer Kuh, und anstatt einer richtigen Lanze wurden stumpfe Äste verwendet, oder statt Schwertern auch mal eine Mistgabel oder Äxte. Aber das waren nur Gerüchte, und bisher hatte sie das für puren Unsinn gehalten. Beobachtet hatte sie so etwas jedenfalls noch nie, und außerdem hatte man doch andere Dinge zu tun, die wichtiger waren, als Ritter zu spielen. Immerhin waren die ja auch schon seit der Erfindung der Armbrust fast gänzlich verschwunden und daher eigentlich gar keine richtigen Vorbilder mehr. Doch jetzt, da sie ein solches Loch vor sich hatte, war sie sich nicht mehr sicher. Vielleicht gab es diese Bauernspiele tatsächlich, aber »… wie schnell muss denn ein Esel rennen, damit man mit einem stumpfen Ast eine solche Wunde reißen kann?« fragte sie sich. Julie hatte keine Erklärung für diesen merkwürdigen Vorfall. Andererseits hatte sie auch festgestellt, dass der Mann sturzbetrunken war. Er stank wie ein Fass Rum und ohne diesen hätten ihn die Schmerzen sicher schon lange umgebracht.
Vorsichtig schob sie ihre Hände in den Bauchraum und unter den Magen und wusch alles mit einer Mixtur aus Brandwein und Heilsalbe aus. Da der Mann sowieso schon halb tot und im Delirium war, merkte er nichts von dieser Prozedur. »Er hält sich gut. Vielleicht überlebt er es doch« sagte Julie verwundert. »Kannst du sehen, was ich tue. Es hat nichts mit Schwarzer Magie zu tun.« Die Dirne nickte und ließ wieder etwas Brandwein von oben in den Bauchraum hineintropfen, damit Julie diesen zum Reinigen verwenden konnte, ohne dafür die Tücher oder ihre Hände aus dem Mann herausnehmen zu müssen. Jede unnötige Bewegung musste unbedingt vermieden werden. »Das machst du sehr gut« lobte Julie und schnürte das Band zwischen ihnen enger.
Der Bauch war mittlerweile schon einigermaßen sauber und frei von dem ekelerregenden Eiter, als sämtliche offenen Wunden erneut zu saften begannen. »Das wird heute Nacht noch öfter so gehen« versprach Julie und wusch den Lappen im heißen Kräuterwasser aus, bevor sie erneut mit der Reinigung begann. Nach fünf Stunden lebte der Mann noch immer und endlich gaben die Wunden ein wenig Ruhe. »Er hat gute Aussichten« sagte sie und öffnete einen Beutel mit Paste, den sie in ihrer Tasche hatte. Dann schmierte sie mit dessen Inhalt den Innenraum des Bauches aus, nahm sich anschließend noch einmal den Darm vor und wusch ihn zum Schluss wieder mit Brandwein ab. »Er wird nicht mehr ganz der Alte werden, das ist dir hoffentlich klar.«
Die Dirne nickte und entgegnete zufrieden »… wenn er nur lebt.« Ein kleines Lächeln zeichnete sich auf ihren Lippen ab.
»Noch hat er es nicht geschafft, aber hoffen kannst du wieder. Die Salbe wird die Wunden vorerst beruhigen, aber der Bauch muss heute Nacht offen bleiben« erwiderte sie. »Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn reinigen müssen.« Und tatsächlich mussten die beiden den Mann in dieser Nacht noch dreimal von den Flüssigkeiten befreien und die Wunden beruhigen.
Aber am nächsten Morgen, der Mann lebte noch immer, war der Wundbrand abgeklungen. »Die Verletzungen eitern nicht mehr« stellte Julie zu ihrer eigenen Verwunderung fest. Die Operation war besser gelungen, als sie selbst zu hoffen gewagt hatte. Noch vor einigen Stunden hätte sie keinen Centime auf das Überleben des Mannes gewettet, doch dass er die Nacht überstanden hatte, ließ sie hoffen. »Wir können den Bauch jetzt verschließen. Danach bleibt uns nur das Warten« sagte sie und begann dann einen Faden auf die Nadel aufzuziehen. Als der Bauch geschlossen war, rieb sie ihn mit Brandwein sauber und legte Salbe und Kräuter auf die Naht. »Du musst das dreimal am Tag und dreimal in der Nacht machen. Wenn er Morgen noch lebt, hat er gute Aussichten auch die nächste Woche zu überleben« sagte Julie. »Aber decke ihn nicht mehr zu. Die Wunde muss Luft bekommen, und gib auch dem Zimmer etwas Luft. Auch wenn es draußen kalt ist, sollte das Fenster ab und zu geöffnet sein. Leg’ lieber mehr Holz auf … Falls es wieder zu eitern beginnt, rufe mich noch einmal. … Hier nimm auch etwas von meinem Opiat, er muss bis morgen schlafen. Träufle es alle fünf Stunden auf Nase und Mund. Und wechsle die Tücher regelmäßig.«
»Wie kann ich das je wieder gut machen?« fragte die Dirne und schaute Julie ehrfürchtig an.
»Besorge dir einen anderen Beruf, und bezahle mich dann aus deinem ersten Lohn« antwortete sie und ging erschöpft nach Hause. Dort wartete schon eine neue Ladung Wäsche auf sie.
Kapitel II - Astronom wider Willen
Venedig, Dogenpalast
1456 anno Domini, Sommeranfang
Drei geschlagene Stunden wartete Giovanni Patroni bereits auf seine Audienz beim Dogen. Und dass, obwohl er doch der ausgewiesene und sicher sehr ehrenhafte Haus- und Hofastronom war und damit gleichfalls ein hohes Amt im Fürstentum Venedig bekleidete.
Als Giovanni Patroni vor etwa drei Jahren von einer seiner vielen Reisen zurückgekehrt war, beschäftigte er sich fast ausschließlich mit der Beobachtung der Gestirne und dem Lauf der Planeten. Noch ein paar Jahre zuvor hatte er diesem Gebiet der Wissenschaft kaum Beachtung geschenkt, und stattdessen nur seiner Leidenschaft gefrönt - der Chemie und ein wenig auch der Alchimie.
Eigentlich ist „wenig“ maßlos untertrieben, denn Giovanni war ein ausgezeichneter Alchimist, doch die Tatsache, dass er durch seine neuerlichen Himmelsbeobachtungen zu einem hervorragenden Sterndeuter geworden war, hatte ihm zu einer sehr lukrativen Stellung bei Hofe verholfen und die Alchimie gleichzeitig auf die hinteren Ränge verwiesen.
Es ging noch weiter, denn tief in seinem Herzen war Giovanni gar kein überzeugter Astrologe. Sicher konnte er durch diese Tätigkeit sehr viel Geld verdienen und sich ein sehr angenehmes Leben leisten »… schließlich muss man ja auch von irgendetwas leben« war sein Wahlspruch immer. Doch sagte er das eigentlich viel mehr um sein eigenes Gewissen zu beruhigen, denn wirklich glücklich war er mit dieser Art von Arbeit nicht und das spürte man, wenn er wieder einmal beim Dogen saß und auf Einlass wartete.
Giovanni Patroni war von Natur aus ein Wissenschaftler, wie man sie sich damals zurecht vorstellte. Vorwitzig, faul und geradezu verspielt mit den Dingen die ihn interessierten. Er war neugierig auf alles, was er nicht kannte, andererseits auch furchtbar desinteressiert, bei Angelegenheiten, die nichts wirklich Neues brachten. Eigentlich war dieses Verhalten für Italiener nichts Untypisches. Aber Giovanni hatte auch für die alltäglichen Dinge keine Zeit und keine Geduld mehr. Immer vergaß er seine Miete zu bezahlen, weshalb er sich plötzlich auf der Straße wiederfand, oder er versäumte die häuslichen Geschäfte rechtzeitig zu erledigen, was ihn dann des Abends mit hungrigem Magen einschlafen ließ. So wie er dann abends ins Bett gegangen war, so wachte er auch morgens wieder auf - knurrend und schlecht gelaunt.
Giovanni war launisch und man konnte ihn schnell erzürnen, wenn man ihn allzu sehr reizte. Aber sein schlimmstes Übel war seine große Klappe und seine unglaubliche Sturheit. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann führte er es auch durch, egal was ihm dabei im Weg stand. Doch immer öfter, mit zunehmendem Alter, stand er sich nur selbst im Weg. Dann verlor er die Kontrolle über seine Worte, was dann sehr oft in einem verbalen Missgriff endete und ihm anschließend einen Haufen Ärger einbrachte.
Astronomie war seit neustem sein Steckenpferd und diese Wissenschaft brachte er zur Vollendung, mindestens glaubte er das selbst von sich. Giovanni war kompetent und belesen, wusste mehr als die meisten seiner Kollegen und machte leider auch keinen Hehl daraus. Und im Grunde konnte er auch stolz auf sich sein, nur hätte er dabei etwas weniger forsch sein sollen, dann wäre ihm sicher einiges erspart geblieben.
Giovanni war eine stadtbekannter Physicus, und das nicht nur, weil er überaus intelligent und behände im Umgang mit neuartigen Experimenten war. Er war spendabel bei den Frauen, rechthaberisch bei den Männern und beliebt bei den Kindern, denen er immerzu Geschichten von weit entfernten Ländern erzählte. Hin und wieder wurden ihm Arroganz und Überheblichkeit unterstellt. Doch das beachtete er nur wenig und tat es dann mit einer Handbewegung ab. „Einfallspinsel« nannte er die Schwätzer, ging nach Hause und trank ein oder zwei Gläser Wein. Wenn man es genau bedenkt, hätte Giovanni Patroni einen durchaus akzeptablen Adligen abgegeben. Eigensinnig genug, war er dafür allemal. Eigentlich gab es nur eine einzige Person in Giovanni’s Umfeld, die noch mehr Eigensinn, Arroganz und Selbstverliebtheit besaß, als er - und das war der Doge selbst.
»Warum hat er mich überhaupt eingestellt?« brummte Giovanni vor sich hin. »Er hätte auch jeden anderen einstellen können, der ihm die Sterne deutet. Es spielt sowieso keine Rolle, was ich vorschlage. Er macht doch immer, was er will« greinte er die Wand an, die er bereits seit Stunden vor Augen hatte. »Was hätte ich nicht alles machen können, in der Zeit. Aber nein … Ich muss ja mal wieder die Welt retten. So was Idiotisches. Ich habe wirklich besseres zu tun, als hier zu sitzen und auf diesen eingebildeten Fatzke zu warten.«
Giovanni wartete bereits mehr als zwei Stunden, als einer der Diener des Dogen den Saal, vor dem er sich hingesetzt hatte, verließ. Auf seinen Unterarmen trug er ein Tablett, das mit Bechern und einem Weinkrug bestückt war. »Offenbar lässt man es sich hinter dieser Wand nur allzu gut gehen« dachte er mürrisch, stand auf und trat vor seinen Stuhl. Dann nahm er wieder Platz und wartete geduldig weiter.
Giovanni saß in einem gangartigen Vorraum direkt gegenüber vom großen Saal, in dem der Doge gewöhnlich seine Gäste empfing. Überall an den Wänden waren Bilder, in dafür vorgesehenen Steinrahmen, aufgehangen. Zwei mal zwei Meter maßen alle Gemälde und passten so in dafür vorgesehen Aussparungen in der Marmorwand. Auf jedem Bild war eine Person dargestellt. Manche hatten einen bunten Hut auf dem Kopf, für die Giovanni schon von je her nichts übrighatte und die er teilweise sogar nur allzu peinlich fand. Der Bildhintergrund dagegen war meist einfarbig und langweilig braun dargestellt, damit sich der Blick des Betrachters vollends auf die vordergründig dargestellte Person konzentrieren konnte. Die Absicht des Malers, oder sollte man sagen, die des Dargestellten »… ist so was von durchschaubar« dachte Giovanni und schüttelte den Kopf über diese Einfallslosigkeit.
Da das letzte Gemälde den derzeitigen Dogen darstellte, konnte es sich bei den anderen Personen nur um seine Vorgänger handeln. Hier und da waren die Maler etwas zu ehrlich gewesen, denn Giovanni fiel auf, dass alle Personen auf den Bildern grinsten, wie aufgeblasene Breitmaulfrösche. »Das liegt wohl in der Familie« dachte er, doch eigentlich war das nicht richtig, denn so etwas, wie Titelvererbung gab es in Venedig offiziell gar nicht. Doge zu werden, musste man sich eigentlich verdienen. Inoffiziell wurde allerdings zumeist der Erstgeborene des regierenden Dogen als Nachfolger vorgeschlagen, vorausgesetzt natürlich, er war kein Dummkopf.
Giovanni sah sich die Decke an. Nicht, dass er sie nicht schon vorher hundertmal betrachtet hätte, aber manchmal fand er wieder etwas, das ihm vorher nicht aufgefallen war. Und schließlich hatte er ja nichts anderes zu tun. Er bewunderte die Fresken, die dort aufgemalt worden waren und fragte sich, ob er sich so etwas auch leisten könnte. Der Fußboden kam aus Carrara, da war sich Giovanni sicher. Schon einige Male hatte er diesen Boden bewundert und er kannte mittlerweile jede Ader, die sich im Marmor verbarg. Oft genug, wenn er wieder einmal warten musste, zeigte sein Kopf nach unten und stützten sich seine Unterarme auf die Oberschenkel - so wie heute auch wieder.
Venedig war extrem reich, und sicherlich eine der führenden Städte in der zivilisierten Welt. Es gab Schulen für Geistliche und sogar eine Universität, die von Franziskanern geleitet wurde. Sie trugen alles Wissen der Welt zusammen und vervielfältigten es dann in ihren Skriptorien, die kein Nichtmönch je betreten durfte. Außerdem gab es hier auch Banken und unendlich viele Händler unterschiedlichster Art und Herkunft. Sie verbanden sich alle zu einer Zunft und erhielten dadurch eine stärkere Position, wenn es um rechtliche oder kaufmännische Dinge ging. Jeder Doge erhielt von diesen Zunftleuten seinen Anteil am Geschäft. Und seit hundert Jahren konnte es der Fürst von Venedig - im Sinne des Reichtums - deshalb mit jedem Kaiser, König oder anderen Wichtigtuer in Europa aufnehmen. Geld hatte der Doge im Überfluss und damit forderte er Macht und Einfluss von Kirche und Staat.
Eines war daher mehr als offensichtlich. Italien mit seinen Bankenstädten, wie Genua, Venedig und Mailand, war zu dieser Zeit, Mittelpunkt der Welt und führend in allen Belangen, was nicht gerade zur Demut und Bescheidenheit des herrschenden Dogen beitrug.
»Ich solle mich in Bescheidenheit üben, sagt dieser dumme Mensch gestern doch tatsächlich zu mir. Das ist was, das er besser mal probieren würde« dachte Giovanni noch immer auf seine Audienz wartend. Seit er sich wieder hingesetzt hatte, war niemand mehr, außer einem Dienstboten ab und zu, aus dem Zimmer getreten oder hatte es verlassen. Das konnte eigentlich nur zwei Gründe haben. Entweder gab es eine sehr lange Besprechung, oder, was viel wahrscheinlicher war, der Doge ließ ihn wieder einmal nur Duldsamkeit proben.
Seit einiger Zeit verstand sich Patroni nicht mehr allzu gut mit seinem Fürsten. Drei Jahre war er jetzt bereits Hofastronom in den Diensten des Dogen und zu Beginn ließ er Patroni seine Eigenheiten noch durchgehen, doch immer öfter gerieten die beiden aneinander. Und sogar in der Öffentlichkeit sorgten sie für Aufsehen, wenn sie sich wieder einmal gegenseitig vorführten. Im Grunde wusste jeder Beobachter, dass dieses Verhältnis so nicht mehr lange andauern würde. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann sich die beiden gegenseitig die Köpfe eintreten würden. Wer dabei ein paar mehr Beulen abbekommen würde, war eigentlich auch schon klar. Das allerdings beunruhigte Giovanni in keinster Weise. »Man wird sich schon auf vernünftige Art und Weise einigen können« dachte er und meinte dabei seine Abfindung.
Das alles lag für Giovanni momentan aber in weiter Ferne. Denn es gab Dinge, die waren jetzt wichtiger. Giovanni hatte beschlossen, die Streitigkeiten für heute zu vergessen und sich professionell zu verhalten. Deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als weiter zu warten. Geduldig ging er auf und ab, sah aus dem Fenster auf den nahegelegenen Hof des Palastes, und betrachtete die roten Dächer, die still vor ihm lagen. Vögel saßen darauf und sangen ein Lied. Hinter den Dächern ging die Sonne schon langsam unter und der Himmel färbte sich rot. »Die Engel backen schon. Sehr früh dieses Jahr« dachte er, als endlich sein Name aufgerufen wurde.
Niemand hatte zuvor das Audienzzimmer verlassen, und außer dem Stadtkämmerer war auch keine weitere Person im Raum zu sehen, als Giovanni den Saal betrat. »Also doch …« dachte er »… wieder nur reine Schikane.«
Verärgert über die lange Wartezeit, aber noch immer auf die Zähne beißend, erklärte er dem Dogen, was er bei seinen neuerlichen Himmelsbeobachtungen festgestellt hatte. Doch leider, wie so oft in letzter Zeit, schenkte ihm der Fürst keinen Glauben. Stattdessen wiegelte er nur ab, suchte nach Gegenargumenten und tat alles, um Giovanni zu ärgern, bloß zu stellen oder ihm Unfähigkeit anbieten zu können, auch wenn er selbst nur allzu gut wusste, dass Giovanni der beste Sterndeuter der westlichen Hemisphäre war. »Ehrenwerter Herr Patroni …« sagte der Doge zu ihm, und bereits das war spöttisch gemeint »… warum, frage ich mich - sollte sich denn die Sonne schon wieder verfinstern? Haben wir denn den Allmächtigen irgendwie verärgert, dass er die Sonne abermals ausgehen lässt?«
»Aber nein, nicht doch«, entgegnete Giovanni. »Es ist der Lauf der Gestirne, der hierfür verantwortlich ist. Genau wie schon vor zwei Jahren wird sich der Mond vor die Sonne schieben und sie verdunkeln. Es hat nichts mit Religion zu tun, ehrenwerter Doge.«
»Alles hat mit Religion zu tun, Physicus. Auch wenn euch das nicht immer in den Kram passt. Und vor zwei Jahren wurden wir dafür bestraft, dass wir die Hexe am Leben ließen. Damals sagtet ihr auch, dass dies nichts mit Religion zu tun hätte, und dass es nicht mehr so schnell vorkommen würde. Wenn ich mich recht entsinne, vermutetet ihr, es würde sogar einige Jahrzehnte dauern. Und jetzt steht ihr schon wieder hier, und habt das gleiche ketzerische Gedankengut, wie damals« erwiderte der Doge verärgert darüber, dass Giovanni ihn offensichtlich für einfältig hielt.
»Sicher, ehrenwerter Doge. Ihr habt mal wieder recht. Aber in diesem Fall ist der Grund doch ein anderer« betonte Giovanni vorsichtig. Er wusste um seine Lage und wollte keinen Rauswurf riskieren. Immerhin war der Doge bei seinem wöchentlichen Verdienst nicht kleinlich gewesen. Das durfte man doch keinesfalls leichtfertig aufs Spiel setzten. Andererseits musste er den Fürsten unbedingt überzeugen. Das war schließlich seine Pflicht, andernfalls hätte er nicht wieder in seinen mit Gold verzierten Spiegel schauen können.
»Nun, Giovanni. Ich nehme an, ihr kennt den Grund« höhnte der Doge. »Was genau ist denn eurer Meinung nach die Ursache für den baldigen Untergang der Welt?«
»Ehrenwerter Doge. Ich sage nicht, dass die Welt untergehen wird. Sie wird nur - für eine kurze Zeit - etwas dunkler werden, aber das wird sicher wieder eine Panik auslösen« beteuerte Giovanni. »Ich glaube, dass wir diesmal die Bevölkerung davon in Kenntnis setzten sollten - frühzeitig informieren, meine ich - sonst gibt es wieder nur Rauben und Morden, wie beim letzten Mal.«
»Rauben und Morden gibt es in meiner Stadt nicht. Ich denke, das wisst ihr so gut, wie ich. Und dunkel wird es jede Nacht. Dafür brauche ich keinen neuen Grund. Außerdem werde ich unseren allmächtigen Herrn sicher nicht bevormunden. Wenn er uns für irgendetwas bestrafen will, dann ist Panik genau das richtige, um daraus zu lernen. So ist das eben, Patroni. Ihr werdet das nicht ändern, und ich ganz bestimmt auch nicht« gab der Doge zurück und kam sich unglaublich intelligent und fromm vor.
Im Grunde war damit eigentlich schon alles entschieden, das wusste Giovanni. Der Doge würde nichts unternehmen, was das drohende Unheil noch abwenden könnte. Vielleicht hätte der Doge etwas unternommen, wenn ihn ein anderer davon unterrichtet hätte, aber bei Giovanni Patroni lehnte er jede Bitte, kategorisch und von vorne herein, ab.
Doch Giovanni war ein sturer Hund und er gab nicht so schnell auf. Er startete einen letzten Versuch, die Bevölkerung vor einer Panik zu bewahren. »So versteht doch« sagte Giovanni, bemüht seine Fassung zu behalten. »Es ist keine Strafaktion. Es liegt vielmehr daran, dass sich der Mond in etwas weniger als einem halben Jahr genau vor die Sonne schieben wird. Und da dessen Durchmesser relativ zur Entfernung genau mit dem Durchmesser der Sonne relativ zu deren Entfernung - natürlich immer gemessen an unserem eigenen Standpunkt Erde - ziemlich genau korrespondieren, wird sich …«
»Genug« sprang der Doge Giovanni hart ins Wort. »Was redet ihr denn da? Wollt ihr mich für dumm verkaufen?«
»Aber ehrenwerter Doge. Ich versuche doch nur, euch zu erklären, dass … wenn sich die Erde um die Sonne dreht, und sich der Mond dann dabei …«
Doch urplötzlich sprang der Doge von seinem Thron und strahlte, als hätte er ein Geschenk bekommen. »Aaa..a..a, was sagt er da? Hat er gerade behauptet, dass sich die Erde um die Sonne dreht. So war es doch, oder? … Stadtkämmerer, was habt ihr gehört?« fragte der Doge den anwesenden Kämmerer, der sich allerdings bisher nur gelangweilt in der Ecke aufgehalten hatte, ohne dabei der Unterhaltung wirklich Folge zu leisten.
Etwas ertappt richtete er sich nun auf, nahm Haltung an und sagte dann: »Ich, … ähm. Was ich gehört habe? Nun, … ähm … das gleiche wie ihr, euer Hochwohlgeboren. Das gleiche wie ihr. Ich kann es bezeugen« versicherte er und grinste.
»Ich bin kein Hochwohlgeboren, du Dummkopf« fuhr der Doge den Stadtkämmerer an. »Wann versteht ihr das endlich? Ein Doge wird gewählt, nicht geboren.« Er drehte sich wieder zu Giovanni, dem gerade klar wurde, was er da behauptet hatte. Das war eine Vorlage für den Dogen und er würde sie vermutlich nutzen. »Ketzer wie ihr es seid … Patroni … brauchen wir nicht auf den Straßen Venedigs« sagte er zu ihm und lachte. Dann nahm er einen großen Schluck Wein und trank auf sein eigenes Wohl.
In der sogenannten zivilisierten Welt glaubte man, oder besser gesagt, man musste glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht, und nicht umgekehrt. Die Erde war unumstößlich das Zentrum der Welt. Und jeder, der dies in Zweifel zog, behauptete damit gleichzeitig, dass der Mensch, als das Werk Gottes, nicht länger im Mittelpunkt der Schöpfung stand. Aber das wiederum war ein direkter Angriff auf die Heilige Schrift und ihren weltlichen Vertreter, die heilige römische Kirche und sogar den Papst.
Giovanni hatte gerade ein Tabu gebrochen und langsam wurde es ihm auch klar. Was hämmerte er doch immer seinen Schülern ein: »Ein kluger Mann kann denken, was er will, aber er sollte es keinesfalls auch öffentlich aussprechen.« Und schon gar nicht sollte man dies tun, wenn der Gegenüber jeden begangenen Fehler sofort aufnimmt und einen selbst dafür gnadenlos büßen lässt. Und jetzt hatte er selbst diesen Fehler gemacht. Wieder einmal hatte seine große Klappe die Oberhand gewonnen, und ausgesprochen, was besser nie hätte gesagt werden sollen.
Doch es kam noch schlimmer. Der Doge wollte Genugtuung für die Tage der Demütigung, für die vielen Situationen in denen er von Patroni vor aller Welt als Dummkopf hingestellt wurde. In seiner Gesellschaft fühlte sich der Doge minderwertig und daher nie als Fürst von Venedig. Doch Patroni war auch ein außerordentlicher guter und intelligenter Physicus und alle Welt beneidete den Dogen um diesen vorzüglichen Sterndeuter. Trotzdem. Das Gefühl von erbärmlicher Minderwertigkeit saß tief in seiner Brust. Und jetzt endlich bot sich ihm die Möglichkeit zur Gegenoffensive. Jetzt endlich hatte er etwas in der Hand gegen Patroni, und der Stadtkämmerer hatte es mit angehört. Wie immer würde der alles behaupten, was der Doge hören wollte. Dass Giovanni eine gotteslästerliche Behauptung aufgestellt hatte, konnte - oder vielmehr wollte - der Fürst ihm nicht verzeihen. »Ihr Gelehrten, …« sagte er »… wie ich euch hasse, für eure Überheblichkeit. Für eure Anmaßung, Gottes Werke in den Dreck zu ziehen und eure eigene Welt, selbst neu zu erschaffen. Aber ich werde euch eines Besseren belehren, Patroni. Ich zeige euch, wie die Welt wirklich aussieht, dann werden wir ja sehen, wer hier der Dummkopf ist … Werft ihn in die Kammern. Soll sich die Kirche mit ihm beschäftigen. Die Inquisition wird euch schon wieder zurechtbiegen, und vielleicht, Patroni … eines schönen Tages … lassen sie euch wieder frei, als reuigen Bürger dieser Stadt, falls ihr euch bis dahin auf ein Besseres besinnt habt.« Der Doge lachte verschmitzt und etwas hinterhältig.
»Und bis es soweit ist, Patroni, dürft ihr in meinen Kammern darüber nachdenken, wie man sich einem Fürsten gegenüber zu benehmen hat.«
Das war das letzte Wort, das der Doge an Giovanni richtete. Dann wurde er abgeführt und ohne weitere Verhandlung oder Anhörung in die Bleikammern von Venedig geworfen. Niemand übernahm seine Verteidigung und keiner wollte sein Geständnis entgegennehmen. Er hätte natürlich sofort widerrufen, wie es ein vernünftiger Mann täte, wenn er die Möglichkeit dazu bekäme. Doch niemand wollte hören, was er zu sagen hatte. Keiner der Wärter oder Soldaten machte Anstalten sich für ihn oder seine Meinung zu interessieren.
Dass man einem einfachen Mann nicht zuhört - gut, das konnte Giovanni noch verstehen. Aber er war schließlich der Hofastronom des Dogen, und als solcher galt man doch etwas. Doch hatte er sich abermals getäuscht. Dort, wo er jetzt war, besaß er keinen Namen und keine Stellung mehr, geschweige denn etwas anderes, dass von Wert gewesen wäre. Nicht einmal eine Nachricht konnte er nach draußen senden. Niemand wusste, dass er hier in den Bleikammern einsitzen musste.
Giovanni wurde in einen dunklen Raum hineingeworfen, ohne Kerze und ohne Fenster. Kein Tageslicht drang hinein in diese abscheuliche Kammer, in der er die nächsten Tage - so glaubte er - fristen sollte, ganz alleine und jeder Sträfling für sich. »Nicht mal so groß, wie die kleinste meiner Kutschen« dachte er und blickte suchend umher. Ein Holzgestell stand in der Ecke und wartete auf müde Besucher. Das war alles. Kein Tisch, kein Stuhl und nichts für die Notdurft. Immer musste er sich bücken, wollte er einen Schritt in die andere Ecke tun, so tief hing ihm die Decke ins Gesicht.
Er setzte sich auf seine Pritsche, die selbst für italienische Verhältnisse zu klein war, doch dann fiel ihm plötzlich seine Wohnung ein und er sprang auf und stieß mit dem Kopf an die Decke. Er musste doch seinem Hauswart Bescheid geben, dass er die nächsten Tage keine Miete zahlen konnte. »Er wird sie anderweitig vermieten« dachte er. Das hatte er schon einmal getan, als Giovanni auf einer kleinen Reise war. »Sie dauerte doch nur ein einziges Jahr« sagte er damals zu seinem Hauswart.
Doch den interessierte das nur wenig. »Keine Miete, keine Wohnung« war alles, was dieser darauf antwortete.
Giovanni setzte sich wieder hin und überlegte. »Aussichtslos …« dachte er »… da ist nichts mehr zu machen. Die Wohnung ist sicher schneller weg, als ich hier raus bin.« Dann dachte er an seinen Freund. »Vielleicht kann er mir helfen? Aber wird er mich hier auch finden? Wahrscheinlich nicht. Wie sollte er auch. Er hat ja gar keine Ahnung … Na ja. Wahrscheinlich komme ich sowieso bald wieder hier raus. Ich muss nur widerrufen« beruhigte er sich und begann erneut mit Warten.
Doch es kam noch einmal anders, als erwartet. Giovanni, eigentlich ein für italienische Verhältnisse stattlicher großer und aufrechter Mann mit strammen Waden und heftigem Bartwuchs, war nun seit siebenunddreißig Tagen in den Bleikammern von Venedig eingesperrt und bisher hatte es noch immer keine Anhörung gegeben. »Sicher wird es sie auch nie geben« vermutete er mittlerweile und ganz zurecht, denn der Doge hatte die Inquisition keineswegs unterrichtet, wie er es zu Beginn vorgegeben hatte. Nachdem das Problem mit Patroni einmal aus der Welt geschafft worden war, sollte es auf gar keinen Fall wieder hervorgeholt werden. Und so blieb Giovanni weiterhin eingesperrt, und langsam erkannte auch er die Situation, in der er sich befand.
Betrübt, verärgert und resigniert verwendete er die viele Zeit zum Nachzudenken, doch »… was nutzt es, wenn man die Gedanken nicht aufschreiben kann - dann verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind« dachte er und bastelte in seinen Gedanken weiter an einer besseren Welt.
Mit dem Essen war es ähnlich. Auch das verschwand so schnell, wie es aufgetischt wurde. Von den Gefangenen wurde es die letzte Ration genannt, denn es war nur wenig mehr, als ein Kochlöffel voll Suppe, bestehend aus fast hundert Prozent Wasser und vielleicht auch mal etwas Gemüse. Dazu gab es eine schimmlige Scheibe Brot. Wenigstens war die Suppe warm, aber Kraft gab sie kaum. So verging die Zeit, und noch immer gab es keine Mitteilung bezüglich seines weiteren Schicksals. Mittlerweile war aus dem stolzen Giovanni ein geknickter alter Mann geworden, der kaum noch aufrecht stehen konnte. Zum Teil lag das natürlich an dem niedrigen Raum, in dem er sein Leben fristete. Doch auch sein Gesicht war matt und fahl geworden, leblos und ohne einen Tupfer Farbe. Der Bart war zerzaust und hing verfilzt bis auf die Brust. Seine Arme und Beine waren bereits so dünn, wie die eines Kindes, denn die Muskeln wurden durch das ständige Sitzen und Liegen kaum mehr beansprucht. Seine Kleider waren nur noch Fetzen, während ihm die Schuhe schon zu Beginn der Haft weggenommen worden waren. »Hier brauchst du keine mehr« sagte einer der Wärter und zog sie ihm mit Gewalt von den Füßen.
Wer hier länger als sechs Monate durchgehalten hatte, gehörte schon zu den Altvorderen unter den Insassen. Und so gab es auch keine Gefangenen, die länger als ein Jahr in den Kammern überlebt hatten. Die meisten verstarben je nach anfänglichem Zustand bereits nach drei bis sieben Monaten. Giovanni war mittlerweile fast vier Monate hier, doch sein Glück war, dass er als Hofastronom des Dogen ein sehr gutes Auskommen hatte und sich daher ein recht üppiges Leben hatte gönnen können. Sein leiblicher Zustand war daher auch überdurchschnittlich gut gewesen, als er seine Kammer zum ersten Mal betreten musste. Man kann nicht sagen, dass er in den letzten Jahren Fett geworden wäre, doch für mittelalterliche Verhältnisse war er recht gut gerüstet. Leider konnte das sein bevorstehendes Ableben nur hinauszögern, denn offiziell entlassen wurde hier niemand, so dachte der Doge jedenfalls, und er ließ es auch jeden wissen.
Abschreckung war im späten Mittelalter noch immer die Waffe, die die Könige und auch dieser Doge gegen Gewalt und Verbrechen einzusetzen pflegten. Und damit auch jeder richtig beurteilen konnte, wie überaus schlecht es jedem Straftäter ergehen würde, bat er ab und zu Gäste in seine Gemächer und erwähnte dann stolz und ganz nebenbei, dass aus seinen Bleikammern »… überhaupt noch kein Gefangener lebendig entlassen wurde.«
Um der Abschreckung vor seinem Gefängnis noch mehr Gewicht zu verleihen, genehmigte er auch Gefangenenbesuche. Nicht aus reiner Herzensgüte, sondern lediglich, wie er sagte, zur Information für Verwandte und Bekannte. Auf diese Weise wurden nicht nur die Übeltäter selbst, sondern gleich auch die ganze Familie von seiner Art der Abschreckung in Kenntnis gesetzt. Dieses Prinzip schien sich auszuzahlen, denn zur Zeit des amtierenden Dogen hatte die Stadt Venedig die geringsten Verbrechen aller Zeiten zu vermelden, worüber die zahlreichen Händler und Bankiers mehr als dankbar waren, denn Verbrechen verhagelten den Händlern das Geschäft. Und sie waren sogar bereit dafür zu zahlen. Das äußerte sich dann in sogenannten Kopfpauschalen, die regelmäßig von den verschiedenen Handelszweigen zwecks Geschäftssicherung an den regierenden Dogen ausbezahlt werden mussten.
Kopfpauschalen wurden von einer fixen Anzahl an Straftaten ausgehend berechnet. Je weniger Straftaten gemeldet wurden, desto höher war der an den Dogen zu zahlende Betrag. Stieg die Zahl der Straftaten wieder an, musste der Doge nachbessern und das kostete ihn sein eigenes Geld. So kam es, dass keiner der je verhaftet wurde noch ein weiteres Mal die Gelegenheit zur Straftat bekam. Denn die Gerichtsbarkeit lag in den Händen des gewählten Dogen und der befahl einfach, dass niemand entlassen werden sollte, völlig egal welches Vergehen ihm zu Last gelegt worden war, oder ob er es überhaupt begangen hatte. Gerecht war das sicher nicht, aber dafür eine sehr wirkungsvolle Art und Weise für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Als die Tage bereits wieder kürzer und die Nächte kälter wurden, hatte sich auch für Giovanni Besuch angemeldet. Das kam so überraschend für ihn, dass er fast vor Schreck und im Halbschlaf von seiner Pritsche gefallen wäre. So lag er dann auch in einer etwas merkwürdigen Position zwischen Liege und Boden, als seine Zellentür geöffnet wurde. Im Glauben daran, dass er nun doch endlich Rechenschaft ablegen sollte, wollte er sich keine Minute mehr zurückhalten und versuchte dem erwarteten und erhofften Besucher zuvorzukommen.
»Ah, mein ehrenwerter Doge. Endlich gibst du mir die Gelegenheit zu widerrufen« sagte er mit ironischer Stimme zu der dunklen Gestalt, die halb in der Tür und halb auf dem Flur stand. »Viel Zeit hast du dir gelassen. Bald wäre nichts mehr von mir übrig gewesen, was noch hätte Abbitte leisten können.«
Lange hatte er über das nachgedacht, was er dem Dogen sagen wollte, wenn er ihn denn endlich besuchen würde. Doch als es soweit war, fiel ihm nichts wirklich Gutes mehr ein. Nach den vielen Monaten des Wartens wurde Giovanni immer einsamer und er glaubte bald nicht mehr daran, dass er noch einmal hier herauskommen könnte. Er wurde merkwürdig eremitisch und langsam verlor er sogar den Glauben an eine gerechte Welt. Fast hätte er sich den finsteren Mächten anvertraut, doch bis zu diesem Tag hatte er noch immer gezögert. Es wäre ein allzu endgültiger Schritt gewesen und musste daher aufs äußerste durchdacht werden. Als Alchimist war ihm natürlich bewusst, welche Konsequenzen dies für ihn gehabt hätte, doch immer öfter dachte er daran, sich dem Teufel hinzugeben und ihm zu Diensten zu sein.
»Ich bin nicht dein ehrenwerter Doge« erwiderte ihm der Mann in einer sonderbaren und Angst einflößenden Stimme.
Der Doge war es tatsächlich nicht. Das zumindest konnte Giovanni erkennen. Die dunkle Gestalt war in einen Umhang gewickelt, als wenn er etwas zu verbergen hätte. Seiner Größe und seinem Akzent nach zu urteilen, war er nicht von hier. Nichts von ihm war richtig gut zu erkennen, nur die schwarzen Umrisse, die gegen den grellen Schein der Lichter vor Giovanni’s Zellentür abgebildet wurden. Giovanni bekam Angst und er glaubte den Leibhaftigen vor sich zu haben, weil er ihn vielleicht innerlich bereits herbeigesehnt hatte. »Wer … wer seid ihr dann und was wollt ihr von mir?« fragte er mit zittriger Stimme …
Kapitel III - Rotröcke
London, nahe des Themseufers
1456 anno Domini, Frühling
Es war zwar noch immer Frühling aber die Sonne stand bereits hoch im Zenit. Keine Wolke trübte den Blick in die Ferne, genauso wie es an den warmen Tagen zuvor auch schon gewesen war. Robert hatte vor einem kleinen Laden in der Nähe des Hafens, nahe der Themse, Halt gemacht. Auf einem großen Schild über der Eingangstür stand geschrieben …
Darunter war ein königliches Wappen aufgemalt. Ganz offenbar war dies ein Geschäft, in dem auch der König und die Königin, oder zumindest die Angestellten des königlichen Palastes einige ihrer Bestellungen aufgaben.
Das Haus, in dem der kleine Kramladen untergebracht war, bestand wie fast alle anderen Häuser hier im Hafenviertel auch, aus altem Fachwerk und die Häuserwände, in der die vorderen Eingangstüren eingelassen waren, wurden stets leicht schräg, zur Straße hinzeigend, in die Gasse hinein gemauert. Das hatte den nicht zu verachtenden Vorteil, dass man seine Notdurft schnell mal aus dem Fenster im oberen Geschoß, in dem die Nachtlager zu finden waren, direkt in die Straßengasse schütten konnte, ohne dabei Gefahr zu laufen, es vor seiner eigenen Haustüre wiederfinden zu müssen. Ein sorgsam angelegter Rinnstein in der Mitte der Gasse beförderte dann das Meiste des Unrats auf direktem Wege in den Fluss. Der morgendliche Regen erledigte fast immer den Rest.
Als Robert eben durch diese Gasse gefahren war, überkam ihn das Gefühl, dass die Häuser bald über seinem Kopf zusammenstürzen würden, so schief starrten ihn die Wände an. Wenn er allerdings entlang dieser abschüssigen Gasse blickte, und das war ein schöner und stolzer Anblick, dann konnte er in einiger Entfernung die Großschoten der königlichen Drei- und Viermaster über den Dächern Londons erkennen, die hier friedlich vor Anker lagen. Dieser Blick gab ihm Luft zum Atmen. Luft, die die Gasse ihm bereits entrissen zu haben schien.
England hatte gerade mal wieder ein paar kleinere Streitigkeiten mit Frankreich, weshalb einem das Glück schon zu Seite stehen musste, wenn man überhaupt Kriegsschiffe im Hafen liegen sehen wollte. Sie kamen eigentlich nur dann nach England zurück, wenn sie Nachschub an Freiwilligen für die Marine oder zur Seefahrt benötigten. In letzter Zeit war das sehr häufig der Fall, und man konnte nur vermuten, dass der Krieg für den König schlecht lief.
Freiwilliger auf einem solchen Kriegsschiff der königlichen Marine wurde man meist einen Abend zuvor, wenn das Schiff den Hafen verlassen wollte. Dann gingen kräftige Seeleute im Auftrag der Krone in die Pubs, gaben dem Wirt ein paar Golddublonen, und schlugen den bereits leicht angetrunkenen Besuchern des Wirtshauses, mit einem Enterholz, eins über den Schädel. Anschließend wurden die Freiwilligen dann aufs Schiff getragen und einfach vor der Reling liegen gelassen. Wenn genügend potentielle Mannschaft an Bord war, setzte die Stammbesatzung die Segel und fuhr mitten in der Nacht los. Nachdem der betrunkene Gast seinen Rausch an der frischen Seeluft ausgeschlafen hatte, war er ohne viel Aufhebens davon zu machen, der Kriegsmarine beigetreten. Flüchten war zwecklos, denn auf hoher See gab es außer dem Schiff, auf dem man saß, nichts als Wasser. Außerdem verpflegte der König seine Getreuen sehr gut, denn er wollte diesen elenden nicht enden wollenden Krieg endlich gewinnen. Daher hörte man nur wenige, die sich über die Einladung zur Seefahrt beschwerten, vielleicht aber auch, weil man Meuterer nur allzu schnell am Fahnenmast zum Schweigen brachte.
Manchmal wurden auch kleiner Schiffsjungen benötigt, die sich in den Gassen Londons zu Hauf finden ließen. Und kaum jemand bemerkte es oder vermisste sie, wenn diese eines schönen Abends in einem Sack verschwanden. Robert kannte die Vorgehensweise der Fänger, die sich tagsüber normalerweise nicht blicken ließen. Dann konnten man getrost seinen normalen Geschäften nachgehen, ohne befürchten zu müssen, doch noch eingetütet zu werden.
Als Robert den kleinen unscheinbaren Laden betrat, meldete eine kleine Glocke über der Tür seine Anwesenheit, trotzdem dauerte es eine ganze Weile bis jemand der Aufforderung nachkam und ihn bedienen wollte. Er nutzte die gebotene Zeit und sah sich den Laden genauer an. Offenbar handelte es sich nicht nur um einen Kramladen, wie über der Tür behauptet wurde. Denn hier waren feinste Köstlichkeiten aus aller Welt zu finden. Von frischem Obst aus Südeuropa, über Gewürze aus der arabischen und orientalischen Welt, bis hin zu Porzellan und Seide aus Indien und China. Aber daran war Robert nur nebensächlich interessiert. Er hatte von einem äußerst explosiven Stoff gehört, der seit kurzem auch in den Kriegsschiffen eingesetzt wurde. Angeblich konnten damit sogar schwere Metallkugeln mehrere hundert Meter weit geschossen werden. Robert war sehr skeptisch, und doch auch angetan von diesem Gedanken. Ein alter aber durchaus vornehmer Geschäftsmann aus Paris hatte ihm eines Abends in einem der unzähligen Londoner Pub’s erzählt, dass man dieses Pulver unter anderem in Sir Lorradal’s Kramladen in der Salsburyroad erstehen könnte - nur deshalb war er hier.
Robert schaute sich um. Er suchte nach kleinen Säcken oder Beuteln, die vielleicht Aufschluss über die Anwesenheit des Pulvers geben könnten, als die Eingangstür erneut aufging und ein kleiner Junge hereinkam Er war vielleicht zehn oder elf Jahre alt - keinesfalls älter, und er war kaum größer als zwei Säcke Korn übereinander, nur nicht so breit. Sein Haar war nass und hing ihm tief ins Gesicht. Die Kleider baumelten an ihm in Fetzen herunter und Schuhe besaß er nicht, was aber für Jungs in seinem Alter nicht ungewöhnlich war. Allerdings war er wohl gerade mit samt seinen Kleidern in den Fluss gesprungen. Das wiederum war schon etwas sonderbar. Zwar sah man sehr oft die Kinder Londons in der Themse schwimmen, doch immer nur nackt. Dieser hier war aber so nass, dass die Pfütze, die er hinterließ, bereits zu den Mehlsäcken kroch.
Der Knabe stand im Raum und schaute sich um, sagte aber nichts, als der Besitzer endlich durch eine Tür im hinteren Bereich in den Laden trat. »Entschuldigen sie bitte, Sir. Ich werde mich sofort um sie kümmern. Lassen sie mich nur kurz den Knaben bedienen« sagte er zu Robert.
»Machen sie nur. Ich habe Zeit« erwiderte Robert.
Hastig ging der beleibte Mann in den Raum hinein, und auf den Jungen zu. »Was machst du hier, du Lümmel? Raus, aber schnell, bevor ich die Rotröcke kommen lasse« sagte er und versuchte den Jungen zu greifen, der daraufhin Reißaus nehmen wollte.
Doch Robert kam beiden zuvor. Mit einer Hand stoppte er den rundlichen und gedrungenen Ladenbesitzer, mit der anderen griff er nach dem Jungen, um ihn am Fortlaufen zu hindern. »Entschuldigen sie genauso. Aber was hat der Junge ihnen getan, außer ihren Fußboden zu überschwemmen?« fragte Robert, womit Sir Lorradal nicht gerechnet hatte. Irgendwie erinnerte ihn der Junge an seine eigene Kindheit.
»Sie sind wohl nicht von hier, wie?« fragte er, wartete aber nicht auf Robert’s Antwort, sondern sagte selbst: »Nun, in Anbetracht seines Erscheinungsbildes wird das Überschwemmen meines Fußbodens schon ausreichen, um ihn vor die Tür zu setzen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser junge Herr mir den Schaden mit einem Einkauf aufwiegen wird. Wenn sie also nichts dagegen haben, werde ich ihn auf die Straße setzen.«
Der dicke Mann schob Robert’s Arm beiseite und ging erneut auf den Jungen los. Der befreite sich gleichfalls gekonnt aus Robert’s Griff und rannte hinter seinem Rücken in die Stube hinein. Er wollte gerade zur Hintertür hinauslaufen, als Sir Lorradale mit einem überaus geschwinden Satz, den man ihm gar nicht zugetraut hätte, den Schopf des Jungen schnappte und ihn zurück zur Eingangstür beförderte. Sir Lorradale öffnete sie, packte den Jungen unter den Armen und holte zum Wurf aus, der den Jungen mit Leichtigkeit zwei oder drei Meter vor die Tür geschleudert hätte, als ihm Robert abermals zuvor kam.
»Wenn sie nichts dagegen haben?« wiederholte Robert die Frage von Sir Lorradal. »Nun … ich habe. Und es wird mir gleichfalls eine Freude sein, ihnen den Schaden zu ersetzen, wenn sie dafür den Jungen vom Schopf lassen.«
»Dann gehört er also zu ihnen. Warum haben sie das denn nicht gleich gesagt? Das habe ich nicht gewusst. Entschuldigen sie vielmals« sagte er und ließ den Jungen los. »Sie wissen sicher, wie es mit diesen Straßenkindern ist. Immerzu klauen sie nur, oder bringen alles durcheinander, und immer hat man nur den Schaden«, bedauerte Sir Lorradale sich selbst. Robert wusste tatsächlich sehr genau, wie es mit den Straßenkindern ist - er war früher selbst eins gewesen, und dass sie noch immer genauso schlecht behandelt wurden, ärgerte ihn ziemlich.
Jetzt, da der kleine kräftige Mann vom Leib des Jungen abließ, sah man eine streifenförmige Verletzung im Gesicht des Knaben. Daneben waren überall Schmauchspuren zu sehen. Robert erkannte, dass diese Spuren nur von dem besagten schwarzen Pulver stammen konnten. Aber die einzigen, die sich bisher solch einer Waffe bedienen durften oder konnten, waren die Angestellten der britischen Krone. Das waren zum einen die Fänger, zum anderen die Soldaten, die im Volksmund nur Rotröcke genannt wurden. Wahrscheinlich hatte der Junge gerade eine Auseinandersetzung mit einem der beiden Parteien hinter sich gebracht. Und vielleicht war er nur knapp entkommen, oder noch immer auf der Flucht, was seine nassen Kleider erklären würde.
Es fiel auf, dass der Junge bei der ganzen Konversation zwischen Robert und dem Besitzer des Ladens keinen einzigen Ton gesagt hatte. Und auch jetzt, wo er unter der Obhut von Robert stand, kam nicht ein einziges Wort des Dankes über seine Lippen.
»Nun gut, Mister« unterbrach Sir Lorradal das kurze Schweigen, das dem Jungen die Möglichkeit zur Danksagung geben sollte. »Wie gedenken sie mir den Schaden zu ersetzen?«
Robert schaute sich bedächtig um. Er wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Also suchte er nach anderen brauchbaren Dingen. An den hinteren Wänden des Ladens hingen Schweinebäuche und Rinderhälften. »Das wäre sicher das richtige, für eine längere Reise.« dachte er. »Nun, Sir. Zunächst benötige ich etwas Verpflegung für eine Person, die etwa einen Monat unterwegs sein wird« sagte er, doch dann hielt er kurz inne, dreht sich um und blickte den Jungen an. Der rührte sich noch immer nicht von Robert’s Seite - er schien sich geradezu hinter ihm verstecken zu wollen. Robert korrigierte sich. »Nein, warten sie. Geben sie mir Proviant für zwei Personen, die einen Monat unterwegs sein werden.« Was hatte er gerade gesagt? Hatte er wirklich den Jungen eingeladen mitzukommen, auf seine Reise? Warum hatte er das gemacht? Robert war eigentlich immer jemand gewesen, der alleine unterwegs war. Er hatte keine Frau oder gar Kinder. Seine Eltern hatte er nicht wirklich gekannt und eine Familie besaß er deshalb schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Er vermisste sie nicht einmal. Was sollte das also? Robert überlegt und plötzlich fielen ihm die Worte seines Freundes ein. »Robert …« hatte er gesagt »… denke immer daran. Du kannst dich ihr nicht widersetzen. Versuche also besser nicht ihr zuwider zu handeln« Hatte es etwa etwas mit ihr zu tun? Wollte Sie, dass der kleine Junge mit ihm kam? Warum sonst hatte Robert den Jungen in Schutz genommen? Er beschloss, das Schicksal eine Entscheidung treffen zu lassen. »Wenn der Junge mitkommen will, dann soll er ruhig. Was geht’s mich an.« dachte er und wendete sich wieder Sir Lorradale zu.