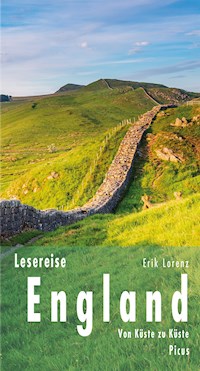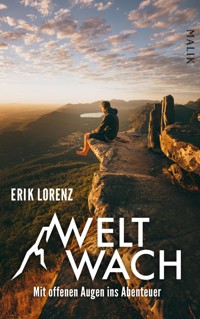Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Preis der Hoffnung
- Sprache: Deutsch
"Setzt Europa in Brand!", befiehlt Winston Churchill den Agenten der von ihm gegründeten Geheimorganisation Special Operations Executive. Mathieu Trudeau und sein Team planen, genau das - und zwar in Frankreich, das noch immer fest in der Hand der deutschen Besatzungsmacht ist. Jeder Funke Widerstand, der in der französischen Bevölkerung aufglimmt, wird von ihr erbarmungslos ausgetreten. Mathieu ist entschlossener denn je, die Deutschen aufzuhalten. Mit der Gestapo dicht auf den Fersen begibt er sich in ein Dickicht aus Verrat, Hass und Gewalt und wird mit nahezu unüberwindbaren Hindernissen konfrontiert. Sein Auftrag verlangt ihm alles ab, und er muss sich immer wieder fragen, welche Opfer er zu bringen bereit ist, um sein Ziel zu erreichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
EINS
„Warum ist das Jahr 1859 für das Deutsche Kaiserreich ein ganz besonderes?“, fragte der Lehrer und fuchtelte mit seinem Stock. „Na?“
Es war bereits die fünfte in schneller Folge abgefeuerte Frage, und bisher hatte keiner der Schüler auch nur eine von ihnen beantworten können.
„Es ist das Geburtsjahr unseres Kaisers!“ Der Lehrer deutete auf ein an der Wand hängendes Porträt, stemmte seine Hände in die Hüfte und betrachtete die rund sechzig Kinder vor ihm. „Ich lasse euch die leeren Blicke heute und morgen noch durchgehen, aber ab nächster Woche weht ein anderer Wind! Ich erwarte Gehorsam, Fleiß, Ordnung und Ehrlichkeit statt Faulheit, Laster und Lüge!“
Der Junge schluckte schwer. Aus dem Mund des Lehrers klang beinahe jedes Wort wie eine Drohung. Er war ein frühzeitig ergrauter Mann mit einem von Falten durchfurchten Gesicht, in dessen Mitte eine mächtige, mit roten Äderchen durchzogene Knollennase thronte. Der Junge wusste, dass es die Nase eines Trinkers war. Einmal hatte der Blick des Lehrers ihn gestreift, und für eine Sekunde hatte der Junge geglaubt, in ihnen ein wenig Wärme aufblitzen zu sehen. Aber das war wohl eher Hoffnung als Wirklichkeit gewesen. Die Augen waren weitergewandert, ohne bei dem Jungen zu verharren, und hatten dann weiter wütend gefunkelt.
„Die Monarchie ist für das Wohlergehen der Menschen erforderlich“, sagte der Lehrer jetzt, „und insbesondere dem Sozialismus und Kommunismus vorzuziehen.“
Seine Stimme war laut und aggressiv. Einzig die große Menge an Schülern, die dicht aufgefädelt auf den harten Holzbänken saßen, vermittelte dem Jungen ein gewisses Gefühl von Sicherheit: Er konnte sich in der Menge verbergen, auch wenn er recht weit vorn saß. Er konnte den Kopf einziehen und unsichtbar sein. Und er war entschlossen, genau das so lange wie möglich zu tun.
Es war sein dritter Tag an der Volksschule, und der Mann, der gerade vor der Klasse stand, war nur einer von bisher vier Lehrern, die dem Jungen Angst eingeflößt hatten. Mit ihrem Verhalten und ihren Erwartungen. Lesen, Schreiben, Rechnen sollten die Kinder möglichst bald können, sie sollten Geschichte und Religion lernen. Immer die richtigen Antworten parat haben und dabei gerade sitzen und aufmerksam sein und sich stets tugendhaft verhalten.
Hohe Erwartungen kannte der Junge von daheim, aber dort wurde er mit ihnen punktuell konfrontiert, immer dann, wenn der Vater ihn anschrie und maßregelte und züchtigte. Doch es gab auch Zeiten, in denen er all dem aus dem Weg gehen konnte, in denen er frei durch die Wälder und Hügel der Eifel streifen konnte. Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass dieser Teil seiner Kindheit, der entscheidende, mit dem Schulbeginn zu Ende gegangen war.
„Na?“
Es kam dem Jungen so vor, als durchflösse ihn siedend heißes Wasser. Das Blut schoss ihm in einem einzigen Schwall in den Kopf.
„Na?“
Der Lehrer stand wenige Meter von ihm entfernt und betrachtete ihn mit erwartungsvoll gehobenen Brauen.
„Ich ...“, murmelte der Junge.
„Sprich lauter!“
„Ich ... weiß nicht ...“
„Du weißt die Antwort. Ich weiß genau, dass du sie weißt. Und wenn du sie mir nicht nennst, muss ich das als Verweigerung verstehen! Jetzt sprich!“
Die Lippen des Jungen bebten. Sein Hals war wie zugeschnürt. Tränen traten ihm in die Augen.
„Ich ... habe die Frage nicht verstanden.“
„Wirst du wohl zuhören!“ Der Lehrer machte einen Schritt auf den Jungen zu, hob drohend seinen Stock und ließ ihn langsam wieder sinken. „Und gerade sitzen! Die Füße parallel nebeneinander, die Hände gefaltet auf den Tisch.“
Er kehrte zu seiner Ausgangsposition zurück und sagte an die gesamte Klasse gerichtet: „Hände falten, Schnabel halten, Kopf nicht stützen, Ohren spitzen. Merkt euch das! Hat irgendjemand die Ohren gespitzt? Wer kann meine Frage beantworten?“
Vereinzelte Hände wurden zögerlich in die Höhe gestreckt.
„Du!“ Der Lehrer zeigte mit seinem Stock auf einen für sein Alter groß gewachsenen Jungen in den hinteren Reihen.
„Friedrich III.?“
„Jawohl. Gut.“
Der Lehrer wandte sich um und pochte mit dem Stock an die Schiefertafel, die hinter ihm hing. „Der Kaiser ist ein lieber Mann“, stand dort. „Dieses Lied werden wir morgen lernen“, verkündete der Lehrer. „Die Stunde ist beendet.“
Die Kinder erhoben sich, packten schweigend ihre Hefte und Stahlfedern ein und verließen das Klassenzimmer. Der Junge hatte noch ganz weiche Knie. Ihm stand der Schweiß auf der Stirn. Während die anderen Kinder dem Ausgang zustrebten, um nun, nach der letzten Stunde, nach Hause zu gehen, bog er zu den Toiletten ab. Er betrat den Waschraum der Jungen, ging in eine der Kabinen und lehnte sich mit der Stirn gegen die dünne hölzerne Zwischenwand. Obwohl er versuchte, tief durchzuatmen und sich zu beruhigen, konnte er nicht verhindern, dass ihm Tränen über die Wangen kullerten.
Er wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht, ließ die Hose herunter und setzte sich auf die Toilette. Da hörte er, wie die Tür zum Waschraum aufging. Der Junge setzte sich aufrecht hin und lauschte. Aus irgendeinem Grund beschlich ihn ein böses Gefühl. Genau genommen hatte das böse Gefühl ihn schon beschlichen, als er vor drei Tagen die Schule betrat. Seither war er wachsam.
Die Schritte näherten sich seiner Toilettenkabine und verklangen. Der Junge lehnte sich nach vorn und drückte mit der Hand von innen an die Tür, die kein Schloss mehr hatte und nur angelehnt war.
Doch sie flog nach innen auf und schleuderte seine Hand zur Seite. Der Junge schrie. Er rutschte auf der Toilette zurück bis an die Wand hinter sich. Vor ihm, halb in der Toilettenkabine, stand der kräftige Junge, der auf die letzte Frage des Lehrers die richtige Antwort gegeben hatte, ein Blondschopf mit übergroßen Ohren und großen Händen, der einen Kopf größer war als der Junge auf der Toilette.
Und er grinste über das ganze Gesicht.
„Volltreffer!“, sagte er, beugte sich in die Kabine, packte den Jungen am Kragen und zog ihn von der Toilette herunter und hinter sich her. Der Junge machte zwei Trippelschritte, dann stolperte er über seine Hose und fiel der Länge nach hin. Der Blondschopf lachte lauthals, und zu seinem Lachen gesellte sich das Gelächter zweier weiterer Jungen, die mit ihm in den Waschraum gekommen waren.
„Hallo Kleiner“, sagte der Blondschopf, noch immer breit grinsend.
„Was wollt ihr von mir?“, brachte der Junge mit Mühe hervor.
„Wie war das?“, fragte der Blonde und drehte ihm das rechte Ohr zu. „Was hast du gesagt?“
„Was wollt ihr?“
„Ich ... habe die Frage nicht verstanden!“, sagte der Blondschopf gespielt weinerlich, den Tonfall imitierend, in dem der Junge den gleichen Satz vorhin zum Lehrer gesagt hatte. Und lachte wieder los. Dann befahl er: „Los, schnappt ihn euch!“
Seine beiden Begleiter packten den Jungen unter den Armen, hoben ihn hoch und folgten dem Blondschopf, der voranging und überprüfte, ob die Luft rein war. Sie trugen den wimmernden und zappelnden Jungen aus dem Waschraum hinaus und über die Flure. Er wagte nicht zu schreien. Was, wenn ihn jemand so sah, wehrlos und mit heruntergelassener Hose? Er würde für alle Zeit das Gespött der Schule sein, der Schwächling, mit dem man alles machen konnte.
Sie brachten ihn durch den Haupteingang nach draußen und um das Schulgebäude herum an dessen Rückseite. Es war ein kalter, grauer Tag. Ein Nieselregen ging nieder, benetzte Pflanzen und Menschen und weichte den Boden auf.
„Lasst mich los“, bettelte der Junge, aber seine Peiniger beachteten ihn nicht.
„Kommt, schneller“, sagte der Blondschopf und schritt aus. „Hinter dem Schuppen liegt noch Schnee!“
Sie schafften ihn zu einem freistehenden Gebäude, in dem der Hausmeister Spaten, Schubkarren und anderes Werkzeug aufbewahrte.
„Lasst mich los!“, flehte der Junge erneut, noch leiser als zuvor. „Ich habe euch doch nichts getan!“
„Gebt ihn mir“, sagte der Blondschopf, drehte dem Jungen die Hände auf den Rücken und hielt ihn fest. Dieser versuchte sich loszureißen, aber er konnte gegen den Blondschopf nichts ausrichten. „Zieht ihn aus“, sagte der Blondschopf, und als seine Begleiter zögerten, fügte er hinzu: „Na los, mir wird kalt!“
Die anderen beiden zogen dem Jungen die Hose aus und den Pullover über den Kopf. Mittlerweile weinte der Kleine bitterlich. Er jammerte und flehte und hustete im Wechsel, aber es half nichts.
„So, du weinerlicher Wicht“, sagte der Blondschopf, „jetzt wollen wir dich mal ein bisschen abhärten.“ Und er stieß den Jungen von sich, sodass er in den Schnee stürzte. Die drei bewarfen ihn mit Schneebällen, rieben ihn ein und wälzten ihn hin und her.
„Seht nur!“, rief einer von ihnen und zeigte grinsend auf das Genital des Jungen, das sich in der Kälte zusammengezogen hatte. „Was für ein winziger Pimmel!“
„Ein kleiner Ringelwurm!“
„Die Schnecke zieht sich in ihr Haus zurück!“
Sie grölten und jubelten. Zitternd saß der Junge auf der Erde und brachte kein Wort mehr hervor.
„Seid ihr verrückt?“, erklang eine Jungenstimme.
Die drei zuckten zusammen.
„Ach, du bist es, Franz“, sagte der Blondschopf erleichtert, der den älteren Jungen zu kennen schien. „Du hast uns einen Heidenschreck eingejagt!“
Franz wischte den Kommentar mit einer Geste zur Seite. „Seid ihr verrückt?“, wiederholte er. „Wisst ihr nicht, dass das der Sohn vom Blenke ist?“
„Blenke?“, fragte der Blondschopf.
„Ja genau, Blenke!“
„Die Suffnase von eben?“
„Eben die!“
„Der hat aber nicht den Eindruck gemacht, als würde sein Sohn im Klassenzimmer sitzen.“
„Was nichts daran ändert, dass der da Emil Blenke ist, sein Sohn! Pass bloß auf, Thomas.“
Der Blondschopf Thomas wandte sich wieder dem Jungen im Schnee zu. „Soso. Dann bist du Emil Blenke? Ich habe schon gehört, dass der Sohn der Suffnase mit uns eingeschult worden sein soll. Ich kenne eigentlich jeden aus der Umgebung, aber dich kenne ich nicht. Bist wohl ein Stubenhocker, was?“
„Hör lieber auf, das zu sagen“, sagt Franz eindringlich und schaute sich um.
„Was denn?“, fragte Thomas grinsend. „Stubenhocker?“
Franz schaute sich nochmals um. „Suffnase“, sagte er halblaut.
Thomas lachte. „So nennt mein Vater ihn. Du hast wohl Angst.“
„Die hast du doch auch, wenn du wieder vor ihm sitzt. Jetzt spuckst du große Töne, aber sieh dich lieber vor, sonst wirst du bald sehen, wie kräftig eine Suffnase zuschlagen kann.“
„Aber doch nicht wegen dem Verlierer da.“
Emil hatte sich mit seinen Empfindungen in sich selbst verkrochen und war dem Gespräch nicht gefolgt. Sein Heulen war zu einem Schluchzen abgeebbt. In den Tiefen seiner Angst fiel ihm ein, dass er auf der Toilette nicht mehr dazu gekommen war, zu pinkeln. Nun konnte er nicht mehr an sich halten. Sein Wasser kam.
„Was ...“, setzte Thomas an, in einer Mischung aus Verblüffung und Ekel. Dann begannen er und seine zwei Begleiter von Neuem zu lachen, lauter und entzückter als zuvor. Ohne die Warnungen des Freundes zu beachten, packten sie Emil und wälzten ihn im Schnee hin und her, der sich gelb färbte und als leuchtender Fleck seiner Schmach Ausdruck verlieh.
Mit einem tiefen Japsen riss Emil Blenke die Augen auf. Keuchend blickte er in die Dunkelheit. Er lag da wie erstarrt, wie ein Beutetier, das sich totstellte. Für einen Moment war er vollkommen orientierungslos, dann begann er seinen Brustkorb zu spüren, den trockenen Hals. Er holte tief Luft.
Langsam kehrten die Erinnerungen zurück. Die drei Jungen, seine flehenden Fragen, die unbeantwortet geblieben waren. Die Mitschüler hatten einfach nur ein Opfer gesucht und gefunden. Er schluckte schwer. Es war alles nur ein Traum. Längst vergangen und vergessen.
Inzwischen war er Hauptsturmführer, weit davon entfernt, Opfer zu sein. Weit davon entfernt, wehrlos zu sein. Er hatte Macht. Er hatte Kontrolle. Und niemand ...
Eine weitere Erinnerung überwältigte ihn, heftiger als die Ereignisse seiner Kindheit.
Mathieu Trudeau.
Der Mann, der die Schuld an seinem körperlichen Schaden trug. An seiner Schwäche. Der Mann, an den er noch immer jeden Tag dachte. Er war ihm begegnet, gestern. Die Details fielen ihm ein, brachen über ihn herein wie eine Welle und rissen ihn mit.
Er war zum Rangierbahnhof gefahren, um einen Offizier einzuweisen, der das Kommando über den Bahnhof übernehmen würde, denn künftig sollten alle wichtigen Industrie- und Transportbetriebe in deutscher Hand sein.
Dann hatte er plötzlich vor ihm gestanden. Die Haarfarbe war verändert, aber diese Augen!
Trudeau hatte zuerst reagiert. Er hatte ihn niedergeschlagen und sich sofort auf den nächsten Soldaten gestürzt, wie Blenke später erfahren hatte. Gleichzeitig hatte einer von Trudeaus Männern von hinten angegriffen. Er musste den herannahenden Soldatentrupp bemerkt haben und ums Zugende herumgegangen sein. Die Soldaten jagten die Kriminellen durch den Bahnhof, aber ihnen gelang die Flucht. Nicht einen einzigen von ihnen hatten sie erwischt.
Blenke presste die Zähne aufeinander. Seine Kiefer knackten. „Hallo, Blenke“, hatte Trudeau gesagt, mit einem leicht ironischen Zucken im Mundwinkel.
Dieses selbstverliebte Gesicht.
Er würde es ihm austreiben! Niemand sah auf Emil Blenke herab, niemand sollte je wieder über ihn lachen!
Er knipste die Nachttischlampe an, setzte sich im Bett auf und atmete tief durch. Jetzt brauchte er ein Glas Wasser.
Er schlug die Decke zurück, doch als er die Beine rührte, bemerkte er, dass sein Schritt feucht war. Ungläubig betrachtete er den dunklen Fleck auf der beigen Pyjamahose. Dann schaute er zu Ilse, in der Hoffnung, dass sie tief und fest schlief.
Doch sie war wach und sah ihn an. Ihr Blick traf ihn wie ein Stich, grausam und herablassend. Seit sein Bein so schwer verletzt worden war, schien sie ihn noch weniger zu respektieren. Selbst die Tatsache, dass er Kurt eine Position in der Feldgendarmeriestaffel des Wehrmacht-Erfassungskommandos verschafft hatte, hatte sie ihm mit keiner Silbe gedankt, mit keiner Geste gewürdigt.
Dennoch hätte er ihr gern erzählt, was ihm so zu schaffen machte. Dass der Mann, der ihm die Beinverletzung angetan hatte, wieder aufgetaucht war. Als er gestern Nacht heimgekommen war, hatte Ilse bereits geschlafen. Er hatte sich die Zähne geputzt und sich zu ihr ins Bett gelegt und zur Decke gestarrt und darauf gewartet, dass sein Herzschlag sich endlich verlangsamte. Offenbar war er doch noch eingeschlafen.
Er erzählte ihr nichts, sondern stand schweigend auf, ging ins Bad und duschte. Dann ließ er den Fahrer kommen und stieg in seine Mercedes-Limousine, deren Scheinwerfer wegen der Verdunkelungsvorschriften abgedeckt waren. Er schaute durchs Fenster, sah die Häuser und Menschen an sich vorbeiziehen. Die dunklen Straßen waren beinahe leer. Auf der gesamten Strecke sah er nur zwei Citroëns und einen Renault Monaquatre. Das lag zum einen an der Uhrzeit, zum anderen daran, dass Autos von Zivilisten kaum noch benutzt werden durften, weil Benzin gespart werden sollte.
Während der Fahrt verwandelte er sich von dem Mann, der während seines Alptraums den Pyjama benässt hatte, in den Emil Blenke, den die Welt kannte, den Hauptsturmführer, den geachteten und gefürchteten Soldaten.
Er setzte sich auf den Polsterstuhl in seinem Büro, erledigte Papierkram und wartete darauf, dass sein Adjutant Hermann Kuhn kam, den er hatte anrufen lassen.
„Rottenführer Kuhn, lassen Sie sie antreten.“
Kuhn schaute ihn vorsichtig fragend an. „Wen genau?“
„Alle! Sie sollen alle kommen. Vom Gefreiten über den Feldwebel und den Fähnrich zum Oberstleutnant. Alle!“ Als er bemerkte, dass Kuhns Gesicht immer noch einen fragenden Ausdruck hatte, fügte er hinzu: „Herrgott, schauen Sie mich nicht so an, ich weiß, dass es früh am Morgen ist. Sei‘s drum. Sorgen Sie dafür, dass diejenigen, die keine Nachtschicht haben, sich aus ihren Betten hieven und herkommen, aber zackig! Und noch was. Kündigen Sie Pfeiffer an, dass ich gleich morgen in die Funkaufklärungszentrale komme. Zur Inspektion.“
Kuhn eilte davon. Eine halbe Stunde später eröffnete Blenke die Versammlung im Besprechungsraum. Er spürte die Neugierde seiner Untergebenen, die über den Grund für die verfrühte Einberufung nur mutmaßen konnten. Aber Blenke musste souverän auftreten. Und durfte keine Emotionen zeigen. Er sprach über dies und das. Und genoss dabei die Aufmerksamkeit.
„Meine Herrschaften, wir müssen und wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, um die Mitglieder der Résistance aus ihren Löchern zu locken. Sie treffen sich gern in Cafés und an öffentlichen Plätzen. Wir müssen noch mehr Kellner und Verkäufer und dergleichen bestechen, damit sie verdächtige Tischgespräche melden. Dieses Vorgehen hat sich bewährt und muss verstärkt werden. Es soll für die Ratten keinen einzigen sicheren Treffpunkt in Lille geben!“
Er blickte in die bekannten Gesichter, suchte nach Gemütsbewegungen, versuchte sie einzuordnen. Dienstmäßiges Interesse, ansonsten wenig Reaktion.
„Außerdem ...“ Blenke fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. „Außerdem ist der Agent Mathieu Trudeau wiederaufgetaucht.“
Einige gehobene Augenbrauen, unterschwelliges Interesse, auf anderen Mienen weiter Gleichgültigkeit. Nicht jeder kannte den Namen.
„Wir müssen ihn finden“, fuhr Blenke fort, und dann noch einmal nachdrücklicher, mit erhobener Stimme und geballter Faust: „Wir müssen ihn finden!“ Er bemerkte, dass seine Lippen bebten, und löste die Faust. Dann gab er seiner Stimme einen gleichmütigen Ton. „Und wir werden ihn finden. Meine Herren, die Aktionen der Résistance haben in ganz Frankreich, ja, selbst in Belgien, ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Diese Kriminellen schaden dem Deutschen Reich. Es ist an uns, ihre Tätigkeiten zu unterbinden und gegen sie vorzugehen, mit aller Stärke, aller Unnachgiebigkeit, aller Gerissenheit, aller Grausamkeit. Trudeau ist der Gefährlichste von ihnen.“ Für einen Moment überlegte Blenke, ob er begründen sollte, warum Trudeau so gefährlich war. Aber was konnte er schon sagen? In den Augen der meisten anderen war Trudeau ein unbedeutender Agent, der seit seiner Ankunft vor über einem Jahr, bei der er ihnen entwischt war, kein einziges Mal von sich reden gemacht hatte.
„Wir müssen ihn finden!“, wiederholte er. „Da sind Sie alle gefordert. Nutzen Sie ihre Kontakte. Üben Sie Druck aus. Ich erwarte Ergebnisse.“ Er richtete sich auf, machte sich so groß er vermochte und ließ seine Augen entschlossen funkeln. „Meine Herren, die Jagd ist eröffnet!“
ZWEI
Es war stockfinster in der fensterlosen Kammer. Düster war es hier immer, aber noch sickerte keine Spur von Licht unter der Tür hindurch und deutete an, dass die Sonne die Nacht verscheucht hatte. Trotzdem lag Mathieu wach auf seiner Pritsche und war so munter, als sei helllichter Tag.
Es war gut, dass er sich, nachdem ihnen die Flucht vom Bahnhof geglückt war, direkt für diesen Morgen mit Vincent verabredet hatte. Zweifellos wäre es sicherer für Mathieu gewesen, wenn er nun, da Blenke wusste, dass er wieder in der Stadt war, untergetaucht wäre. Blenke würde alles daran setzen, ihn zu finden. Aber Mathieu konnte sich jetzt nicht ducken. Er musste sich exponieren, um das Netzwerk aufzubauen. Gerade jetzt musste er die Fäden rasch zusammenführen – bevor Blenke begann, seine Züge zu setzen. Auch wenn Ricard den Vorschlag abgelehnt hatte, Mathieu einen Polizeiausweis zu besorgen, war es an der Zeit, die Aktion in jeder anderen möglichen Hinsicht vorzubereiten. Bevor Blenke ihm auf die Schliche kommen konnte.
Sprengstoff würden sie in jedem Fall brauchen. Ihn direkt bei ihrer Ankunft in Frankreich mitzubringen, wäre – ohne Empfangskomitee, ohne konspirative Wohnung – zu gefährlich gewesen. Jetzt waren sie vorbereitet.
Nach einer Weile stand er auf, schaltete das Licht ein und schaute auf seine Uhr. Noch eine halbe Stunde, bis Vincent kommen würde. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und spähte in den Gastraum. Alles ruhig. Die Vorhänge hingen vor den Fenstern und verhinderten jeden Blick nach draußen. Auf leisen Sohlen ging Mathieu durch den Gastraum zu den Toiletten und wusch sich. Dann füllte er ein Glas Wasser und setzte sich an seinen Stammtisch.
„Wie steht es mit dem Bauern, den du wegen unserer Sprengstofflieferung ansprechen wolltest?“, fragte Mathieu ohne Umschweife, als Vincent eingetroffen war.
„Ich habe noch nicht geschafft, zu ihm zu fahren.“
„Dann fahren wir zusammen“, sagte Mathieu, „und zwar heute. Wir müssen schnell handeln.“
Vincent verzog skeptisch den Mund. „Das ist vielleicht nicht so gut. Seine Frau und er sind Fremden gegenüber misstrauisch.“
„Aber du glaubst, dass sie uns helfen würden?“
„Ja. Wenn wir sie auf die richtige Weise fragen. Sie sind recht spezielle Leute.“
„Vor speziellen Leuten fürchte ich mich nicht. Wir werden schon mit ihnen fertig werden. Los, fahren wir hin!“
„Jetzt?“ Nun sah Vincent doch ein wenig überrumpelt aus.
„Warum nicht? Es wird schon hell. Der ganze Tag liegt vor uns. Nutzen wir ihn, um voranzukommen.“ Mathieu fiel ein, dass Vincent vermutlich in seiner Fabrik erwartet wurde. „Wenn du keine Zeit hast, beschreib mir ihren Wohnort. Dann fahre ich allein.“
„Nein, schon gut. Ich komme mit. Ich muss nur in der Fabrik Bescheid sagen. Dort können wir uns auch zwei Fahrräder leihen.“
Sie liefen zu Vincents Arbeitsstelle, stiegen auf die Räder und fuhren los, übers Land gen Südosten. Sie versuchten, von möglichst wenigen Leuten gesehen zu werden, denn obwohl das Fahrrad aufgrund des Benzinmangels inzwischen zum Standardtransportmittel geworden war, galt auf dem Land ein fremder Radfahrer als Ereignis, das sich rasch herumsprach.
Nach dreieinhalb Stunden erreichten sie den Hof. Sie bogen von der Landstraße ab, fuhren eine kurvige Einfahrt hinauf und schoben die Räder durch ein Tor.
Drei Gebäude waren zu sehen: ein kleineres und ein größeres Bauernhaus und weiter hinten am Hang eine große Holzscheune. Auf den Weiden ringsum grasten Rinder.
„Ich kenne den Bauern nur flüchtig“, sagte Vincent. Er wusste nicht, in welchem der Gebäude der Mann wohnte. Aus beiden Bauernhäusern stiegen Rauchsäulen auf. Sie beschlossen, es mit dem kleineren zu versuchen.
Sie stellten die Räder ab, vergewisserten sich, dass sie von der Straße aus nicht zu sehen waren, und gingen zur Tür.
„Es ist vielleicht besser, wenn ich als Erster mit ihnen spreche“, sagte Vincent. Mathieu nickte.
Vincent klopfte.
Kurz darauf öffnete eine ergraute Frau die Tür.
„Guten Tag“, sagte sie. „Kommen Sie herein.“
Sie trat zur Seite und machte eine einladende Geste, ohne zu fragen, was sie für die beiden tun könne oder was sie hier wollten. Zögerlich folgten sie der Frau hinein in die wohlige Wärme, die ein Kamin verbreitete.
„Setzen Sie sich“, sagte sie mit einer altersschwachen Stimme, die erschöpft wirkte von den Versuchen, so laut zu reden, dass die Frau sich selbst hörte. „Nun setzen Sie sich schon. Trinken Sie etwas Tee. Hier haben Sie eine ... Nein, nicht auf den Sessel! An der Sitzkuhle habe ich jahrelang gearbeitet. Hier, nehmen Sie auf der Couch Platz.“
Sie kicherte, legte ein Kissen zur Seite und stellte zwei Tassen auf den kleinen Tisch vor der Couch. Ihre Hände waren flink und tastend. Mathieu vermutete, dass die Alte nicht mehr gut sah. Vincent und er nahmen Platz. Sie stellten sich vor und erfuhren, dass die Frau mit Nachnamen Quinet hieß.
„Leben Sie hier allein?“, fragte Mathieu.
„Im Haus ja“, sagte sie, „aber mein Sohn lebt mit seiner Familie ein Stück den Weg hinauf und sieht jeden Tag nach mir. Sie müssen sich also keine Hoffnungen machen, hier unbemerkt über mich herfallen zu können. Ich kann laut schreien.“ Sie lachte und fuhr fort: „Mein Sohn versucht ständig, mich zu überreden, zu ihm und seiner Frau zu ziehen, aber ich bin noch nicht alt genug, um den ganzen Tag in der dunklen Ecke eines überfüllten Hauses zu sitzen und zu stricken und zu warten, bis die nächste Mahlzeit zubereitet werden kann. Ich schätze, dazu bin ich zu neumodisch.“ Sie lachte wieder, und in ihren Augen sah Mathieu das lebensfrohe Funkeln des jungen Mädchens, das sie vor vielen Jahrzehnten gewesen war. Er fragte sich, wann sie sich bei den beiden endlich nach dem Grund ihres Besuchs erkundigen würde.
„Mein lieber Gérard ist vor einem halben Jahr gestorben“, sagte sie und wurde ernst. „Er war bei allen Nachbarn beliebt. Gut, davon haben wir nicht viele, aber alle im Dorf mochten ihn. ‚Er ist ein Charakter‘, haben sie gesagt, ‚ein Exzentriker.‘ Aber das war Unsinn. Wenn Sie mich fragen, war er ein ganz gewöhnlicher Idiot, das ist alles.“ Sie lachte ein weiteres Mal, verschluckte sich und hustete wie ein alter, stotternder Auspuff. „Bitte verzeihen Sie“, brachte sie mühsam hervor, „meine Luftröhre ist nicht mehr die beste.“
Mathieu konnte sich vorstellen, was für ein Mensch die Frau einst gewesen war: kantig und energisch, herzlich, mit reichlich rauem Humor, vielleicht etwas zu redselig. Diese Eigenschaften steckten offenbar noch immer in ihr, aber heute brauchte sie den Großteil ihrer Kraft, um mit ihrem schwachen Körper zurechtzukommen.
Mathieu schloss sie innerhalb weniger Minuten in sein Herz. Sie erinnerte ihn an die alte Frau, die Kylian und ihm vor ihrer Überquerung der Pyrenäen Unterschlupf gewährt hatte.
Er hätte ihrem kleinen Redeschwall gern den Rest des Tages zugehört, aber sie waren aus einem bestimmten Grund hier. Er warf seinem Begleiter einen auffordernden Blick zu.
Vincent trank einen Schluck Tee, lehnte sich vor und sagte: „Madame Quinet, meinen Sie, mein Freund und ich können einmal zu Ihrem Sohn hinübergehen und mit ihm plaudern? Wir haben das zweite Haus schon entdeckt. Ist er daheim?“
„Du liebes bisschen, plaudern wollen Sie mit Alexis?“ Sie wollte kichern, aber ein neuer Hustenanfall hielt sie davon ab. „Da werden Sie bei ihm nicht viel Glück haben.“
„Ich kenne ihn“, sagte Vincent. „Wir waren zusammen in der Marine. Ich habe eine wichtige Angelegenheit mit ihm zu besprechen.“
„Das klingt mir ganz und gar nicht nach plaudern!“ Sie warf Vincent einen scharfen Blick zu, aber Mathieu vermutete, dass sie vor allem mit ihrer Mimik spielte. Ihre Augen wirkten zu schlecht, als dass sie ihn wirklich so sorgfältig mustern könnten.
„Sie haben recht“, gab Vincent zu und versuchte, ihre plötzliche Schärfe mit einem Lächeln aufzulösen.
„Sie müssen wissen, wir haben hier nicht viel Besuch“, sagte Madame Quinet. „Was unter anderem daran liegt, dass Alexis keinen Besuch mag. Schon gar keinen, der sich selbst für wichtig hält und nicht klar mit der Sprache herausrückt.“
„Von wem er das haben mag?“, fragte Mathieu. Er spürte, dass die Frau zwischen einer tiefen, ihr eigenen Freundlichkeit und einem von ihren Lebensumständen geprägten Misstrauen schwankte. Die heitere Ironie schien aber die Oberhand zu behalten.
„Scharf kombiniert, mein junger, gutaussehender Herr.“
„Wir brauchen die Hilfe Ihres Sohnes. Wir möchten ihn darum bitten. Wenn er ablehnt, verschwinden wir.“
„So viel zur Plauderei.“ Madame Quinet grinste wieder vergnügt. „Bleibt nur eine Frage.“ Sie lehnte sich nach vorn, als wollte sie die beiden in ein Geheimnis einweihen. „Warum vergeuden Sie Ihre Zeit mit mir, als sei ich ein Wachhund, den man mit Zuckerstückchen gefällig stimmen muss? Sie müssen sich nicht mit mir abgeben.“ Sie kicherte kurz, als habe sie einen Einfall, der sie außerordentlich amüsierte. „Gehen Sie nur, gehen Sie zu Alexis. Erzählen Sie ihm alles, was Sie auf dem Herzen haben. Er wird sich freuen Sie zu sehen, zumal einen alten Kampfgefährten!“
Mit Mühe stemmte sie sich von ihrem Sessel hoch. Ihre Knie knackten wie Äste. „Sie brechen jetzt besser auf und erledigen die wichtigen Aufgaben, denen junge Menschen wie Sie so gern nachgehen, und lassen mich hier in der grauen Bedeutungslosigkeit des Alters zurück.“
Auch Mathieu und Vincent standen auf und folgten ihr zur Tür. Sie legte die Hand auf die Klinke, verharrte und sagte: „Es sei denn natürlich, Sie haben Interesse an der einen oder anderen Geschichte. Ich hatte ein langes, aufregendes Leben, müssen Sie wissen.“
Sie sah sie aus ihren zusammengekniffenen Augen an. Ihre Miene verriet Mathieu, wie sehr sie es genoss, sie zu necken und auf die Probe zu stellen.
Vincent schüttelte den Kopf. „Madame Quinet“, sagte er, „ich habe Ihren Mann leider nicht kennengelernt, aber Sie sind mindestens ebenso ein Charakter, wie er es war.“
„Ich hoffe, das ist nicht ihre wenig charmante Art, mir zu sagen, dass ich eine Idiotin bin.“
Er lachte und streckte die Hände in die Höhe. „Sie haben für alles eine Antwort. Ich gebe auf.“
Sie nickte zufrieden und öffnete die Tür. „Ich sehe, auch Sie finden gelegentlich die richtigen Worte. Jetzt dürfen Sie gehen.“
Sie folgten weiter dem von tiefen Furchen durchzogenen Weg, der über eine Wiese und einen sanften Hang hinauf zum zweiten Bauernhaus führte. Mit Moos in den Ritzen, alter, fleckiger Holzverkleidung und bröckelndem Putz am Eingang sah es recht heruntergekommen aus. Sie klopften auch hier. Für ein paar Sekunden hörten sie nichts außer dem Wind, der hinter ihnen im Gras säuselte. Dann ertönte eine tiefe, beinahe grollende Stimme, kaum einen Meter entfernt hinter der dünnen Tür.
„Was wollen Sie?“
Vincent räusperte sich überrascht. „Ich ... Wir möchten mit Ihnen sprechen.“
„Was mir immer noch nicht verrät, was Sie wollen!“
„Wir möchten mit Ihnen ... über die Deutschen sprechen. Darüber, wie wir mit ihnen umgehen können.“
Mathieu hob eine Braue. Vincent hatte recht viel preisgegeben, andererseits musste er den Mann hinter der Tür irgendwie ködern, und eine noch vagere Andeutung hätte kaum sein Interesse geweckt.
„Na, sehen Sie, es geht doch“, sagte der Mann. „Jetzt weiß ich immerhin, dass es sich nicht lohnt, Ihnen die Tür aufzumachen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“
„Alexis, warten Sie!“, rief Mathieu.
Es kam keine Antwort mehr, aber Mathieu spürte, dass der Mann noch immer hinter der Tür stand. Vielleicht beobachtete er sie durch irgendeinen Spalt oder durch die Gardine am Fenster neben der Tür.
„Wir werden uns nicht abweisen lassen!“, sagte Mathieu so laut er konnte, ohne zu schreien. „Wir haben gewissermaßen ein Recht darauf, mit Ihnen zu sprechen.“
„Wovon reden Sie?“
„Ihre Mutter hat uns die Erlaubnis gegeben, Ihnen das Herz auszuschütten und Ihnen in Ruhe unser Anliegen vorzutragen.“
Nach ein paar Sekunden öffnete sich die Tür einen Spaltbreit, sodass Mathieu das Gesicht des Mannes sehen konnte.
„Das alte Biest“, murmelte der, aber seine Mundwinkel hoben sich leicht und deuteten die Zuneigung an, die er für seine Mutter empfand.
„Na schön, kommen Sie rein.“
Der Mann mochte Mitte vierzig sein, eine raue Gestalt von breiter Statur, mit wettergegerbtem Gesicht und großen Händen. Etwas Unnachgiebiges, Hartes ging von ihm aus, und seine Züge wirkten verschlossen wie bei Menschen, die nicht oft mit anderen zu tun haben und nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Er hatte nichts von der gewitzten Gewandtheit seiner Mutter – der junge Quinet erschien eher grimmig und wortkarg.
„Sie bekommen nicht oft Gäste?“, fragte Mathieu, während er Alexis mit Vincent ins Haus folgte.
„Falls das eine wenig subtile Anspielung auf meine mangelnde Gastfreundschaft sein soll, haben Sie recht. Ich bekomme nicht oft Gäste. Meine Familie und ich, wir bleiben gern unter uns. Die meisten anderen Leute, die hier so herumschwirren, öden uns an. Öden mich an. Und jetzt werden Sie mich anöden, vermute ich.“
„Wir werden sehen. Sie haben Familie?“
„Ja, eine Frau und einen Sohn, wenn Sie es genau wissen wollen. Großartige Wesen. Sie sammeln gerade Feuerholz. Eben wollte ich mich aufmachen und ihnen helfen.“
Mathieu und Vincent nickten verständnisvoll.
„Das heißt“, fügte Alexis hinzu, um die Sache klarzustellen, „jede Sekunde, die Sie mir stehlen, halten Sie mich davon ab, mich meiner Familie oder meiner Arbeit zu widmen.“
„Wir verstehen“, sagte Mathieu in einem unverbindlichen Ton und sah sich in dem Haus um. Und es gab einiges zu sehen. Wo er nach dem äußeren Eindruck des Hauses ein durchgesessenes Sofa sowie alte, abgewetzte Tische und Schränke erwartet hatte, sah er mit großer Fachkenntnis gebaute Holzmöbel: Schränke, Regale, Tische, ein Kleiderständer, Sitzbänke aus dickem Holz, das sorgfältig bearbeitet und von einer talentierten Hand bemalt worden war.
„Meine Frau“, sagte Alexis, der seinem Blick gefolgt war. „Sie ist recht geschickt mit Pinsel und Farbe.“
„Und die Möbel? Das sind keine windschief zusammengenagelten Bretter.“
„Aufmerksam beobachtet. Ich arbeite gern mit den Händen, und die Holzmöbel bilden eine zusätzliche Einnahmequelle. Ich verwende Bäume aus meinem eigenen Wald, meine Frau wirft ein paar Farbkleckse darauf, und dann verkaufen wir alles. Das macht uns Freude und bringt etwas Geld ein. Jedenfalls tat es das früher. Aber nun setzen Sie sich lieber, damit wir diese Angelegenheit hinter uns bringen können.“
Die beiden gingen über die knarzenden Dielen und setzten sich auf zwei hölzerne Sitzbänke, die einander gegenüberstanden.
„Sie kenne ich“, sagte Alexis nun zu Vincent und legte die Stirn in Falten. „Sie sind ... Vincent Limbour, richtig?“
Vincent nickte. „Ganz genau.“
„So sieht man sich also wieder. Was wollen Sie?“
„Ihre Unterstützung“, sagte Vincent.
„Brauchen Sie Möbel?“, fragte Alexis in einem Ton, der klarmachte, dass er kein Ja erwartete. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt.
Vincent zögerte eine Sekunde, dann sagte er: „Wir brauchen einen Abwurfplatz für eine Sprengstofflieferung aus England.“
Mathieu hielt unwillkürlich die Luft an. Er beobachtete Alexis, suchte in seinem Gesicht nach dem ersten Anzeichen einer Reaktion. Vincent hatte alles auf eine Karte gesetzt.
„Frankreich ist groß“, sagte Alexis mit ernster Miene und fuhr ungerührt fort: „Es gibt hier viel Land, über dem sich etwas abwerfen lässt. Es überrascht mich, dass Sie dafür zu mir kommen.“
„Wenig davon ist geeignet.“
„Ich bin politisch nicht aktiv.“
„Dabei kann es bleiben. Sie müssten von nichts wissen. Es reicht, wenn Sie uns dulden.“
„Und wer soll mir abnehmen, dass ich nicht weiß, wer sich auf meinem Hof herumtreibt?“
„Wir werden vorsichtig sein.“
„Wie kommen Sie dazu, mich um so etwas zu bitten? Entweder Sie sind naiv, oder Sie sind wahnsinnig. Sie kennen mich doch kaum.“
„Gut genug, um zu wagen, viel von Ihnen zu halten.“
„Ach Gottchen.“
Alexis hatte bisher jede Regung vermieden, die gezeigt hätte, wie er über die Frage dachte. Mathieu glaubte, dass er nur wenige seiner Äußerungen ernst meinte. Vermutlich tastete er seine beiden Besucher ab, um zu prüfen, ob sie ehrlich waren oder nicht vielleicht selbst für die Deutschen arbeiteten, auf der Suche nach Widerstandsmitgliedern und deren Sympathisanten, die sie verhaften konnten, um ihre Quoten zu erfüllen. Zumindest hoffte Mathieu, dass dies der einzige Grund war, weshalb Alexis sich ablehnend äußerte.
Er entschied, Alexis mit deutlichen Worten zu überzeugen. Sollte sein Versuch scheitern, sollte Alexis darauf beharren, mit ihren Aktivitäten nichts zu tun haben zu wollen, sollte er vielleicht gar feindselig reagieren, würde Mathieu ihn womöglich töten müssen.
„Ach Gottchen“, wiederholte Alexis. Dieses Mal sagte er es leiser, mehr zu sich selbst. Er sah Mathieu und Vincent an und sagte: „Sie können von mir halten, so viel Sie wollen, aber ich bin nicht bereit, für irgendeine Angelegenheit, über die ich kaum etwas weiß, die Sicherheit meiner Familie aufs Spiel zu setzen.“
„Heißt das, Sie wollen uns nicht helfen?“, erwiderte Vincent. „Oder brauchen Sie mehr Informationen, um eine Entscheidung zu treffen?“
Alexis überlegte, bevor er antwortete: „Das heißt, dass Sie jetzt besser gehen.“
Er machte einen Schritt in Richtung Tür, die in diesem Moment aufgeschlossen und geöffnet wurde. „Du liebes bisschen, du bist doch wieder am Schwatzen statt am Arbeiten!“, schimpfte eine altersschwache Stimme sofort los. „Habe ich einen Nichtsnutz herangezogen?“
Madame Quinet humpelte herein, stemmte die Hände in die Hüfte und sah die drei Männer an. Auf ihrem Sohn verharrte ihr Blick. „Was stehst du hier so herum? Wenn du schon Gäste hast, kannst du dich wenigstens zu ihnen setzen! Und wo sind ihre Getränke? Habe ich dir denn gar nichts beigebracht?“ Sie schob sich an Alexis vorbei. „Rücken Sie mal ein Stück“, sagte sie zu Mathieu. „Ihr jungen Leute mögt mich bei euren wichtigen Gesprächen nicht dabeihaben wollen, aber solange ich noch hier bin, sitze ich, wo ich will!“ Sie nahm neben Mathieu Platz und tätschelte ihm das Knie. „Da bin ich wieder, mein junger Herr. Ich habe mir gedacht, dass Sie bestimmt schon Sehnsucht nach mir hatten.“
„Ganz recht“, sagte Mathieu.
„Und du?“, sagte Madame Quinet an ihren Sohn gewandt. „Du stehst immer noch herum wie bestellt und nicht abgeholt, statt deinen Gästen endlich etwas zu trinken anzubieten.“
Alexis seufzte leise. Ihm war anzusehen, dass es ihn all seine Beherrschung kostete, die Schrulligkeit seiner Mutter mit guter Miene zu erdulden. „Eigentlich wollten die Herren gerade gehen“, sagte er.
„Ach was?“, sagte Madame Quinet überrascht und sah Mathieu und Vincent fragend an. Mathieu zuckte kaum merklich mit den Schultern.
„Unsinn!“, entschied sie. „Los, bring einen Tee oder wenigstens etwas Wasser. Kehlen, die sprechen, müssen feucht und geschmeidig sein.“ Hustend fügte sie hinzu: „Ich weiß, wovon ich rede.“
Alexis brummte unwillig, verschwand dann aber.
„Keine Sorge, Schätzchen“, sagte Madame Quinet zu Mathieu und tätschelte ihm wieder das Knie. „Wir machen das schon.“
Mathieu nickte, fragte sich aber insgeheim, ob sie auch nur die leiseste Ahnung hatte, weshalb Vincent und er hier waren. Vielleicht machte sie sich lediglich einen Spaß daraus, ihren Sohn zu ärgern. Vielleicht hatte sie aber auch eine unerklärliche Intuition, die ihr verriet, dass die beiden Besucher etwas Heikles, aber Ehrbares im Sinn hatten.
Kurz darauf kehrte Alexis mit einem Wasserkrug und vier Gläsern zurück, schenkte ihnen ein, setzte sich, wie seine Mutter gefordert hatte – und schwieg, als wolle er unterstreichen, dass für ihn alles gesagt sei.
Die alte Quinet klatschte in die Hände. „Also! Was habe ich verpasst?“
„Wir haben Ihren Sohn um einen Gefallen gebeten“, sagte Mathieu.
„Und er hat ihn Ihnen verwehrt?“
Mathieu nickte.
„Glaube mir, Mutter, was sie wollen, können wir nicht leisten“, erklärte Alexis.
„Und das hast du in so wenigen Minuten entschieden? Du meine Güte!“
„Die Sache ist klar. Da gibt es nicht viel zu überlegen.“
„Nicht, wenn man so starrköpfig ist wie du, nein. Aber ich schlage dir vor, dass du diesen Leuten vernünftig zuhörst. Einmal in deinem Leben solltest du zuhören!“
Alexis sah sie verwundert an, so als habe er etwas an ihr entdeckt, was ihm vorher nicht aufgefallen war. Vielleicht war auch ihm bewusst geworden, dass ihre Hartnäckigkeit heute über das gewöhnliche Maß hinausging. Dass sie mehr im Sinn haben musste, als ihn zu necken. Dass sie ein Ziel verfolgte. Mathieu überlegte, ob sie vielleicht sogar selbst im Widerstand war, ohne dass ihr Sohn davon wusste.
„Also gut“, entgegnete er und seufzte. „Ich höre zu.“
Mathieu räusperte sich und fixierte ihn mit dem Blick. „Mein Name ist Benjamin Marcus Dayan“, sagte er. „Ich bin britischer Agent. Meine Aufgabe ist es, den Widerstand zu stärken und die Deutschen zu schwächen. Für eine kriegswichtige Aktion benötige ich Sprengstoff. England wird ihn mir schicken, aber es geht nicht ohne einen geeigneten Abwurfplatz. Mein Freund Vincent glaubt, Sie würden uns helfen.“
Alexis’ Maske bröckelte. Mathieus unerwartete Offenheit hatte ihn in Erregung versetzt. Seine gespielte Gleichgültigkeit verwandelte sich in eine Mischung aus Argwohn und vorsichtiger Freude, glaubte Mathieu zu erkennen. Die Hände, die Alexis auf seinen schweren Flanellhosen abgelegt hatte, zuckten.
Mathieu legte nach: „Wir brauchen Sie.“
„Ist das wahr?“, wandte sich Alexis an Vincent.
„Jedes Wort.“
Alexis blickte zwischen den beiden hin und her. In seinem Gesicht arbeitete es. Auf den Zügen seiner Mutter hatte sich der Anflug eines Lächelns ausgebreitet.
Schließlich sagte er: „Ich glaube Ihnen.“ Er erhob sich und baute sich vor ihnen auf. Mathieu befürchtete, er wolle sie hinauswerfen, aber er streckte seine prankenartige Hand aus. Vincent und Mathieu standen auf und schüttelten sie. Nicht die Geste der ausgestreckten Hand, sondern erst die Berührung, Haut auf Haut, löste Mathieus Anspannung.
Alexis drückte kräftig zu, sah ihnen in die Augen und sagte: „Wenn das, was Sie sagen, wahr ist, können Sie auf mich zählen.“ Mit einer Geste bedeutete er ihnen, zu warten, verschwand und kehrte eine Minute später mit Gläsern und einer Flasche Cognac zurück. Sie setzten sich und tranken. Auch Madame Quinet genehmigte sich ein paar große Schlucke.
„Nachdem meine Mannschaft von der Waffenstillstandskommission demobilisiert wurde, hat mich der Pflichtarbeitsdienst einberufen“, erzählte Alexis. „Aber ich weigere mich, in Deutschland für Verbrecher zu arbeiten. Ich habe die Behörden mit falschen Papieren in die Irre geführt.“
„Gut gemacht“, sagte Mathieu.
„Sie müssen mich schon von meinem Hof tragen. Freiwillig gehe ich nicht. Schon gar nicht nach Deutschland. Über mein Schicksal bestimme ich, niemand sonst!“
„Darauf trinke ich!“, sagte Vincent und erhob sein Glas. Mathieu, Alexis und Madame Quinet taten es ihm gleich und tranken, als die Tür geöffnet wurde. Alexis’ Frau und Sohn kehrten vom Holzsammeln zurück.
„Ihr seid früh zurück“, sagte Alexis. „Ich wollte euch gleich folgen.“
„Wir machen nur eine Pause“, sagte seine Frau. Sie sah kräftiger aus als mancher Mann. Trotz der Kälte hatte sie geschwitzt: Die Haare klebten ihr am Kopf. Ihr etwa fünfzehnjähriger Sohn und sie zogen die Jacken aus und hängten sie an den Kleiderständer.
„Das sind Benjamin und Vincent“, sagte Alexis. „Und das sind meine Frau Simone und mein Sohn Louis.“
Der Junge nickte ihnen grüßend zu und verließ den Raum. Simone setzte sich zu ihnen. „Und was machen Sie hier?“, fragte sie Mathieu und Vincent. Sie war ähnlich direkt wie ihr Mann.
„Alte Freunde von der Navy“, erklärte Alexis. „Waren in der Nähe.“
„Aha.“
Es folgten Kommentare zum Wetter, zur zurückliegenden Ernte, zur Verdunkelung, zur Lebensmittelknappheit, die hier, auf dem Land, weniger gravierend war. Mathieu hörte nur mit einem Ohr zu. Er erlaubte sich für einen Moment, sich dem zufriedenstellenden Gefühl hinzugeben, einen weiteren Unterstützer gewonnen zu haben. Es ging voran.
Die Rekrutierung in der vergangenen Woche war vielversprechend angelaufen. Serge, Vincent, Denise und Dominique hatten sich in ihren Bekanntenkreisen vorsichtig nach verlässlichen Leuten umgehört und alte Freunde kontaktiert, denen sie Widerstandswillen und Mut zutrauten. Oft kam eines zum anderen. Ein Zahnarzt namens Dr. Gide hatte Vincent mit einem Verkäufer bekanntgemacht, einem Sozialisten, der schon seit Monaten im Widerstand aktiv war und in Verbindung zu einigen kleinen, unbewaffneten Gruppen stand, die sich weigerten, für die deutschen Kriegsbemühungen zu arbeiten. Mathieu integrierte diese kleinen, unsicheren Gruppen und Privatleute in sein entstehendes Netzwerk.
Simone schlug sich mit den flachen Händen auf die Knie und stand auf. „Genug gequatscht!“, sagte sie und bedachte Alexis mit einem Blick, der es zweifelhaft erschienen ließ, ob sie nur für sich selbst gesprochen oder ihn gerügt hatte.
Er verzog sein Gesicht zu einem rauen Lächeln, das manchem Kleinkind Angst gemacht hätte. „Ich brauche noch einen Moment.“
Sie brummte etwas Unverständliches und rief nach Louis. Ein interessantes Paar, dachte Mathieu. Fremden gegenüber und im Umgang miteinander scheinbar kühl, und doch war eine verborgene Herzlichkeit zu spüren.
Simone und Louis verabschiedeten sich und verschwanden nach draußen.
„Wie kann ich Ihnen nun genau helfen?“, fragte Alexis.
„Wie gesagt, wir brauchen einen geeigneten Platz für Fallschirmabwürfe“, entgegnete Mathieu.
„Und wie sieht so ein Platz aus?“
„Idealerweise eine Lichtung, umgeben von Wald, so weit wie möglich entfernt von Straßen und Bahnlinien. Und natürlich von der deutschen Flugabwehr. Am besten auf einer Erhöhung, keinesfalls in einem Tal. Damit die Lichter unseres Empfangskomitees nicht etwa von benachbarten Hügelseiten, sondern möglichst nur aus der Luft zu sehen sind. Hilfreich wäre ein Fluss oder ein anderes Landschaftsmerkmal in der Nähe, das dem Piloten die Orientierung erleichtert.“
„Das sind eine Menge Anforderungen.“
„Es ist ein gefährliches Unterfangen. Wir wollen das Risiko so weit wie möglich minimieren.“
„Soll mir recht sein!“ Er leerte sein Cognacglas mit einem zweiten Schluck. „Unser Wald hat eine Lichtung. Mit einem Fluss kann ich allerdings nicht dienen.“
„Können Sie uns die Stelle zeigen?“
„Ja.“
Mathieu bemerkte, dass sein Gang durch den Cognac – auf nüchternen Magen getrunken, nach Stunden sportlicher Betätigung auf dem Rad – etwas unsicher war. Die drei Männer liefen den langgestreckten, sanften Hang weiter hinauf, auf dem das Haus stand, vorbei an der Scheune, durch ein Tor. Dahinter wurde das Gelände eben, und ein dichter Mischwald begann. Alexis erzählte, dass nur ein kleiner Teil des Waldes zum Land der Quinets gehörte. Im Wald trafen sie bald auf Simone und Louis, die gerade den Stamm einer Fichte zersägten.
„Endlich!“, stieß Simone keuchend aus. „Tatkräftige Unterstützung.“ Louis grinste nur. Offenbar sprach er nicht viel.
„Noch nicht“, sagte Alexis, ohne stehenzubleiben. „Ich zeige meinen Gästen unseren Wald. Ich helfe euch nachher.“
„Wann auch immer das ist!“, rief Simone ihm hinterher, ohne im Sägen innezuhalten.
Der Ort, den Alexis ihnen zeigte, war günstig gelegen. Eine ausgedehnte, von dichtem Wald umgebene Lichtung, gut geschützt vor unerwünschten Blicken.
„Zufrieden?“, fragte Alexis.
Mathieu nickte.
„Fehlt noch etwas?“
Mathieu bat den Mann ungern um weitere Hilfe, weil er ihn nicht noch mehr in Gefahr bringen wollte. Aber er hatte keine Wahl.
„Kennen Sie ein Versteck, wo der abgeworfene Nachschub deponiert werden könnte?“
„Am besten in meinem Haus“, sagte Alexis, ohne zu zögern.
Sie machten sich auf den Rückweg. Nachdem sie Simone und Louis passiert hatten, wies Mathieu ihn auf die Gefahr hin, in die er sich begab, indem er ihnen half.
„Mir ist das Risiko bewusst“, antwortete Alexis nur.
Sie erreichten das Haus, begaben sich auf die Suche nach geeigneten Verstecken für die Pakete und fanden verborgene Nischen und Winkel in der Küche und im Keller, unter Dielen und im Dach.
„Haben Sie vielleicht weitere Kontakte, die den Widerstand unterstützen würden?“, fragte Mathieu, während sie den Dachboden besichtigten.
„Was brauchen Sie?“
„Ein Netzwerk aus einheimischen Sympathisanten, die bereit sind, Lebensmittelmarken oder Bezugsscheine abzugeben oder eigene Erzeugnisse mit uns zu teilen. Je mehr Mitglieder wir gewinnen, desto mehr von uns werden ohne Einkommen in der Illegalität leben.“
„Ich werde mich umhören.“
Mathieu war beeindruckt und gerührt. Kannte dieser Mann keine Zweifel, nachdem er einmal eine Entscheidung getroffen hatte? Immerhin half er einem Spion, einem Gesetzlosen, der im Gegensatz zu Alexis nur sein eigenes Leben aufs Spiel setzte, nicht das seiner Familie. Und einer Gefahr leichter entkam, weil er sich unabhängig bewegen konnte, ohne einen unsichtbaren Anker, der ihn bei seinem Bauernhof hielt. Wenn ihnen Emil Blenkes Gestapo auf die Spur kam, würde Alexis ihm mit seiner Familie, seinem Hof, seiner Existenz vollkommen wehrlos ausgeliefert sein. Und gewiss mit Folter und Tod bestraft werden.
Sie kehrten ins Wohnzimmer zurück, wo Madame Quinet noch immer gutgelaunt auf der Sitzbank saß. Alexis’ Blick fiel auf den Tisch mit dem Cognac. Er füllte nach und verteilte die Gläser. „Auf Gesundheit und Sieg!“, sagte er und hob sein Glas.
Die einzigen zwei Gäste waren gegangen, kurz bevor Dominique das Café betrat. In der Hand trug er seinen klobigen, quadratischen Aktenkoffer mit verstärkten Kanten, sichtlich darum bemüht, ihn leichter aussehen zu lassen, als er war.
„Wie lange kannst du den Laden schließen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen?“, fragte Mathieu Thierry.
„Reicht eine halbe Stunde?“, fragte Thierry.
„Vielleicht.“
Thierry klebte einen Zettel an die Tür – Gleich zurück! – und verschloss sie. Mathieu führte Dominique zu einem Ecktisch, der von der Straße aus nicht zu sehen war. Dominique legte den Koffer darauf ab und öffnete ihn. Keine Hefter und Papierstapel kamen zum Vorschein, sondern vier Fächer, auf die sich alle Bestandteile eines Transmitters verteilten: der Empfänger, der Morseschlüssel, die Batterie, allerlei Einzel- und Ersatzteile. Beim ersten Absprung hatte Mathieus Team ein schweres, altmodisches Gerät dabeigehabt, das aus zwei Teilen bestand. Die neue Generation war kleiner und mit fünfzehn Kilogramm deutlich leichter.
Draußen klapperten die Räder eines Wagens über das Kopfsteinpflaster. Mathieu öffnete das nächste Fenster, steckte den Kopf heraus und schaute nach links und rechts. Der Holzwagen, beladen mit Ersatzteilen und gezogen von einem alten Mann, entfernte sich. Sonst war niemand zu sehen. Es wurde langsam dunkel.
„Alles ruhig.“
Er ließ sich von Dominique die lange, auffällige Antenne reichen, befestigte sie außen am Fensterrahmen und richtete sie aus. Ab jetzt lief die Zeit. Dominique steckte das Kabel in eine Steckdose und die Kopfhörer in den Empfänger und verband den Morseschlüssel mit dem Sender. Er holte einen Quarzkristall hervor, mit dem er die mit der SOE vereinbarte Frequenz einstellte und breitete ein großes Stück Seidenpapier auf dem Tisch aus, auf das in einer Tabelle aus paarweise angeordneten Buchstabenreihen die Codes und Chiffren gedruckt waren.
Dominique arbeitete zügig und sicher. Selbst seine Augen machten keine unnötige Bewegung. Sie waren ausschließlich auf den Transmitter und die anstehende Aufgabe fokussiert. Sobald die Verbindung stand, würden Konzentration und Eile vonnöten sein. Eine Funkübertragung zog Feinde an wie ein Magnet.
Dominique betätigte die Morsetaste und schüttelte den Kopf. Er verließ die vereinbarte Sendefrequenz, kehrte zu ihr zurück und versuchte es erneut.
„Was ist los?“, fragte Mathieu, aber Dominique zuckte nur mit den Schultern, weiter konzentriert über den Transmitter gebeugt.
„Irgendwas stimmt nicht“, sagte Dominique. „Ich sende kein Signal.“
„Liegt es an der Verbindung zur Antenne?“
„Ich glaube nicht.“
„Hast du genug Strom?“
Dominique nickte.
„Hast du den Sender richtig eingestellt?“
„Selbstverständlich! Vielleicht haben wir falsche Kristalle bekommen.“
„Unwahrscheinlich. Wohl eher ein Defekt oder eine Störung.“
„Ach, und woher weißt du das?“, gab Dominique gereizt zurück.
Mathieu schluckte die scharfe Antwort, die ihm auf der Zunge lag, herunter. „Bau das Set ab und wieder auf, damit wir es ausschließen können“, sagte er nur.
Nach kurzem Zögern begann Dominique, das Transmitter-Set mit flinken Bewegungen auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen.
„Überprüf den Empfang“, sagte Mathieu.
Dominique kippte einen Schalter von Senden auf Empfangen. „Ich höre ein leichtes Rauschen“, sagte er. „Ein sehr leises.“
„Die Verbindung zur Antenne funktioniert also“, stellte Mathieu fest. „Aber das Signal scheint zu schwach zu sein.“
Mathieu vermutete, dass die Nachbargebäude das Signal störten – eine Option, die er zuletzt ausschließen wollte, weil das Hantieren mit der Antenne auf offener Straße sie leicht verraten konnte. Er öffnete das Fenster und richtete sie neu aus, mit dem gleichen Ergebnis. Dann warf er einen Blick auf die Uhr: Die vereinbarte Zeit, zu der die SOE täglich seine Sendefrequenz beobachten würde, näherte sich.
„Hast du Zugang zu den oberen Gebäudeetagen?“, fragte er Thierry, der noch hinter dem Tresen stand. Der Wirt schüttelte den Kopf.
„Das Gebäude muss ungünstig liegen“, sagte Dominique ungehalten. „Wir können von hier nicht senden.“
Mathieu spähte schräg durchs Fenster nach draußen und sah dann Dominique an. „Du wirst dir von Vincent ein Fahrrad besorgen, den Transmitter zerlegen und ins Umland fahren, um einen geeigneten Ort für die Übertragung zu finden.“
„Bist du wahnsinnig? Das ist viel zu gefährlich!“
„Dann bring den Transmitter hier in Gang.“
„Du weißt so gut wie ich, dass es nicht an mir liegt, dass wir kein Signal bekommen. Die Antenne ...“
Mathieu machte einen Schritt auf den Tisch mit dem Transmitter zu.
„Deine Aufgabe ist, mir eine Verbindung nach London herzustellen. Du bist der Experte. Lass dir etwas einfallen. Ich brauche diese Verbindung.“
Dominique funkelte ihn aus wütenden Augen an, sagte aber nichts, sondern beugte sich wieder über den Transmitter.
Nachdem er Dominique ein paar Sekunden dabei zugesehen hatte, wie er Stecker ein- und wieder aussteckte, Regler hin und her schob und Schalter betätigte, verlor Mathieu die Geduld. „Das bringt nichts“, sagte er. „Komm.“
Dominique atmete hörbar durch die Nase aus. „Wie du schon sagtest, ich bin der Experte. Nicht dein Kind. Dein Umgang ...“
Mathieu machte noch einen Schritt auf den Tisch zu, bis er direkt davorstand und Dominique zu ihm aufschauen musste. „Ich weiß, du warst nicht in der Armee, kennst keine Befehlsketten. Das Wichtigste kann ich dir aber hier und jetzt sagen: Ich brauche keine Diskussionen. Nicht, wenn es gilt zu handeln. Und jetzt komm. Das ist ein Befehl!“
Mathieu lief zur Tür, schloss auf, steckte den Kopf hinaus und stellte sicher, dass die Luft rein war. Hinter sich hörte er das Rücken von Dominiques Stuhl und Schritte. „Du hältst hier an der Ecke Wache“, sagte Mathieu in den Innenraum hinein, trat nach draußen, bog nach links und lief dicht an der Hausfassade entlang. Vor dem letzten Fenster und der Antenne blieb er stehen und schaute sich erneut um. Für den Moment war die Nebenstraße leer. Die nächsten Fußgänger sah er in einigen hundert Metern Entfernung. Dominique stand gemütlich vor dem Eingang des Cafés, als wartete er auf eine Verabredung, und ließ den Blick hierhin und dorthin schweifen. Hinter den Fenstern des Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite rührte sich nichts.