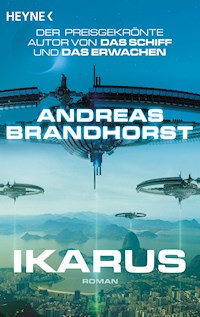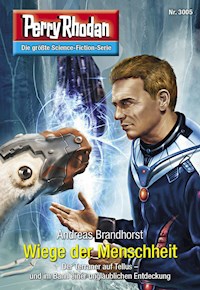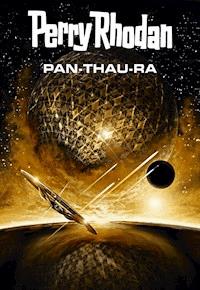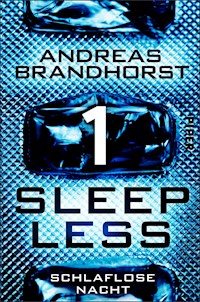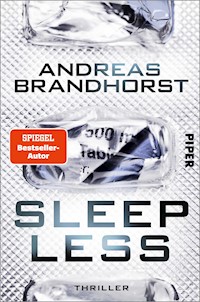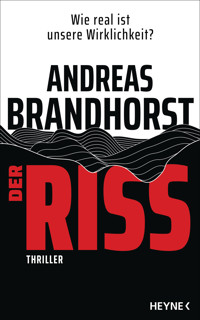
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Flynn Darkster, einer der weltweit besten Hacker, wird verhaftet, weil er in die Computersysteme des Pentagon eingedrungen ist. Er wird vor die Wahl gestellt: entweder Gefängnis oder Mitarbeit bei der »Gruppe Horatio«, einem geheimen Regierungsprogramm. Schon bald kommt Flynn dem wahren Ziel des Geheimprojekts auf die Spur, die Suche nach Beweisen dafür, dass unsere Realität in Wirklichkeit eine gewaltige Computersimulation ist. Doch wenn das so ist, wer hat diese Simulation geschaffen? Und gibt es einen Weg, die Menschheit daraus zu befreien? Für Flynn beginnt eine atemlose Jagd nach mächtigen Gegnern, die sich hinter den Grenzen der Wirklichkeit selbst zu verbergen scheinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Roman
Flynn Darkster, einer der weltweit besten Hacker, wird verhaftet, weil er in die Computersysteme des Pentagons eingedrungen ist. Er wird vor die Wahl gestellt: entweder Gefängnis oder Mitarbeit bei der »Gruppe Horatio«, einem geheimen Regierungsprogramm. Schon bald kommt Flynn dem wahren Ziel des Geheimprojekts auf die Spur, die Suche nach Beweisen dafür, dass unsere Realität in Wirklichkeit eine gewaltige Computersimulation ist. Doch wenn das so ist, wer hat diese Simulation geschaffen? Und gibt es einen Weg, die Menschheit daraus zu befreien? Für Flynn beginnt eine atemlose Jagd nach mächtigen Gegnern, die sich hinter den Grenzen der Wirklichkeit selbst zu verbergen scheinen.
Wie real ist unsere Wirklichkeit? Der große Thriller von Andreas Brandhorst sprengt die Grenzen unserer Realität.
Der Autor
Andreas Brandhorst, geboren 1956 im norddeutschen Sielhorst, hat mit Romanen wie Äon, Das Erwachen oder Das Schiff die deutsche Science-Fiction-Literatur der letzten Jahre entscheidend geprägt. Spektakuläre Zukunftsvisionen verbunden mit einem atemberaubenden Thriller-Plot sind zu seinem Markenzeichen geworden und verschaffen ihm regelmäßig Bestsellerplatzierungen. Zuletzt ist im Heyne Verlag sein Roman Zeta erschienen. Andreas Brandhorst lebt im Emsland.
www.andreasbrandhorst.de
diezukunft.de
AndreasBrandhorst
DerRiss
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 10/2024
Copyright © 2024 by Andreas Brandhorst
Copyright © 2024 dieser Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur,www.textbaby.de
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-31811-6V005
diezukunft.de
In Wirklichkeit erkennen wir nichts; denn die Wahrheit liegt in der Tiefe.
Demokrit(460–370 v. Chr.)griechischer Naturphilosoph
Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes.
Salvador Dali(1904–1989)spanischer Maler, Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer und BÜHNENBILDNER
Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.
Marcus Aurelius(121–180 n. Chr.)römischer Kaiser und Philosoph
Prolog
Alma SalomeMadrid, SpanienMittwoch, 3. August
Die Nacht starrte sie an.
Nicht mit den Tausenden Lichtern der Stadt, die unter ihr ausgebreitet lag, sondern mit Augen in den dichtesten und dunkelsten Schatten.
Alma Salome stand auf der Dachterrasse ihres Penthouse im fünfzehnten Stock des neuen Apartmentgebäudes und suchte den Blick der Nacht erst im Osten, beim nicht weit entfernten Palacio Real, dem Königspalast. Doch dort leuchten Madrids Lichter besonders hell, und die Schatten blieben grau, schmal und klein. Im Südosten, beim monumentalen Friedhof Saint Isidore, wurden sie breiter und größer, doch jene Finsternis blieb den Toten vorbehalten und den Menschen, die des Nachts ihre Nähe suchten. Im Westen und Norden schien die Stadt Löcher zu bekommen. In dem mehr als tausendfünfhundert Hektar großen Park Casa de Campo wirkten die wenigen Lichter wie Eindringlinge, wie Sterne, die vom Himmel gefallen waren, ohne ganz zu erlöschen.
Alma beobachtete den Park und fröstelte plötzlich trotz der schwülen Hitze, die die Stadt seit Tagen gefangen hielt. Sie hatte den Blick gefunden und glaubte, auch die Stimme zu hören, an die sie sich erinnerte, leiser als der nächtliche Pulsschlag von Madrid.
»Was willst du mir sagen?«, flüsterte sie und versuchte, die Erinnerung festzuhalten.
Du kannst es herausfinden, antwortete die Dunkelheit.
»Wie?«
Oh, das weißt du.
Alma kletterte auf die Brüstung und starrte in den fünfzehn Stockwerke tiefen Abgrund direkt vor ihr. Unten rollten Fahrzeuge mit leisen Elektromotoren über die breite Straße. Ihr Scheinwerferlicht verschmolz mit dem Schein der Straßenlampen.
Sie blickte noch einmal zurück, zu den Fenstern ihres Penthouse. Nur eine Lampe brannte dort, die Stehlampe in der Ecke des Wohnzimmers, deren mattes Licht bis zur offenen Terrassentür reichte.
Jemand stand dort, ein Mann, mittelgroß und schlank, sein Gesicht verborgen in den Schatten. Sie sah den Unbekannten nicht zum ersten Mal. Bisher war er immer stumm geblieben, er hatte nie auch nur ein Wort gesprochen, und wie sehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr auch dieses Mal nicht, sein Gesicht zu erkennen.
Sie blinzelte, und die Gestalt verschwand. Es zeigte sich keine Silhouette mehr in der offenen Tür.
Alma blickte wieder in die Tiefe.
Vielleicht lande ich auf einem der Autos, dachte sie, von einer seltsamen Ruhe erfasst. Ich könnte jemanden verletzen.
Demokrit, raunte die Nacht.
»Was?« Das war neu. Daran erinnerte sich Alma nicht.
Ein griechischer Philosoph, teilte ihr die Dunkelheit mit. Die Wahrheit liegt in der Tiefe, hat er gesagt.
»Was?«
Spring!, befahl die Nacht. Finde die Wahrheit in der Tiefe.
Plötzlich waren Almas Gedanken klar wie Glas. Sie kannte die Fragen und ihre Antworten. Sie wusste, was geschah und geschehen würde. Sie wusste auch, dass es zu spät war, etwas dagegen zu tun. An dieser Stelle war es immer zu spät.
Sie sprang.
Nichts hielt sie fest. Sie schwebte nicht, sie fiel und begriff, dass ihr nur einige wenige Sekunden blieben, gerade noch Zeit genug für zwei schnelle Atemzüge.
Alma stürzte nicht auf ein Auto, sondern auf die Straße, direkt vor einen Kleintransporter, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte – das Fahrzeug überrollte sie.
Aber Alma starb nicht. Sie …
… erwachte, schweißgebadet trotz der Klimaanlage in ihrem Schlafzimmer. Die Uhr auf dem Nachtschränkchen zeigte 3:07.
Es geschah immer um diese Zeit, gegen drei Uhr nachts. Ein Albtraum, der sie im tiefen Schlaf heimsuchte, seit ein paar Wochen fast in jeder Nacht: von ihrer Dachterrasse ein Sprung in die Tiefe, in den sicheren Tod. Und immer fühlte sie sich dabei beobachtet, etwas starrte sie an.
Die Anzeige der Uhr wechselte auf 3:10.
Alma Salome blinzelte. Drei Minuten in wenigen Sekunden. Auch das geschah manchmal: Die Zeit verging zu schnell.
Sie stand auf, von plötzlichem Durst geplagt, wankte zur Tür, in den Flur und ins Bad. Dunkelheit empfing sie, aber hier gab es keine verborgenen Augen, die sie beobachteten.
Ihre linke Hand fand das Glas, die rechte den Wasserhahn. Sie trank gierig, wie halb verdurstet, stellte das Glas ab und merkte, dass sich die Hand, die es gehalten hatte, anders anfühlte.
Für einen Moment stand sie still. Dann tastete sie mit der anderen Hand nach dem Lichtschalter.
Jähe Helligkeit blendete Alma. Für einige Sekunden kniff sie die Augen zu.
Mit dem Gesicht im Spiegel stimmte etwas nicht. Sie sah genauer hin und bemerkte Schmutz auf den Wangen und am Kinn.
Langsam hob sie die ebenfalls schmutzigen Hände und drehte sie. Hautabschürfungen zeigten sich an den Handflächen und auch an den Unterarmen.
Der Albtraum, begriff sie, war mehr gewesen als nur ein Traum.
Erster Teil
Das Institut
1
Flynn DarksterOakville bei Toronto, KanadaMittwoch, 3. August
Das goldgelbe Messingschild neben der Tür des Apartmenthauses an der Ontario Street war erst wenige Wochen alt, und auch an diesem Morgen betrachtete Flynn Darkster es voller Zufriedenheit. »SeCon Security Consulting« stand dort geschrieben, und darunter: »Team Darkster«.
Die große Wohnung, inzwischen zum Büro umfunktioniert, war ein echter Glücksfall gewesen. Oakvilles Jachthafen lag nur einen Steinwurf entfernt, und aus den Zimmern im fünften Stock hatte man einen ungehinderten Blick auf den Ontariosee. Noch wichtiger: Das Apartment verfügte über einen 10 Gbits schnellen Internet-Anschluss, womit sich einiges anfangen ließ. Mit Washington, D.C., konnte man Oakville kaum vergleichen, dachte Flynn, als er zum Lift ging. Aber Toronto war nicht weit, nur einige Kilometer, und außerdem lag eine Staatsgrenze zwischen ihm und seiner Vergangenheit.
Im fünften Stock angekommen, hielt er seine ID-Karte vor den Scanner, hörte das Klicken im Schloss und drückte die Tür auf.
Emily erwartete ihn im Flur, ihr feuerrotes Haar wie eine Wolke am Kopf. Flynn blieb stehen und warf einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Es ist noch nicht einmal sieben, und du bist schon da?«, sagte er verwundert. »Warum glaube ich, dass das nichts Gutes bedeutet?«
»Wir müssen reden, Flynn«, sagte Emily. »Bevor die anderen da sind.«
»Redet nur«, erklang eine Stimme. »Ich höre nichts.«
Der alte Rudy saß in seinem kleinen Büro ganz hinten, das zu Anfang ein Abstellraum gewesen war. Er hatte es sich selbst ausgesucht, weil er die nahen Wände mochte; angeblich fühlte er sich von ihnen nicht eingezwängt, sondern umarmt.
Flynn winkte ihm durch die offene Tür zu. »Bist ebenfalls früh dran.«
Rudy saß vor einem großen gewölbten Bildschirm, der fast von einer Wand zur anderen reichte. »Ach, in meinem Alter braucht man nicht mehr viel Schlaf«, behauptete er.
So alt war er eigentlich gar nicht, Ende sechzig, aber von den sechs anderen SeCon-Mitarbeitern trennten ihn ein oder zwei Generationen, weshalb ihn alle »den alten Rudy« nannten. Er hatte, worauf er immer wieder stolz hinwies, schon mit den ersten PCs gearbeitet, beginnend mit dem Apple II in den 70er-Jahren.
»Bei dir«, zischte Emily. »In deinem Büro.«
»Entschuldige uns, Rudy«, sagte Flynn.
»Ich höre nichts, überhaupt nichts«, lautete die Antwort, und dann huschten flinke Finger über mechanische Tasten.
Flynns Büro – neben der Küche gelegen und früher das Esszimmer der Wohnung – war nicht größer als die Arbeitszimmer von Emily, Beatrice, Zergo, Nayla und des Wunderknaben Arvid, aber es verfügte über den mit Abstand besten und leistungsfähigsten Computer. Was man ihm auf den ersten Blick nicht ansah, denn das Board mit dem Threadripper-Prozessor, der 128 Kerne aufwies, den 512 Gigabyte RAM und insgesamt 30 Terabyte NVMe-Speicher steckte in einem alten, zerkratzten Workstation-Gehäuse neben dem Schreibtisch, auf dem drei jeweils 28 Zoll große Monitore standen. Die blinkende Einschalttaste deutete darauf hin, dass der Computer schlief. Ein Tastendruck genügte, um ihn zu wecken, mit allen laufenden Programmen.
Flynn fuhr die Jalousien hoch. Sonnenschein glänzte auf dem Ontariosee hinter dem nahen Jachthafen.
»Also?« Er sank in seinen Sessel, ohne die Tastatur anzurühren.
Emily setzte sich auf die Schreibtischkante. Sie war vier Jahre jünger als er, einunddreißig, und kümmerte sich um die Buchhaltung von SeCon. Manchmal half sie auch bei den Penetrationstests aus, denn von Computern verstand sie nicht weniger als die anderen.
»Weißt du, wie hoch unsere monatlichen Kosten sind?«
»Ziemlich hoch, nicht wahr?« Flynn ahnte, was ihm bevorstand.
»Fast siebzigtausend Dollar.«
»Es sind kanadische Dollar.«
»Es ist trotzdem viel Geld.« Emily verschränkte die Arme und sah auf ihn hinab. »Und rate mal, wie hoch unsere Einnahmen sind.«
Flynn seufzte leise. »Ihr habt euer letztes Gehalt bekommen, nicht wahr?«
»Das ist einer der Gründe, warum wir in Schwierigkeiten sind. Ich rede hier gegen meine eigenen Interessen, aber du zahlst uns zu viel Geld. Unsere Gehälter sind zu hoch.«
»Schlägst du eine Kürzung vor?«
»Es würde nicht viel helfen«, erwiderte Emily ernst. »Ich schlage vor, dass wir die Einnahmen erhöhen, und zwar schnell. Wir verdienen zu wenig!«
»Wir sind nahe dran …«
»Wie nahe?«, hakte Emily sofort nach.
Flynn seufzte erneut. »Sehr nahe. Es könnte jeden Tag so weit sein. Vielleicht meldet sich Ford Oakville heute. Oder die TDL-Group. Ich habe ihnen ein detailliertes Sicherheitskonzept vorgestellt und die bei den durchgeführten Pentests festgestellten Sicherheitslücken beschrieben. Wir könnten schon sehr bald den Auftrag erhalten, die Lücken zu schließen und die Sicherheitssysteme zu aktualisieren.«
»Flynn …« Emily suchte nach geeigneten Worten. »Das würde helfen, die nächsten Monate zu überbrücken, mehr nicht. Die Banken werden uns bald keine weiteren Kredite geben. Wir müssen unser Geschäft ausweiten. Wir brauchen mehr Aufträge, die mehr Geld einbringen, und zwar auf einer dauerhaften, stabilen Basis.«
»Wir sind noch nicht lange hier«, sagte Flynn. »Wir müssen uns erst noch einen guten Ruf erwerben und Kontakte knüpfen.«
Emily rutschte von der Schreibtischkante, ging zum Fenster und sah einige Sekunden lang hinaus. Dann drehte sie sich um und stand mit dem Rücken zum Ontariosee. Ihr rotes Haar leuchtete im Sonnenschein. »Wir könnten der Sache ein wenig nachhelfen.«
Eine Alarmglocke schrillte in Flynns Kopf. »Wie meinst du das?«
»Es gibt zahlreiche wichtige und zahlungskräftige Unternehmen hier in Oakville und erst recht drüben in Toronto«, erklärte Emily. »Was würde geschehen, wenn sie merken, dass ihre IT-Systeme wie ein Schweizer Käse voller Löcher sind? Sie würden nach Beratern suchen, nach Sicherheitsfirmen, die ihnen helfen können.«
»Emily …«
»Denk drüber nach«, sagte sie schnell. »Es wäre nichts Schlimmes. Ich meine, es ginge nicht darum, Konten zu knacken oder irgendwelche Firmengeheimnisse auszuspähen. Es wäre Hacken ohne die Absicht, Profit zu erzielen. Ganz harmlos, eine andere, etwas aggressivere Art von Penetrationstesting.«
Flynn schüttelte langsam den Kopf. »Ich weiß nicht.«
»Niemand käme zu Schaden«, fügte sie hinzu. »Natürlich müsste klar sein, dass es zu einem digitalen Einbruch kam, dass sich jemand in den Intranets umgesehen hat. Sonst hätte die Sache ja keinen Sinn. Wir zeigen den Administratoren und Geschäftsführern, wie angreifbar ihre Systeme und wie wenig geschützt ihre Daten sind. Grund genug für sie, sich an SeCon zu wenden und unsere Dienste in Anspruch zu nehmen.«
»Ich habe nie irgendwelche Konten geknackt«, sagte Flynn.
»Das hat auch niemand behauptet.«
»Ich bin immer ein White Hat gewesen.«
»Es muss nicht gleich Schwarz sein«, meinte Emily. »Wie wär’s mit ein bisschen Grau?«
Flynn holte tief Luft. »Hast du Washington vergessen?«
Emily warf die Hände hoch und ließ sie wieder sinken. »Natürlich nicht. Wie könnte ich das? Deshalb sind wir hier.«
»Ja, deshalb sind wir hergekommen«, bestätigte Flynn. »Um in Kanada neu anzufangen. Hier haben wir eine reine Weste.«
»Die uns aber nicht viel nützt, wenn wir pleite sind!« Einige schnelle Schritte brachten Emily zur Tür. Sie schien das Zimmer ohne ein weiteres Wort verlassen zu wollen, zögerte aber. »Ich weiß, dass es nicht angenehm für dich war.«
»Nicht angenehm?«
»Ich meine, es muss ziemlich hart für dich gewesen sein …«
»Sechs Monate Gefängnis«, sagte Flynn. »Sechs lange Monate.«
»Wenigstens waren es keine sechs Jahre.«
»Ich habe Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt«, betonte Flynn, denn Emily war mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. »Ich möchte unser Glück nicht noch einmal auf die Probe stellen.«
»Aber das tust du gerade. Du vertraust darauf, dass wir Glück haben und einfach so weitere Aufträge bekommen. Und danach sieht es derzeit leider nicht aus.« Mit der Hand an der Klinke zögerte Emily erneut. »Überleg es dir. Lass es dir durch den Kopf gehen. Und noch etwas.«
»Ja?«
»Vergiss Mermaid. Sie lenkt dich zu sehr ab.«
Emily öffnete die Tür und ging.
2
Um elf Uhr abends, als es draußen längst dunkel war, schritt Flynn noch einmal durch die Büroräume von Security Consulting und vergewisserte sich, allein zu sein. Als Letzter war der alte Rudy, der angeblich wenig Schlaf brauchte, vor einer guten Stunde gegangen.
An der Eingangstür blieb Flynn stehen und horchte, hörte jedoch nichts. Er sicherte die Tür mit einem persönlichen Code, horchte erneut und kehrte in sein Arbeitszimmer zurück. Manchmal schlief er hier auf einem Klappbett aus der kleinen Abstellkammer nebenan – er stellte es am offenen Fenster auf und ließ sich von den Geräuschen der Nacht in den Schlaf begleiten. Diesmal blieb das Fenster nicht nur geschlossen, er ließ auch die Jalousien herunter.
Am Schreibtisch lauschte er einige Sekunden lang der Stille und dachte daran, dass ihm die ganze Nacht zur Verfügung stand. Mehr Zeit, als er brauchte. Es war alles vorbereitet, ein oder zwei Stunden sollten genügen.
Ein letztes Mal, dachte er. Ein im wahrsten Sinne des Wortes krönender Abschluss.
Er holte einen kleinen Scanner hervor, bestehend aus Einzelteilen, die im Fachhandel frei erhältlich waren und nicht einmal viel Geld kosteten, ging damit langsam durchs Zimmer, den Blick aufs Display gerichtet, und suchte nach verräterischen Signalen. Natürlich fand er keine. Emily, der alte Rudy und die anderen hatten nicht den geringsten Grund, irgendwo eine winzige Kamera oder ein Mikrofon zu installieren. Und die wenigen Kunden, von denen sie in den vergangenen Tagen Besuch erhalten hatten, waren nie unbeobachtet geblieben.
Flynn dämpfte das Licht, setzte sich, drückte eine Taste und rief den Computer damit aus dem Bereitschaftsschlaf. Worksheets erschienen auf den drei Bildschirmen, ein weiterer Tastendruck ließ sie verschwinden.
Ein leeres Terminalfenster des Linux-Desktops wartete auf Eingabe.
Tasten klickten unter Flynns flinken Fingern. Er spürte vertraute, angenehme Aufregung, als er einen seiner virtuellen Computer startete, ein Kali-Linux-System für Penetrationstests und digitale Forensik, ausgestattet mit zahlreichen Hacker-Programmen aus seiner eigenen Sammlung. Aus dieser virtuellen Umgebung heraus stellte er eine VPN-Verbindung her, von Oakville, Kanada, nach Kapstadt, Südafrika. Von dort ging es weiter zu einem Cray XC50 an der IT-Forschungsabteilung der König-Saud-Universität von Riad, einem betagten Supercomputer von 2016, der aber immer noch gute Dienste leistete.
Dabei handelte es sich um eins von mehr als zwanzig »Sprungbrettern«, die Flynn nutzte. Die in ihren Programmbibliotheken eingebetteten und gut versteckten »Nester« boten ihm die Möglichkeit, auf mehr Computerressourcen zuzugreifen, als ihm selbst zur Verfügung standen. Und ein sehr wichtiger Punkt: Sie boten Schutz, sollten sich irgendwo unterwegs Probleme ergeben, die einen Rückzug erforderten – sie würden die Verbindung automatisch kappen, sobald Entdeckung drohte.
Vergiss Mermaid, hatte Emily gesagt und meinte M3RM41D. Natürlich wusste sie von ihr. Vor einem Jahr, zu Beginn der Challenge, hatte sie einige Male seine kurzen Online-Kontakte mit ihr verfolgt.
Die Challenge. Während der sechs Monate im Gefängnis hatte Flynn oft an sie gedacht und sich fest vorgenommen, nicht mehr daran zu denken. Aber er hatte jahrelang daran gearbeitet, es steckte zu tief in ihm drin.
Ein letztes Mal, sagte er sich erneut. Ein letzter großer Erfolg. Und dann Schluss. Hacken ohne Streben nach Profit, das waren Emilys Worte gewesen. Ohne Daten zu kompromittieren. Nur um ein Zeichen zu setzen.
Wer war der beste Hacker? Darum ging es. Wer bekam die virtuelle Krone des Cyberkings oder der Cyberqueen?
Flynn schrieb auf der Tastatur und gab Anweisungen ein, woraufhin ihn das saudische Sprungbrett in den Libanon brachte, ins wiederauferstehende Beirut. Dort hielt er sich – inzwischen zu »Riddle« geworden beziehungsweise zu R1DDL3 – nur wenige Sekunden auf, bevor er die Reise nach Ankara fortsetzte, dort kurz in einem Server der Fernsehgesellschaft TRT Türk verweilte und sich dann nach Stuttgart in Deutschland weiterleiten ließ, ins Höchstleistungsrechenzentrum HLRS.
Vor einer Handvoll Jahren hatte es tatsächlich einmal Höchstleistungen vollbracht, aber die Entwicklung ging so schnell voran, dass es im Ranking der besten Supercomputer Europas auf einen der hinteren Plätze zurückgefallen war. Man arbeitete dort noch immer an Lösungen für die akademische und industrielle Spitzenforschung, und die Datenbanken, zu denen sich Flynn als Riddle Zugang verschaffen konnte, enthielten wichtige wissenschaftliche Informationen, für die Konkurrenten und Rivalen in anderen Ländern viel Geld gezahlt hätten.
Doch auch das HLRS war nur eine Zwischenstation, die letzte vor dem eigentlichen Ziel, das sich in der Nähe von – ausgerechnet! – Washington befand, in Arlington.
Das Pentagon, Sitz des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wer fand ein Loch in seinen Brandmauern, in den Firewalls? Wem gelang es, durch die schmalen Lücken zwischen den Aufpassern und Spähern zu schlüpfen, die das Allerheiligste schützten, den Zentralrechner?
Vermutlich gab es auf der ganzen Welt kein sorgfältiger geschütztes Computersystem. Nur der oder die Beste konnte sich dort Zugang verschaffen und verdiente die Cyberkrone.
Hackerruhm, dachte Flynn in seinem stillen Arbeitszimmer, in dem nur das Lüfter-Rauschen der Workstation und das Klicken der Tasten zu hören waren. Eigentlich dumm und töricht, das wusste er, das begriffen Kopf und Verstand. Aber Herz und Stolz verweigerten sich hartnäckig dieser Erkenntnis.
Einmal ganz oben stehen, wünschten sie sich. Einmal die Krone tragen und die größte Anerkennung genießen.
Und dann … Schluss. Aus und vorbei. Nie wieder. Das hatte sich Flynn geschworen.
Mit den konkreten Vorbereitungen hatte er vor einigen Wochen begonnen, kurz nach dem Umzug von SeCon in die Ontario Street von Oakville, und die letzten Abende hatte er genutzt, um sich abzusichern und nach Fallen zu suchen. Die winzigen Türen, von den automatisierten Miniprogrammen seiner reisenden Scripte geschaffen, existierten nach wie vor und warteten auf die digitalen Schlüssel, die Flynn mit einigen Tasten in den Einsatz schickte: von Oakville nach Kapstadt, Riad, Beirut, Ankara, Stuttgart und schließlich Arlington. Jede Etappe hatte eine andere verschleierte IP-Adresse. Eine Rückverfolgung war zwar möglich, aber sehr, sehr aufwendig und würde schließlich in Südafrika enden, beim VPN-Server, mit dem ein gewisses Kali-System in Oakville verbunden war.
Natürlich wuchsen die Latenzen mit jeder Zwischenstation – die Verzögerungen bei der Befehlsübermittlung und den Antworten summierten sich auf bis zu zehn Sekunden. Das war der Preis für Sicherheit.
Die Statusmeldungen im Terminalfenster auf dem mittleren Bildschirm zeigten an, dass sich im Zielrechner eine kleine Tür nach der anderen öffnete, ohne dass die automatischen Überwachungssysteme Alarm auslösten. Es kam darauf an, nichts anzurühren, die lokalen Dateien und ihre Zeitstempel unverändert zu lassen und so wenig Daten-Traffic wie möglich zu verursachen.
Der rechte Monitor präsentierte in nahezu Echtzeit die Protokolldateien des VPN-Servers in Kapstadt. Buchstaben- und Zahlenkolonnen scrollten unablässig, gerade noch langsam genug, um vom menschlichen Auge erfasst zu werden. Auf dem linken Schirm war oben die Anzeige eines Tracers zu sehen, die Auskunft gab über das aktuelle Detection Level: War jemand auf ihn aufmerksam geworden, und falls ja, welche Fortschritte wurden bei der Rückverfolgung erzielt? Der Tracer zeigte eine beruhigend grüne 9. Alles bestens. Niemand hatte Verdacht geschöpft, niemand ahnte etwas.
Das Fenster unter der 9 gab in einer Liste an, wie es um die Challenge stand. Ganz oben stand der Name M3RM41D, Mermaid – sie war allen anderen weit voraus. Der Name R1DDL3 fehlte bisher.
Mermaid, dachte Flynn und fragte sich erneut, wer hinter diesem Namen steckte. Vor der Sache in Washington war sie seine größte Rivalin gewesen, und diesmal hatte sie mehr Erfolge vorzuweisen als er, nicht zuletzt wegen seiner sechs Monate langen Zwangspause.
Ein leises Piepen störte die Stille. Ein Warnsignal. Es wies darauf hin, dass ein Überwachungsprogramm im Pentagon aktiv geworden war.
Flynn überprüfte seine Scripte und die letzten manuellen Eingaben, konnte keinen Fehler entdecken und vermutete, dass jemand anders, bereits hinter den Firewalls wie er selbst, einen digitalen Wachhund geweckt hatte. Mermaid?, überlegte er. Vielleicht. Oder jemand, der es ebenfalls auf die Cyberkrone abgesehen hatte. Viel Zeit blieb nicht mehr, in wenigen Tagen ging die Challenge zu Ende.
Aus der grünen 9 oben auf dem linken Monitor wurde eine ebenfalls grüne 8. Noch gab es nichts zu befürchten.
Ein weiteres Mal überprüfte Flynn seine Sicherheitsmaßnahmen und vergewisserte sich, dass er nichts übersehen hatte.
Er behielt die Statusmeldungen im Terminalfenster des mittleren Monitors im Auge. Noch eine letzte kleine Tür trennte ihn vom Ziel, mit einem besonders komplizierten Schloss versehen. An dem Schlüssel dafür hatte er lange genug gefeilt. Gleich würde sich herausstellen, ob er passte.
Flynns Finger vollführten einen langsamen, vorsichtigen Tanz auf der Tastatur. Nichts überstürzen, sagte er sich. Gerade jetzt nicht. Ruhe bewahren. Aufpassen. Wachsam bleiben.
Aus der grünen 8 wurde eine hellgrüne 7.
Der Schlüssel – ein spezielles Script, für die letzte Barriere geschrieben, eine mehrstufige Authentifizierung, die die Eingabe von Passworten und Codeschlüsseln erforderte – passte. Die Tür öffnete sich mit der Meldung, von einer autorisierten Person aufgeschlossen worden zu sein.
Flynn sah auf die Uhr. Mitternacht. Was es möglicherweise ein wenig leichter machte. Natürlich wurde im Pentagon rund um die Uhr gearbeitet, aber um diese Zeit lag die Aufmerksamkeit der Techniker und Systemverwalter vielleicht nicht mehr bei hundert Prozent, sondern nur noch bei fünfundneunzig.
Zwei oder drei Sekunden lang spielte Flynn mit dem verlockenden Gedanken, sich hinter der letzten Tür ein wenig umzusehen und aus reiner Neugier einen Blick in den nun offenen Datenkosmos des Pentagons zu werfen. Doch das wäre riskant gewesen, denn je länger er an diesem Ort verweilte, desto größer wurde die Gefahr einer Entdeckung.
Auf dem linken Monitor wich die hellgrüne 7 einer gelben 6.
Die Enter-Taste sandte das letzte Script. Es hatte die vergleichsweise einfache Aufgabe, den ersten vierzig Textdateien, die es in den frei zugänglichen Pentagon-Servern fand, einige wenige Worte hinzuzufügen. Sie lauteten: »Ich war hier – R1DDL3.«
Wieder piepte es, nicht nur einmal, sondern mehrmals schnell hintereinander. Der Tracer setzte den gefährlichen Countdown beim Detection Level fort – aus der gelben 6 wurde eine 5, die sich gleich darauf in eine orangefarbene 4 verwandelte.
Flynns Finger flogen über die Tasten.
Es piepte lauter und beharrlicher. Die Detection-Zahl auf dem linken Bildschirm blinkte in einem warnenden Rot: erst 3, dann 2, 1 und unmittelbar darauf die 0.
Auf dem mittleren Schirm öffnete sich ein Fenster und verdeckte das Terminal. Ein Schriftzug erschien:
Wir haben dich.
Flynn griff nach dem Netzwerkschalter und unterbrach die Stromzufuhr, ohne die Workstation zuvor herunterzufahren. Dann lehnte er sich langsam zurück und sagte leise: »Verdammter. Dreimal. Verfluchter. Mist.«
3
Alma SalomeMadrid, SpanienDonnerstag, 4. August
»Meine Güte, Sie sehen schrecklich aus!«
»Danke für das Kompliment«, sagte Alma. Sie stand vor dem breiten Mahagonischreibtisch von Fabian Kowalski, Architekt aus Warschau und Geschäftsführer des Architekturbüros Form Factor. Ein dicker cremefarbener Teppich bedeckte den Boden, und Ölgemälde hingen an den Wänden. Das breite Fenster hinter Kowalski bot Blick auf die Puerta de Toledo, ein aus dem neunzehnten Jahrhundert stammendes Stadttor in Form eines Triumphbogens.
»Im Ernst, Alma.« Der schlanke, hochgewachsene CEO von Form Factor deutete auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. Alma setzte sich. »Was ist passiert?«
Sie hob die Hand zum Gesicht. Trotz des Make-ups sah man noch immer zu viel von den Kratzern.
»Ich bin gestürzt«, sagte sie.
»Gestürzt«, wiederholte Kowalski. Er war gut zwanzig Jahre älter als Alma, Mitte fünfzig, hatte graublaue Augen, schütteres Haar und einen sehr wachen Verstand. In den vergangenen Monaten schien er ihr gegenüber in eine Art Vaterrolle geschlüpft zu sein, doch Alma vermutete gelegentlich, dass seine Gefühle noch tiefer gingen. »Hat da jemand nachgeholfen?«
»Nein«, antwortete Alma sofort. »Niemand.« Bis auf eine Stimme in der Nacht, dachte sie.
»Wenn Sie Hilfe brauchen …«, sagte Kowalski langsam. »Sie finden bei mir immer ein offenes Ohr.«
Alma rang sich ein Lächeln ab. Nach dem Albtraum in der vergangenen Nacht hatte sie nicht mehr geschlafen. Die Herkunft der Verletzungen blieb ein Rätsel, das sie noch mehr beschäftigte als der seltsame Traum.
»Es ist alles in Ordnung«, behauptete sie.
»Sind Sie ganz sicher?«, fragte Kowalski besorgt.
Alma nickte.
Er musterte sie noch etwas länger. »Weshalb ich Sie zu mir gebeten habe …«
»Ja?«
Der Chefarchitekt schob eine Projektmappe über den Schreibtisch. »Ihre Entwürfe für die neue Mehrzweckhalle. Ich habe sie mir angesehen.«
Alma nahm die Mappe entgegen, schlug sie auf und begann zu blättern. Kowalski hatte zahlreiche Anmerkungen in den Zeichnungen hinterlassen, die meisten in kritischem Rot, nur einige wenige in anerkennendem Grün.
Es ging um den Ersatz für die von Julio Cano Lasso entworfene Madrid-Arena, gar nicht weit vom Park Casa de Campo und ihrem Apartmenthaus entfernt. Eine neue Halle mit fast doppelt so vielen Sitzplätzen und so aufgebaut, dass sich eine Katastrophe wie die Massenpanik von 2012 nicht wiederholen konnte.
Damals waren bei einer Halloween-Party mit dem bekannten DJ Steve Aoki zu viele Eintrittskarten verkauft worden, mit dem Ergebnis, dass sich zum Zeitpunkt des Unglücks doppelt so viele Menschen als die erlaubten zehntausendsechshundert in dem Gebäude aufgehalten hatten. Fünf Personen waren bei der Massenpanik ums Leben gekommen.
»Modern und sicher«, sagte Kowalski. »Ein würdiger Nachfolger der alten Madrid-Arena. Ich muss nicht extra betonen, dass es um viel Geld geht, das wissen Sie.«
Alma nickte erneut.
»Ihre Entwürfe sind«, Kowalski gestikulierte vage, »extravagant, gelinde gesagt.«
»Sie gefallen Ihnen nicht«, stellte Alma fest.
»Sie sind in dieser Form nicht realisierbar.« Kowalski faltete die Hände auf dem Schreibtisch und wirkte tatsächlich wie ein Vater. »Eine Ansammlung von Kurven und Kanten, Rampen und Treppen, Säulen, Wandelgängen und Sälen. Die Berechnungen stimmen, man könnte ein solches Gebäude errichten, es wäre tatsächlich stabil. Aber es würde mindestens das Doppelte von dem kosten, was uns vom Stadtrat bewilligt wurde, wenn nicht das Dreifache.«
Alma betrachtete die Zeichnungen und fühlte sich an etwas erinnert, das sie in den tiefen Schatten der Nacht gesehen hatte.
»Zudem sieht es viel zu futuristisch aus, wie aus einem Science-Fiction-Film«, fügte der Chefarchitekt hinzu. »Ein klassischeres Design würde mehr Freunde und Förderer finden. Alma …«
Sie sah von der Mappe auf.
»Vielleicht sollten Sie mal ausruhen, ein paar Tage freinehmen«, schlug Kowalski vor.
»Nein, es geht schon. Ich überarbeite die Entwürfe, ich fange sofort damit an.« Alma schloss die Projektmappe und wollte aufstehen.
»Einen Moment noch. Ich weiß, dass Sie eine schwere Zeit hinter sich haben. Sie kommen aus Mekele im Norden von Äthiopien. Der Krieg … Es muss schlimm für Sie gewesen sein.«
»Es ist noch viel schlimmer für all jene, die das Land nicht verlassen konnten.«
»Es fällt schwer, mit so etwas fertigzuwerden«, sagte Kowalski. »Vielleicht sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.«
Das tue ich bereits, dachte Alma.
»Ihrem Lebenslauf habe ich entnommen, dass Sie einmal Läuferin werden wollten. Ich meine, Profi. Warum ist nichts daraus geworden?«
»Weil ich nicht das Talent einer Genzebe Dibaba, Almaz Ayana oder Tigist Assefa habe«, antwortete Alma und fragte sich, warum Kowalski sie ausgerechnet darauf ansprach.
»Laufen Sie heute noch?«
»Gelegentlich.«
»Es hilft«, sagte Kowalski. »Es macht den Kopf frei. Das weiß ich, weil ich selbst laufe, fast jeden Tag. Wir könnten gemeinsam laufen, bei Ihnen in Casa de Campo. Dann hätten Sie jemanden, mit dem Sie reden können, wenn Sie möchten.«
Alma nahm die Mappe und stand auf. »Danke für das Angebot, darauf komme ich gern zurück.« Sie hob die Mappe. »Ich mache mich sofort an die Arbeit.«
Als sie die Tür erreichte, sagte Fabian Kowalski hinter ihr: »Wenn es Probleme gibt, von welcher Art auch immer … Kommen Sie zu mir. Jederzeit.«
»Danke«, erwiderte Alma müde und halbherzig und verließ das Büro.
4
»Sie sehen schrecklich aus«, sagte Dr. Jacobo Fernandez, Psychologe und Therapeut.
»Das habe ich heute mehrmals zu hören bekommen.« Alma sank in den bequemen Sessel des Therapiezimmers. »Kowalski hat mich als Erster darauf hingewiesen. Heute Morgen. Er wollte wissen, was passiert ist.«
Dr. Fernandez saß an einem kleinen, runden, mit Intarsien verzierten Tisch: etwa sechzig, der Kopf kahl, das schmale Gesicht noch erstaunlich glatt, die Augen nussbraun, weißer Bartflaum auf Wangen und Kinn. Wie er sprach und sich bewegte, hatte etwas Aristokratisches, fand Alma. Etwas, das beruhigte und Vertrauen weckte.
»Möchten Sie es mir erzählen?« Vor Fernandez stand ein Laptop auf dem kleinen Tisch. Seine Fingerkuppen ruhten auf den Tasten.
Es war still im Zimmer. Wenn niemand sprach, hörte man … nichts. Die Geräusche von Stadt und Menschen blieben ausgesperrt.
Alma schloss die Augen und spürte, wie ein Teil der Anspannung von ihr abfiel. »Manchmal habe ich das Gefühl, hier wie auf einer einsamen Insel zu sein. Mitten im Ozean. Es fehlt nur das Rauschen des Meers.«
Plötzlich war es da, das Rauschen, leise und unaufdringlich. Alma öffnete die Augen. Der große Bildschirm vor ihr an der Wand zeigte einen tropischen Ozean, blaugrün unter einem wolkenlosen Himmel. Wellen rollten endlos.
»Er möchte mit mir laufen«, sagte Alma, anstatt die Frage zu beantworten. Sie war noch nicht so weit. »Kowalski. Mein Chef bei Form Factor.«
»Und Sie, Alma? Möchten Sie mit ihm laufen?«
»Ich weiß nicht. Er ist wie ein Vater. Ich meine, er hilft, wo er kann, er ist immer freundlich und verständnisvoll, aber manchmal …«
Dr. Fernandez wartete geduldig, die Hände am Laptop.
»Meine Entwürfe haben ihm nicht gefallen«, sagte Alma. »Die der neuen Madrid-Arena.«
»Hat Sie das sehr enttäuscht?«, fragte der Psychologe, als Alma nicht weitersprach.
»Ich weiß nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Seltsam, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es mich enttäuscht hat. Vielleicht bin ich eher von mir selbst enttäuscht.«
»Warum?«
»Weil ich mehr kann. Viel mehr. Ich habe mich … ablenken lassen.«
Dr. Fernandez schrieb so leise auf der Laptop-Tastatur, dass Alma nicht ein einziges Klicken hörte. »Wovon haben Sie sich ablenken lassen?«
»Das wissen Sie, Doktor.«
»Haben die Kratzer in Ihrem Gesicht und an den Armen damit zu tun?«
Wieder ging Alma nicht direkt auf die Frage ein. »Ich habe etwas gesehen, in der Nacht. Offenbar wollte ich es in den Entwürfen wiedergeben. Mein Unterbewusstsein hat mir einen Streich gespielt.«
»Der menschliche Geist ist voller Fallstricke«, dozierte Dr. Fernandez in einem gutmütigen Ton.
»Eine Art Gebäude«, erinnerte sich Alma. »In den tiefsten Schatten der Nacht.«
»Während eines Albtraums?«
Das Wort brachte jähen, stechenden Schmerz. »Ja.«
Die Finger bewegten sich auf der Tastatur. »Sie haben ein Gebäude gesehen und es für Ihre Entwürfe verwendet?«
»Ja. So muss es gewesen sein.«
»Eine Art … Inspiration?«
»Er nannte die Entwürfe zu futuristisch, wie aus einem Science-Fiction-Film.«
»Kowalski von Form Factor?«
»Ja.«
»Als Sie das Gebäude in der Dunkelheit sahen, während eines Albtraums – was haben Sie dabei gedacht und empfunden?«
Alma sah es mit den inneren Augen: ein Bauwerk aus Kanten und Kurven, wie Kowalski es beschrieben hatte, eine riesige Ansammlung von Glas und Kristall, schön und gleichzeitig abstoßend, wie das Versprechen von Antworten, die man fürchtete.
»Welche Antworten?«, fragte Dr. Fernandez sanft, und Alma begriff, dass sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hatte. »Wie lauten die Fragen?«
»Ich weiß es nicht!«, platzte es laut aus ihr heraus.
Ein Schatten schien sich im Zimmer auszubreiten und Farben und Töne zu dämpfen. Der Ozean auf dem großen Bildschirm wurde grau, sein Rauschen zu einem Flüstern in der Ferne.
»Was ist das?«
»Was ist was?«, erwiderte der Psychologe ruhig.
Alma fühlte, wie etwas mit ihren Händen geschah. Die Finger wurden durchsichtig, sie schienen sich in Glas zu verwandeln.
»Sehen Sie das?«, entfuhr es ihr erschrocken. Sie hob die Hände. »Sehen Sie!«
»Was soll ich sehen, Alma?«, fragte Dr. Fernandez ruhig.
Der Schatten, der sich im Therapiezimmer ausgebreitet hatte, löste sich auf. Das vom großen Wandschirm präsentierte Meer wurde wieder blaugrün, sein Rauschen etwas lauter.
Alma schnappte nach Luft.
Fernandez beugte sich etwas näher. »Was ist geschehen, Alma? Beschreiben Sie es mir.«
»Ich hatte gerade eine …« Vision?, dachte sie. Nein, das Wort klang zu stark. »Eine Art Wachtraum. Das Zimmer wurde dunkler, meine Finger verwandelten sich in Glas …«
»Glas«, wiederholte der Psychologe und schrieb. »Wie das Gebäude, das Sie in der Dunkelheit gesehen haben?«
Was ist los mit mir?, dachte Alma. Was geschieht mit mir? Die Anspannung war wieder da, ihr Herz schlug schneller.
Sie rieb sich die Hände, wie um sich zu vergewissern, dass sie Substanz und Leben hatten. »Ja, könnte sein.«
»Der Albtraum in der vergangenen Nacht, möchten Sie mir davon erzählen?«
Alma Salome schloss die Augen – und öffnete sie sofort wieder, als Bilder in ihr aufstiegen.
»Es war mitten in der Nacht, ich stand auf der Brüstung«, brachte sie hervor, die Stimme plötzlich rau. »Ich wollte nicht springen, aber …«
Sie öffnete die Augen noch etwas weiter und fürchtete sich davor, die Lider zu senken, den Erinnerungsbildern dadurch mehr Deutlichkeit zu geben.
»Aber Sie sind gesprungen.«
»Ja! Ich konnte nicht anders!«
»Haben Sie ihn wiedergesehen, den jungen Mann?«
Alma erinnerte sich an die Gestalt in der offenen Terrassentür. »Ja.«
»Hat er diesmal etwas gesagt?«
Sie sah ihn erneut, vor dem inneren Auge, eine schattenhafte Gestalt, die verschwand, wenn sie blinzelte. »Nein.«
»Hat er irgendwie in das Geschehen eingegriffen?«, fragte Dr. Fernandez.
»Nein. Nein, er war … einfach nur da, für ein paar Sekunden.«
Die Finger des Psychologen wanderten leise über die Tasten des Laptops. »Was ist mit der Stimme? Haben Sie sie wieder gehört?«
»Ja. Sie war noch eindringlicher als zuvor und versprach mir Wahrheit in der Tiefe.«
»Wahrheit«, wiederholte Dr. Fernandez und schrieb.
»Die Stimme wies mich sogar darauf hin, von wem die Worte stammten. Von dem griechischen Philosophen Demokrit.«
»Wie klang die Stimme?«, fragte Fernandez. »Stammte sie von einem Mann oder einer Frau?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Alma und versuchte, sich zu beruhigen. »Es war die Stimme der Nacht. Sie hat mich nicht über die Ohren erreicht, sondern erklang direkt im Kopf.« Sie holte tief Luft. »Und diesmal war der Traum anders.«
»Wie anders?«, fragte Dr. Fernandez nach einer kurzen Pause.
»Ich bin gesprungen, von der Brüstung meiner Dachterrasse, aus dem fünfzehnten Stock. Ich weiß noch, dass ich befürchtet habe, auf ein Auto zu stürzen und jemanden zu verletzen. Aber nein, ich bin auf die Straße geprallt, direkt vor einen Kleintransporter, der mich überrollt hat. Niemand kann so etwas überleben.«
»Es war nur ein Traum.«
»Nein«, widersprach Alma. »Diesmal muss es mehr gewesen sein. Ich bin im Bett aufgewacht und ins Bad gegangen, weil ich Durst hatte. Und als ich dort in den Spiegel sah …« Sie unterbrach sich.
»Ich verstehe«, sagte Dr. Fernandez.
»Gesicht und Arme waren voller Kratzer und Hautabschürfungen!«
»Und Sie glauben, dass die Verletzungen von dem Sturz stammen.«
»Woher sonst?«
»Sie könnten sich selbst verletzt haben«, vermutete Dr. Fernandez. »Wenn Sie in Ihrem Albtraum auf die Brüstung der Dachterrasse steigen, das Empfinden kurz vor dem Sprung … Sie folgen einem Ruf, nicht wahr? Sie unterliegen einem seltsamen Zwang.«
Alma nickte langsam. »So fühlt es sich an.«
»Die Erklärung könnte Dissoziation und Depersonalisation lauten«, fuhr der Psychologe fort. »Selbstverletzendes Verhalten wird manchmal als Versuch eingesetzt, derartige Erlebnisse zu beenden. Zumindest kurzfristig kann die Verletzung des eigenen Körpers zu einem Nachlassen des negativen Gefühlszustands führen.«
»Das ist Borderline, nicht wahr?«, fragte Alma voller Unbehagen.
»Nicht unbedingt. In Ihrem Fall würde ich das eher ausschließen. Es könnte der Wunsch dahinterstecken, sich selbst zu bestrafen. Vielleicht fühlen Sie sich tief in Ihrem Innern schuldig, weil Sie Freunde und Familie in Äthiopien zurückgelassen haben.«
Alma gewann immer mehr den Eindruck, dass sie einen falschen Weg einschlugen. »Ich stand auf der Brüstung, und die Stimme der Nacht war deutlicher als jemals zuvor. Ich bin gesprungen, weil ich nicht anders konnte. Es muss ein Traum gewesen sein, denn niemand kann einen Sturz aus dem fünfzehnten Stock überleben. Von dem Transporter, der mich überfahren hat, ganz zu schweigen. Dann wache ich in meinem Bett auf, mit Kratzern und Hautabschürfungen im Gesicht und an den Armen. Und mit Schmutz. Ich könnte mir Gesicht und Arme zerkratzt haben, zugegeben, aber woher kam all der Schmutz?«
Dr. Fernandez schwieg und schrieb. Alma betrachtete das Meer auf dem großen Wandschirm und wünschte sich Frieden.
»Ich habe Angst«, sagte sie, als das Schweigen zu lange dauerte. »Es eskaliert, es wird schlimmer. Ich fürchte die nächste Nacht. Können Sie mir etwas geben, das mich schlafen lässt, tief und traumlos?«
»Als Sie in der vergangenen Nacht gesprungen sind, Alma, in Ihrem Traum … Haben Sie da das Gebäude gesehen, das Sie bei den Entwürfen beeinflusst hat?«
Sie überlegte. »Nein.« Und nach einer kurzen Pause: »Hat das etwas zu bedeuten?«
»Das werden wir gemeinsam herausfinden.« Dr. Fernandez schrieb erneut. »Ihr Handy empfängt gleich ein digitales Rezept. Ich verschreibe Ihnen Dormatan. Das ist ein ziemlich starkes Schlafmittel, Sie sollten sehr vorsichtig damit umgehen.«
»Ich möchte einfach nur schlafen«, erwiderte Alma. »Ohne den Albtraum.«
»Eine einzige Tablette, mehr nicht«, mahnte der Psychologe. »Sie werden schlafen, ohne zu träumen. Berichten Sie mir morgen davon.«
Alma stand auf und fühlte ihr Handy vibrieren. Es hatte das Rezept empfangen. »Danke.«
Dr. Fernandez begleitete sie zur Tür. »Wir machen gute Fortschritte, Alma. Bestimmt können wir Ihr Problem bald lösen.«
Jacobo Fernandez stand am Fenster seines Büros und beobachtete, wie Alma Salome das Gebäude verließ und über den Bürgersteig ging, vorbei an einem Verkaufsstand, der Wassermelonen anbot. Er blickte ihr nach, bis sie hinter der nächsten Straßenecke verschwand, kehrte dann zu seinem Schreibtisch zurück und scrollte durch die Notizen, die er während der Sitzung auf dem Laptop angefertigt hatte.
Eine ganze Minute lang saß er still und stumm. Dann griff er nach dem Telefon und wählte eine bestimmte Nummer.
5
Ein Sonnenstrahl weckte Alma am nächsten Morgen – sie hatte vergessen, die Jalousien herunterzulassen.
Die Uhr auf dem Nachtschränkchen zeigte 6:45. Daneben lag die Schachtel Dormatan, in deren Blister eine Tablette fehlte.
Viertel vor sieben, nicht drei Uhr nachts. Und sie erinnerte sich an keinen Traum. Hände und Unterarme waren ohne neue Kratzer und ohne Schmutz.
Erleichtert stand sie auf. Ein Blick in den Badezimmerspiegel bestätigte ihr, dass sich auch das Gesicht nicht verändert hatte. Es zeigten sich noch immer Kratzer darin, aber sie stammten aus der vorletzten Nacht mit dem Albtraum.
Um halb acht, nach einem schnellen Frühstück und mit etwas mehr Make-up als sonst, verließ sie ihr Penthouse beim Park Casa de Campo, in dem zahlreiche Läufer den noch kühlen frühen Morgen nutzten. Im Wartebereich an der Straße stand kein selbstfahrendes Auto bereit. Alma holte ihr Handy hervor, um eins zu bestellen.
Eine elegant gekleidete Frau trat ihr entgegen. »Bitte entschuldigen Sie, Señora Salome …«
Sie sah vom Handy auf. »Ja?«
»Ich wollte gerade zu Ihnen. Mein Name ist Victoria Tajeda, ich bin Mitarbeiterin der Praxis von Dr. Jacobo Fernandez.«
»Oh, ich verstehe.«
»Dr. Fernandez hat mich gebeten, Sie abzuholen und zu ihm zu bringen«, sagte die dunkelhaarige Frau, die etwa vierzig sein musste. Ihr Lächeln zeigte strahlend weiße Zähne. »Es sei sehr wichtig, hat er betont.«
Alma steckte ihr Handy ein und sah auf die Uhr. »Ich wollte heute früher ins Büro als sonst.«
»Bestimmt dauert es nicht lange«, sagte Victoria Tajeda. »Zwanzig Minuten, höchstens. Dr. Fernandez möchte mit Ihnen reden. Es geht um Ihre Therapie. Er hat etwas entdeckt, das sehr nützlich sein könnte. Mein Wagen steht dort drüben, kommen Sie.«
Alma folgte ihr zu einer blauen Limousine mit abgedunkelten Seitenfenstern. Als sie den Wagen fast erreicht hatten, öffnete sich die Fondtür, und ein junger Mann in einem Anzug fast so grau wie der Wagen stieg aus. Er hielt die Tür offen.
Alma blieb stehen. Ihr Instinkt warnte sie.
Die dunkelhaarige Frau stand plötzlich vor ihr, nicht einmal einen halben Meter entfernt.
»Nur zwanzig Minuten«, wiederholte sie. »Keine Sorge, Sie werden pünktlich im Büro sein.«
»Ich glaube nicht, dass Dr. Fernandez Sie geschickt hat«, erwiderte Alma mit plötzlichem Misstrauen. Sie machte Anstalten, ihr Handy hervorzuholen. »Ich rufe ihn an.«
»Tut mir leid, dafür haben wir keine Zeit.« Victoria Tajeda – wenn die Frau wirklich so hieß – streckte die Hand aus und berührte Alma am Hals. »Wir haben es eilig und können leider keine Rücksicht nehmen, wir brauchen Sie.«
Alma spürte, wie die Kraft aus ihr wich. Plötzlich konnte sie kaum mehr sehen, in den Ohren knisterte es laut, und ihr wurden die Knie weich. Sie merkte noch, wie der junge Mann im grauen Anzug sie stützte und in den Fond der Limousine bugsierte, dann schwanden ihr die Sinne.
6
Flynn DarksterOakville bei Toronto, KanadaDonnerstag, 4. August
»Meine Güte, du siehst schrecklich aus!«, entfuhr es Emily.
Flynn schnitt eine Grimasse. »Danke.«
Sie sah sich in seinem Arbeitszimmer um. Vielleicht suchte ihr Blick nach dem Klappbett. »Hast du die ganze Nacht hier verbracht?«
»Ich habe nachgedacht.« Er stand auf und ging zum Fenster. Ein bedeckter Himmel gab dem Ontariosee die Farbe von Blei. Die Wellen hatten kleine Schaumkämme. »Es könnte ungemütlich werden.«
Emily stand noch immer in der offenen Tür, ihr feuerrotes Haar in einem Zopf gebändigt. »Ich hoffe, du meinst das Wetter.«
Flynn sah noch immer nach draußen. »Sind die anderen schon da?«
»Es ist halb neun«, erklärte Emily. »Natürlich sind alle da. Der alte Rudy ist schon seit sechs hier. Er hat dich gehört. Offenbar hast du Selbstgespräche geführt.«
Flynn blickte zur Straße hinab, ohne genau zu wissen, wonach er Ausschau hielt. Alles wirkte normal, ihm fiel nichts Außergewöhnliches auf. »Worüber habe ich gesprochen?«
»Wenn du das selbst nicht weißt …«
Ihm fiel etwas ein. »Ich habe die Tür gesichert. Mit einem persönlichen Code.« Er drehte sich um. »Wie konnte Rudy herein?«
»Was für ein Code?«, fragte Emily erstaunt.
Flynn schob sich an ihr vorbei und trat wenige Sekunden später ins kleine Zimmer des alten Rudy. Er saß an seinem gewölbten Monitor, der fast von einer Wand zur anderen reichte.
»Wie bist du hereingekommen?«, fragte Flynn.
»Wünsche ebenfalls einen guten Morgen.« Rudy lächelte. »Wie ich hereingekommen bin? Durch die Tür.«
»Ich habe sie gestern Abend mit einem speziellen Code gesichert!«
Der alte Rudy schüttelte den Kopf. »Von einem speziellen Code weiß ich nichts. Ich habe wie immer meinen Schlüssel benutzt.«
Flynn kehrte in den Flur zurück. Emily sah ihn fragend an.
»Alle mal herhören!«, rief er. Gesichter erschienen in den Türen: der blasse Zergo mit dem struppigen Haar; die gertenschlanke, graziöse Koreanerin namens Nayla, Spezialistin für Online-Marketing; das Wunderkind Arvid, gerade einmal vierzehn Jahre alt, die Augen silbern von den AR-Linsen, die er oft trug; und seine sechs Jahre ältere Schwester Beatrice, das glatte schulterlange Haar blau gefärbt. »Habt ihr heute Morgen irgendetwas an der Tür bemerkt?«
Alle schüttelten den Kopf wie zuvor der alte Rudy.
»Hätten wir etwas bemerken sollen?«, erklang Zergos tiefe Stimme.
»Ist euch auf dem Weg hierher oder beim Hereinkommen irgendetwas aufgefallen?«
»Flynn«, sagte Emily laut und deutlich, die Hände in die Hüften gestützt, »gibt es da etwas, das du uns sagen solltest?«
Alle warteten.
Es klingelte an der Tür.
Flynn sah Emily an. »Erwarten wir jemanden?«
»Dein Terminkalender ist leer«, lautete die Antwort.
Flynn kehrte hastig in sein Büro zurück. Der linke Monitor auf seinem Schreibtisch zeigte in einem Bildschirmfenster den Stream der Türkamera. Drei Männer in dunklen Anzügen waren zu sehen. Einer von ihnen stand etwas weiter vorn, streckte die Hand aus und klingelte erneut.
»Sind das die Men in Black?«, fragte Emily, die ihm ins Arbeitszimmer gefolgt war.
Flynn starrte auf den Bildschirm. »Ich habe Mist gebaut, Emily.«
»Kleinen oder großen?«
»Ziemlich großen, fürchte ich.«
Der vorn stehende Mann klingelte erneut und klopfte mit der Faust an die Tür.
»So großen wie in Washington?«, fragte Emily.
Flynn sank in seinen Sessel. »Du solltest die Besucher besser hereinlassen, bevor sie die Tür aufbrechen. Schick sie zu mir.«
Emily verschwand im Flur.
Flynn schloss die Augen und versuchte, seine wirbelnden Gedanken zu ordnen. Als er die Lider wieder hob, zeigte das Kamerabild nur noch zwei Männer vor der Eingangstür. Den dritten führte Emily in sein Zimmer.
»Das ist Mister …«, begann sie.
»Smith«, sagte der Mann.
»Das ist Mister Smith. Er möchte dich in einer wichtigen Angelegenheit sprechen.« Emily blieb stehen und gab nicht zu erkennen, dass sie das Zimmer verlassen wollte.
Flynn deutete auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Worum geht es, Mister … Smith?«
Der Mann im dunklen Anzug – um die vierzig, hohe Stirn, die Augen eisgrau, auf den Wangen ein Bartschatten – setzte sich und richtete einen demonstrativen Blick auf Emily.
»Ich bin die stellvertretende Geschäftsführerin von Security Consulting«, sagte Emily. »Was Flynn betrifft, geht auch mich etwas an.«
Smith wandte den Kopf. »Unter vier Augen.«
Einige Sekunden verstrichen.
»Emily …«, sagte Flynn.
Nach kurzem Zögern drehte sie sich wortlos um, verließ das Zimmer und schloss die Tür etwas fester als nötig.
»Mister Smith … wenn Sie wirklich so heißen …«
Der Mann im dunklen Anzug lächelte kühl. »Wir haben Sie.«
7
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte Flynn voller Anspannung. »Aber ich weiß, wer Sie sind. Keine Polizei. Nein. Geheimdienst, nehme ich an. Und nicht unbedingt ein kanadischer.«
»Wir wissen, wer Sie sind. Riddle beziehungsweise R1DDL3.«
»Nie gehört«, behauptete Flynn lahm.
»Gestern Abend sind Sie in die Computersysteme des Pentagons eingedrungen«, erklärte Smith. Er saß reglos, nur der Mund bewegte sich. »Sie haben dort eine Nachricht hinterlassen, die weithin sichtbar sein sollte. Hackerruhm. Darum ging es. Um eine infantile, dumme Cyber-Challenge. Sie hätten es besser wissen sollen.«
Ein Honeypot, dachte Flynn. Eine Falle. Und er war hineingetappt. »Sie brauchen Beweise. In meinem Computer werden Sie nichts finden.«
»Wir haben, was wir brauchen. Sie werden mit uns kommen – jetzt.« Der Mann stand auf.
»Einfach so?«
»Einfach so.«
»Was ist mit einem Haftbefehl oder dergleichen?«
Smith hob die rechte Braue.
»Wohin wollen Sie mich bringen?«, fragte Flynn. »Warum der Geheimdienst und nicht die Polizei?«
Der Mann im dunklen Anzug ging zur Tür. »Kommen Sie.«
Flynn deutete auf die Tastatur. »Ein Tastendruck genügt, und eine vorbereitete Nachricht wird gesendet. An die Polizei von Oakville und mehrere Online-Zeitungen.«
Smith kehrte zum Schreibtisch zurück und griff unter das Jackett seines Anzugs. Plötzlich hielt er eine Pistole in der Hand und richtete sie auf Flynns Kopf. »Halten Sie das hier für ein Spiel?«
Flynn starrte in die Mündung der Waffe. »Wer schickt Sie? FBI? CIA? NSA? Wir sind in Kanada. Sie haben hier keine Befugnisse!«
»Seit wann spielen Staatsgrenzen bei solchen Dingen eine Rolle?« Smith ließ die Pistole wieder unter der Anzugjacke verschwinden, fügte jedoch mit ungnädiger Stimme hinzu: »Sie kommen mit uns, freiwillig oder nicht. Es kann einigermaßen komfortabel oder recht unangenehm für Sie werden, das liegt ganz bei Ihnen.«
Flynn erhob sich langsam. »Was ist mit meinen Leuten?«
»Wir könnten sie ins Gefängnis schicken, meinetwegen ein kanadisches.«
»Emily und die anderen haben nichts damit zu tun!«
»Wenn Sie auf stur schalten, sorgen wir für Anklage und Verurteilung«, sagte Smith entschieden. »Wenn Sie kooperieren, bleiben sie unbehelligt.« Er ging erneut zur Tür. »Ihre Entscheidung.«
Flynn trat hinter dem Schreibtisch hervor. »Kann ich noch kurz mit Emily reden?«
»Wir haben genug Zeit vertrödelt«, erwiderte Smith und zeigte auf seine Armbanduhr. »Ein Flugzeug wartet auf uns.«
8
Dr. Hannah TambeyBei Wilmington, North Carolina, USAFreitag, 5. August
»Was halten Sie davon, wenn wir uns ein wenig draußen umsehen, Miss Tambey?«, fragte der Mann von der Regierung. »Ein kleiner Spaziergang, bei dem wir uns ungestört unterhalten können.«
Dr. Hannah Tambey zögerte. Es gab viele Dinge, die ihre Aufmerksamkeit erforderten, gerade im derzeitigen Stadium des Projekts, und am liebsten hätte sie sich wieder um Jota gekümmert. Doch bestimmte Kompromisse ließen sich nicht vermeiden.
»Wie Sie wünschen.« Sie führte den Mann, der viel mehr war als ein gewöhnlicher Besucher, aus dem Empfangsraum, vorbei am Sicherheitsbeauftragten Miller, der vor seinen Monitoren saß und ihr freundlich zunickte, und durch die Glastür nach draußen.
Schwülwarme, nach dem nahen Meer riechende Luft empfing sie. Nach einem Dutzend Schritten auf dem Gehweg zum Zaun und dem Strand dahinter blieb Carl Conrad Wallace stehen und sah zurück. Hannah drehte sich ebenfalls um.
»Institute for Ocean Research« – Institut für Meeresforschung – stand in schwarzen Lettern über dem Eingang des zweistöckigen grauen Gebäudes. Der Name täuschte. Forschungen, die den Ozean betrafen, fanden in dem Institut nicht statt.
»Es sieht unscheinbar aus«, sagte Wallace. »Nichts deutet darauf hin, dass dort drin etwas Besonderes geschieht.«
»Es soll auch niemand auf einen solchen Gedanken kommen.«
Als sie weitergingen, zum Zaun und an ihm entlang, musterte Hannah den Mann aus den Augenwinkeln und versuchte, einen Eindruck von ihm zu gewinnen. Die neue Regierung hatte einen neuen Aufpasser geschickt, das war zu erwarten gewesen. Mit seinem Vorgänger hatte sie gut zusammengearbeitet. Er hatte Rücksicht genommen, manchmal ein Auge zugedrückt und ihr Freiraum genug gelassen, um das Projekt voranzubringen. Dafür war sie ihm dankbar gewesen, denn sie mochte es nicht, wenn man ihr dauernd auf die Finger sah.
Carl Conrad Wallace war einen Kopf größer als sie und schmächtig, Hemd und Hose ließen mehr als genug Platz. Das aschblonde Haar reichte über die Ohren hinweg und schien seit einer ganzen Weile nicht mehr geschnitten worden zu sein, es wirkte fast ungepflegt. Die dunklen Augen zeigten eine Mischung aus Blau und Grün, wenn das Licht sie von der Seite erreichte. Er sprach ruhig und überlegt, schien ein freundlicher, umgänglicher Mann zu sein. Doch manchmal schwang in seiner Stimme eine gewisse Schärfe mit, die Hannah darauf hinwies, dass er seine Autorität durchaus zu nutzen wusste.
»Wie sehen die Sicherheitsmaßnahmen aus, Miss Tambey?«, fragte er und verzichtete erneut darauf, sie mit »Doktor« anzusprechen.
»Es sind ständig mindestens zwei Wächter im Einsatz«, antwortete Hannah. »Rund um die Uhr. Einer vor dem Gebäude, der andere dahinter. Hinzu kommen spezielle Sensoren am Gebäude, am Zaun und im Pflaster der Wege.«
»Jotas Augen und Ohren?«
»So könnte man sie nennen, ja. Außerdem sind mehrere Drohnen im Einsatz.« Hannah beschattete sich die Augen und sah nach oben. »Selbst wenn man weiß, dass es sie gibt, sind sie schwer zu erkennen. Niemand kann sich dem Gebäude nähern, ohne dass Miller und seine Leute davon erfahren.«
»Drohnen«, wiederholte Wallace nachdenklich. Der Wind vom Atlantik spielte mit seinem Haar. »Was würde bei einem Angriff mit Drohnen passieren?«
»Die Sensoren würden sie schon in einer Entfernung von mehreren Kilometern entdecken und Alarm auslösen.«
»Und dann?«, hakte der Mann von der Regierung nach. »Angenommen, es kommt eine Kampfdrohne zum Einsatz.«
»Mit Sprengstoff, meinen Sie?«
»Ja.«
»Jota würde dem Angreifer Abwehrdrohnen entgegenschicken. Sie ist auf so etwas vorbereitet.«
»Sie?«, fragte Wallace. »Nicht ›es‹?«
»Jota klingt nach einem Frauennamen«, wich Hannah aus.
Wallace nickte und blickte zum Gebäude. »Und wenn eine Kampfdrohne das Institut trotz aller Abwehrmaßnahmen erreicht und explodiert?«
»Es käme auf die Größe und Art der Sprengladung an«, sagte Hannah und beobachtete einen Lkw, der durch das Tor hinter dem Institut rollte. Er hielt an der Verladestelle, und mehrere Männer begannen damit, Verschalungselemente abzuladen. »Die beiden oberirdischen Stockwerke könnten zerstört werden.«
»Und der Keller?«
»Die sieben Kellergeschosse sind wie ein Bunker«, erklärte Hannah. »Eine gewöhnliche Explosion am oder über dem Boden könnte höchstens das erste Untergeschoss beschädigen. Nummer sieben ganz unten ist noch einmal besonders gesichert.«
»Eine ziemlich aufwendige Einkapselung, wie ich den Unterlagen entnommen habe«, kommentierte Wallace.
»Auch in elektromagnetischer Hinsicht, ja«, bestätigte Hannah. »Außerdem ist das siebte Untergeschoss energetisch autark.«
»Könnte der Keller des Instituts einen Flugzeugabsturz überstehen?«
»Ich denke schon«, sagte Hannah. »Vielleicht sogar eine Atombombe, wenn es sich nicht um einen direkten Treffer handelt. Dank der elektromagnetischen Abschirmung wäre der EMP bei einer Atomexplosion kein Problem für Jota.«
Wallace blieb stehen und deutete zum Lkw. »Was geschieht dort?«
»Vorsorge«, sagte Hannah. »Kennen Sie die letzten Wetterberichte?«
»Sie meinen den Hurrikan?«
»Grace. So heißt er. Schon der siebte in dieser Hurrikansaison, obwohl es erst Anfang August ist. Und ein besonders schwerer. Er könnte Stufe vier auf der Saffir-Simpson-Skala erreichen.«
»Wir sind hier bei Wilmington in North Carolina«, wandte Wallace ein. »Florida ist ein ganzes Stück entfernt.«
Hannah deutete übers ruhige Meer. »Etwa dort, fast genau östlich von uns, liegt Bermuda, tausendzweihundertvierzig Kilometer entfernt. Derzeit befindet sich Grace nördlich der Britischen Jungferninseln in der Karibik. Das Meer dort ist ziemlich warm, was dem Hurrikan zusätzliche Kraft verleiht. Er wird nicht nach Westen ziehen, wie zunächst angenommen, sondern nach Norden, in Richtung Bermuda. Erst dort soll er westlichen Kurs nehmen.«
»Wann erwarten Sie ihn hier?«
»Bestenfalls bleibt uns noch eine Woche, vielleicht sogar zehn Tage. Aber Grace könnte auch schon in drei oder vier Tagen bei uns anklopfen. Deshalb die Verschalung. Wir bereiten den oberirdischen Teil des Instituts vor. Für den Keller besteht keine Gefahr, auch nicht bei einer Überflutung.«
Sie gingen langsam weiter. Der Strand war nur einen Steinwurf entfernt.
»Es ist der Klimawandel, nicht wahr?«, sagte Wallace nach einer Weile. »Der siebte Hurrikan schon Anfang August. Sehr stark und weiter im Norden als sonst.«
»In der Karibik steigen die Wassertemperaturen, im Atlantik ebenso«, entgegnete Hannah. »Je höher die Temperaturen für tropische Wirbelstürme, desto häufiger werden starke Stürme. Wir müssen mit immer mehr Hurrikans rechnen, bis hinauf nach New York.«
»Wir könnten das Problem lösen, wenn ich Ihr Projekt richtig verstanden habe«, sagte Wallace. »Ich meine die Klimakrise. Nicht in einigen Jahrzehnten, sondern fast sofort.«
Hannah zweifelte nicht eine Sekunde lang daran, dass Carl Conrad Wallace alle Aspekte des Projekts kannte und verstanden hatte. Andernfalls wäre er von der neuen Regierung nicht nach Wilmington geschickt worden.
»Noch sind wir nicht so weit«, erwiderte sie.
»Wie weit sind Sie, Miss Tambey?«
Hannah zögerte kurz. »Wir machen Fortschritte.«
Wallace drehte den Kopf und sah sie direkt an. Der Wind wehte ihm eine Haarsträhne in die Stirn. »Haben Sie einen Beweis gefunden? Für …« Sein Blick huschte zur Seite, wie auf der Suche nach einem Lauscher. »Sie wissen schon.«
»Jota hat die Wahrscheinlichkeit neu berechnet«, sagte Hannah. »Sie liegt bei einundachtzig Komma vier Prozent. Das ist viel. Sehr viel.«
»Aber es ist noch keine Gewissheit.«
»Absolute Gewissheit gibt es nie, Mister Wallace«, sagte Hannah.
»Ja.« Er lächelte freundlich. »Ja, da haben Sie natürlich recht. Wenn wir Zugang bekommen …« Seine Stimme gewann einen anderen Klang. »Wenn wir finden, was wir suchen … Wir könnten alle unsere Probleme lösen, nicht wahr? Ich meine wirklich alle.«
»Wir müssen vorsichtig sein«, mahnte Hannah. »Sehr vorsichtig. Ich nehme an, Sie sind mit den Implikationen vertraut.«
Wallace schien sie gar nicht zu hören. »Wir bekämen eine Art Zauberstab …«
Hannah gefiel nicht, was sie hörte. »Kennen Sie den Zauberlehrling von Disney, Mister Wallace?«
Der Mann von der Regierung lächelte schnell und kurz. »Der Zauberlehrling war allein, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben ein Team, das bald Verstärkung bekommen wird. Einige außerordentlich talentierte Computerspezialisten sind hierher unterwegs und werden Ihnen helfen. Es gilt, so bald wie möglich konkrete Ergebnisse zu erzielen. Wir müssen uns beeilen, die Konkurrenz schläft nicht.«
»Eile ist bei dieser Angelegenheit alles andere als ratsam«, gab Hannah zu bedenken.
Wallace deutete in die Richtung, aus der sie kamen. »Hier draußen habe ich genug gesehen. Bitte zeigen Sie mir Jota.«
9
Hannah wollte nach der Verstärkung fragen, was es damit auf sich hatte, aber im Lift kam ihr Carl Conrad Wallace mit weiteren Fragen zuvor.
»Was, wenn der Hurrikan noch stärker wird als vorgesehen? Was, wenn er Stufe fünf erreicht?«
»Das Gebäude ist stabil genug, es besteht aus Stahlbeton«, antwortete Hannah. »Die Verschalungen dienen vor allem dem Schutz von Fenstern und Türen.«
»Ich meine eine mögliche Überschwemmung«, präzisierte der Mann von der Regierung. »Das Meer ist nah.«
»Wir sind hier auf einem Hügel«, erklärte Hannah. »Besser gesagt, wir sind in ihm. Und selbst wenn das Wasser bis zur Hügelkuppe stiege … Mit den Verschalungen ist das Erdgeschoss luft- und wasserdicht.«
»Angenommen, es gäbe eine undichte Stelle«, beharrte Wallace.
Hannah fragte sich, ob er um seine persönliche Sicherheit oder um die des Projekts fürchtete.
»Dann könnte das Erdgeschoss überflutet werden«, sagte sie. »Aber der Keller wäre trotzdem sicher, alle sieben Etagen. Es könnte kein Wasser eindringen.«
»Nicht einmal durch diesen Liftschacht?« Wallace deutete nach oben, während die Kabine weiter sank.
»Bei Planung und Bau wurde an alles gedacht«, versicherte ihm Hannah. »Ich habe die Einkapselung bereits erwähnt, sie ist vollständig und komplett. Elektromagnetische Isolation, energetische Autarkie, Sauerstofftanks und Luftaufbereitung, Lebensmittelvorräte für drei Monate, dicke Wände, hermetische Schotten – Grace kann uns nichts anhaben, auch nicht mit Stufe fünf.«
Der Lift hielt an, seine beiden Türhälften glitten auseinander.
»Das alles hat viel Geld gekostet«, kommentierte Wallace.
Dieser Hinweis gab Hannah zu denken. Drohte eine Budgetkürzung?
»Es ist gut investiertes Geld.« Sie trat zusammen mit Wallace in die kleine Sicherheitskammer. Hinter ihnen schloss sich der Lift.
Die Tür vor ihnen trug eine große rote 7.
»Wir sind ganz unten«, stellte Wallace fest.
Hannah hielt ihre Codekarte an den Scanner, und die dicke Sicherheitstür schwang mit einem leisen Summen auf. Sie traten in einen Flur, ausgelegt mit beigefarbenen Teppichboden und Bildern an den Wänden, die Naturszenen zeigten: Meere, Berge, Wälder und hügelige Landschaften.
Rechts und links führten offene Türen in wohnlich eingerichtete Büros mit großen Topfpflanzen und falschen Fenstern – Wandbildschirme zeigten die Umgebung des Instituts. Männer und Frauen, kaum jemand von ihnen älter als vierzig, saßen an Monitoren und tippten auf Tastaturen. Viele von ihnen waren so in ihre Arbeit vertieft, dass sie Hannah und den Besucher gar nicht bemerkten.
»Unsere Programmierer und Systemverwalter«, erklärte sie. »Vier oder fünf sind immer da. Auch hier wird rund um die Uhr gearbeitet.«
»Zweifellos gute Leute«, sagte Wallace, als sie weitergingen und sich der blauen Tür am Ende des Flurs näherten.
»Ja«, bestätigte Hannah.
»Sie werden noch bessere bekommen. Die besten, die es gibt.«
Wieder erhielt sie keine Gelegenheit, nach Details zu fragen, denn Wallace fügte sofort hinzu: »Was bedeutet das?«
Er meinte das große weiße Symbol auf der Tür: ∞
»Es ist ein mathematisches Zeichen, das Unendlichkeit symbolisiert.«
»Ich weiß, was es bedeutet«, erwiderte Wallace fast ein wenig unwillig. »Aber was macht es hier, an diesem Ort?«
Hannah hielt erneut ihre Codekarte vor den Scanner. »Das Symbol soll uns daran erinnern, womit wir es zu tun haben.«
Es klickte im Schloss. Die blaue Tür öffnete sich und bot Zugang zu einer kleinen Sicherheitsschleuse.
»Mit Unendlichkeit?«, fragte Wallace erstaunt.
»Mit unendlich vielen Möglichkeiten.«
Die zweite Tür, weiß wie Schnee, schwang auf, nachdem sich die blaue geschlossen hatte. Vor ihnen lag ein runder Raum, nicht größer als zwanzig Quadratmeter, mit zahlreichen Bildschirmen an den Wänden und einem bogenförmigen Schreibtisch mit Tastaturen, Anzeigetafeln und Schaltern.
Penelope und Baihu saßen dort, ein Paar voller Gegensätze: sie dunkel, groß und recht kräftig gebaut; er blass, klein und zart.
Hannah bemerkte dünne Falten in Wallace’ Stirn, als er den Chinesen sah.
»Hier sehen Sie Herz und Hirn des Instituts«, sagte sie.
»Dies ist Jota?« Wallace klang enttäuscht.