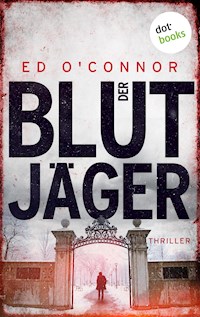5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine mörderische Jagd durch London: Der abgründige Psycho-Thriller »Der Ritualmörder« von Ed O’Connor jetzt als eBook bei dotbooks. Manchmal muss ein grausamer Preis gezahlt werden, um wahre Schönheit zu erschaffen … Eine rätselhafte Mordserie erschüttert London – alle Opfer sind weiblich, alle wurden vor ihrem Tod exakt 36 Tage lang gefangen gehalten, allen steckt ein Vogelschnabel im Hals. Die Tatorte geben Rätsel auf, doch eins weiß Detective Lucy Maguire sicher: der Täter wird nicht aufhören zu morden – und er genießt sein Spiel. Hilfe erhält Maguire von dem wortkargen Profiler Aidan Duffy, der ein außergewöhnliches Gespür dafür zu haben scheint, was den Mörder antreibt. Gemeinsam entdecken sie bald Hinweise auf einen uralten Schwanen-Mythos, der bereits Michelangelo zu dunkler Kunst inspirierte. Gibt es eine Verbindung zu dem Todeskünstler, der bereits das nächste Opfer in seine Gewalt gebracht hat? Für Maguire und Duffy beginnt ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der atemlose Brit-Crime-Thriller »Ritualmörder« von Ed O’Connor – über einen perfiden Serienkiller, der das Morden zu einer schrecklichen Kunst erhebt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Ähnliche
Über dieses Buch:
Manchmal muss ein grausamer Preis gezahlt werden, um wahre Schönheit zu erschaffen … Eine rätselhafte Mordserie erschüttert London – alle Opfer sind weiblich, alle wurden vor ihrem Tod exakt 36 Tage lang gefangen gehalten, allen steckt ein Vogelschnabel im Hals. Die Tatorte geben Rätsel auf, doch eins weiß Detective Lucy Maguire sicher: der Täter wird nicht aufhören zu morden – und er genießt sein Spiel. Hilfe erhält Maguire von dem wortkargen Profiler Aidan Duffy, der ein außergewöhnliches Gespür dafür zu haben scheint, was den Mörder antreibt. Gemeinsam entdecken sie bald Hinweise auf einen uralten Schwanen-Mythos, der bereits Michelangelo zu dunkler Kunst inspirierte. Gibt es eine Verbindung zu dem Todeskünstler, der bereits das nächste Opfer in seine Gewalt gebracht hat? Für Maguire und Duffy beginnt ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit …
Über den Autor:
Ed O’Connor lebt in Hertfordshire, England, und arbeitet als Dozent für Geschichte in St. Albans. Er studierte in Oxford und Cambridge, danach arbeitete er mehrere Jahre in London und New York als Investmentbanker.
Bei dotbooks veröffentlichte Ed O’Connor auch seine »Underwood & Dexter«-Reihe mit den Bänden:»Der Augenräuber«»Der Kopfsammler«»Der Blutjäger«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »Leda«. Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Leda« bei Bastei Lübbe.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2007 by Ed O’Connor
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: © HildenDesign unter Verwendung mehrerer Motive von Shuterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-053-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Ritualmörder« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ed O’Connor
Der Ritualmörder
Thriller
Aus dem Englischen von Marion Sohns
dotbooks.
Für Jude, Esme und Isabel
In Liebe
Teil 1Und ich zeichne deine Stirne
London, Evening Standard
5. September 2006
Zweiter Entführungsfall
Die Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter, nachdem heute bekannt wurde, dass erneut eine Frau aus ihrer Londoner Wohnung entführt wurde.
Carolyn Cooper, eine sechsundzwanzigjährige Rechtsanwaltssekretärin, verschwand gestern aus ihrer Wohnung im Norden Londons. Dieser Vorfall ereignet sich nur kurz nach der Entdeckung der Leiche von Melissa Birchall, die Ende Juli entführt wurde.
Die Polizei lehnt es ab, Mutmaßungen, die Frauen seien Opfer eines Ritualmörders geworden, zu kommentieren. Dennoch hat die Einschaltung des Sonderdezernats von Scotland Yard die öffentliche Aufmerksamkeit erhöht. DI Lucy Maguire vom Mordkommissariat Scotland Yard, verantwortliche Leiterin der Ermittlung, bemerkt dazu:
»Wir schließen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Möglichkeit aus. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass Carolyn Cooper unversehrt zu ihrer Familie zurückkehrt.«
Die Metropolitan Police rät Frauen zu besonderer Vorsicht, vor allem, wenn sie in den Abendstunden allein unterwegs sind. Bislang gibt es noch keine Beschreibung eines Verdächtigen, sodass noch keine Festnahmen erfolgen konnten.
Kapitel 1
ParcMonceau, Paris
7. Oktober 2006
Es war der jungen Frau gelungen, seine Aufmerksamkeit zu wecken. So viel war Siegfried Gratz – trotz der trostlosen Stimmung, in der er sich befand – immerhin bewusst. Es war friedlich im Parc Monceau, eine Atmosphäre bar jeder Hektik. Der Ort war ihm vertraut. Genau dreißig Jahre zuvor hatte die Frau, die er liebte, Gratz an dieser Stelle das Herz gebrochen. Was für eine absurde Idee, dachte er, hierherzukommen, um diesen Schmerz noch einmal zu durchleben.
Gratz strich die Asche seiner Gauloise an der Holzlehne der Parkbank ab und sah verstohlen zu der fremden jungen Frau hinüber. Eine unleugbar faszinierende Erscheinung mit ihrem üppigen dunklen Haar und den blauen Augen, aus denen eine bestechende Intelligenz sprach. Ihre seltsam lässige Sexualität schien sich über den offensichtlichen Altersunterschied zwischen ihm und ihr hinwegzusetzen. Er schätzte sie auf Mitte zwanzig.
Die junge Frau starrte ihn plötzlich mit einer Eindringlichkeit an, die ihm Unbehagen verursachte. Sie kam auf ihn zu. Vermutlich eine Geistesgestörte, dachte er, eine attraktive Geistesgestörte, zugegeben, aber seiner Aufmerksamkeit nicht wert. In solchen Momenten zog Gratz sich gern in seine Fantasie zurück, in das Luftreich des Traums, das sein Lieblingsdichter Heine einst so leidenschaftlich beschrieben hatte. Während er das sanfte Grün des Parks auf sich einwirken ließ, verspürte er erneut den tief verwurzelten Schmerz. Was für ein Schwachsinn, zurückzukehren. Es war, als würde er eine alte Kruste von einer Wunde kratzen. Und nun blutete diese Wunde in ihm.
Zu seiner Überraschung setzte die junge Frau sich plötzlich neben ihn. Gratz zog nachdenklich an seiner Zigarette und fragte sich, wie ihre Gestörtheit sich wohl offenbaren würde.
»Sind Sie zufällig Siegfried Gratz?«, fragte sie mit einem erfrischenden, englischen Akzent.
»Woher wissen Sie das?«, erwiderte Gratz verblüfft.
Sie lächelte; eine gewisse Erleichterung schien ihre Züge zu besänftigen. »Wenn Sie mir eine Zigarette geben, verrate ich es Ihnen.«
Gratz kam der Aufforderung nach. Eine Sekunde lang tanzte die gelbe Flamme seines Feuerzeugs zwischen ihnen.
»Herr Gratz, mein Name ist Helen Aurel. Meine Mutter war Elizabeth Weir.«
Gratz spürte, wie die Wunde in seinem Inneren weiter aufriss. Der Name löste noch immer die alte, schmerzhafte Wirkung in ihm aus.
»Ich verstehe nicht …«
»Ich wusste, dass Sie heute hier sein würden«, sagte Helen Aurel. »Sie hat es mir gesagt. Ich muss über etwas Wichtiges mit Ihnen reden.«
Gratz verspürte plötzlich eine sonderbare Scham, war seine Sentimentalität doch auf verletzliche Weise offenkundig geworden. Auf den Tag genau dreißig Jahre nachdem Elizabeth Weir sein Leben hier im Parc Monceau zerstört hatte, war ihre Tochter gekommen, um die Emotionen erneut zu schüren.
»Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Miss Aurel.« Gratz stand auf. Er hatte es plötzlich eilig, das Weite zu suchen. »Das Ganze ist wohl ein Missverständnis. Guten Tag.«
Er wandte sich ab und ging auf die Kolonnaden zu, auch wenn die Richtung seiner Flucht zweitrangig war.
»Sie ist tot«, rief Helen ihm nach.
Gratz erstarrte und blieb stehen.
»Es tut mir leid«, fügte sie hinzu. »Tut mir leid, dass ich es Ihnen auf diese Weise mitteilen muss. Aber ich habe etwas für Sie.«
Der Schmerz bohrte weiter. Für einen Sekundenbruchteil, im Luftreich seines Traums, kam er sich vor wie das Opfer auf Hogarths Kupferstich Lohn der Grausamkeit, dessen Innereien aus seinem zuckenden Leib quollen. Er kehrte zur Bank zurück und setzte sich.
»Ich bedaure Ihren Verlust«, sagte er schließlich. »Sie war eine bemerkenswerte Frau.«
Helen Aurel zog einen Umschlag aus ihrer Tasche.
»Meine Mutter ist vor zwei Monaten gestorben. Sie hatte Leukämie. Sie hat lange dagegen angekämpft, aber letztlich hat die Krankheit gesiegt.«
»Was für eine Tragödie«, hörte Gratz sich sagen. Die Hoffnung, die ihn all die Jahre vorwärtsgetrieben hatte, war mit einem Schlag ausgelöscht worden.
»Zwei Tage vor ihrem Tod gab sie mir diesen Umschlag. Ich weiß nicht, was er enthält. Sie trug mir auf, ihn Ihnen zu geben. An diesem Ort und an diesem Tag, dem 7. Oktober 2006.«
»Wie konnte sie wissen, dass ich hier sein würde? Ich lebe in London.«
»Ich hatte gehofft, dass Sie mir diese Frage beantworten können.«
Gratz nahm den Umschlag entgegen. »Nun, vielleicht. Ihre Mutter und ich waren einmal befreundet. Lange, bevor Sie geboren wurden. Sie würden vermutlich sagen, wir waren ein Liebespaar. Jedenfalls habe ich sie geliebt.«
»Das dachte ich mir schon. Ich weiß, dass sie ein ziemlich bewegtes Leben geführt hat.«
»Sie war etwas Besonderes. Das schönste Wesen, das mir je begegnet ist. Allerdings – verzeihen Sie meine Offenheit, Miss Aurel – hat die Erfahrung Ihre Mutter für mich zu einer Parodie der Schönheit werden lassen. Sie hat mich furchtbar verletzt. Auf den Tag genau vor dreißig Jahren hat sie mir hier auf dieser Bank den Laufpass gegeben. Weil sie einen anderen liebte.«
»Das muss schrecklich für Sie gewesen sein!«
»Nun, so ist der Lauf der Dinge.« Gratz brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Sie würden es vielleicht natürliche Gerechtigkeit nennen, denn hätte sie mich nicht verlassen, wären Sie nie geboren worden. Ich nehme an, der Betreffende war Ihr Vater. Das Leben schlägt oft solch verschlungene Wege ein.«
»Ich verstehe trotzdem nicht ganz, wie sie wissen konnte, dass Sie heute hier sein würden.«
»Zu meiner Scham muss ich gestehen, Miss Aurel, dass ich Ihre Mutter damals angefleht habe, mich nicht zu verlassen. Es war der schlimmste Moment meines Lebens. Aber sie ließ sich nicht erweichen. Während wir miteinander stritten, verwandelte sich meine Verzweiflung in Zorn. Ich habe ihr vorgeworfen, dass sie einen großen Fehler beginge. Was sie natürlich nicht hören wollte. Sie erklärte mir, sie habe den Mann gefunden, den sie heiraten wolle. Ich antwortete, dass ich auf sie warten würde. Dass ich in dreißig Jahren, auf den Tag genau, auf dieser Bank sitzen und auf sie warten würde. Es war eine kindische, romantische Idee.«
»Trotzdem, Sie sind hier.«
Er sah sie jetzt direkt an. Zum ersten Mal bemerkte er die kalte Schönheit Elizabeth Weirs in ihren Augen.
»Ja. Da bin ich.«
Gratz blickte auf den Umschlag.
»Wollen Sie ihn nicht öffnen?«
»Ehrlich gesagt, fürchte ich mich ein wenig davor.«
»Herr Gratz, bei allem Respekt. Ich habe einen ziemlich langen Weg hierher zurückgelegt. Ich bin müde und hungrig. Könnten wir wenigstens einen Kaffee zusammen trinken gehen, während Sie sich entscheiden?«
Gratz nickte. Schweigend schritten sie über die gewundenen Parkwege auf den Hauptausgang am Boulevard de Corcelles zu. Aufgrund seines zwanglosen englischen Stils und seiner architektonischen Anspielungen auf das Freimaurertum war der Parc Monceau eher untypisch für Paris. Sein Gründer, Louis-Philippe, Herzog von Orleans, war ein führendes Mitglied der Freimaurerloge gewesen, so gab es im Park eine Reihe kleiner Pavillons und Tempel aus weißem Marmor, die auf diese Loge hinwiesen.
Normalerweise wäre Gratz’ beruflich bedingte Neugier dadurch geweckt worden. Als leitender Kunstkritiker des Daily Telegraph bereiteten ihm derartige stilistische Eigenheiten in der Regel besonderes Vergnügen. Jetzt jedoch schritt er in dumpfem Schweigen dahin. Elizabeth Weir war tot. Dreißig Jahre lang hatte er sich mit ihrer Abwesenheit abgefunden, hatte er versucht, seine Obsession durch andere Formen der Schönheit zu stillen. Die Hoffnung, ihr hier wieder zu begegnen, hatte ihn aufrecht gehalten – damit war es nun vorbei. Stattdessen hielt er einen unerbetenen Umschlag in der Hand von einer mysteriösen jungen Frau, deren Schönheit ihn sichtlich verwirrte. Es war, als hätte der kühle Pariser Nachmittag sich um ihn verdunkelt. Er suchte Zuflucht in angenehmeren Winkeln seines Bewusstseins. Ein vertrauter Gedichtauszug von Heine fiel ihm ein:
Auch die Lampen, sie erlöschen.
Morgen kommt der Aschermittwoch,
Und ich zeichne deine Stirne
Mit dem Aschenkreuz und spreche:
Weib, bedenke, dass du Staub bist.
Sie überquerten den Boulevard de Corcelles und fanden ein kleines Café an der Ecke einer Seitenstraße. Helen bestellte ihnen Kaffee am Tresen, während Gratz an einem Fenstertisch Platz nahm. Regentropfen sprenkelten die Scheibe, der Himmel schien sich immer mehr zu trüben.
»Auch die Lampen, sie erlöschen«, murmelte er.
Helen hatte sich inzwischen zu ihm an den Tisch gesellt.
»Was haben Sie gesagt?«, fragte sie.
»Ach, nichts.« Gratz musterte sie aufmerksam. »Der Ausdruck Ihrer Augen ähnelt dem Ihrer Mutter«, bemerkte er. »Aber ich vermute, ansonsten kommen Sie ganz und gar nach Ihrem Vater.«
»Danke. Der heutige Tag muss ein ziemlicher Schock für Sie sein.«
»Allerdings.« Gratz blickte auf den Umschlag, der zwischen ihnen lag. »Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was Ihre Mutter mir nach all den Jahren zu sagen beschlossen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihre Zeilen wirklich lesen will. Das Letzte, worauf ich aus bin, wäre eine Entschuldigung oder Worte des Mitgefühls.«
»Mitgefühl gehörte nicht gerade zu den Stärken meiner Mutter«, erwiderte Helen, während die Bedienung zwei Tassen Kaffee brachte. »Wenn schon nicht um ihretwegen, dann öffnen Sie den Umschlag wenigstens mir zuliebe. Je mehr Sie zögern, desto mehr brenne ich vor Neugier. Ich habe mich seit dem Tod meiner Mutter verdammt zusammenreißen müssen, den Umschlag nicht selbst zu öffnen. Aber wenn Sie es partout nicht fertigbringen, dann werde ich es tun.«
Gratz hatte diesem Argument nichts entgegenzusetzen und riss den Umschlag auf. Er entnahm ihm zwei Blätter, die mit einer blauen Büroklammer zusammengeheftet waren, sowie ein kleines, ziemlich abgegriffen wirkendes Büchlein, dessen verblasster Einband einmal rot gewesen sein mochte.
Helen Aurel lehnte sich vor.
»Was ist das?«
Gratz war verwirrt und enttäuscht.
»Es ist kein Brief von Ihrer Mutter dabei«, bemerkte er mit einer gewissen Verbitterung. »Nur die Fotografie eines Gemäldes.«
»Welchen Gemäldes?«
Gratz musterte das Foto durch seine Lindberg-Titan-Brille.
»Es handelt sich um Michelangelos Leda. Um genau zu sein, um eine der Kopien von Michelangelos Leda, die in der National Gallery in London hängt. Sie wurde von Rosso Fiorentino angefertigt.«
»Ergibt das irgendeinen Sinn für Sie?«
»Eigentlich nicht.«
»Was ist noch in dem Umschlag?«
Gratz las die Worte auf dem zweiten Blatt Papier. »Ein Gedicht. Vielleicht war Ihre Mutter zum Schluss nicht mehr ganz bei Verstand. Es handelt sich um Leda mit dem Schwan, von William Butler Yeats.«
»Ich verstehe das nicht. Wieso diese Verweise auf Leda?«
Gratz zuckte mit den Schultern. »Es ist eine bekannte Sage aus der griechischen Mythologie, die häufig in der Kunst aufgegriffen wurde. Leda war die Frau von Tyndareos, des Königs von Sparta. Der Gott Zeus näherte sich ihr in Gestalt eines Schwans und verführte sie. Er schwängerte sie, und sie brachte zwei Eier zur Welt. Eine Überlieferung besagt, dass aus dem einen Castor und Klytaimnestra schlüpften, aus dem anderen Pollux und …«
Gratz hielt einen Moment inne.
»… und?«, ermunterte Helen Aurel ihn fortzufahren.
»Helena – die später als die schöne Helena von Troja berühmt wurde.«
Helen blickte ihn verblüfft an.
»Eine interessante Übereinstimmung mit Ihrem Namen«, bemerkte Gratz.
»Hat das irgendetwas zu bedeuten?«
»Keine Ahnung.« Gratz schlug das kleine Buch auf. »Das hier ist eine Ausgabe von Vasaris Leben der hervorragendsten Künstler, vermutlich hat sie Ihrer Mutter gehört. Sie hat ein paar Kapitel über Michelangelo angekreuzt.« Er blätterte durch die Seiten. »Sehen Sie hier, auf dieser Seite gibt es einen Hinweis auf die Leda.«
»Ich bekomme allmählich den Eindruck, als habe meine Mutter gewollt, dass wir uns dieses Gemälde ansehen. Wissen Sie, in welchem Museum das Original hängt? Vielleicht hier im Louvre? Wir könnten zusammen hingehen.«
»Das wird nicht möglich sein. Die Original-Leda von Michelangelo gilt seit Jahrhunderten als verschollen. Meines Wissens nach gibt es schon seit mehreren Hundertjahren keinen Hinweis auf den Verbleib des Bildes.«
»Vermutlich ist es unbezahlbar.«
»Sofern es noch existiert. Was höchst unwahrscheinlich ist. Die französische Regierung hat die Mona Lisa vor Jahren für eine Million Dollar versichert. Heute könnte das Bild gut und gerne siebenhundert Millionen Dollar wert sein. Ich nehme an, der Wert der Original-Leda beliefe sich auf eine vergleichbare Summe.«
»Woher wissen Sie das alles?«
»Ich bin Kunstkritiker – und Journalist, wie Ihre Mutter. Es war eine der Leidenschaften, die Ihre Mutter und ich geteilt haben.«
Helen Aurel setzte die Kaffeetasse ab, die sie nachdenklich mit beiden Händen umschlossen hatte.
»Es muss einen Grund geben, warum sie uns zusammengebracht hat.«
»Vielleicht wollte sie, dass wir uns auf die Suche nach der Original-Leda begeben«, bemerkte Gratz trocken. »Damit ich noch mal dreißig Jahre meines Lebens vergeude.«
»Sind Sie denn gar nicht neugierig, warum sie Ihnen dieses Material zukommen ließ?«, fragte Helena.
Gratz schüttelte den Kopf. In Gedanken versuchte er die Bedeutung dieser nachmittäglichen Ereignisse zu begreifen. Sein selbstvergessenes Schwelgen in der Vergangenheit war von dieser sonderbaren, schönen jungen Frau unterbrochen worden, die behauptete, die Tochter seiner verlorenen Liebe zu sein. Er war durchaus noch fähig zu rechnen. Das Mädchen musste ein paar Jahre nach seinem Bruch mit Elizabeth Weir geboren worden sein. Wären die Dinge ein wenig anders verlaufen, könnte er, Gratz, jetzt mit seiner eigenen Tochter in einem Pariser Café sitzen. Dieses Mädchen war jedenfalls nicht seine Tochter, dessen war er sich absolut sicher. Sie wies keinerlei Ähnlichkeit mit ihm auf. Und um ehrlich zu sein, konnte er auch kaum etwas von Elizabeth Weir in ihr entdecken, außer einem sonderbaren, unergründlichen Etwas, das sich hinter ihren Augen zu verbergen schien: vielleicht das Aufblitzen einer vertrauten Aufgewecktheit – oder auch ein Funken Verrücktheit.
Aber was sollte er nun von dieser ungewöhnlichen Sammlung aus einem Foto, einem Gedicht und einigen biografischen Bruchstücken halten? Elizabeth Weir hatte ihm offensichtlich eine Nachricht zukommen lassen wollen, aber warum hatte sie diese nicht präziser formuliert? Aus dem Inhalt des Umschlags ging nicht einmal hervor, was sie eigentlich von ihm erwartete. Er konnte mit ihrer augenscheinlichen Obsession der Leda nichts anfangen, in seinen Augen ein Gemälde, das definitiv nicht einmal zu Michelangelos herausragendsten Werken gehört hatte. Und doch, Weirs Anmerkungen in Vasaris Leben der hervorragendsten Künstler ließen darauf schließen, dass sie versucht hatte, das Gemälde ausfindig zu machen.
»Meinen Sie, wir sollten uns auf die Suche nach dem Bild machen?«, fragte Helen Aurel verwirrt. »Ist es das, was sie beabsichtigt hat?«
»Das wäre höchst unrealistisch. Denn da ist nichts, wonach man suchen könnte. Dieses merkwürdige Geschenk Ihrer Mutter ergibt überhaupt keinen Sinn.«
»Es muss einen Zusammenhang zwischen dem Gemälde und irgendetwas anderem, das ihr wichtig war, geben. Meinen Sie nicht? Sind Sie denn gar nicht neugierig?«
Gratz fühlte sich plötzlich entsetzlich müde. Er legte fünf Euro auf den Tisch und stand auf.
»Miss Aurel, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Und ich weiß es zu schätzen, dass Sie meinetwegen so viel Zeit geopfert haben. Trotzdem wäre es sinnlos, diese Begegnung noch weiter in die Länge zu ziehen.«
»Sie können jetzt nicht gehen! Wir müssen das erst klären!«
»Leben Sie wohl, Miss Aurel.«
Gratz ließ die junge Frau am Tisch zurück, nickte dem Besitzer des Cafés zu, der an der Theke stand und in der Le Monde las, und trat auf die Straße hinaus. Auf dem Boulevard de Corcelles blieb er einen Moment lang unschlüssig stehen. Der Schmerz, den er seit dreißig Jahren mit sich herumtrug, bohrte noch immer in ihm. Er hatte genug Zeit in seinem Luftreich des Traums vergeudet. Vielleicht war nun der Punkt gekommen, endlich nach vorn zu blicken.
Sofern das Schicksal es zuließ.
»Herr Gratz«, ertönte Helens Stimme vom Eingang des Cafés, »bitte, warten Sie einen Augenblick.«
Sie kam ihm nach und drückte ihm den Umschlag in die Hand. »Hier, nehmen Sie. Ich bin noch zwei Tage in Paris. Ich wohne im Hotel Bristol. Die Nummer habe ich auf den Umschlag geschrieben. Falls Sie Ihre Meinung ändern, wäre es schön, wenn Sie mich anriefen.«
Es regnete jetzt heftiger. Siegfried Gratz nahm den Umschlag und nickte. Dann zog er seine Jacke enger um sich und eilte, mit gegen die Kälte vorgeneigtem Körper, auf die Metro-Station zu. Helen sah ihm nach. Sekundenlang verspürte sie einen Anflug von Mitleid, der jedoch rasch verflog. Sie wartete, bis Gratz aus ihrem Blickfeld verschwunden war, dann zog sie ihr Handy aus der Tasche.
Kapitel 2
Florenz
1530
Der Blick des Göttlichen wanderte über Antonio Minis nackten Körper. Wie herrlich gebaut der Junge war. Im flackernden Kerzenlicht seines Ateliers verharrten die Augen des Künstlers auf seinem Modell. Seine Hand umriss die Konturen des Körpers geschickt auf dem vor ihm liegenden Blatt Papier. Doch es frustrierte ihn, dass es ihm nicht gelingen wollte, die Schönheit, die er wahrnahm, wirklich auf das Blatt zu bannen. Auch wenn dies nur eine vorbereitende Skizze war. Vielleicht würden die leuchtenden Temperafarben auf dem späteren Tafelbild dem Objekt gerechter werden.
Wie sehr Minis herrliche, ja göttliche Statur sich doch von seiner eigenen Erscheinung unterschied. Diese glich mit den Jahren immer mehr der eines knorrigen Baumes, seine Lippen waren schmal und blass, die Nase krumm – eine Erinnerung an den Angriff des halbstarken Torrigiano de Torrigianis Jahre zuvor – und die Stirn von den Furchen unermüdlichen Schaffens gezeichnet.
Der Göttliche beobachtete, wie die Kerzen langsam herunterbrannten und mit fortschreitender Zeit immer mehr Wachstränen an den Stümpfen herabrannen. Er fragte sich, wie lange Mini wohl noch in seinem Dienst bleiben, wie oft sie einander noch lieben würden.
Kapitel 3
Hotel Bristol, Paris
7. Oktober 2006
Helen Aurel saß in einem teuren schwarzen Chanelkleid, das einen Teil ihrer Schultern freigab, im Hotel Bristol und nahm allein ihr Abendessen ein. Es war keine Situation, an die sie gewöhnt war, und entsprechend war ihre Stimmung. Ihre Mission in Paris war offensichtlich missglückt, und sie beabsichtigte, schon am nächsten Morgen nach London zurückzureisen. Im Augenblick zog sie jedoch die hungrigen Augen der Männer und die neidischen Blicke der anwesenden Damen auf sich. Sie war zutiefst enttäuscht von den Ereignissen dieses Nachmittags und tröstete sich mit einem Glas schwerem Burgunder und einem köstlichen Kalbfleischgericht. Das Ganze wurde begleitet von den Klängen eines Pianospielers, der sich versiert durch ein Stück arbeitete, das Helen als eines von Erik Satie erkannte.
»Miss Aurel.«
Siegfried Gratz stand an ihrem Tisch.
»Herr Gratz, das ist aber eine erfreuliche Überraschung.«
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze?«
»Überhaupt nicht.«
Gratz nahm ihr gegenüber Platz. »Tut mir leid, wenn ich Sie störe. Aber unsere Begegnung heute Nachmittag ist mir nicht aus dem Kopf gegangen.«
»Mir tut es leid, dass ich Sie so aus der Fassung gebracht habe.«
»Ich bin nun mal ein alter Narr, der sich leicht aus der Ruhe bringen lässt. Jedenfalls habe ich noch mal über die Angelegenheit nachgedacht und meine Meinung geändert.«
»Lassen Sie hören.«
»Aus welchem Grund auch immer war Ihrer Mutter offenbar daran gelegen, dass wir beide uns begegnen. Und ebenso offenbar wollte sie, dass wir dieses sonderbare Rätsel gemeinsam lösen. Die Möglichkeit, die Leda zu finden, ist, wenn man es genau betrachtet, zu verlockend, um sie einfach zu verwerfen. Ich habe mir dieses Material noch einmal genauer angesehen, und ich glaube, dass sie uns so etwas wie einen Anhaltspunkt gegeben hat.«
»Der da wäre?«
»Ich habe heute Nachmittag den Abschnitt gelesen, den Ihre Mutter in Vasaris Leben der hervorragendsten Künstler unterstrichen hat. Außerdem habe ich meine Erinnerung an die Geschichte der Leda mithilfe des Internetanschlusses im Hotel ein wenig aufgefrischt. Darin findet sich ein Ort, an dem wir unserer Suche vielleicht beginnen können.«
Gratz verschwieg ihr, dass er auf dem Balkon seines Hotels in einer belebten Seitenstraße des Montmartre gestanden und einen Moment lang wahrhaftig erwogen hatte hinabzuspringen, in dem absurden Bedürfnis, zu spüren, wie sein Kopf auf dem harten Pflaster zerschellte. Er erzählte ihr auch nichts von dem Schmerz, der unablässig in ihm bohrte, oder dass er bezweifelte, das letzte Band, das ihn noch mit seiner verlorenen Liebe verknüpfte, einfach so lösen zu können. Und vor allem verschwieg er ihr, dass er im Begriff war, die Leere in seinem Inneren, die bis dahin von Elizabeth Weir ausgefüllt worden war, nun durch das Bild Helen Aurels zu ersetzen.
»Aber sagten Sie nicht heute Nachmittag, eine solche Suche sei aussichtslos?«
»Ihre Mutter hat eine Kette von Ereignissen ausgelöst. Ich finde, wir sollten uns ihrem Willen fügen. Es wird mir guttun, eine Beschäftigung zu haben. Und Ihnen möglicherweise ebenfalls. So sehe ich die Sache jedenfalls.
Michelangelo wurde 1530 durch einen gewissen Alfonso d’Este, dem Herzog von Ferrara, mit der Anfertigung des Leda-Gemäldes beauftragt. Ferrara war ein mächtiger Edelmann und bekannter Kunstsammler. Aus irgendeinem Grund missfiel dem Herzog das fertige Bild, womit der Vertrag nicht erfüllt wurde. Das Gemälde gelangte also nie in seinen Besitz.«
»Das ist ungewöhnlich.«
»Allerdings. Michelangelo war zu diesem Zeitpunkt fünfundfünfzig, was man im 16. Jahrhundert durchaus schon als alt bezeichnen konnte. Aber er hat in diesem Alter noch immer Werke von außerordentlicher Meisterhaftigkeit geschaffen.«
»Warum mag der Herzog das Bild abgelehnt haben?«
»Das spielt für uns keine Rolle. Für uns ist mehr von Belang, was danach geschah. Ihre Mutter hat den betreffenden Abschnitt unterstrichen. Ich lese ihn Ihnen vor.« Gratz schlug behutsam Elizabeth Weirs Ausgabe des Vasaris auf und fuhr wie ein eifriger Schüler mit dem Finger die Zeilen entlang. »›Antonio Mini, Michelangelos Schüler, der zwei Schwestern hatte, die in Kürze heiraten sollten, bat den Meister, ihm das Bild zu überlassen. Dieser kam der Bitte willig nach und gab es ihm, zusammen mit einem Großteil seiner übrigen Zeichnungen und Skizzen und zwei Büsten. Als Mini nach Frankreich ging, nahm er die Werke mit sich.‹«
»Nach Frankreich?« Helen Aurel strich mit dem Finger nachdenklich den Rand ihres Glases entlang. »Bemerkenswert, dass meine Mutter unsere Begegnung ausgerechnet in Frankreich arrangiert hat.«
»Allerdings. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist.«
»Wo sollen wir also mit der Suche anfangen? Frankreich ist groß.«
»Vasari bietet uns einen Anhaltspunkt.« Gratz blickte wieder auf den Text. »›Das Gemälde verkaufte er an König Franz, die Zeichnungen und Skizzen jedoch gingen verloren, da Mini kurz darauf starb und sie gestohlen wurden.‹«
»An König Franz?«
»Franz I. Hier hat Ihre Mutter eine Bemerkung an den Rand geschrieben: ›Dies wird durch die Biografie Condivis untermauerte.‹«
»Ich habe ein wenig Schwierigkeiten, Ihnen zu folgen, Herr Gratz. Wer ist Condivi?«
»Ein anderer zeitgenössischer Biograf Michelangelo Buonarrotis. Wenn König Franz die Leda von Antonio Mini erwarb, ist sie höchstwahrscheinlich in Fontainebleau. Dort hat der König seine wertvolle Kunstsammlung aufbewahrt.«
»Fontainebleau ist nicht weit von Paris.«
»Nein. Ich wäre bereit, dieser Spur nachzugehen, wenn Sie mich begleiten.«
Helen Aurel musterte Gratz eindringlich. Die Farbe seiner Augen war von einer sonderbaren Nuance aus Grün und Blau. Ein leichter deutscher Akzent schwang in seinem ansonsten sehr gewählten Englisch mit, was seiner Stimme ein gewisses Etwas verlieh, ähnlich einem Schuss Whisky in einem Glas Sodawasser. Sie fragte sich sekundenlang, ob ihre Mutter ihn wohl geliebt hatte. Welcher Natur die Beziehung der beiden gewesen war. Was für eine Wirkung musste sie auf diesen Mann ausgeübt haben, dass seine Liebe zu ihr ihn auch nach dreißig Jahren der Trennung noch immer gefangen hielt. Sie erkannte den Kummer hinter dem intelligenten Blick dieser sonderbaren Augen, es war ein Ausdruck, der sich oft in ihren eigenen Augen spiegelte. Ihr Entschluss war gefasst.
»Also gut, Herr Gratz. Darf ich Sie zu einem Drink einladen, um auf unsere Partnerschaft anzustoßen?«
Siegfried lächelte zustimmend, und Helen gab einem vorbeigehenden Kellner ein Zeichen. Er würde der Laune Elizabeth Weirs nachgeben und abwarten, wohin diese Reise ihn führte.
Kapitel 4
Spitalfields, London
8. Oktober 2006
Aiden Duffy wurde durch den Polizeikordon geführt, der den Eingang zum Providence Row Refuge versperrte. Das imposante Gebäude, eine zweckgebundene Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert, ragte beeindruckend vor ihm auf.
»Wer ist der verantwortliche Einsatzleiter?«, fragte er den uniformierten Polizisten, der ihn begleitete.
»Detective Inspector Maguire.«
»Und wie ist er so?«
»Er ist eine Frau.«
Duffy nickte, sich seiner vorschnellen Schlussfolgerung bewusst.
Ein provisorisches Zelt aus weißen Plastikplanen war von den Tatortbeamten am Eingang des Gebäudes errichtet worden. Duffy wurde hineingeführt und sofort mit einem der sterilen Schutzanzüge ausgestattet, die für den Zutritt zum Tatort eines Mordes Vorschrift sind. Ein Beamter lotste ihn durch die Absperrungen. Die Räumlichkeiten befanden sich im Zustand völliger Verwahrlosung. Wasser hatte sich in den Korridoren gesammelt, und von den Decken hing geborstenes Holz herab. Das ganze Gebäude war dem Verfall überlassen.
DI Lucy Maguire erwartete Duffy an einem chaotisch anmutenden Ort, der vermutlich einmal das Erdgeschoss eines Treppenhauses gewesen war.
»Mr Duffy?«
»Richtig. Schön, Sie kennenzulernen.«
»Detective Inspector Maguire. Tut mir leid, dass ich Sie am Sonntag stören muss. Ich arbeite für das Sonderdezernat der Mordkommission Scotland Yard.«
»Aus welchem Grund wurde das Sonderdezernat hinzugezogen?«
»Weil es sich hier um einen recht ungewöhnlichen Fall handelt und wir über die notwendigen Mittel und Ressourcen für derartige Fälle verfugen.«
»Die da wären?«
»Jemand wie Sie zum Beispiel.«
Ihre Unverblümtheit gefiel Duffy. Zumindest im Augenblick.
»Möchten Sie mir erklären, worum es geht?«
»Gehen wir ein Stück, während ich Sie auf den Stand der Dinge bringe.« Maguire führte Duffy durch einen düsteren, muffigen Flur zum Tatort. »In den letzten zehn Wochen wurden zwei Frauen aus ihren jeweiligen Wohnungen in Außenbezirken Londons entführt. Beide wurden ermordet und ihre Leichen in verfallenen Gebäuden zurückgelassen.«
»Wo wurde die erste Leiche gefunden?«
»Bethnal Green. Zehn Autominuten von hier. Die Frauen wurden jeweils sechsunddreißig Tage nach ihrem Verschwinden gefunden.«
»Sechsunddreißig Tage? Ist das Zufall?«
»Sie sind der Forensikspezialist. Sagen Sie’s mir.«
»Keine Ahnung.«
»Beide Opfer waren Mitte zwanzig. Die erste wurde erstickt. Die Todesursache des zweiten Opfers haben wir noch nicht ermittelt, aber es gibt keine sichtbaren Verletzungen an ihrem Körper.«
Vor ihnen lag die Leiche von Carolyn Cooper. Ihr Körper war nackt, sie war mit dem Rücken gegen eine feuchte Steinmauer gelehnt worden. Ein Gefühl der Niedergeschlagenheit stieg in Duffy auf.
»Und aus welchem Grund haben Sie mich hinzugezogen?«
»Es gibt da ein paar ungewöhnliche Aspekte.«
»Zum Beispiel?«
»Werfen Sie mal einen Blick auf die Wand.«
Duffy tat, wie ihm geheißen. Erst jetzt bemerkte er das Zeichen, das jemand einen knappen Meter über der starr blickenden Toten an die Wand gemalt hatte.
»Lassen Sie mich raten«, sagte Duffy. »Sie haben das gleiche Zeichen auch an dem anderen Tatort gefunden.«
»So ist es.« Maguire fiel auf, dass Duffy etwas Goldenes in der rechten Hand hielt, das er sachte zwischen den Fingern hin und her rollte. Es schien ihm zu helfen, sich zu konzentrieren. Es irritierte sie, dass sie nicht erkennen konnte, was es war. Vielleicht ein kleines Schmuckstück? Für einen Sekundenbruchteil glaubte sie, die Glieder eines Goldkettchens zu erkennen.
Duffy nickte. »Ich brauche ein wenig Zeit, um mich hier bei der Leiche umzusehen, und ich brauche Kopien aller Unterlagen, sobald Sie fertig sind. Außerdem benötige ich die Unterlagen und Tatortfotos des vorangegangenen Falles.«
»Das wird kein Problem sein.«
»Dann wird es mir ein Vergnügen sein, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Inspector Maguire.«
Duffy blickte zu dem sonderbaren Zeichen an der Wand über dem Opfer.
»Wissen Sie, was es bedeutet?«, fragte Maguire. »Vielleicht ein okkultes Symbol?«
»Es heißt, Symbole seien unser Eingangstor zum kollektiven Gedächtnis der Natur, Inspector. Es könnte alles Mögliche bedeuten. Allerdings glaube ich nicht, dass wir es hier mit einem bloßen Symbol zu tun haben.«
»Was dann?«
Duffy sah sie an und genoss ihre Verunsicherung. Sie hatte rotes, zu einem rigorosen Kurzhaarschnitt gestutztes Haar und einnehmende, haselnussfarbene Augen.
»Ich halte es für eine Unterschrift.«
Kapitel 5
Fontainebleau
8. Oktober 2006
Helen Aurel hatte Paris mit hoher Geschwindigkeit über die A6 in Richtung Fontainebleau hinter sich gelassen. Sie fuhr ein dunkelblaues Mercedes Sportcoupe, das sie zwei Tage zuvor auf dem Flughafen Charles de Gaulles gemietet hatte.
Nun ragte der weitläufige Wald von Fontainebleau, einst das bevorzugte Jagdgebiet der Könige von Frankreich, zu beiden Seiten der Straße geschichtsträchtig neben ihnen auf, eingehüllt in den tiefliegenden Morgennebel. Gratz blickte zu den in Fontainebleau beheimateten, breitblättrigen, Früchte tragenden Mehlbeerbäumen auf. Er musste an Baryes Gemälde Schluchten von Apremont denken, das im Musee National du Louvre in Paris hing, an die tiefen Grüntöne und eigenartigen Felsformationen.
Er versuchte, die erotische Ausstrahlung von Helen Aurel zu ignorieren. Das Chateau Fontainebleau mit seinen grandiosen Gärten und Höfen, die in ihrer symbiotischen Beziehung zu Mensch und Natur so charakteristisch für die französische Architektur waren, entzückte Gratz stets aufs Neue. Wie viel sie doch der Vision Franz I. zu verdanken hatten, einem Zeitgenossen des aggressiven, ehrgeizigen Heinrich VIII. Franz I. hatte das ursprüngliche königliche Jagdschloss auf einzigartige Weise erweitert und verschönert und somit in einen spektakulären Renaissancepalast verwandelt. Laut Vasaris Michelangelo-Biografie hatte er das Original der Leda 1530 erworben und in seiner großen Galerie in Fontainebleau ausgestellt. Gratz hoffte, es werde ihnen gelingen, diese Behauptung zu bestätigen und, wenn möglich, herauszufinden, in welche Hände das Gemälde anschließend gelangt war.
Siegfried Gratz hatte sich unterwegs telefonisch mit dem Superintendenten von Fontainebleau, Nicholas Fouquet, in Verbindung gesetzt. Als leitender Kunstkritiker des Daily Telegraph und Autor zweier Bücher über die Renaissance war Gratz’ Name in der exklusiven Welt der Schönen Künste nicht unbekannt. Fouquet hatte eingewilligt, ihn zu empfangen und sich – was noch wichtiger war – bereit erklärt, Gratz Zugang zu einigen der wichtigsten Museumsarchive zu gewähren.
Nicholas Fouquet erwartete sie, wie versprochen, an der Statue des Ulysses am Cours de la Fontaine. Sein Blick war auf den großen Teich gerichtet, der an diesen Teil des Chateau angrenzte. Er trug einen makellosen grauen italienischen Designeranzug. Gratz schätzte ihn auf nicht älter als vierzig. Sein glatt anliegendes schwarzes Haar war zurückgekämmt, die forschenden Augen wurden von einem silbernen Brillengestell umrahmt.
»Monsieur Gratz, ich bin Nicholas Fouquet, der Superintendent des Chateau.« Fouquet kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. »Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ihr Buch über Dürer wurde außerordentlich positiv aufgenommen.«
»Vielen Dank, dass Sie uns empfangen, Monsieur Fouquet. Darf ich Ihnen Miss Helen Aurel vorstellen?«
»Enchante. Vergeben Sie mir meine Impertinenz, Mademoiselle Aurel«, bemerkte Fouquet galant. »Aber Sie sind überaus hinreißend.«
»Vielen Dank.«
»Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Monsieur Gratz? Ihr Anruf klang ja recht geheimnisvoll.« Fouquet bedeutete ihnen, ihm zur Galerie Franz I. zu folgen.
»Wir versuchen die Spur von Michelangelos Leda zurückzuverfolgen. Unsere ersten Nachforschungen haben uns hierher nach Fontainebleau geführt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Franz I. das Gemälde 1530 von einem Assistenten Buonarrotis erworben.«
»Das ist richtig.« Fouquet nickte. »Ich kann Ihnen selbstverständlich Dokumente zeigen, aus denen hervorgeht, dass das Gemälde in der Tat eine Zeit lang zum Bestand von Fontainebleau gehörte. Über das weitere Schicksal des Kunstwerks gibt es verschiedene Theorien. Unter anderem existieren Hinweise, die darauf schließen lassen, dass es von einem meiner Vorgänger um 1640 zerstört wurde. Ich kann Ihnen das entsprechende Quellenmaterial gern heraussuchen. Allerdings furchte ich, jedwede Schlussfolgerungen, zu denen Sie möglicherweise kommen, werden pure Mutmaßung bleiben. Die Wahrheit ist, dass niemand eine eindeutige Vorstellung davon hat, was aus dem Bild geworden ist.«
»Wie können derartige Werke so einfach verschwinden?«, fragte Helen Aurel.
»Wer vermag das schon zu sagen?«, erwiderte Fouquet. »Michelangelos Statue des Herkules stand einst in genau diesem Hof, in dem wir uns gerade befinden. Auch sie ist für die Nachwelt verloren gegangen.«
Fouquet führte sie jetzt in die atemberaubende Galerie Franz I. Helen Aurel bestaunte die beeindruckenden, in Stuck gerahmten Fresken.
»Das ist wunderschön«, stieß sie hervor.
»Das hier war die erste, in großem Stil ausgestattete Galerie Frankreichs. Der größte Teil der dekorativen Arbeiten, die Sie hier sehen, wurde von Rosso Fiorentino angefertigt, einem Zeitgenossen Michelangelos, auch II Rosso genannt. Er schenkte diesem Teil Frankreichs damit unbestritten eine Atmosphäre italienischer Renaissance. Was auch der politischen Intention Franz I. entsprach.«
Angesichts der eleganten Aufmachung Fouquets mutmaßte Gratz, dass dieser sich den italienischen Stil ebenso zu eigen zu machen versuchte wie Franz I.
»Welche historischen Unterlagen dürfen wir einsehen?«, erkundigte er sich.
»In der angrenzenden wissenschaftlichen Bibliothek gibt es zahlreiches Quellenmaterial, das interessant für Sie sein dürfte. Wir sind im Besitz der Unterlagen und Zeichnungen von Fiorentino persönlich und denen seines Nachfolgers Primataccio. Dann gibt es noch Dokumente, die sich auf die Regentschaft Franz I. beziehen: Fragmente seiner Staatsunterlagen, Abrechnungen und dergleichen. Ich werde sie Ihnen bringen. Außerdem verfügen wir über eine ansehnliche Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten über diese Epoche. Sofern Sie mit dem Originalquellenmaterial arbeiten möchten, muss ich Sie natürlich ersuchen, die Seidenhandschuhe anzuziehen, die ich bereitgelegt habe. Diese Dokumente sind äußerst fragil.«
Fouquet führte sie aus der Galerie in einen angrenzenden Korridor, der im Vergleich zu dem Raum, den sie soeben verlassen hatten, düster und schmucklos wirkte. Er öffnete eine Tür mit der in Goldlettern angebrachten Aufschrift BIBLIOTHÈQUE DE SCHOLAR. Der Raum war klein, aber hervorragend ausgestattet. In der Mitte stand ein schwerer Holztisch mit zwei prunkvollen Tischlampen. An den Wänden reihten sich Hunderte Bücher und historische Magazine in französischer, italienischer oder englischer Sprache. Fouquet verließ den Raum, um das versprochene Material aus dem Archiv zu holen. Helen Aurel betrachtete die immense Zahl wissenschaftlicher Werke um sich herum.
»Wo sollen wir anfangen?«
»Wie sieht’s mit Ihrem Französisch aus?«, erkundigte sich Gratz, der bereits Bücher aus den Regalen zog.
»Ganz gut. Mein Italienisch ist fast perfekt.«
»Dann nehmen Sie sich zuerst die italienischen Geschichtswerke vor. Konzentrieren Sie sich auf die Regierungszeit Franz I., also 1515-1547. Versuchen Sie, irgendwelche Hinweise auf das Leda-Gemälde zu finden. Notieren Sie alles, was von Bedeutung sein könnte.«
Gratz begann sich durch einige französische Texte zu arbeiten. Er überflog die relevanten Abschnitte des Catalogue des actes de Francois Ier und die Chronique du Roi Francois Ier. Beides waren Ausgaben aus dem 19. Jahrhundert und in außerordentlich gutem Zustand, aber sie förderten nichts zutage.
Eine Stunde verging in schweigender Lektüre. Dann unterbrach Helen die Stille. »Ich habe etwas gefunden, ein Abschnitt in Condivis Leben des Michelangelo Buonarroti. Es bringt uns zwar nicht viel weiter, aber es bestätigt einen Teil dessen, was wir bereits wissen.«
»Lesen Sie vor.«
»Michelangelo gab das Bild einem seiner Assistenten, der ihn um Hilfe bat, da er zwei Schwestern hatte, die verheiratet werden mussten. Es wurde nach Frankreich gebracht, wo König Franz es erwarb und wo es sich noch heute befindet.«
»Immerhin ein Anfang.«
»Haben Sie bessere Fortschritte gemacht?«
»Eigentlich nicht. Es gibt eine Menge Material über Rosso Fiorentino. Verständlicherweise, angesichts der Länge seines Aufenthaltes hier. Allerdings habe ich noch nichts über die Leda finden können. Das Ganze scheint mir ein ziemlich Zeit raubendes Unterfangen zu werden.«
Die Tür öffnete sich, und Fouquet kehrte mit zwei Assistenten zurück. Diese legten zwei ledergebundene Mappen auf den Tisch, die mit einem schwarzen Band zusammengehalten wurden.
»Wir haben hier eine Reihe von Unterlagen, die von Interesse für Sie sein dürften. In der ersten Mappe befinden sich die Vermögensaufzeichnungen von Fiorentino, der von 15 2 9 bis zu seinem frühen Tod 1540 hier in Fontainebleau gelebt hat. Die zweite Mappe enthält einige Staatspapiere Franz I. Wir besitzen nicht viel Material des Königs. Die meisten Schriftstücke werden woanders aufbewahrt. Aber es ist ein Dokument darunter, das Sie vermutlich freuen wird.«
Fouquet streifte ein Paar Seidenhandschuhe über und zog einen Ordner mit einer Reihe handgeschriebener Dokumente aus einer der Mappen. »Das Material des Königs, das sich noch in unserem Besitz befindet, bezieht sich überwiegend auf die Sammlung der Kunstwerke.«
Fouquet legte eine der Seiten behutsam vor Helen und Gratz auf den Tisch; beide waren neben ihn getreten. »Der Text ist ziemlich verblasst, aber es handelt sich um einen Abschnitt aus der königlichen Buchführung vom Dezember 1530. Darin ist die Auszahlung von hundert Golddukaten an Antonio Mini vermerkt. Wie Sie sicher wissen, war Mini von 1523 bis 1530 Michelangelos Schüler. Dies ist der einzige schriftliche Beleg in unserem Besitz, der bestätigt, dass König Franz die Leda erworben hat. Es war in jedem Fall hier.«
»Aber was ist damit geschehen?«, fragte Helen. »Wenn es definitiv hier war, muss es doch irgendeinen Eintrag über seinen Verbleib geben?«
»Wir wissen, dass das Gemälde mehrfach von II Rosso kopiert wurde. Einige seiner vorbereitenden Zeichnungen befinden sich in der anderen Mappe. Das Original ist jedoch verschwunden. In einigen Quellen, einschließlich Mariettes Abcedario-Fibel von 1746, gibt es Hinweise, dass das Gemälde verbrannt wurde.«
»Verbrannt?«, fragte Helen Aurel entgeistert. »Wer verbrennt denn einen Michelangelo?«
»Mariette behauptet, die Original-Leda sei von einem meiner Vorgänger vernichtet worden – einem Mann namens Des Noyers – der von 1638 bis 1643 hier tätig war.«
»Warum?«, fragte Helen.
»Angeblich wurde das Gemälde aufgrund seines sexuellen Inhalts vernichtet, der die Gefühle der Königin verletzte. Allerdings sollte ich hinzufügen, dass Mariette diese Behauptung an anderer Stelle widerlegt, indem er anführt, Des Noyers habe eine Kopie Rosso Fiorentinos vernichtet und nicht das Original. Er äußert auch Vermutungen, das Original könnte in England gelandet sein. Bedauerlichweise macht er keine Angaben, wo in England.«
Gratz hatte den Eindruck, dass die Geschichte immer verworrener wurde. »Es gibt eine Kopie von Il Rosso in der National Gallery in London«, bemerkte er, »Sie sagen jetzt, eine seiner Kopien sei hier verbrannt worden. Aus welchem Grund sollte Rosso Fiorentino dieses Bild gleich mehrfach kopiert haben?«
Fouquet trat zu der zweiten Mappe und öffnete sie behutsam. »Wie Sie hier sehen können, hat II Rosso eine Reihe von Skizzen angefertigt, die eindeutig auf der Leda basieren.« Vorsichtig legte er drei Beispiele auf den Tisch. »Vielleicht hat ihn das Gemälde inspiriert. Vielleicht hatte er auch nur kommerzielle Gründe: Meine persönliche Theorie geht dahin, dass Il Rosso eine Art obsessive Bewunderung für Michelangelo hegte. Das wird durch seine eigenen Aufzeichnungen belegt. Die Florentiner Künstler, die sich gegen einen Zeitgenossen wie Michelangelo Buonarroti behaupten mussten, dürften es nicht leicht gehabt haben.«
»Gibt es einen Beweis, dass II Rosso Antonio Mini begegnete, als er nach Fontainebleau kam?«
»Meines Wissens nach nicht. Angesichts des Zeitraums und der Tatsache, dass II Rosso Florentiner und ein Verehrer Michelangelos war, ist es allerdings schwer vorstellbar, dass er nicht mit dessen Schüler zusammentraf, als er 1530 hier ankam.«
»Was meinen Sie dazu, Herr Gratz?«, fragte Helen.
»Vielleicht hat Rosso Fiorentino die Leda kopiert und diese Zeichnungen angefertigt, weil ihm das Thema gefiel. Wie bekannt ist, ließ Michelangelo seine männlichen Gehilfen für seine Arbeiten Modell stehen, selbst für weibliche Gestalten. Es gibt Vermutungen, dass Mini das Modell für die Leda gewesen ist.«
»II Rosso unterhielt zweifellos sexuelle Beziehungen zu diversen Männern«, bemerkte Fouquet. »Böse Zungen behaupten, dies habe letztlich zu seinem Selbstmord geführt.«
»Wenn das stimmt und Rosso Fiorentino, wie Sie behaupten, eine Art obsessive Verehrung für Michelangelo hegte, wäre es denkbar, dass er sich auch von Mini angezogen fühlte.«
»Durchaus möglich, allerdings sehe ich nicht, inwiefern Sie das weiterbringt.«
Der Einwand leuchtete Gratz ein. So interessant diese Möglichkeit war, brachte sie sie bei ihren Nachforschungen vermutlich nicht weiter.
Zwei Stunden später lehnte Gratz, erschöpft von seinen intensiven Recherchen, an der Balustrade, die den Cours de la Fontaine von der trapezförmig angelegten Wasserfläche trennte, an der sie vor dem Betreten der Galerie Franz I. zusammen mit Fouquet vorbeigegangen waren. Er nahm einen Zug von seiner Zigarette und inhalierte tief, wobei er den starken Tabak ebenso genoss wie die Aussicht. Kurz darauf trat Helen neben ihn.
»Sie wirken nicht besonders glücklich«, bemerkte sie.
»Ich bin frustriert«, erwiderte Gratz. »Diese Angelegenheit entwickelt sich genau, wie ich befürchtet habe. Die Spur ist kalt. Oder, um es genauer auszudrücken: Es gibt gar keine Spur.«
Helen Aurel ließ ihren Blick über das Wasser gleiten, auf dessen Oberfläche sich die dahinziehenden Wolken spiegelten. »Fouquet hat mir eine unterhaltsame Geschichte erzählt, nachdem Sie die Bibliothek verlassen hatten. Er sagte, König Heinrich V. von Schottland habe seine zukünftige Frau zum ersten Mal gesehen, als sie nackt in diesem Wasser badete. Sie bemerkte seine Anwesenheit nicht, aber er war sofort bezaubert von ihr.«
»Fouquet versucht Sie mit seinem Wissen nebensächlicher Begebenheiten zu beeindrucken«, schnaubte Gratz verächtlich.
»Aber vielleicht lasse ich mich gar nicht beeindrucken.«
»Warum haben Sie es dann erwähnt?«
»Es erinnerte mich an die Legende des Zeus, der auf die Erde herabsteigt, um Leda zu verfuhren. Und ich fand die Vorstellung romantisch. Kommt Romantik in unserem Leben nicht viel zu kurz? Heutzutage dreht sich alles um Hypotheken und Energiepreise. Finden Sie nicht, wir sollten im Namen der Romantik weitermachen? Kommen Sie schon, immerhin hat Nietzsche behauptet, die Deutschen seien großer Taten fähig.«
»Er sagte aber auch, sie würden sie vermutlich niemals vollbringen.«
»Seinen Sie nicht so ein Langweiler. Kommen Sie, begleiten Sie mich auf einem Spaziergang durch diese großartigen Gärten. Und erzählen Sie mir, wieso die Beziehung zwischen II Rosso und Mini wichtig sein könnte.«
Und so kam es, dass Gratz, dreißig Jahre nachdem er sich mit gebrochenem Herzen von Elizabeth Weir verabschiedet hatte, befangen Arm in Arm mit ihrer Tochter durch die Gärten von Fontainebleau spazierte. Er hatte keine Ahnung, wohin diese Geschichte ihn führen würde, aber er spürte, dass die Leere in seinem Inneren zunehmend durch die Person Helen Aurel ausgefüllt wurde.
Kapitel 6
Florenz
1530
Alfonso d’Este, der Herzog von Ferrara, trat durch den steinernen Bogen in die Künstlerwerkstatt. Trotz seines fortgeschrittenen Alters durfte sich der Veteran der Belagerung von Bologna und der Schlacht von Ravenna noch immer einer beeindruckenden körperlichen Statur rühmen. Er war mit einem prächtigen tiefroten Umhang mit Samtapplikationen und kostspieligem, schwarzem Pelzbesatz bekleidet. Um den Hals trug er seine schwere goldene Amtskette. An seiner Hüfte baumelte das Schwert, das seine Männer der Hand des toten Gaston de Foix entnommen hatten, nachdem dieser auf dem Schlachtfeld von Ravenna gefallen war.
»Der Göttliche lehnt es ab, mich persönlich zu empfangen?«, fragte er, verärgert über diesen Affront.
Antonio Mini, Michelangelos Schüler, bemühte sich, den Unwillen des Herzogs zu zerstreuen.
»Der Meister wird in Kürze eintreffen.« Minis Haar war von einem solchen Tiefbraun, dass es im schattigen Eingang der Werkstatt nahezu schwarz wirkte. »Er entschuldigt sich dafür, Euch warten lassen zu müssen.«
»Er hat bereits meinen Stellvertreter Paulo d’Agostini vor den Kopf gestoßen. D’Agostini ist ein Mann, dessen Urteil ich schätze, und er teilte mir mit, das Bild, das ich in Auftrag gegeben habe, sei ein minderwertiges Werk und meiner Sammlung nicht würdig. Ich bin hier, um mich von der Richtigkeit dieser Behauptung zu überzeugen. Was ist das für ein widerwärtiger Geruch?« Der Herzog verzog angewidert das Gesicht.
»Wir arbeiten hier mit zahlreichen unterschiedlichen Substanzen, Eure Exzellenz. Wir selbst nehmen diese Gerüche kaum noch war, so sehr sind wir in unsere Arbeit vertieft. Ich bedaure, wenn es Ihnen Unbehagen bereitet.«
Alfonso d’Este begutachtete Minis Antlitz. Er verstand, wieso Buonarroti eine Vorliebe für diesen Burschen hegte, und fand die Vorstellung gleichzeitig widerwärtig.
»Wie ich höre, seid Ihr jetzt Buonarrotis Günstling«, bemerkte der Herzog. »Dieser Mann ist unersättlich. Sagt, findet Ihr sein Alter und seine Erscheinung nicht abstoßend? Sein Arm mag noch stark sein, aber gebt Acht, dass Ihr dem größten Künstler der Stadt Florenz nicht die Inspiration heraussaugt.«
Mini zögerte. »Ich werde meinen Meister darüber informieren, dass Ihr eingetroffen seid.«
Der Göttliche stand schweigend im angrenzenden Raum. Das hereinfallende Licht umhüllte den mächtigen Marmorklotz, der vor ihm stand. Sein mit unermüdlicher Schaffenskraft erfülltes Genie nahm den großen Stein in sich auf, betastete ihn, erfühlte seine Strukturen und schälte in Gedanken bereits die Schönheit aus dem groben, formlosen Fels heraus. Mochte die körperliche Stärke den großen Bildhauer auch allmählich verlassen, so war seine Vorstellungskraft doch brillant und rege wie ehedem. Der Göttliche sah die Gestalt eines Mannes aus dem Marmorblock entstehen: den Kopf leicht zur rechten Schulter geneigt, um die Muskulatur von Brustkorb und Bauchpartie zu betonen; das rechte Bein leicht angewinkelt über das Linke gekreuzt, sodass die Genitalien, die das Zentrum der Skulptur bildeten, wie eingerahmt wirkten. Die Marmorskulptur sollte Bestandteil des Grabmonuments von Papst Julius werden.
»Meister?«
Buonarroti zuckte zusammen, als er aus seinen Gedanken herausgerissen wurde.
»Ich arbeite.«
»Der Herzog ist eingetroffen. Er erwartet Euch.«
Die gefälligen Züge und die lässige Haltung der halb liegenden Männergestalt seiner Vorstellung verwandelten sich in leblosen Marmor zurück. Der Moment war dahin. Michelangelo wandte sich Mini zu, dessen Schönheit ihm unvergänglich schien.
»Bringen wir es hinter uns.«
»Er wirkt nicht besonders heiter.«
»Das ist nicht mein Problem. Übrigens ist meine Laune ebenso düster. Ich verwahre mich dagegen, als Objekt der Diplomatie missbraucht zu werden.«
Buonarroti berührte Minis Gesicht und ertastete die ausgeprägte Linie des Kinns bis zum Haaransatz.
»Deine Schönheit nimmt mich immer wieder gefangen«, sagte er sanft. »Aber du solltest jung sterben. Das Alter würde solche Perfektion nur entstellen.«
»Ihr schmeichelt mir.«
»Und was ist deine Meinung, Antonio? Findest du es angemessen, dass meine Kunst für die politischen Absichten der Medicis missbraucht werden soll?«
»Es heißt, der Herzog besitze eine einzigartige Sammlung in Ferrara. Er ist ein Bewunderer Eurer Arbeit. Es wäre ein angemessener Ort, Eure Kunst dort auszustellen.«
»Warten wir ab, was der große Mann von seinem Auftrag hält.«