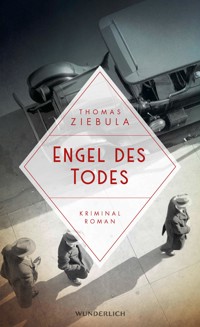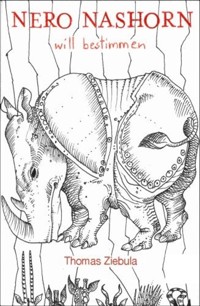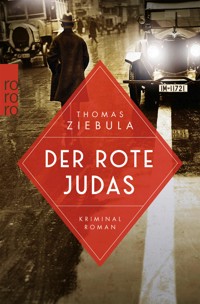
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Paul Stainer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
LEIPZIG,1920: DER KRIEG IST VORBEI, DAS TÖTEN IST ES NICHT… Inspektor Paul Stainer kehrt schwer traumatisiert aus der Kriegsgefangenschaft zurück – und wird gleich mit einer rätselhaften Mordserie konfrontiert: ein Gymnasiallehrer, in seiner eigenen Wohnung überfallen. Zwei Männer, bei einem vermeintlichen Einbruch in einer Villa erschossen. Mit den Ermittlungen betraut, geraten Stainer und sein Kollege Junghans auf die Spur der «Operation Judas», und bald stellt sich heraus: Die Opfer verbindet ein grauenhaftes Geheimnis – ein Geheimnis, das auch Stainer in Gefahr bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Ähnliche
Thomas Ziebula
Der rote Judas
Kriminalroman
Über dieses Buch
Leipzig, Januar 1920. Der Polizist Paul Stainer kehrt aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Deutschland taumelt durch die Nachkriegswirren, nichts ist mehr so, wie es einmal war, und in viel zu vielen Nächten wird Stainer vom Grauen der Schützengräben eingeholt. Doch ein aufsehenerregender Fall zwingt den Kriminalinspektor, sich mit der Gegenwart zu befassen: In der Villa eines Fabrikanten werden mehrere Menschen erschossen. Alles sieht nach einem missglückten Einbruch aus, doch eine verängstigte Zeugin und ein Koffer voller Dokumente führen Stainer bald auf die Spur der «Operation Judas», Männer, die über Leichen gehen, um ihre Verbrechen zu vertuschen. Was der Inspektor nicht ahnt: Die Mörder haben ihn längst ins Visier genommen und planen seinen Tod.
Vita
Thomas Ziebula ist freier Autor und schreibt vor allem Fantasy- und historische Romane. 2001 erhielt er den Deutschen Phantastik Preis. «Der rote Judas» ist sein erster Kriminalroman und vereint auf beeindruckende Weise Thomas Ziebulas Leidenschaft für deutsche Zeitgeschichte und spannende Kriminalfälle. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Karlsruhe.
Für Norbert Mierswa
Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.
Rainer Maria Rilke
Prolog
Manchmal, wenn er besonders heftig in die Tasten hieb, klang das Tackern der Schreibmaschine wie das Gehämmer eines Maschinengewehrs. Dann bebte der Tisch, dann zitterte das Weinglas, und von der qualmenden Zigarette im Ascher brach der Aschenkegel ab. Und ganz nah bei ihm war dann das, was er sich von der Seele zu schreiben versuchte, so nahe, dass er zu zittern begann. Stürz jetzt bloß nicht ab, Heinrich, dachte er in solchen Momenten, verwechsle bloß nicht wieder damals mit heute.
Er schrieb weiter, immer weiter, denn Erinnerungen bedrängten ihn – Stimmen, Gesichter und Gesten. Böse alte Bilder huschten vor seinem inneren Auge vorbei, so böse manchmal, dass er den Atem anhielt und seine gespreizten Finger sekundenlang über der Maschine verharrten. Er lauschte Schreien und Schüssen, sah Grimassen und Blut – und musste seine Finger in die Tasten zwingen, damit sie das Böse weiter in die Maschine hämmerten und auf Papier bannten.
So ging das seit Stunden.
Dicht über dem Tisch flackerte die Glühbirne, neben der Schreibmaschine brannten die Kerzen herunter, der Aschenbecher quoll über, die Weinflasche leerte sich, und vor den Fenstern graute der neue Morgen über den Dächern Berlins.
Schließlich stiegen ihm Bilder ins Bewusstsein, die seinem Willen widerstanden, sie in Worte und Sätze zu verwandeln. Diese Bilder wollten sich nicht aufs Papier bannen lassen, sie machten seine Finger steif und seine Brust so eng, dass er kaum atmen konnte. Während ihm die Hände auf den Tisch fielen und sein Oberkörper zurück gegen die Stuhllehne sank, schloss er die Augen.
Er sah Mordlust und Gier im Gesicht eines Mannes, Verzweiflung und Hass im Gesicht einer Frau, Flehen und Todesangst im Gesicht eines Mädchens. Doch er sah nicht nur, er hörte auch: Männergebrüll, Schüsse, eine zufallende Tür und dahinter die Schreie des Mädchens. Verschiedene Gerüche krochen ihm in die Nase: Mündungsfeuer, Harn, Schweiß und Blut.
Er öffnete die Augen und atmete so schwer wie jemand, der eine große Last zu stemmen hatte. Seufzend und mit erschöpfter Geste schlug er erst nach dem Walzenhebel und tastete dann nach der Zigarettenschachtel. An der Glut der heruntergebrannten Kippe entzündete er die nächste Zigarette.
Tief inhalierte er den Rauch und blies ihn gegen die Glühbirne. Vor seinen Fenstern sickerte die erste, noch fahle Morgenröte in den Nachthimmel. Er trank einen Schluck Wein, rauchte und wartete, bis seine Erregung sich ein wenig legte.
«Weiter», flüsterte er, «du wirst es niederschreiben, du musst. Du hörst erst auf, wenn du alles erzählt hast, alles. Los, Heinrich, weiter!» Und dann beugte er sich so tief über die Schreibmaschine, als wollte er die Stirn hineinhauen, und seine Finger hieben, stachen und hämmerten weiter in die Tasten, und alles, was er sah, hörte und roch, verwandelte sich in Sätze und Absätze und füllte Seite um Seite.
Irgendwann war das Kapitel vollbracht. Erschöpft sank er gegen die Stuhllehne und blinzelte in das helle Morgenlicht, das die Wintersonne in sein Zimmer goss. Eine Zeitlang saß er so – zusammengesunken, blinzelnd und bleich – und tat weiter nichts, als zu Atem zu kommen. Bis er sein Weinglas leer trank, die Blätter zu den anderen in seine schwarze Aktenmappe steckte – in sein Hauptarchiv, wie er sie nannte – und sich eine Zigarette anzündete. Rauchend ging er zum Fenster und schaute auf die morgendliche Straße seines Kiezes hinunter. Ein Strom von Fahrrädern, Kraftwagen, Fuhrwerken und Passanten wälzte sich unter ihm vorüber.
Später, während er in der Küche den Gasherd aufdrehte und Kaffeewasser aufsetzte, verfluchte er laut die Mörder, deren Taten er geschildert hatte, und beschimpfte den Verleger, der es abgelehnt hatte, seine Erinnerungen zu veröffentlichen.
Mit der Kaffeetasse in der Linken und einer Zigarette im Mundwinkel setzte er sich schließlich auf die Chaiselongue, griff zum Hörer des Fernsprechers und wählte die Nummer der Berliner Fernsprechzentrale. «Ein Ferngespräch nach Leipzig bitte!»
«Reichsgericht», meldete sich nach kurzem Warten eine Männerstimme. «Assessor Weingarten.»
«Heinrich Baumann hier. Stell dir vor, Hans – ich bin fast fertig.»
«Gratuliere. Ich habe schon Kontakte zu zwei Verlegern geknüpft.»
«Großartig, Hans, danke! Ich muss nur noch ein paar Sätze zu Murrmann und das Kapitel über Jagoda schreiben, und dann geht es an die Überarbeitung.» Er fühlte sich ganz leicht auf einmal, nahezu euphorisch, sodass ihm die verbleibende Arbeit und die Suche nach einem Verlag wie ein Kinderspiel erschienen. «Ich komme nach Leipzig», sagte er, «muss unbedingt mit Jagoda persönlich sprechen. Murrmann stellt den Kontakt zu ihm her. Morgen fahre ich los.»
«Sei auf der Hut, Heinrich.» Die Stimme des anderen klang jetzt ernst und besorgt. «Sie haben ihre Augen und Ohren überall. Vielleicht wissen sie längst, dass du aussagen willst, vielleicht haben sie sogar schon von deinem Manuskript gehört.»
«Gut möglich. Gestern sind mir zwei üble Burschen auf Krafträdern ins Büro gefolgt. Aber keine Sorge, Hans – ohne Revolver gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Und in Leipzig bin ich erst einmal sicher.»
Im Bahnhof Charlottenburg löste Heinrich Baumann am nächsten Tag einen Fahrschein nach Leipzig. Als ahnte er, dass er nicht zurückkehren würde, verzichtete er darauf, einen Fahrschein für die Rückfahrt zu kaufen.
IDer Heimkehrer
1
Es war Jagodas letzter Tag. Draußen regnete es, der Wind wälzte schwarze Wolkengebirge durch den Winterhimmel, und der Hospitalpark darunter sah aus wie ein alter Friedhof. Im Morgenmantel stand Jagoda am Fenster und schaute auf den Park hinunter, als die Visite das Zimmer stürmte.
Der Chefarzt erinnerte ihn an seinen Vater, schon seit er ihn nach der Einweisung in der Tobsuchtzelle untersucht hatte. Nicht weil er ihm besonders ähnlich sah, sondern weil Jagoda jedes Mal Hoffnung schöpfte, wenn der grauhaarige Aristokrat mit dem kaiserlichen Schnauzbart den Tross aus Assistenzärzten, Schwestern und Medizinstudenten hereinführte.
«Guten Abend, Herr Jagoda.» Der Arzt reichte ihm die Hand. «Ihr letzter Tag bei uns?» Jagoda ergriff sie und nickte. «Wie geht es uns denn?»
«Bestens, Herr Professor.» Der Mann im Nachbarbett grunzte und riss an seinen Gurten, auf der anderen Zimmerseite glotzte der Kerl mit den Zuckungen stumm herüber, und der mit den Krämpfen kicherte blöde.
Der Chefarzt musterte Jagoda prüfend, bevor er seine Hand freigab. «Dann wollen wir doch noch ein letztes Mal schauen.» Er legte sein Stethoskop an und bedeutete Jagoda, sich auf die Bettkante zu setzen. Die Schwester half ihm aus dem Morgenmantel, der Chefarzt hörte ihn ab. «Albträume?», fragte er hinterher, während er sich die Stethoskopbügel wieder um den Hals klemmte.
«Schon lange nicht mehr», log Jagoda.
«Sehr gut. Gucken Sie mich bitte an.» Mit einem Wattestäbchen fuhr der Chefarzt ihm von den Unterlidern aus über die Hornhäute und registrierte befriedigt den Lidreflex. Er sprach ein paar lateinische Worte zu seinem Tross, bevor er mit Finger und Hämmerchen den Mundreflex prüfte. «Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die Schule denken, Herr Gymnasialprofessor?»
«Gut. Ich freue mich auf die Arbeit.» Plötzlich krachte der Tisch gegen die Wand. Der Kicherer riss sich die Decke über den Kopf, der Grunzer schrie auf, Jagoda aber blieb ruhig. Kein Zusammenschrecken, kein unterdrückter Schrei, nicht einmal ein Zucken – er sah nur interessiert zu dem Assistenzarzt hin, der gegen das Tischbein getreten hatte. Der beobachtete ihn, alle beobachteten ihn, und der Chefarzt nickte befriedigt.
«Gestern in der Frühe hat die Elektrische direkt vor der Klinik ein Kohlefuhrwerk gerammt.» Der Chefarzt ging vor seinem Bett in die Hocke und prüfte Jagodas Knie- und Fußreflexe. «War gewaltig laut. Sind Sie sehr erschrocken?»
«Ich habe nur die Nachtigall im Klinikgarten singen gehört.»
«Nervtötend, nicht wahr?» Der Chefarzt murmelte ein paar lateinische Brocken in die Richtung seiner Gefolgschaft, erhob sich dann und schaute zu Jagodas Nachttisch, wo ein Gedichtband des Leipziger Inselverlages auf zwei Schillerdramen lag. «Oh! Wenden Sie sich jetzt unseren zeitgenössischen Dichtern zu, Herr Gymnasialprofessor?»
«Ich kann meinen Schülern ja nicht ständig mit Goethe, Klopstock und Hölderlin kommen, Herr Professor.»
Der Chefarzt griff nach dem oberen Buch. «Jetzt also Rilke», murmelte er, blätterte, las und trug schließlich einen Vers vor: «‹Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.›» Er drehte sich nach seinen Assistenten und Studenten um, die bis vor vierzehn Monaten alle noch an der Front gewesen waren. «Haben Sie das gehört, meine Herren?» Die Männer guckten nur, und das ziemlich betreten.
«Bin ich geheilt, Herr Professor?» Jagoda atmete plötzlich schneller und musste sogar schlucken. Er hoffte, der Arzt würde es nicht merken.
«Das will ich meinen.» Der Chefarzt legte das Buch zurück. «Vergessen Sie, was hinter Ihnen liegt, und schauen Sie nach vorn, verstanden?» Lächelnd reichte er ihm die Hand. «Leben Sie wohl, Herr Jagoda. Ich will Sie nicht mehr hier sehen, ist das klar?»
Erleichtert ließ Jagoda später die Abteilung hinter sich, erleichtert trug er seinen kleinen Koffer durch die Eingangshalle auf die Pforte zu. Ein Einarmiger hockte auf einer Bank im Wartebereich und schaute schnell in seine Zeitung, als ihre Blicke sich trafen. Doch nicht deswegen fiel der Mann ihm auf, sondern weil ein Eisernes Kreuz I. Klasse an seinem schwarzen Mantel glänzte.
Jagoda selbst hatte seine Orden zu Hause in der Kommode versteckt, nachdem aufgebrachte Passantinnen sie ihm im Dezember 1918 samt Schulterstücken von der Jacke gerissen hatten. Leipzig, diese Brutstätte von Unruhe und Sozialismus, hatte seine Kriegsheimkehrer – seine Kriegsverlierer – besonders undankbar empfangen.
«Schon Ihr letzter Tag heute, Herr Oberstleutnant Jagoda?» Der Pförtner trat aus seiner Loge und stand stramm; sie kannten sich vom Flandernfeldzug. «Freut mich für Sie, Herr Oberstleutnant!» Der Mann war ihm peinlich, denn nicht nur, dass er stramm stand – er sprach auch noch so laut, dass nun wirklich jeder im Wartebereich seinen ehemaligen militärischen Rang kannte. «Hat Ihre Schwester für Sie abgegeben.» Der Pförtner reichte ihm zwei Kuverts. «Außerhalb der Besuchszeit.» Jagoda steckte die Briefe ein und verabschiedete sich.
Draußen sah er die Elektrische nicht weit vor der Einfahrt zur Nervenklinik halten, die Linie 2 zum Hauptbahnhof. Einen Augenblick zögerte er, dann ging er doch zu den wartenden Kraftdroschken. Der Regen klatschte ihm ins Gesicht, die Friedhofsstimmung sickerte ihm ins Gemüt. «Hauptbahnhof», rief er dem Fahrer zu und stieg in den Fahrgastraum hinauf.
Als sie am Eingang vorbeirollten, sah er den Einarmigen aus der Tür treten. Ein untersetzter Mann in feldgrauem Mantel und mit schwarzer lederner Schildkappe folgte ihm, ein zweiter in Fliegerjacke und mit Wollmütze hielt ihm die Tür auf. Alle drei blickten seinem Wagen hinterher. Jagoda stutzte. Kannten sie ihn?
Noch als die Droschke längst über die Windmühlenstraße in Richtung Innenstadt tuckerte, gingen ihm die drei Männer durch den Kopf – ihre starren, ausdruckslosen Mienen hatten ihm nicht gefallen. Der Anblick der Elektrischen, die sie bald links überholten, gefiel Jagoda auch nicht, verursachte ihm sogar Beklemmungen.
Im Anhänger eines elektrischen Straßenwagens nämlich war es geschehen – im August letzten Jahres. Ein Gewitter aus heiterem Himmel, und schon nach dem ersten Donnerschlag hatte er sich an der Front gewähnt und mitten im feindlichen Artilleriefeuer. Angeblich sei er durchgedreht. Er selbst konnte sich an nichts erinnern, als er, gefesselt an die Gummiwand der Tobsuchtzelle, wieder zur Besinnung gekommen war. Nur an Granateinschläge und Explosionsblitze.
Am Königsplatz hielt die Kraftdroschke, um eine Elektrische vorbeirollen zu lassen. Die Fassade des Neuen Rathauses war dunkel vom Regen. Die Rathausuhr und den Giebel mit dem Grabspruch konnte Jagoda von hier aus nicht sehen, doch aus irgendeinem Grund stand er ihm dennoch vor Augen: Mors certa, hora incerta. Auf den Schlachtfeldern in Flandern und Frankreich hatte er oft an ihn denken müssen – Der Tod ist gewiss, die Stunde ungewiss.
Sie erreichten den Hauptbahnhof. «Herrliches Bauwerk!», entfuhr es ihm. Der Fahrer drehte sich nach ihm um und lächelte wie ein glücklicher kleiner Junge. Die Leipziger waren stolz auf ihren neuen Hauptbahnhof, Jagoda war es auch. Der Anblick der prächtigen Fassade, des weitläufigen Vorplatzes und der hohen Laternensäulen gab ihm das Gefühl, nach fünf Monaten Krankenzimmer und Klinikgarten endlich wieder frei durchatmen zu können.
Im Postamt der Bahnhofshalle schickte er ein Telegramm an seine Mutter in Dresden und kündigte seinen Besuch für den nächsten Tag an. Danach kaufte er Zigarren, Zeitungen, einen Fahrschein nach Dresden und Schokolade für seine Mutter.
Ins Menschengetümmel der großen Halle einzutauchen, verursachte ihm buchstäblich Glücksgefühle. Um diese noch eine Weile festzuhalten, ging er in die Bahnhofskneipe, trank nach fünf Monaten sein erstes Bier und schaute dabei durch die großen Fenster hinaus auf das muntere Treiben in der Halle. Niemand ringsum an Tischen und Theke kicherte, grunzte oder krampfte. Herrlich!
Sein Blick fiel auf ein Plakat an der Kneipentür, das für eine Sportveranstaltung warb, einen Boxkampf. Max Heiland gegen Oskar Stecher, las er, Samstag, 31. Januar 1920, Gasthof Windorf. Plötzlich spürte er, wie sehr ihn nach Spektakel und der Gesellschaft normaler Menschen verlangte. Da gehst du hin!, entschied er spontan.
Er trank sein Bier, rauchte Zigarre, zog die Briefe, die ihm der Pförtner gegeben hatte, aus dem Mantel, und las die Absender. Das Reichsgericht teilte ihm endlich einen Termin für eine Anhörung mit. Der zweite Brief war von Robert Murrmann. Überrascht öffnete und las er ihn: Murrmann, ein Kriegskamerad, hielt sich in der Stadt auf und wollte sich mit ihm treffen. Mit ihm und einem Berliner namens Heinrich Baumann, der Jagoda kennenlernen wollte.
Er steckte die Briefe weg und hob den Blick – ein Einarmiger, an dessen schwarzem Mantel ein Orden glänzte, stand vor dem Tabakladen im Eingangsbereich der Halle. Jagoda stutzte, und unwillkürlich suchte sein Blick die Menge in der Bahnhofshalle nach dem untersetzten Feldgrauen mit der schwarzen Lederkappe ab und nach dem dritten Mann, dem in der Fliegerjacke.
Er konnte sie nirgends entdecken, doch irgendetwas veränderte sich plötzlich da draußen in der Halle. Der Lärmpegel? Die Blickrichtung der Leute? Und dann sah er es: Soldaten schlurften und hinkten auf einmal dem Ostausgang entgegen, Heimkehrer, mindestens hundert Mann. Einige schob man in Rollstühlen oder auf fahrbaren Liegen hinterher.
Erinnerungen stiegen in ihm hoch, Erinnerungen, die er hasste. Jagoda wandte sich schnell ab vom Anblick der gebeugten und verkrüppelten Soldaten, bezahlte und ging.
Statt den Heimkehrern zum Ausgang zu folgen, bog er zum Tabakladen ab und spähte durchs Schaufenster nach dem Einarmigen. Er musste wissen, ob es derselbe Mann war, den er in der Klinik gesehen hatte. Doch unter den Kunden drinnen konnte er ihn nicht entdecken.
Seine Zigarre war ausgegangen. Er stellte den Koffer ab, kramte nach Zündhölzern, als ihm jemand ein Feuerzeug entgegenstreckte. Jagoda blickte in eisgraue Augen, während er sich über die Flamme beugte. «Danke», sagte er und saugte an seiner Zigarre.
Das Gesicht des Mannes war bleich, kantig und hohlwangig, seine Lippen schmal und farblos und unter seinen wachen grauen Augen lagen dunkle Ringe. Der Mann war höchstens Ende dreißig, hatte aber schon weißes Haar. Jagodas Blick fiel auf den abgewetzten Tornister in seiner Linken, und er las einen Namen auf dem ausgebleichten Aufnäher: Major Paul Stainer. Wortlos steckte der Mann sein Feuerzeug ein, nickte ihm zu und ging.
Jagoda schaute ihm hinterher. Der Weißhaarige trug einen alten Offiziersmantel ohne Schulterstücke und Tressen und unter dem Arm ein Bündel. Er war groß und hager, beinahe dürr. Einer der Heimkehrer, wahrscheinlich aus Frankreich; dort hielten die Sieger noch Hunderttausende gefangen, wie man hörte.
Hatte Jagoda ihn nicht schon irgendwo gesehen? Er grübelte. Nein – er kannte keinen Paul Stainer, keinen mit einem jungen Gesicht und schlohweißem Haar. Noch während er nachdachte, bog der Mann um die Ecke und verschwand im Eingangsbereich.
Jagoda rauchte eine Zeitlang in Gedanken versunken, bevor er seinen Koffer nahm und ebenfalls die Halle verließ. Auf dem Vorplatz stürzten Frauen, alte Männer und Kinder mit ausgebreiteten Armen unter die Soldaten. Manche schrien ihre Freude laut heraus, andere weinten still an der Brust ihres Heimkehrers.
Etwas abseits entdeckte er eine blonde Frau mit dunkelrot geschminkten Lippen und weißen Perlen an den Ohren. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und trug rote Stöckelschuhe. Aus nassen Augen betrachtete sie die Heimkehrer und die Glücklichen, die sie umarmten. Sie selbst schien vergeblich gewartet zu haben.
Meine Güte, dachte Jagoda, als er an ihr vorbeiging, so schön und doch so traurig.
Es dämmerte bereits. Am Blücherplatz hielt die Linie 17. Einen Moment zögerte er, dann rannte er los. Hatte der Professor ihn nicht für geheilt erklärt? Also konnte er auch wieder mit der Elektrischen fahren! Wenigstens eine Station! Jagoda atmete tief durch – er wollte es, nein, musste es wissen. Also stieg er ein und bezahlte. Gleich in der ersten Bank fand er einen freien Platz.
Neben ihm hustete ein Kind. «Bitte machen Sie Ihre Zigarre aus, mein Herr!» Im Führerstand drehte eine zierliche schwarzhaarige Frau sich nach ihm um. «Hören Sie nicht den Kleinen husten?» Stimme und Blick duldeten keinen Widerspruch, also drückte Jagoda die Glut an seiner Sohle aus.
«Danke, Frau König!», sagte die Mutter des Kindes. «Danke, Fine!», kam es von der Bank gegenüber.
Jagoda zog den Kopf ein und entschuldigte sich. «Ich war in Gedanken», murmelte er verlegen grinsend. «Hat man in der Leipziger Straßenbahn früher nicht rauchen dürfen?»
«Das ist lange her, mein Herr», beschied ihn die Fahrerin, ohne sich noch einmal nach ihm umzudrehen.
Schon am Schulplatz stand Jagoda auf und stieg wieder aus. Er hatte es nicht weit in die Jakobstraße, wo er direkt über dem Elstermühlgraben wohnte. Es tat ihm gut, die vertrauten Fassaden wiederzusehen. Vor seinem Haus hockten ein Hund und ein Bettler, ein Kriegsversehrter, wie es aussah.
Auf der anderen Straßenseite flammten die Scheinwerfer eines parkenden Kraftwagens auf, die große dunkle Limousine rollte an. Jagoda sah eher beiläufig hin, aber als sein Blick den Mann auf dem Rücksitz streifte, stand er still, um ihn genauer ins Auge zu fassen. Doch da beschleunigte das Automobil bereits und fuhr in Richtung Humboldtstraße davon.
Erschrocken blickte er dem Wagen hinterher. War das nicht der Einarmige gewesen? Der Träger des Eisernen Kreuzes, der ihm schon in der Nervenklinik und in der Bahnhofshalle aufgefallen war? Er schüttelte sich. Sah er denn jetzt schon Gespenster? Stockend setzte er den Weg zu seiner Haustür fort. Auf einmal zweifelte er daran, dass er wirklich geheilt war.
2
Eisblumen bedeckten das Buntglas der Treppenhausfenster. Gaslicht von der Straße tränkte sie mit zauberhaftem Schein. Paul Stainer blieb stehen, legte den Kopf in den Nacken und bestaunte das farbige Lichtspiel. Wie schön! Wieso war ihm das früher nie aufgefallen?
Vielleicht, weil er die letzten Jahre zu viel Hässliches hatte sehen müssen. Vielleicht auch, weil die Nähe des Todes seinen Blick für das Wesentliche geschärft hatte.
Stufe um Stufe stieg er ins zweite Obergeschoss hinauf, das im Halbdunkeln lag. Er dachte an jenen Augusttag sechs Jahre zuvor, als er das letzte Mal durch dieses Treppenhaus gegangen war; damals war er die ausgetretenen Stufen hinabgestiegen. Es kam ihm vor, als wäre das in einem anderen Leben geschehen, im Leben eines Fremden.
Sein Herz klopfte wild und sein Atem ging schnell – beides ärgerte ihn. Er sollte Sport treiben, am besten noch diese Woche wieder damit anfangen!
Endlich vor ihrer Tür, lehnte er sich gegen das Geländer, verschnaufte ein wenig und lauschte. Kein Geschirr klapperte in der Wohnung, kein Wasser rauschte, kein Klavier klimperte. Er stutzte. War sie gar nicht da? Seine Mutter hatte ihr vor zwei Tagen eine Karte in den Briefkasten geworfen. Seine Eltern wussten schon seit letzter Woche, dass er heute aus der Gefangenschaft zurückkehren würde.
Er atmete ein paarmal tief durch, zwang sich, dem Anblick der schwarzen Buchstaben auf dem emaillierten Türschild standzuhalten – Paul & Edith Stainer – und schöpfte Hoffnung, weil sie es noch nicht abgeschraubt hatte. Zögernd tastete er nach der weinroten Kordel neben der Tür, verharrte und erschrak beinahe vor dem wilden Pochen in der Brust. Gegen diese Art von Herzrasen half kein Sport, musste er sich eingestehen.
Er zog an der Kordel und zuckte zusammen, als die Glocke ertönte. Jahrelang hatte er diesen Klang nicht mehr gehört, hatte ihn schon fast vergessen. Er weckte ein verschüttetes Gefühl – das Gefühl, ein Zuhause zu haben.
Lass dich nicht täuschen, Stainer!, wies er sich selbst zurecht. Du hast kein Zuhause mehr.
Hinter der Wohnungstür näherten sich eilige Schritte. Ein Schlüssel wurde herumgedreht, ein Schloss schnappte auf. Sein Herz pochte ihm nun bis in die trockene Kehle hinauf, und als die Tür sich eine Handbreit öffnete, sah er sie.
«Mein Gott, Paul!» Aus aufgerissenen Augen und mit weit geöffnetem Mund starrte sie ihn an. Der Schrecken stand ihr ins Gesicht geschrieben, und am liebsten hätte er sie in seine Arme gezogen.
Sie sah kaum älter aus als am Tag des Abschieds vor sechs Jahren. Die Furchen zwischen Nasenflügeln und Unterkiefer erschienen ihm ein wenig länger als damals. Und eine Spur tiefer. Vieles mochte er vergessen haben, ihr Gesicht jedoch würde er auch nach zwölf Jahren und zwei Kriegen nicht vergessen.
«Edith», sagte er leise, mehr brachte er nicht heraus.
Sie löste die Türkette, öffnete und zog ihn in die Wohnung. «Mein Gott, Paul!», wiederholte sie. Er hätte sie wirklich gern umarmt oder wenigstens ihr blondes Haar berührt, doch sie ließ ihn sofort wieder los, schlug die Hände vor den Mund und starrte ihn an, wie man ein Gespenst anstarren würde.
Wahrscheinlich gab es keine Gespenster, ganz gewiss aber gab es deutsche Männer, die jahrelang kaum geschlafen, in Unterständen gehaust, in Schützengräben gezittert, neben toten Kameraden geweint, zu viel geraucht und zu wenig gegessen hatten.
Männer, die zu lange durch granatengepflügte Erde gerobbt waren, zu lange in Gefangenenlagern gehaust hatten und dort zu oft von Schreien, Schüssen und Detonationen geweckt worden waren, obwohl zwischen den Baracken nur Nachtigallen sangen, Grillen zirpten und Käuzchen riefen.
Männer, die in diesen Wintertagen des Jahres 1920 zu Zehntausenden aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrten.
Männer wie er: Paul Stainer, ehemaliger Major und Kriminalkommissar. Und vom Pech verfolgt – wenn man einmal davon absah, dass er überlebt hatte.
Stainer räusperte sich und fand seine Stimme wieder. «Was guckst du mich so an?» Er ging an Edith vorbei zum Garderobenspiegel, streifte den alten Mantel ab, hängte seine alte Melone an einen Huthaken und knipste die Wandlampe an. Er versuchte, sein Spiegelbild mit Ediths Augen zu betrachten, und musste zugeben, dass es tatsächlich eher einem Gespenst als einem Major ähnelte: Ein schwarzgrauer Schatten lag um die tiefliegenden, grauen Augen, die Wangen waren eingefallen, die Lippen ein bleicher Strich, und der altmodische, von der Mutter vorhin noch schnell gedämpfte Hochzeitsanzug hing wie ein Stück schlaffer Stoff um dürre Glieder.
Und dann das Haar – gütiger Himmel, das schlohweiße Haar! Das hatte Edith wohl am meisten erschreckt. Als sie ihm vor sechs Jahren am Bahnsteig einen Handkuss zum Waggonfenster heraufgeworfen hatte, war es noch schwarz gewesen.
Kann passieren, dachte Stainer, atmete tief durch und schaltete die elektrische Lampe wieder aus. «Mach kein Drama draus, Edith. Andere haben Arme und Beine verloren, viele sogar den Kopf.» Er versuchte, die Bitterkeit wegzulächeln. «Ich bin wieder hier, mit vollzähligen Gliedern und habe nicht mal eine Glatze bekommen.»
Stainer strich sich über das volle weiße Haar und sah ihr ins Gesicht. Sie hatte ihn nicht umarmt. Vor zwei Jahren war sie mit einem anderen Mann im Theater gewesen. Seit seine Mutter ihm das erzählt hatte, war ihm zum Heulen zumute. «Ich muss mit dir reden, Edith.»
«Reden?» Sie wandte ihm den Rücken zu und ging voraus in die Stube. «Hast du meine Briefe nicht bekommen?» Sie deutete aufs Kanapee. Als wäre er ein Fremder, dem man einen Platz anzubieten hatte. «Den letzten habe ich deiner Mutter doch neulich erst in der Kirche zugesteckt.»
In der Kirche – beinahe hätte Stainer laut gelacht. Man konnte also seinen Ehemann vergessen, sich mit einem Liebhaber vergnügen und dennoch zum Gottesdienst gehen?
Sofort bedrängten ihn schlimme Erinnerungen, und seine zynischen Gedanken lösten sich in nichts auf. Warum nicht, Herr Major?, verspottete er sich selbst. Man kann ja auch im Unterstand der Morgenandacht lauschen und ein paar Minuten nach dem Amen eine Handgranate in einen Schützengraben voller flaumbärtiger englischer Oberprimaner werfen.
Er räusperte sich. «Natürlich habe ich deine Briefe gelesen.» Einer hatte ihn kurz vor Weihnachten im Gefangenenlager erreicht, der andere heute am frühen Abend, als er mit seiner Mutter in der Kraftdroschke saß, mit der sie ihn vom Bahnhof abgeholt hatte. Der erste war niederschmetternd gewesen, der zweite niederschmetternd und frostig. «Deswegen müssen wir ja reden.»
Am Kanapee vorbei steuerte er seinen alten Lesesessel an. Lieber Himmel, wie hatte er den vermisst! Den und das Klavier neben der Tür zum Schlafzimmer. An die Stehlampe hinter seinem Sessel erinnerte er sich nicht. Und hatte neben dem Sessel schon immer dieses Tischchen mit diesem Grammophon gestanden? Er stutzte und verharrte einen Augenblick. Über der Sessellehne hatte doch ein Bild gehangen? Sein Blick flog über die Wände – hatten nicht überhaupt viel mehr Bilder hier gehangen? Stainer verkniff es sich, seine Frau danach zu fragen, ging weiter und ließ sich stumm im Lesesessel nieder.
Eine Tageszeitung lag auf der Lehne, die Vossische Zeitung. Hatten Edith und er diese Zeitung abonniert? NEUE AUSLIEFERUNGSNOTE AN HOLLAND, lautete die Schlagzeile. Er faltete das Blatt zusammen, überflog dabei die ersten Zeilen des Berichts: Die Botschafter der Alliierten hatten in Paris verhandelt und beschlossen, von der holländischen Königin die Auslieferung Wilhelms II. zu verlangen.
Der oberste Soldat des Reiches war nach Holland ins Exil geflohen? Die Siegermächte wollten den Kaiser vor Gericht stellen? Stainer schüttelte den Kopf. Kaum zu glauben. Er hatte seit Jahren keine Zeitung mehr gelesen. Und heute im Gefangenentransport hatte niemand über Politik gesprochen.
Kauf dir ein paar Zeitungen, Stainer, dachte er, und sprich mit den Leuten, damit du in der Wirklichkeit ankommst.
«Seit wann haben wir elektrisches Licht?» Er legte die Zeitung neben das Grammophon und schaute seiner Frau wieder ins Gesicht. Wie beherrscht sie jetzt wirkte, wie kühl.
«Seit dem Frühjahr vor dem Krieg.» Edith runzelte die Stirn. «Das weißt du doch?»
«Ja, stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein», sagte er, obwohl ihm gar nichts einfiel. Außer, dass sie ihn an der Wohnungstür nicht umarmt hatte. Nicht einmal berührt hatte sie ihn. Keine Willkommensgeste, kein Zeichen der Erleichterung, weil er lebte und frei war, nichts. Kerzengerade stand sie vor dem Lesesessel, als wollte sie ihn gleich wieder zur Wohnungstür führen. Ihr erster Schrecken schien verflogen zu sein.
«Wann kann ich wieder einziehen?» Alle Selbstverständlichkeit, zu der er noch fähig war, legte er in diese Frage.
Ihre Gestalt straffte sich, sie atmete tief durch und hielt seinem Blick stand. «Gar nicht mehr, Paul.» Der Satz hörte sich an, als hätte sie lange daran gefeilt. Nicht eine Spur von Heiserkeit lag in ihrer Stimme.
«Warum nicht?» Er hätte schreien mögen, beherrschte sich aber und gab sich den Anschein von Sachlichkeit. «Ich kann doch nicht bei meinen alten Eltern wohnen! Wir müssen reden, Edith.»
Sie schüttelte den Kopf. «Gott, was gibt es denn noch zu reden? Ich habe dir doch alles geschrieben.» Edith ging zum Sekretär, kehrte mit einem Stapel Briefe zurück. «Die sind erst in den letzten Tagen gekommen, ich habe sie deiner Mutter noch nicht bringen können. Gott, Paul, es tut mir doch selbst so leid!»
An ihr vorbei betrachtete Stainer den Sekretär. An den erinnerte er sich, jedenfalls dunkel. Aber hatte das Kaiser-Wilhelm-Porträt schon immer darüber gehangen? Nach seiner Erinnerung hatte er diesen selbstgefälligen Herrn schon vor dem Krieg nicht leiden können. Außerdem war er Sozialdemokrat. Wie hätte er da ein Bild von Wilhelm Zwo in der Wohnstube ertragen können?
Er schaute zur Schlafzimmertür und zum Klavier links daneben. Und glaubte plötzlich sicher zu wissen, dass es im September 14 rechts von der Schlafzimmertür gestanden hatte. So sicher, dass er Edith beinahe danach gefragt hätte.
Die stand nun vor ihm und streckte ihm die Kuverts hin. Statt sie zu nehmen, betrachtete er ihre Hand. Sie trug keinen Ring mehr – sie meinte es ernst! Die Erkenntnis traf ihn wie ein Fausthieb.
Er riss ihr die Briefe aus der Hand, senkte schnell den Blick und tat, als würde er die Post durchsehen, so routiniert, als hätte er all die Jahre im Graben, im Dreck, im Lazarett, im Gefangenenlager tagtäglich die Briefe durchgesehen. Etwas stieg ihm die enge Kehle hoch wie eine Blase dicker, schlechter Luft. Er schluckte, er atmete tiefer, er hielt sie in Schach, die lästige Blase, und bekam sie endlich heruntergeschlungen.
«Dein letzter Brief kam vor vier Jahren, Paul!» Edith zog sich einen Stuhl an seinen Sessel, setzte sich auf die Kante und beugte sich zu ihm. Würde sie seine Hand nehmen? «Vor – vier – Jahren!» Sie betonte jedes Wort und dachte gar nicht daran, seine Hand zu berühren.
«Andere Frauen haben es durchgehalten.» Diese lästige Heiserkeit! Er schluckte und schluckte. «Manche fünf Jahre und länger.»
«Weil sie Lebenszeichen erhalten haben!» Sie wurde lauter. «Feldpost, Briefe vom Roten Kreuz, offizielle Benachrichtigungen von der Reichswehr! Ich hatte nichts!» Sie warf die Arme in die Luft. «Nichts! Was hätte ich denn tun sollen?»
Sie hatte recht. Doch wie hätte er schreiben sollen? Wie hätte ein verstörtes Angstbündel, an ein Lazarettbett geschnallt und nahezu ohne Gedächtnis, schreiben sollen? Und wie sollte er das irgendeinem Menschen erklären?
Mit einer müden Geste streckte er die Hand nach ihr aus, wollte ihren Arm berühren. «Warten, Edith. Du hättest warten können.»
Sie wich zurück. «Habe ich das nicht die Jahre zuvor schon getan? Habe ich das nicht viel zu lange getan?» In ihren Zügen stand jetzt der vertraute Vorwurf, in ihrem Blick der vertraute Zorn. «Ich war doch nur den Papieren nach deine Ehefrau, verheiratet warst du mit der Wächterburg!»
Er blieb stumm. Die Wächterburg – das Polizeiamt Leipzig. Die nächste Klippe. Wer brauchte einen Kriminalisten mit krankem Kopf, mit Gedächtnislücken? Wenn sie auf seiner alten Dienststelle erfuhren, wie übel ihm der Krieg mitgespielt hatte, würde er sein geliebtes Polizeiamt in der Wächterstraße nur noch ein einziges Mal betreten: um seine Papiere abzuholen. Er schüttelte sich. Bloß nicht daran denken.
Edith strich sich seufzend über die Stirn. «Wie auch immer – ich musste dich für tot halten, Paul. Ich musste!» Sie stand auf, fummelte eine Zigarette aus einer Schachtel in ihr schwarzes Mundstück und zündete sie an. «Und jetzt ist es zu spät.» Sie ging zum Fenster, wo sie einen hastigen Zug nach dem anderen nahm.
Er hatte vergessen, dass sie rauchte. Oder hatte sie erst während des Krieges damit angefangen?
Eine Zeitlang schwiegen sie. Sie starrte in die Winternacht hinaus und blies den Rauch in die Topfpflanzen, er dachte an ihren vorletzten Brief, an den, der es kurz vor Weihnachten zu den Franzosen geschafft hatte. Sie habe erst im November Nachricht von der Reichswehr bekommen, hatte sie da geschrieben, sie habe ihn für tot gehalten, und da keine Kinder sie aneinander bänden, habe sie einen Entschluss gefasst. Sie wolle die Scheidung.
Das war Edith. Klar, konsequent, kompromisslos. Das war seine Frau.
Stainer suchte nach Worten – und fand sein Zigarettenetui. Er zog es aus dem Mantel, holte eine Salem heraus. Weil seine Hand zitterte, verzichtete er darauf, sie anzuzünden. «Hör zu, Edith. Ich …» Er räusperte sich, setzte noch einmal an. «Ich will dich um etwas bitten. Ich bitte dich, es dir noch einmal zu überlegen. Eine Ehe wirft man nicht einfach so weg.»
«Einfach so? Machen wir uns doch nichts vor!» Sie fuhr herum, blies den Rauch in seine Richtung. «Es war doch schon in den drei Jahren vor dem Krieg kalt und still geworden zwischen uns. So kalt und still, dass ich nichts vermisst habe, seit du vor sechs Jahren in den Zug gestiegen bist. Nichts!» Sie senkte die Stimme, merkte wohl, wie hart ihre Worte ihn treffen mussten. «Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, Paul.» Sie setzte sich wieder zu ihm. «Doch es ist die Wahrheit.»
Seine Kehle war wie zugeschnürt. Hatte sie recht? Kein klarer Gedanke wollte ihm mehr gelingen. War es wirklich so schlimm gewesen? Übertrieb sie nicht maßlos? Stainer umklammerte das Zigarettenetui, zerbrach die Zigarette zwischen den Fingern, wünschte sich weit weg und schien doch an seinem Lesesessel festgefroren zu sein.
Er schaute ihr in die Augen. Ediths Blick hatte etwas Forschendes, beinahe Lauerndes. Sie wippte mit dem Fuß, strich sich ständig den Rock glatt, rauchte hastig. Jetzt erst fiel ihm auf, dass sie ihn nichts gefragt hatte. Wie es ihm ging, wann er verwundet und in Gefangenschaft geraten war, welche Verletzung er erlitten und warum er ihr nicht geschrieben hatte – all das wollte sie gar nicht wissen! Nicht einmal den Mantel hatte sie ihm abgenommen!
So saßen sie einander gegenüber. Er stumm und reglos wie ein Stein, sie rauchend und mit dem Fuß wippend. Nach der dritten Zigarette fing sie an, über die Zukunft zu sprechen. Ob er Geld brauche, wollte sie wissen und machte Vorschläge, wie man Hausrat und Möbel aufteilen, wer wo wohnen könnte und so weiter. Stainer verstand kaum die Hälfte.
Sein Blick irrte von ihrem Gesicht zum Kaiser-Wilhelm-Porträt, vom Porträt zum Klavier, vom Klavier zum Grammophon und von dort zurück zu Ediths Gesicht, wieder und wieder, und er fragte sich, ob er wirklich jemals mit dieser Frau in diesen vier Wänden gelebt hatte.
Irgendwann schloss jemand die Wohnungstür auf.
Edith fuhr herum und sprang auf. Ein hochgewachsener Mann öffnete die Stubentür, Ende fünfzig, schlank und mit weißen Haaren. Er trug einen modernen Hut und einen blauen Seidenschal zu elegantem cognacfarbenem Anzug und über dem Anzug einen dunklen Lodenmantel. Als suche er Halt, hielt er die Klinke fest und blieb reglos auf der Schwelle zum Flur stehen. Er musterte Stainer mit wachem und zugleich ängstlichem Blick.
Edith funkelte den Fremden zornig an. Mit energischen Schritten und heftig gestikulierend lief sie zu ihm; fast sah es aus, als wollte sie ihn von der Schwelle zurück in den Flur stoßen. «Ich habe dir doch gesagt, dass ich heute Abend allein sein muss!», zischte sie.
«Und ich wollte nicht wie ein Feigling zu Hause in Deckung bleiben.» Der Mann schob sie einfach beiseite und kam zu Stainers Sessel. «Brand.» Er nahm den Hut vom Kopf und streckte Stainer die Rechte hin. «Dr. Eugen Brand. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, Ihnen von Mann zu Mann zu erklären, wie leid mir das alles tut, Herr Kommissar Stainer, und Ihnen dabei in die Augen zu schauen, Herr Major.»
Über die ausgestreckte Hand hinweg betrachtete Stainer das Gesicht des Mannes. Sein Lesesessel schien sich in einen Schaukelstuhl zu verwandeln, das Zimmer drehte sich. Er hat einen Schlüssel, dachte er. Er hat einen Schlüssel zu unserer Wohnung und er ist mindestens zwanzig Jahre älter als du.
In diesem Moment erinnerte er sich, dass kein Bild, sondern eine gerahmte Urkunde über seinem Lesesessel an der Wand gehangen hatte. Eine Siegesurkunde des Polizeisportvereins, die den Kriminalkommissar Paul Stainer als sächsischen Meister des Jahres 1912 im Jiu-Jitsu-Mittelgewicht ehrte. Und über dem Klavier fehlten sein Offizierspatent und die Hochzeitsfotos.
Diese Erkenntnis brachte sein Blut in Wallung. Er steckte Briefe und Zigarettenetui in den Mantel, stand auf und ballte die Fäuste. «Ich sage Ihnen lieber nicht, was mir ein tiefes Bedürfnis wäre.»
An dem Mann namens Brand und seiner ausgestreckten Hand vorbei ging er zu seiner Frau. Drei Atemzüge lang stand er vor ihr, sah ihr ins Gesicht. Dann wandte er sich wortlos ab, nahm seine Melone vom Haken und verließ die Wohnung.
Unten, auf der Vortreppe, zündete Stainer sich doch noch eine Zigarette an. Seine Hand zitterte nicht übermäßig, wie er staunend bemerkte. Draußen klatschte Schneeregen auf die Straße. Willkommen daheim, dachte er und schritt in die Dunkelheit hinaus.
3
Der Schäferhund des Kriegsversehrten erhob sich und trottete Jagoda entgegen. Der blieb geistesabwesend stehen, denn seine Gedanken kreisten noch um die dunkle Limousine und den Mann auf der Rückbank. Er hätte wetten können, dass es der Einarmige mit dem Eisernen Kreuz gewesen war.
Konnte es Zufall sein, dass man ein und denselben Fremden innerhalb so kurzer Zeit gleich dreimal hintereinander zu sehen bekam?
Der Hund beschnüffelte seine Schuhe, seine Hosenbeine und seinen Koffer. Danach machte er kehrt und trottete zurück zu dem beinamputierten Bettler. Der trug eine Blindenbinde um den Arm und eine große, schwarze Brille. Ein breites Rollbrett diente ihm als Sitzgelegenheit und Vehikel zugleich. Darauf hockte er ganz in sich selbst versunken und spielte auf einer Mundharmonika.
Jagoda, der sonst einen Bogen um solche Leute machte, beugte sich zu ihm hinunter und warf ein paar Pfennige in seine Soldatenmütze. Der Einarmige wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Auf seltsam weichen Knien stieg er die drei Stufen zur Haustür hinauf.
In seinem Briefkasten lag ein unfrankierter Brief. Er las den Absender – Ernst Hummels – und fluchte. Schon wieder ein Brief von diesem Kerl! Sogar in der Klinik hatte er ihn mit seinen beleidigenden Schmierereien belästigt! Woher wusste der überhaupt, dass er entlassen werden sollte?
Hummels hatte als Feldwebel zu seinen Kompanien gehört. Seit Kriegsende schickte der Mann Drohbriefe und beschimpfte ihn wegen irgendwelcher Befehle, die Jagoda irgendwann in Frankreich gegeben hatte. Schwachkopf!
Die Abschiedsworte des Chefarztes gingen ihm durch den Kopf, während er zu seiner Wohnung hinaufstieg. Vergessen Sie, was hinter Ihnen liegt, schauen Sie nach vorn. Kluger Mann, dachte er und schloss die Tür zu seiner Wohnung auf.
Kaum hatte er sie hinter sich zugedrückt und den Koffer abgestellt, verharrte er wie gelähmt – erst vor Schreck, dann vor Wut: Der Garderobenschrank stand weit offen, Kleidungsstücke, Hüte und Schuhe lagen davor auf dem Boden, und aus der Kommode daneben hingen die Schubladen halb heraus.
Er schaute sich um: Sämtliche Zimmertüren waren geöffnet, der Dielenteppich verschoben und voller Wellen, der Schlafzimmerteppich übersät mit Kleidung, Wäsche, Büchern und Medikamentenschachteln.
«Das ist nicht wahr!» Jagoda stürzte ins Schlafzimmer: Auch hier waren alle Schranktüren geöffnet, Schubladen herausgerissen, die aufgeschlitzten Matratzen bogen sich über dem Fußende des Bettes, Daunen bedeckten Kleidung, Bücher und Dokumente wie frisch gefallener Schnee. Seine Münzsammlung lag zwischen aufgeschlitzten Bettdecken und Krawatten.
Jemand hatte bei ihm eingebrochen!
«Das darf doch nicht wahr sein!» Wutschnaubend stürzte er in die Küche – das gleiche grässliche Bild. Kein Schrankfach, das nicht ausgeräumt, keine einzige Schublade, die nicht durchwühlt worden war!
Fluchend rannte er ins Wohnzimmer: Ein Tohuwabohu aus Büchern, Fotoalben, Tischwäsche, Kristallgläsern, Sammeltassen, Dokumenten und gerahmten Bildern. Das Schillerporträt lag zerbrochen zwischen den Hochzeitsfotos, Blumenerde aus umgekippten Topfpflanzen bedeckte die am Boden verstreuten Bände seiner geliebten Goethegesamtausgabe.
Dieser Anblick trieb Jagoda die Tränen in die Augen. Er lehnte gegen den Türrahmen, zitterte vor Wut und Fassungslosigkeit. Wie konnte man einem Menschen, der hilflos und leidend im Hospital lag, Derartiges antun?
Er atmete tief, kämpfte gegen das Gefühl grenzenloser Ohnmacht an und schrie endlich seinen Zorn heraus. Natürlich dachte er an Hummels. «Was für eine bodenlose Gemeinheit!», rief er. «Welch niederträchtiges Gesindel!»
Doch was nützte alles Gejammer? Was geschehen war, war geschehen. Gehandelt werden musste jetzt, sofort! Er zog ein großes Taschentuch aus der Anzughose und wischte sich die Tränen aus den Augen. Mit zitternder Hand griff er zum Fernsprecher, um im Polizeiamt anzurufen – und stutzte: Das Spiralkabel, das Hörer und Apparat normalerweise verband, hing lose herab.
Plötzlich roch er Zigarettenrauch und im gleichen Moment war ihm, als würde ein Eiszapfen das Innere seiner Brust durchbohren. Er fuhr herum – ein Mann hockte im Sessel an der hinteren Wand zwischen Stehlampe und Aquarium: schwarzhaarig, untersetzt, in feldgrauem Mantel und mit schwarzer, lederner Schildmütze. Er musterte Jagoda mit vollkommen regloser Miene. Seine Hände steckten in schwarzen Lederhandschuhen und ruhten auf den Armlehnen des Sessels.
Jagoda erinnerte sich sofort – einer der Männer vom Klinikausgang! «Schickt Hummels Sie?!», schrie er mit bebender Stimme. Der Fremde blieb stumm. «Haben Sie etwa meine Wohnung derart verwüstet?!»
Der Fremde erhob sich. «Ich habe Ihnen Ihr Urteil zu überbringen, Herr Oberstleutnant», erklärte er ruhig. «Es lautet: Tod durch den Strang.»
«Was?» Jagoda starrte ihn an wie eine Erscheinung. «Was sagen Sie da?» Sein ungläubiger Blick flog zwischen den in schwarzem Leder steckenden Handschuhen des Eindringlings hin und her, und jetzt erst merkte er es: der Fremde rauchte gar nicht.
Wie? Er rauchte nicht und dennoch roch es nach Zigarettenrauch? Panik durchzuckte Jagoda, und er wirbelte auf den Absätzen herum.
Da hatte der Mann, der hinter ihm stand, schon ausgeholt und schlug zu. Jagoda registrierte noch, dass der zweite Eindringling eine Fliegerjacke trug und dass ihm eine Zigarette im Mundwinkel hing, dann stürzte er in bodenlose Finsternis.
4
27. Januar, 1920
Weißt du noch, wie wir im Sommer vor Kriegsausbruch in Connewitz deinen Dreißigsten gefeiert haben? Alle waren gekommen, sogar mein großer Bruder Hagen. Und alle waren betrunken.
Wir beide hatten unseren ganz eigenen Rausch. Erinnerst du dich an die schlaflose Nacht? Zwischen tausend Küssen hast du mir erklärt, wir sollten uns mehr davon gönnen und möglichst ein Leben lang. Und ich habe «ja» gesagt.
Doch dann musstest du erst einmal für Kaiser und Vaterland den Helden geben. Manchmal hasse ich dich dafür.
Gestern ist ein Zug angekommen, der sächsische Soldaten aus Frankreich gebracht hat, entlassene Kriegsgefangene, Kranke und Verwundete zumeist. Obwohl ich wusste, dass du aus keinem der Waggons steigen wirst, war ich am Hauptbahnhof. «Realitätsarbeit» würde Dr. Polanski das nennen.
Ich habe sie aussteigen sehen, die zerlumpten Jammergestalten. Viele mussten aus dem Zug getragen und in Rollstühle gesetzt werden. Ob ich dich überhaupt erkannt hätte, wenn du unter ihnen gewesen wärst? Du warst nicht unter ihnen. Sonst könntest du jetzt den Brief lesen, der vom Juwelier Heine gekommen ist. Wann denn der künftige Herr Gemahl die Ringe abzuholen und zu bezahlen gedenke. Ich schlage schon lange einen Bogen um Heines Laden.
Der Morgen graut bereits, Willy fängt schon an zu erzählen. Eine Nacht wie viele zuvor liegt hinter mir: tanzen, singen, hübsch sein, am Sektkelch nippen, freundliches Gesicht machen. Ein Mann hat mich an seinen Tisch gebeten. Ich mag ihn, nur die Pistole unter seinem Jackett mag ich nicht. Ich habe den Kolben gesehen, als er nach seiner Brieftasche gegriffen hat. Und die ganze Zeit hat er seine Aktentasche nicht aus den Augen gelassen. Ein Agent? Ein Polizist?
Er heißt Heinrich. Ein Berliner wie du, schön wie du, charmant wie du, Soldat gewesen wie du. Ein bisschen zurückhaltender als du, weniger heiter. Und der wichtigste Unterschied: Er hat überlebt.
Was glaubst du, Albert – bin ich mit ihm gegangen? In dem Augenblick, als er mich gefragt hat, habe ich an dich gedacht. «Genieße das Leben, Rosa», hast du beim Abschied gesagt. «Selbst wenn ich nicht zurückkomme: Versprich mir, glücklich zu sein. Für mich.» Du hast gelacht, ich habe geweint, und die Kapelle hat Heil dir im Siegeskranz geblasen.
Auch heute warst du anwesend: In Willys Geschwätz, im Brief vom Juwelier, im Blick des schönen Mannes, als ich «nein» gesagt habe, als ich gesungen, als ich getanzt habe. Du bist auch jetzt anwesend, während ich wieder eine leere Seite meines Tagebuches fülle.
Vergangenheit vergeht nicht, das lerne ich durch dich. Das Wort schon täuscht: Vergangenheit. Ganz und gar falsch! Sie durchtränkt die Gegenwart, schleicht sich in die Zukunft, bleibt für immer.
Den Kaiser gibt es nicht mehr, dennoch verwüstet er dieses Land. Dich gibt es nicht mehr, dennoch verdunkelst du dieses Herz.
Vor drei Jahren, nach deinem letzten Urlaub, in deinem letzten Brief, hast du es noch einmal geschrieben: Ob ich nun zurück zu dir ins schöne Leipzig komme, oder ob ich hier in der verbrannten Erde der Champagne liegen bleiben werde – du musst mir versprechen, eine glückliche Rosa zu sein.
Also gut. Wenn der Pistolenmann mit seiner lächerlichen Aktentasche mich morgen in der Bar wieder an seinen Tisch bittet, werde ich ihn mit nach Hause nehmen.
5
Flammen erleuchteten die Nacht, Flammen loderten, wohin er sich wandte. Die nasse Uniform zog ihn tiefer ins Wasser, der Fluss brannte, es stank nach Schweröl. Das Wummern, Donnern und Brodeln einschlagender Artilleriegeschosse schwoll noch an. Gewehrschüsse heulten von einem Ufer zum anderen, Handgranaten explodierten, Männer schrien, Motoren brüllten, Umrisse monströser Maschinen bohrten sich durch schwarzen Qualm. Er schwamm von ihnen weg und auf ein Boot zu, das Schlagseite hatte, weil es längst überfüllt war. Er schwamm schneller, kam kaum vom Fleck. Jemand streckte ihm die Hand entgegen. Das Rauschen einer heranfliegenden Granate löste sich aus dem höllischen Chor des allgegenwärtigen und niemals schweigenden Kanonendonners, übertönte ihn sekundenlang und röhrte durch den Nachthimmel heran. Er sah die rettende Hand, streckte sich nach ihr aus, versuchte, nach ihr zu greifen. Die Detonation stülpte ihm die Trommelfelle ins Hirn, erstickte jedes andere Geräusch. Totenstille trat ein.
Stainer fuhr aus dem Schlaf hoch – sein Herz raste, er schnappte nach Luft. Hatte er geschrien? Gehetzt blickte er sich um: kariertes Bettzeug, eine brennende Nachttischlampe, eine Kommode aus dunklem Holz, ein runder Tisch, eine offene Tür.
Alles gut, Stainer, du bist durch.
Eine Frau im Nachthemd stand im Zimmer. «Was ist denn mit dir, Paul?»
«Was soll denn sein?» Er rieb sich die Augen und blinzelte zu der kleinen Frauengestalt: Sie hatte langes graues Haar und ein rundes, weiches Gesicht, in dem sich Sorgenfalten türmten. Seine Mutter.
«Du hast wieder laut geredet im Schlaf, hast sogar geschrien. Dein Vater ist davon aufgewacht.» Sie kam näher, beugte sich zu ihm, betrachtete seine Stirn. «Du schwitzt ja. Bei der Kälte?» Sie ging zur Kommode, holte ein Handtuch heraus und kam zurück zu seinem Bett. «Was ist nur mit dir, Paul? Du wirst doch nicht krank werden?» Behutsam wischte sie ihm den Schweiß von der Stirn.
«Gar nichts ist, Mutter.» Er fühlte sich ertappt, spürte Scham und Ärger zugleich in sich aufsteigen. Unwillig nahm er ihr das Tuch aus der Hand, trocknete sich Nacken und Hals. Zitterte seine Hand? «Ich habe schlecht geträumt, sonst ist gar nichts. Geh ruhig wieder schlafen.»
Sie neigte den Kopf auf die Schulter und schaute ihn an. Einen Augenblick stutzte er: Wann hatte er zuletzt so viel Erbarmen in einem Blick gesehen? Scham und Ärger verflogen – er streckte die Hand nach ihrem Gesicht aus und berührte zärtlich ihre Wange. «Nun geh schon, Mutter, es ist alles in Ordnung. Gute Nacht.»
«Gute Nacht, Paul.» Im Weggehen warf sie einen Blick auf den Tisch – auf den Marmorkuchen und die halb leere Branntweinflasche darauf. Kurz schien es ihm, als stockte ihr Schritt, doch ohne ein weiteres Wort ging sie hinaus und schloss leise die Tür hinter sich.
Wenigstens hatte sie nicht nach Edith gefragt. Stainer seufzte. Ausgeschlossen, die Eltern auch nur einen Tag länger mit seinen … – er schluckte, legte sich das Schweißtuch um den Hals, suchte nach Worten – … mit seinen Zuständen zu belasten. Er musste sich ein Zimmer suchen, so schnell wie möglich.
Umständlich kroch er aus dem Bett und schlurfte zum Tisch; Himmel, wie butterweich seine Knie sich anfühlten! Bebte der Fußboden, oder täuschte er sich? Er ließ sich auf den Stuhl davor fallen, atmete tief ein und aus, schaute sich aufs Neue um. Kaum zu glauben, doch er hockte in einem ganz normalen Zimmer. Er war tatsächlich durch und lebte wieder in menschenwürdigen Verhältnissen. Dennoch kam ihm das Zimmer unwirklicher vor als das Traumbild, das ihm noch immer vor Augen stand: der Panzer, das überfüllte Boot, die ausgestreckte Hand des Hauptmanns.
Er betrachtete den Marmorkuchen, mit dem seine Mutter ihn gestern überrascht hatte. Wie hatte er nur vergessen können, dass er Geburtstag hatte? Mutter hatte es nicht vergessen. Sein Gewissen regte sich, weil er ihn noch nicht angeschnitten hatte. Wann hatte ihm jemand zuletzt einen Geburtstagskuchen gebacken? Stainer konnte sich nicht erinnern.
Sein Blick glitt über das Durcheinander auf dem Tisch und blieb an der kleinen Taschenbibel hängen, die zwischen dem Kuchen und ein paar Abendzeitungen neben der Branntweinflasche lag: abgegriffen, fleckig, in der Mitte ein Loch mit schwarzen Rändern. Stainer hatte den Granatsplitter stecken lassen. Und seitdem nicht mehr in ihr gelesen.
Die kleine Taschenbibel und die ausgestreckte Hand seines Hauptmanns – ihnen hatte er zu verdanken, dass er Edith wiedergesehen hatte, dass er jetzt hier in einem ganz normalen Zimmer sitzen konnte; der Bibel und dem Hauptmann.
Traurig stützte er den schmerzenden Kopf auf, dachte an seine Frau und betrachtete die Branntweinflasche.
Teufelszeug!, schimpfte er stumm.
Es ersetzte den Schmerz lediglich durch anderen Schmerz, und als Betäubungsmittel hielt es nicht lange vor. Er musste aufhören damit, unbedingt. Denn wenn er getrunken hatte, suchte der Albtraum ihn so zuverlässig heim, wie dem Geschützlärm der Einschlag folgte. Hatte er das nicht schon im Gefangenenlager gelernt?
«Nein, nicht gelernt.» Murmelnd betrachtete er die verdammte Branntweinflasche. «Nur gemerkt.»
Stainer langte eine Zigarette aus seinem aufgeklappten Etui und zündete sie an. Rauchend lauschte er zum Fenster hin. Der neue Morgen graute schon. Schneeregen klatschte gegen die Scheiben. Nicht nur in Frankreich, auch hier in Leipzig wollte es nicht recht Winter werden in diesem Jahr. Ob die Eisblumen im Treppenhaus in der Gustav-Freytag-Straße wieder geschmolzen waren?
Gustav-Freytag-Straße zwölf – da hatte er einmal gewohnt. Mit ihr. In einem anderen Leben.
«Edith», murmelte er. Ihr Gesicht stand ihm vor Augen – kühl, verschlossen, bleich. «Meine Güte, Edith …»
Er stand auf, ging zur Tür, wo sein Offiziersmantel hing, und zog die Briefe aus der Tasche, die sie ihm gegeben hatte. Ein ganzer Reigen von Bildern tanzten ihm jetzt durch den schmerzenden Schädel: Edith, wie sie ihre Finger küsst, die Hand zum Waggonfenster heraufstreckt und seine Lippen berührt; Edith mit rotem Gesicht und feuchten Augen neben ihm vorm Altar; Edith, wie sie aus der Elektrischen in seine Arme stolpert. So hatten sie sich kennengelernt. Im April 1906, vierzehn Jahre her.
Diese Bilder wirkten wie Brandbeschleuniger – sie entzündeten ihm die vom Alkohol betäubten Gefühle erneut: Schmerz, Hass, Bitterkeit, Eifersucht – alles war wieder wach.
Er blieb stehen, schloss die Augen und ballte die Fäuste. Was fand sie an einem Mann, der gut zwanzig Jahre älter war als sie? Wahrscheinlich ein Arzt aus der Universitätsklinik. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis. Wahrscheinlich hatte sie ihn auf der Wöchnerinnenstation kennengelernt, wo sie als Hebamme arbeitete. Von Mann zu Mann. Was für ein Idiot!
Er riss die Augen auf, denn das Parkett unter seinen Fußsohlen schien plötzlich zu schwanken. «Mach kein Drama daraus, Stainer!», wies er sich selbst zurecht, während er zum Stuhl wankte. «Mach bloß kein Drama daraus, hörst du?»
Zurück am Tisch sah er die Kuverts durch; Briefe vom Polizeisportverein, von der Reichswehr, von seiner Partei, der SPD, vom lutherischen Pfarramt der Paul-Gerhardt-Kirche, vom Polizeiamt.
Vom Polizeiamt?
Er schluckte und blinzelte, bis der Absender nicht mehr vor seinen Augen verschwamm: Polizeiamt, Polizeidirektor, Wächterstraße 3–5.
«Gratuliere, Stainer», flüsterte er, «Glückwunsch zum nächsten Absturz. Ein Stockwerk tiefer geht immer noch.» Er sog den Rauch ein, blies die Backen auf, stieß Luft und Rauch durch vibrierende Lippen aus. Bring es hinter dich, Stainer, viel schlimmer kann es nicht mehr kommen.
Seufzend legte er die Zigarette in den Aschenbecher, riss das Kuvert auf und überflog das Schreiben. Er traute seinen Augen kaum und las sorgfältiger: Glückwunsch zur Rückkehr aus dem Feld der Ehre stand da, Dank für den heldenhaften Einsatz für Volk und Vaterland, Segenswünsche für die Zukunft und so weiter, und er möge sich dann und dann in Zimmer so und so beim Polizeidirektor persönlich einfinden. Und man freue sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
Stainer konnte es nicht glauben. Wieso weitere Zusammenarbeit? Hatte die Reichswehr denn seine Dienststelle nicht informiert? Wusste man in der Wächterburg nichts von seinem Zusammenbruch? Von seiner sogenannten «Kriegsneurose»?
Er griff wieder zur Zigarette, las noch einmal und murmelte den Namen des Unterzeichners. «Dr. Friedrich Kubitz, Polizeidirektor.» Kopfschüttelnd hob er den Blick. «Kubitz?» Er konnte sich nicht erinnern, den Namen schon einmal gehört zu haben.
Er las zum dritten Mal. Und wieder und wieder den letzten Satz: Ich freue mich auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
Fassungslos ließ er den Brief sinken. «Es geht weiter, Stainer», murmelte er ungläubig. «Du hast ausnahmsweise mal wieder Glück.» Beinahe hätte er laut gelacht. «Du bist schon fast wieder Polizist.»
6
Der Boxer erinnerte sich nicht mehr, wie er aus der Mitte des Ringes in seine Ecke gelangt war. Jetzt jedenfalls hing er hier in den Seilen, buchstäblich. Geschrei, Gelächter und Stimmengewirr der Zuschauer gellten ihm in den Ohren, und das grelle Licht von der Hallendecke blendete ihn. Er atmete keuchend und spürte, wie ihm das linke Auge zuschwoll.
Von rechts nahm ihm jemand den Gebissschutz heraus und hielt ihm einen Wasserbecher an die Lippen. Von links wischte ihm jemand mit einem nassen Schwamm über Kopf und Gesicht und schrie ihm etwas ins Ohr, dessen Bedeutung es nicht bis in sein Hirn schaffte. Er trank wie ein Verdurstender.
Immerhin wusste er noch, dass er Max Heiland hieß, dass ein Boxkampf stattfand, dass er gegen den baumlangen Kerl da drüben in der anderen Ecke kämpfte und dass die Stimme, die ihm unbegreifliches Zeug ins Ohr brüllte, seinem Trainer Hans Jänig gehörte. Er wusste sogar noch, dass die gerade überstandene Runde die sechste gewesen war.
Dass die siebte Runde die letzte Runde seines Lebens sein würde, wusste er nicht.
Dafür fiel ihm der Name des Kerls in der Ecke gegenüber wieder ein: Oskar Stecher. Ein Riese, ein Ungeheuer. In sechs Runden war er nur ein einziges Mal so nah an Stecher herangekommen, dass er einen Treffer hatte landen können.
«Dein Auge schwillt zu!» Die Worte seines Trainers drangen allmählich in sein Bewusstsein. «So kannst du nicht boxen, Max.»
«Was?»
«Wir müssen aufgeben, Max!» Sein Trainer schrie so laut, dass Heiland zusammenzuckte. «Mit dem Auge kannst du unmöglich weiterboxen.»
«Blödsinn.» Schlagartig sah Heiland wieder klar.
«Du hast Stecher nicht ein einziges Mal getroffen!» Jänig gestikulierte wild. «Du bist fix und fertig, Max! Wir müssen aufgeben!»
«Leck mich.» Heiland packte die Seile, zog sich vom Hocker und fasste seinen Gegner ins Auge. «Aufgeben is nich.»
Applaus mischte sich in das Stimmengewirr. Stecher, in der Ecke gegenüber, starrte zu ihm herüber – halb amüsiert, halb überrascht. Schließlich hatte noch niemand zu Klöppel und Gongschale gegriffen. «Mach ihn fertig, Max!», rief eine Frauenstimme nahe am Ring, und eine Männerstimme schrie: «Polier ihm die Fresse!»
Der Ringrichter schritt in die Ringmitte, und der Gong zur siebten Runde ertönte. Jänig tätschelte Heilands Hinterkopf, wie jemand den Kopf eines Kindes tätschelte, für das ihm sonst kein Trost mehr einfiel. Gewöhnlich rief sein Trainer Hau ihn weg, denk an das Preisgeld, du bist der Größte und solche Sachen. Und jetzt hatte er nicht mehr als ein onkelhaftes Tätscheln für ihn übrig? Heiland hätte schreien mögen vor Wut, da trat der Ringrichter an den Rand und gab den Ring frei.
«Leck mich», flüsterte Heiland. Er schlug Boxhandschuh gegen Boxhandschuh und fasste Stecher ins Auge. Der kam seelenruhig und mit Riesenschritten auf ihn zu und sah so zuversichtlich und zufrieden aus wie ein Fleischer, der seine Würste noch eben in den Räucherofen hängen wollte, bevor es in den Feierabend ging.
«Dreckskerl», murmelte Heiland. «Ich bin der Größte. Einen Schweinehund wie dich hau ich weg.» Er holte tief Luft und schritt auf seinen Gegner zu.
Er blinzelte häufiger und wankte heftiger, als er es unbedingt hätte tun müssen, und als er in Reichweite des anderen war, schlug er absichtlich ein paar Luftlöcher. Er führte sich wie ein halb betäubter Tollpatsch auf – und freute sich, als er den Triumph in Stechers Blick aufblitzen sah.
Wie erwartet, griff sein Gegner an: eine kraftvolle rechte Gerade und ein präziser linker Haken. Doch Heiland fing beides ab – mit scheinbar letzter Kraft – und ließ danach wie ermattet die Arme sinken. Im selben Augenblick feuerte Stecher die nächste rechte Gerade gegen seine offene Deckung.
Heiland triumphierte – genau so hatte er sich das vorgestellt. Blitzschnell duckte er sich zur Seite, ließ die Faust und den langen Arm des anderen am Ohr vorbeischrammen und holte aus.
Von der Wucht des eigenen Hiebes nach vorn gerissen, fing Stecher sich einen Haken Heilands hinter dem Ohr, eine wuchtige Gerade in den Nacken und im Sturz noch einen Hammerhaken gegen die Schläfe. In ganzer Länge krachte der Riese auf die Bretter.
Das klang wie Musik in Heilands Ohren. Und die Musik hörte nicht auf: Der Ring erbebte, seine Holzbohlen ächzten, das Publikum grölte, Stecher stöhnte und der Ringrichter schrie Zahlen.
Heiland torkelte zur Seite und in die Seile. Er hielt sich daran fest, um nicht selbst zu Boden zu gehen. Seine Knie fühlten sich butterweich an, sein linkes Auge war wie zugenäht, die Zuschauerränge begannen, um ihn zu kreisen. Er wandte sich der Mitte des Ringes zu, sah einen Atemzug lang gar nichts mehr, wischte sich das rechte Auge aus und blinzelte: Zwei Ringrichter beugten sich über zwei Stechers, die sich vergeblich hochzustemmen versuchten.
Heiland ahnte zwar, dass der Richter seinen Gegner anzählte, hörte aber die Zahlen wegen des Geschreis des Publikums nicht mehr. Als ein paar Leute in der ersten Reihe von ihren Sitzen aufsprangen und die Arme hochrissen, begriff er, dass der Richter bei zehn angelangt war. Nur kurz stemmte er die Fäuste über den Kopf, denn sie fühlten sich an wie mit Blei gefüllt.
Jemand klatschte ihm auf die schweißnasse Schulter und schrie ihm ins Ohr – Jänig, und diesmal verstand er ihn sofort: «Sieg durch K.o., na, wer sagt’s denn.»
Der Rest rauschte an Heiland vorbei wie ein flüchtiger Traum: Siegerehrung, der Weg in die Umkleide an Jänigs Seite, Glückwünsche und Schulterklopfen von allen Seiten, auf der Liege die warmen Hände des Masseurs, der Eisbeutel über dem Auge und Jänig noch immer dicht neben ihm.
«Du bist ein Teufelskerl, Max.» Sein Trainer lobte ihn, wie er ihn noch nie gelobt hatte. «Dass du den noch auf die Bretter schickst! Das hätte ich nie geglaubt! Keiner hat das geglaubt, keiner hätte noch einen Groschen auf dich gewettet!» Heiland bekam feuchte Augen bei diesen Worten.
Er hatte zwar begriffen, dass er Sieger war, doch jetzt erst kam das auch in seinem Gemüt an. Er dachte an seine kleine Tochter und an seine Frau. Christel würde sich niemals einen Boxkampf von ihm anschauen; sie ertrug es nicht, wenn er sich einen Treffer einfing. Dann dachte er an die Siegprämie und lächelte selig.
Der Veranstalter kam ins Hinterzimmer des Gasthofs, das als Umkleide diente, und zahlte ihm das Preisgeld aus: zehn Mark auf die Hand. Heiland platzte schier vor Stolz. Jänig hatte gesagt, er wolle einen sächsischen Boxverein gründen, sollte sich der Boxsport auch im Reich durchsetzen. Dann würde es hier wie in Amerika regelmäßig Preisboxen geben, Meisterschaften sogar.
Heiland fühlte es: Goldene Zeiten standen vor der Tür. Bald würde es vorbei sein mit der Arbeitslosigkeit. Und mit den krummen Touren, auf denen er seit Kriegsende gerade noch genug Geld machte, um sich und seine kleine Familie über Wasser zu halten.
Später ging er zwischen seinem Trainer und dem Masseur zum Seitenausgang des Gasthauses an der Mittelstraße. Mit der Rechten drückte er sich einen frischen Eisbeutel ans zugeschwollene Auge. Er spürte keine Schmerzen, fühlte sich wie berauscht, als würde er schweben.
Ein paar Freunde mit ihren Mädels warteten schon neben einer Kraftdroschke, deren Motor vor sich hin tuckerte. Jänig hatte sie bestellt. «Heute gebe ich einen aus!», rief der Trainer, als er sich neben Heiland in die Fahrgastkabine zwängte.
Von Windorf fuhren sie nach Reudnitz hinüber, wo sie in einem Tanzlokal, dem Schlosskeller, feierten. Natürlich gab nicht nur Jänig einen aus – gegen Mitternacht hatte auch Heiland schon fast die Hälfte seiner Siegprämie auf den Kopf gehauen. Die andere Hälfte wollte er um jeden Preis nach Hause bringen, das hatte er Christel versprochen. «Denk an das Kind», hatte sie ihm eingeschärft. «Es wird bald laufen und braucht Schuhe.»
Heiland hockte allein am Tisch. Der Kellner brachte ihm einen frischen Eisbeutel, den er vorsichtig gegen das geschwollene Auge drückte; mittlerweile spürte er den Schmerz. Er hatte schon ein paar Bier intus und dachte an den besiegten Stecher, an seine Frau und Tochter und an seine glorreiche Zukunft als Boxer. «Nee, aufgeben is nich», murmelte er und lächelte selig sein leeres Bierglas an.