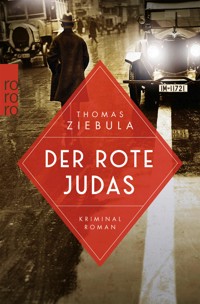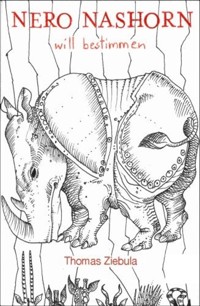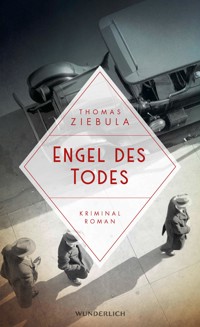
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Paul Stainer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Leipzig, März 1920: Der Kapp-Putsch bricht aus. Frustrierte Reichswehrsoldaten haben die Regierung in Berlin für abgesetzt erklärt. In Leipzig, wie in vielen deutschen Städten, kommt es zu blutigen Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Putschisten. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände halten Kriminalinspektor Stainer in Atem – auch innerhalb der «Wächterburg», da die völkisch-nationalen unter Stainers Kollegen die Weimarer Republik zur Hölle und die Putschisten an die Macht wünschen. Damit nicht genug, bemerkt Stainer unter den vielen Toten in den Straßen einzelne Opfer, die in auffälliger Manier erwürgt oder erstochen wurden. Jemand scheint die Gunst der Stunde zu nutzen, um seine Morde unter dem Deckmantel der Unruhen zu begehen. Hinweise der Straßenbahnfahrerin Josephine König und ihrer Tochter Mona, die es sich in den Kopf gesetzt hat, Polizistin zu werden, lotsen Stainer und Junghans ins Theatermilieu – wo jemand seinen ganz eigenen Rachefeldzug führt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Ähnliche
Thomas Ziebula
Engel des Todes
Kriminalroman
Über dieses Buch
März 1920. In vielen deutschen Städten bricht das Chaos aus, nachdem in Berlin frustrierte Reichswehrsoldaten unter dem neuen Reichskanzler Kapp die Regierung für abgesetzt erklärt haben. Auch in Leipzig kommt es zu blutigen Aufständen und Barrikadenkämpfen. Die Unruhen wecken in Stainer böse Erinnerungen an den Krieg, die ihn nachts wach halten. Trost sucht er bei der Straßenbahnfahrerin Josephine König. Deren Tochter Mona, inzwischen mit Stainers Kollegen Junghans liiert, arbeitet noch immer im städtischen Theater. Dort herrscht große Aufregung, weil die bekannte Tänzerin Valerie Schwarz auftritt, die sich mit ihren skandalösen Nackttänzen bereits einen einschlägigen Namen gemacht hat. Als Mona nach der Aufführung einen mysteriösen Fremden vor deren Garderobe entdeckt, ist ihr kriminalistischer Spürsinn geweckt. Auch Stainer und Junghans stecken bis zum Hals in Ermittlungen. In der Stadt treibt ein Mörder sein Unwesen, der seine Opfer grausam verstümmelt. Doch ihre Nachforschungen werden durch die immer gewalttätigeren Unruhen behindert. Dann taucht auch noch ein alter Bekannter auf, den Stainer längst hinter Gittern glaubte …
Vita
Thomas Ziebula ist freier Autor und schreibt vor allem Fantasy- und historische Romane. 2001 erhielt er den Deutschen Phantastik-Preis. Seine erste Krimi-Reihe um Inspektor Paul Stainer vereint auf beeindruckende Weise Thomas Ziebulas Leidenschaft für deutsche Zeitgeschichte, spannende Kriminalfälle und seine Liebe zu der Stadt Leipzig, die bis heute seine deutsche Lieblingsstadt ist. Der Autor lebt in Karlsruhe.
Für Peter Thannisch
Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen
lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
wagt er zu weinen
mitten in uns.
Rainer Maria Rilke
ISonnabend, 13. März 1920
gegenrevolution in berlin - bis jetzt ruhe und keine kämpfe - reichsregierung soll durch truppen abgesetzt und geflüchtet sein - generaldirektor kapp als diktator in reichskanzlei - sicherheitspolizei zu truppen übergegangen - reichsratssitzung ausgefallen
Telegramm vom Morgen des 13. März 1920 aus dem Berliner Reichstag an den Staatsrat von Sachsen
1Behandlungsprotokoll
Dritte Kur-Sitzung mit A.v.G., März 1920
Wie Sie wünschen, Herr Doktor. Dann werde ich heute einmal versuchen, mich hinzulegen während unseres Gesprächs. Sie werden schon wissen, was mir guttut, Sie sind ja der Arzt.
(erhebt sich zögernd aus dem Sessel)
Soll ich nicht meine Schuhe ausziehen? Ich meine …, ich ziehe sie lieber aus, ja? Es herrscht doch ein Sauwetter draußen, nicht dass ich Ihnen noch Couch und Decke schmutzig mache.
(bleibt vor der Couch stehen, betrachtet sie, wie andere ein offenes Grab betrachten würden, zupft die Decken zurecht, streckt sich umständlich aus)
Oh, das fühlt sich anders an, tatsächlich.
(liegt steif wie ein Brett)
Nun sitzen Sie aber hinter mir, Herr Doktor, da kann ich Sie ja gar nicht mehr anschauen, wie schade.
(Schweigen, lange)
Man kommt sich irgendwie so ausgeliefert vor, wenn man liegt, wissen Sie? So schwach, beinahe krank, möchte ich sagen. Doch, doch, ich hab’s schon lieber, wenn ich Sie anschauen kann, Herr Doktor, dann sehe ich Ihr Gesicht, dann weiß ich, wie Sie gucken – ob Sie grinsen oder sich ärgern.
Hören kann ich Sie immerhin, da haben Sie schon recht, Herr Doktor. Ich kann Sie sogar schreiben hören – wie das Geflüster von Stimmen wispert das, wenn Ihr Stift über den Block schabt. Worüber Sie grinsen oder sich ärgern könnten? Na, über mich, Herr Doktor, über das, was ich Ihnen erzähle.
Warum ich mich an der Couch festklammere? Tu ich das denn?
(lacht bemüht)
Es kommt mir vor, als würde sie schwanken, die Couch, wahrscheinlich deswegen. Ja, wirklich – grad hab ich mich gefühlt wie in einem Flugzeug, wie in meiner Fokker, wenn eine Sturmböe uns geschüttelt hat oder wir in ein Luftloch gesackt sind, meine Fokker und ich.
(zieht die Schultern hoch, schüttelt den Kopf wie in Zuckungen, winkt dann ab, schweigt wieder lange)
Sind Sie schon einmal geflogen, Herr Doktor? Auch nicht im Luftschiff? Nein, ich klammere mich ja nicht fest, ja, ich weiß doch, dass die Couch auf festem Boden steht, ich entspann mich ja schon, doch, doch, ich atme ganz tief und entspann mich.
(Schweigen, sehr lange)
Wenn ich nachts aufwache, mitten im Luftkampf, dann schwankt mein Bett, das ganze Schlafzimmer schwankt dann. Oder wenn ich die Stimme höre …
(spricht leiser, nahezu unverständlich)
… dann schwankt der Boden unter mir oder zittert zumindest ein bisschen, jedenfalls am Anfang, also wenn sie anfängt zu reden, die Stimme. Was sie sagt? Keine Ahnung, Herr Doktor, wirklich nicht, wenn ich’s nur wüsste! Sie ist kaum zu verstehen. Sie flüstert, wissen Sie? Aber nicht sanft. Streng und hart klingt sie.
(unterbricht sich, schluckt, spricht nur stockend weiter, heiser, gedämpft)
Streng und hart, fast ein bisschen wie die Stimme der Mutter. Oder nein – eher wie die Stimme des gnädigen Herrn? Ich glaube, sie schimpft mit mir. Wer das ist? Der gnädige Herr, meinen Sie? Na, der Vater, so nenn ich den Vater.
(schluckt immer wieder)
Liege ich jetzt entspannt, Herr Doktor? Lachen Sie über mich? Ich meine, wegen der Stimme. Ich weiß doch, Herr Doktor, ich weiß schon, dass Sie mich niemals auslachen würden, natürlich nicht.
(bemühtes Kichern, Abwinken, Schweigen)
Als ich zu mir kam damals, da hat meine Pritsche geschwankt, grad fällt’s mir ein. Damals im Lazarett, meine ich, als ich wieder zu Bewusstsein kam und all die Verwundeten um mich herum stöhnen, jammern und schreien hörte, ich hab’s Ihnen ja erzählt. Da hat meine Pritsche geschwankt, das ist wahr …
(kämpft mit den Tränen, schweigt wieder sehr lange)
Was ist das eigentlich für ein Gemälde hier über der Couch, Herr Doktor? Seltsam, dass mir das jetzt gerade ins Auge sticht. Ist das nicht von diesem düsteren Schweizer? Böcklin, genau! Ich kenn mich nicht so aus mit moderner Kunst, aber der Name hat mir auf der Zunge gelegen.
Wie heißt das Bild, sagen Sie? Die Toteninsel? Habe ich richtig verstanden? Ach was, Die Toteninsel, o weh …!
2Tänzerin
Böse Traumbilder weckten ihn. Er blinzelte in den Deckenstuck und versuchte, sie festzuhalten: Mord und Totschlag, Blut und Geschrei – irgendwer hatte den Generalmajor angegriffen, an viel mehr erinnerte er sich schon nicht mehr. Oder doch! Er hatte sich zwischen den Generalmajor und den Attentäter geworfen und sich gleichzeitig gefragt, warum er so dumm war, für einen wie den Alten sein Leben aufs Spiel zu setzen.
Weil es mein Beruf ist, dachte er und setzte sich im Bett auf, weil es mein verdammter Beruf ist.
Ein Blick nach rechts – Valerie schlief noch. Meine Güte, wie ihr blauschwarzes Haar auf dem weißen Seidenkissen schimmerte! Wie ein Fächer aus Rabengefieder. Und die schneeweiße Haut, die hohe Wölbung der Stirn über den schwarzen Brauenbögen und den schweren Lidern, die langen schwarzen Wimpern und der große Mund mit den vollen, so herrlich geschwungenen Lippen! Ein Übermaß an Schönheit, kaum zu ertragen.
Er bezwang den Wunsch, die Schlafende zu küssen, schob sich leise aus dem Bett und ging nackt hinüber ins Kaminzimmer. Auf der Schwelle ein letzter Blick noch auf seine Tänzerin, seine Herzdame, seine geliebte Hexe. Was für ein Glück, sie endlich wieder bei sich zu haben! Er formte die Lippen zum Kussmund und schloss dann geräuschlos die Tür hinter sich.
Letzte Holzstücke glühten noch in der Kaminasche, die Restwärme kroch ihm die Beine hinauf, über Rücken und Brust. Der dicke Perserteppich schmeichelte seinen Fußsohlen, die Luft roch abgestanden und schal.
Wie so oft, wenn er sich allein im Kaminzimmer aufhielt, blieb er kurz vor dem Ölporträt über dem schweren Eichensekretär stehen und betrachtete das schmale Frauengesicht: schwarzes zu einem Zopf geflochtenes Haar, hochstehende Wangenknochen, Haut so weiß wie die Perlen um den schlanken Hals, wehmütig lächelnder großer Mund mit schönen vollen Lippen, nahezu schwarze Augen.
Seine Mutter an ihrem siebten Hochzeitstag, kurz vor ihrem Tod. Damals war er vier Jahre alt gewesen. Wenn er an seine Mutter dachte, stand ihm meistens dieses Bild vor Augen. Wahrscheinlich, weil er es seit vierzig Jahren beinahe täglich betrachtete. Abgesehen von der Zeit auf der Kadettenschule und der Militärakademie; und von den Kriegsjahren natürlich.
«Maman bien-aimée», murmelte er; und nickte dann, als hätte er ihre Antwort gehört.
Er ging zur Fensterseite, zog einen Vorhang auf und öffnete das Fenster. Frostige Luft schlug herein, er wickelte sich in den bordeauxroten Stoff und beugte sich trotzdem hinaus: Raureif bedeckte den Rasen, der fette schwarze Kater des Nachbarn schlich um den marmornen Springbrunnen, den der Vater der Mutter zum sechsten Hochzeitstag geschenkt hatte; ein schwarzer Vogel hockte auf dessen Rand und sang sein Morgenlied, eine Amsel.
Er stutzte – eine Amsel? Wirklich? Waren die denn schon zurück? Er lauschte in den Morgen hinaus, während er die kalte Luft einsog, stand und lauschte so andächtig, als würde er zum ersten Mal den Gesang einer Amsel hören.
Oder zum letzten Mal.
Das Stampfen einer Lokomotive riss ihn aus seiner Versunkenheit, der D-Zug nach Halle. Für einen Moment hielt er den Atem an, und ein kalter Schauer kroch ihm über Nacken und Schultern. Er verabscheute dieses Geräusch. Als der Zuglärm sich entfernt hatte, hörte er Stiefelknallen und Rufe aus der nahen Kaserne, worüber er sich wunderte. So früh schon zum Appell? Und das am Sonnabend? Seltsam – gestern Abend jedenfalls war von Alarmbereitschaft nicht die Rede gewesen.
Einen Atemzug lang stieg ein Traumbild wieder an die Oberfläche seines Bewusstseins – der Attentäter, seine Militärpistole, sein Finger am Abzug, die Entschlossenheit in seinen Zügen, der ahnungslose Generalmajor. Das Bild verblasste und löste sich auf, doch es blieb das Gefühl, das er auch im Traum empfunden hatte: klammheimliche Freude.
Und trotzdem hatte er sich dazwischengeworfen.
«Ein Traum», murmelte er, «nur ein Traum.» Er schaute in die graue Wolkendecke, hinter der unsichtbar die Sonne aufging.
Merkwürdig, dieser Radau aus der Kaserne um diese Zeit, dachte er, während er das Fenster schloss und es ihm säuerlich aus dem Magen in die Kehle kroch. Viertel vor sieben Uhr schätzte er, Siegloch würde heute erst gegen neun mit dem Wagen vorfahren. Noch Zeit genug also für ein gepflegtes Frühstück.
Auf dem Weg ins Herrenzimmer las er seine Kleider vom Teppich auf – Wäsche, Socken, Hemd und Uniformhose lagen verstreut und zwischen Valeries Sachen um den Lesesessel herum. Darin hatten sie sich gestern Abend geliebt. Er nahm ihren seidenen BH hoch, küsste ihn, legte ihn über die Sessellehne.
Im Herrenzimmer ging er zum Schachtisch, wo seine Uniformjacke über einem Stuhl hing; auf einmal fühlte er sich unbehaglich. Er zog seine goldene Taschenuhr aus der Jacke: Vierzehn Minuten vor sieben – auf sein inneres Uhrwerk konnte er sich jederzeit verlassen. Vor dem Fenster zum Garten sang unermüdlich die Amsel. So ein Vogel hat gut singen, dachte er, so ein Vogel hat keine Sorgen.
Um zehn vor zehn wollte er im Neuen Rathaus sein, die Zeremonie war für zehn Uhr angesetzt; schon wieder musste irgendein Afrika-Veteran für besondere Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet werden. Dabei hatte die neue Regierung militärische Auszeichnungen abgeschafft. Jedoch – Anordnung aus Dresden. Von General Maercker persönlich. Dieser selbstherrliche Zwerg neigte dazu, seinen Willen mit dem Gesetz zu verwechseln!
Die Verleihung des Ordens hatte der Alte, Generalmajor von Pilsach, ihm aufs Auge gedrückt. Er hasste ihn dafür, auch dafür.
Der Lärm aus der Kaserne ging ihm nicht aus dem Kopf, und er spähte zum Fernsprecher, während er in die Unterhose stieg. Ob er vor dem Frühstück mal beim Kommandostab anrufen sollte?
Ein durchdringender Schrei ließ seinen Atem stocken, sodass er einen Augenblick stand wie festgefroren und sein Blick zum Fenster zuckte – draußen im Garten schrie eine Kreatur in Todesnot. Die Socken in der Rechten, lief er zum Fenster: Der schwarze Kater huschte vom Springbrunnen weg zur Lorbeerhecke hin, in seinem Maul zappelte die kreischende Amsel.
«Gustl!» Wie aus dem Nichts: Valeries Stimme. «Du hast mich noch gar nicht geküsst heute Morgen!» Er atmete tief ein, wischte sich die Tränen aus den Augen und drehte sich um: In ein Leintuch gehüllt stand sie in der Tür und zog einen Schmollmund, seine geliebte Tänzerin, seine zärtliche Hexe. Himmel, was für herrliche Schultern, dachte er.
«Was fällt dir denn ein?» Die Gestrenge mimend, rauschte sie heran, schlug ihm mit den Fingerspitzen auf die Wange und verschloss ihm gleich darauf mit ihren weichen Lippen den Mund. «Sofort kommst du wieder zu mir ins Bett!» Hinter sich her zog sie ihn zurück ins Schlafzimmer.
In der Hitze ihrer Arme, ihrer Küsse, ihrer Schenkel vergaß er den Kater, die Amsel, die Uhr, vergaß den Generalmajor und den Lärm aus der Kaserne. Er vergaß sogar Siegloch und die Zeremonie im neuen Rathaus, und als er das nächste Mal auf die Uhr blickte, staunte er, weil es schon nach acht war. Das gepflegte Frühstück konnte er vergessen.
Im Garderobenzimmer später hörten sie das Mädchen im Esszimmer mit den Kaffeetassen klappern. «Sie muss einfach Lärm machen, sie kann nicht anders.» Valerie verdrehte die Augen. «Reich mir mal meine Strümpfe, mein geliebter Krieger.»
«Bitte nenn mich nicht ‹Krieger›.» Er langte Valeries schwarze Seidenstrümpfe vom Waschtisch, reichte sie ihr und stellte sich wieder vor den Garderobenspiegel. «Du weißt, dass ich das nicht mag.»
«Aber das bist du doch!»
«Das war ich, meine süße Hexe.»
Aus irgendeinem Grund hatte sie eine Schwäche fürs Heroische mit all seinen glänzenden Abzeichen. Noch hatte er ihr nicht verraten, dass er seinen Abschied einreichen würde. Das Kuvert mit dem entsprechenden Schreiben an den Generalmajor lag bereits frankiert im Sekretär. Spätestens am Montag wollte er es in die Post geben. Ihm war ein wenig bange vor dem Augenblick, in dem er es ihr sagen würde. Doch noch musste sie nichts davon wissen.
Er schloss den Hosengurt, strich sich mit Pomade das blonde Haar zurück, modellierte seinen langen blonden Schnurrbart und schlüpfte in die Uniformjacke – der Blaue Max zwischen den Kragenaufschlägen, das Eiserne Kreuz und zwei weitere Orden an der Brustleiste und auf den Schulterstücken der goldene Stern, der seinen Rang verriet.
Aufmerksam und mit skeptischem Blick betrachtete er sein Spiegelbild: August von Herzberg, Oberstleutnant der sächsischen Infanterie, hochdekorierter Kriegsheld, rechte Hand des Leipziger Stadtkommandanten, vierundvierzig Jahre alt, hagere eins fünfundachtzig groß.
Die Uniformjacke hatte deutlich Luft in den Schultern, saß auch über Bauch und Brust keineswegs straff, und dennoch hatte er das Gefühl, dass sie ihm zu eng war, ihm sogar das Atmen schwer machte. Von Herzberg freute sich auf sein neues Leben als Zivilist. Glücklich war er nur in an der Seite seiner zärtlichen Tänzerin, seiner geliebten Hexe.
«Du glaubst nicht, wie sehr ich der Abendvorstellung entgegenfiebere!» Valerie knöpfte den linken Strumpf an den Bändern ihres Hüfthalters fest; an der Art, wie sie dabei ihren schlanken, drahtigen Leib bog, konnte er sich kaum sattsehen. «Nach den himmlischen Stunden in deinen Armen werd ich heute Abend nicht einfach nur tanzen – ich werde fliegen, mein Gustl-Held!» Anmutig warf sie die Arme hoch, drehte eine Pirouette, sprang über den Hocker und dann an seine Brust. «Fliegend werd ich den Raben tanzen, fliegend die Hexe, fliegend den Tod!» Gierig küsste sie ihn und rieb ihre Hüften an seinen. «Und du bist schuld.»
Die Amsel und der Kater standen ihm plötzlich vor Augen, während er sie umarmte, und ein Vers fiel ihm ein. «Hoffentlich wird es recht düster sein in meiner Loge, damit keiner mich erröten sieht.» Er küsste sie auf die Stirn, machte sich von ihr los und zog Stift und Notizbuch aus der Uniformtasche, um den Vers zu notieren. «Und tu mir den Gefallen, geliebte Hexe, und tanz nicht wieder halb nackt.»
Sie lachte. «Was für komische Einfälle du manchmal hast!» Ein leichtfüßiger Sprung brachte sie zum Garderobenständer, auf dem ihr schwarzes Kleid hing. «Natürlich werde ich so wenig anziehen wie irgend möglich, mein süßer Kriegsheld. Vielleicht sogar gar nichts! Was schreibst du denn da schon wieder?»
«Nenn mich nicht Kriegsheld …»
«Das bist du doch! Mein geliebter Kriegsheld Augustus bist du …»
«… und bitte nicht wieder diese Nacktnummer!» Von Herzberg verdrehte die Augen und steckte das Notizbuch ein. «Du weißt doch, dass sie dir dann …»
Er schluckte herunter, was ihm sonst noch auf der Zunge lag, denn statt vor einem weiteren Auftrittsverbot zu warnen, musste er lauschen – ein Automobil hatte mit quietschenden Bremsen gehalten; augenblicklich schoss es ihm wieder säuerlich aus dem Magen die Kehle herauf. Jetzt verstummte auch das letzte Motorengestotter, kurz darauf schlug eine Wagentür zu, dann näherten sich rasche Schritte.
«Das ist der Benz deines Regiments, Liebster!» Valerie stand längst auf Zehenspitzen am Fenster. «Dein Chauffeur hat’s aber eilig.»
«Siegloch?» Von Herzberg riss die Taschenuhr heraus. «Tatsächlich?» Er tat überrascht, hatte es jedoch insgeheim geahnt. Der Lärm aus der Kaserne. «Was will der denn schon? Ist doch erst halb neun.» Vom Fenster aus sah er seinen Stabsgefreiten schon nicht mehr. «Ist er wirklich die Vortreppe hochgelaufen?» In diesem Moment erklang das Glockenspiel der Haustürklingel.
Sicher – Hans Siegloch pflegte überpünktlich zu sein, doch eine halbe Stunde zu früh zu kommen, war dennoch nicht seine Art. Und an der Haustür zu läuten, zweimal nicht. Von Herzberg machte sich nichts vor: Nicht nur das gepflegte Frühstück, das ganze freie Wochenende konnte er vergessen.
Er räusperte sich, schluckte den sauren Geschmack herunter, der ihm auf der Zunge brannte. «Irgendetwas muss passiert sein», sagte er mit gepresster Stimme.
«Um Gottes willen!» Valerie schlug die Hände an die Wangen, während er sich abwandte, um zur Esszimmertür zu eilen. «Du wirst doch nicht etwa wieder fortmüssen?»
Statt zu antworten, strich er ihr fahrig über die Wange und wandte sich vom Fenster ab, um in die Empfangshalle zu gehen.
Seit zehn Monaten bewohnte von Herzberg wieder die große Villa in Gohlis, die er von seinem Vater geerbt hatte; seit er im Mai letzten Jahres mit General Maercker in Leipzig einmarschiert war, um die Arbeiter- und Soldatenräte zu entmachten und der neuen, der Weimarer Verfassung Geltung zu verschaffen. Valerie stieg hier bei ihm ab, wenn sie in Leipzig und Dresden gastierte, oder auch auf ihren Reisen zwischen Berlin und München. Mit denen allerdings war es vorerst vorbei, denn im Januar hatten die Bayern ein Auftrittsverbot wegen Nackttanzens über sie verhängt.
Im Esszimmer kam ihm das Mädchen entgegen. Mit einem Knicks präsentierte es ihm das kleine Silbertablett für die Post. Er sah den Regimentsstempel auf dem Kuvert, und seine Ahnung wurde endgültig zur Gewissheit.
«Bieten Sie meinem Chauffeur bitte einen Kaffee an», sagte er, nahm das Kuvert vom Tablett und öffnete es, während er zurück ins Garderobenzimmer ging.
«Und?» Seine Geliebte tänzelte ihm entgegen. «Ein Brief? Du musst nicht fort, nicht wahr, Liebster?» Sie war noch bleicher als sonst. «Bestimmt fällt nur die Ordensverleihung aus.»
«Ein Brief vom Alten.» Er zog das Schreiben aus dem Kuvert und überflog es. In nur wenigen Zeilen wies der Generalmajor auf die beiliegende Abschrift eines Telegramms aus der Reichshauptstadt hin. «Mit einem Telegramm aus dem Reichstag.» Stumm und mit steinerner Miene las er den Wortlaut – und sog dann scharf die Luft durch die Nase ein.
«Etwa eine Dienstreise nach Dresden?» Valerie biss sich auf die Unterlippe.
Er schüttelte den Kopf und faltete die Briefbögen zusammen. «Sag, dass du nicht fortmusst!» Beinahe flehend schaute sie zu ihm auf.
«Schlimmer.»
«Randalieren etwa die Arbeiter wieder?»
«Noch schlimmer.» Er atmete tief.
«Was denn?!» Sie zerrte an seinem Arm. «Nun sag doch endlich, Gustl!»
«Bürgerkrieg.»
Valerie entfuhr ein Schrei. Sie packte ihn an den Knopfleisten seiner Uniformjacke und zog ihn an sich. «Aber zu meinem Auftritt musst du trotzdem kommen! Hörst du? Du hast es mir versprochen!»
3Kameraden
Der Anruf erreichte ihn kurz vor acht. Westhof war gerade aus dem Bett gekrochen und in seine gute Stube gewankt. Mit ausgestreckten Armen auf die Anrichte gestützt, stierte er die gerahmte Fotografie des Kommandanten an, als der Fernsprecher läutete. Er zog genervt die Schultern hoch, kniff die schmerzenden Augen zusammen und fluchte leise.
Behutsam wandte er den brummenden Kopf ein wenig, sodass der kleine Tisch in sein Blickfeld geriet, auf dem der vibrierende Apparat stand. In Momenten wie diesen fragte er sich, welcher Dämon ihn geritten hatte, als er diese moderne Nervensäge gekauft und einen Wohnungsanschluss beantragt hatte. Wahrscheinlich war er betrunken gewesen.
Er wandte sich wieder dem Kommandanten zu. Das große Porträtfoto an der Wand steckte hinter Glas in einem schwarzen Rahmen, den Westhof regelmäßig mit frischem Grün bekränzte; Lorbeer- oder Eichenzweigen, je nachdem, was die Jahreszeit gerade zu bieten hatte. Vor drei Tagen hatte er das Bild mit Tannenzweigen geschmückt, doch die wollte er noch heute gegen Efeu austauschen, denn ein deutscher Kriegsheld mit Weihnachtsdekoration? Das passte einfach nicht.
Westhofs Kopf schmerzte, ihm war schlecht, und der Fernsprecher läutete und läutete. «Wer zum Teufel ruft mich am Sonnabendmorgen an?» Er ging zum Fenster, drückte den Vorhang ein Stück zur Seite und blinzelte in den grauen Märzhimmel über den nassen Dächern von Plagwitz. «Ist doch gerade erst Tag geworden, verdammt noch mal!»
Zurück vor der Anrichte, nahm er seine Offiziersmütze vom Wandhaken, setzte sie auf, stand stramm, klatschte die nackten Fersen zusammen und legte die Fingerspitzen an den Schirm. «Staffelführer Westhof meldet sich zum Dienst, Herr Rittmeister!»
Ohne den lächelnden Offizier auf dem Bild aus den Augen zu lassen, fischte er die noch halb volle Weinflasche aus dem Geschwader der Flugzeugmodelle, die er rund um die samtene Leiste mit seinen Orden und Auszeichnungen gruppiert hatte. Der Fernsprecher wollte und wollte nicht aufhören zu läuten. Westhof versuchte, den durchdringenden Radau zu ignorieren, entkorkte die Flasche, füllte das Glas, aus dem er am Abend zuvor Schnaps getrunken hatte, und prostete dem Geschwaderkommandanten zu, dem Roten Baron, wie sie ihn genannt hatten.
«Auf die glorreichen alten Zeiten, Herr Rittmeister.» Er trank einen Schluck. «Mögen sie bald zu noch glorreicheren wiederauferstehen!» Er nahm einen größeren Schluck. «Mögen deutsche Männer sich bald ein Herz fassen und dieser Totgeburt von Republik ein rasches Ende bereiten, dieser stinkenden Eiterbeule namens Demokratie. Auf Männer, die noch wissen, was Ehre, Kampfeshärte und Fahnentreue bedeuten, Männer wie Sie und ich!» Er leerte sein Glas, und unentwegt läutete der Fernsprecher.
Westhof glaubte zu wissen, wer ihn in dieser Herrgottsfrühe anrief: eine seiner Frauen, wer sonst? Seine Mutter oder seine Ex-Verlobte. Vielleicht auch seine Ex-Ex-Verlobte; die wollte ihm nämlich ein Kind anhängen. Oder seine künftige Verlobte? Auch möglich.
«Na gut.» Er stellte das leere Glas zu den Flugzeugen. «Dann wollen wir doch mal hören, was so Dringendes anliegt.» Auf dem Weg zum Tischchen neben der Stubentür zündete er sich eine Zigarette an und räusperte sich, bevor er endlich den Hörer abnahm. «Westhof. Was gibt’s denn?»
«Heinze, Polizeiamt Leipzig. Kannst du sprechen, Fritz?»
«Ich bin allein, falls du das meinst.» Es entspannte ihn ein wenig, die Stimme des Turnkameraden zu hören, statt die einer Frau. Oder wirkte bereits der Wein? Westhof ließ sich auf den Stuhl neben dem Fernsprecher sinken und zog den Aschenbecher heran. «Was ist los, Rudi?»
«Bald der Teufel, schätze ich. Kapitän Ehrhardts Marinebrigade ist in Berlin einmarschiert …»
«Die Kameraden, die letztes Jahr in München die Arbeiterräte und in Berlin die Spartakisten zur Hölle geschickt haben?!» Westhof traute seinen Ohren kaum.
«… samt Liebknecht und Luxemburg. Genau die, Fritz. General Lüttwitz scheint wieder die treibende Kraft zu sein, jedenfalls hat er Bauer und Ebert für abgesetzt erklärt.»
Westhof riss Augen und Mund auf und hockte auf einmal kerzengerade auf der Stuhlkante. «Das sind ja zur Abwechslung mal richtig gute Nachrichten!» Schlagartig war er hellwach. «Und was ist dem jämmerlichen Kanzler Bauer und unserem fetten Reichspräsidenten dazu eingefallen?»
«Sind angeblich auf der Flucht. Der Reichstag soll schon besetzt sein. Dort hat sich Herr Doktor Kapp zum neuen Reichskanzler ausrufen lassen.»
«Wolfgang Kapp? Der Bezirkschef von Königsberg?» Westhof lachte laut auf. «Das wird ja immer schöner!» Er schlug sich wiehernd auf den Schenkel. «Ein verdammter Putsch? Ist das wirklich wahr? Das wäre ja hervorragend! Woher weißt du das alles, Rudi?»
«Ein Kamerad von den Berliner Turnern hat mich angerufen. Und aus der Kaserne in Gohlis hat es mir ein Kontaktmann gerade erst bestätigt; dort herrscht schon Alarmbereitschaft.»
«Dann kann ja nichts mehr schiefgehen.» Westhof saugte an seiner Zigarette. «Die Reichswehr wird sich doch hoffentlich auf die Seite der Putschisten stellen?»
«Warten wir’s ab. Ich muss mich kurzfassen, Fritz, die Kollegen sind gleich hier. Wenn sich der Putsch in Leipzig rumspricht, werden wahrscheinlich die Arbeiter auf die Barrikaden gehen.»
«Darauf kannst du Gift nehmen! Die Spartakusleute warten doch nur auf einen Anlass, um endlich losschlagen zu können.»
«So ist es leider, Fritz. Andererseits gäben sie uns damit einen Anlass, sie zu erledigen. Richtig zu erledigen, meine ich. Ich denke, da sind wir einer Meinung.»
«Verlass dich drauf, Rudi.»
«Was wir hier von der Wächterburg aus tun können, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, werden wir natürlich tun. Leider hat unser neuer Inspektor dafür gesorgt, dass man mich in die Sitte versetzt …»
«Stainer? Der rote Judas?»
«Genau der. Ich kann mich also nur beschränkt einmischen. Allerdings hat mir der Zufall einen gewissen Einfluss auf die politische Abteilung in die Hände gespielt, sodass ich einen verdienten Kameraden auf freien Fuß setzen konnte. Wie auch immer: Sieh du zu, dass du bald in die Innenstadt kommst und deine Leute von der Weißen Garde in Stellung bringst.»
«Bin schon unterwegs, Rudi. Halt die Ohren steif, und – ran!»
Westhof legte auf. Er inhalierte tief und blies behaglich den Rauch aus. Lächelnd und kopfschüttelnd zugleich betrachtete er die aufsteigenden Schwaden. «Ein Putsch, ich glaub’s ja nicht!» Pfeifend stand er auf, ging zur Anrichte und schenkte sich Wein nach. «Es geht los, Herr Rittmeister!» Lachend prostete er dem Porträt zu. «Noch ist das Kaiserreich nicht verloren!» Er war aufgekratzt, sein Kater wie weggeblasen.
Beinahe zärtlich betrachtete er das Porträt seines gefallenen Geschwader-Kommandanten, das bestens gelaunte Gesicht eines Mittzwanzigers, das nichts als Willenskraft, Selbstvertrauen und Siegesgewissheit ausstrahlte – all das, was Westhof seit der Kapitulation und dem sogenannten Friedensvertrag zunehmend abhandenkam. «Dann also ran, Herr Rittmeister!» Er hob das Weinglas. «War das nicht unser Schlachtruf, wenn die englischen Störche heranknatterten und wir zu unseren Jagdmaschinen spurteten? Ran!»
Die Türglocke schellte. Er drehte den Kopf und lauschte. Etwa schon die Kameraden? Im Auftrag der Reichswehr kommandierte er drei Kompanien des Zeitfreiwilligen-Regiments, das der große General Maercker letztes Jahr nach der Besetzung Leipzigs aufgestellt hatte; Weiße Garde nannte die Bevölkerung die Miliz, der viele Studenten angehörten.
Westhof stellte das Glas ab, drückte die Zigarette aus und ging in den Flur. Dort nahm er den ledernen schwarzen Fliegermantel von der Garderobe, zog ihn über sein Nachthemd, rückte die Offiziersmütze zurecht und öffnete die Wohnungstür.
Ein zierlicher Mann mit dunkelblondem, schütterem Haar stand im Treppenhaus. «Ich werd verrückt …!» Es verschlug Westhof die Sprache, als er das schmale Gesicht mit den hellblauen Augen erkannte. Wortlos riss er den anderen an sich und umarmte ihn. Der fühlte sich seltsam steif an. Westhof zog ihn in die Wohnung und drückte die Tür zu.
«Herrgott noch mal – dich habe ich ja ewig nicht gesehen! Wie hast du mich gefunden, Waldo?» Besuch war eigentlich das Letzte, was er jetzt brauchen konnte, doch ehemalige Geschwaderkameraden durften ihn sogar nachts aus dem Bett klingeln.
«War kein Kunststück, Herr Hauptmann. Über die Kirchengemeinde.»
«Was hast du da drin?» Westhof deutete auf den Instrumentenkoffer seines Gastes. «Deinen Karabiner? Samt Munition? Dann weißt du also schon Bescheid.»
«O ja, ich weiß Bescheid, Herr Hauptmann.» Der andere hinkte an ihm vorbei und weiter in die Wohnung hinein. «Ich weiß genau, was ich zu tun habe.»
«Kannst das Ding hier unter die Garderobe stellen.» Die hohle Stimme des Kameraden machte Westhof stutzig. «Was ist los mit dir? Und warum trägst du deine Orden nicht, Waldo?» Er winkte ihn hinter sich her in die gute Stube. «Was ist das überhaupt für eine komische Uniform, die du da anhast?»
«Es dauert nicht lang, Herr Hauptmann.»
«Der Putsch? Das glaube ich auch. Wenn wir das rote Pack schnell in den Dreck getreten kriegen, wird das eine recht kurze Vorstellung. Jedenfalls bei uns hier in Leipzig. Doch dass die Kameraden in Berlin und im Ruhrgebiet auch nicht zimperlich sind, wissen wir ja.» Er lachte wiehernd, schlug dem anderen auf die schmale Schulter und deutete auf einen Sessel. «Mensch! Dass ich dich noch einmal wiedersehe, Waldo! Nimm Platz, Kamerad. Ich muss mich eben anziehen. Bevor wir in die Stadt gehen, mach ich uns natürlich noch einen Kaffee. Zigarette?»
Westhof deutete auf die Zigarettenschachtel, die vor den Flugzeugmodellen auf der Anrichte lag, und verschwand im Schlafzimmer. Weil ihm sein Besucher eigenartig vorkam, ließ er die Tür offen stehen, um ihn im Spiegel der Schranktür beobachten zu können.
«Was ist los mit dir, Waldo? Du warst doch früher nicht so wortkarg.» Während er in Wäsche und Hose stieg, sah er den anderen wie festgefroren vor der Anrichte stehen. Statt zu den Zigaretten zu greifen, starrte er erst die Flugzeugmodelle an und dann das Porträt. «Sag bloß, du hast dir das Rauchen abgewöhnt, Waldo!» Westhof verfiel in Hektik, denn aus irgendeinem Grund machte ihn der schmächtige Mann vor der Anrichte nervös.
«Sie haben sich das Foto des Rittmeisters also an die Wand gehängt, Herr Hauptmann», kam es aus der Stube.
«Selbstverständlich!» Die hohle Stimme des anderen und seine monotone Art zu sprechen behagten Westhof immer weniger. «Du etwa nicht?» Hatte der arme Kerl womöglich einen Schaden zurückbehalten? Sein Abschuss war ja alles andere als glimpflich verlaufen, wie man sich im Geschwader erzählt hatte.
«Wir waren per Du, Waldo, hast du das vergessen?» Westhof stieg in seine Hose. «Komm, schenk dir Wein ein, Gläser stehen im Büfett.» Er war so fahrig auf einmal, dass er die Gurtkoppel nicht geschlossen kriegte. «Die Franzmänner mögen lausige Piloten sein, doch ihr Wein schmeckt verdammt gut.»
Im Schrankspiegel beobachtete er weiter die starre Gestalt des anderen. «Du wirst dir doch hoffentlich nicht auch das Weintrinken abgewöhnt haben? Mach mich bloß nicht schwach! Weißt du noch, wie wir unsere Abschüsse gefeiert haben, abends nach den Einsätzen? Himmelsakrament, was haben wir gesoffen! Und was bist du für ein Teufelskerl von einem Kampfflieger gewesen!»
«Ich bin jetzt Musiker, Herr Hauptmann.»
«Musiker? Wirklich?»
«Und bald werde ich Schauspieler sein.»
«Musiker und Schauspieler, was du nicht sagst.» Westhof fragte sich, warum er so viel redete, warum er den Kameraden im Nebenzimmer nicht aus den Augen lassen konnte, warum er das verdammte Koppelschloss nicht zubekam. «Wie viele hast du eigentlich abgeschossen damals, Waldo? Unterm Strich, meine ich. Ich habe es immerhin auf neunzehn gebracht, bevor mich die Australier vom Himmel geholt haben. War kein Spaß, doch das muss ich einem wie dir ja nicht erzählen.»
«Dreiunddreißig, Herr Hauptmann, genau dreiunddreißig.»
«He, Waldo!» Endlich, er schaffte es, den Gurt zu schließen. «Für dich bin ich immer noch der Fritz. Das ist ein Befehl, Herr Leutnant!» Er griff sich seine Jacke und trat auf die Türschwelle. «Irgendwas stimmt nicht mit dir, Waldo. Sag mal: Hast du eigentlich einen Kopfschuss abgekriegt damals?» Er runzelte die Stirn. «Du erinnerst dich doch an mich, oder?» Kaum hatte er es ausgesprochen, winkte er ab. «Na klar erinnerst du dich, sonst hätt’st du mich ja nicht gefunden.»
«O ja, Herr Hauptmann, ich erinnere mich sogar sehr gut an Sie.» Jetzt kam doch noch Bewegung in Westhofs Gast – er langte zwei Flugzeugmodelle aus dem Geschwader heraus und hielt sie in Augenhöhe vor sich hin. «Ich erinnere mich sogar ganz genau.»
«Waren es nicht vierunddreißig Abschüsse? Ich könnt’s schwören.» Westhof schlüpfte in seine Jacke. «Nach dem zwanzigsten haben sie dir den Blauen Max verpasst, das weiß ich genau. Warum zum Teufel trägst du den eigentlich nicht? Du bist ein Ritter des höchsten Ordens und zeigst ihn nicht?»
«Dreiunddreißig, Herr Hauptmann, den vierunddreißigsten zähle ich nicht mit, der geht auf Ihr Konto. Ich erinnere mich sehr gut, Herr Hauptmann. Ich denke jeden Tag daran. Ich wünschte, ich könnte es vergessen.»
Jetzt war es Westhof, der reglos verharrte. Für ihn stand endgültig fest, dass der Geschwaderkamerad den Abschuss nicht ohne Folgen überstanden hatte. «Woran, Waldo?», fragte er leise. «Woran denkst du jeden Tag?» Er neigte den Kopf auf die Schulter. «Was genau willst du vergessen?»
«Wie Sie befohlen haben, den Engländer zu verfolgen. Wie wir’s dann getan haben. Und wie es dann passiert ist.»
Aus schmalen Augen musterte Westhof den anderen. In den ersten Wochen hatten sie ihn Waldi genannt, weil er mit seiner Maschine so ziellos durch die feindlichen Geschwader geirrt war wie ein junger Dackel durch einen Entenschwarm. Wochenlang hatte er keinen Abschuss hingekriegt, der Rote Baron hatte ihn schon rausschmeißen wollen. Westhof betrachtete seine kerzengerade Gestalt, sein weiches Profil, seine hohe Stirn, das Geflecht der Brandnarben über seinem Mantelkragen, die Modelle der beiden Jagdflugzeuge in seinen vernarbten Fingern, einen roten Fokker Dreidecker und eine weiße Albatros.
So stand kein normaler Mann. So hielt kein normaler Mann ein Flugzeugmodell. So guckte kein normaler Mann.
Westhofs Nackenhaare stellten sich auf.
«Du kommst mir irgendwie komisch vor, Waldo, direkt unheimlich.» Er erschrak vor der eigenen Stimme, denn auf einmal klang sie belegt, ja brüchig. Er räusperte sich. «Was zur Hölle ist los mit dir?» Langsam und mit lauerndem Blick ging er auf den anderen zu. «Auch, dass du deinen Blauen Max nicht trägst, ist mehr als komisch. Und deine Uniform sowieso.» Der Instrumentenkoffer, den der andere in der Diele abgestellt hatte, fiel ihm ein. «Musiker und Schauspieler, sagst du, hm. Hör mal, Waldo: Du bist doch bei der Weißen Garde, oder?»
«Es muss sein, Herr Hauptmann.» Der Mann vor der Anrichte machte kreisende Bewegungen mit den beiden Flugzeugmodellen. So als wollte er jedes in eine günstige Angriffsposition bringen. «Seit es passiert ist damals, hat es nie eine andere Wahl gegeben. Es muss sein.»
Er breitete die Arme aus, imitierte plötzlich wie ein spielender Junge die brummenden, heulenden Töne von Jagdflugzeugen und ließ dann die beiden Modelle in einer jähen, ruckartigen Bewegung zusammenstoßen. Die rote Fokker und die Albatros zersplitterten in Hunderte Einzelteile.
«Spinnst du?!» Westhof stürzte sich auf ihn. «Bist du denn vollkommen übergeschnappt, du Arsch?!» Er packte den Kameraden am Kragen und zerrte ihn weg von der Anrichte. Jedenfalls versuchte er es, doch so grob und kraftvoll Westhof auch zerrte und riss – der Geschwaderkamerad stand wie eine tief in der Erde verankerte steinerne Säule und war nicht von der Stelle zu bewegen.
«Es muss sein, Herr Hauptmann», flüsterte der Mann, während seine schmalen Hände an Westhofs Hals flogen und sich um seine Gurgel schlossen.
Dem Hauptmann war, als würde ein Schraubstock ihm die Luft abdrücken. Er griff nach den Handgelenken des anderen, trat nach seinen Knien, versuchte, sich auf alle Arten zu befreien, die er jemals gelernt hatte. Doch sein kleinerer und leichterer Gegner ließ einfach nicht locker, würgte Westhof mit eiserner Hartnäckigkeit und mit einer Kraft, die der Hauptmann ihm niemals zugetraut hätte und die keinen Moment nachließ. Erst als Westhof schon halb besinnungslos erschlaffte und in den Knien einknickte, gab er ihn frei.
Der Hauptmann stürzte aufs Parkett und erbrach sich. Er wälzte sich unter dem Tisch hindurch auf die andere Seite der Stube. Der jähe Angriff seines Kameraden und dessen ungeheure Kraft stürzten ihn in Panik. Während ihm das Wasser aus den Augen und aus der Blase rann, begriff er mit tödlicher Klarheit, dass er nur eine Chance hatte: Er musste ins Schlafzimmer. Er musste es bis zum Kleiderschrank schaffen. Er musste an den geladenen Revolver gelangen, den er dort zwischen Wäsche und Socken vergraben hatte. Er musste!
Oder er würde sterben.
Hinter sich hörte er splitternde und krachende Schläge, als er über die Schwelle des Schlafzimmers kroch. Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Kamerad mit der Weinflasche auf die Flugzeugmodelle eindrosch. «Ran!», schrie Waldo vor jedem Schlag. «Ran!»
Mit aller Selbstbeherrschung, zu der Westhof noch fähig war, kämpfte er gegen den Brechreiz an, gegen die aufbrandende Ohnmacht, gegen die Schwäche. Seine eingenässten Hosen beschämten und entmutigten ihn.
Dennoch schaffte er es irgendwie bis zum Schlafzimmerschrank, schaffte es sogar, die Schranktür zu öffnen und seine Hand zwischen die Wäschestapel und in den Sockenhaufen zu bohren. Schon spürte er das Metall der Waffe.
Er tastete nach dem Revolver, riss ihn aus den Kleiderhaufen und warf sich herum. Unter der Schlafzimmertür stand sein ehemaliger Leutnant: in der Linken das Porträt des Rittmeisters, in der Rechten ein entsetzlich großes Messer und auf dem bleichen Gesicht das traurige Lächeln eines Kindes.
Westhof drückte ab.
4Tapferkeit vor dem Feind
Am Vormittag war noch alles ruhig. Nasskaltes Wetter hielt die Leipziger in ihren Häusern und Wohnungen. Kaum Leute in der Elektrischen, die vor ihnen in den Königsplatz einbog, kaum Fußgänger auf den Bürgersteigen und nur einzelne Fuhrwerke und Automobile auf den Straßen. Dachte irgendjemand an Generalstreik, Sondersitzungen oder Straßenkämpfe? Paul Stainer jedenfalls nicht.
Sein Vater vielleicht. Jedes Plakat des Spartakusbundes oder der Unabhängigen SPD, an dem Stainer ihn auf dem Weg zum Neuen Rathaus vorbeischob, entlockte dem Alten Schimpftiraden auf die Regierung Noske-Bauer und den Reichspräsidenten Ebert. Stainer hörte es kaum noch.
Seine Mutter schon. «Reg dich doch nicht so auf, Heini», mahnte sie wieder und wieder. Und als Stainer senior das «verfluchte rote Schweinepack» einmal besonders herzhaft zur Hölle wünschte, rief sie entnervt: «Nun halt endlich die Klappe, Heinrich! Du führst dich auf wie ein Straßenlümmel! Merkst du das denn nicht?»
Stainers Vater schnappte nach Luft. «Das ist ja wohl der Gipfel der Frechheit!» Das Blut stieg dem Alten ins Gesicht. «Was versteht ihr Weiber denn von Politik?»
Stainers Mutter bestand ähnlich laut darauf, von Politik auf alle Fälle mehr zu verstehen als ihr Gatte von Anstand und kultiviertem Benehmen, und schon ergab ein Wort das andere. Sie stritten den ganzen weiteren Weg von der Haltestelle bis zum Neuen Rathaus.
Stainer guckte so unbeteiligt wie möglich und schwieg. Blieb nur zu hoffen, im Rathaus jemanden zu treffen, der seiner Mutter nach der Zeremonie helfen würde, den Alten nach Hause zu bringen. Er selbst ertrug seinen Vater nur eine begrenzte Zeit.
Das Neue Rathaus glich in Stainers Augen eher einem Königsschloss als einem nüchternen Behördengebäude. Der wuchtige Turm, den man von der früheren Burg übrig gelassen und um dessen Stumpf herum man das Rathaus gebaut hatte, erinnerte ihn an den Bergfried einer mittelalterlichen Raubritterburg. Als Student hatte er schon den Rohbau nicht gemocht.
Etwa zwei Dutzend Männer erwarteten sie an der breiten Außentreppe, die Hälfte uniformiert und mit Orden und Medaillen behängt. Völkisch oder wenigstens national gesinnte junge und mittelalte Kameraden zumeist, die den alten Stainer als Kriegshelden bewunderten und die, wie er, den Kaiser Wilhelm wieder an der Spitze des Reiches sehen wollten. Die jüngeren unter ihnen trugen fast alle die Uniform der Weißen Garde.
Unter den älteren erkannte Stainer eine Handvoll grauköpfiger Veteranen, die mit seinem Vater in Deutsch-Südwestafrika gegen die Herero und die Nama gekämpft hatten; oder genauer: sie massakriert hatten. So gut er konnte, entbot ihnen der Alte vom Rollstuhl aus den militärischen Gruß. Einige standen stramm, andere klopften ihm auf die Schulter.
Die meisten dieser Männer kannte Stainer flüchtig von wenigen Begegnungen am Stammtisch ihrer Billardkneipe, wohin er seinen Vater zweimal geschoben hatte, seit er selbst Ende Januar aus französischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war. Er nickte ihnen angemessen höflich zu, reichte seiner Mutter den Regenschirm und gab den Männern ein Zeichen. Zwei Afrikaveteranen hielten daraufhin einen Türflügel auf, und drei Studenten von der Weißen Garde packten mit an, um den Rollstuhl mit dem Gelähmten die Vortreppe hinauf- und in die gigantische Eingangshalle hineinzutragen. Auch dort hatten sich bereits einige Männer und Frauen eingefunden, die an der Zeremonie teilnehmen wollten.
Ein hochgewachsener weißhaariger Endsechziger löste sich aus der plaudernden Menschentraube und kam auf Stainer und seine Eltern zu. «Da seid ihr ja endlich!»
Der Sanitätsrat und Polizeiarzt Dr. Philipp Eckstein begrüßte sie und nickte in die Runde. In Deutsch-Südwestafrika wo er Stabsarzt gewesen war, hatte er Stainers Vater nach dessen schwerer Verwundung operiert und ihm so das Leben gerettet. Heute stritten sie über Politik oder spielten Skat.
«Dein neuer Orden ist schon im kleinen Festsaal oben, Heinz», erklärte Eckstein launig. «Mit einem Offizier und drei Mann Ordonnanz im Schlepptau.»
«Nur ein Offizier?» Stainer senior schnitt eine mürrische Miene. «Rang?»
«Oberstleutnant, soviel ich gesehen habe.»
«Nur ein Oberstleutnant?» Heinrich Stainer schlug mit der Faust auf die Rollstuhllehne. «Ich bin davon ausgegangen, dass der General persönlich mir die Ehre geben wird!»
«Du hast tatsächlich erwartet, dass Maercker in Dresden in die Eisenbahn steigt, um dir das nächste Stück Blech an die Brust zu hängen?» Stainer schüttelte müde lächelnd den Kopf. «Der hat, weiß Gott, Wichtigeres zu tun.» Seinem Vater stieg die Zornesröte ins Gesicht.
General Maercker kommandierte als Oberbefehlshaber den Wehrkreis IV der Reichswehr, mit Hauptquartier in Dresden, wo er mit seinen Regimentern stationiert war, um die noch junge sächsische Regierung vor linken Revolutionären und rechten Putschisten zu beschützen. Seit er mit seinem Landjägerkorps die Arbeiter- und Soldatenräte in Gotha, Halle, Magdeburg, Braunschweig und Leipzig entmachtet hatte, nannten sie ihn im Reich den Städtebezwinger. «Was für eine respektlose Frechheit!» Der Alte brauste auf. «Ein Stück Blech?! Man wird mich heute mit dem goldenen Militär-Verdienstkreuz für besondere Tapferkeit vor dem Feind auszeichnen! Außerdem spreche ich nicht von General Maercker, sondern von Generalmajor Senfft von Pilsach.» Von Pilsach, seinerseits Kommandant der sächsischen Reichswehrbrigade 18, sorgte unter Maerckers Oberbefehl in Leipzig für Ruhe und Ordnung. «Der hätte sich ruhig die Mühe machen können, hätte dazu nicht einmal in einen Zug steigen müssen, wohnt schließlich in Gohlis.»
«Du immer mit deinen steilen Ansprüchen, Heini!» Marianne Stainer winkte ab. «Freu dich doch einfach über die Ehrung und sei dankbar, dass die Reichswehr überhaupt einen hochrangigen Offizier schickt.» Seine Mutter sprach aus, was Stainer dachte.
«Das ist ja wohl das Mindeste!», donnerte der Alte.
Wenigstens hörte er auf, die Regierung zu beschimpfen, während Stainer ihn zum Paternoster schob. In Gegenwart seines Skatbruders und alten Freundes Philipp Eckstein pflegte er sich zurückzuhalten, wenn er nicht gerade zu viel getrunken hatte. Eckstein nämlich war wie Stainer SPD-Mitglied; außerdem saß sein Schwiegersohn für die Regierungspartei im Stadtparlament. Das immerhin respektierte Stainer senior; wenigstens gab er sich den Anschein.
Der sperrige Rollstuhl passte nicht in den Paternoster. Also setzten sie den Alten auf einen Stuhl, den jemand aus einem Kontor holte und in den Aufzug stellte. Die Mutter und einer der Afrikaveteranen hielten ihn auf der Fahrt nach oben fest, während Stainer und Eckstein den Rollstuhl ins erste Obergeschoss hinauftrugen.
Das Vestibül mit dem Treppenaufgang entsprach der schlossartigen Eingangshalle: breit, wuchtig, prachtvoll ausgestattet und großzügig dekoriert. Die Balustraden waren ein einziger steinerner Bilderreigen mythischer Figuren, an denen vorüber Stainer und der Amtsarzt den Rollstuhl zur unteren Wandelhalle hinauftrugen. Auch hier oben: eine feudale Prunkwelt aus neoklassizistischen Säulen, antiken Bögen, weißen Marmorfiguren und neobarockem Pomp, aus der schier endlose Zimmerfluchten in die Tiefen des Gebäudes und breite Prachttreppen zur oberen Wandelhalle und in weitere Stockwerke führten.
Eine Residenz des gehobenen Bürgertums, erbaut erst vor wenigen Jahren und doch in einer untergegangenen Zeit. Niemand vermochte sich damals vorzustellen, dass ein großer Krieg, eine blutige Revolution und eine Weimarer Republik das sächsische Königtum und das deutsche Kaiserreich bald hinwegfegen würden, wie ein Windstoß vertrocknetes Herbstlaub von der Straße fegte. Niemand – abgesehen von ein paar sogenannten Wirrköpfen, die man inzwischen ermordet oder in den Reichstag gewählt hatte.
Auch Paul Stainer hätte diese Umwälzungen niemals für möglich gehalten, als er sechs Jahre zuvor in den Krieg gezogen war. Dennoch bevorzugte er von jeher das Volkshaus, das die Leipziger Arbeiterschaft Ende des letzten Jahrhunderts gebaut hatte und als ihr informelles Rathaus betrachtete.
Davon abgesehen, stand ihm heute nicht der Sinn nach Prunk und Pracht und militärischer Zeremonie; nach nichts, was ihn an den Krieg erinnerte, stand ihm der Sinn. Er wollte die Sache möglichst schnell hinter sich bringen.
«Ich dachte, unsere neue Republik kennt keine militärischen Auszeichnungen mehr», sagte er beiläufig, während er den leeren Rollstuhl durch die Wandelhalle schob.
«So ist es auch.» Eckstein schaute sich um und senkte die Stimme. «Ehrlich gesagt, ich vermute, dass Maercker persönlich hinter der Ordensverleihung steckt. Der war mit uns in Deutsch-Südwestafrika, das weißt du sicher, und dein Vater hat einiges gut bei ihm. Wahrscheinlich wollte Maercker seinem alten Kriegskameraden nachträglich noch ein goldenes Dankeschön verschaffen. Allerdings bin ich mir über den Anlass nicht ganz im Klaren.»
«Vielleicht hat Maercker sich an den Jahrestag seiner Verwundung erinnert», mutmaßte Stainer. «Demnächst ist es nämlich auf den Tag sechzehn Jahre her, dass eine Kugel meinem Vater die Wirbelsäule zerschmettert hat.»
«Sechzehn Jahre schon?» Eckstein schnitt eine skeptische Miene und nickte nachdenklich. «Kommt mir vor, als wäre es vorgestern gewesen. Andererseits ist sechzehn nicht gerade eine Schnapszahl.»
Am Paternoster hievte Stainer seinen Vater aus der Kabine zurück in den Rollstuhl und schob ihn dann an zahlreichen Gästen vorüber zum Festsaal. Einige grüßten freundlich, andere militärisch stramm. Der Alte schaute sich unruhig um, weil er die Porträtmalerin nirgends entdeckte, die ihn während der Ordensverleihung fotografieren und dann nach Vorlage der Bilder ein Ölporträt anfertigen sollte.
Die Tür zum kleinen Festsaal stand weit offen. Zwei Soldaten der Reichswehr mit aufgepflanzten Bajonetten flankierten sie. Mit beiden Händen hielten sie ihre Gewehre am Lauf fest, stützten die Kolben zwischen den blank gewienerten Stiefeln auf den Boden und verzogen keine Miene. Stainer atmete tief und unterdrückte einen Seufzer – alles, was nach Krieg schmeckte, verursachte ihm Beklemmungen.
Ganz anders sein Vater: Der legte die Fingerspitzen an seine Offiziersmütze und richtete sich mit heiterer Miene im Rollstuhl auf, um die Uniformierten zu grüßen. Stainer beeilte sich, ihn an den Soldaten vorbei in den Saal zu schieben und dort in die vordere Reihe, wo einige Plätze reserviert waren.
Auch im Saal konnte Stainer senior die Fotografin nicht entdecken, was ihn reichlich nervös machte. Sein Sohn dagegen hätte sich gewundert, sie jetzt schon hier zu sehen, denn Paul Stainer war eine Zeit lang mit Helga Schilling verlobt gewesen und kannte sie gut: Pünktlichkeit gehörte nicht zu ihren herausragenden Tugenden. Der Alte aber bedrängte seine Frau, schnell noch einen Fernsprecher zu suchen und die Malerin anzurufen, was Marianne Stainer strikt ablehnte.
Zwischen der Stirnseite des kleinen Saales und dem Rednerpult lief ein hochgewachsener Uniformierter auf und ab; am goldenen Stern auf den Schulterstücken erkannte Stainer seinen Rang: ein Oberstleutnant. Sein blondes Haar hatte er mit Pomade zurückgekämmt, der blonde Schnurrbart war buschig und ausladend. Er trug den Pour le Mérite zwischen den Kragenaufschlägen seiner Uniformjacke, die höchste Tapferkeitsauszeichnung, die in Preußen und im Kaiserreich vergeben worden war; an der Brustleiste glänzten noch etliche Orden der eher handelsüblichen Sorte.
Als ihre Blicke sich trafen, blieb der Offizier stehen und musterte den Vater im Rollstuhl und die Mutter neben ihm. Er stutzte kurz, winkte dann und kam auf sie zu.
Von Nahem schätzte Stainer den Offizier auf Mitte vierzig. Im Blick seiner blauen Augen lag etwas ungemein Weiches, nahezu Wehmütiges, etwas, das so gar nicht zu seinem eher zackigen Auftreten passen wollte. Stainer empfand eine unerklärliche Sympathie für den Mann.
«Major Stainer?» Stainer nickte unwillkürlich, während sein Vater ein energisches «Jawoll, Herr Oberstleutnant!» ausstieß. Irritiert blickte der blonde Offizier von einem zum anderen. «Sie sind auch Major?», fragte er schließlich an Stainer gewandt.
«Mein Sohn ist mit dem gleichen Rang ausgeschieden wie ich seinerzeit», beeilte sein Vater sich zu erklären. «Allerdings erst vor Kurzem.» Sein bewundernder Blick hing am Blauen Max des Offiziers, wie man den Pour le Mérite in gewissen Militärkreisen nannte. «Mein Sohn dient jetzt als Kriminalinspektor im Polizeiamt von Leipzig.»
«Ach so ist das. Oberstleutnant von Herzberg.» Der Offizier begrüßte erst Stainer senior – mit Handschlag, nicht mit militärischem Gruß, wie Stainer schadenfroh zur Kenntnis nahm –, danach seine Frau und zum Schluss Stainer selbst. Dabei konnte er sich einen erstaunten Blick auf dessen schlohweißes Haar nicht verkneifen. Sein Händedruck war übertrieben fest, seine Hand kalt und feucht. Nachdem alle sich gesetzt und zwei von der Weißen Garde die Tür geschlossen hatten, trat der Oberstleutnant ans Rednerpult begrüßte die Anwesenden mit einer kurzen Rede. Er sprach auffallend schnell, beinahe hastig, und Stainer gewann den Eindruck, dass der Mann in Eile war.
Sein Kommandant Generalmajor von Pilsach habe ihm die Ehre zuteilwerden lassen, im Auftrage des Generals Maercker einen deutschen Patrioten und Kriegshelden mit einer seit Langem überfälligen Auszeichnung zu belobigen: dem goldenen Militärkreuz für besondere Tapferkeit vor dem Feind. Und so weiter.
Die Saaltür öffnete sich, und links und rechts von Stainer fuhren die Köpfe herum. Er hörte seinen Vater aufatmen, denn Helga Schilling, die Malerin und Fotografin, trat ein. Ihre fünfzehnjährige Tochter Paula begleitete sie. Während das Mädchen scheu in die letzte Reihe huschte, baute ihre Mutter ein Stativ auf und befestigte ihre Kamera daran.
Der Oberstleutnant tat, als merke er es nicht, und sprach von Afrika und den alten Zeiten, in denen das Deutsche Reich sich noch im Glanze einer Kolonialmacht sonnen konnte, sprach von Tradition, Ehre und Vaterland, sprach von der neuen Zeit, die dem deutschen Volk nie dagewesene Zumutungen auferlege. Er betonte, wie wichtig heutzutage Vorbilder wie Major Heinrich Stainer seien, Männer, die ihr Leben riskiert hatten, um Volk und Vaterland zu dienen. Vom Feind an den Rollstuhl gefesselt, habe Major Stainer sein Schicksal seit nunmehr fünfzehn Jahren tapfer mit Gleichmut ertragen. Und so weiter, und so weiter.
Seit sechzehn Jahren, korrigierte Stainer im Stillen und senkte den Blick. Es stimmte schon: Sein Vater ertrug Lähmung und Rollstuhl ohne großes Gejammer, wenn man einmal davon absah, dass er tagtäglich über die neue Regierung und die Republik herzog. Dass allerdings eine feindliche Kugel ihn an den Rollstuhl gefesselt hatte, war ein Ammenmärchen. Ein verirrtes Geschoss aus den Reihen der eigenen Kompanie hatte ihn getroffen. Das wusste Stainer von Eckstein; drei Zeugen hatten es dem Amtsarzt damals bestätigt. Der Alte jedoch wollte davon nichts wissen.
Stainer merkte, dass seine Gedanken abgeschweift waren. Er hörte nicht mehr zu – weil ihm die alten Geschichten zuwider waren, weil die alten Lügen ihn langweilten und weil er sich auf einmal beobachtet fühlte.
Er wollte gerade hinter sich schauen, da beugte Eckstein sich zu ihm herüber. «Kommst du heute Mittag auch zur Versammlung?», flüsterte er.
«Versammlung?» Stainer wusste nicht, wovon er sprach. «Wo?»
«Im Volkshaus.» Eckstein unterbrach sich, denn Stainers Vater kurbelte seinen Rollstuhl zum Rednerpult hin, um das goldene Militärkreuz in Empfang zu nehmen. Die etwa siebzig Männer und Frauen im kleinen Festsaal applaudierten.
«Lipinski hat mich angerufen», flüsterte Eckstein. Er sprach vom Chef der Leipziger Sozialdemokraten. «Hat sogar Boten losgeschickt, um sämtliche Genossen zusammenzutrommeln. Es muss also außergewöhnlich dringend sein.»
Stainer runzelte die Brauen. «So?» Ihn hatte weder ein Bote noch ein Anruf erreicht. «Keine Zeit. In der Wächterburg wartet jede Menge Arbeit auf meinem Schreibtisch, am Nachmittag wollen die Kollegen endlich ihren Polizei-Gesangverein gründen, und heute Abend bin ich seit Langem verabredet. Und dann all die Umzugskisten, die noch unausgepackt in der Gustav-Freytag-Straße herumstehen.» Er schüttelte den Kopf.
Anfang März war Stainer aus seiner Mansarde in der Moltkestraße in die Wohnung gezogen, in der er vor dem Krieg gelebt hatte; zusammen mit Edith, seiner Frau. Edith war nun tot. Ermordet. Fünf Wochen war es her, dass er sie beerdigen musste.
«Überhaupt – was ist denn so Wichtiges passiert, dass man gleich eine Versammlung einberuft?», flüsterte Stainer.
«Frag mich nicht, Paul», flüsterte der andere. «Habe nur gehört, dass Riesenärger in der Luft liegt.»
«Ärger? In der Leipziger SPD?»
«In Berlin.»
Stainer zuckte mit den Schultern. «Irgendjemand wird mir schon berichten, was besprochen wurde», sagte er und dachte: Was geht mich Ärger in Berlin an?
Auf einmal kroch ihm der Geruch nach brennendem Schwefelholz in die Nase. Er schaute zur Fotografin – Helga hatte die