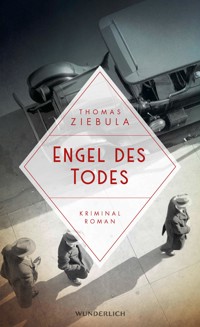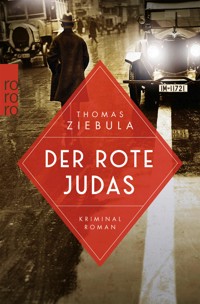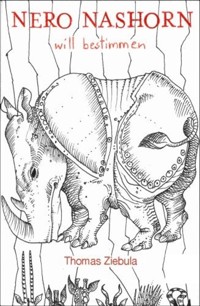9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Paul Stainer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der zweite Teil der packenden Krimi-Reihe um Leipziger Kriminalinspektor Paul Stainer. Die Erinnerung lässt sich nicht begraben... Leipzig, 1920. Der Erste Weltkrieg liegt zwei Jahre zurück, aber Kriminalinspektor Paul Stainer hat nach wie vor mit seinen Dämonen zu kämpfen. Um den traumatischen Erinnerungen an die Schützengräben und den Tod seiner Frau Edith zu entkommen, stürzt sich Stainer mit seinem Kollegen Siegfried Junghans in die Arbeit, denn auch wenn der Krieg vorbei ist, das Töten ist es nicht: Im Park findet man die Leiche eines Soldaten. Wurde das ehemalige Mitglied einer jüdischen Studentenverbindung von radikalen Rechten ermordet? Noch während Stainer in Richtung Stahlhelm und Schwarze Reichswehr ermittelt und einen Verdächtigen festnimmt, gibt es eine weitere Tote: Marlene Wagner, Journalistin der sozialdemokratischen Leipziger Volkszeitung wird am Ufer der Pleiße gefunden. Auch sie ein Opfer der rechten Gewalt? Oder musste sie sterben, weil sie ein unliebsames Interesse an einem weiteren toten Soldaten gezeigt hat, der bei Basel aus dem Rhein gezogen wurde? Dieser trägt ein Zigarettenetui der Leipziger Manufaktur Adamek bei sich. Adrian Adamek, einer von drei Brüdern, ist im Krieg gefallen, wie Stainer von dessen Bruder Konrad erfährt. Der dritte Bruder, Roman, gilt indessen als schwarzes Schaf unterhält tatsächlich Verbindungen in monarchistisch-nationalistische Kreise. Stainer folgt der Spur, ohne zu bemerken, wie sich an anderer Front ein Gewitter zusammenbraut, das nicht nur ihn in Gefahr bringt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Ähnliche
Thomas Ziebula
Abels Auferstehung
Kriminalroman
Über dieses Buch
Leipzig, 1920. Nach dem Tod seiner Frau stürzt sich Stainer in die Arbeit, denn der Krieg ist vorbei, das Töten jedoch nicht: Im Park findet man die Leiche eines Soldaten. Wurde das ehemalige Mitglied einer jüdischen Studentenverbindung von radikalen Rechten ermordet? Bei Basel wird ein weiterer toter Soldat aus dem Rhein gezogen. Er trägt ein Zigarettenetui der Leipziger Manufaktur Adamek bei sich. Adrian, einer von drei Adamek-Brüdern, ist im Krieg gefallen, wie Stainer von dessen Bruder Konrad erfährt. Der dritte Bruder, Roman, unterhält derweil tatsächlich Verbindungen in monarchistisch-nationalistische Kreise. Stainer folgt der Spur, ohne zu bemerken, wie sich an anderer Front ein Gewitter zusammenbraut, das nicht nur ihn in Gefahr bringt.
Vita
Thomas Ziebula ist freier Autor und schreibt vor allem Fantasy- und historische Romane. 2001 erhielt er den Deutschen Phantastik-Preis. Seine erste Krimi-Reihe um Inspektor Paul Stainer vereint auf beeindruckende Weise Thomas Ziebulas Leidenschaft für deutsche Zeitgeschichte, spannende Kriminalfälle und seine Liebe zu der Stadt Leipzig, die bis heute seine deutsche Lieblingsstadt ist. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Karlsruhe.
Für Gertrud Senftleben
Man sieht nur, was man weiß.
Johann Wolfgang von Goethe
Prolog
Die Luft dröhnte vom Stürzen der Wassermassen; er verstand kaum sein eigenes Wort, geschweige denn das der anderen. Die Bohlen der Aussichtsplattform waren feucht und glitschig, Eiszapfen hingen an der alten Balustrade. Weil das Holz sich nasskalt anfühlte, nahm er die Hände von der Brüstung und versuchte, sie an seinem zerschlissenen Uniformmantel trocken zu reiben, doch auch der war schon klamm von der Gischt, die aus dem Sturzbecken des Wasserfalls aufstieg und sich in einer lichten Wolke aus gefrorenen Kristallen auf Felsen, Bäume und Plattform senkte. Fröstelnd zog er die Schultern hoch und steckte die Hände in die Manteltaschen.
Etwas würde geschehen, doch nur der Andere wusste es schon.
Für einen kurzen Moment übertönte plötzlich Gelächter das allgegenwärtige Rauschen, so schrill, dass er sich erschrocken umwandte: In Pelzmäntel gehüllte Menschen verschwanden zwischen den kahlen Büschen und Bäumen, um auf den Serpentinenpfad zurückzukehren, der zum Schloss hinaufführte.
Nun waren sie beide allein auf der Aussichtsplattform – er und der Andere.
Die Abenddämmerung verdüsterte längst beide Stromufer und verwandelte ihm die Felsen, die aus dem Wasserfall aufragten, in verkrüppelte und dem Abendhimmel drohende Titanenfäuste. Im erlöschenden Licht des Tages erinnerten ihn die stürzenden Fluten an jene Schneelawine, die er im zweiten Kriegswinter einen riesigen Granattrichter hatte herabrutschen sehen, bevor sie in dem brodelnden, schäumenden Becken aufschlugen, von dem aus sich der Rhein nach Westen wälzte. Dort schien bereits die Nacht anzubrechen.
Das Schauspiel der Naturgewalt faszinierte ihn, und sein Geist tauchte ein in all das Stürzen, Brodeln, Schäumen und Strömen. Was für ein entsetzlicher Anblick, dachte er, und was für ein schöner zugleich. Um sich jede Einzelzeit einprägen zu können, lehnte er sich weit über die feuchte Brüstung.
Unter ihm fiel schroffer, mit kahlem Buschwerk bewachsener Fels steil ab bis an den Rand des Sturzbeckens und in das Gewirbel hinein. Das Donnern der dort unten aufschlagenden Wassermassen beschwor ihm das unablässige Artilleriefeuer herauf, dem er über nahezu vier Jahre hinweg ausgesetzt und dem er nun ein für alle Mal entronnen war. Schon als sie vorhin die Serpentinen zur Aussichtsplattform hinunter- und dem Lärm entgegengelaufen waren, hatte er an nichts anderes mehr denken können.
Und wahrhaftig – war nicht wie dieser Wasserfall auch sein Leben gewesen in den vergangenen Jahren? Stürzend, brausend, brüllend, über den Abgrund geworfen, in die Tiefe gerissen? Und würde wie dieser Fluss nicht künftig sein gerettetes Leben sein? Ruhig und stark und breit dahinströmend?
Vielleicht sind wir ja deswegen hierhergefahren, dachte er, damit ich genau das sehe – das schreckliche Stürzen der Wassermassen und ihr friedliches und kraftvolles Dahinströmen danach. Ja, dachte er und war sich nun ganz sicher: Wahrscheinlich, um mir das zu zeigen, hat der Andere diesen Umweg gemacht, damit ich meine Vergangenheit verabschieden und einen Blick voraus in meine Zukunft werfen kann. Mut schöpfe.
Ein seit langem nicht empfundenes Glücksgefühl durchströmte ihn und wühlte sein Gemüt so sehr auf, dass ihm die Tränen in die Augen traten. «Es ist gut, dass du mich hierhergebracht hast!», rief er gegen das Tosen und Donnern an. «Es ist gut, hier zu sein!»
«Ja», antwortete der Andere, «es ist sehr gut.» Oder bildete er sich nur ein, diese Antwort aus dem Gebrüll der aufschlagenden Fluten raunen zu hören?
Auf einmal nahm er stoßweises Atmen und eine unerwartete Bewegung hinter sich wahr. Bevor er sich umdrehen konnte, schloss sich etwas jäh und mit eisernem Griff um seine Knöchel, riss ihm die Beine nach hinten weg, sodass er kopfüber bis zum Bauch nach vorn über die Brüstung rutschte und durch die Balustrade hindurch Mantelsaum und Stiefel des Anderen sehen konnte. Der stemmte ihn mit erbarmungsloser Kraft nach vorn, Mantelknopf für Mantelknopf rutschte er über das feuchte Holz weiter nach unten.
Wie eine Stichflamme loderte ihm Panik durch jede Faser seines Körpers, und er befreite die Hände aus den Taschen, langte hinter und über sich, um nach der Brüstung zu greifen und sich daran festzuhalten, doch der Andere stieß ihn blitzschnell und sehr hart nach vorn, ließ dann seine Knöchel los und beraubte ihn so seines letzten Halts – kopfüber stürzte er auf den Felsrücken unterhalb der Aussichtsplattform zwischen kahles Buschwerk und verkrüppelte Bäume.
Er schlug auf, rutschte durch winterliches Gehölz, nasses Gras und über Geröll, rutschte schneller und schneller und stürzte auf einmal wieder im freien Fall. Im Sturz breitete er die Arme aus und griff nach allem, was seinen Körper streifte und Halt verhieß – nach vereistem Geäst, Baumstrünken, Grasbüscheln, Felsvorsprüngen. Und alles, alles entglitt seinen Fingern.
Es würde geschehen – die Erkenntnis durchfuhr ihn wie Eishauch: Nichts konnte sein Fallen mehr aufhalten, und er würde unweigerlich dort unten ins schäumende Brodeln eintauchen und versinken. Diese Einsicht löschte die Flamme der Panik aus, und von einem Augenblick auf den anderen erfüllte ihn eine überirdische Ruhe. Er kapitulierte, er ließ los, er ergab sich in sein Schicksal, er stürzte nicht mehr – er ließ sich fallen.
Im selben Augenblick geschah etwas Seltsames, völlig Unverhofftes: Er schwebte plötzlich über den Baracken des Gefangenenlagers, flog einen Moment später durch das Niemandsland zwischen den feindlichen Linien, hinweg über englische Geschützbatterien und zurück zu jenem Waggon, der ihn fort aus seiner Stadt und nach Westen zur Front gebracht hatte; er flog zurück in die Arme der geliebten Frau, die ihn mit Abschiedsküssen überhäufte, zurück in eine berauschte Hochzeitsgesellschaft, zurück vor den Traualtar in der Paulinerkirche, zurück, zurück, zurück: in sein Atelier in Reudnitz, in seine vollgestopfte Mansarde über der Innenstadt, in die Kunsthochschule, in die Klassenräume des Gymnasiums, auf den Schoß der Mutter, an ihre Brust.
«Mutter!», schrie er, «Mutter!», und mit diesem Schrei in der Kehle schlug er knapp über dem Sturzbecken auf einer Felsnase auf, rutschte halb betäubt ab, tauchte in die eisige Kälte des schäumenden Tohuwabohus ein.
Und versank für immer in dunklem Nichts.
IDer Maler
1Geständnis
Leipzig, 1. März 1920
Was soll ich tun? Kann ich überhaupt noch etwas tun? Fest steht doch Folgendes: Das Spiel ist aus, und ich habe es verloren.
Das ‹Spiel›? Welch harmloses Wort – es ist kein Spiel, in das ich mich da verstrickt habe, es ist eine todernste Angelegenheit.
Wie auch immer: Mir bleibt nur eine Möglichkeit, das sehe ich jetzt mit schmerzhafter Klarheit. Doch zuvor muss ich reinen Tisch machen. Hier also mein Geständnis:
Ich habe getötet.
Nicht aus Versehen, nicht einmal im Affekt, sondern ganz bewusst und geplant. Nennen Juristen das unter diesen Vorzeichen noch töten? Nein, sie nennen es morden.
Nun denn – dann will ich mich um juristische Präzision bemühen und beim Namen nennen, was ich getan habe: Ich habe gemordet, ganz bewusst und geplant gemordet, und das sogar mehr als nur einmal.
Ich erschrecke vor mir selbst, während ich diese Sätze aufschreibe.
Ist es denn wirklich wahr?
Bin wirklich ich das gewesen, der diese Menschen ermordet hat? Und warum?
Aus einem ganz einfachen Grund: um mein Leben zu retten. Oder vielmehr: um den Traum von meinem Leben zu retten.
Was ich hier niederschreibe, liest sich monströs. Doch es wird noch monströser, denn dies ist erst der Anfang meines Geständnisses. Morden nämlich, töten, kann man nicht einfach so, man muss es lernen.
Einige Grundregeln und Techniken sind mir bereits bekannt gewesen – durch den Krieg. Doch einen französischen oder englischen Soldaten abzuwehren und zu töten, der dich angreift, um dein Leben auszulöschen, dich in der Feldschlacht zu wehren, ist etwas ganz anderes, als einen friedlichen und nichtsahnenden Menschen zu ermorden. Insofern habe ich das Töten noch einmal ganz neu lernen müssen.
Zu diesem Zweck habe ich getan, was alle Lernenden tun: Ich habe geübt.
Zunächst an einer Schneiderpuppe. Mit ihr bin ich nach Kitzscher zur Ruine der Schlosses Thierbach gefahren, wohin sich im Winter kein Mensch verirrt, schon gar nicht vor Sonnenaufgang. Im oberen Turmgeschoss habe ich der Puppe einen alten Uniformmantel umgehängt und sie gegen die Fensterbrüstung gelehnt, sodass sie aussah wie einer, der in die Morgendämmerung hinausschaute. Selbstverständlich hatte ich vorher sorgfältig studiert, wo ich zuzupacken habe, um sie mit möglichst wenig Kraftaufwand über die Brüstung stürzen zu können – ganz unten am Dreifuß.
Wieder und wieder habe ich die Puppe hinaufgetragen und hinabgestoßen; bis sie unter dem Turmfenster im Wurzelgeflecht eines Baumes zerbrochen ist.
Eine vergleichsweise leichte Übung, denn bei ihr ist es ja nur um den mechanischen Ablauf des Tötens gegangen. Die eigentliche Schwierigkeit des Tötens besteht ja darin, die gründlich eingewurzelte Hemmung zu überwinden, einem anderen Menschen das Leben zu rauben.
Wie leicht diese zu überwinden ist – viel leichter, als man gemeinhin zu glauben geneigt ist –, hat der hinter uns liegende Krieg bewiesen. Doch ich war überrascht, wie leicht es mir auch fernab jeder Kriegshandlung gefallen ist, die moralische Hemmung in meiner Seele zu bezwingen.
Auch das habe ich aufs Neue geübt – allerdings nur einmal, dafür an einem lebenden Wesen: an einem Hund. Um es mir so schwer und damit die Übung so realistisch wie möglich zu machen, habe ich einen gewählt, an dem ich hing.
Schon der Tritt, den ich ihm versetzen musste, um ihn in den vollgelaufenen Tagebaukrater zu befördern, hat mich geschmerzt und Überwindung gekostet. Doch das war ja der Sinn der Übung: meine Fähigkeit zu trainieren, anerzogene moralische Fesseln zu sprengen, ja, diese Fähigkeit zugleich zu ergründen: Ein Geschöpf in den Tod zu stürzen – schaffe ich das überhaupt?
Weiß Gott – ich habe es geschafft. Wieder und wieder.
2Anfang vom Ende
Ihr Untergang begann im Grunde schon am späten Nachmittag des 12. Februars, ein Donnerstag, kurz bevor sie sich auf den Weg zum Duell machte: Ernst Tanner, der stellvertretende Chefredakteur, stand im Gang vor dem Konferenzsaal und wedelte mit einer Handvoll Kuverts. «Leserbriefe, Leni!»
Sie drückte ihre Bürotür zu und runzelte genervt die Brauen. In der Miene ihres Chefs las sie, dass diese Briefe ihr besser nicht gleichgültig sein sollten, also ließ sie die Klinke los und ging auf ihn zu statt zur Treppe. Die Absätze ihrer Stöckelschuhe knallten auf die Fliesen, dass es nur so hallte.
«Hab sie schon gelesen, betreffen mal wieder ausschließlich Texte von dir.» Tanner reichte ihr den Stapel, ohne ihn jedoch gleich loszulassen, als sie danach griff. «Ich habe nichts gegen deine scharfe Zunge, Leni, das weißt du. Du weißt aber auch, dass die Rechten jede Ausgabe nach Verbotsgründen durchforsten.» Er beugte sich zu ihr und senkte die Stimme. «Der Bürgermeister hat Block wegen deiner jüngsten Artikel vorgeladen, die Militärverwaltung macht ihm wohl Druck. Und das Polizeiamt hat per Fernsprecher Mäßigung gefordert und droht mit einem neuerlichen Verbotsantrag.»
«Das Polizeiamt? Wer genau?»
«Kriminalrat Dr. Kasimir.»
Sie verdrehte die Augen. «Dieser Idiot schon wieder. Gib endlich her!» Sie nahm ihm die geöffneten Kuverts ab und las die Schriftzüge auf dem ersten: An die Redaktion der Leipziger Volkszeitung, z.H.v. Frau Marlene Wagner, Tauchaer Straße 19–21, Leipzig, Deutsches Reich.
«‹Zu meinen Händen› – kannst du nicht lesen, Ernst?» Sie blitzte ihren Chef an. «Was fällt dir ein, meine Briefe zu öffnen?»
«Mach kein Theater, Leni! Habe nur ‹an die Redaktion› gelesen und dann gleich geöffnet. Ein Reflex; kommt schon mal vor, oder?»
«Wie man sieht.» Sie zählte die Kuverts durch. «Und das gleich viermal. Außerdem heiße ich Marlene.» Sie zog ein Telegramm aus dem Stapel. «Was ist das hier?»
«Ein Telegramm, siehst du doch. Kam vorhin. Hab gerade am Fernsprecher gehangen, deswegen kriegst du’s erst jetzt. Und wann krieg ich die Geschichte über die Studentenverbindungen, Mar-le-ne?» Er betonte jede Silbe ihres Namens.
«Morgen.» Marlene Wagner steckte die Briefe in ihre Handtasche. «Schönen Feierabend gelegentlich.»
Sie wandte sich ab und ging zur Treppe. Im vergangenen Sommer war sie ein paarmal mit Tanner im Bett gewesen, doch als er Blocks Stellvertreter wurde und anfing, sie wie eine kleine Volontärin zu behandeln, hatte sie damit Schluss gemacht.
«Ich brauche den Text spätestens morgen Mittag!», rief er ihr hinterher. «Du weißt, dass ich ihn für die Sonnabendausgabe eingeplant habe!»
«Ich tu mein Bestes, Ernst!» Schon stöckelte sie die Stufen hinunter, wobei sie das Telegramm überflog. Es stammte von einem Kollegen aus Basel; oder nein: Lampert war mehr als nur ein Kollege, eigentlich war er schon beinahe ein guter Freund. Außerdem ihr Geliebter.
Sie blieb mitten auf der Treppe stehen und erbleichte, während sie die kargen Sätze las: Wasserleiche aus Rhein gezogen– Stopp – deutscher Soldat – Stopp – Leipziger? – Stopp – ruf mich an – Stopp – L.J.
Ihre Knie waren auf einmal weich. Langsamer ging sie weiter; als fürchtete sie zu stolpern, stieg sie die restlichen Stufen ins Erdgeschoss hinunter. Draußen schnappte sie erst einmal nach Luft.
Ein toter Soldat im Rhein? Warum telegraphierte Lampert ihr das? Glaubte er etwa …? Sie wagte nicht zu denken, was die Angst ihr einflüstern wollte, spürte aber, wie ihr das Herz plötzlich in der Kehle schlug und ihr Mund trocken wurde.
Die Elektrische stoppte, die Zwei nach Plagwitz. Sie hätte nicht einsteigen müssen, doch tat es und fuhr eine Haltestelle weit; einfach nur, um sich irgendwo hinsetzen und den Schrecken verdauen zu können.
Während der Triebwagen in Richtung Hauptbahnhof rasselte, las sie noch einmal das Telegramm. Es blieb dabei: Irgendjemand hatte irgendwo bei Basel einen toten deutschen Soldaten aus dem Rhein gezogen, und aus irgendeinem Grund wollte Lampert, dass sie davon erfuhr. Was konnte das anderes heißen, als dass es sich bei dem Toten um Roland handelte? Wenn es aber tatsächlich Roland war, warum telegraphierte Lampert dann nicht: Man hat deinen Bruder ertrunken aus dem Rhein gezogen?
Sie ließ das Telegramm sinken und starrte zum Bahnfenster hinaus. Die Fassade des Krystallpalastes rückte in ihr Blickfeld, die Bahn hielt. Marlene stieg aus, lief ein Stück die Tauchaer Straße zurück und in die Mittelstraße hinein. Die Angst um Roland beschlagnahmte sie so gründlich, dass sie die entgegenkommenden Passanten kaum wahrnahm, auch die Soldaten nicht, die ihr hinterherpfiffen.
In der Mittelstraße Nummer 11 stieg sie die Vortreppe zu einem Lokal hinauf. Bei Ella hieß die Kneipe, Stammlokal vieler Kollegen aus der Leipziger Volkszeitung. Hier wollte man sie zum Duell abholen, irgendwann gegen sechs, zur Mensur, wie ihr Kontaktmann von der philosophischen Fakultät sich ausgedrückt hatte.
An der Theke schlürfte ein Kollege aus der Anzeigenabteilung sein Feierabendbier, am Tisch neben der Garderobe blickten eine Kollegin und zwei Sekretärinnen aus der Kulturredaktion auf, grüßten und steckten wieder die Köpfe zusammen. Am Nebentisch klopften zwei Setzer und ein Kraftdroschkenchauffeur Skat.
«Hast du noch ein bisschen was Warmes, Ella?», fragte Marlene die kleine grauhaarige und etwas stämmige Frau hinter der Theke nach der Begrüßung. «Hab seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Eine Suppe würde mir schon reichen.» Sie hängte den dunkelgrauen Mantel an die Garderobe und knöpfte die lange Strickjacke auf, die sie über dem schwarzen Wollkleid trug.
Ella drückte ihre Zigarette aus. «Für dich habe ich doch noch immer was in der Küche gefunden, Rotkäppchen.» Sie sächselte stark, und ihre Stimme klang rau und dennoch mütterlich zärtlich. Marlene liebte die Wirtin. Seit dem Tod ihrer Eltern vor zwei Jahren kam sie mindestens dreimal die Woche hierher zu Ella.
«Und mach mir einen Kaffee, ja? Und einen Cognac könnte ich auch brauchen.» Marlene setzte sich an einen freien Fenstertisch. Während sie ihre Zigaretten und die Kuverts aus der Tasche holte, verschwand Ella in der Küche. Jeden ihrer Stammgäste, den sie besonders gern bei sich sah, pflegte die Wirtin irgendwann mit einem Spitznamen zu adeln. Rotkäppchen passte eigentlich nicht zu Marlene, denn sie war groß, stark gebaut und berüchtigt für ihr resolutes Auftreten. Doch ihr dichter kupferroter Lockenschopf, der ihr knapp unterhalb der Ohren vom Kopf abstand wie der Rand einer Sturmhaube, hatte ihr diesen Namen eingebracht. Und vermutlich Ellas Beobachtung, dass sie spätabends mit unterschiedlichen Männern die Kneipe verließ, und das, nach Ellas Geschmack, ein wenig zu oft.
Marlene schielte nach Ellas Fernsprecher, der an der Wand über der Schmalseite der Theke hing, während sie in ihrer Tasche nach Lamperts Nummer kramte. Sie fand sie, legte sie bereit und überflog dann die Leserbriefe. Lauter tadelnde Zeilen hatte sie sich wieder eingehandelt, üble Beschimpfungen teilweise sogar:
Für ihre harsche Kritik an der Stadtverwaltung und der Großen Leipziger Straßenbahn, weil nun auch die letzten Frauen entlassen werden sollten, die noch als Schaffnerinnen und Fahrerinnen arbeiteten.
Für ihren schwarz auf weiß gedruckten Verdacht, dass die Polizei jenen einarmigen Offizier, der für das schreckliche Blutbad in Gohlis verantwortlich war, bewusst in die Pleiße und den Tod gejagt hatte, damit er nicht mehr gegen seine Auftraggeber in der Schwarzen Reichswehr aussagen konnte.
Dafür, dass sie jene Reichsheersoldaten arme Teufel genannt hatte, die vor knapp zwei Wochen im Badischen Bahnhof zu Basel aus einem Zug gestiegen waren, der sie aus der französischen Kriegsgefangenschaft gebracht hatte. Arme Teufel, deren beste Jahre Regierung und Kaiser in einem sinnlosen Angriffskrieg verheizt haben. Genau das hatte Marlene geschrieben, und genau das würde sie jederzeit wieder schreiben. Vaterlandsverräterin war noch das gelindeste Schimpfwort, das sie nun lesen musste.
Ihr Chef hatte sie nach Basel geschickt, worum sie ihn zwei Tage lang hatte anbetteln müssen. Sie hatte um jeden Preis über die Heimkehrer schreiben wollen, denn einer dieser «armen Teufel» hätte eigentlich ihr Bruder sein sollen.
In seinem letzten Brief aus einem Gefangenenlager bei Metz hatte er jedenfalls angekündigt, dass man ihn Ende Januar in ebenjenem offiziellen Gefangenentransport über die Grenze bringen würde. Doch am 31. Januar hatte Marlene unter ihrem großen Pappschild mit Rolands Namen vergeblich zwischen den Zigtausenden, die im Badischen Bahnhof aus dem Zug gestiegen waren, nach ihm Ausschau gehalten.
Und jetzt sollte man ihn tot aus dem Rhein gefischt haben? Marlene konnte es nicht glauben; sie wollte es nicht glauben.
Der schärfste Leserbrief war von jenem Kriminalrat, dessen Anruf beim Chefredakteur Tanner erwähnt hatte: Dr. August Kasimir vom Polizeiamt in der Wächterstraße. Noch einmal nahm sie ihn zur Hand. Kasimir schrieb, er verwahre sich aufs Energischste gegen den Vorwurf, seine Behörde lasse Verdächtige ertrinken, um Zeugen gegen eine angebliche Schwarze Reichswehr zu beseitigen.
Außerdem protestierte er mit vielen Worten gegen Marlenes Darstellung, Kaiser und Regierung hätten einen sinnlosen Angriffskrieg geführt und deutsche Männer verheizt. Diese infame Lüge, so Kasimir, wird Folgen haben, und er habe die politische Abteilung des Polizeiamtes angewiesen, sich mit der Militärverwaltung in Verbindung zu setzen, um ein erneutes Verbot der Leipziger Volkszeitung wegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Klassenhass vorzuschlagen.
Marlene musste tief durchatmen, während sie den Brief zusammenfaltete und wieder ins Kuvert steckte. Tanner hatte recht: Sie musste vorsichtiger sein – als Journalist eines linken Blattes stand man immer mit einem Bein im Gefängnis.
Zum Glück war sie mit dem Chefredakteur Hans Block und seinen Stellvertretern einer Meinung, was die Beurteilung der deutschen Kriegsschuld betraf. Allerdings nicht mit der Führung der Mehrheits-SPD, die das Reich regierte und immer noch mit der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei um die Macht in den Redaktionsstuben der Leipziger Volkszeitung kämpfte. Mit ein wenig Pech würde Kasimirs Protest nicht nur Folgen für Marlene, sondern für die ganze Zeitung haben. Seit der Novemberrevolution 1918 hatte General Maercker, der Chef der Militärverwaltung, die Leipziger Volkszeitung immer wieder für einige Tage oder mehrere Wochen verboten; vermehrt, seit er im Mai letzten Jahres den Ausnahmezustand über die Stadt verhängt hatte.
Ella kam mit Kaffee und Cognac an ihren Tisch. «Die Erbsensuppe braucht noch ein paar Minuten. Hast du Kummer, dass du jetzt schon den ersten Cognac brauchst, Rotkäppchen?»
Marlene nickte. «Erzähle ich dir später. Kann ich deinen Fernsprecher benutzen? Ich bezahle natürlich.»
«Du bist schon die Siebte heute.» Ella rümpfte die Nase. «Gestern waren es mindestens zehn von der LVZ, die bei mir telefoniert haben. Hans soll gefälligst dafür sorgen, dass seine Zeitung mir den Anschluss bezahlt, sag ihm das.» Mit einer Kopfbewegung deutete sie auf den Fernsprecher. «Geh schon.»
«Danke, Ella. Richte ich Block aus. Bis er reagiert, knöpf den Kollegen, die hier berufliche Ferngespräche führen, ordentlich was ab.» Sie zeigte ihr das Telegramm und zog eine Zigarette aus der Schachtel. «Ich muss privat telefonieren, und das sehr dringend.»
Während Ella das Telegramm las, ging Marlene zum Fernsprechapparat. Sie wählte die 90, die Nummer der Telefonzentrale im Neuen Rathaus, meldete ein Ferngespräch in die Schweiz an und gab Lamperts Basler Nummer durch. Während das Mädchen in der Zentrale die Verbindung herstellte, zündete Marlene sich die Zigarette an. Bereits nach zwei Zügen hörte sie Lamperts hohe Stimme in der Leitung. «Jäggi, Basler Nachrichten.»
«Ich bin’s, Lampert. Hab dein Telegramm gekriegt.» Sie schluckte und flüsterte dann: «Ist es Roland?»
«Ich kenne nur ein einziges Foto von deinem Bruder, Leni, und der Tote in der Gerichtsmedizin hat kaum noch Gesicht.»
«Kaum noch Gesicht …?» Sie musste schon wieder schlucken. «Doch es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er Leipziger ist?»
«Sein Zigarettenetui. Stammt wohl von einer Leipziger Firma. Luxusware: Leder in Goldfassung.»
«So was hat Roland nie besessen!», entfuhr es ihr, die Erleichterung löste ihr die Stimme.
«Weißt du das so genau?»
«Natürlich! Er hat nicht mal geraucht.»
«Du hast ihn lange nicht gesehen, Marlene.»
Die erste Erleichterung verflog schon wieder, denn Marlene musste einsehen, dass er recht hatte. «Und selbst wenn – deswegen muss der Tote doch kein Leipziger sein», wandte sie kleinlaut ein. «In anderen Städten werden doch auch Leipziger Luxuswaren verkauft.»
«Schon wahr, Leni. Am besten, du kommst so schnell wie möglich selbst her. Zwei Tage kann mein Schwager die Bestattung der Leiche noch aufschieben.» Lamperts Schwager war Gerichtsmediziner bei der Basler Polizei.
«Zwei Tage?» Das Duell ging ihr durch den Kopf – bis morgen Abend musste die Geschichte auf Tanners Schreibtisch liegen. Würde er ihr überhaupt Urlaub bewilligen? Er würde es müssen, schließlich ging es um ihren Bruder.
Kurz kam ihr der Gedanke, Lampert könnte den Leichenfund vorschieben, um sie nach Basel zu locken. Er war ihr verfallen, das wusste sie genau, und er würde sie auf der Stelle heiraten, wenn sie wollte. Doch ein Spiel mit derart ernsten Umständen traute sie ihm nicht zu – er wusste, wie sehr sie an Roland hing.
Nach dem Tod der Eltern und einiger weiterer Verwandter im Verlauf der Spanischen Grippe war ihre Familie auf einen Onkel, eine Großnichte und eine Tante geschrumpft. Abgesehen von Roland; seine Braut rechnete Marlene noch nicht zur Familie.
«Morgen Abend bin ich bei dir», sagte sie schließlich. «Hol mich vom Bahnhof ab. Ich schlaf bei dir.»
«Ich sag meinem Schwager Bescheid. Bis morgen.»
Sie stelzte wie über dünnes Eis, als sie zu ihrem Tisch zurückkehrte. Dort kramte sie ein Markstück aus ihrer Handtasche und legte es für Ella an den Rand des Tisches. Danach leerte sie das Cognacglas. Ob sie Marianne Bescheid sagen sollte, Rolands Braut?
Ihre Gedanken fuhren Karussell. Roland im Rhein ertrunken? Absurd! Er war nicht im Zug gewesen, daran gab es doch keinen Zweifel, und sollten sie sich am Badischen Bahnhof dennoch verfehlt haben, hätte er den nächsten Zug nach Norden genommen. Außerdem: Einer wie Roland ging doch nicht ins Wasser!
Andererseits – wusste sie denn, was Krieg und Gefangenschaft aus ihrem Bruder gemacht hatten? Seine Briefe waren seltsam düster gewesen zuletzt, und man hörte schlimme Geschichten. Und hatte sie vor zwei Wochen nicht mit eigenen Augen die menschlichen Wracks aus dem Zug steigen sehen?
«Guten Appetit.» Ella brachte die Erbsensuppe und setzte sich zu ihr. «Was ist los, Rotkäppchen? Was hat das Telegramm zu bedeuten?» Marlene erzählte es ihr, doch Ella, die Roland gut kannte, schüttelte nur den Kopf. «Es ist nicht dein Bruder, den sie da gefunden haben – schlag dir diese dumme Idee aus dem Hirn.» Sie stand auf. «Einer wie Roland tut sich nichts an, also spar dir diese Reise. Und mach bloß Marianne nicht verrückt. Er kommt zurück. Bald.»
«Dein Wort in Gottes Ohr», seufzte Marlene. Während im Aschenbecher ihre Zigarette herunterbrannte, löffelte sie die Erbsensuppe. Sich Ella anvertraut zu haben, linderte ihre Anspannung ein wenig.
Die Geschichte über die schlagende Verbindung und die Mensur konnte sie nicht mehr abblasen. Wollte sie auch nicht mehr abblasen, denn sie war froh, zur Abwechslung einmal über etwas politisch Unverfängliches berichten zu können. Doch sie würde den Artikel heute Nacht schreiben müssen. Gleichgültig – schlafen konnte sie im Zug nach Basel.
Vor den Fenstern dämmerte es bereits. Motorengedonner eines Kraftrades näherte sich draußen, ebbte ab und stotterte noch ein bisschen vor der Kneipe herum, bis es endlich verstummte. Kurz darauf betrat ein Paar die Kneipe – er groß, breitschultrig, Anfang dreißig, in schwarzem Ledermantel und mit dunklem Stahlhelm; sie in langem schwarzem Pelzmantel über ebenfalls schwarzem Kleid und Stöckelschuhen.
Marlene erkannte sie: eine Kollegin aus der Stadtredaktion; eine, die Rosa Luxemburg nahegestanden hatte und seit ihrem Tod Trauer trug. Stand ihr gut. Den Mann hatte Marlene noch nie an ihrer Seite gesehen. Auch bei Ella nicht. Waren die beiden überhaupt ein Paar? Vielleicht waren sie ja zufällig zur gleichen Zeit hier angekommen.
Nur ein paar Minuten vergingen, bis sie den Kraftradfahrer kennenlernte. Nachdem er sich nämlich den Helm abgeschnallt und bei einem Korn und einem Bier flüchtig umgeschaut hatte, kam er zu ihr an den Tisch. «Marlene Wagner?» Sie nickte. «Lusatia gegen Saxo-Bavaria», raunte er. «Und ich bin Ihr Chauffeur, Fräulein.»
Lusatia und Saxo-Bavaria – so hießen die Studentenverbindungen der beiden Fechter, die sich heute duellieren wollten, und es war zugleich die Parole, an der sie laut Kontaktmann ihren Chauffeur erkennen sollte.
«Marlene Wagner», murmelte sie. «Leipziger Volkszeitung.»
«Sieht man Ihnen an, Fräulein. Die Branche, nicht den Namen. Carl Thorwald.» Der große Kerl grinste und streckte ihr die Rechte hin. Marlene drückte sie und betrachtete die hässliche Narbe, die seine linke Wange entstellte. «Carl mit C», fügte er hinzu. Marlene nickte höflich. «Ihr linken Schreiber dürft jetzt also doch wieder in die Tasten hauen.» Carl mit C spielte auf das jüngste Verbot der Leipziger Volkszeitung an.
«Zum Glück» , antwortete Marlene unverbindlich.
Ein paar Minuten später stieg sie in den Beiwagen seines Kraftradgespanns. Thorwald reichte ihr eine Schutzbrille, so schwarz, dass sie nicht hindurchsehen konnte, als sie das Ding über die Augen zog. Sofort streifte sie es wieder ab.
«Aufsetzen!», befahl er barsch, während er sein Kraftrad antrat, und jetzt erst nahm Marlene den Totenkopf wahr, der handtellergroß vorn auf seinem Helm prangte. «Es ist vereinbart, dass Sie nicht zu wissen brauchen, wo wir hinfahren.»
«Weiß schon, doch ich zieh das Ding erst nach dem Hauptbahnhof auf. Dort halten Sie bitte, ich muss mir eine Zugverbindung heraussuchen lassen. Dauert nicht lang.» Sie band sich ein Tuch um den Kopf, knöpfte sich den Mantel bis obenhin zu und blickte stur geradeaus.
Thorwald begriff, dass Widerspruch zwecklos war, und fuhr los. An der Tauchaer Straße flammten die Gaslaternen auf.
3Nach Hause
Die Welt kam ihm merkwürdig vor an diesem Abend – fremdartig, ablehnend sogar; als wollte sie nichts mit ihm zu tun haben. Er musste nach Hause, unbedingt nach Hause, und er hatte sich verlaufen.
Das lag womöglich daran, dass er am Vormittag vom Friedhof aus noch einige Umwege genommen hatte. Zunächst ins Polizeiamt in der Wächterstraße und von dort aus dann ins Preußergäßchen in eine Kneipe, deren Name ihm momentan nicht mehr einfallen wollte.
«Zum Zillertal», half er sich selbst auf die Sprünge und stand still, damit zwei Passanten und ihr Hund ihm gefahrlos ausweichen konnten.
Von dort aus hatten die Kollegen unbedingt noch einen Abstecher in die Lustige Witwe und in die Gute Quelle machen wollen. Und Bruno Schilling, der Hausmeister, hatte darauf bestanden, auch noch das Café Reichspost zu beehren, weil es sich dort doch so überaus angemessen auf die Vergangenheit und die Toten anstoßen ließ.
Die Welt kam ihm besonders dunkel vor an diesem Abend, und vor allem schwankte der Leipziger Asphalt unter ihm, und um ihn herum drehten sich Häuser, Gaslaternen, Automobile, Radfahrer, Fuhrwerke und elektrische Droschken.
Er stürzte zu einem Laternenpfahl und hielt ihn fest, weil er den bestimmten Eindruck hatte, die Gaslaterne könne umfallen ohne seine Unterstützung. Und wirklich – er kam keinen Augenblick zu früh: Die zuvor schwankende Laterne stand wieder still, und die Gefahr ihres Umsturzes war gebannt, jedenfalls für den Moment.
Allerdings misslang ihm der Versuch, die Gaslaterne wieder sich selbst zu überlassen. Aus irgendeinem Grund nämlich wollte sie ihn keinesfalls weitergehen lassen, weiter nach Hause. «Hören Sie mir zu, Gnädigste», sagte er, und das mit doch recht klarer Artikulation, wie er fand. «Ihr Verhalten entbehrt jeder Pietät. Wissen Sie nicht, dass ich von einer Beerdigung komme? Lassen Sie mich sofort los!»
Die Laterne wusste es nicht, jedenfalls reagierte sie nicht entsprechend. Das erschien ihm unhöflich, ja grausam, denn immerhin kam er von der Beerdigung seiner eigenen Frau, doch der Laterne das mitzuteilen, erschien ihm unter seiner Würde. Also ging er zum Angriff über.
«Ich werde jetzt meinen Heimweg fortsetzen, Gnädigste, und Sie werden mich nicht daran hindern. Nur damit wir uns verstehen.»
Als er am Laternenpfahl entlang hinauf in den Abendhimmel blickte, sah er die Sichel des Mondes, ein alter Vertrauter, und in diesem Moment erinnerte er sich dunkel, dass er seit neustem eine Dachmansarde in der Moltkestraße bewohnte, und zwar gemeinsam mit einer jungen Katze.
Es war ihm jedoch unangenehm, die Laterne nach dem Weg in die Moltkestraße zu fragen, denn er hatte ein wenig Sorge, sich lächerlich zu machen. Davon abgesehen traute er sich durchaus noch zu, auch ohne ihre Hilfe nach Hause zu finden. So viele Biere und Schnäpse hatte er nun auch wieder nicht genossen.
«Hören Sie mir zu, Gnädigste», forderte er sie stattdessen auf, so scharf, dass er vor sich selbst erschrak. «Sie haben mich jetzt lange genug festgehalten.» Mit der Rechten wühlte er seinen Dienstausweis aus der Innentasche seines Mantels und streckte ihn entlang des Laternenpfahls hinauf und der Gaslichtquelle dort oben entgegen. «Kriminalinspektor Paul Stainer. Ich muss Sie leider verhaften, wenn Sie mich nicht sofort loslassen.»
Die Welt, in der Tat höchst merkwürdig an diesem Abend, stand daraufhin einen Augenblick vollkommen still, doch nur, um im nächsten einen völlig unberechenbaren Richtungswechsel vorzunehmen, und das recht abrupt: Der Laternenpfahl entglitt seiner Hand, er stürzte nach rechts über den Bürgersteig und prallte gegen eine Hausfassade.
«Na also», sagte er, und bückte sich nach seinem Dienstausweis, der seinen Fingern entglitten war, «warum nicht gleich so.» Entlang der Fassade tastete er sich voran, passierte ein Schild mit der Aufschrift Gustav-Freytag-Straße und stand irgendwann vor der Hausnummer 12.
«Endlich zu Hause», murmelte er und staunte, wie instinktiv er den Weg gefunden hatte; den Weg hierher in die Gustav-Freytag-Straße 12, wohin er ursprünglich gar nicht aufgebrochen war.
Mühelos gelang es ihm, die nicht abgeschlossene Haustür zu öffnen, doch die Treppen hinauf ins zweite Obergeschoss erschienen ihm anschließend wie eine unendlich steile Leiter. Er verfluchte den trinkfesten Schilling, denn er war die treibende Kraft auf der Tour durch die Kneipen gewesen.
Als er auf Händen und Knien schließlich oben anlangte und den Schalter für das elektrische Licht gefunden hatte, blinzelte er so lange auf das emaillierte Türschild, bis es nur noch geringfügig verschwamm: Paul & Edith Stainer.
Jawohl, hier war er zu Hause! Hier hatte er gelebt bis zum August 1914, hier, bei der Frau, die er heute beerdigt hatte. Was interessierten ihn eine Katze und die Mansarde in der Moltkestraße? Hier würde er wieder einziehen, hier gehörte er hin!
Er fummelte einen Schlüsselbund aus der Manteltasche, und dass er gleich den ersten Schlüssel, den er erwischte, ins Türschloss zu stecken vermochte – schon beim ersten Mal –, erschien ihm wie ein kosmischer Beweis: Hier gehörte er hin.
Daran, wie er abgeschlossen hatte, erinnerte er sich später noch, und auch an den großen hageren Mann mit den dunklen Ringen unter den Augen und dem schlohweißen Haar, der ihn aus dem Garderobenspiegel angestaunt hatte; daran, wie er durch Diele und gute Stube ins Schlafzimmer gelangt war, jedoch nicht mehr. Mit Hut, Mantel und in Schuhen sank er ins Bett – nicht in seines, in Ediths. Und exakt dorthin hatte er gewollt. Schon seit August 1914. Schon immer.
Tief sog er ihren Duft ein, wieder und wieder. Er lächelte, er weinte, er stammelte ihren Namen, er kapitulierte. Ein wenig Angst vor dem Einschlafen blieb ihm allerdings, denn er fürchtete sich vor einem der Albträume, die ihn immer dann quälten, wenn er Trost im Alkohol gesucht hatte.
«Du hast eine Fahne, Paul», glaubte er, Ediths Stimme aus der Dunkelheit des Schlafzimmers raunen zu hören.
«Schilling …» Erst im dritten Anlauf gelang ihm die Antwort: «Schilling ist schuld.»
«Du bist ja vollkommen betrunken, Paul.» Schon wieder Ediths Stimme.
«Da hast du wahrscheinlich recht, mein Schatz», antwortete er.
«Das tut dir nicht gut, Paul», meinte er, sie flüstern zu hören.
«Da hast du wahrscheinlich recht, mein Schatz.» Und dann schlief er ein.
Kein Albtraum plagte ihn in dieser Nacht. Zwar sah er Edith wie tot in einem Automobil mit zerschossener Windschutzscheibe liegen, sah auch das schwarzrote Loch in ihrem Kopf, konnte sogar ihr Blut riechen; doch das ängstigte ihn nicht im Geringsten, denn Edith stieß die Wagentür auf, stieg aus, umarmte ihn und hielt ihn fest.
Irgendwann jedoch, in einem anderen Traum, hörte er die Türglocke läuten, und das erschreckte ihn schon ein wenig. Fluchend stand er auf, ging zur Wohnungstür und öffnete: Junghans, der neue Kommissaranwärter, kniete im Treppenhaus vor dem Fußabtreter auf dem Boden. Er schien direkt aus dem Café Reichspost zu kommen, denn er war maßlos betrunken und versuchte vergeblich, sich aufzurichten.
«Arbeit, Paul.» Junghans sprach überraschend laut und deutlich. «In der Stadt haben sie einen toten Mann gefunden. Ermordet.»
«Ist mir vollkommen gleichgültig, Siggi», hörte Stainer sich im Traum antworten, während er Junghans die Wohnungstür vor der Nase zuschlug. «Ich habe genug von all den Toten, hörst du? Ein für alle Mal genug!»
4Bonaparte
Vor dem Bonaparte-Porträt unten am Ende der Eingangstreppe verharrte Rosa erst einmal. Selten hatte es sie so viel Mühe gekostet, ein paar Stufen hinabzusteigen. Sie wusste genau, woran das lag: an ihrem Bruder Hagen – jeder weitere Schritt verkürzte die Entfernung zu ihm. Auch jetzt, während sie das Bild Napoleons betrachtete und tief durchatmete, sträubte sich alles in ihr dagegen weiterzugehen.
Wie lange war es eigentlich her, dass sie zum letzten Mal vor dem Porträt dieses kleinen, kriegerischen Franzosen gestanden hatte, nach dem Hagen und sie ihren Nachtclub benannt hatten? Acht Tage? Oder schon zehn? In der Einsamkeit ihres Ateliers war ihr Zeitgefühl ein wenig durcheinandergeraten.
Im Gesicht des Feldherrn, an dem sie sonst immer achtlos vorüberging, entdeckte sie plötzlich einen Zug, der sie an Hagen erinnerte – einen selbstgewissen, herablassenden Zug. Die Wut packte Rosa. «Scheißkerl», murmelte sie. «Du elender Scheißkerl!» Ein paar Minuten noch, dann würde sie ihm in die Augen sehen.
Tief sog sie ein letztes Mal die kühle Abendluft ein, bevor sie sich nach rechts wandte, dem roten Sandsteinbogen der offenen Clubtür zu. Sie schaute hinauf, und der gehörnte rote Schädel des Schlusssteins grinste auf sie herab.
Wirklich wohl war ihr nicht in ihrer Haut. Ihre Knie fühlten sich an, als wollten sie nachgeben, und ihr Herz schlug ein wenig schneller, während sie unter dem Eingangsbogen hindurchtrat und das Gewölbe des kleinen Foyers durchquerte. Doch sie hatte beschlossen, Hagen heute Abend gegenüberzutreten und reinen Wein einzuschenken, also würde sie sich zusammenreißen.
Sie winkte dem freundlich grüßenden Mädchen hinter dem Garderobentresen zu und ging am monumentalen Gemälde der Völkerschlacht von 1813 vorbei direkt zur alten Eichentür, die in den Barraum des Clubs führte. Keine Musik, nur gedämpftes Stimmengewirr war dahinter zu hören. Rosa packte die gusseiserne Klinke – und zögerte.
Unverhofft gewannen wieder Angst und Unruhe die Oberhand. Das Atmen fiel ihr schwer, und unter ihrem Blondschopf begannen ihre Gefühle und Gedanken Karussell zu fahren.
Vielleicht ist es doch zu früh, schon wieder zu arbeiten, sagte sie sich, vielleicht sollte ich mich besser doch noch eine weitere Woche zu Hause im Atelier verkriechen. Und warum überlasse ich die Auseinandersetzung mit Hagen nicht einfach meinem Anwalt? Jeder, der weiß, was ich in letzter Zeit durchgemacht habe, würde mir genau dazu raten!
Doch dann stand ihr Hagens hartes Gesicht vor Augen, sein lauernder Blick und die Kälte darin, und sie musste wieder daran denken, wie er sie gepackt und geschüttelt und ihr Haus durchsucht hatte. Augenblicklich loderte erneut die Wut in ihrer Brust auf – war es nicht sogar schon Hass? –, drängte die Angst zurück, half ihr, die Klinke hinunterzudrücken und die Tür aufzustoßen.
Stimmengewirr, Rauchschwaden, Gläserklirren und Gelächter schlugen ihr entgegen. Rosa blieb stehen und staunte: Obwohl es noch nicht einmal acht Uhr war und das Bonaparte erst vor einer halben Stunde geöffnet hatte, saßen bereits an fast jedem dritten Tisch Gäste.
Während sie die Treppe ins große Gewölbe des Nachtclubs hinunterstieg, senkte sich der Geräuschpegel merklich. Viele Gäste grüßten sie, manche riefen ihren Namen. Einige Männer standen sogar auf und verneigten sich, und die Soldaten unter ihnen salutierten. Komplimente, Glückwünsche und Ausrufe der Erleichterung begleiteten sie auf dem Weg zur Theke.
Das tat ihr gut. Dankbar und zugleich ein wenig verwundert nickte Rosa den Gästen zu und begriff erst nach und nach, was die Leute bewegte: die schlichte Tatsache, dass sie überlebt hatte. Offenbar hatte sich herumgesprochen, dass sie die entführte Frau gewesen war, von deren Schicksal sämtliche Leipziger Blätter berichtet hatten. Ob sich auch Hagens Rolle bei diesem Verbrechen herumgesprochen hatte?
«Mensch, Rosa!» Der kleine blonde Kellner mit dem Walross-Schnurrbart warf sich das Geschirrtuch über die Schulter, kam hinter der Theke hervor und streckte beide Hände nach ihr aus. «Du glaubst ja nicht, wie gottfroh ich bin, dass du wieder bei uns bist!»
«Was ist hier los, Franz?» Rosa ließ sich von ihm umarmen und küssen. «Warum haben wir um die Zeit schon so viele Gäste?»
«Hagen hat gestern verkündet, dass du heute wieder zu besichtigen sein wirst.» Mit einer Kopfbewegung deutete er zu den Gästen hin. «Mund-zu-Mund-Propaganda, schätze ich. Hat funktioniert.»
«Wo ist mein Bruder?»
«Im Kontor.» Mit dem Daumen deutete der Kellner hinter sich und grinste. «Knete zählen, schätze ich, denn ein Mädel hat er nicht mit nach hinten genommen. Das wüsste ich.»
An ihm vorbei ging Rosa hinter die Theke. Als sie dort die ledergepolsterte Tür neben dem Spiegelschrank öffnen wollte, nahm sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung an einem Tisch nahe der Bühne wahr. Zwei Paare saßen dort, und eine der Frauen winkte. Abrupt blieb Rosa stehen und schaute genauer hinüber.
«Clara …» Ein Lächeln glättete ihre angespannten Züge. Wie lange hatte sie die ehemalige Kommilitonin nicht mehr gesehen! Und hier im Bonaparte war Clara überhaupt noch nie gewesen. Sie winkte zurück und zögerte wieder.
Erneut geriet sie in Versuchung, der Begegnung mit ihrem Bruder auszuweichen und erst einmal an den Tisch der alten Freundin statt direkt in Hagens Büro zu gehen. Immerhin begegnete man sich schließlich nicht jeden Tag, denn seit dem Tod ihres Mannes vor vier Jahren machte sich Clara rar in der Stadt. Rosa fiel auf, dass sie kein Schwarz mehr trug.
Sie hatte die Türklinke bereits losgelassen, doch dann gab sie sich einen Ruck und bedeutete Clara mit ein paar Gesten, dass sie noch etwas zu erledigen hatte, bevor sie zu ihr kommen würde.
Sie zog die gepolsterte Tür auf und betrat den kleinen Trakt, in dem die Künstlergarderobe, die Personaltoiletten, drei Hinterzimmer und das Büro lagen. Hinter dessen Tür hörte sie die Stimme ihres Bruders. Offenbar telefonierte er.
Wieder schwoll der Kloß in ihrem Hals, und die Brust wurde ihr eng. Doch zugleich ärgerte sie sich: Warum um alles in der Welt geriet ihr Selbstbewusstsein jedes Mal ins Wanken, wenn sie ihrem großen Bruder Widerstand zu leisten hatte? War sie nicht aus eigener Kraft der Enge des Elternhauses entflohen? Stand sie nicht seit bald zehn Jahren auf eigenen Beinen? War sie nicht erst vor ein paar Tagen skrupellosen Mördern entkommen?
«Du bist eine Amazone», murmelte sie. Das hatte Albert manchmal zu ihr gesagt, ihr gefallener Verlobter. «Du bist eine kluge Kriegerin und Hagen ein dumpfer, kleingeistiger Bauernrüpel. Und ein Feigling noch dazu.»
Um ihm gar nicht erst die Gelegenheit zu geben, sie zu vertrösten, trat Rosa sofort ein, nachdem sie einmal kurz geklopft hatte. Dem rundlichen, über ein großes Foto gebeugten Mann hinter dem Schreibtisch, der gerade den Hörer des Fernsprechers ans Ohr drückte, entgleisten kurz die Gesichtszüge, als ihre Blicke sich trafen.
«Ich muss jetzt Schluss machen, August», haspelte er in die Sprechmuschel. «Rufe dich später noch einmal an.» Er legte auf und saß auf einmal kerzengerade in seinem Schreibtischsessel. Der herablassende und selbstgewisse Ausdruck kehrte schnell in seine Miene zurück. In seinem vollen tellergroßen Aschenbecher dampfte eine Zigarre.
«Da bist du ja, Schwesterchen!» Sein Feixen hatte etwas Bemühtes. «Geht’s denn wieder?» Bevor es ihm gelang, das Foto umzudrehen, das vor ihm lag, erhaschte Rosa einen Blick darauf: Es zeigte eine sehr junge und sehr leicht bekleidete Frau.
«Nein.» Rosa wandte sich ab und stelzte zur Sitzecke, wo ein Kaiserbildnis und die schwarz-weiß-rote Fahne des abgewickelten Kaiserreiches über wuchtigen Polstermöbeln an den Wänden hingen. «Jedenfalls nicht mehr so, wie es bisher gegangen ist.» Sie ließ sich in den Sessel unter der Fahne fallen, direkt unter dem schwarzen Adler, Hagens Lieblingsplatz, und wunderte sich über ihre klare und feste Stimme. «Gravierende Änderungen stehen bevor, Hagen.»
«Was du nicht sagst?!» Sein Feixen wurde breiter. «Ich weiß zwar nicht genau, worauf du hinauswillst, doch ich gebe zu, dass es nicht besonders glattlief letzte Woche. Hat mir selbst nicht gefallen.» Ihr Bruder griff zu seiner Zigarre und stemmte sich aus seinem Schreibtischsessel, um zu ihr in die Sitzecke zu kommen. «Hör mir zu, Schwesterchen, ich kann dir alles erklären …»
«Bleib, wo du bist!» Rosa streckte ihm abwehrend den Arm entgegen. «Und nimm Stift und Papier, damit du dir notieren kannst, was ich dir zu sagen haben; es ist nicht viel, aber wichtig.»
«Jetzt dreh nicht durch, Schwesterchen, ist doch alles halb so wild.» Er feixte noch immer, blieb aber, wo er war.
«Und nenn mich nicht mehr ‹Schwesterchen›, verstanden?» Rosa öffnete ihre Handtasche und holte ein Feuerzeug und eine frische Schachtel Astor heraus. «Um gleich zum Punkt zu kommen: Ich werde nicht mehr mit dir zusammenarbeiten.»
«Ich bitte dich, Rosalinde!» Hagen verdrehte die Augen und sank zurück in seinen Schreibtischsessel. «Hör mir doch erst einmal zu …»
«Nein!», unterbrach sie ihn scharf. «Kein Wort mehr über das, was geschehen ist …!»
«Es tut mir doch leid!»
«… ich will nicht mehr darüber sprechen, ich will nicht einmal mehr daran denken, und schon gar nicht will ich dafür irgendeine Entschuldigung von dir hören! Und schreib besser mit, denn ich werde mich nicht wiederholen.» Sie zog eine Zigarette aus der Schachtel und zündete sie sich an. Die Handtasche behielt sie auf dem Schoß.
«Verflucht, Rosa!» Er klemmte die Zigarre zwischen die Zähne und versuchte offensichtlich, trotz seines unablässigen Feixens gefährlich auszusehen. Das war ihm noch nie wirklich gelungen mit seinem fleischigen Gesicht, seinem kurzen, mittig gescheitelten graublondem Haar und dem daumenbreiten Schnauzer über der kleinen und zu dick geratenen Oberlippe. «Dein Ton gefällt mir nicht.»
«Das kümmert mich nicht.» Rosa musterte ihn kühl. Sein Anblick erinnerte sie an einen fettsüchtigen Haifisch, dem ein kleines Kanonenrohr aus dem Maul ragte. Diese Assoziation erheiterte sie und befeuerte ihren sowieso schon im Wachsen begriffenen Mut. «Hör also gut zu», sagte sie mit vor Kälte klirrender Stimme. «Künftig wird nur noch einer von uns beiden diesen Nachtclub betreiben.»
«Was?» Endlich fiel ihm das Feixen endgültig aus dem Gesicht. «Du willst allen Ernstes aussteigen?»
«Unsinn, Hagen! Dann müsstest du mir ja meinen Gesellschafteranteil auszahlen, und das ist wohl völlig ausgeschlossen in deiner finanziellen Situation.» Rosa kannte den privaten Schuldenstand ihres ältesten Bruders. «Du wirst aussteigen.» Sie legte den Kopf in den Nacken und blies den Rauch ihrer Zigarette Richtung Decke, sodass die Schwaden den schwarzen Adler auf der Kaiserfahne vernebelten. «Ich werde dich auszahlen.»
«Komm, komm, Mädel!» Er sprang auf. «Jetzt fang nicht an zu spinnen!»
«Bleib, wo du bist!» Rosa griff in die Handtasche, zog eine Pistole heraus und richtete sie auf Hagen. «Komm mir bloß nicht zu nahe!»
Der Anblick der Waffe erschütterte ihn dermaßen, dass er einen Hustenanfall bekam. «Sag ich nicht, dass du durchdrehst?», krächzte er und riss sich die Zigarre aus dem Mund. «Übergeschnappt bist du, vollkommen übergeschnappt!»
«Setz dich und schreib endlich mit: Ich gebe dir bis nächste Woche Freitag Zeit, einen Termin mit deinem Anwalt zu vereinbaren, um die Gesellschaft aufzulösen, den Nachtclub auf mich zu überschreiben und die Auszahlung deines Anteils in die Wege zu leiten. Bis zum Zwanzigsten, hast du das verstanden?»
«Was soll denn dieser Scheißdreck, Rosalinde?» Aus tränenden Augen, die Fäuste auf seinen Schreibtisch gestützt, stierte er sie an. «Das kannst du doch nicht machen! Das Bonaparte ist doch unser gemeinsames Kind.»
Der Zigarrenrauch war ihm in die Nase gestiegen, hustend richtete er sich auf. «Hör zu, Schwesterchen.» Er schlug nun einen moderateren Tonfall an und drückte die Zigarre aus. «Ich vergesse, dass du mich letzte Woche mit einem Gewehr bedroht hast, und du vergisst meinen kleinen Wutanfall während meines Überraschungsbesuches.»
«Du hast mich nicht besucht, sondern überfallen. Nenn mich nie wieder ‹Schwesterchen›!» Sie hob die Waffe und zielte auf seinen Kopf. «Du bist ein Verbrecher, Hagen Bockwitz, mit Verbrechern will ich nichts zu tun haben. Und nun noch einmal zum Mitschreiben: Am nächsten Freitag habe ich einen Brief mit einem Termin bei deinem Anwalt in der Post, oder ich gehe zur Polizei und unterschreibe das Protokoll mit der Aussage, um die man mich dort gebeten hat.»
«Bitte?» Hagen erbleichte. «Was für eine Aussage denn?»
«Stell dich nicht noch blöder, als du bist. Du wirst mir den Nachtclub überschreiben und dich nie wieder hier blickenlassen, oder ich werde der Staatsanwaltschaft meine Aussage bestätigen, dass du mit jener Kampfzelle der Schwarzen Reichswehr unter einer Decke steckst, die das Blutbad in Gohlis, den Mord an Inspektor Stainers Frau und meine Entführung zu verantworten hat.»
Eine Zeitlang schwiegen sie. Hagen Bockwitz starrte seine Schwester an und sah aus wie ein leidender Hund, den man sonst wohin getreten hatte. Rosa taxierte ihn rauchend und mit harter, regloser Miene.
«Das kannst du doch nicht machen, Rosalinde!», brach es schließlich aus Hagen heraus. Er sank zurück in seinen Bürostuhl.
Rosa stand auf. «Das Protokoll meiner Aussage liegt bereits in Kriminalinspektor Stainers Schublade. Du tust, was ich verlange, und ich widerrufe sie. Du weigerst dich, und ich unterschreibe.» Sie ging zu ihm an den Schreibtisch und drückte ihre Zigarette zwischen seinen Zigarrenstummeln aus.
«Du wirst doch mit deinem Bruder nicht brechen?», flüsterte Bockwitz. «Du wirst doch deinen eigenen Bruder nicht ins Zuchthaus bringen?» Wie ein Häufchen Elend hing er hinter seinem Schreibtisch.
«Ich habe bereits mit dir gebrochen, Hagen.» Sie steckte die Pistole zurück in ihre Handtasche. «Und du entsinnst dich sicher dunkel, wohin du mich gebracht hast: in die Hände deiner mörderischen Freunde, und das ohne zu zögern.»
Rosa machte kehrt, verließ das Büro und warf die Tür hinter sich zu. Sie fühlte sich erleichtert, sie fühlte sich so gut wie lange nicht mehr, sie fühlte sich einfach großartig.
5Schmisse
Kahle Bäume, eine Wegkreuzung, eine Lichtung mit einer Art Jagdhütte und eine Gruppe Männer, die meisten unter dreißig – das war es, was Marlene zu sehen bekam, seit sie die schwarze Schutzbrille abgenommen hatte und aus dem Beiwagen gestiegen war. Vier Fackeln brannten, und zwei junge Burschen entzündeten gerade vier weitere.
Marlene hatte nur eine vage Ahnung, wo dieser Thorwald sie hingebracht hatte. Vielleicht ins Rosental. Oder ins Leutzscher Holz? In ein Waldgebiet jedenfalls, das nördlich der Stadt lag; so viel glaubte sie aus den Abzweigungen schließen zu können, die ihr Chauffeur genommen hatte und die ihr trotz geschwärzter Brille nicht entgangen waren.
Thorwald hatte seinen Stahlhelm abgeschnallt, lümmelte links neben ihr auf der Bank vor der Hüttentür, die man ihr zugewiesen hatte, und rauchte eine lang nach unten gebogene Pfeife. Sein Helm lag zwischen ihnen, und im Schein der Fackeln, die über ihnen in Haltern an der Hüttenwand steckten, entdeckte Marlene knapp über dem Totenkopf eine rostige Schramme.
Manchmal ertappte sie Thorwald dabei, wie er sie von der Seite musterte, wobei er jedes Mal lächelte. Auch jetzt wieder, als sie die Rostschramme betrachtete. «Feindliches Maschinengewehrfeuer.» Er schlug den Kragen seines schwarzen Ledermantels hoch. «Verdun, Sommer sechzehn. Beim Sturm auf einen strategisch entscheidenden Viehstall. Müsste tot sein.» Sein Lächeln zerfloss in ein breites Grinsen. «Bin ich aber nicht.»
Marlene dachte an ihren Bruder und nickte stumm. Roland müsste nicht tot sein, er war ja ein entlassener Gefangener, sollte ja aus dem Zug steigen; war er aber nicht. Der salzige Geschmack nach Tränen kroch auf ihre Zunge.
Einen Atemzug lang oder zwei rückten die Waldhütte, Carl Thorwald und die anderen Männer in weite Ferne, und ihre Gedanken kreisten einzig und allein um den geliebten Bruder. Würde er auf der Bahre liegen, die Lamperts Schwager morgen Abend oder übermorgen früh aus der Leichenkammer der Basler Gerichtsmedizin ziehen würde? Mit eiskalter Hand griff auf einmal die Angst nach ihrem Herzen und presste es zusammen.
«Alles in Ordnung, Fräulein Wagner?» Thorwald runzelte die Stirn, beugte sich über seinen Totenkopfhelm zu ihr herüber und berührte ihre Schulter. Schon wieder hatte der Mann sie beobachtet, und wie aufmerksam!
«Aber ja doch.» Marlene tat, als erstaune sie seine Frage. «Was denken Sie denn? Ich freue mich auf das Duell.» Mit einem Lächeln versuchte sie ihm die Lüge zu verkaufen. Thorwald neigte den Kopf auf die Schulter, in seinem Gesicht eine Mischung aus Skepsis und Spott.
Sie hatte nichts dagegen, von diesem Mann betrachtet zu werden, denn trotz seiner entstellten Wange sah er gut aus mit seinen dichten dunkelblonden Locken, seinen kantigen Zügen und seiner kräftigen Gestalt. Seine blauen Augen leuchteten wie zwei Bergseen, in denen sich der Sommerhimmel spiegelte.
«Mensur, nicht Duell», korrigierte leicht verspätet ein bleicher Mensch, der zu ihrer Rechten hockte und Gustav Hügel hieß. Er war Philosophiestudent im vorletzten Semester und ihr Kontaktmann. Ohne seine Vermittlung und Fürsprache wäre sie niemals an diese Geschichte gekommen, denn die Corpsstudenten taten alle sehr geheimnisvoll. Mit leiser Stimme und wichtiger Miene erklärte ihr Hügel, was sich hier abspielte, während Marlene stenographierte und skizzierte.
Mehr Männer, als sie erwartet hatte, tummelten sich auf dem Vorplatz der Hütte, sicher ein gutes Dutzend. Sie beugten sich über ein Formular oder prüften Säbel, ritzten mit einem Bajonett Striche in den feuchten Boden oder halfen den beiden Fechtern in ihre Schutzkleidung.
Jedem dieser Männer verunstaltete mindestens eine Narbe das Gesicht, den meisten zwei oder drei. Auch dem schmalen Philosophen, der Marlene auf ihre verwunderte Nachfrage hin erklärte, dass man solche Narben Schmisse nannte und sie unter aktiven oder ehemaligen Corpsstudenten als Nachweis absolvierter Mensuren galten.
Marlene notierte jede Einzelheit, und sie musste sich dabei nicht einmal beeilen, denn die Herren vor der Waldhütte ließen sich Zeit und machten ganz und gar nicht den Eindruck von Männern, die sich auf ein Duell vorbereiteten; auf eine Mensur, korrigierte Marlene sich im Stillen.
So wurde, wie sie inzwischen wusste, der Abstand zwischen den beiden Fechtenden genannt, den ein Mann in einem Uniformmantel nun anhand der Striche auf dem Boden nachmaß. Überhaupt ging hier, ihrem Eindruck nach, alles recht steif, beinahe bürokratisch zu: Zwei andere Männer in Frack und Zylinder prüften wiederholt die Schärfe der Säbel; einer mit blauer Studentenmütze und blau-gold-roter Schärpe unter dem Mantel ging herum und ließ sich von jedem das Formular unterschreiben; ein anderer redete flüsternd auf die beiden Kontrahenten ein; und ein junger Bursche in den Farben Hellgrün-Weiß-Hellblau half einem eleganten graubärtigen Herrn in ein Paar Latexhandschuhe.
Der Bursche war Erstsemester an der medizinischen Fakultät, wie Marlene von Hügel erfuhr, der Graubart ein Leipziger Chirurg. «Bei jeder Mensur haben zwei Paukärzte anwesend zu sein», erklärte Gustav Hügel. «Dazu ein Unparteiischer, zwei Sekundanten, zwei Testanten, zwei Protokollführer und zwei Füxe als Schlepper. Jeder Paukant …»
«Paukant?» Marlene schaute mit fragend gerunzelten Brauen von ihrem Notizblock auf. «Füxe?»
«So heißen bei uns die Neulinge und Paukanten die aktiven Fechter», erklärte Hügel. «Wer Mitglied einer schlagenden Studentenverbindung ist, muss täglich eine Stunde fechten üben, also pauken, wie wir das nennen. Wobei Fritz Sternberg kein Paukant mehr ist, sondern bereits ein Alter Herr. So heißen Corpsmitglieder, die nicht mehr studieren.»
Er deutete auf einen hageren Mann, dessen vernarbtes Gesicht fahl, hohlwangig und mindestens dreißig Jahre alt aussah und dem sein Sekundant und sein Testant gerade einen Brustschutz in den Farben der Saxo-Bavaria-Burschenschaft anlegten: Hellgrün, Weiß, Hellblau.
«Sternberg ist erst kürzlich aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen», sagte Hügel mit düsterer Miene. «Keine Ahnung, wann er zum letzten Mal gepaukt hat.»
In diesem Moment hob der hagere Fechter namens Sternberg den Blick und schaute haarscharf an Marlene vorbei zu Thorwald, und das nicht sehr freundlich. Als sie den Kopf nach links wandte, erschrak Marlene vor Thorwalds ebenfalls feindseliger Miene. Er sog erst scharf die Luft durch die Nase ein und spuckte dann nach links in den Farn. «Hoffentlich kriegt er heute Abend ordentlich Dresche!»
«Nanu?», wunderte sich Marlene. «So viel Wut?»
«Man kennt sich», seufzte Hügel, der den Blickwechsel der beiden Männer und Marlenes Verwunderung bemerkt hatte.
«Noch lange nicht gut genug, schätze sich», raunte Thorwald, und es klang wie eine Drohung.
Marlene erfuhr, dass jener Sternberg der jüdischen Verbindung Saxo-Bavaria angehörte und dass sie gleich einer sogenannten Verabredungsmensur beiwohnen würde. Sie stenographierte eifrig mit und staunte nicht schlecht, als sie hörte, dass der bevorstehende Kampf bereits vor dem Krieg verabredet worden war, genauer: drei Tage vor der Mobilisierung.
An jenem Augusttag 1914, so Hügel, hatte der heutige Gegner Sternbergs, ein strohblonder Architekturstudent namens Winter von der Verbindung Lusatia, Sternberg beleidigt. Weil beide den Krieg überlebt hatten, konnte der Kampf nun endlich stattfinden, und das, obwohl Sternberg inzwischen im Südwesten des Reiches am Neckar wohnte.
«Er studiert bei einem Meister in Heidelberg», erzählte Hügel, «keine Ahnung, bei wem. Ist gestern extra angereist, denn eine Verabredungsmensur zum Zwecke der Satisfaktion hat um jeden Preis stattzufinden, Ehrensache. Zum Glück hat Sternberg auf die Schnelle noch einen Ersatzsekundanten gefunden, der ursprünglich vorgesehene Kommilitone ist nämlich nicht am verabredeten Ort erschienen. Ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich sogar.»
«Er studiert bei einem Meister?» Marlene verstand nicht ganz.
«Bei einem Professor an der Heidelberger Kunsthochschule. Fritz ist Maler, wissen sie?»
Ja, dachte Marlene, so sieht er auch aus – wie ein Hungerleider. Sternberg wirkte um Jahre älter als Winter mit seinen weichen, jungenhaften Zügen, dabei mussten die Männer im etwa gleichen Alter sein.
Sie wurde allmählich ungeduldig, schließlich musste sie die Geschichte noch schreiben, und in ihrer Handtasche steckte ein Fahrschein für die Reichsbahn nach Basel. Kurz nach sechs fuhr ihr Zug ab. Die Vorstellung, bei Dunkelheit zum Hauptbahnhof fahren zu müssen, behagte ihr ganz und gar nicht.
Hügel ließ sie einen Blick auf das Formular werfen, das bereits teilweise ausgefüllt war, mit Datum, Fakultäten und Namen aller Beteiligten. Die Spalten, in die man die Schläge und Treffer eintragen würde, waren noch leer.
«Keine Namen, Fräulein Wagner, verstanden?», sagte er streng und mit hochgezogenen Brauen. Marlene nickte.
Von links beugte sich der grinsende Thorwald nahe an ihr Ohr. «Sie verstehen, Fräulein?», flüsterte er. «Verabredungsmensuren werden nicht gern gesehen an der Universität, und Säbelfechten ist sowieso verboten. Eigentlich.» Der Mann roch irgendwie gut.
Der Unparteiische und die Sekundanten und Testanten beider Kontrahenten trafen letzte Absprachen, den Kämpfern wurden Schutzbrillen – sogenannte Paukbrillen – aufgesetzt, sie stellten sich an den in die Erde geritzten Grundlinien auf, und nachdem sieben Fackelträger den Mensurplatz umringt hatten, rief irgendjemand: «Los!» Blitzartig machten beide Fechter einen Ausfallschritt, dann prallten die Säbel zum ersten Mal aufeinander.
Marlene atmete auf – endlich!
Für das gesamte Treffen waren dreißig Gänge zu je sechs Hieben vereinbart worden. Die Fechter durften weder hinter ihre Grundlinie zurückweichen noch diese mit ihrem hinteren Fuß verlassen. Dadurch gerieten sie einander beim Fechten so nahe, dass sie die Säbel meist nur über ihren Köpfen führen konnten. Weil sie an Beinen, Armen und Oberkörpern mit Schutzbandagen gepolstert waren, bewegten sie sich zudem auf seltsam linkische Weise, die Marlene unnatürlich und puppenhaft vorkam.
Die Protokollanten standen mit Stift und Kladde seitlich bei ihnen wie Buchhalter neben einem zu beladenden Fuhrwerk und notierten im Fackelschein jeden Hieb, jeden Treffer, jeden Gang. Manchmal protestierten die Sekundanten, weil der gegnerische Fechter Hiebe ausführte, die ihrer Meinung nach unstatthaft waren.
Vor allem ein Sekundant der Lusatia-Verbindung, ein hochgewachsener Mittdreißiger in langem Pelzmantel über blauem Frack, tat sich immer wieder mit lautstarkem Protest hervor, weil er den Kämpfer seiner Verbindung, den Architekturstudenten Winter, benachteiligt wähnte. Dieser Sekundant in seiner eleganten Kleidung und mit seinem etwas affektierten Benehmen kam Marlene bekannt vor. Hatte sie ihn nicht sogar schon im Büro des Chefredakteurs gesehen?
Die Veranstaltung zog sich hin, die Nacht schritt voran, und weitere Fackeln flammten auf. Marlene, deren Vorstellung von Säbelkämpfen durch Opernaufführungen und Besuchen im Lichtspieltheater geprägt war – von Duellen zwischen Liebesrivalen, Piraten und kühnen Edelmännern –, Marlene war zunehmend enttäuscht: Die Mensur stellte sich als recht ereignislose und von ständigen Kommandorufen begleitete Choreographie heraus, die nach festgelegten Schritten und Bewegungen erfolgte.
Unterbrochen wurde das langweilige Theater nur von wenigen Pausen, in denen die Fechter Atem schöpften, ihre Klingen abgewischt und die Grundlinien im Boden nachgezogen wurden. Während dieser kurzen Unterbrechungen schielte Marlene auf das Protokoll in Hügels schmalen Händen, um die Namen der Anwesenden genauer zu studieren. Sie hob erstaunt die Brauen: Außer einigen Studenten und den beiden Ärzten waren noch zwei hohe Leipziger Verwaltungsbeamte – Geheimräte – mit von der Partie, ein hoher stadtbekannter Offizier und ein Schauspieler namens Rainer Maximilian Delius.
Das war der blonde Sekundant des Architekturstudenten Winter! Jetzt erst erkannte Marlene ihn.
Dann erhielt Sternberg den ersten Treffer, der augenblicklich mit einem großen Pflaster an der Stirn versorgt wurde. Im Gegenzug traf Sternberg Winter gleich dreimal. Die ersten beiden Male bestand Delius’ Schützling darauf, mit Kopfverband weiterzufechten, nach dem dritten Treffer jedoch strömte ihm das Blut in solcher Menge übers Gesicht, dass der Unparteiische und die Ärzte die Mensur abbrachen und Sternberg zum Sieger erklärt wurde.
«Frecher Judenlümmel, elender!», zischte Thorwald neben Marlene, und es klang bitterböse. Sie fuhr herum und schaute ihm streng in die wasserblauen Augen. «Das war die Beleidigung damals», erklärte er mit gequältem Grinsen. «Die hat Winter jetzt drei Schmisse eingebracht.» Er reichte Hügel die noch rauchende Pfeife und kramte eine Schachtel Zigaretten aus seinem Ledermantel. «Dabei hätte diese Lusche dem Sternberg gar keine Satisfaktion geben müssen.» Er wich Marlenes Blick aus und zündete sich eine Zigarette an.
«Keine Satisfaktion?» Fragend schaute sie nach rechts zu Gustav Hügel. «Warum nicht?»
«Manche Paukanten im Reich nehmen Herausforderungen von Juden nicht an», sagte Hügel ein wenig kleinlaut.
«‹Manche›?» Thorwald lachte verächtlich.
«Nicht einmal, wenn sie einen Juden beleidigt haben und der Betreffende eigentlich zu Recht Genugtuung fordert.» Hügel räusperte sich und tat, als hörte er Thorwalds Bemerkung nicht. «Leider. Die Satzung unserer Lusatia sieht so einen Unsinn zum Glück nicht vor, und das ist gut so. Davon abgesehen ist Alexander Winter ein Ehrenmann.»
«Ach was?» Thorwald schaute Hügel herausfordernd an. «Da habe ich schon ganz andere Sachen gehört.»
Während Thorwald und Hügel sich in das Thema verbissen, schaltete Marlene ab. Sie hatte genug.
Später, als sie neben Thorwald im Beiwagen seines Kraftrades saß und die schwarze Brille ihr die nächtliche Stadt vollkommen verdunkelte, beschloss sie, die Mensur für ein stumpfsinniges Theater eitler Kindsköpfe zu halten, für eine phantasielose Männerveranstaltung.
Und so würde sie die Veranstaltung in ihrem Artikel auch schildern – als unsinniges bürokratisches Männertheater. So viel Bürokratie hatte sie zuletzt erlebt, als sie vor zwei Jahren beim Standesamt die Sterbeurkunde ihrer Eltern beantragt hatte. Und wie merkwürdig, dass die so aufwendig wattierten, bebrillten und bandagierten Fechter ausgerechnet ihre Köpfe nicht schützten! Als hätten sie es auf Verletzungen abgesehen, auf diese hässlichen Schmisse.
In Gedanken arbeitete Marlene bereits an ihrer Geschichte, und als ihr Chauffeur sein Gespann vor der Tauchaer Straße 19 bis 21 anhielt, war sie so gut wie fertig.
Sie reichte Thorwald die geschwärzte Schutzbrille und stemmte sich aus dem Beiwagen. «Kann ich Sie wiedersehen, verehrtes Fräulein?», fragte er in überraschend manierlichem Tonfall.
Marlene war für einen Augenblick verdutzt. «Warum nicht?»,