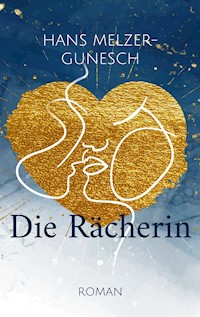5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Johann Maurer nach dem Krieg heimkehren will, muss er existentielle Prüfungen bestehen. Von Überlebensstrategien bis hin zu täglichen Entscheidungen darüber, welche Risiken er eingehen kann. Das Schicksal weist ihm schließlich eine neue Heimat zu, Wien, wo ihn als Kriminalkommissar die Schatten seiner Vergangenheit verfolgen und erneut vor lebensbedrohende Prüfungen stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hansitante und Hansonkel zu Ehren!
***
Er geriet langsam außer Atem bei dem Tempo, das er eingeschlagen hatte. Der Krieg war seit ein paar Tagen vorbei. Er hatte sich zivile Kleidung „besorgt“. Das war nicht leicht gewesen, denn Geld hatten sie nicht mehr viel, als sie sich auf den Weg nach Hause machten. Die Wehrmacht hatte sie bis dahin mit allem Nötigen ganz ordentlich versorgt und das letzte wenige Geld hatte er für Proviant ausgegeben. Für Kleidung hatte es nicht gereicht. Es wurde empfohlen, auch die Waffen abzugeben, um als zivile Person durchzugehen. Natürlich, eine Ausweiskontrolle würde ihn sofort als ehemaligen Wehrmachtsangehörigen entlarven, aber wenn er auf keiner Fahndungsliste stand, würde man ihn weitergehen lassen.
Die Zeiten waren trotzdem gefährlich. Ehemals besetzte Gebiete waren plötzlich „Feindesland in Friedenszeiten“. Niemand scherte sich um das Kriegsende. Er hatte gehört, dass ehemalige deutsche Soldaten wie Wild gejagt wurden von aus dem Krieg zurückkehrenden tschechischen Soldaten oder ehemaligen Partisanen. Von den Einheimischen konnte man auch keine Hilfe erwarten. Es bestand nicht unbedingt Lebensgefahr von ihrer Seite, aber die Feindseligkeit war offenkundig.
Dennoch, Johann war zuversichtlich. Er war der Einzige seiner Einheit, der zurück nach Siebenbürgen wollte. Das bedeutete einerseits, sich alleine durchschlagen zu müssen. Andererseits waren seine Wege nicht so im Brennpunkt der Kontrollen und Gefährdungen. Er war hauptsächlich zu Fuß unterwegs. Es war nicht angeraten, auf tschechischem Gebiet mit dem Zug zu fahren. Die Züge wurden gezielt von den Partisanen kontrolliert und die deutschen Soldaten mitgenommen. Was mit ihnen geschah, war Gegenstand von Gerüchten. Aber auch ein Gerücht hat einen Kern Wahrheit und deshalb wollte Johann nichts riskieren. Güterzüge kamen auch nicht in Frage. Sie wurden ebenfalls, sogar zwischen den Bahnhöfen, angehalten. Diese Hatz auf deutsche Soldaten schien die Hauptbeschäftigung der ehemaligen Feinde in den ersten Tagen nach dem Kriegsende zu sein.
Er war zuletzt in Brünn stationiert gewesen. Als er zu Beginn des Krieges in seiner Heimat einberufen wurde, kam er nach einer schier endlosen Zugfahrt nach Passau. Als einfacher Soldat, ohne vorher je einen Wehrdienst abgeleistet zu haben, trotz seiner 20 Jahre. All jene, denen es ebenso ging, wurden täglich zwei Stunden auf dem Kasernenhof am Rande der Stadt an der Waffe ausgebildet und danach körperlich durch harte Übungen ertüchtigt. Nach drei Monaten galt die Grundausbildung als abgeleistet und sie wurden ihren Einheiten zugeteilt.
Johann kam an die russische Front. Hier erlebte er zum ersten Mal, wie zerfetzte Körper um ihn herumflogen und schwer verletzte Kameraden nach ihrer Mutter schrien. Er selbst, das wusste Johann, hatte in all den Kämpfen einen Schutzengel gehabt. Anders konnte er sich die Tatsache, dass er den brutalen Feldzug überlebt hatte, nicht erklären.
Mit der zurückweichenden Front landete er in Brünn. Hier war es zunächst ruhiger, da sich die Hauptfront weiter nördlich befand. Abgesehen von sporadischen Partisanenbeschüssen wurde er nicht mehr viel ins Kriegsgeschehen eingebunden. Lediglich ein paar Wochen vor der Kapitulation gerieten sie stärker unter Beschuss.
Der Weg zur slowakischen Grenze war beschwerlich. Es galt knapp 130 Kilometer zu überwinden. Er war bei guter Gesundheit und hatte sich ausgerechnet, bei bis zu 20 Kilometern am Tag sechs bis sieben Tage zu brauchen. Er wusste in etwa, dass er auch recht bergige Gegenden durchqueren musste. Sie hatten in Brünn mit Erlaubnis der Offiziere alles aus den Büros mitgenommen, was sie brauchen konnten. Johann hatte gute Landkarten gefunden, in denen auch ehemalige Stellungen der Deutschen eingetragen waren. Er wusste, diese müsste er meiden, denn sie standen bestimmt unter der Beobachtung der Partisanen.
Heute, am dritten Tag seiner Wanderung, spürte er zum ersten Mal seine Füße. Er vermied es, darüber nachzudenken. An und für sich hatte er anständige Schuhe. Knöchelhoch, wetterfest und relativ geschmeidig im Leder. Er hatte seine Armeestiefel noch in Brünn gegen diese Schuhe eingetauscht. Ein Glücksfall! Die Stiefel der Deutschen waren wegen ihrer guten Qualität gefragt. Aber er war froh, diese Schuhe bekommen zu haben. Deshalb unterdrückte er den Gedanken an die Schmerzen. Am Abend würde er sich um die Blasen kümmern.
Tagsüber war es recht warm, aber Johann zog es lieber vor zu schwitzen, als den ganzen Tag regennass zu laufen. So konnte er in den lauwarmen Nächten gut unter freiem Himmel schlafen. Sein Proviant ging langsam zu Ende, obwohl er sehr sparsam damit umgegangen war. In seinen Leinensack, den er über der Schulter trug wie ein Handwerker auf der Walz, hatte er einen Laib Brot, vier kleine Konserven gepökeltes Fleisch und zwei Feldflaschen Wasser eingepackt. Mehr hatte er nicht auftreiben können. Er hoffte, gegen Abend an einem Dorf vorbeizukommen. Irgendwie musste er Proviant besorgen. Wie, das wusste er noch nicht. Bis auf seine Zivilkleidung, ein einigermaßen passendes kurzärmliges Hemd und eine etwas zu kurze Hose, die schon ein paar Zentimeter über dem Knöchel endete, hatte er noch nie in seinem Leben vorher etwas gestohlen. Oder besser gesagt, geplündert. Mehrere aus seiner Einheit waren in ein kleines Bekleidungsgeschäft eingefallen und hatten alles mitgenommen, was ihnen passte. Leider hatte Johann nicht mehr als die zwei Teile gefunden. Deshalb hatte er die Unterwäsche seiner Uniform behalten. Er musste das Risiko in Kauf nehmen. Das langärmlige baumwollene Unterhemd und die lange Unterhose würden ihm an kühleren Tagen guttun.
Es hatte seiner Erziehung und seinem Ehrgefühl völlig entgegengestanden. Aber nur vor der Tat. Danach war er froh, es getan zu haben, und zum ersten Mal verstand er den tieferen Sinn des Spruches: Der Zweck heiligt die Mittel. Und so hatte er jetzt keine Bedenken, als er aus der Not heraus plante, etwas zum Essen zu stehlen.
Im Krieg hatte er unsägliches Leid gesehen. Es war ein Angriffsfeldzug in Russland und Johann und seine Kameraden hatten keine Wahl, als zu schießen. Er dachte nicht darüber nach, ob er jemanden traf oder nicht. Er wollte nicht bewusst jemanden töten. Er wollte, dass die andere Seite mit dem Schießen aufhörte. Angst bestimmte ihre Handlungen. Man konnte sie nur überwinden, indem man sich den Befehlen unterordnete und schoss, was das Zeug hielt. Und da war es Johann klar, dass seine Kugeln unweigerlich auch jemanden trafen.
Einmal kamen sie in ein Dorf nach tagelangen heftigen Kämpfen. Auf den Gassen, in den Höfen und in den zerstörten Häusern lagen unzählige Leichen. Bäuerinnen, Kinder. Bei den wenigen Männern handelte es sich um die paar bewaffneten Bauern, die offenbar auf Befehl der russischen Militäreinheit, die sich dann aber vorzeitig zurückgezogen hatte, bis zuletzt Widerstand geleistet hatten.
Bis hierher war es ihm gelungen, Ortschaften zu umlaufen. Heute aber musste er eine regelrecht suchen. Laut seiner Karte vermutete er ein Dorf oder zumindest ein paar Gehöfte hinter dem nächsten Hügel. Wo es ging, benutzte er natürlich ländliche Wege, die in diesen trockenen Tagen ein gutes Vorankommen zuließen. Als er aber am Vormittag die größere Ortschaft Nedakonice umlief, musste er beschwerlich über Stock und Stein laufen.
Johann ging davon aus, dass der Weg, auf dem er lief, zum Dorf führte. In den drei Tagen hatte er einmal ein Automobil von weitem gehört und sich in den Büschen am Wegesrand versteckt. Vor den Fuhrwägen der Bauern hatte er keine Angst. Er winkte freundlich im Vorbeigehen und tat so, als hätte er es nicht gehört, wenn er angesprochen wurde.
Noch bevor er den Hügel erklommen hatte, hörte er die typischen Geräusche des Dorflebens. Hunde bellten, Hähne krähten und Menschenstimmen waren stoßweise zu hören, je nachdem wie der leichte Wind wehte. Oben angekommen, wich er sofort einen halben Schritt zurück. Das Dorf war näher, als er gedacht hatte, die ersten Höfe höchstens 500 Meter entfernt. Er fürchtete, entdeckt zu werden, und duckte sich so tief, dass er gerade noch die Lage erspähen konnte. Das Dorf lag in einer Senke, von allen Seiten umgeben von Hügeln. Die Gärten vieler Höfe erstreckten sich ein Stück an den Hügeln hoch. Am Fuße der Gärten befanden sich die Scheunen und die Ställe, in denen vielleicht Schweine und die Tiere, die man über den Krieg hatte retten können, gehalten wurden. Johann merkte sich zwei, drei Höfe, die am Hang des linken Hügels lagen, der seiner Position am nächsten war. Günstig war auch, dass sich oberhalb der Gärten ein kleines Waldstück befand, in dem er sich bis in die späten Abendstunden verstecken konnte. Dann würde er sehen, ob ihm das ersehnte Glück, etwas Essbares zu finden, hold war.
„Vstávej!“ – schrie jemand und Johann schreckte auf. Er verstand etwas tschechisch, aber dieses Wort war ihm unbekannt. Der Ton aber zielte unmissverständlich darauf ab, ihn zu wecken. Als er die Augen öffnete, sah er zwei Männer, die ihr Gewehr auf ihn gerichtet hatten. Im Hintergrund unverkennbar wohl der Bauer, in dessen Scheune er es sich gemütlich gemacht hatte.
Eigentlich hatte er wieder zurück in den Wald gewollt, nachdem er sich, was er brauchte, „besorgt“ hatte. Aber draußen hatte es nach aufkommendem Regen ausgesehen und Johann hatte es als gute Fügung betrachtet, die Möglichkeit zu haben, im Trockenen zu schlafen. Außerdem erinnerte ihn das Heu, auf das er sich niedergelassen hatte, an zu Hause. An ihren Hof und an das Heu, das sie für ihre Pferde in der Scheune aufbewahrten. An die glückliche Kindheit, als sie im Spätsommer, nachdem sie den strengen Vater erfolgreich anbettelten, im Heu schlafen durften.
„Aufstehen!“ – wiederholte einer der zwei Männer auf Deutsch und fuchtelte mit seiner Waffe vor seinem Gesicht herum. Indem er mit der Waffe wiederholt eine kurze Bewegung nach oben machte, signalisierte er ihm unmissverständlich, dass er aufstehen müsse. Johann erhob sich und griff nebenbei zu seinem Beutel, in den er das Huhn, dem er den Hals umgedreht hatte, und den Brotlaib verstaut hatte. Neben einem nicht sehr gut genährten Schwein gab es keine weiteren Tiere. Die Hunde hatten laut gebellt, waren aber angekettet und so konnte sich Johann mitten in der Nacht in die Speisekammer wagen. Er hatte nicht viel genommen, weil es nicht viel zu nehmen gab, außer noch ein paar Paradeiser und Gurken.
Daraufhin hatte er sich bereit gemacht zu flüchten, falls der Bauer nach der Ursache des Gebells schauen sollte. Als in geraumer Zeit nichts geschah und die ersten Regentropfen fielen, beschloss er, in der Scheune zu schlafen. Er war sich sicher, vor Sonnenaufgang aufzuwachen. Er war das von zu Hause aus gewohnt. Mit dem Vater vor Sonnenaufgang in den Wald aufzubrechen und die Bäume zu fällen, die sie nach Schäßburg ins Sägewerk verkaufen wollten. Aber die Müdigkeit der tagelangen Wanderung hatte ihn wohl übermannt. Nun hatte er den Schlamassel!
Er spürte einen Schlag auf den Arm, der Beutel fiel zu Boden und die Männer stießen ihn unsanft mit der Waffe aus der Scheune hinaus. Draußen regnete es leicht und es war deutlich kühler als die Tage zuvor.
„Was habt ihr vor?“ – rief Johann eher überrascht als ängstlich. Es ging alles so schnell, dass noch keine Zeit da war, um Angst zu empfinden.
„Drž hubu!“ – schrie ihn der andere an und das verstand er. Die von den Deutschen rekrutierten tschechischen Hilfspolizisten hatten die gefangengenommenen Partisanen oft genug so angeschrien: „Halt’s Maul!“
Er wurde Richtung Wald gestoßen, während hinter ihm die zwei Männer unaufhörlich aufgeregt redeten. Johann hatte den Eindruck, dass es recht kontrovers zuging, aber er verstand sie nicht. Langsam kam die Angst in ihm auf, für die er bis dahin noch keine Zeit gehabt hatte. Was hatten die vor mit ihm? Worüber stritten sie? Waren sie sich wohl nicht einig darüber, ob sie ihn töten sollten? Weshalb dann nicht gleich im Dorf?
„Na klar!“ – erkannte er. Es war illegal, ihn zu töten. Gegen die Genfer Konvention. Aber die Männer machten nicht den Eindruck, als gehörten sie zum regulären tschechischen Militär. Johann tippte eher auf ehemalige Partisanen. „So ein Mist!“ – dachte er sich. „Ausgerechnet denen in die Hände zu fallen!“
Sie durchquerten das Wäldchen und gingen auf der anderen Seite des Hügels den Hang hinunter.
„Stopp!“ – schallte es von hinten. „Stehen bleiben!“ Er drehte sich um und sah die zwei Männer zum ersten Mal bewusst an. Sie waren beide älter als er selbst, aber nicht viel, vielleicht um die dreißig. Sie waren unrasiert, die Haarstoppeln hatten sich aber noch nicht zu einem Bart geformt. Die Gesichter waren rau und Johann erkannte, dass sie es im Krieg wohl nicht leicht gehabt hatten. Was er aber noch erkannte, ließ ihn zum ersten Mal erschauern. Auf dem Rücken trug der etwas Kräftigere eine … Schaufel! Zuerst dachte Johann, es sei eine weitere Waffe, denn er erkannte nicht gleich das einfache Seil, an dem sie hing.
Der Tscheche nahm die Schaufel vom Rücken und warf sie Johann vor die Füße. „Kopat!“ – schnauzte er Johann an und machte mit seinen Händen die typische Schaufelbewegung. „Ne!“ – rief Johann auf Tschechisch und machte dabei eine deutlich verneinende Handbewegung. Daraufhin richtete der Mann die Waffe auf Johanns Kopf und wiederholte auf Deutsch: „Graben!“ Johann spürte, wie ihm schwindlig wurde, aber er riss sich zusammen. Er wusste, wenn er nicht gleich anfing zu graben, würde man ihn erschießen. Der andere stand ein paar Schritte weiter, der Schaft seiner Waffe am Boden neben seinem rechten Bein, die Waffe am Lauf haltend. Er schien in dem Augenblick nicht gerade erpicht darauf, Johann zu erschießen. Er sah seinen Kameraden an, als ob er nicht genau wusste, ob der wirklich schießen würde. Johann registrierte das und ohne darüber nachzudenken, gab ihm das Hoffnung auf Aufschub. Aufschub vom Erschossenwerden, Aufschub vom Sterben. In solchen Augenblicken möchte man sein Leben um jede mögliche Sekunde verlängern, um jede Sekunde, in der sich ein Ausweg auftun könnte. Und so begann er zu graben. Zum Glück war es sehr mühsam. Der Boden war hart und ohne Spaten dauerte es seine Zeit, bis Johann in die Erde eindrang. Sein Peiniger hatte ihm die Umrisse des auszuhebenden Grabens angedeutet und Johann war sich nun sicher: Er sollte sein eigenes Grab schaufeln.
Johann hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Er wusste nicht, wie lange er schon grub, aber er musste eine Pause einlegen, denn es war anstrengend. Der Mann aber schrie ihn auf Tschechisch an und deutete an, er solle weitergraben.
Langsam bekam Johann einen einigermaßen klaren Kopf. Langsam wurde ihm bewusst, dass er sich nicht einfach so diesem Schicksal ergeben würde. Er machte sich einen einfachen Plan. Das Einzige, was in dieser Situation wohl möglich war. Denn der Zeitpunkt nahte. Der Zeitpunkt, an dem man ihn töten würde. Das Grab war fast fertig. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und seine ganze Verstellkunst:
„Hey!“ – rief er. „Ist das gut so?“ – und deutete auf die Grube. Unmerklich näherte er sich dabei ihrem Rand. Sie war ein Meter tief und so überragte er mit seinem Oberkörper den Rand. Er hielt dabei den Kopf gebeugt, so als wolle er dem Feind nicht in die Augen schauen und als habe er sich seinem Schicksal ergeben. Als er die Präsenz des Tschechen spürte, holte er mit der Schaufel aus und während er dabei hochschaute, traf er den Mann, der sich leicht hinuntergebeugt hatte, mit voller Wucht am Kopf. Der fiel grotesker Weise ins Grab, wobei die Waffe oben am Rand liegenblieb. In Sekundenschnelle stieg Johann aus der Grube und näherte sich dem verdutzten zweiten Tschechen, der wohl ursprünglich sogar mit dem Rücken zum Geschehen saß. Wumm! – traf er ihn ebenfalls voll am Kopf. Aus den Augenwinkeln erkannte er noch, wie ihm Blut aus den Ohren rann, während er umkippte. Johanns Körper war überflutet mit Adrenalin. Er dachte nicht viel nach, aber genug, um zu entscheiden, die beiden nicht zu erschießen.
Später wusste er es nicht mehr genau, ob aus der Hemmung heraus, wehrlose Menschen zu töten, oder aus Angst, man könne im Dorf die Schüsse hören. Er hatte ja keinen Überblick über die Situation und wusste nicht, wer sich im Dorf alles aufhielt. Aber er war wütend. Wütend wegen der ganzen Situation, wegen dem, was er durchmachte, nur weil er gegen seinen Willen in den Krieg ziehen musste! Weil es ihm die Umstände so unsäglich schwer machten, nach Hause zu kommen! Er griff sich eine Waffe und lief entschlossen durchs Wäldchen zurück zum Dorf. Es gab keine Alternative. Er wollte seinen Beutel mit Proviant zurückhaben. Er hatte ein Recht darauf! Er wollte nur nach Hause und auf dem Weg nicht verhungern!
Vorsichtig schlich er sich durch den Garten in Richtung Hof. Plötzlich erblickte er den Bauern! Gebückt arbeitete der gerade am zu einer Seite offenen Schweinestall. Johann lief los und mit erhöhtem Tempo erreichte er den Bauern. Der hatte ihn gehört und sah zu ihm auf. Johann hielt ihm mit rechts die Waffe vors Gesicht. Die linke Hand hielt er vor seinen Mund und deutete damit an, der Bauer solle schweigen. Dann zeigte er ihm mit der typischen Haltung, mit der man den Leinenbeutel um die Schulter trug, was er wollte. Mit der Waffe wies er zum Haus und stieß ihn in die Richtung. Der Bauer ging aber zur Speise, die sich zwischen Scheune und Haus befand. Drinnen lag der Beutel am Boden. Die Unterwäsche und die Landkarten waren noch drin, sonst aber nichts mehr. Johann sah sich um und entdeckte seine zwei Feldflaschen auf einem Regal. Daneben zwei Metallkanister voller Wasser. Er wies den Bauern per Zeichen an, seine Feldflaschen mit Wasser zu füllen. In der Zwischenzeit entdeckte er auch wieder seine letzte Dose Pökelfleisch, die er sich selbst holte. Daraufhin zeigte er auf das Huhn, das er letzte Nacht eingesteckt hatte, und den Laib Brot. Der Bauer packte die zwei Sachen in den Beutel und fiel auf die Knie. „Nestřílejte prosím!“ – flehte er Johann an. Johann verstand ihn und gab auf Deutsch zurück: „Ich erschieße dich nicht.“ Er war immer noch wütend. Er drehte die Waffe um und hieb dem Bauer mit dem Schaft auf den Schädel. Er musste es tun. Sonst würde der Bauer Alarm schlagen und das halbe Dorf würde hinter ihm her sein. Er wollte ihn nicht töten, nur ohnmächtig schlagen. Aber man wusste ja nie … Es war keine Rache. Reiner Selbsterhaltungstrieb. Johann stand immer noch unter dem Schock, fast erschossen worden zu sein. Er wollte überleben. So wie er auch im Krieg alles getan hatte, um zu überleben.
Ohne sich weiter umzudrehen, ging er hinaus und lief den Garten hoch in Richtung Wäldchen. Er hoffte, dass die zwei Partisanen nicht aufgewacht waren. Wobei auch die Möglichkeit bestand, dass sie durch die Wucht der Schläge tot waren. Johann konnte es nicht einschätzen. Nur wie im Traum erinnerte er sich an das Geschehen. Alles, woran er sich noch erinnerte, war die Todesangst und der unbändige Wille zu leben.
Im Wäldchen lief er erst ein Stück gen Osten, um das Dorf zu umgehen, und dann schlug er die südöstliche Richtung ein auf dem Weg zur Slowakei. Er hoffte, dass die zwei Tschechen, wenn sie aufwachten, der Meinung waren, er würde gen Westen gehen in Richtung Deutschland. Die Waffe hatte er vorsichtshalber noch bei sich, aber er würde sie bald, wenn er sich in Sicherheit wähnte, wegwerfen. Es war zu gefährlich, mit ihr erwischt zu werden.
***
„Köszönöm szépen Istvan!“ Johann streckte seine noch rußschwarze Hand aus und drückte die seines Gegenübers. Mehr als „Dankeschön“ konnte er nicht bieten. Aber es kam von Herzen. So ein Glück hätte er sich vorher nicht mehr erträumt. Nach der strapaziösen Wanderung ins slowakische Gebiet hatte er sich wieder unter die Menschen gewagt. Er hatte schon in Brünn gehört, dass die Slowaken den Deutschen nicht nachstellten. Deshalb hatte er die Route über die Slowakei gewählt, die im Übrigen auch die kürzeste nach Hause nach Siebenbürgen war. Er musste danach nur noch Ungarn durchqueren und dann würde er wieder sein Heimatland betreten. Die letzten 300 Kilometer würde er auch noch irgendwie zurücklegen. Darüber hatte er sich noch keine Gedanken gemacht. Die Idee, Lokomotivführer von Güterzügen anzusprechen, erwies sich als Volltreffer. Er wusste aus der Zeit seiner Stationierung in Brünn, dass es vielen Zügen an Heizern fehlte, die den Dampfkessel befeuerten. So mussten die Lokführer diese anstrengende Tätigkeit oft selbst verrichten und übersahen dabei nicht selten unterwegs Signale. Es gab deshalb schon Unfälle und sogar Entgleisungen.
In Trenčin, gleich nach der Grenze, begab er sich sofort zum Bahnhof und fragte bei den zwei Güterzügen nach, die dort gerade hielten, wer in Richtung Ungarn fuhr. „Magyarország“ sagte er auf Ungarisch in der Hoffnung, dass ihn der Slowake auf dem Führerstand des ersten Güterzugs verstand. Die ungarische Bezeichnung für „Ungarn“ war in den Nachbarländern bekannt. In Siebenbürgen sowieso. Dort lebte auch eine zahlenmäßig große ungarische Minderheit, die sich in der österreichungarischen Zeit angesiedelt hatte. Es war nicht ungewöhnlich, dass Siebenbürger Sachsen einigermaßen ungarisch sprachen und umgekehrt.
Wie erstaunt war Johann, als er hörte: „Ön magyar?“ – „Bist du Ungar?“
„Nem, de tudok egy kicsit magyarul.“ – “Nein, aber ich kann ein wenig Ungarisch.“
In diesen Zeiten freute man sich, wenn man Landsleute traf. Der Krieg hatte gleichgesinnte Menschen in ihrem Leid zusammengeschweißt. Istvan war Ungar und als Lokführer bereits im Krieg sehr gefragt gewesen. Jetzt, kurze Zeit nach dessen Ende, fuhr er für die slowakische Eisenbahn. Der Grund waren die Russen. Sie kontrollierten die Verwaltung in Ungarn und Istvan befand sich gerade in der Slowakei, als er von Übergriffen der russischen Soldaten hörte. So beschloss er, vorerst nicht zurückzukehren. Er kam aus der Gegend von Györ.
„Du willst also über Ungarn nach Siebenbürgen?“ – fragte Istvan und beobachtete Johann mit einem prüfenden Blick.
„Ja“, antwortete Johann. „Ich will endlich nach Hause.“
„Hast du noch nicht von dem Treiben der Russen gehört?“
„Nein, was für ein Treiben?“
„Sie verschleppen alle Deutschen – auch die Siebenbürger Sachsen – nach Russland. Sibirien, sagt man. Zum Wiederaufbau.“
Johann sah ihn verblüfft an. Das musste er erst einmal verdauen.
„Bist du dir da sicher?“ – fragte er in der Hoffnung, dass die Information doch nicht stimmte.
„Du kannst hier jeden fragen. Jeder weiß es. Es gibt etliche Siebenbürger, die aus diesem Grund zurück nach Westen gehen.“
Johann fühlte sich wie erschlagen. Die ganzen Strapazen! Das ganze Leid! Fast wäre er in der Tschechei während seiner Rückkehr erschossen worden! Das alles hatte er nur überstanden, weil er sich auf zu Hause gefreut hatte! Und jetzt erschien ihm die Heimat so fern. Ferner als sie es ohnehin schon war.
„Was soll ich nur in diesem fremden Land hier machen? Vielleicht sollte ich es doch nach Hause riskieren?“ Unsicher blickte er aus dem Führerstand des Lokführers in die Ferne …
„Da musst du dich entscheiden. Und zwar bald. Denn ich könnte dich hier auf meiner Lok gut gebrauchen.“
„Fährst du denn in Richtung Ungarn?“ – fragte Johann erstaunt.
„Nein, ich fahre nach Österreich, nach Wien. Hab 15 Waggons Holz geladen und zehn Kohle. In einer Stunde geht es los.“
„Was soll ich in Wien?“ – fragte Johann unentschlossen. Es klang auch Verzweiflung durch. Innerhalb kürzester Zeit musste er entscheiden, wie sein Leben weitergehen sollte. Klar, er konnte einfach losgehen und sich in Trenčin nach etwas anderem umschauen. Aber er hatte nichts. Kein Geld, keine Sprachkenntnisse. Wie sollte er sich durchschlagen in diesem fremden Land? Er könnte sich ja vorerst in Ungarn aufhalten. Aber nach Istvans Aussage waren die Russen dort auch zugange.
„Dort, in Österreich, sprechen die Leute wenigstens deutsch“, antwortete Istvan. „Ich werde auch dort bleiben, obwohl ich nicht gut Deutsch spreche.“ Er lächelte Johann an und hielt ihm 10 Reichsmark hin. „Du gehst jetzt in den Laden gegenüber dem Bahnhofseingang und kaufst Proviant für uns Zwei. Einverstanden?“
Johann nickte noch ganz verwirrt und stieg aus dem Führerstand aus.
„Und erzähl keinem von unseren Plänen, hörst du?!“
Auf der Fahrt erklärte ihm Istvan, dass er ihn nicht direkt bis Wien mitnehmen könne. Bereits vorher, mehrmals ab dem Schwechater Flughafen, würde man den Güterzug gründlich kontrollieren. Kritisch seien auch Bratislava, wo sie aber mit etwas Glück nicht einmal halten müssten, und die Grenze zu Österreich. Aber sie hatten ihn als Lokführer nie überprüft und so hoffe er, dass sie es mit dem Heizer auch nicht tun würden.
Glücklicherweise ging alles gut und kurz nach der Grenze hielt Istvan irgendwo zwischen Hainburg an der Donau und Bad Deutsch-Altenburg seinen Güterzug an. Johann schwang seinen Leinenbeutel über die Schulter und stieg aus. Ohne das übliche Pfeifsignal fuhr der Zug los und Istvan winkte vom Führerstand aus zurück.
* Sieben Jahre später *
„Herr Maurer, kann ich Sie mal sprechen, bitte?“ Johann blickte auf. Er hatte die zwei Männer kommen sehen und ahnte schon, weshalb sie da waren. Aber dass sie ausgerechnet ihn sprechen wollten, überraschte ihn dann doch. Es hatte einen Todesfall auf der Baustelle gegeben. Ein Mann war von einer eigentlich gesicherten Stelle über das bereits hüfthohe Mauerwerk im zweiten Stock hinabgestürzt und hatte sich das Genick gebrochen.
„Ich bin Kriminalkommissar Chefinspektor Baumgartner und das ist mein Kollege, Inspektor Koller.“
„Womit kann ich dienen?“ – fragte Johann und seine Überraschung ließ ihn zaghaft wirken. Zumindest auf Baumgartner, denn der fragte herausfordernd: „Weshalb so ängstlich, Herr Maurer? Haben Sie etwas zu verbergen?“ Solch eine Fragetechnik war für den Kommissar schon längst Routine. Er setzte sie, ohne zu überlegen, aus reinem Bauchgefühl ein.
Johann richtete sich auf. Er ließ von dem Eisenende ab, das aus dem getrockneten Beton hervorragte, und warf beide Handschuhe auf den Boden. Diese Frage verunsicherte ihn nicht. Im Gegenteil, sie forderte geradezu seinen Widerspruch heraus. „Ich habe nichts zu verbergen, Herr Kommissar. Was möchten sie wissen?“ – gab er jetzt selbstbewusst zurück.
„Haben Sie den Vorfall heute Morgen beobachtet?“
„Sie meinen den Unfall des Kollegen aus der Maurertruppe?“ Johann fiel auf, dass der Kommissar „Vorfall“ sagte und nannte es deshalb bewusst einen „Unfall“. Aber nur aus Widerspruchsgeist. Denn der Kommissar war ihm unsympathisch. „Nein, ich konnte den Unfall nicht beobachten. Ich habe seit 7 Uhr hier gearbeitet und der Unfall hat sich auf der anderen Seite der Baustelle ereignet.“
„Hat Sie jemand hier arbeiten sehen?“ Dieses Mal kam die Frage des Kommissars ohne irgendeinen Hinterton.
Johann dachte sich natürlich sofort, weshalb er das gefragt wurde, aber er antwortete ebenfalls ruhig: „Ja, mein Capo. Wir haben den Tagesplan besprochen und dann ist er weitergegangen.“
„Und Sie haben Ihren Platz nicht verlassen? Sind nicht unter ihresgleichen, den Maurern, gegangen?“ Mit einem süffisanten Lächeln wandte sich Baumgartner halb zu seinem Kollegen und sah dann Johann mit einem Grinsen im Gesicht an.