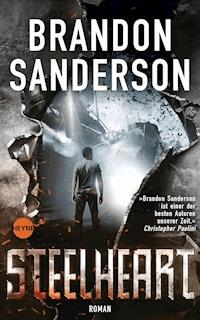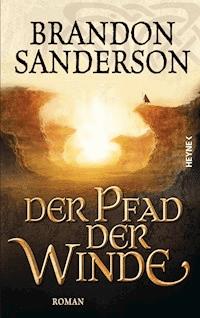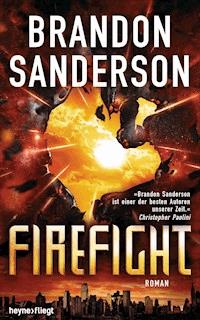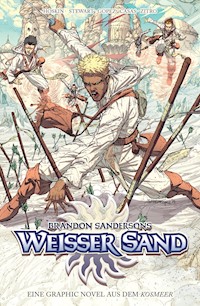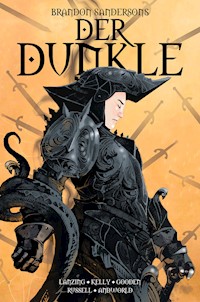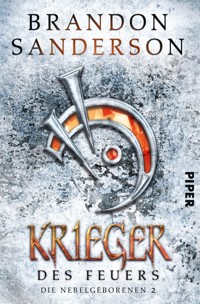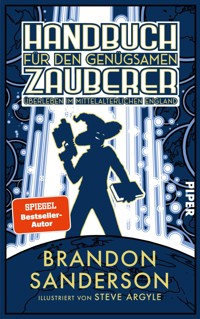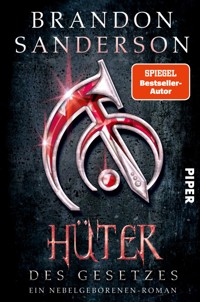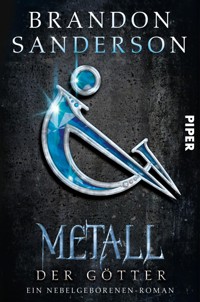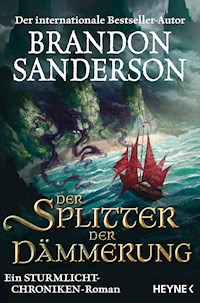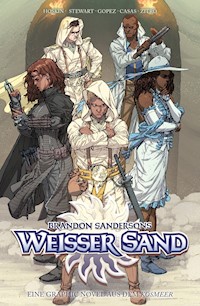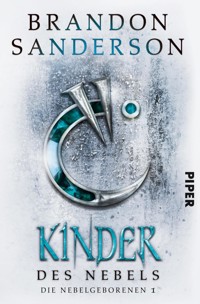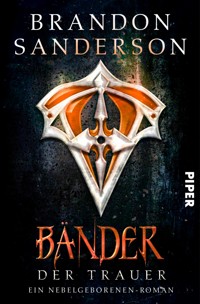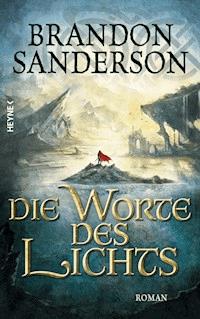13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Sturmlicht-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Episch, packend, bildgewaltig – die große Fortsetzung der Sturmlicht-Chroniken
Man nennt sie die Splitterklingen – gewaltige Schwerter, deren magische Kraft jedes Material durchtrennt und die ihren Trägern übermenschliche Stärke verleiht. Doch wer genau hinhört, kann im Flüstern der Klingen das Geheimnis einer ganzen Welt entdecken …
Die Völker von Roschar stehen vor der größten Bedrohung seit vielen Tausend Jahren. Eine neue Wüstwerdung droht, die völlige Zerstörung des ganzen Kontinents durch einen gewaltigen magischen Sturm. Hervorgerufen wurde dieser Sturm durch die Parschendi, eines der Völker, das bislang von allen anderen unterdrückt und versklavt wurde. Nun sind sie erwacht und trachten danach, ihre Ketten abzuwerfen. Sie sammeln sich bereits zu einer großen Streitmacht, um im Gefolge des Sturms ganz Roschar mit Krieg zu überziehen und Rache für ihr jahrtausendelanges Leid zu suchen. Einzig Kaladin, der Sturmgesegnete, und seine Getreuen können sich den Bringern der Leere entgegenstellen. Mit ihren neuentdeckten Kräften haben sie die sagenumwobenen Ritterorden neu gegründet, und neue Hoffnung keimt in den Herzen der Menschen auf. Doch je mehr Kaladin über die Parschendi erfährt, umso größer sind seine Zweifel. Welches Volk kann von sich behaupten, der wahren Gerechtigkeit zu dienen – und wer steckt wirklich hinter dem Bösen, das ganz Roschar zu überschatten droht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1198
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die Völker von Roschar stehen vor der größten Bedrohung seit vielen Tausend Jahren. Eine neue Wüstwerdung droht, die völlige Zerstörung des ganzen Kontinents durch einen gewaltigen magischen Sturm. Hervorgerufen wurde dieser Sturm durch die Parschendi, eines der Völker, das bislang von allen anderen unterdrückt und versklavt wurde. Nun sind sie erwacht und trachten danach, ihre Ketten abzuwerfen. Sie sammeln sich bereits zu einer großen Streitmacht, um im Gefolge des Sturms ganz Roschar mit Krieg zu überziehen und Rache für ihr jahrtausendelanges Leid zu suchen. Einzig Kaladin, der Sturmgesegnete, und seine Getreuen können sich den Bringern der Leere entgegenstellen. Mit ihren neu entdeckten Kräften haben sie die sagenumwobenen Ritterorden neu gegründet, und neue Hoffnung keimt in den Herzen der Menschen auf. Doch je mehr Kaladin über die Parschendi erfährt, umso größer sind seine Zweifel. Welches Volk kann von sich behaupten, der wahren Gerechtigkeit zu dienen – und wer steckt wirklich hinter dem Bösen, das ganz Roschar zu überschatten droht?
Der Autor
Brandon Sanderson, 1975 in Nebraska geboren, schreibt seit seiner Schulzeit fantastische Geschichten. Er studierte Englische Literatur und unterrichtet Kreatives Schreiben. Sein Debütroman »Elantris« avancierte in Amerika auf Anhieb zum Bestseller. Seit seiner Steelheart-Trilogie und den epischen Sturmlicht-Chroniken ist Brandon Sanderson auch in Deutschland einer der großen Stars der Fantasy. Brandon Sanderson lebt mit seiner Familie in Provo, Utah.
Die Sturmlicht-Chroniken
FÜNFTER ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Michael Siefener
Die Originalausgabe ist unter dem Titel
Oathbringer – Book Three of The Stormlight Archive (Part I)
bei Tor/Tom Doherty Associates, LLC, New York, erschienen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Dragonsteel Entertainment, LLC
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Joern Rauser
Illustrationen und Karten: Dan dos Santos, Ben McSweeney, Miranda Meeks, Kelley Harris, Isaac Stewart, Howard Lyon
Umschlagillustration: Federico Musetti
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-17517-7 V004
twitter.com/heynefantasysf
Für Alan Layton,
der Dalinar (und mich) bejubelt hat,
bevor das Sturmlicht überhaupt existierte
VORWORT UND DANKSAGUNG
Willkommen bei »Oathbringer«, zu Deutsch »Der Ruf der Klingen« und »Die Splitter der Macht«! Es hat lange gedauert, dieses Buch zu schreiben. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Geduld. Die Sturmlicht-Chroniken sind ein gewaltiges Unternehmen – was Sie auch an der langen Dankesliste von Personen weiter unten ablesen können.
Falls Sie nicht die Möglichkeit hatten, »Edgedancer« zu lesen – eine einzelne Sturmlicht-Erzählung, die zwischen dem zweiten und dem dritten Buch angesiedelt ist –, möchte ich sie Ihnen hiermit empfehlen. Sie ist entweder als Einzelveröffentlichung oder in dem Sammelband »Arcanum Unbounded« zu finden, in dem Novellen und Geschichten aus dem ganzen Kosmeer versammelt sind (das ist das Universum, in dem diese Reihe sowie die Nebelgeborenen-Saga, »Elantris«, »Sturmklänge« und andere Bücher spielen).
Nichtsdestotrotz ist jede Reihe so geschrieben, dass sie eigenständig gelesen und genossen werden kann, ohne dass man die anderen Reihen oder Bücher kennen muss. Wenn es Sie interessiert, können Sie eine längere Erklärung auf brandonsanderson.com/cosmere finden.
Und nun zur Parade der Namen! Wie ich schon oft gesagt habe, steht zwar mein Name auf dem Umschlag, aber es gibt unzählige Personen, die dabei geholfen haben, diese Bücher zu Ihnen zu bringen. Sie haben meinen – und Ihren – herzlichsten Dank verdient, weil sie während der drei Jahre, die ich an diesem Roman geschrieben habe, unermüdlich daran mitgearbeitet haben.
Mein Hauptagent für diese Bücher (und alles andere) ist der wunderbare Joshua Bilmes von JABberwocky. Andere Mitarbeiter der Agentur, die sich ebenfalls damit beschäftigt haben, waren Brady McReynolds, Krystyna Lopez und Rebecca Eskildsen. Ein besonderer Dank geht an John Berlyne, meinen Agenten von Zeno in England, zusammen mit all den Subagenten, die auf der ganzen Welt für uns arbeiten.
Mein Lektor bei Tor war für dieses Projekt der wie immer brillante Moshe Feder. Besonderer Dank gebührt Tom Doherty, der schon seit Jahren an das Sturmlicht-Projekt glaubt, und an Devi Pillai, die während der Entstehung des Romans wesentliche Hilfe bei Lektorat und Veröffentlichung geleistet hat.
Weitere hilfreiche Personen bei Tor waren Robert Davis, Melissa Singer, Rachel Bass und Patty Garcia. Karl Gold war unser Herstellungsleiter und Nathan Weaver der Projektleiter, während Meryl Gross und Rafal Gibek für die Produktion verantwortlich waren. Irene Gallo war die künstlerische Leiterin, Michael Whelan hat den (Original-)Umschlag entworfen, von Greg Collins stammen die Innenillustrationen, und Carly Sommerstein war die Korrektorin.
Bei meinem englischen Verleger Gollancz/Orion geht ein Dank an Gillian Redfearn, Stevie Finegan und Charlotte Clay.
Der Redakteur des Buches war Terry McGarry, der schon bei vielen meiner Romane ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Das E-Book wurde von Victoria Wallis und Caitlin Buckley bei Macmillan betreut.
Viele Leute aus meiner eigenen Firma haben lange an der Produktion gearbeitet. Ein Sturmlicht-Roman ist jedes Mal ein entscheidendes und einschneidendes Ereignis hier bei Dragonsteel, darum sollten Sie dem ganzen Team zujubeln (oder, in Peters Fall, ihm ein großes Stück Käse geben), falls Sie ihnen einmal begegnen. Unsere Managerin und Geschäftsführerin ist meine wunderbare Frau Emily Sanderson. Der Vizepräsident und Redaktionsleiter ist der stets so beharrliche Peter Ahlstrom. Künstlerischer Leiter ist Isaac Stewart.
Unsere Versandleiterin (und damit diejenige, die all Ihre signierten Bücher und T-Shirts verschickt, wenn sie über den brandonsanderson.com-Store bestellt wurden) ist Kara Stewart. Karen Ahlstrom ist für unser Continuity-Wiki verantwortlich. Mein persönlicher Assistent und Marketing-Direktor ist Adam Horne. Emilys Assistentin ist Kathleen Dorsey Sanderson, und Emily »Mem« Grange ist die Aushilfe.
Das Hörbuch wurde von meinen bevorzugten Sprechern Michael Kramer und Kate Reading eingelesen. Vielen Dank, ihr beiden, dafür, dass ihr Zeit dafür gefunden habt!
»Der Ruf der Klingen« und »Die Splitter der Macht« führen die Tradition fort, das Sturmlicht-Archiv mit wunderbarer Kunst zu füllen. Wieder haben wir eine fantastische Umschlagillustration von Michael Whelan, dessen Detailgenauigkeit uns ein erstaunlich konkretes Bild von Jasnah Kholin schenkt. Es gefällt mir, dass sie einen Platz zum Leuchten auf diesem Umschlag hat, und ich bin dankbar und fühle mich geehrt, dass Michael sich so viel Zeit außerhalb von seiner Galeriearbeit nimmt, um die Welt von Roschar zu malen.
Es bedarf etlicher Künstler, um die verschiedenen Stile zu erschaffen, die in den Ephemera einer anderen Welt gefunden werden, und diesmal haben wir sogar mit noch mehr Künstlern gearbeitet als je zuvor. Dan dos Santos und Howard Lyon sind für die Gemälde von den Herolden auf dem Vorsatzpapier verantwortlich. Ich wollte, dass ihr Stil die klassischen Gemälde der Renaissance und der späteren Romantik nachahmt, und sowohl Dan als auch Howard haben unsere Erwartungen übertroffen. Diese Bilder sind nicht nur große Buchillustrationen, sondern erstaunliche Kunstwerke, die einen Platz in jeder Galerie verdient haben.
Ich sollte noch anfügen, dass Dan und Howard ihr Talent auch auf die Innengestaltung verwendet haben, wofür ich sehr dankbar bin. Dans Modebilder sind so gut, dass sie ebenso den Umschlag hätten zieren können, und Howards Vignetten für einige Kapitel hoffe ich in den folgenden Bänden wiederzusehen.
Ben McSweeney hat sich ein weiteres Mal zu uns gesellt und neun Zeichnungen aus Schallans Skizzenblock beigesteuert. Obwohl er vom einen Ende des Landes zum anderen umgezogen ist, einen anstrengenden Beruf hat und sich um die Bedürfnisse seiner wachsenden Familie kümmern muss, hat Ben dennoch überragende Illustrationen abgeliefert. Er ist ein großer Künstler und ein wunderbarer Mensch.
Weiterhin haben Miranda Meeks und Kelley Harris ganzseitige Illustrationen für diesen Band angefertigt. Beide haben schon früher großartige Arbeit für uns geleistet, und ich bin mir sicher, dass Sie sie genauso lieben werden wie ich.
Außerdem hat uns eine Vielzahl von großartigen Menschen hinter der Bühne als Berater geholfen oder andere Elemente der Kunst in diesem Buch ermöglicht: die David Rumsey Map Collection, Brent von Woodsounds Flutes, Angie und Michelle von Two Tone Press, Emily Dunlay, David und Doris Stewart, Shari Lyon, Payden McRoberts und Greg Davidson.
Meine Schreibgruppe zu »Oathbringer« (sie lesen jede Woche Einsendungen, die fünf- bis achtmal so umfangreich wie gewöhnliche Texte sind) bestand aus Karen Ahlstrom, Peter Ahlstrom, Emily Sanderson, Eric James Stone, Darci Stone, Ben Olsen, Kaylynn Zo-Bell, Kathleen Dorsey Sanderson, Alan »Leyten von Brücke Vier« Layton, Ethan »Narb von Brücke Vier« Skarstedt und außerdem Ben »Steckt mich nicht in Brücke Vier« Olsen.
Ein besonderer Dank geht an Chris »Jon« King für seine Rückmeldungen zu einigen besonders kniffligen Szenen um Teft, Will Hoyum für seinen Rat zur Querschnittslähmung und Mi’chelle Walker für ihren besonderen Rat zu jenen Szenen, in denen es um Fragen der geistigen Gesundheit geht.
Beta-Leser waren (tief Luft holen) Aaron Biggs, Aaron Ford, Adam Hussey, Austin Hussey, Alice Arneson, Alyx Hoge, Aubree Pham, Bao Pham, Becca Horn Reppert, Bob Kluttz, Brandon Cole, Darci Cole, Brian T. Hill, Chris »Jon« King, Chris Kluwe, Cory Aitchison, David Behrens, Deana Covel Whitney, Eric Lake, Gary Singer, Ian McNatt, Jessica Ashcraft, Joel Phillips, Jory Phillips, Josh Walker, Mi’chelle Walker, Kalyani Poluri, Rahul Pantula, Kellyn Neumann, Kristina Kugler, Lyndsey »Lyn« Luther, Mark Lindberg, Marnie Peterson, Matt Wiens, Megan Kanne, Nathan »Natam« Goodrich, Nikki Ramsay, Paige Vest, Paul Christopher, Randy MacKay, Ravi Persaud, Richard Fife, Ross Newberry, Ryan »Drehy« Dreher Scott, Sarah »Saphy« Hansen, Sarah Fletcher, Shivam Bhatt, Steve Godecke, Ted Herman, Trae Cooper und William Juan.
Unsere Kommentarkoordinatoren für die Beta-Leser waren Kristina Kugler und Kellyn Neumann.
Unsere Gamma-Leser waren viele der Beta-Leser und zusätzlich: Benjamin R. Black, Chris »Gunner« McGrath, Christi Jacobsen, Corbett Rubert, Richard Rubert, Dr. Daniel Strange, David Han-Ting Chow, Donald Mustard III, Eric Warrington, Jared Gerlach, Jareth Greef, Yesse Y. Horne, Joshua Combs, Justin Koford, Kendra Wilson, Kerry Morgan, Lindsey Andrus, Lingting Xu, Loggins Merrill, Marci Stringham, Matt Hatch, Scott Escujuri, Stephen Stinnett und Tyson Thorpe.
Wie Sie sehen können, ist ein Buch wie das vorliegende ein gewaltiges Unternehmen. Ohne die Bemühungen dieser vielen Menschen würden Sie ein ganz ganz anderes Buch in den Händen halten.
Wie immer geht mein letzter Dank an meine Familie: an Emily Sanderson, Joel Sanderson, Dallin Sanderson und Oliver Sanderson. Sie ertragen einen Ehemann/Vater, der sich oft in einer anderen Welt befindet und über Großstürme und Strahlende Ritter nachdenkt.
Schließlich danke ich aber auch Ihnen allen für Ihre Unterstützung dieser Bücher! Sie kommen nicht immer so schnell aus mir heraus, wie ich es mir wünschte. Das liegt teilweise daran, dass ich sie so vollkommen haben möchte, wie es irgend möglich ist. Sie halten einen Band in Ihren Händen, den ich fast zwei Jahrzehnte lang vorbereitet, skizziert, auf- und umgeschrieben habe. Genießen Sie Ihre Zeit in Roschar.
Reise vor Ziel.
INHALT
Prolog: Weinen
ERSTER TEIL: Vereinigt
Zwischenspiele
ZWEITER TEIL: Der Gesang neuer Anfänge
Zwischenspiele
Ars Arcanum
ILLUSTRATIONEN
Anmerkung:Viele Illustrationen einschließlich der Beschriftungen enthalten Hinweise auf Ereignisse, die zuvor im Text beschrieben wurden. Wenn Sie die Bilder vor dem Lesen betrachten, geschieht das auf Ihr eigenes Risiko.
Karte von Roschar
Karte der Standorte der Eidtore
Karte von Alethkar
Schallans Skizzenbuch: Der Turm
Schallans Skizzenbuch: Korridor
Schallans Skizzenbuch: Pferde
Schallans Skizzenbuch: Sprengsel in der Mauer
Schallans Skizzenbuch: Urithiru
Blatt: Die Vorin-Havah
Navanis Notizbuch: Schiffstypen
Alethi-Glyphen, Seite 1
SECHS JAHRE ZUVOR
Immer wieder hatte Eschonai ihrer Schwester berichtet, etwas Wunderbares befinde sich hinter dem nächsten Hügel. Dann hatte sie eines Tages einen Hügel erklettert und Menschen gefunden.
Die Menschen hatte sie sich immer als dunkle, gestaltlose Ungeheuer vorgestellt, so wie sie in den Liedern beschrieben wurden. Stattdessen waren es jedoch wundervolle, bizarre Kreaturen, die in keinem erkennbaren Rhythmus sprachen. Ihre Kleidung war zwar farbenprächtiger als ein Panzer, aber eigene Rüstungen wuchsen ihnen nicht. Sie hatten so große Angst vor den Stürmen, dass sie sich sogar auf der Reise im Innern von Wagen versteckten.
Das Bemerkenswerteste an ihnen war allerdings, dass sie nur eine einzige Form besaßen.
Zuerst hatte sie angenommen, dass die Menschen ihre anderen Formen vergessen haben mussten, so wie es früher bei den Lauschern der Fall gewesen war. Dies schuf sofort ein Band zwischen ihnen.
Nun, mehr als ein Jahr später, summte Eschonai zum Rhythmus der Ehrfurcht, während sie dabei half, Trommeln aus dem Karren zu laden. Sie waren weit gereist, weil sie das Heimatland der Menschen hatten sehen wollen, und mit jedem Schritt hatte ihre Überwältigung zugenommen. Diese Erfahrung fand hier ihren Höhepunkt in dieser unglaublichen Stadt Kholinar und ihrem prachtvollen Palast.
Die höhlenartige Entladestation an der Westseite des Palastes hatte so gewaltige Ausmaße, dass hier zweihundert Lauscher nach ihrer Ankunft Platz gefunden und den Raum dabei nicht einmal annähernd ausgefüllt hatten. Die meisten Lauscher konnten nicht an dem Fest im Palast teilnehmen – an der Unterzeichnung und Beglaubigung des Vertrages zwischen den beiden Völkern. Aber die Alethi hatten dafür gesorgt, dass auch sie Erfrischungen erhielten, und wahre Berge an Speisen und Getränken waren für die Gruppe hier unten bereitgestellt worden.
Sie kletterte von dem Karren, sah sich auf der Entladestation um und summte im Rhythmus der Erregung. Als sie Venli gesagt hatte, dass sie entschlossen war, die ganze Welt zu kartografieren, hatte sie dabei an die Vermessung der Natur gedacht, an Täler und Berge, an Wälder und Laits, in denen es vor Leben wimmelte. Und dabei hatte sich die ganze Zeit hindurch dies alles hier draußen befunden. Es hatte nur knapp außerhalb ihrer Reichweite auf sie gewartet.
Zusammen mit weiteren Lauschern.
Als Eschonai den Menschen zum ersten Mal begegnet war, hatte sie auch die kleinen Lauscher in ihrer Begleitung gesehen. Es war ein unglückseliger Stamm, der in der Fadform gefangen war. Damals hatte Eschonai noch angenommen, dass sich die Menschen um solche armen Seelen ohne Lieder kümmerten.
Oh, wie unschuldig diese ersten Begegnungen doch gewesen waren.
Die gefangenen Lauscher bildeten nicht nur irgendeinen kleinen Stamm, sondern sie waren die Abgesandten einer gewaltigen Population gewesen. Und die Menschen kümmerten sich nicht um sie.
Sie gehörten zum Eigentum der Menschen.
Eine Gruppe dieser Parscher, wie sie genannt wurden, drängte sich um den äußeren Ring von Eschonais Arbeitern.
»Sie versuchen zu helfen«, sagte Gitgeth im Rhythmus der Neugier. Er schüttelte den Kopf, und in seinem Bart glitzerten die Rubine auf, die zu den hervorstechenden roten Färbungen seiner Haut passten. »Die kleinen Rhythmuslosen wollen in unserer Nähe sein. Ich sage dir, sie spüren, dass etwas mit ihren Köpfen nicht stimmt.«
Eschonai gab ihm eine Trommel aus dem hinteren Teil des Karrens und summte selbst im Rhythmus der Neugier. Sie hüpfte herunter und näherte sich der Parscher-Gruppe.
»Ihr werdet hier nicht gebraucht«, sagte sie im Rhythmus des Friedens und spreizte die Hände. »Wir kümmern uns lieber selbst um unsere Trommeln.«
Die Wesen ohne Lieder sahen sie mit matten Augen an.
»Geht jetzt«, sagte sie im Rhythmus des Bittens und zeigte auf die Festlichkeiten, die nicht fern von ihnen stattfanden, wo Lauscher und menschliche Diener trotz der Sprachbarriere miteinander lachten. Die Menschen klatschten, während die Lauscher all die alten Lieder sangen. »Amüsiert euch.«
Einige schauten dort hinüber – wo gesungen wurde – und hielten die Köpfe schräg, aber sie bewegten sich nicht.
»Es wirkt nicht«, sagte Brianlia im Rhythmus des Zweifelns und legte den Arm auf eine Trommel neben sich. »Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie es ist, wenn man lebt. Sie sind Eigentum, das gekauft und wieder verkauft wird.«
Was sollte sie davon halten? Sklaven? Klade, einer der Fünf, war zu den Sklavenhändlern in Kholinar gegangen und hatte dort eine Person erworben, weil er herausfinden wollte, ob so etwas tatsächlich möglich war. Er hatte nicht einmal einen Parscher gekauft, denn es waren auch Alethi angeboten worden. Anscheinend waren die Parscher teuer und wurden als Sklaven von höchster Qualität betrachtet. Dies war den Lauschern gesagt worden, als hätten sie darauf stolz sein können.
Sie summte im Rhythmus der Neugier, deutete mit dem Kopf zur Seite und sah zu den anderen hinüber. Gitgeth lächelte, summte im Rhythmus des Friedens und winkte sie davon. Alle waren daran gewöhnt, dass Eschonai mitten in der Arbeit davonschlenderte. Es war keineswegs so, dass sie unverlässlich war … na ja, vielleicht war sie es doch, aber wenigstens war sie konsequent.
Aber schon bald würde sie auf dem Fest des Königs gebraucht werden. Sie war eine der Besten, wenn es darum ging, die fade Sprache der Menschen zu verstehen und zu sprechen; dafür besaß sie eine natürliche Gabe. Das war ein Vorteil, der ihr zu einem Platz in dieser Expedition verholfen hatte, aber es war auch ein Hindernis. Ihre Beherrschung der menschlichen Sprache machte sie zu einer wichtigen Person, und wichtigen Personen konnte nicht erlaubt werden, dem Horizont nachzujagen.
Sie verließ die Entladestation und ging die Treppe zum Palast hinauf. Dabei versuchte sie, all das Schmuckwerk, die Kunstfertigkeit und die schiere, überwältigende Großartigkeit des Gebäudes in sich aufzunehmen. Es war zugleich wunderschön und schrecklich. Personen, die gekauft und verkauft wurden, sorgten für den Unterhalt dieses Ortes – aber war das der Grund dafür, dass die Menschen solche großartigen Werke wie die Schnitzwerke an den Säulen neben ihr oder die Einlegearbeiten im Marmorboden erschaffen konnten?
Sie ging an Soldaten vorbei, die ihre künstlichen Panzer trugen. Gegenwärtig besaß Eschonai keine eigene Rüstung; statt der Kriegerform trug sie die Arbeitsform, denn sie schätzte deren Biegsamkeit.
Die Menschen hatten keine Wahl. Sie hatten ihre Formen nämlich gar nicht verloren, wie Eschonai zunächst vermutet hatte – sie besaßen nur eine einzige. Sie steckten für immer und ewig in Paarungsform, Arbeitsform und Kriegerform gleichzeitig fest. Und sie trugen ihre Gefühle viel deutlicher auf den Gesichtern als die Lauscher. Oh, Eschonais Volk konnte auch lächeln, lachen und weinen. Aber nicht so wie diese Alethi.
Der untere Bereich des Palastes war von breiten Korridoren und Galerien durchzogen, die von sorgfältig geschliffenen Juwelen erhellt wurden, durch die das Licht glitzerte und gleißte. Leuchter hingen wie gebrochene Sonnen über ihr, die ihr Licht überallhin versprühten. Vielleicht war das schlichte Erscheinungsbild der menschlichen Körper – mit ihrer farblosen Haut, die höchst unterschiedliche Brauntönungen aufwies – ein weiterer Grund dafür, dass sich die Menschen bemühten, alles zu verzieren, von ihrer Kleidung bis hin zu diesen Säulen.
Könnten wir das auch tun?, dachte sie und summte im Rhythmus der Anerkennung. Wenn wir die richtige Form zur Erschaffung von Kunst kennen würden?
Die oberen Stockwerke des Palastes glichen Tunneln: schmale Steinkorridore und Räume, die Bunkern in einer Bergflanke ähnelten. Sie begab sich zur Festhalle, weil sie nachsehen wollte, ob sie gebraucht wurde, doch hier und da blieb sie stehen und warf einen Blick in die abzweigenden Räume. Man hatte ihr gesagt, dass sie nach Belieben herumspazieren durfte und ihr der ganze Palast offenstand – mit Ausnahme der Räume, vor deren Türen Wachen postiert waren.
Sie kam an einem Zimmer vorbei, in dem an allen Wänden Gemälde hingen, dann an einem mit einem Bett und weiteren Möbelstücken. Eine andere Tür enthüllte eine Toilette mit fließendem Wasser – ein Wunder, das sie noch immer nicht ganz verstand.
Sie steckte den Kopf in ein Dutzend weiterer Räume. Solange sie das königliche Fest rechtzeitig zur Musik erreichte, würden sich Klade und die anderen der Fünf nicht beschweren. Sie waren mit Eschonais Angewohnheiten ebenso vertraut wie jeder andere. Sie schweifte stets durch die Gegend, steckte den Kopf in Dinge, die sie nichts angingen, spähte durch Türen …
Und fand den König?
Eschonai erstarrte und öffnete die Tür vor ihr einen Spaltbreit. Nun sah sie ein üppig ausgestattetes Zimmer mit einem dicken roten Teppich und Bücherregalen an den Wänden. So viele Informationen lagen hier unbeachtet herum! Doch noch überraschender war der Umstand, dass König Gavilar in diesem Zimmer stand, umgeben von fünf anderen Personen: zwei Offizieren, zwei Frauen in langen Kleidern und einem alten Mann in einer Robe. Der König zeigte mit der Hand auf etwas, das auf einem Tisch lag.
Warum befand sich Gavilar nicht auf dem Fest? Warum standen keine Wachen vor der Tür? Eschonai stimmte sich auf den Rhythmus der Angst ein und zog sich zurück, doch zuvor sah sie noch, wie eine der Frauen Gavilar anstieß und in Eschonais Richtung deutete. In ihrem Kopf klopfte es vor Entsetzen, und sie zog die Tür zu.
Einen Augenblick später trat ein großer Mann in Uniform heraus. »Der König möchte dich sprechen, Parschendi.«
Sie täuschte Verwirrung vor. »Herr? Worte?«
»Sei nicht so scheu«, sagte der Soldat. »Du gehörst zu den Übersetzern. Komm herein. Du steckst nicht in Schwierigkeiten.«
Von Angst geschüttelt ließ sie zu, dass er sie in das Zimmer führte.
»Danke, Meridas«, sagte Gavilar. »Lasst uns für einen Augenblick allein.«
Die anderen gingen, während sich Eschonai bei der Tür in den Rhythmus des Trostes einstimmte und diesen laut summte – auch wenn die Menschen nicht verstehen mochten, was es bedeutete.
»Eschonai«, sagte der König, »ich möchte dir etwas zeigen.«
Er kannte ihren Namen? Sie trat weiter in den kleinen, warmen Raum hinein und hielt dabei die Arme eng um ihren Körper geschlungen. Sie verstand diesen Mann nicht. Das lag aber nicht nur an seiner fremdartigen, beinahe toten Art zu sprechen. Und auch nicht allein an dem Umstand, dass sie seine Gefühle nicht erkennen konnte, da in ihm die Kriegerform und die Paarungsform miteinander im Wettstreit lagen.
Dieser Mann verblüffte sie stärker als jeder andere Mensch. Warum hatte er ihrem Volk einen so vorteilhaften Vertrag angeboten? Zuerst hatte es wie eine Gefälligkeit unter zwei Stämmen gewirkt. Doch so hatte sie es gesehen, bevor sie hierhergekommen war und diese Stadt und die Alethi-Armeen erblickt hatte. Ihr Volk hatte früher einmal eigene Städte besessen und auch Armeen, die neidisch machen konnten. Aufgrund der Lieder war das bekannt.
Aber es war nun auch schon lange her. Sie bildeten nur noch das Bruchstück eines untergegangenen Volkes. Sie waren Verräter, die ihre Götter verlassen hatten, weil sie frei sein wollten. Dieser Mann hätte die Lauscher zerschmettern können. Früher einmal hatten sie angenommen, dass ihre Splitter – Waffen, die sie bisher vor den Menschen geheim gehalten hatten – zu ihrem eigenen Schutz ausreichten. Inzwischen aber hatte sie bei den Alethi mehr als ein Dutzend Splitterklingen und Splitterpanzer gesehen.
Warum lächelte er sie so an? Was verbarg er nur, indem er nicht dem Rhythmus gemäß sang und sie beruhigte?
»Setz dich, Eschonai«, forderte sie der König auf. »Oh, hab keine Angst, kleine Späherin. Ich hatte ohnehin mit dir sprechen wollen. Deine Beherrschung unserer Sprache ist einzigartig!«
Sie nahm in einem Sessel Platz, während Gavilar etwas aus einer winzigen Ledertasche holte. Es glühte in rotem Sturmlicht und war ein Gebilde aus Juwelen und Metall, gegossen in eine wunderschöne Form.
»Weißt du, was das ist?«, fragte er und schob es ihr langsam hin.
»Nein, Euer Majestät.«
»Wir nennen es ein Fabrial. Es ist ein Gerät, das mit Sturmlicht betrieben wird. Dieses hier erschafft Wärme – leider nur äußerst wenig davon, aber meine Frau ist zuversichtlich, dass ihre Gelehrten eines herstellen können, das sogar in der Lage ist, einen ganzen Raum zu beheizen. Wäre das nicht wunderbar? Keine rauchenden Feuer mehr in den Kaminen!«
Dies erschien Eschonai zwar leblos, aber sie sagte es nicht. Sie summte Lob, damit er sich gut fühlte, weil er ihr davon erzählt hatte. Dann gab sie ihm das Gebilde zurück.
»Sieh es dir genau an«, sagte König Gavilar. »Schau ganz tief hinein. Kannst du erkennen, was sich darin bewegt? Das ist ein Sprengsel. So funktioniert dieses Gerät.«
Gefangen in einem Edelsteinherz, dachte sie und stimmte sich auf Ehrfurcht ein. Sie haben Geräte gebaut, die unsere Art nachahmen, die Formen anzuwenden? Trotz ihrer Beschränkungen unternahmen die Menschen so viel!
»Die Kluftteufel sind nicht eure Götter, oder?«, meinte er.
»Wie bitte?«, fragte sie und stimmte sich auf Skepsis ein. »Warum fragt Ihr das?« Was für eine seltsame Wendung in diesem Gespräch.
»Ach, das ist nur etwas, worüber ich mir einige Gedanken gemacht habe.« Er nahm das Fabrial aus ihren Händen entgegen. »Meine Offiziere fühlen sich so überlegen, weil sie glauben, dass sie euch durchschaut haben. Sie sind der Meinung, ihr seid Wilde, aber darin irren sie sich vollkommen. Ihr seid keine Wilden. Ihr seid eine Enklave der Erinnerung. Ein Fenster in die Vergangenheit.«
Er beugte sich vor, und das Licht der Rubine floss zwischen seinen Fingern hindurch. »Du musst eine Botschaft an eure Anführer überbringen. Es sind die Fünf, nicht wahr? Du stehst ihnen nahe, und ich werde beobachtet. Ich brauche ihre Hilfe bei einer gewissen Angelegenheit.«
Sie summte im Rhythmus der ängstlichen Anspannung.
»Nein, nein«, sagte er. »Ich werde dir helfen, Eschonai. Wusstest du schon, dass ich herausgefunden habe, wie ich eure Götter zurückbringen kann?«
Nein. Sie summte im Rhythmus des Schreckens. Nein …
»Meine Vorfahren«, sagte er und hob dabei das Fabrial hoch, »haben gelernt, ein Sprengsel im Innern eines Edelsteins einzuschließen. Und in einem ganz besonderen Edelstein ist es sogar möglich, einen Gott einzuschließen.«
»Euer Majestät«, sagte sie und wagte es, seine Hand zu ergreifen. Er konnte die Rhythmen nicht spüren. Er wusste es einfach nicht. »Bitte. Wir beten diese Götter nicht mehr an. Wir haben sie verlassen – wir haben sie verstoßen.«
»Ah, aber es ist zu eurem Besten – und auch zu unserem.« Er stand auf. »Wir leben ohne Ehre, denn eure Götter haben früher einmal die unseren gebracht. Ohne sie haben wir keine Macht. Diese Welt sitzt in der Falle, Eschonai! Wir stecken in einem matten, leblosen Übergangszustand fest.« Er hob den Blick zur Decke. »Sie müssen vereinigt werden. Ich brauche dringend eine Bedrohung. Nur Gefahr wird sie zusammenbringen.«
»Was …«, sagte sie im Rhythmus der Angst. »Was sagt Ihr da?«
»Unsere versklavten Parscher waren einst wie du. Doch dann haben wir sie ihrer Fähigkeit der Verwandlung beraubt. Wir haben es getan, indem wir ein Sprengsel eingefangen haben. Ein uraltes, ein wesentliches Sprengsel.« Er sah sie an, und in seinen grünen Augen leuchtete es. »Ich habe gesehen, wie es rückgängig gemacht werden kann. Ein neuer Sturm wird die Herolde aus ihrem Versteck locken. Ein neuer Krieg.«
»Wahnsinn.« Sie erhob sich. »Unsere Götter haben versucht, die Euren zu vernichten.«
»Die Alten Worte müssen wieder gesprochen werden.«
»Ihr könnt aber nicht …« Sie verstummte und bemerkte zum ersten Mal, dass auf dem Tisch in ihrer Nähe eine ausgebreitete Karte lag. Sie war groß und zeigte ein Land, das von Meeren umschlossen war – und ihre künstlerische Gestaltung stellte alle Versuche Eschonais in den Schatten.
Sie trat an den Tisch heran und keuchte. Der Rhythmus der Ehrfurcht spielte in ihrem Geist. Das ist großartig. Sogar die prächtigen Leuchter und die beschnitzten Wände waren im Vergleich dazu gar nichts. Das hier war Wissen und Schönheit, miteinander verschmolzen.
»Ich war der Meinung, dir eine Freude zu machen, wenn du erfährst, dass wir Verbündete in dem Versuch sind, eure alten Götter zur Rückkehr zu bewegen«, sagte Gavilar. Beinahe hörte sie den Rhythmus des Tadels in seinen toten Worten. »Du behauptest, sie zu fürchten, aber warum fürchtest du das, was dir das Leben geschenkt hat? Mein Volk muss vereinigt werden, und ich brauche ein Reich, das sich nicht durch innere Kämpfe zerreißt, sobald ich nicht mehr da bin.«
»Also sucht ihr den Krieg?«
»Ich suche nach einem Ende für etwas, das wir nie richtig beendet haben. Mein Volk, das bestand einst aus den Strahlenden, und euer Volk – die Parscher – sprühte vor Leben. Wem ist mit dieser trostlosen Welt gedient, in der sich mein Volk in endlosen Scharmützeln gegenseitig bekämpft und kein Licht hat, das es führt, während dein Volk lebenden Leichnamen gleicht?«
Wieder blickte sie auf die Karte. »Wo … wo ist die Zerbrochene Ebene? Ist es dieser Teil hier?«
»Du zeigst gerade auf ganz Natanatan, Eschonai! Das hier ist die Zerbrochene Ebene.« Er deutete auf eine Stelle, die nicht größer als sein Daumennagel war, während die Karte den ganzen Tisch bedeckte.
Bei diesem Anblick wurde ihr schwindlig. Das war die Welt? Sie hatte vermutet, dass sie auf ihrer Reise nach Kholinar fast das ganze Land durchquert hatten. Warum hatte ihr bisher niemand die Wahrheit gesagt?
Ihre Beine wurden schwach, und sie stimmte sich in den Rhythmus des Trauerns ein. Sie sank in ihren Sessel zurück, konnte nicht mehr stehen.
So riesig.
Gavilar zog etwas aus seiner Hosentasche. Eine Kugel? Sie war dunkel, glimmerte aber irgendwie. Als ob sie … eine Aura aus Schwärze besäße – ein Phantomlicht, das gar kein richtiges Licht war. Sie schimmerte in schwachem Violett, schien das Licht um sich herum aufzusaugen.
Er legte die Kugel auf den Tisch vor ihr. »Bring sie zu den Fünfen und erkläre ihnen, was ich dir mitgeteilt habe. Sag ihnen, dass sie sich daran erinnern sollen, was ihr Volk einmal gewesen ist. Wach auf, Eschonai.«
Er klopfte ihr auf die Schulter, dann verließ er das Zimmer. Sie starrte jenes schreckliche Licht an. Aus den Liedern wusste sie, was es war. Die Formen der Macht hatten mit einem dunklen Licht in Zusammenhang gestanden – mit einem Licht, das vom König der Götter stammte.
Sie nahm die Kugel vom Tisch und rannte davon.
Als die Trommeln aufgestellt waren, beharrte Eschonai darauf, sich zu den Trommlern zu gesellen. Es war ein Ventil für ihre Angst. Sie schlug im Einklang mit dem Rhythmus in ihrem Kopf, schlug so hart zu, wie sie konnte, und versuchte mit jedem Schlag all das zu verbannen, was der König gesagt hatte.
Und auch das, was sie soeben getan hatte.
Die Fünf hatten am Hochtisch gesessen; die Speisereste des letzten Gangs hatten vor ihnen gestanden.
Er beabsichtigt, unsere Götter zurückzuholen, hatte sie den Fünfen gesagt.
Schließ die Augen. Konzentriere dich auf die Rhythmen.
Er kann es tun. Er weiß so viel.
Wilde Schläge hallten durch ihre Seele.
Wir müssen etwas unternehmen.
Klades Sklave war ein Attentäter. Klade behauptete, eine Stimme, die den Rhythmen antwortete, habe ihn zu dem Mann geführt, der seine Fähigkeiten eingestanden hatte, als er heftig bedrängt worden war. Anscheinend war Venli bei Klade gewesen, auch wenn Eschonai ihre Schwester früher an diesem Tag nicht gesehen hatte.
Nach einer hitzigen Debatte waren die Fünf darin übereingekommen, dass dies ein Zeichen für das war, was sie tun sollten. Vor langer Zeit hatten die Lauscher den Mut aufgebracht, die Fadform anzunehmen, damit sie auf diese Weise ihren Göttern entkommen konnten. Um jeden Preis hatten sie die Freiheit gesucht.
Heute würde der Preis, diese Freiheit beizubehalten, sehr hoch sein.
Sie schlug die Trommel. Sie spürte den Rhythmus. Sie weinte leise und sah nicht hin, als der seltsame Attentäter – der jene fließenden weißen Gewänder trug, die Klade ihm gegeben hatte – den Raum verließ. Zusammen mit den anderen hatte sie für diese Handlungsweise gestimmt.
Spüre den Frieden der Musik. Das hatte ihre Mutter immer gesagt. Suche nach den Rhythmen. Suche nach den Liedern.
Sie leistete Widerstand, als die anderen sie wegzogen. Sie weinte, weil sie die Musik hinter sich lassen musste. Sie weinte um ihr Volk, das wegen dem, was heute geschehen würde, möglicherweise vernichtet wurde. Sie weinte um die Welt, die nie erfahren würde, was die Lauscher für sie getan hatten.
Sie weinte um den König, den sie zum Tode verurteilt hatte.
Die Trommeln um sie herum verstummten, und ersterbende Musik hallte durch die Gänge und die Korridore.
Ich bin mir sicher, dass sich einige durch diesen Bericht bedroht fühlen werden. Und ein paar wenige werden sich befreit fühlen. Die meisten werden einfach nur das Gefühl haben, dass er nicht existieren sollte.
Aus Eidbringer, Vorwort
Als Dalinar Kholin in der Vision erschien, stand er neben der Erinnerung eines toten Gottes.
Es war sechs Tage her, seit seine Streitkräfte in Urithiru eingetroffen waren, der legendären heiligen Turmstadt der Strahlenden Ritter. Sie waren einem neuen, verheerenden Sturm entronnen und in den Schutz eines alten Portals geflohen. Nun gewöhnten sie sich in ihrem neuen Zuhause ein, das versteckt in den Bergen lag.
Und doch fühlte sich Dalinar, als wüsste er gar nichts. Er verstand die Kraft nicht, gegen die er kämpfte, und er wusste erst recht nicht, wie er sie besiegen konnte. Er verstand auch kaum den Sturm und dessen Rolle bei der Rückkehr der Bringer der Leere, der alten Feinde der Menschheit.
Also kam er hierher, in seine Visionen. Er versuchte dem Gott, der sie verlassen hatte – und der entweder Ehr oder der Allmächtige genannt wurde –, seine Geheimnisse zu entlocken. Diese besondere Vision war die erste, die Dalinar je gehabt hatte. Sie begann damit, dass er neben einem Bildnis des Gottes in menschlicher Gestalt stand, das sich auf einer Klippe befand, von der aus ganz Kholinar überblickt werden konnte: Dalinars Heimat und der Sitz der Regierung. In der Vision war die Stadt von einer unbekannten Macht zerstört worden.
Der Allmächtige sagte zwar etwas, aber Dalinar hörte ihm nicht zu. Dalinar war zu einem Strahlenden Ritter geworden, indem er sich mit dem Sturmvater selbst verbunden hatte – mit der Seele des Großsturms und dem mächtigsten Sprengsel von Roschar –, und Dalinar hatte herausgefunden, dass er die Visionen nun nach seinem Belieben immer und immer wieder ablaufen lassen konnte. Er hatte diesen Monolog schon dreimal gehört und ihn Wort für Wort vor Navani wiedergegeben, damit sie ihn aufschreiben konnte.
Diesmal begab sich Dalinar stattdessen an den Rand der Klippe, kniete nieder und schaute auf die Ruinen von Kholinar. Hier roch die Luft trocken, staubig und warm. Er blinzelte und versuchte in dem Chaos der zerstörten Gebäude irgendeine bedeutungsvolle Einzelheit zu erkennen. Selbst die Windklingen – einst prächtige, schlanke Felsformationen, in denen zahlreiche Erdschichten erkennbar gewesen waren – waren zerschmettert worden.
Der Allmächtige fuhr mit seiner Rede fort. Diese Visionen muteten wie ein Tagebuch an oder wie eine Reihe von umfassenden Botschaften, die der Gott hinterlassen hatte. Zwar schätzte Dalinar die Hilfe, die sie gewährten, im Augenblick jedoch ging es ihm nur um bestimmte Einzelheiten.
Er suchte den Himmel ab und bemerkte eine Kräuselung in der Luft – wie Hitze, die über einem fernen Stein aufstieg. Es war ein Schimmern von der Größe eines Hauses.
»Sturmvater«, sagte er. »Kannst du mich nach unten bringen, zwischen den Schutt und das Geröll?«
Du sollst nicht dorthin gehen. Das ist kein Teil der Vision.
»Beachte für den Augenblick nicht, was ich tun und was ich lassen soll«, sagte Dalinar. »Kannst du es tun? Kannst du mich zu diesen Ruinen bringen?«
Der Sturmvater grollte. Er war ein seltsames Wesen, auf irgendeine Weise verbunden mit dem toten Gott, aber nicht vollkommen identisch mit dem Allmächtigen. Zumindest bediente er sich heute nicht der Stimme, die sonst bis in Dalinars Knochen fuhr.
In einem einzigen Augenblick wurde Dalinar davongetragen. Er stand nicht länger auf der Klippe, sondern befand sich nun auf der Ebene vor den Ruinen der Stadt.
»Danke«, sagte Dalinar und brachte die kurze Strecke bis zu den Ruinen zu Fuß hinter sich.
Seit ihrer Entdeckung Urithirus waren erst sechs Tage vergangen. Sechs Tage seit dem Erwachen der Parschendi, die merkwürdige Kräfte und glühende rote Augen erlangt hatten. Sechs Tage seit dem Eintreffen des neuen Sturms – des Ewigsturms, eines Hurrikans aus dunklen Donnerwolken und roten Blitzen.
Einige in seiner Armee glaubten, der Sturm sei nun für immer vorbei, wie ein katastrophales Ereignis, das nicht wiederkehren werde. Doch Dalinar wusste es besser. Der Ewigsturm würde zurückkommen und im äußersten Westen auf Schinovar treffen. Und dann würde er quer über das Land ziehen.
Niemand beachtete seine Warnungen. An Orten wie Azir und Thaylenah gaben die Monarchen zwar zu, dass im Osten ein seltsamer Sturm aufgezogen war, aber sie glaubten nicht an seine Wiederkehr.
Sie konnten nicht einmal erahnen, wie zerstörerisch dieser Sturm bei seinem erneuten Eintreffen wirken würde. Bei seinem ersten Erscheinen war er mit dem Hochsturm zusammengeprallt, was einen einzigartigen Kataklysmus erschaffen hatte. Hoffentlich war er für sich allein nicht ganz so schlimm – aber es blieb noch immer ein Sturm, der in die falsche Richtung blies. Und er würde die Parscher-Diener auf der ganzen Welt erwecken und sie zu Bringern der Leere machen.
Was erwartest du zu erfahren?, fragte der Sturmvater, als Dalinar den Rand der Ruinen erreicht hatte. Diese Vision wurde erstellt, damit du zu der Klippe gezogen wirst und mit Ehr sprichst. Der Rest ist nichts anderes als eine Kulisse – ein Bild.
»Der Allmächtige hat diesen Schutt hierher gebracht«, sagte Dalinar und deutete auf die geborstenen Mauern, die er da vor sich hatte. »Es kann dahingestellt bleiben, ob es eine Kulisse ist oder nicht, denn jedenfalls hat seine Kenntnis der Welt und unseres Feindes die Art und Weise beeinflusst, wie er diese Vision erstellt hat.«
Dalinar kletterte auf die Trümmer der äußeren Mauern. Kholinar war eine großartige Stadt gewesen. Sturmverdammt, nein, es war noch immer eine großartige Stadt, wie nur wenige auf der Welt! Anstatt sich im Schatten einer Klippe oder in einer geschützten Kluft zu verstecken, vertraute Kholinar auf seine gewaltigen Mauern, die es vor den Großstürmen schützten. Es trotzte den Winden und verneigte sich nicht vor den Stürmen.
Doch in dieser Vision war die Stadt trotzdem zerstört worden. Dalinar stieg auf die Krone der Trümmer, warf einen Blick um sich und versuchte sich vorzustellen, wie es gewesen sein musste, vor so vielen Jahrtausenden hier zu siedeln. Damals hatte es noch keine Mauern gegeben. Es waren harte, sture Menschen gewesen, die diesen Ort gegründet hatten.
Er sah Rillen und Kratzer in den Steinen der umgestürzten Mauern, die an die Wunden erinnerten, die Raubtiere ihrer Beute zufügten. Die Windklingen waren zerschmettert worden, und aus der Nähe erkannte er auch die Spuren ihrer Klauen.
»Ich habe Kreaturen gesehen, die zu so etwas in der Lage sind«, sagte er, kniete sich neben einen der Steine und betastete die großen Scharten in der Oberfläche des Granits. »In meinen Visionen habe ich ein steinernes Ungeheuer beobachtet, das sich aus dem Fels des Erdbodens befreit hat.
Es gibt hier keine Leichen, aber vermutlich ist das dem Umstand geschuldet, dass der Allmächtige die Stadt in seiner Vision nicht bevölkert hat. Er wollte nur ein Symbol für die kommende Zerstörung erschaffen. Er glaubte, dass Kholinar nicht dem Ewigsturm, sondern den Bringern der Leere zum Opfer fallen wird.«
Ja, sagte der Sturmvater. Der Sturm wird eine Katastrophe sein, aber nicht annähernd das Ausmaß dessen erreichen, was auf ihn folgt. Du kannst Schutz vor einem Sturm suchen, Ehrensohn, nicht aber vor unseren Feinden.
Was konnte Dalinar noch tun, da sich die Herrscher von Roschar geweigert hatten, Dalinars Warnung vor dem baldigen Herannahen des Ewigsturms anzuhören? Das echte Kholinar wurde angeblich von Aufruhr erschüttert – und die Königin schwieg. Dalinars Armee war von ihrem ersten Zusammenstoß mit den Bringern der Leere gedemütigt weggehumpelt, und sogar viele seiner eigenen Großprinzen hatten ihn in dieser Schlacht nicht unterstützt.
Ein Krieg zog auf. Durch das Beschwören der Wüstwerdung hatte der Feind einen Jahrtausende alten Konflikt mit unvordenklichen Kreaturen erneuert, deren Beweggründe unbegreiflich und deren Kräfte unbekannt waren. Es hieß, Herolde würden auftreten und den Angriff gegen die Bringer der Leere anführen. Die Strahlenden Ritter sollten schon auf ihrem Platz sein, gut ausgebildet und bereit für den Kampf gegen den Feind. Sie sollten in der Lage sein, auf die Führung des Allmächtigen zu vertrauen.
Doch stattdessen hatte Dalinar nur eine Handvoll neuer Strahlender unter seinem Kommando, und von einer Hilfe durch die Herolde war nichts zu bemerken. Außerdem war der Allmächtige – Gott höchstpersönlich – tot.
Doch Dalinar sollte noch immer die Welt retten.
Der Boden erbebte – und die Vision endete damit, dass das Land geradezu wegglitt. Auf der Klippe würde der Allmächtige nun seine Rede beendet haben.
Eine letzte Welle der Vernichtung rollte wie ein Großsturm über das Land. Es war eine Metapher, die der Allmächtige für die Finsternis und Zerstörung ersonnen hatte, die beide über die Menschheit kommen würden.
Eure Legenden behaupten, dass ihr gewonnen habt, hatte er gesagt. Aber in Wahrheit habt ihr verloren. Und wir verlieren …
Der Sturmvater grollte. Es ist Zeit zu gehen.
»Nein«, erwiderte Dalinar, der noch immer auf dem Schutthügel stand. »Lass mich allein.«
Aber …
»Ich möchte es spüren!«
Die Welle der Vernichtung traf auf Dalinar, und er brüllte seinen Trotz heraus. Er hatte sich nicht vor dem Großsturm niedergebeugt, und hiervor würde er sich auf keinen Fall verneigen! Er hielt den Kopf hoch, und in der Kraftwelle, die den Boden auseinanderriss, sah er etwas.
Ein goldenes Licht, strahlend und schrecklich zugleich. Vor ihm stand eine dunkle Gestalt in einem schwarzen Splitterpanzer. Die Gestalt warf neun Schatten. Jeder breitete sich in einer anderen Richtung aus, und ihre Augen glühten in einem gleißenden Rot.
Dalinar starrte tief in diese Augen und spürte, wie eine Kälte ihn durchfuhr. Obwohl die Vernichtung ihn umtoste und Felsen zu Staub werden ließ, entsetzten ihn diese Augen noch viel mehr. Er entdeckte etwas entsetzlich Vertrautes in ihnen.
Dies war eine Gefahr, die jeden Sturm übertraf.
Dies war der Kampfmeister des Feindes. Und er kam immer näher.
VEREINIGE SIE. SCHNELL.
Dalinar keuchte, als die Vision zerschmettert wurde. Er fand sich in sitzender Position neben Navani wieder, in einem stillen steinernen Zimmer irgendwo in Urithiru, der Stadt der Türme. Dalinar musste nicht mehr gefesselt werden, wenn er seine Visionen durchlebte. Inzwischen hatte er eine ausreichende Kontrolle über sie, sodass er sie nicht mehr durchspielen musste, wenn er sie erlebte.
Er atmete tief durch. Schweiß rann an seinem Gesicht herab, und sein Herz raste. Navani sagte etwas, aber er konnte sie nicht hören. Im Vergleich zu dem Rauschen in seinen Ohren schien sie sehr weit entfernt zu sein.
»Was war das für ein Licht, das ich gesehen habe?«, flüsterte er.
Ich habe kein Licht gesehen, sagte der Sturmvater.
»Es war strahlend und golden, aber schrecklich«, flüsterte Dalinar. »Es hat alles in seine Hitze getaucht.«
Odium, grollte der Sturmvater. Der Feind.
Der Gott, der den Allmächtigen getötet hatte. Die Macht hinter den Wüstwerdungen.
»Neun Schatten«, flüsterte Dalinar und zitterte.
Neun Schatten? Die Ungemachten. Seine Häscher. Uralte Sprengsel.
Bei den Stürmen! Dalinar kannte sie nur aus den Legenden: schreckliche Sprengsel, die in der Lage waren, den Geist der Menschen zu verwirren.
Diese Augen suchten ihn noch immer heim. Auch wenn es entsetzlich war, über die Ungemachten nachzudenken, jene Gestalt mit den roten Augen fürchtete er doch am meisten. Odiums Kampfmeister.
Dalinar blinzelte und sah Navani an – die Frau, die er liebte. Sie machte eine schmerzhaft sorgenvolle Miene, als sie seinen Arm ergriff. An diesem seltsamen Ort und in dieser noch seltsameren Zeit bedeutete sie etwas zutiefst Wirkliches. Etwas, woran er sich festhalten konnte. Eine reife Schönheit – in gewisser Weise das Urbild einer vollkommenen Vorin-Frau: üppige Lippen, hell-violette Augen, mit Silber durchzogenes schwarzes Haar, zu vollendeten Zöpfen geflochten, die Rundungen von der engen Seidenhavah umschmiegt. Kein Mann würde Navani vorwerfen können, dürr zu sein.
»Dalinar?«, fragte sie. »Dalinar, was ist geschehen? Geht es dir gut?«
»Es …« Er holte tief Luft. »Es geht mir gut, Navani. Und ich weiß, was wir tun müssen.«
Sie runzelte die Stirn. »Was?«
»Ich muss die Welt schneller vereinigen – gegen den Feind, damit er sie nicht zerstören kann.«
Er musste es erreichen, dass ihn die übrigen Herrscher der Welt anhörten. Er musste sie auf den neuen Sturm und auf die Bringer der Leere vorbereiten. Und außerdem musste er ihnen helfen, die Auswirkungen zu überleben.
Wenn es ihm gelang, würde er sich der Wüstwerdung nicht allein entgegenstemmen müssen. Hier ging es nicht um den Kampf einer Nation gegen die Bringer der Leere. Es war notwendig, dass sich die Reiche der Welt ihm anschlossen, und er hatte die Aufgabe, die Strahlenden Ritter zu finden, die mitten unter den Völkern erschaffen worden waren.
Und diese musste er vereinigen.
»Dalinar«, sagte sie. »Ich glaube, das Ziel ist ein gutes … aber, bei den Stürmen, was wird dabei aus uns? Dieses Bergland ist eine Wüste. Womit sollen wir unsere Armee versorgen?«
»Die Seelengießer …«
»… werden bald keine Edelsteine mehr haben«, sagte Navani. »Außerdem können sie nur die grundlegenden Bedürfnisse erfüllen. Dalinar, wir sind halb erfroren, gebrochen und gespalten. Unsere Kommandostruktur ist in Unordnung geraten, und sie …«
»Friede, Navani«, sagte Dalinar und erhob sich. Er zog sie auf die Beine. »Ich weiß. Und trotzdem müssen wir kämpfen.«
Sie umarmte ihn. Er hielt sie fest, spürte ihre Wärme und roch ihr Parfum. Sie bevorzugte einen weniger blumigen Duft als andere Frauen – einen mit Gewürzen darin, wie das Aroma frisch gehackten Holzes.
»Wir können es schaffen«, sagte er zu ihr. »Mit meiner Hartnäckigkeit. Und deinem Scharfsinn. Gemeinsam werden wir die anderen Reiche davon überzeugen, dass sie sich uns anschließen müssen. Wenn der Sturm zurückkehrt, werden sie erkennen, dass unsere Warnungen gerechtfertig waren, und sie werden sich gegen den Feind vereinigen. Wir können die Eidtore dazu benutzen, Truppen zu bewegen und mit Nachschub zu versorgen.«
Die Eidtore. Zehn Portale, uralte Fabriale, die Tore nach Urithiru. Wenn ein Strahlender Ritter eines dieser Tore aktivierte, wurden all jene, die auf der Plattform standen, die sie umgab, nach Urithiru gebracht und erschienen auf einem ähnlichen Gebilde hier beim Turm.
Gegenwärtig wurde nur ein Torpaar genutzt und beförderte Menschen zwischen Urithiru und der Zerbrochenen Ebene hin und her. Theoretisch konnten noch neun weitere in Betrieb genommen werden, doch leider hatten Nachforschungen ergeben, dass innerhalb eines jeden Tores auf beiden Seiten ein Mechanismus in Gang gesetzt werden musste, bevor sie benutzt werden konnten.
Wenn er nach Vedenar, in die Stadt Thaylen, nach Azimir oder an irgendeinen anderen Ort reisen wollte, musste zuerst einer der Strahlenden dorthin gehen und das Tor entsperren.
»Also gut«, sagte sie. »Wir werden es schaffen. Irgendwie wird es uns gelingen, sie zum Zuhören zu bringen – selbst wenn sie sich die Finger tief in ihre Ohren stecken. Man fragt sich aber, wie ihnen das gelingen sollte, wo doch ihre Köpfe so fest in ihren Allerwertesten stecken.«
Er lächelte, und plötzlich kam er sich dumm vor, weil er sie vorhin so idealisiert hatte. Navani Kholin war ein furchtsames, großartiges Ideal – sie war ein Sturm von einer Frau, voller fester Gewohnheiten, stur wie ein Felsbrocken, der einen Berghang herabrollt, und zunehmend unduldsam in Dingen, die sie närrisch fand.
Dafür liebte er sie am meisten. Dafür, dass sie offen und ehrlich in einer Gesellschaft war, die voller Stolz auf ihre Geheimnisse blickte. Sie hatte seit ihrer Jugend viele Tabus und Herzen gebrochen. Manchmal erschien ihm der Gedanke, dass sie auch ihn liebte, so unwirklich wie eine seiner Visionen.
An der Tür seines Zimmers ertönte ein Klopfen, und Navani befahl der Person einzutreten. Eine von Dalinars Späherinnen steckte den Kopf herein. Dalinar drehte sich um, runzelte die Stirn und bemerkte sofort die angespannte Haltung sowie das rasche Atmen der Frau.
»Was ist los?«, wollte er wissen.
»Herr«, sagte die Frau und salutierte. Ihr Gesicht war bleich. »Es … hat einen Zwischenfall gegeben. In den Korridoren wurde eine Leiche entdeckt.«
Dalinar spürte, wie sich etwas zusammenzog. Eine Energie lag in der Luft, wie vor einem niedergehenden Blitz. »Wer?«
»Der Großprinz Torol Sadeas, Herr«, sagte die Frau. »Er wurde ermordet.«
Ich musste es ohnehin aufschreiben.
Aus Eidbringer, Vorwort
Halt! Was tut ihr da?« Adolin Kholin ging auf eine Gruppe von Arbeitern in kremfleckiger grober Kleidung zu, die gerade Kisten aus einem Wagen luden. Ihr Chull wand und drehte sich und suchte nach Steinknospen, die es fressen konnte. Aber das war vergeblich. Sie befanden sich tief im Turm, auch wenn ein ganzes Dorf in diese Höhlung gepasst hätte.
Die Arbeiter besaßen den Anstand, zerknirscht zu wirken, obwohl sie vermutlich nicht einmal wussten, warum sie es sein sollten. Eine Schar von Schreiberinnen folgte Adolin und überprüfte den Inhalt des Wagens. Die Öllampen auf dem Boden vermochten es kaum, die Dunkelheit des gewaltigen Raums zu vertreiben, dessen Decke sich vier Stockwerke über ihnen befand.
»Hellherr?«, fragte einer der Arbeiter und kratzte sich an den Haaren unter seiner Kappe. »Ich hab grade ausgeladen. Ich glaub, das war es, was ich gemacht hab.«
»Im Ladungsverzeichnis steht Bier«, sagte Ruschu, eine junge Feuerin, zu Adolin.
»Sektion zwei«, sagte Adolin und klopfte mit den Knöcheln seiner linken Hand gegen den Wagen. »Die Tavernen werden entlang des Mittelkorridors bei den Aufzügen eingerichtet, sechs Kreuzungen weiter im Innern. Meine Tante hat das ausdrücklich zu euren Großherren gesagt.«
Die Männer starrten ihn mit leeren Blicken an.
»Eine Schreiberin wird es euch zeigen. Ladet diese Kisten wieder ein.«
Die Männer seufzten, aber sie machten sich sogleich daran, ihren Wagen erneut zu beladen. Sie wussten, dass es nicht gut war, sich mit dem Sohn eines Großprinzen zu streiten.
Adolin drehte sich um und betrachtete die tiefe Kaverne, die zu einem Abladeplatz sowohl für Vorräte als auch für Menschen geworden war. Kinder liefen in Gruppen vorbei. Arbeiter stellten Zelte auf. Frauen holten Wasser von der Quelle in der Mitte. Soldaten trugen Fackeln und Laternen. Sogar Axthunde rannten hin und her. Vier vollständige Kriegslager voller Menschen hatten in großer Hast die Zerbrochene Ebene nach Urithiru überquert, und Navani hatte sich bemüht, den passenden Ort für sie alle zu finden.
Trotz des großen Chaos war Adolin froh, dass diese Menschen hier waren. Sie wirkten ausgeruht und hatten nicht an der Schlacht gegen die Parschendi teilgenommen; überdies hatten sie weder den Angriff des Attentäters in Weiß noch das Zusammenprallen der beiden Stürme erlebt.
Die Kholin-Soldaten hingegen befanden sich in einem schrecklichen Zustand. Adolins Schwerthand war bandagiert und pochte noch immer heftig; beim Kampf hatte er sich das Handgelenk gebrochen. Auf seinem Gesicht prangte eine hässliche Prellung, und dabei war er noch einer der Glücklicheren.
»Hellherr«, sagte Ruschu und deutete auf einen anderen Wagen. »Das sieht wie Wein aus.«
»Wunderbar«, sagte Adolin. Warum hielt sich niemand an Tante Navanis Anweisungen?
Er kümmerte sich um den Wagen, und danach musste er einen Streit zwischen Männern schlichten, die wütend darüber waren, dass sie zum Wasserholen eingeteilt worden waren. Sie behaupteten, das sei Parscher-Arbeit und unter ihrem Nahn. Leider gab es keine Parscher mehr.
Adolin beruhigte sie und schlug ihnen vor, eine Wasserträger-Gilde einzurichten, falls sie gezwungen sein sollten, diese Tätigkeit auch weiterhin auszuüben. Vater würde dem gewiss zustimmen, doch Adolin machte sich Sorgen. Hatten sie überhaupt die Mittel, all diese Leute zu bezahlen? Der Lohn richtete sich nach dem jeweiligen Rang, und es war schließlich nicht möglich, Menschen grundlos zu Sklaven herabzusetzen.
Adolin war über die ihm anvertraute Aufgabe froh, denn sie lenkte ihn ab. Auch wenn er nicht jeden Wagen persönlich überprüfen musste – er sollte hier nur die Aufsicht führen –, stürzte er sich doch in alle Einzelheiten seiner Arbeit. Mit seinem gebrochenen Handgelenk konnte er keine Übungskämpfe mehr durchführen, und wenn er zu lange allein dasaß, musste er immer wieder an das denken, was am Tag zuvor geschehen war.
Hatte er es wirklich getan?
Hatte er wirklich Torol Sadeas umgebracht?
Fast war es eine Erleichterung, als schließlich ein Bote auf ihn zulief und ihm zuflüsterte, in den Korridoren des dritten Stockwerks sei etwas entdeckt worden.
Adolin wusste, worum es sich handelte.
Lange bevor er sein Ziel erreicht hatte, hörte Dalinar die Rufe. Sie hallten die Korridore entlang. Er kannte diesen Ton. Auseinandersetzungen standen bevor.
Er ließ Navani hinter sich zurück und rannte los. Als er eine breite Kreuzung zweier Gänge erreicht hatte, war er heftig ins Schwitzen geraten. Männer in Blau, beleuchtet von dem harten Licht der Laternen, standen anderen Männern in Waldgrün gegenüber. Wutsprengsel breiteten sich wie Blutlachen auf dem Boden aus.
Ein Leichnam mit einer grünen Jacke über dem Gesicht lag vor ihm.
»Zurück!«, brüllte Dalinar und stürmte in den Raum zwischen den beiden Soldatengruppen. Er zog einen Brückenmann beiseite, der sich dicht vor einen von Sadeas’ Soldaten gestellt hatte. »Auseinander, oder ich werde euch alle in den Bau schicken, jeden einzelnen Mann!«
Seine Stimme traf die Männer wie ein Sturm, und von allen Seiten richteten sich die Blicke auf ihn. Er stieß den Brückenmann zu seinen Gesellen, schob dann einen von Sadeas’ Soldaten zurück und betete, der Mann möge klug genug sein, von einem Angriff auf einen Großprinzen abzusehen.
Navani und die Späherin blieben am Rand des Aufruhrs stehen. Die Männer von Brücke Vier wichen schließlich in einen der Korridore zurück, und Sadeas’ Soldaten begaben sich in den gegenüberliegenden Gang – jedoch nur so weit, dass sie einander noch böse anstarren konnten.
»Ihr solltet Euch auf den Donner der Verdammnis gefasst machen«, rief Sadeas’ Offizier Dalinar zu. »Eure Männer haben einen Großprinzen ermordet!«
»Wir haben ihn so gefunden!«, brüllte Teft von Brücke Vier zurück. »Vermutlich ist er über sein eigenes Messer gestolpert. Das geschieht ihm recht, diesem sturmverdammten Bastard.«
»Teft, halt den Mund!«, schrie Dalinar ihn an.
Der Brückenmann wirkte verblüfft, dann salutierte er mit steifer Geste.
Dalinar kniete sich hin und zog die Jacke von Sadeas’ Gesicht. »Das Blut ist getrocknet. Er liegt schon seit einiger Zeit hier.«
»Wir haben nach ihm gesucht«, sagte der Offizier in Grün.
»Gesucht? Hattet ihr euren Großprinzen denn verloren?«
»Die Gänge sind sehr verwirrend!«, sagte der Mann. »Sie verlaufen nicht natürlich. Wir hatten kehrtgemacht und …«
»… angenommen, er wäre zu einem anderen Teil des Turms gegangen«, sagte ein anderer Mann. »Dort haben wir ihn während der ganzen letzten Nacht gesucht. Einige Leute hatten uns gesagt, sie seien ihm begegnet, aber sie hatten sich geirrt, und …«
Und ein Großprinz wurde einen halben Tag lang in seinem eigenen Blut liegen gelassen, dachte Dalinar. Im Blut meiner Väter.
»Wir konnten ihn nicht finden«, sagte der Offizier, »weil Eure Männer ihn ermordet und dann den Leichnam weggeschafft haben …«
»Das Blut hat sich stundenlang hier gesammelt. Niemand hat den Leichnam bewegt.« Dalinar streckte den Arm aus. »Bringt den Großprinzen in den Seitenraum dort hinten und lasst Ialai holen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich möchte mir das genauer ansehen.«
Dalinar Kholin war ein Kenner des Todes.
Seit seiner Jugend war er an den Anblick toter Menschen gewöhnt. Wenn man lange genug auf dem Schlachtfeld blieb, wurde man mit seinem Meister vertraut.
Daher schockierte ihn Sadeas’ blutiges, zerstörtes Gesicht nicht: nicht das geplatzte Auge, durch das ihm eine Klinge ins Hirn gerammt worden war, und auch nicht das Blut und die anderen Flüssigkeiten, die aus der Wunde getreten und inzwischen getrocknet waren.
Ein Messerstich ins Auge war die Art von Wunde, die sogar einen Mann in einer Rüstung und mit einem Helm auf dem Kopf töten konnte. Es war ein Manöver, das stetig geübt und auf dem Schlachtfeld angewendet wurde. Aber Sadeas hatte keine Rüstung getragen und sich nicht auf einem Schlachtfeld befunden.
Dalinar beugte sich herunter und betrachtete den Leichnam, der auf einem Tisch lag, im Licht der flackernden Öllampen.
»Ein Attentäter«, sagte Navani, schnalzte mit der Zunge und schüttelte den Kopf. »Das ist nicht gut.«
Hinter ihm hatten sich Adolin und Renarin mit Schallan und einigen Brückenmännern versammelt. Gegenüber von Dalinar stand Kalami. Die dünne Frau mit den orangefarbenen Augen war eine seiner älteren Schreiberinnen. Ihren Gemahl Teleb hatten sie in der Schlacht gegen die Bringer der Leere verloren. Zwar gefiel es ihm nicht, sie in ihrer Trauerzeit einzusetzen, aber sie hatte selbst darauf beharrt weiterzuarbeiten.
Bei den Stürmen, ihm waren so wenige hochrangige Offiziere geblieben. Cael war bei dem Zusammenprall des Ewigsturms und des Großsturms gestorben, kurz bevor er hatte Schutz finden können. Ilamar und Perethom hatte Dalinar durch Sadeas’ Verrat am Turm verloren. Der einzige Großherr, der ihm geblieben war, war Khal, der sich noch von einer Verletzung erholte, die er während des Kampfes gegen die Bringer der Leere empfangen hatte – eine Verletzung, die er erst dann offenbart hatte, als alle anderen in Sicherheit gewesen waren.
Sogar Elhokar, der König, war von Attentätern in seinem Palast angegriffen und verwundet worden, während die Armeen in Narak gekämpft hatten. Seitdem versuchte er sich zu erholen. Dalinar war sich nicht sicher, ob er herkommen und Sadeas’ Leiche in Augenschein nehmen würde oder nicht.
Wie dem auch sei, Dalinars Mangel an Offizieren erklärte die anderen Anwesenden im Zimmer: Großprinz Sebarial sowie seine Geliebte Palona. Es musste dahingestellt bleiben, ob Sebarial liebenswürdig war oder nicht; zumindest war er einer der zwei noch lebenden Großprinzen, die Dalinars Ruf zum Marsch auf Narak gefolgt waren. Dalinar musste sich auf jemanden verlassen können, und den meisten Großprinzen traute er nicht weiter, als der Wind sie blasen konnte.
Sebarial würde zusammen mit Aladar – der zwar schon gerufen worden, aber noch nicht hier eingetroffen war – das Fundament des neuen Alethkar bilden müssen. Der Allmächtige mochte ihnen allen helfen.
»Also!«, sagte Palona und stemmte die Hände in die Hüften, während sie Sadeas’ Leichnam betrachtete. »Damit ist wohl ein Problem gelöst.«
Alle im Raum wandten sich ihr zu.
»Was ist los?«, fragte sie. »Sagt mir nicht, dass ihr nicht dasselbe gedacht habt.«
»Es sieht schlecht aus, Hellherr«, sagte Kalami. »Jeder wird sich wie diese Soldaten draußen verhalten und annehmen, dass Ihr ihn habt umbringen lassen.«
»Irgendwelche Hinweise auf den Verbleib seiner Splitterklinge?«, fragte Dalinar.
»Nein, Herr«, antwortete einer der Brückenmänner. »Vermutlich hat derjenige, der ihn umgebracht hat, sie an sich genommen.«
Navani rieb Dalinars Schulter. »Ich hätte es vielleicht nicht so ausgedrückt wie Palona, aber er hat wirklich versucht, dich aus dem Weg zu räumen. Vielleicht ist es das Beste so.«
»Nein«, sagte Dalinar mit heiserer Stimme. »Wir hätten ihn gebraucht.«
»Ich weiß, dass du verzweifelt bist, Dalinar«, sagte Sebarial. »Das beweist bereits meine Anwesenheit hier. Aber sicherlich sind wir nicht schon so tief gesunken, dass wir Sadeas unbedingt gebraucht hätten. Ich stimme Palona zu. Auf Nimmerwiedersehen!«
Dalinar hob den Blick und sah die Personen im Zimmer an. Sebarial und Palona. Teft und Sigzil, die Leutnants von Brücke Vier. Eine Handvoll weiterer Soldaten, einschließlich der jungen Späherin, die ihn hierher geführt hatte. Seine Söhne, der beständige Adolin und der unzugängliche Renarin. Navani, deren Hand noch auf seiner Schulter lag. Und die alternde Kalami, die die Hände vor sich verschränkt hatte, seinen Blick erwiderte und nickte.
»Ihr alle seid dieser Meinung, nicht wahr?«, fragte Dalinar.
Niemand wandte etwas dagegen ein. Ja, für Dalinars Ruf war dieser Mord schädlich, und die in diesem Zimmer Anwesenden wären sicherlich nicht so weit gegangen, Sadeas eigenhändig zu töten. Aber nun, da er nicht mehr da war … warum sollte jemand Tränen für ihn vergießen?
Erinnerungen wogten durch Dalinars Gedanken. Erinnerungen an die Tage, die er mit Sadeas verbracht und an denen er Gavilars großartigen Plänen gelauscht hatte. Erinnerungen an die Nacht vor Dalinars Hochzeit, als er mit Sadeas bei einem wilden Fest, das dieser für ihn organisiert hatte, zu viel Wein getrunken hatte.
Es war schwer, jenen jüngeren Mann, jenen Freund, mit dem dickeren, älteren Gesicht auf der Tischplatte vor ihm in Einklang zu bringen. Der erwachsene Sadeas war ein Mörder gewesen, dessen Verrat den Tod vieler guter Männer nach sich gezogen hatte. Um dieser Männer willen, die während der Schlacht beim Turm ihrem Schicksal überlassen worden waren, verspürte Dalinar nichts als Befriedigung darüber, Sadeas endlich tot zu sehen.
Und das bereitete ihm Sorgen. Er wusste genau, was die anderen fühlten. »Kommt mit.«
Er verließ den Leichnam und schritt aus dem Zimmer. Dabei kam er an Sadeas’ Wachen vorbei, die sofort hereineilten. Sie würden sich um die Leiche kümmern. Hoffentlich hatte er die Lage so weit entspannt, dass es nicht mehr zu einem plötzlichen Zusammenstoß zwischen seinen und den anderen Soldaten kam. Er musste unbedingt Brücke Vier von hier wegbringen.
Dalinars Gefolge lief mit Öllampen in den Händen hinter ihm durch die Gänge des höhlenartigen Turms. Die Wände waren mit gewundenen Linien bedeckt – mit natürlichen Gesteinsschichten aus unterschiedlichen Erdfarben, ähnlich den Schichten des getrockneten Krem. Er warf es den Soldaten nicht vor, dass sie Sadeas’ Spur verloren hatten, denn es war leicht, an diesem Ort mit seinen endlosen, allesamt in die Finsternis führenden Gängen die Orientierung zu verlieren.
Glücklicherweise hatte er eine ungefähre Vorstellung davon, wo sie sich befanden, und er führte seine Gruppe zum äußeren Rand des Turms. Hier trat er durch eine leere Kammer auf einen Balkon – auf einen von vielen, die wie breite Veranden wirkten.
Über ihm stieg die gewaltige Turmstadt Urithiru vor dem Hintergrund des Gebirges verblüffend hoch auf. Sie war aus einer Reihe von zehn kreisförmigen Lagen zusammengesetzt, von denen jede achtzehn Stockwerke hoch war, und geschmückt mit Aquädukten, Fenstern und Balkonen wie diesem hier.
Im Erdgeschoss ragten weite Teile aus dem Kreis hervor: große steinerne Oberflächen, die jeweils so etwas wie ein eigenes Plateau bildeten. Sie wurden durch Steinmauern begrenzt, hinter denen der Fels in die Tiefe der Klüfte zwischen den einzelnen Berggipfeln abfiel. Zuerst waren diese weiten, flachen Steinflächen noch verwirrend gewesen. Doch die Furchen im Stein und die Pflanzkisten am inneren Rand hatten schließlich ihren Zweck enthüllt. Es musste sich um Felder