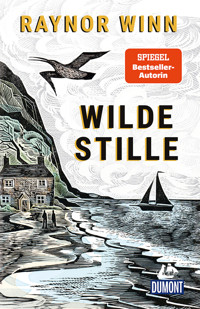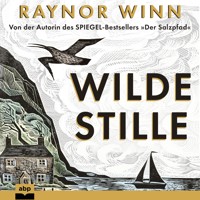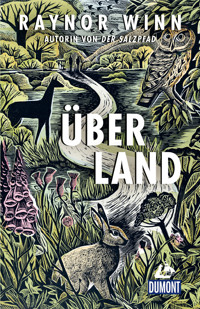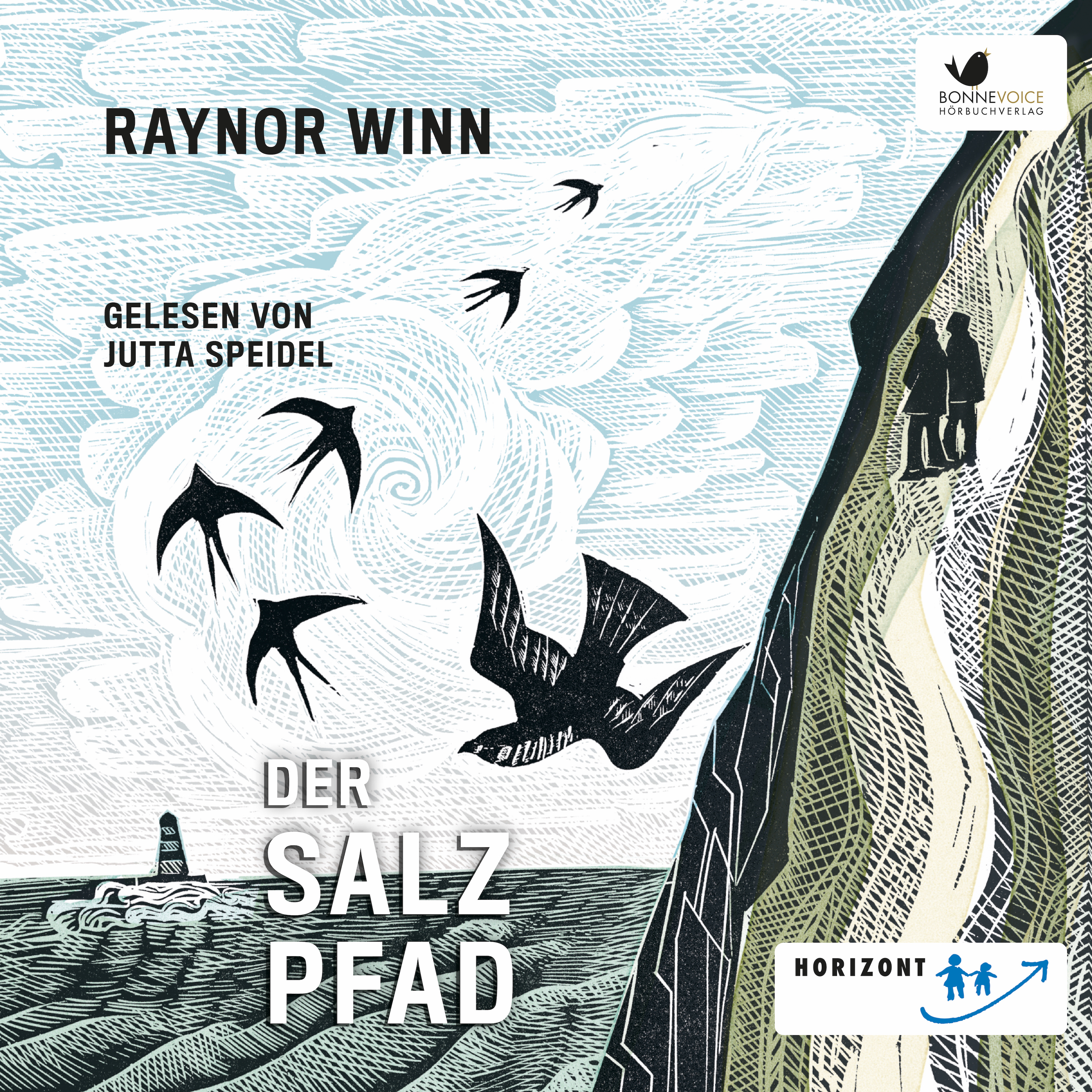
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BONNEVOICE Hörbuchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: DuMont Welt - Menschen - Reisen E-Book
- Sprache: Deutsch
Mit den E-Books der DuMont Reiseabenteuer können viele praktische Zusatzfunktionen nutzen!
Das E-Book basiert auf: 1. Auflage 2019, Dumont Reiseverlag
Alles, was Moth und Raynor noch besitzen, passt in einen Rucksack. Sie haben alles verloren – ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth seine Gesundheit. Mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf, den South West Coast Path, Englands berühmten Küstenweg, zu wandern. Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer nur dort, wo sie gerade sind. Sie kämpfen mit Vorurteilen, Ablehnung und der Sorge, dass das Geld für den nächsten Tag nicht mehr reicht. Und zugleich entdecken sie auf ihrer großen Wanderung das Glück: herzliche Begegnungen, ihre neu erstarkte Liebe und die Fähigkeit, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Allen Prophezeihungen zum Trotz führt sie der mehrmonatige Trip zurück ins Leben und öffnet die Tür zu einer neuen Zukunft.
Tipp: Setzen Sie Ihre persönlichen Lesezeichen an den interessanten Stellen und machen Sie sich Notizen… und durchsuchen Sie das E-Book mit der praktischen Volltextsuche!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RAYNOR WINN
DER
SALZ PFAD
Aus dem Englischen von
Heide Horn und Christa Prummer-Lehmair
Kollektiv Druck-Reif
1. Auflage 2019
© Raynor Winn 2018
© 2019 für die deutschsprachige Ausgabe: DuMont Reiseverlag, Ostfildern
Alle Rechte vorbehalten
Die englische Originalausgabe ist 2018 unter dem Titel »The Salt Path« bei Michael Joseph, Penguin Random House, London, erschienen.
Übersetzung: Heide Horn und Christa Prummer-Lehmair, Kollektiv Druck-Reif
Lektorat: Katharina Theml, Wiesbaden
Gestaltung: Andreas Staiger, Stuttgart
Umschlagillustration: Angela Harding, Rutland (UK)
Fotos: Valentin Betz (Klappe), Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0/Nilfanion (Bildstrecke S. 4/5), alle anderen: Raynor Winn
Die Übersetzung des Homer-Zitats >>>> stammt aus: Homer, »Odyssee«, übersetzt von Kurt Steinmann, Penguin 2016; die Übersetzung der Beowulf-Zitate >>>> und >>>> f. stammen aus: »Beowulf«, übersetzt von Johannes Frey, Reclam 2013.
Für das Team
Grafik herunterladen
INHALT
Prolog
TEIL 1INS LICHT
1Staub des Lebens
2Der Verlust
3Eine seismische Verschiebung
4Schurken und Vagabunden
TEIL 2DER SOUTH WEST COAST PATH
5Obdachlos
6Der Weg
7Hunger
8Zwischen den Elementen
TEIL 3DIE PERFEKTE WELLE
9Warum?
10Grün/Blau
11Überleben
12Wellentänzer
13Häutungen
14Dichter
TEIL 4BROMBEEREN MIT EINEM HAUCH SALZ
15Landzungen
16Auf der Suche
17Kälte
TEIL 5ENTSCHEIDUNGEN
18Schafe
TEIL 6AM RAND
19Lebendig
20Annehmen
21Salz im Blut
Danksagung
Über die Autorin
PROLOG
Das Geräusch der Brandung ist unverwechselbar. Im Hintergrund das untrügliche Rauschen, darüber das Klatschen der ankommenden Welle und dann das saugende Geräusch, wenn der Rückstrom einsetzt. Es war stockfinster, kaum ein Fünkchen Licht, doch mir genügte das laute Klatschen, um zu wissen, dass es nah sein musste. Ich versuchte, logisch zu denken. Unser Zelt stand ein gutes Stück über der Flutlinie; unterhalb von uns fiel der Strand ab und dahinter lag der Wasserspiegel. Die Brandung konnte uns nicht erreichen, alles in Ordnung. Ich legte den Kopf zurück auf den zusammengerollten Pullover mit dem Vorsatz, weiterzuschlafen. Nein, gar nichts war in Ordnung, im Gegenteil. Das Geräusch der Wellen kam nicht von weiter unten, sondern von direkt neben uns.
Ich kroch im grünlich-schwarzen Licht durch das Zelt und riss die Zeltklappe auf. Das Mondlicht fiel schräg über die Kliffkante, sodass der Strand vollkommen im Dunkeln lag, während die Wellen, die schäumend ans Ufer schlugen, glitzerten; sie schwappten bereits auf die Sandbank, die nur einen Meter vor dem Zelt endete. Ich schüttelte den Schlafsack neben mir.
»Moth, Moth, das Wasser, es kommt.«
Wir warfen alle schweren Gegenstände in unsere Rucksäcke, schlüpften schnell in die Wanderstiefel, zogen die Stahlheringe heraus und hoben das Zelt hoch, ohne es abzubauen, immer noch mit unseren Schlafsäcken und Kleidern drin, sodass die Bodenplane tief in den Sand hing. Wie ein grüner Riesenkrebs krabbelten wir über den Strand, auf das zu, was noch am Abend ein kleiner Süßwasserbach gewesen war, der ins Meer floss, nun aber ein metertiefer, mit Salzwasser gefüllter Kanal, der sich Richtung Kliff ergoss.
»Ich kann es nicht hoch genug heben. Die Schlafsäcke werden nass werden.«
»Tu doch was, sonst werden nicht nur die Schlaf…!«
Wir brachten uns in Sicherheit. Als sich die Welle zurückzog, sah ich, dass sich der Kanal zu einem breiten Wasserstreifen abflachte, der nur dreißig Zentimeter tief war. Wieder rannten wir los, inzwischen schwappte das Wasser bereits bis weit über die Sandbank hinweg und kam auf uns zu.
»Wir warten, bis das Wasser zurückfließt, dann überqueren wir den Kanal und laufen nach oben.«
Ich war baff vor Staunen. Dieser Mann, der noch vor zwei Monaten kaum ohne Hilfe seine Jacke hatte anziehen können, stand in Unterhosen, den Rucksack geschultert, am Strand, hielt ein aufgeschlagenes Zelt hoch über seinem Kopf und sagte mir, ich solle laufen.
»Lauf, lauf, lauf!«
Das Zelt hoch erhoben platschten wir durch das Wasser und stapften verzweifelt das Ufer hoch, während das Wasser gegen unsere Fersen klatschte und der Rückstrom uns ins Meer zu ziehen drohte. Wir stolperten durch den weichen Sand, die Stiefel randvoll mit Salzwasser, und ließen das Zelt am Fuß des Kliffs fallen.
»Die Felsen hier scheinen mir nicht allzu stabil zu sein. Wir sollten noch ein Stück weitergehen.«
Wie bitte? Wie konnte er um drei Uhr morgens so umsichtig sein?
»Nein.«
Wir waren dreihundertneunzig Kilometer gelaufen, hatten sechsunddreißig Nächte wild gecampt und die meiste Zeit von Trockennahrung gelebt. Der Wanderführer über den South West Coast Path hatte angegeben, wir würden nach achtzehn Tagen hier ankommen, hatte uns Restaurants mit köstlichem Essen und Übernachtungsmöglichkeiten mit weichen Betten und heißem Wasser in Aussicht gestellt. Der Zeitplan und all diese Annehmlichkeiten waren jenseits unserer Möglichkeiten, aber das machte mir nichts. Moth rannte im Mondlicht in einer löchrigen Unterhose, die er seit fünf Tagen ununterbrochen trug, über den Strand und hielt ein aufgeschlagenes Zelt über seinem Kopf. Es war ein Wunder. Besser konnte es gar nicht mehr kommen.
Als wir unsere Rucksäcke packten und Tee kochten, erschien das erste Tageslicht über der Portheras Cove. Ein neuer Tag lag vor uns. Ein ganz normaler Tag zum Wandern. Nur noch 622 Kilometer.
TEIL 1
INS LICHT
Muse, erzähl mir vom Manne, dem wandlungsreichen,den oft es abtrieb vom Wege …
Homer, Die Odyssee
1
STAUB DES LEBENS
Als ich den Entschluss fasste zu wandern, saß ich unter der Treppe. In jenem Moment hatte ich noch nicht bedacht, was es bedeutete, 630 Meilen – über tausend Kilometer – mit einem Rucksack auf dem Rücken zurückzulegen, hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ich das finanzieren sollte und dass ich fast einhundert Nächte wild campen würde, und auch nicht darüber, wie es danach weitergehen sollte. Und ich hatte meinem Lebenspartner, mit dem ich seit zweiunddreißig Jahren zusammen war, noch nicht eröffnet, dass er mitkommen würde.
Nur wenige Minuten zuvor hatte ich mich in meiner Not unter der Treppe versteckt. Die Männer in Schwarz kamen um neun Uhr morgens und hämmerten an unsere Tür, aber wir waren noch nicht bereit. Wir waren noch nicht bereit, loszulassen. Ich brauchte noch etwas Zeit: nur eine Stunde, eine Woche, ein ganzes Leben. Es würde nie genug Zeit sein. Also kauerten wir uns unter die Treppe, dicht aneinandergedrängt, flüsternd wie ängstliche Mäuse, wie unartige Kinder, die ihre Entdeckung fürchten.
Die Gerichtsvollzieher gingen zur Rückseite des Hauses und klopften an die Fenster, probierten jeden Fensterriegel aus. Ich hörte, wie einer auf die Gartenbank kletterte, an das Küchen-Oberlicht drückte und rief. Da fiel mein Blick auf das Buch in einem der Umzugskartons. Ich hatte Five Hundred Mile Walkies von Mark Walling-ton mit Anfang zwanzig gelesen, die Geschichte eines Mannes, der mit seinem Hund den South West Coast Path absolviert. Moth hockte eingequetscht neben mir, den Kopf auf den Knien, die Arme um die angezogenen Beine geschlungen, zum Schutz und vor Schmerz und Angst und Wut. Vor allem Wut. Das Leben hatte ihn in einem nicht enden wollenden, dreijährigen Kampf mit jeder nur erdenklichen Munition beschossen. Er war erschöpft vor Wut. Ich legte meine Hand auf sein Haar. Ich hatte dieses Haar gestreichelt, als es noch lang und blond war, voller Meersalz, Heidekraut und Jugend; als es braun und kürzer war, voller Gips und Knetmasse der Kinder; und ich streichelte es jetzt, da es silbergrau war und dünner, voll vom Staub unseres Lebens.
Ich hatte diesen Mann mit achtzehn kennengelernt; nun war ich fünfzig. Wir hatten diese heruntergekommene Farm zusammen renoviert, jede Mauer, jeden Stein wiederaufgebaut, Gemüse gezüchtet, Hühner gehalten und zwei Kinder großgezogen, und eine Scheune für Feriengäste hergerichtet, die wir in unser Leben einbezogen und die uns ein Auskommen sicherten. Doch sobald wir durch diese Tür traten, würde das alles hinter uns liegen, wäre alles vorbei, zu Ende, erledigt.
»Wir könnten eine Wanderung machen.«
Es war ein absurder Vorschlag, aber ich sagte es trotzdem.
»Eine Wanderung?«
»Ja, eine Wanderung.«
Würde Moth das bewältigen? Es war ja nur ein Küstenwanderweg; so schwierig konnte das nicht sein, und wir konnten langsam gehen, immer einen Fuß vor den anderen setzen, während wir der Karte folgten. Ich brauchte dringend eine Landkarte, etwas, das uns den Weg wies. Warum also nicht? So schwer konnte das nicht sein.
Die gesamte Küste entlangzuwandern, von Minehead in Somerset über Nord-Devon, Cornwall und Süd-Devon bis nach Poole in Dorset, schien einigermaßen machbar. Und dennoch war der Gedanke, über Hügel, Strände, Flüsse und Moore zu streifen, in diesem Augenblick ebenso fern und unwahrscheinlich wie der, dass wir aus unserem Versteck unter der Treppe hervorkrochen und die Tür öffneten. Das war etwas, was andere fertigbrachten, nicht wir.
Andererseits, wir hatten eine Ruine wiederaufgebaut, uns selbst das Klempnern beigebracht, zwei Kinder großgezogen, uns gegen Richter und hochbezahlte Anwälte verteidigt, warum also nicht?
Weil wir verloren hatten. Den Prozess, das Haus und uns selbst.
Ich streckte die Hand aus, um das Buch aus dem Karton zu ziehen, und sah auf den Einband: Five Hundred Mile Walkies. Was für eine idyllische Aussicht! Damals hatte ich keine Ahnung, dass der South West Coast Path erbarmungslos war, dass wir fast so viele Höhenmeter bewältigen mussten, als würden wir viermal auf den Mount Everest klettern, dass wir über tausend Kilometer auf einem Weg wandern würden, der zum Teil nur dreißig Zentimeter breit war, dass wir in der freien Natur schlafen und leben und jedes schmerzliche Detail noch einmal durcharbeiten würden, das uns hierher in dieses Versteck geführt hatte. Ich wusste nur, dass wir es tun sollten. Außerdem hatten wir jetzt sowieso keine andere Wahl mehr. Ich hatte die Hand schon zu dem Karton ausgestreckt, und jetzt wussten sie, dass wir zu Hause waren, sie hatten mich gesehen, es gab kein Zurück, wir mussten gehen. Als wir aus dem Dunkel unter der Treppe krochen, drehte sich Moth um.
»Wir beide?«
»Für immer.«
Wir standen an der Haustür, die Gerichtsvollzieher auf der anderen Seite warteten schon ungeduldig darauf, das Schloss auszuwechseln, uns aus unserem alten Leben auszusperren. Gleich würden wir das spärlich beleuchtete, jahrhundertealte Haus verlieren, das zwanzig Jahre lang unser Kokon gewesen war. Wenn wir durch diese Tür traten, würden wir niemals zurückkehren können.
Wir hielten uns an den Händen und gingen ins Licht.
2
DER VERLUST
Begannen wir unsere Wanderung an jenem Tag unter der Treppe oder an dem Tag, als wir in Taunton aus dem Van einer Freundin stiegen, im Regen am Straßenrand abgeladen wurden, die Rucksäcke auf dem Asphalt? Oder waren wir seit Jahren auf diese Wanderung zugesteuert, hatte sie bereits am Horizont auf uns gewartet, auf den Tag, an dem wir absolut nichts mehr zu verlieren hatten?
Der Tag im Gerichtsgebäude markierte das Ende eines dreijährigen Kampfes, aber es geht nie so zu Ende, wie man es erwartet. Als wir auf die Farm in Wales gezogen waren, schien die Sonne, die Kinder liefen zwischen unseren Beinen herum, und das Leben lag vor uns. Ein verfallener Steinhaufen auf einem einsamen Fleckchen Land am Fuß der Berge. Wir machten uns mit vollem Einsatz an die Renovierung, arbeiteten in jeder freien Minute daran, während die Kinder größer wurden. Es war unser Zuhause, unser Betrieb, unser Refugium, und ich hätte nicht erwartet, dass es in einem schmuddeligen grauen Gerichtssaal neben einem Spielsalon zu Ende gehen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass es zu Ende gehen würde, während ich vor einem Richter stand und ihm sagte, er habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht erwartet, dass ich die Lederjacke tragen würde, die mir die Kinder zum fünfzigsten Geburtstag geschenkt hatten. Ich hätte nicht erwartet, dass es jemals zu Ende gehen würde.
Während wir im Gerichtssaal saßen, sah ich zu, wie Moth an einem weißen Fleck auf dem schwarzen Tisch vor ihm herumrieb. Ich wusste, was er dachte: Wie hatte es nur so weit kommen können? Er war mit dem Mann, der die finanziellen Ansprüche gegen uns geltend machte, eng befreundet gewesen. Sie waren zusammen aufgewachsen, gehörten zur selben Clique; sie waren auf ihren Dreirädern herumgeflitzt, hatten Fußball gespielt, die Teenagerjahre miteinander verbracht. Ja, wie hatte es so weit kommen können? Der Kontakt zu anderen war abgerissen, aber sie waren dicke Kumpel geblieben. Als sie erwachsen wurden, schlugen sie unterschiedliche Wege ein, Cooper stieg in Finanzkreise auf, die kaum einer von uns durchblickte. Moth jedoch hielt die Verbindung zu ihm, blieb mit ihm befreundet. Er vertraute ihm so sehr, dass wir, als sich die Gelegenheit ergab, in eine seiner Firmen investierten, und zwar mit einer erheblichen Summe. Dann ging die betreffende Firma pleite und hinterließ offene Rechnungen. Irgendwann hing die Andeutung im Raum, wir seien Geld schuldig. Zunächst ignorierten wir es, aber Cooper hörte nicht auf zu behaupten, unser Vertrag sei so gestaltet, dass wir für die Begleichung der Schulden hafteten.
Anfänglich war Moth vor allem wegen der zerbrochenen Freundschaft am Boden zerstört und weniger wegen der finanziellen Forderungen, und ihr Streit gärte mehrere Jahre lang. Wir waren überzeugt davon, dass wir nicht für die Schulden haftbar waren, weil es nirgendwo ausdrücklich stand, und Moth glaubte fest daran, dass sie beide das irgendwann zwischen sich ausmachen würden. Bis zu dem Tag, an dem per Post ein gerichtlicher Mahnbescheid kam.
Unsere Ersparnisse waren bald weg, aufgezehrt von Anwaltshonoraren. Von da an vertraten wir uns selbst vor Gericht, wurden einer der vielen Fälle, wie sie die kürzlich verabschiedete Reform der Prozesskostenhilfe der britischen Regierung tausendfach hervorgebracht hatte. Demnach hatten wir kein Anrecht auf einen kostenlosen Rechtsbeistand, weil unser Fall als »zu komplex« eingestuft wurde. Die Reform mag ja 350 Millionen Pfund pro Jahr eingespart haben, aber sie bedeutet, dass wehrlose Menschen keine Möglichkeit mehr haben, zu ihrem Recht zu kommen.
Unsere einzige Taktik war die des Hinauszögerns, wir spielten auf Zeit, während wir im Hintergrund Juristen und Steuerberater kontaktierten und versuchten, irgendeinen schriftlichen Beweis zu finden, der den Richter von der Wahrheit überzeugen würde: dass wir den ursprünglichen Vertrag richtig ausgelegt hatten und für die Schulden nicht haftbar waren. Ohne die Hilfe eines Prozessanwalts wurden wir ständig ausmanövriert, und schließlich wurde die Verpfändung unserer Farm als Sicherheit für die Begleichung von Coopers Forderungen beantragt. Wir warteten voller Anspannung, und dann trudelte sie ein, die gerichtliche Räumungsanordnung für unser Heim, unser Haus und das Land, jeden Stein, den wir sorgfältig auf den anderen gelegt hatten, den Baum, unter dem unsere Kinder gespielt hatten, das Mauerloch, wo die Blaumeisen nisteten, das lose Kaminblech, wo die Fledermäuse wohnten. Eine Anordnung, uns das alles wegzunehmen. Wir zogen es weiter hinaus, reichten Anträge ein, baten um einen Aufschub, bis wir dachten, wir hätten ihn gefunden, den Hoffnungsschimmer in Form eines verheißungsvollen Blattes Papier, das bewies, dass Coopers Forderung an uns gegenstandslos war, weil wir ihm nichts schuldeten. Nach drei Jahren und zehn Gerichtsterminen besaßen wir endlich den Beweis, der unser Zuhause retten konnte. Kopien davon hatten wir dem Richter und dem Anwalt des Klägers geschickt. Wir waren bereit. Ich trug meine Lederjacke und strotzte vor Zuversicht.
Der Richter blätterte sich durch die Akten, als wären wir gar nicht da. Ich warf einen Blick zu Moth, weil ich ein bisschen Unterstützung brauchte, aber er starrte geradeaus. Die letzten Jahre hatten ihren Tribut gefordert: Sein dichtes Haar war spärlich und weiß geworden, und seine Gesichtshaut war wächsern und grau. Er wirkte wie ausgehöhlt; der Verrat durch einen engen Freund hatte diesen vertrauensvollen, ehrlichen, großzügigen Mann bis ins Mark erschüttert. Ein ständiger Schmerz in der Schulter und im Arm zehrte an seiner Kraft und machte es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Das musste jetzt endlich ein Ende finden, damit wir unser normales Leben wiederaufnehmen konnten, und dann, da war ich mir sicher, würde es ihm bald bessergehen. Doch normal sollte unser Leben nie wieder werden.
Ich stand auf, mit wackligen Beinen, als wären sie unter Wasser. Ich klammerte mich an das Blatt Papier wie an einen Anker. Draußen zankten die Möwen, ich hörte ihre lästigen, aufgeregten Schreie.
»Guten Morgen, Sir. Ich hoffe, Sie haben das neue Beweismittel erhalten, das ich Ihnen am Montag zugeschickt habe.«
»Habe ich.«
»Ich möchte mich auf dieses Beweismittel berufen …«
Coopers Anwalt stand auf und rückte seine Krawatte zurecht, wie immer, wenn er den Richter ansprach. Selbstbewusst. Kontrolliert. Alles, was wir nicht waren. Ich wünschte mir nichts sehnlicher als einen Anwalt.
»Sir, bei dieser Information, die Ihnen und mir zugestellt wurde, handelt es sich um einen neuen Beweis.«
Der Richter sah mich vorwurfsvoll an.
»Ist das ein neuer Beweis?«
»Nun, ja, wir haben ihn erst vor vier Tagen in die Hände bekommen.«
»Zu diesem späten Zeitpunkt dürfen keine neuen Beweise vorgebracht werden. Ich kann ihn nicht akzeptieren.«
»Aber dieses Papier belegt alles, was wir in den letzten drei Jahren behauptet haben. Es belegt, dass wir dem Kläger nichts schulden. Es enthält die Wahrheit.«
Ich wusste, was gleich kommen würde. Ich wollte die Zeit einfrieren, anhalten, die nun folgenden Worte verhindern. Ich wollte Moths Hand nehmen, aufstehen und den Gerichtssaal verlassen, nie wieder an das Ganze denken, nach Hause gehen und Feuer machen, mit den Händen über die Steinmauern streichen, während sich die Katze in der Wärme zusammenrollte. Wieder atmen, ohne dass sich meine Brust zusammenschnürte, an mein Zuhause denken, ohne die Angst davor, es zu verlieren.
»Sie müssen bei der Vorlage von Beweisen die korrekte Verfahrensweise einhalten. Ich werde jetzt das Urteil verkünden. Hiermit gebe ich dem Räumungsbegehren des Klägers statt. Sie werden das Grundstück innerhalb von sieben Tagen räumen, bis neun Uhr morgens an dem betreffenden Tag. Und nun zu den Kosten. Haben Sie dazu etwas zu sagen?«
»Ja, Sie machen einen großen Fehler, das ist alles falsch. Und nein, zu den Kosten habe ich nichts zu sagen, wir haben sowieso kein Geld, Sie nehmen uns unser Zuhause, unseren Betrieb, unser Einkommen weg, was wollen Sie noch?« Ich klammerte mich an den Tisch, da der Boden unter mir wegsackte. Nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen.
»Ich berücksichtige das und weise die Forderung auf Kostenübernahme ab.«
Meine Gedanken drifteten ab, brachten sich in Sicherheit. Als Moth auf seinem Stuhl herumrutschte, war der Geruch der heißen, trockenen Kieselsteine und der frisch gestutzten Buchsbäume förmlich zu greifen, der von seiner Jacke ausging. Die Kinder hatten sich auf den Kieselsteinen die Knie aufgeschürft, als sie Radfahren lernten, hatten die Kiesel spritzen lassen, wenn sie mit dem Auto zur Uni fuhren. Die Rosen standen in voller Blüte, hingen wie Wattebäusche über die Buchsbaumhecke; bald würde ich die welken Blüten abschneiden.
»Ich beantrage die Zulassung der Berufung.«
»Abgelehnt. Dieses Verfahren zieht sich schon viel zu lange hin; sie hatten ausreichend Gelegenheit, Beweise vorzubringen.«
Der Raum begann zu schrumpfen, die Wände rückten näher. Es spielte keine Rolle, dass wir den Beweis gerade erst gefunden hatten, und auch nicht, dass er die Wahrheit enthielt; das Einzige, was zählte, war, dass ich ihn dem Gericht nicht auf die richtige Art und Weise vorgelegt hatte, dass ich nicht die korrekte Verfahrensweise eingehalten hatte. Was sollte ich – was sollten wir – jetzt tun, was sollten wir mit den Hühnern anfangen, wer würde dem alten Schaf morgens eine Scheibe Brot füttern, wie konnten wir in einer Woche eine ganze Farm einpacken, wie sollten wir den Umzugswagen bezahlen, was war mit den Familien, die eine Ferienwohnung bei uns gebucht hatten, den Katzen, den Kindern? Wie sollte ich unseren Kindern erklären, dass wir gerade ihr Zuhause verloren hatten? Unser Zuhause. Und nur, weil ich das Prozedere nicht kannte. Mir war so ein simpler, grundlegender Fehler unterlaufen: Ich hatte es versäumt, einen Antrag auf die Vorlage weiterer Beweismittel einzureichen. Woher hätte ich wissen sollen, dass das notwendig war? Ich war so glücklich gewesen, so sicher, also hatte ich den Beweis einfach hingeschickt. Hatte dieses verheißungsvolle Blatt Papier mit der reinen Wahrheit völlig umsonst vorgelegt. Und nun hatten wir alles verloren. Waren ohne einen Penny, ohne ein Zuhause.
Wir schlossen die Tür des Gerichtssaals hinter uns und gingen den Flur entlang, starr, stumm. Ich hielt nicht an, als ich den Anwalt der Gegenseite im Nebenzimmer sah, aber Moth ging rein. Nein, Moth, nein, schlag ihn nicht. Ich konnte all die Wut, all den Stress der letzten drei Jahre spüren. Doch er streckte dem Anwalt die Hand entgegen.
Ist schon gut, ich weiß, dass Sie nur Ihren Job erledigen, aber es war die falsche Entscheidung, das wissen Sie, oder?«
Er nahm Moths Hand und schüttelte sie.
»Der Richter hat entschieden, nicht ich.«
Ich weinte immer noch nicht, aber innen drin ergriff mich ein stummes Heulen und drückte zu, sodass mir das Atmen schwerfiel.
***
Ich stand auf der Wiese hinter dem Haus, unter der knorrigen Esche, wo die Kinder in dem schneereichen Winter ’96 ein Iglu gebaut hatten. Ich brach eine Scheibe Weißbrot in sechs Teile, ein Ritual, das in den vergangenen neunzehn Jahren den Beginn eines jeden Tages markiert hatte. Das alte Mutterschaf schnüffelte an meiner Hand und nahm mit seinen weichen Lippen das Brot: neunzehn Jahre alt, ohne Zähne, aber immer noch mit großem Appetit gesegnet. Die Kinder hatten sie Smotyn getauft, das ist walisisch und heißt »gesprenkelt«. Jetzt war sie ein brummiges altes Schaf mit einem schmuddeligen schwarz-weißen Fell und zwei schiefen Hörnern. Na ja, eigentlich einem Horn, das andere hatte sie sich vor ein paar Jahren abgestoßen in dem verzweifelten Versuch, mit dem Kopf in einen Futtereimer zu gelangen. Tom hatte das Horn aufbewahrt; es lag in seinem Schatzkästchen, das er mitnahm, als er zur Universität ging, zusammen mit seinen Fossilien und den Pokémonkarten. Als Rowan drei war, hatte ich mit ihr eine sechzig Kilometer weite Fahrt in unserem winzigen Lieferwagen unternommen. Auf einer Farm an einer Bergflanke mit Blick auf das Meer kauften wir drei quirlige, gefleckte kleine Lämmchen. Rowan heulte vor Wut, weil sie nicht bei ihnen sitzen durfte, also gab ich nach und ließ alle vier auf dem Stroh im Laderaum mitfahren. Seitdem waren die Schafe Teil unseres Lebens, Teil unserer Familie gewesen. Im Lauf der Jahre hatten sie viele Lämmer geworfen, aber jetzt war nur noch Smotyn übrig, ihre Schwestern waren gestorben, und die übrigen hatte ich im vorigen Jahr an einen anderen Züchter verkauft, als der Gerichtsprozess einen Punkt erreicht hatte, an dem wir dachten, es könnte nicht mehr weitergehen und wir würden verlieren. Von Smotyn hatte ich mich nicht trennen können. In ihrem Alter würde niemand sie nehmen; im Durchschnitt wird ein Schaf nur sechs oder sieben Jahre alt, bevor man Hundefutter oder Hackbällchen daraus macht. Am Tag nach der Gerichtsverhandlung hatte ich die Hühner zu einem Freund gebracht, aber für Smotyn hatte er keinen Platz. Sie drehte mir den Rücken zu und wanderte über die Wiese, umgeben von Wolken aus Löwenzahnsamen, zu den Buchen, unter deren Kronen das Gras immer trocken war. Wir beide kannten diese Wiese in- und auswendig. Wie sollten wir, das Schaf und ich, ohne sie weiterleben?
In fünf Tagen würden wir beide obdachlos sein; dann würden wir es erfahren.
***
Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste – nicht wissen konnte –, war, dass es keine fünf Tage dauern würde, bis sich mein Leben für immer verändern würde, bis sich alles, was mir bisher Halt gegeben hatte, in Treibsand verwandeln würde. Doch es geschah bereits am folgenden Tag.
Wir befanden uns im Zimmer eines Facharztes in einem Liverpooler Krankenhaus. Endlich, nach jahrelangem Herumdoktern, sollten wir die Ursache für Moths Schulterschmerzen erfahren. Er hatte sein Leben lang körperlich gearbeitet, und so hatte einer der Ärzte nur gemeint: »Es ist ganz normal, dass es wehtut, wenn Sie den Arm heben, und dass Sie beim Gehen ein bisschen humpeln.« Anderen hatten das leichte Zittern in seiner Hand und eine gewisse Lähmung im Gesicht Sorge bereitet. Aber dieser Arzt hier war eine Koryphäe, der Beste seines Fachs, das Nonplusultra. Er würde uns etwas von einer Bänderverletzung oder dergleichen erzählen und wie sie sich behandeln ließ; dass es passiert war, als Moth vor Jahren durch das Scheunendach fiel – vielleicht hatte er sich dabei einen Haarriss im Schultergelenk zugezogen. Er würde uns garantiert sagen, wie es sich wieder in Ordnung bringen ließ. Er würde mit seiner ganzen Autorität hinter seinem Schreibtisch sitzen und uns das sagen. Ganz ohne Zweifel.
Auf der langen Fahrt nach Liverpool hatten wir kaum ein Wort gesprochen, jeder war tief in einem Sumpf aus Schock und Erschöpfung versunken. Die Tage seit dem Prozess waren ein einziger Wirbel aus Kisten packen und Gerümpel verbrennen, nervenaufreibenden Telefonaten und Verzweiflung gewesen. Wir hatten realisiert, dass wir nirgendwo hinkonnten. Es war zum Schlimmsten gekommen. Die siebenstündige Fahrt nach Liverpool und wieder zurück hatte uns gerade noch gefehlt. Uns war jede Stunde kostbar, jede Stunde, um fertig zu packen, jede Stunde, die wir geborgen im Schutz unserer eigenen vier Wände verbringen durften.
Unsere Odyssee durch die Wartezimmer von Ärzten hatte sechs Jahre zuvor begonnen. Den lähmenden Schmerz in Moths Schulter und seinem Arm, gefolgt von einem Zittern in seiner Hand, hatten die Ärzte als Parkinson-Krankheit diagnostiziert, aber als sich das als Fehlannahme erwies, ging man von einer Nervenschädigung aus. Das Behandlungszimmer dieses Arztes unterschied sich in nichts von den bisherigen: eine weiße, nüchterne Schuhschachtel mit Blick auf den Parkplatz. Doch dieser Arzt thronte nicht hinter seinem Schreibtisch; er kam dahinter hervor und setzte sich vor Moth auf die Schreibtischkante, legte die Hand auf seinen Arm und fragte ihn, wie es ihm gehe. Da stimmte etwas nicht. So etwas machen Ärzte normalerweise nicht. Keiner der bisherigen Ärzte, und wir waren bei vielen gewesen, hatte das jemals gemacht.
»Das Beste, was ich für Sie tun kann, Moth, ist, Ihnen eine Diagnose zu geben.«
Nein, nein, nein, nein, nein. Sagen Sie nichts mehr, sprechen Sie nicht weiter, es wird etwas Schreckliches über Ihre selbstgefälligen, aufeinandergepressten Lippen kommen, öffnen Sie sie nicht, sagen Sie nichts.
»Ich glaube, Sie leiden an kortikobasaler Degeneration, CBD. Die Diagnose lässt sich nicht mit letzter Sicherheit stellen. Es gibt keinen Test, daher können wir es erst post mortem verifizieren.«
»Post mortem? Wann, glauben Sie, wird das sein?« Moths Hände spreizten sich weit über seine Oberschenkel, als wollte er so viel wie möglich von sich selbst zwischen seinen breiten Fingern halten.
Also, normalerweise würde ich sagen, sechs bis acht Jahre nach dem Ausbruch. Aber in Ihrem Fall scheint die Krankheit sehr langsam fortzuschreiten, da Ihre ersten Probleme bereits vor sechs Jahren auftraten.«
»Das heißt, Sie müssen sich geirrt haben. Es ist etwas anderes.« Ich spürte, wie Übelkeit in mir aufstieg und der Raum vor mir unscharf wurde.
Der Arzt sah mich an, als würde er mit einem Kind reden; dann fuhr er fort, uns eine seltene degenerative Gehirnerkrankung zu erklären, die mir den wundervollen Mann wegnehmen würde, den ich schon liebte, seit ich ein Teenager war. Die Krankheit würde erst seinen Körper und dann sein Gehirn zerstören, er würde wirr und dement werden, bis er zuletzt nicht mehr in der Lage sein würde, den eigenen Speichel zu schlucken, und folglich ersticken würde. Und es gab nichts, absolut nichts, was man dagegen tun konnte. Ich hatte Mühe zu atmen; der Raum verschwamm. Nein, nicht Moth, nehmen Sie ihn mir nicht weg, Sie können ihn nicht haben, er bedeutet mir alles, er ist alles für mich, alles von mir. Nein. Nach außen hin versuchte ich, ruhig zu wirken, doch innerlich schrie ich, verfiel in Panik, wie eine Biene, die gegen eine Glasscheibe anfliegt. Die reale Welt war noch da, aber auf einmal unerreichbar.
»Aber Sie können sich auch irren.«
Wovon redete er überhaupt? So würden wir nicht sterben. Es ging hier nicht um Moths Leben, sondern um unseres. Wir waren eins, miteinander verschmolzen, verwoben, auf molekularer Ebene. Es war nicht sein Leben und nicht mein Leben, es war unser Leben. Wir hatten einen Plan, wie wir einmal sterben würden. Mit fünfundneunzig, auf dem Gipfel eines Berges, nachdem wir uns den Sonnenaufgang angesehen hatten, würden wir einfach einschlafen. Nicht in einem Krankenhausbett ersticken. Nicht voneinander getrennt, auseinandergerissen, allein.
»Sie haben sich geirrt.«
***
Zurück auf dem Krankenhausparkplatz klammerten wir uns im Auto aneinander, als würde das alles aufhören, wenn wir nur unsere Körper ganz eng aneinanderpressten. Als könnte uns nichts mehr trennen, wenn zwischen uns kein Lichtstrahl hindurchpasste, als wäre das dann alles nicht wahr und wir müssten es nicht durchmachen. Stumme Tränen liefen über Moths Gesicht, aber ich weinte nicht, konnte nicht weinen. Wenn ich es täte, würde der ganze Schmerz mich in einem einzigen Sturzbach mit sich reißen. Wir hatten unser ganzes Erwachsenenleben miteinander verbracht. Jeden Traum oder Plan, jeden Erfolg oder Misserfolg miteinander geteilt, als zwei Hälften eines gemeinsamen Lebens. Niemals getrennt, niemals allein, ein Ganzes.
Es gab keine Medikamente, um das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen, keine Therapien, um sie in Schach zu halten. Die einzige Hilfe, die man uns bot, war ein Medikament mit dem Wirkstoff Pregabalin gegen die Schmerzen, aber das nahm Moth bereits. Etwas anderes gab es nicht. Wie gerne wäre ich in die Apotheke gegangen und hätte einen Zaubertrank besorgt, irgendein Mittel gegen die Schneise der Zerstörung, die sich in unser Leben fraß.
»Physiotherapie hilft gegen die Steifheit«, hatte der Arzt gemeint. Aber Moth absolvierte bereits ein tägliches Krankengymnastikprogramm. Vielleicht konnte er noch mehr tun; vielleicht konnten wir so die Verschlechterung aufhalten. Ich klammerte mich an jeden Strohhalm, jeden noch so dünnen Faden, an dem ich mich aus diesem erstickenden Nebel des Schocks heraushangeln konnte. Doch es gab keinen Faden, keine Hand, die sich mir entgegenstreckte, um mich in Sicherheit zu bringen, keine beruhigende Stimme, die mir sagte, alles sei gut, das sei nur ein böser Traum. Es gab nur uns beide, die wir uns auf einem Krankenhausparkplatz an die einzige Wirklichkeit klammerten, die zählte, nämlich uns.
»Du kannst nicht krank sein, ich liebe dich doch.«
Als wäre es genug, ihn zu lieben. Es hatte immer genügt, mehr hatte ich nie gebraucht, aber jetzt würde es uns nicht retten. Als Moth mir das erste Mal seine Liebe gestand, hatte ich diese Worte überhaupt zum ersten Mal gehört. Noch nie hatte mir jemand gesagt, dass er mich liebte, weder meine Eltern noch meine Freunde noch sonst jemand, und diese Worte hatten mich mit ihrem Glanz und ihrem Funkeln in die nächsten zweiunddreißig Jahre meines Lebens getragen. Aber Worte waren machtlos dagegen, dass Moths Gehirn auf Selbstzerstörungsmodus schaltete, gegen ein Protein namens Tau, das sich in den Nervenzellen ablagerte und die Verbindungen blockierte.
»Er hat sich geirrt. Das weiß ich einfach, er irrt sich.« Er musste sich täuschen. Der Richter hatte falsch gelegen, warum nicht auch der Arzt?
»Ich kann nicht mehr denken, nichts mehr fühlen …«
»Dann lass uns annehmen, dass er sich irrt. Wenn wir uns weigern, ihm zu glauben, können wir einfach weitermachen und so tun, als wäre das alles nicht wahr.« Ich konnte es nicht an mich heranlassen. Das ergab alles keinen Sinn, nichts davon war real.
»Vielleicht irrt er sich. Aber was, wenn nicht? Was, wenn es so wird, wie er gesagt hat? Daran darf ich gar nicht denken …«
»So weit wird es nicht kommen; wir werden dagegen kämpfen, irgendwie.«
Ich glaube nicht an Gott oder an irgendein höheres Wesen. Wir leben, wir sterben; der Kohlenstoffkreislauf setzt sich endlos fort. Aber bitte, Gott, bitte mach, dass es nicht so weit kommt. Wenn Er existierte, hatte Er gerade die Wurzeln meines Lebens gepackt und ausgerissen, meine ganze Existenz auf den Kopf gestellt. Auf der Heimfahrt drehten wir den CD-Player auf volle Lautstärke, versteckten uns hinter dem Lärm. Unter mir ragten die Berge auf, und über meinem Kopf krachten die Wellen zusammen, meine Welt hatte sich einmal um einhundertachtzig Grad gedreht. Als wir ankamen, lief ich auf den Händen.
***
Gedanken ans Ersticken quälten mich. Noch Wochen nach der Diagnose wachte ich Nacht für Nacht schweißgebadet auf, mit dröhnendem Kopf, angsterfüllt durch die Schreckensvision, an meinem eigenen Schleim zu ertrinken. Albträume davon, wie Moths Hals uschwoll und er qualvoll nach Luft rang, bis er am Ende erstickte, während die Kinder und ich hilflos zusehen mussten.
***
Die Schwalben waren spät gekommen, einzeln und zu zweit, hatten nach einer gewaltigen Reise den Weg nach Hause gefunden, um von den Buchen herabzuschießen und sich an Insekten zu laben. Könnte ich doch nur eine Schwalbe sein, frei umherfliegen und nach Hause kommen, wenn mir der Sinn danach stand. Ich brach das Brot für Smotyn und ging hinaus in den frischen Junimorgen. Die Luft war weich und mild, strich über mein Gesicht mit der Verheißung eines wunderschönen Tages. Zwischen den Ästen der Wildbirnenhecke quetschte ich mich über den Zauntritt. Diese Hecke hatte ich als Sonderangebot bei einer Baumschule gekauft; eigentlich sollte es Buche sein, hatte sich aber zu einem kleinblättrigen, stacheligen Gewächs ohne Birnen entwickelt, das mich ärgerte, wann immer ich über den Zaun klettern wollte. Ich rieb mir die Kratzer auf dem Arm, zu den alten Narben waren frische hinzugekommen. Es machte keinen Sinn mehr, die Hecke jetzt noch zurückzuschneiden. Die Wiese war warm und von Honigduft erfüllt, der Klee begann gerade zu blühen. Über Nacht waren die Maulwürfe wieder aktiv gewesen, in der Mitte der Wiese erhoben sich feinkrümelige Erdhaufen. Ich trat sie flach, ganz automatisch, das Wohlergehen des Bodens, unseres Bodens, lag mir immer noch am Herzen. Moth hatte diese Wiese einem unkrautüberwucherten Fleck Erde abgerungen. Ohne Pestizide und damals auch noch ohne Maschinen hatte er das achttausend Quadratmeter große Stück Land eigenhändig mit der Sense gemäht. Hatte alles zusammengerecht und Nesseln herausgezogen. Er hatte die Umfriedung ausgebessert, sorgfältig Hunderte Steine in der Mauer ersetzt, die seit Jahrzehnten verfallen war. Es war die Wiese, auf der die Kinder der Feriengäste Eier sammelten, die noch warm vom Nest waren, und im Frühling die Lämmchen fütterten. Hier hatten wir mit der ganzen Familie endlose Cricket-Partien ausgetragen, im hohen Gras gelegen, bevor es gemäht wurde, um Heu zu machen, und die Sternschnuppen am sommerlichen Nachthimmel betrachtet. Unser Land.
Smotyn blieb aus. Sie kam immer zum Zauntritt, um sich ihre Scheibe Brot zu holen. Immer. Als ich die Wiese nach ihr absuchte, wusste ich bereits, was ich vorfinden würde. An ihrem Lieblingsplatz unter den Buchen lag sie mit dem Kopf im Gras, als ob sie schliefe. Sie hatte es gewusst. Sie hatte gewusst, dass sie ihre Wiese nicht verlassen konnte, ihr Zuhause, und war einfach gestorben. Hatte den Kopf ins Gras gelegt, die Augen geschlossen und war gestorben. Als ich ihr Fellgesicht streichelte, mit der Hand ein letztes Mal über ihr schiefes Horn strich, überkam es mich wie eine Wehe. Überwältigend und unkontrollierbar. Ich rollte mich auf dem Gras neben ihr zusammen und schluchzte. Ich weinte, bis mein Körper nicht mehr konnte, erschöpft, tränenleer, ausgedörrt durch den Verlust. Das Gras umhüllte mein Gesicht, und ich lag unter den Buchen und wollte sterben, loslassen und wie Smotyn frei sein, frei mit den Schwalben umherfliegen und nicht erdulden müssen, dass ich von hier weg musste und dass Moth ganz allmählich immer weniger wurde. Lass mich jetzt sterben, lass mich diejenige sein, die geht, lass nicht zu, dass ich allein zurückbleibe, lass mich sterben.
Ich holte den Spaten und fing an zu graben, um Smotyn neben ihren Schwestern zu beerdigen, in ihrer Wiese. Moth kam heraus, und schweigend hoben wir zusammen die Grube aus, weigerten uns zu sprechen, weigerten uns, das immer größer werdende Loch zu akzeptieren. Die Schwärze, in die wir am Tag zuvor geblickt hatten, war immer noch zu schockierend, zu neu für uns, um ihre Existenz anzuerkennen, und sei es nur als Gedanke. Ich legte ein Geschirrtuch über Smotyns Kopf; wir ertrugen es nicht mitanzusehen, wie die Erde auf ihr Gesicht fiel. Sie war von uns gegangen. Es war alles vorbei. Der Traum, der unsere Farm gewesen war, wurde mit ihr begraben.
3
EINE SEISMISCHE VERSCHIEBUNG
Nachdem wir die Tür zum letzten Mal hinter uns zugemacht hatten, blieben uns zwei Wochen, um unsere wenigen Besitztümer in der Scheune eines Freundes unterzubringen und uns zu überlegen, wie es jetzt weitergehen sollte. Die Kinder konnten uns nicht helfen; sie studierten beide noch und hatten selbst kaum genug Geld, um sich über Wasser zu halten. Moths Bruder war gerade in Urlaub und hatte uns sein Haus zur Verfügung gestellt, aber in nur zwei Wochen würde er mit seiner Familie zurückkehren, und dann würde es zu eng für alle werden, und wir mussten gehen. Obwohl unser Zuhause nur dreißig Kilometer entfernt lag, konnten wir nicht zurück. Es war die Hölle. Der Schock, unser Haus verlassen und mit der Diagnose des Arztes fertigwerden zu müssen, war noch ganz frisch, und so vergingen die ersten Tage in einem benommenen, nahezu katatonischen Zustand.
Der Logik nach sollten wir uns eine Arbeit und etwas zum Wohnen suchen. Man hatte uns ja nicht nur unser Haus weggenommen, sondern auch unseren Ferienwohnungsbetrieb und damit unser Einkommen. Wir mussten einen Job finden, der es uns ermöglichte, uns ein neues Leben aufzubauen. Aber wir waren auch mit der Tatsache konfrontiert, dass unser gemeinsames Leben vielleicht nur noch auf eine kurze Periode bei einigermaßen guter Gesundheit beschränkt sein würde, gefolgt von lähmendem Verfall und Tod. Ich konnte Moth nicht allein lassen und zur Arbeit gehen – ich musste jede kostbare Minute, in der er noch halbwegs gesund war, mit ihm verbringen. Jede Erinnerung bewahren, um sie in meine einsame Zukunft mitzunehmen.
Wie ich den Arzt hasste, der auf der Schreibtischkante gesessen und ihm seine Diagnose mitgeteilt hatte, als würde er ein Geschenk überreichen. Das Beste, was ich für Sie tun kann, Moth, ist, Ihnen eine Diagnose zu geben. Etwas Schlimmeres hätte er gar nicht tun können. Ich wünschte, er könnte es rückgängig machen und mich ohne dieses Wissen leben lassen. Ich wollte nicht jedes Mal, wenn ich Moth ansah, die schwarze Leere meiner Zukunft vor mir sehen. Wir stolperten durch jene Tage, als wären wir gerade von einem Schlachtfeld gekommen, verwundet, traumatisiert und verloren.
Dauercampen war eine Option, bis wir etwas Besseres fanden, aber das günstigste Angebot eines Campingplatzes lag bei achtzig Pfund die Woche, weit mehr, als wir uns leisten konnten, und Campinggebühren wurden nicht mit Wohngeld bezuschusst. Keiner unserer Bekannten hatte ein Zimmer übrig, oder einen Garten, den er mehr als ein paar Wochen opfern wollte. Und wir brauchten einen Ort, wo wir uns sammeln und das, was passiert war, verarbeiten konnten. Im Hochsommer gab es in den Urlaubszentren ohnehin keine verfügbaren Caravans, weil alle natürlich an zahlungskräftige Feriengäste und nicht etwa an Wohngeldempfänger vermietet wurden.
In einer idealen Welt hätten wir etwas zu mieten gefunden, aber es stellte sich schnell heraus, dass es nahezu unmöglich ist, ein Mietobjekt zu finden, wenn man gerade zwangsgeräumt wurde. Unsere Kreditwürdigkeit war im Keller. Das Wohnungsamt konnte uns auf die Warteliste setzen, wenn wir das wollten, aber unserem Fall wurde keine hohe Dringlichkeit eingeräumt, und die einzige Unterkunft, die man uns momentan anbieten konnte, war ein Zimmer in einem Bed and Breakfast, in dem hauptsächlich Menschen mit Drogen- oder Alkoholproblemen lebten. Eine junge Frau mit straff zum Pferdeschwanz zurückgebundenen dunklen Haaren saß in ihrem Büro hinter dem Schreibtisch und meinte mit starkem walisischem Akzent: »Na ja, wenn Sie nicht bald sterben, also nächstes Jahr oder so, sind Sie wohl nicht so furchtbar krank, oder? Also ist es wohl nicht so furchtbar dringend, oder?« In diesem Moment wussten wir eins sicher: Wir würden lieber ins Zelt ziehen.
Zurück im Haus von Moths Bruder spähte ich benommen aus dem Fenster, unfähig, über unser weiteres Vorgehen nachzudenken.
»Eigentlich bin ich ganz froh. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer Sozialwohnung in der Nähe unserer Farm zu leben. Das würde uns einfach kaputtmachen.« Und nicht nur das, in dieser ländlichen Gegend wären wir monatelang eine Quelle für Klatsch und Tratsch.
»Ich weiß. Auf der Farm konnten wir immer für uns sein. Auf unserer Insel.«
Das war die Farm für uns gewesen: eine Insel. Sobald wir von der Straße in den Wald abbogen, ließen wir den Rest der Welt hinter uns. Jenseits der Bäume boten sich uns Aussichten, als hätten wir eine völlig andere Welt betreten. Nach allen Seiten hin alte Feldsysteme, die Äcker durch heckenbesetzte Böschungen voneinander getrennt. Im Westen hoch aufragende Berge, die sich gen Osten erstreckten, umspielt von zarten, weichen Wolken. Ein mächtiger Bussard, der mit ausgebreiteten Schwingen in den blauen Himmel stieg und irgendwo zwischen den Baumwipfeln und den Bergen schwebte. Wenn der Wald hinter uns seine Pforte schloss, ließen wir die Straße, die Dörfer und den Lärm der Menschen zurück. Aber jetzt hatte man uns ausgesetzt, wir hatten keinen sicheren Hafen mehr, in den wir zurückkehren konnten, trieben auf einem Floß der Verzweiflung durch den Nebel, ohne zu wissen, wo wir ans Ufer kommen würden oder ob es überhaupt ein Ufer gab.
Moth stand am Fenster, ließ den Blick über den mit Ginster und Heidekraut bewachsenen Hügel schweifen. Zu Hause und doch nicht zu Hause.
»Ich glaube nicht, dass ich es ertragen kann, hier in der Gegend zu bleiben. Ich muss etwas Abstand zu Wales bekommen; es tut zu sehr weh, hierzubleiben. Wie es auf lange Sicht ist, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht einmal, wie lange mir noch bleibt, aber im Augenblick muss ich weg. Mich woanders nach einem neuen Zuhause umsehen.«
Ich holte tief Luft.
»Dann lass uns die Rucksäcke packen und unterwegs darüber nachdenken.«
»Ja, gehen wir den South West Coast Path.«
***
Mit fünfzig einen Rucksack zu packen ist nicht ganz dasselbe wie mit zwanzig. Als wir uns das letzte Mal für einen Trail gerüstet hatten, waren die Kinder noch nicht auf der Welt, Moth hatte noch lange Haare, und ich war noch gut sechs Kilo leichter. Damals hatten wir alles in die Rucksäcke gestopft, was wir glaubten, brauchen zu können, und es unbekümmert herumgeschleppt, unsere jungen Körper erholten sich schnell von der Anstrengung und von Verletzungen. Wir waren im Lake District und in Schottland wandern gegangen und hatten täglich viele Kilometer zurückgelegt, aber fast immer auf Campingplätzen übernachtet und sehr selten wild gecampt. Dreißig Jahre später hatte ich nach zwanzig Jahren körperlicher Arbeit allerlei Wehwehchen, die nie mehr ganz weggingen, sondern heimtückisch im Hintergrund lauerten. Und auch die Jahre des Kampfes in einem Gerichtsverfahren, zusammengekauert vor dem Laptop, um unsere Verteidigung auszuarbeiten, hatten mich steif werden lassen und anfällig für Muskelprobleme. Und Moth? Wie sollte er jetzt noch so viel schleppen können wie früher? Wir packten den Rucksack wie damals und luden ihn behutsam auf seinen Rücken. Ein Sechzig-Liter-Rucksack, vollgestopft mit unserem alten orangefarbenen Segeltuchzelt und zwei leicht rostigen Campingtöpfen. Zweimal um das Zimmer herum, und er sank vor Schmerz auf die Knie.
»Tu das runter. Ich schaffe es nicht.«
»Dann müssen wir uns nach einer anderen Ausrüstung umsehen. Als Erstes nach einem leichteren Zelt.«
»Das können wir uns nicht leisten.« Das meiste von dem, was wir im vergangenen Jahr verdient hatten, war in den Prozess geflossen, beziehungsweise in unseren Lebensunterhalt, während wir ihn ausfochten. Dazu zwei studierende Kinder. Ich hatte allen Feriengästen, die unsere Scheune diesen Sommer gebucht hatten, die Miete zurückerstattet, und so hatten wir nur noch dreihundertzwanzig Pfund übrig. Allerdings bekamen wir achtundvierzig Pfund die Woche in Form einer Steuergutschrift für Geringverdiener. Da Moth immer weniger in der Lage gewesen war zu arbeiten, hatten wir nur noch Einkünfte aus der Vermietung der Scheune bezogen, wodurch wir Anspruch auf eine wöchentliche staatliche Zuwendung erhielten. Selbst diese kleine Beihilfe brauchte eine Adresse, was bedeutete, dass wir in der Gegend bleiben mussten. Hierbleiben ging nicht, deshalb ließen wir die Steuergutschrift unter unserer alten Adresse laufen und die Post zu Moths Bruder nachschicken. Achtundvierzig Pfund pro Woche. Davon würden wir leben können, ganz bestimmt.
Ich las Five Hundred Mile Walkies noch einmal und überzeugte mich erneut davon, dass wir das schaffen konnten. Wenn Mark Wallington mit einem geliehenen Rucksack und einem struppigen Hund den South West Coast Path bewältigt hatte, konnten wir das auch, kein Problem. Aber es lag auf der Hand, dass wir die umgekehrte Route nehmen mussten, von Poole nach Minehead. Der erste Abschnitt von Minehead nach Padstow schien der bei Weitem anspruchsvollste zu sein, und das letzte Stück von Plymouth nach Poole das leichteste. Daher war es nur sinnvoll, es anders herum anzupacken, damit wir uns daran gewöhnen konnten, bevor die schwierigeren Abschnitte anstanden. Wir brauchten nur einen Wanderführer. Es musste einer sein, der die gesamte Strecke abdeckte, doch schnell stellte sich heraus, dass es keinen gab, der dem Weg von Süden nach Norden folgte, alle gingen von Norden nach Süden. Ich durchstöberte die Regale bei Cotswold Outdoors, aber in dem riesigen Angebot an Wanderführern gab es keinen einzigen, der die entgegengesetzte Richtung einschlug. Der arme, spindeldürre Verkäufer bekam die ganze Wucht meiner Enttäuschung ab.
»Wissen Sie, ich muss den Weg anders herum laufen, der Anfang muss leicht sein, wegen Moth. Mark Wallington war Anfang zwanzig, und sein größtes Problem war, dass von seinem Rucksack vielleicht mal eine Niete absprang.« Ich sah schon rot vor Wut und Panik und Selbstmitleid und befürchtete, dass bei mir auch gleich ein paar Nieten abspringen würden.
»Tut mir wirklich leid, Ma’am, aber es gibt keinen.« Der Verkäufer verzog sich, und ich saß da und schmollte. Wenn wir mit dem schwierigsten Stück anfangen mussten, würde Moth vielleicht nicht einmal die erste Woche überstehen. Was dann? Ich war nicht bereit, mich dem »was dann?« zu stellen; mein Verstand lief nur noch im Selbstverteidigungsmodus. Es gab nur diese Wanderung; an mehr konnte ich nicht denken, weiter als bis zu diesem Horizont konnte ich nicht blicken. Wir schauten uns Landkarten des Ordnance Survey an, aber für den gesamten Küstenpfad würden wir mehr davon brauchen, als wir uns leisten – oder tragen – konnten.
»Ray, ich werde nicht 800 Kilometer laufen und dabei einen Wanderführer rückwärts lesen. Wir fangen einfach in Minehead an, und ich gehe ganz, ganz langsam.« Moth strich mir übers Haar, aber ich wollte mich nur noch in einen Schlafsack verziehen und heulen. Jetzt bloß nicht zusammenbrechen. Du musst die Starke sein, du bist nicht diejenige, die ersticken wird. Mit den Nerven am Ende riss ich mich gerade so zusammen.
Wir mussten uns für irgendein Buch entscheiden, und bei näherer Betrachtung gab es nur eine Wahl: Paddy Dillons kleines braunes The South West Coast Path: From Minehead to South Haven Point mit seinem praktischen, wasserbeständigen Einband und einer amtlichen Karte des gesamten Pfades. Es passte so gut in meine Hand und in Moths Tasche, dass kein anderes infrage kam. Aber als wir das Buch bei einer Tasse Tee näher inspizierten, wunderten wir uns: Entweder hatte Mark sich bei seiner Wanderung mit dem Hund verzählt oder ein Stück übersehen, oder in den Jahrzehnten zwischen dem Schreiben des Buches und jetzt hatte es eine seismische Verschiebung gegeben und Cornwall reichte nun weiter in den Atlantik hinaus. Der Coast Path war nicht 500 Meilen – 800 Kilometer – lang, sondern 630, also über tausend.
***
Einen Teil der Ausrüstung mussten wir neu kaufen; das ließ sich nicht vermeiden. Die massiven Metallschnallen an Moths altem Rucksack waren verrostet, und an meinem Rucksack war die Innenbeschichtung verschlissen, sodass er nicht mehr wasserdicht war. Sie durch neue, gleich gute zu ersetzen, würde Unsummen verschlingen, mindestens 250 Pfund. Wir suchten nach einer billigeren Lösung und entschieden uns für zwei Modelle von Mountain Warehouse, die zusammen weniger kosteten als ein Rucksack einer großen Marke. Sie waren nicht mit sämtlichen Schikanen ausgerüstet, aber funktional. Um die Rucksäcke drehte sich in den folgenden Tagen alles. Wir räumten sie endlos ein und wieder aus, packten sie immer wieder neu und liefen damit im Haus herum. Es half nichts. Die Sachen, die wir mitnehmen wollten, passten nicht in die kleinen Rucksäcke.
»Nein, Ray, einen größeren kann ich nicht tragen. Probieren wir es so, wie wir es gemacht haben, als wir die Farm räumen mussten. Packen wir noch einmal neu und nehmen nur das absolut Lebensnotwendige mit. Sonst nichts. Dann schaffe ich es vielleicht.«
»Das Zelt ist zu schwer, aber wir können uns kein besseres leisten, eins, das Monate auf einer Felsklippe übersteht. Das war’s dann wohl.«
»Ebay?«
Auf das Ende einer Ebay-Auktion zu warten, um ein Zuhause für den Rest des Sommers und eventuell darüber hinaus zu erwerben, war nervenaufreibend. Drei Sekunden, zwei, eine, und es gehörte uns. Ein einmal benutztes Vango-Zelt, das drei Kilo wog, ein Viertel unseres alten Vango-Zelts, und einen Bruchteil so groß war. Wir tanzten um den Küchentisch herum; soeben hatten wir für achtunddreißig Pfund ein neues Zuhause gekauft.
Ich rief unsere Tochter Rowan an, schrecklich aufgeregt, weil ich diese kleine gute Nachricht unbedingt loswerden und die Atmosphäre zwischen uns nach zwei Wochen Trübsinn auflockern wollte. Ich wollte ihre Mum sein und alles wiedergutmachen. Ich musste wieder diese Mum werden, aber kaum ließ ich es läuten, bereute ich es bereits. Die Kinder mochten erwachsen geworden und ausgezogen sein, aber das Haus, das wir verloren hatten, war auch ihr Heim. Moth war ihr Dad, und seine Krankheit war für sie genauso schwer zu akzeptieren wie für mich. Diese Wochen veränderten das Wesen meiner Beziehung zu ihnen. Es passierten Dinge, vor denen ich sie nicht mehr beschützen konnte. Die Balance verschob sich, und das fand ich furchtbar. Ich war noch nicht bereit. Aber sie waren zwei überraschend anpassungsfähige Erwachsene – wir hatten bei ihrer Erziehung großartige Arbeit geleistet –, und sie waren bereit. Ich war diejenige, die sie immer noch vor der bösen Welt beschützen und dafür sorgen wollte, dass sie in einer Blase lebten, in der alles perfekt war. Wenn ich für sie nicht mehr diese schützende Hand war, was war ich dann? Es war das letzte Fitzelchen, das ich tief im Innern als mein »Ich« erkannte. Was war ich ohne das noch? Nichts.
»Was denkt ihr euch dabei, Mum, seid ihr verrückt? Und wenn er irgendwo abstürzt?« Rowans Stimme riss mich in die Realität zurück. »Ihr habt kein Geld, was wollt ihr essen? Habt ihr tatsächlich vor, den Rest des Sommers in einem Zelt zu verbringen? Wie soll das gehen? Dad wird irgendwann kaum noch vom Sessel hochkommen; was passiert, wenn er auf einer Klippe einen Krampfanfall hat? Wisst ihr eigentlich, was Campingplätze kosten? Habt ihr es Tom schon erzählt?«
»Ich weiß, Row. Es ist total verrückt, aber was sollen wir sonst anfangen? Wir können nicht einfach herumsitzen und auf eine Sozialwohnung warten, das sind wir nicht. Wir brauchen das; solange wir zusammen sind, geht es uns gut, mach dir keine Sorgen.«
In der stillen Leitung knisterte es.
»Ich schicke euch ein neues Handy mit einem neuen Akku. Ruft mich jeden Tag an und geht bitte immer ran, wenn ich anrufe. Und sagt es Tom.«
***
»Hallo, Tom. Dad und ich haben beschlossen, den South West Coast Path zu gehen. Es dauert mindestens zwei Monate, vielleicht auch drei.«
»Okay.«
»Es sind über tausend Kilometer, und wir werden die ganze Zeit campen müssen.«
»Wie cool.«
Unser quirliger, quicklebendiger Kleiner war inzwischen viel gechillter, als gut für ihn war, während die glitzernde Disco-Queen zu meiner Mum mutiert war.
Aber wer war ich jetzt? Wer war Moth? Würden tausend Kilometer reichen, um die Antwort darauf zu finden?
***
Drei Tage später kam das Zelt, und wir bauten es im Wohnzimmer auf: eine breite, flache grüne Kuppel, die sich auf unserem Boden wölbte wie eine Mooskappe auf einem Granitfelsen. Wir rollten unsere selbstaufblasbaren Isomatten aus und schlüpften in unsere superleichten Schlafsäcke, die wir für fünf Pfund das Stück bei Tesco gekauft hatten. Ich kochte auf dem winzigen Campingkocher eine Tasse Tee, und wir saßen im Zelteingang und sahen uns im Fernsehen eine Gartensendung an. Als wir herauswollten, konnte Moth sich nicht mehr bewegen. So sehr er sich auch anstrengte, er konnte nicht aufstehen. Ich zerrte ihn aus seinem Schlafsack und hievte ihn hoch.
»Glaubst du, Rowan hat recht? Es ist wahrscheinlich nicht das Klügste, was wir je gemacht haben.«
»Aber wann haben wir uns je für den leichten Weg entschieden?«
***
Wir packten die Rucksäcke ein allerletztes Mal, wohl wissend, dass wir, sollten wir etwas vergessen haben oder sollte etwas nicht hineinpassen, den ganzen Sommer ohne es auskommen mussten. Etwas neu zu kaufen, war nicht möglich; wir würden kein Geld erübrigen können, um unsere Ausrüstung unterwegs zu ersetzen. Wir konnten froh sein, wenn es fürs Essen reichte, zumal wir uns an der Süd- und Westküste zur Hauptferienzeit mit Lebensmitteln versorgen mussten. Neben den Rucksäcken wuchs der Stapel der Dinge, die wir mitnehmen wollten. Nie im Leben würde das alles reinpassen, aber wir versuchten es trotzdem. Nachdem ich meine Wechselkleidung eingepackt hatte, das absolute Minimum für mehrere Monate, war der Rucksack bereits zur Hälfte gefüllt. Es half alles nichts, hier konnte ich Platz sparen. Ich warf die Kleider aufs Sofa und fing noch einmal mit dem an, was ich absolut nicht entbehren konnte. Ein alter Baumwollbadeanzug, drei Schlüpfer, ein Paar Socken, ein Baumwollunterhemd, ein Paar Leggings und ein langärmeliges T-Shirt zum Schlafen. Alles, was ich gleich tragen würde, legte ich beiseite: ein zweites Paar Baumwoll-Leggings, ein kurzes Blümchenkleid aus Viskose, ein Baumwollunterhemd, ein rotes Paar Wandersocken und eine billige Fleecejacke mit Reißverschluss. Das war alles.