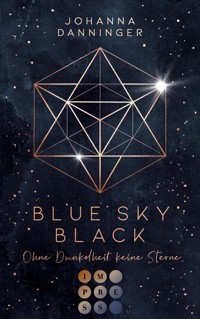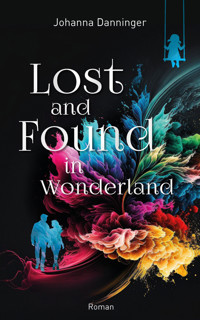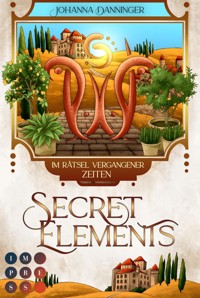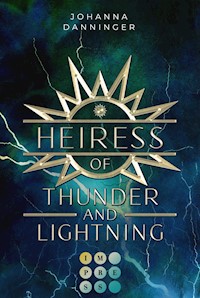11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Das Schicksal der sagenumwobenen Celestials** Seit Dee durch Zufall ein seltsames Artefakt vor die Füße gefallen ist und dadurch magische Kräfte erlangt hat, ist nichts mehr in ihrem Leben wie zuvor. Mithilfe der streng geheimen Militäreinheit Celestial Army Force versucht sie die neu erweckten Fähigkeiten in sich zu verstehen und zu kontrollieren. Einer der Soldaten ist der wortkarge, aber auch äußerst attraktive Jason, dessen Geheimnisse die schlagfertige 17-Jährige zu gern ergründen würde. Doch nicht nur er scheint etwas zu verbergen, auch in Dee schlummert etwas, das die Menschheit ins Unglück stürzen könnte … Tauche ein in die Welt der Celestials und ergründe ihre Geheimnisse … Endlich eine neue Fantasy-Reihe von Johanna Danninger, der Bestsellerautorin von »Secret Elements«! //Dies ist der Sammelband der Celestial-Legacy-Reihe von Johanna Danninger. Alle Bände der Reihe bei Impress: -- Heiress of Thunder and Lightning (Celestial Legacy 1) -- Descendant of Heat and Blaze (Celestial Legacy 2)// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
www.impressbooks.deDie Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2022 Text © Johanna Danninger, 2022 Lektorat: Julia Feldbaum Coverbild: shutterstock.com / ©Igor Petrov (188093957); ©fle-x-elf (655696063); ©S6Wigj (1929532823); ©H.Tahir Saraf (1740079208); © rahmad creative (1865909071); ©klyaksum (1690349665) Covergestaltung: formlabor ISBN 978-3-646-60841-0www.impressbooks.de
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Heiress of Thunder and Lightning (Celestial Legacy 1)
**Entfessle die tief in dir schlummernde Macht des Donners**
Die 17-jährige Dee hat für die Zeit nach der Highschool nur ein Ziel: endlich ihrem verhassten Heimatort in Nebraska zu entkommen. Doch als sie nach einer Spätschicht im Diner mitten in eine Straßenschlacht des Militärs stolpert, werden all ihre Pläne auf den Kopf gestellt. Nicht nur weckt ein seltsames Artefakt verborgene Kräfte in ihr, auch die streng geheime Militäreinheit Celestial Army Force möchte Dee rekrutieren. Dabei trifft sie auf den wortkargen Soldaten Jason, hinter dessen verschlossener Fassade mehr zu stecken scheint – und dessen Blick ihr tief unter die Haut geht …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Dasein ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten, endlich aufgeschrieben zu werden!
Als das Universum noch jung war, gebar die Sonne unserer Galaxie die sieben Götter der Schöpfung. Zusammen formten sie die Erde und hauchten ihr Leben ein. Viele Jahrtausende lang begleiteten die Götter die Entwicklung ihrer Welt und erfreuten sich vor allem an der Menschheit.
Doch allmählich wurden die Götter müde, darum gaben sie ihre Aspekte der Schöpfung an einige ausgewählte Menschen weiter, damit diese fortan das Leben auf Erden behüten konnten.
Somit waren die Celestials geboren und die Götter verschmolzen mit dem Himmel, wo sie seitdem ruhen und ihre geliebte Welt nur mehr aus weiter Ferne beobachten.
KAPITEL 1
Brütende Hitze lag über Minebrooke, Nebraska. Die Nachmittagssonne brachte den Asphalt zum Flimmern und ich fürchtete schon fast, die Reifen meines klapprigen Fahrrads könnten schmelzen, während ich durch die Kleinstadt fuhr.
Ich selbst schmolz definitiv. Meine Kellnerinnenuniform klebte mir unter meinem Rucksack eklig auf der Haut und mir standen Schweißperlen auf der Stirn. Der Fahrtwind brachte keinerlei Abkühlung mit sich. Die aufgeheizte Luft zwischen den kantigen Gebäuden der Mainstreet fühlte sich eher so an, als würde ich gegen einen riesigen Föhn anstrampeln.
Gott, ich hasste das. Für Sommerhitze war ich einfach nicht geschaffen. Ich war eher der nordische Typ – mit meinen blauen Augen und der hellen Haut. Nur dass ich nicht blond war, sondern von Natur aus rabenschwarzes Haar hatte. Was sich wiederum ganz toll machte unter der prallen Sonne, weil meine dunklen Strähnen die Strahlen hervorragend absorbierten und meinen Kopf effektiver aufheizten, als jede Föhnhaube es vermocht hätte.
In der Stadt war wenig los. Eigentlich war hier immer wenig los, doch aktuell wirkten die Straßen wie ausgestorben. Nur ein einziges Auto kam mir auf der gesamten Strecke entgegen, obwohl mein Weg mich beinahe durch die ganze Ortschaft führte. Die meisten Leute versteckten sich lieber in den klimatisierten Gebäuden oder rekelten sich am See der nahe gelegenen Kiesgrube.
Die Pedale meines Fahrrads quietschten bei jedem Tritt. Die Geräusche schienen mein Elend untermalen zu wollen, denn freiwillig hätte ich mich bei dieser Affenhitze niemals auf den Drahtesel begeben. Aber es nutzte nichts, denn ein Auto hatte ich nicht und irgendwie musste ich ja zu dem Diner kommen, in dem ich jobbte. Und der Job wiederum musste sein, damit ich nach meinem Highschool-Abschluss mein College finanzieren konnte.
Noch ein Jahr, dachte ich. Nur noch ein einziges Jahr …
Ich hasste mein Leben in Minebrooke noch sehr viel mehr als die Sommerhitze. Ich war hier geboren und aufgewachsen, doch diese Stadt war nie mein Zuhause gewesen. Sie war seit siebzehn Jahren mein Gefängnis. Nicht mehr und nicht weniger – und ich arbeitete hart dafür, diesem Knast zu entfliehen. Mit Collegebeginn würde ich die Fesseln durchtrennen, die mich hier festhielten. Würde meine Flügel ausstrecken und mir in der großen, weiten Welt einen Platz suchen, an dem ich mir das Leben aufbauen konnte, das ich mir wünschte.
Richtig. Mein Leben war praktisch ein Countrysong. Nur dass ich nicht aus der Kleinstadt rauswollte, um ein Star zu werden, sondern einfach nur einen soliden, anständig bezahlten Job brauchte, der mir eine solide, anständige Lebensführung ermöglichte. An irgendeinem Ort, meinetwegen auch wieder in einer Kleinstadt. Hauptsache, mich kannte dort niemand.
Ein Neubeginn als unbeschriebenes Blatt. Das war mein innigster Wunsch. Mein großer Traum, den ich zielstrebig verfolgte und der mich eben nun durch die zum Garofen mutierte Main Street trieb.
Die schlichten Reihenhäuser an der Hauptstraße waren in unterschiedlichen Farben gestrichen. Manche Ladenbesitzer hatten ihre Shop-Eingänge mit Blumentöpfen verschönert. Ein kleiner Park mit einem Pavillon in der Mitte markierte das Zentrum von Minebrooke. Insgesamt hätte das Städtchen hübsch aussehen können, wären die Fassadenfarben nicht schon seit Jahren ausgeblichen und die wenige Bepflanzung dürr und kraftlos geworden, weil die aktuelle Hitzewelle alles verbrannte.
Es war Anfang August und die Farmer sprachen bereits von katastrophalen Ernteausfällen. Aber das taten sie beinahe jedes Jahr, bevor sich im Herbst herausstellte, dass alles doch nicht ganz so schlimm gewesen war wie befürchtet. Die Leute hier brauchten eben ein bisschen Drama. Sonst passierte ja auch nichts, worüber man hätte reden können.
Ich warf einen Blick über die Schulter und überquerte die menschenleere Straße. Mein altes Fahrrad schepperte bedenklich, als ich schwungvoll über die Bordsteinkante rumpelte und schließlich vor einem Supermarkt anhielt. Ich wollte noch ein paar Besorgungen machen, bevor ich die Spätschicht im Diner antrat.
Mein Fahrradständer war schon vor Jahren abgebrochen, darum lehnte ich den Drahtesel an einen Laternenmast. Ich trat in den Schatten des Dachvorsprungs. Dort spiegelte ich mich in einem der großen Schaufenster des Supermarkts und nutzte die Gelegenheit, um kurz an mir herumzuzupfen.
Mein Haar war schnell gerichtet, denn mein nagelneuer kinnlanger Fransenschnitt war überaus pflegeleicht. Durch meine leichten Naturwellen drehten sich die Spitzen ganz von selbst nach außen, wodurch ein adretter Schwung entstand. Leider klebte mir der fransige Pony auf der verschwitzten Stirn, aber insgesamt konnte die Frisur sich durchaus sehen lassen.
Vor allem wenn man bedachte, dass ich sie mir aus finanziellen Gründen selbst geschnitten hatte. Ein Hoch auf das digitale Zeitalter der Tutorials und natürlich meinen Mut, denn das hätte auch gewaltig schiefgehen können. Darum hatte ich Tag X des Kurzhaarprojekts in weiser Voraussicht auf den Beginn der Sommerferien gelegt. In der Schule hatte ich bereits genug Probleme. Da brauchte ich nicht auch noch mit einer missratenen Frisur das Gespött der anderen zu provozieren.
Das Spiegelbild im Schaufenster war leicht verschwommen. Wären meine Wangen nicht von der Hitze gerötet gewesen, hätte ich mit meinem extrem hellen Teint vermutlich wie ein Geist ausgesehen. Porzellanhaut nannte man das. Oder Leichenblässe. Je nachdem, wen man fragte.
In dem schemenhaften Abbild war das Blau meiner Augen nicht gut zu erkennen. Das helle Rosa meiner Kellnerinnenuniform jedoch umso mehr. Ganz im Stil der Fünfzigerjahre mit feinen Längsstreifen und knielangem Rock. In Kombination mit meiner schneeweißen Haut natürlich der totale Albtraum, aber dagegen konnte ich nichts ausrichten.
Ich wandte mich von meinem Antlitz ab und gelangte mit wenigen Schritten zur Eingangstür des Supermarkts. Im Inneren empfing mich die wohltuende Kälte der Klimaanlage. Es war mucksmäuschenstill. Nicht einmal das Radio lief. An einer der insgesamt drei Kassen saß Mrs Norton und blickte gelangweilt von ihrer Zeitschrift auf. Ich schien aktuell die einzige Kundin zu sein. Zumindest konnte ich auf die Schnelle niemand anderen sehen oder hören.
Mrs Norton arbeitete schon hier, seit ich denken konnte. Und ebenso lange begegnete sie mir bereits mit dem gleichen argwöhnischen Gesichtsausdruck, den sie jetzt auch an den Tag legte. Jedes verdammte Mal, obwohl ich noch nie etwas getan hatte, womit ich diesen Argwohn verdient hätte.
Okay. Einmal war mir versehentlich ein Marmeladenglas auf den Boden gefallen. Aber ich hatte die Sauerei eigenhändig beseitigt und die Marmelade bezahlt. Ohne Aufforderung. Ich fand, das war ein durchaus lobenswertes Verhalten.
Mrs Norton war offensichtlich anderer Meinung, denn die gleiche Miene hätte sie vermutlich auch aufgelegt, wenn gerade eine Gruppe randalierender Kids eingetreten wäre.
»Hi, Mrs Norton«, grüßte ich trotzdem freundlich, so wie ich es immer tat.
Sie nickte nur knapp und wandte sich wieder ihrer Zeitschrift zu.
Dumme Kuh. War nicht einmal zu einem Mindestmaß an Höflichkeit fähig, aber mich wie eine Aussätzige behandeln.
Ich schnappte mir einen Einkaufskorb vom Stapel und trat in den ersten Gang. Die Fläche des Verkaufsraums war eigentlich zu klein für die Fülle des Angebots, darum standen die hohen Regale sehr eng beieinander. Stellenweise waren noch Wagen mit reduzierten Waren in den Fluren geparkt, sodass kaum noch ein Durchkommen war oder sich gar eine Sackgasse formte.
Zielstrebig wanderte ich im Zickzack durch den vertrauten Laden und klaubte meine Einkäufe in den Korb. Es war so still, dass ich selbst im hinteren Teil noch das leise Knistern der Magazinseiten hören konnte, wenn Mrs Norton vorn umblätterte. Dementsprechend laut erklangen auch meine eigenen Bewegungen.
Ich spazierte zu den Regalen mit den Drogerieartikeln. Ich musste bis nach ganz hinten durchgehen, weil sich dort mein überlebenswichtiger Sunblocker befand. Oder befinden sollte, denn in dem gewohnten Fach zeigte sich gähnende Leere.
Missmutig schürzte ich die Lippen, weil ich nun zu den deutlich teureren Produkten greifen musste. Oder sollte ich Mrs Norton fragen, ob sich noch etwas im Lager befand? Lieber nicht. Je weniger ich mit ihrem argwöhnischen Blick konfrontiert wurde, desto besser für mich. Das regte mich nur wieder auf, wo ich doch ohnehin nichts daran ändern konnte.
Als ich gerade die Hand nach einer quietschgelben Flasche ausstreckte, hörte ich die Ladentür aufgehen. Albernes Gekicher erklang. Ein Mädchen sagte etwas, woraufhin das Gegacker noch mehr anschwoll.
Ich erstarrte augenblicklich zur Salzsäule, denn diese Stimme würde ich überall erkennen.
Stacy Cooper. Meine Mitschülerin und ungekrönte Königin der Highschool inklusive hirnverbranntem Gefolge. Genau die Gruppe Weiber, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, mir die Schule zur Hölle zu machen.
Nun, eigentlich hatte es sich nur Stacy zum Ziel gesetzt, doch ihr persönlicher Hofstaat besaß keinen eigenen Willen, darum taten diese Mädels es ihr eben gleich.
Verdammt!
Hektisch sah ich zu dem Gitterwagen, der mir aktuell den Fluchtweg versperrte. Es war zu spät, um die Bremsen zu lösen und ihn einfach wegzuschieben, denn das Getrappel diverser Sommerschühchen auf dem Hauptflur war schon auf Höhe meiner Regalreihe angekommen. Ich konnte nur hoffen, dass der Schwarm an mir vorbeitrieb, ohne mich zu bemerken. Da die Make-up-Artikel in dem Gang hinter mir waren, standen meine Chancen recht gut.
Ich hielt also ganz still, stierte die Cremeflaschen vor mir an und versuchte möglichst gut mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Wie ein Chamäleon. Oder wie ein Opossum, das sich angesichts seines Feindes tot stellte.
Darauf war ich ganz sicher nicht stolz, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es das Beste für mich war, Stacy Cooper aus dem Weg zu gehen. Ich hatte diverse Strategien im Umgang mit dieser gehässigen Ziege ausprobiert. Mit eher mäßigem Erfolg, denn ich war weder verbal noch physisch besonders schlagfertig. Darum wusste ich, dass keine Konfrontation eben die einzig wahre Lösung für mein Problem war.
Als die quasselnde Gruppe schließlich auf direktem Wege in meinen Gang einbog, wäre ich tatsächlich fast vor Schreck wie ein Opossum umgefallen.
Stocksteif stand ich mit klopfendem Herzen da, während ich im Augenwinkel fünf Teenager-Mädels näher kommen sah. Selbst in meinem eingeschränkten Sichtfeld erkannte ich, dass Stacy inmitten des Pulks nicht wirklich mit den hohen Absätzen ihrer Sandalen klarkam. Sie stakste daher wie eine Idiotin in ihren knappen Hotpants und mit ihrem hohen Pferdeschwanz, der durch ihre abgehackten Schritte wild hin- und herschwang, als würde sie mit ihrem hellbraunen Schopf tatsächlich Fliegen verscheuchen.
Die Clique blieb ungefähr in der Hälfte des Flurs stehen und versammelte sich vor einem Regal. Mein Tarnmodus schien interessanterweise zu funktionieren, denn obwohl uns nur ein paar Meter trennten, hatte mich keine bemerkt. Damit das auch so blieb, wagte ich kaum mehr zu atmen, während ich angespannt ausharrte.
»Welche soll ich denn nehmen, Stacy?«, fragte Debbie Morgan verunsichert.
Debbie war eigentlich immer verunsichert. Sie war der Inbegriff einer Mitläuferin, die nie gelernt hatte sich eine eigene Meinung zu bilden, weil sie zeit ihres Lebens im Schatten der Stärkeren herumschlich. Sie verbog sich lieber, bis sie sich das Kreuz brach, anstatt sich aufzurichten und ihren eigenen Weg zu gehen. Denn solange sie hinter der Königin blieb, konnte sie ja nicht in deren Fokus geraten.
Feige Kuh.
Dachte diejenige, die in Toter-Mann-Stellung vor den Sunblockern verharrte …
Ich presste die Lippen zusammen und blieb trotz dieser beschämenden Selbsterkenntnis in meiner Starre. Mein Selbsterhaltungstrieb war aktuell einfach größer als mein Mut.
»Also«, setzte Stacy mit gewichtiger Stimme zu einer Antwort an. »Ich kann dir auf jeden Fall die Gefühlsechten empfehlen. Vergiss den ganzen Noppen- und Rillenkram. Das braucht es nicht, wenn er einigermaßen weiß, was er tut.«
Alles klar, daher das wilde Gegacker beim Betreten des Ladens. Debbie plante das große Ereignis, das jeder jungen Frau früher oder später bevorstand. Welch ein Glück sie doch hatte, sich von Stacy beraten lassen zu können, die sich zweifellos erhaben in ihrer Rolle als Sexguru fühlte.
»Und wenn er es nicht weiß?«, hakte Debbie nervös nach.
»Ach, das weiß er bestimmt«, tat Stacy ab. »Er ist ein paar Jahre älter als du und viel erfahrener. Darum habe ich dir ja empfohlen, es beim ersten Mal auf keinen Fall mit einem der Jungs aus unserer Schule zu machen. Wenn es gut sein soll, brauchst du einen Mann. Keinen pickeligen Teenager, der schon abfeuert, bevor er überhaupt drin ist.«
Der gesamte Hofstaat gackerte über ihren derben Scherz. Debbies Lachen klang ein wenig hysterisch. »Nee, das brauch ich echt nicht.«
»Genau. Hier, nimm die Packung hier. Und keine Sorge, es wird bestimmt super. Immerhin ist er nicht nur ein Mann, sondern auch noch ein GI. Die wissen ganz genau, wo’s langgeht.«
Erneut erschallte kollektives Gegacker.
Ich hingegen runzelte skeptisch die Stirn. Das US-Militär unterhielt in der Nähe von Minebrooke einen Ausbildungsstützpunkt. Die jungen Männer aus Fort Ridge hatten bei ihren Ausgängen an den Wochenenden schon so manches Mädchenherz im Sturm erobert. Und ebenso schnell wieder gebrochen. Im Grunde war es bereits seit Jahren Tradition, dass sich die Mädels der oberen Jahrgangsstufen regelmäßig auf der Schultoilette die Augen ausheulten, weil wieder mal irgendwelche Versprechen nicht eingehalten worden waren. Ich hatte nie verstanden, warum die älteren Schülerinnen immer wieder den gleichen Fehler begingen, wo diese Gefahr doch ständig eindrucksvoll in der Mädchentoilette widerhallte. Jetzt wo ich in ebenjenem Alter angekommen war, verstand ich es erst recht nicht.
Dass Stacy ihre Freundin nun regelrecht in ihr Verderben drängte, war nicht nachvollziehbar. Zumal es mir nicht so vorkam, als wäre Debbie wirklich überzeugt von ihrem Vorhaben. Ich vermutete, dass es sich um einen klassischen Fall von Gruppenzwang handelte. Debbie war zumindest genau der Typ dafür.
Tja, sollte nicht mein Problem sein. Ich hatte genug mit meinen eigenen zu tun.
»Jetzt holen wir dir noch einen passenden Lippenstift«, befahl die Königin.
Die Gruppe schickte sich zum Gehen an. Innerlich atmete ich bereits erleichtert auf. Da war ich ja ausnahmsweise mal glimpflich davongekommen.
»Na, sieh sich das einer an«, säuselte Stacy da lauernd. »Delilah Porter.«
Shit …
Ich zuckte zusammen, als hätte sie mich gerade angeschrien. Gleich darauf straffte ich meine Gestalt und warf der Clique einen Blick zu. »Hey, Leute.«
Nach meinem unverbindlichen Gruß wandte ich mich wieder den Sunblockern zu, nahm eine Flasche heraus und studierte eingehend das Etikett.
Natürlich war es damit nicht getan. Ich spürte, wie Stacys Blick sich in mich hineinbohrte, bevor sie fragte: »Was ist mit deinen Haaren passiert? Musstest du dir einen Kaugummi rausschneiden?«
»Ich wollte was Neues ausprobieren«, erwiderte ich mit gezwungener Ruhe.
»Das ist ja wohl schiefgegangen. Sieht total beschissen aus.«
Der Hofstaat kicherte.
Ich legte bedächtig meinen Sunblocker in den Einkaufskorb und wandte mich zum Gehen. Direkt auf die Gruppe zu, obwohl ich viel lieber über den Gitterwagen auf der anderen Seite gesprungen wäre.
Ich hielt es für klüger, den gehässigen Kommentar einfach zu ignorieren, und wahrte eine ausdruckslose Miene, bis ich bei ihnen angekommen war. »Darf ich mal vorbei?«
Die Clique tat nichts dergleichen. Debbie trat sogar einen winzigen Schritt zur Seite, um eine kleine Lücke zu schließen, durch die ich sowieso nicht gepasst hätte.
Meine Knie zitterten bedenklich, während Stacy mich mit überheblichem Blick musterte und sich offenkundig weitere Beleidigungen zurechtlegte. Nicht zum ersten Mal keimte der Drang in mir auf, ihr einfach das dumme Gesicht zu zerkratzen. Aber ich wusste, dass der Schuss nur nach hinten losgehen würde. Unter anderem weil ihre Fingernägel bedeutend länger waren als meine.
»Du arbeitest also immer noch im Diner?«, fragte Stacy.
Welch intelligente Schlussfolgerung, dachte ich zynisch. »Ja.«
»Was verdient man denn dort so in einer Stunde?«
Mir war nicht klar, wo das nun hinführen sollte, doch dem lauernden Tonfall nach zu nichts Gutem. Weil Stacy mich abwartend ansah, zwang ich mich zu einer einigermaßen neutralen Gegenfrage: »Suchst du einen Ferienjob, oder warum fragst du?«
Sie lachte abschätzig. »Sicher nicht. Und wenn, dann würde ich etwas Würdevolleres auswählen.«
Klar. Weil Bedienung ja bekanntlich so ein unehrenhafter Job war.
Meine Finger krallten sich fest um den Griff des Einkaufskorbs, während ich diverse scharfe Erwiderungen hinunterschluckte und dünn lächelte. »Verstehe. Könnt ihr mich jetzt bitte vorbeilassen?«
Konnten sie nicht, denn Stacy war noch nicht fertig mit mir.
»Ich wundere mich nur, dass du in einem Diner buckelst«, sagte sie bedächtig. »Immerhin gäbe es für dich doch einen viel lukrativeren Job. Oder will deine Mom ihre Kundenliste nicht herausrücken?«
Ein schmerzhafter Stich fuhr durch meinen Brustkorb. Ich starrte Stacy bebend an. »Meine Mutter ist keine Prostituierte.«
»Nein? Sag bloß, sie nimmt nicht mal Geld dafür, dass sie für halb Minebrooke die Beine breitmacht.«
»Das ist nicht wahr«, zischte ich.
»Ach so? Dann nimmt sie also doch Geld dafür?«
Meine Fingerspitzen zuckten, weil ich ihr abermals dieses bescheuerte Grinsen aus dem Gesicht kratzen wollte. Gleichzeitig suchte ich nach einer gepfefferten Antwort, aber ich fand keine. Und dazu stiegen mir auch noch Tränen der Wut spürbar in die Augen. Ein Anblick, den ich Stacy auf gar keinen Fall gönnte.
Ich fragte nicht noch einmal, ob sie mir den Weg freimachen könnten. Ich sagte einfach gar nichts mehr, senkte den Kopf und drängte mich durch den gackernden Hofstaat.
Das hämische Gelächter hallte durch den ganzen Laden, als ich mit aufeinandergepressten Zähnen an die Kasse zu Mrs Norton trat und meine Einkäufe aufs Band legte. Sie musste alles ganz genau mit angehört haben, doch sie blickte nicht einmal zu mir auf. Nur in meinen Rucksack wollte sie hineinsehen. Das wollte sie immer. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nichts geklaut, ganz im Gegensatz zu meinen Mitschülern, aber für Minebrooke zählte das nicht. Es zählte nur, dass ich war, wer ich eben nun mal war.
Die Tochter von Susan Porter.
Meine Mom war gemeinhin als Alkoholikerin bekannt. Dazu kam noch, dass sie alleinstehend, gut aussehend und bei ihren zahlreichen Abenden im Pub als leicht zu haben galt, was ihr zudem den Status der Stadtschlampe einbrachte.
Ich hasste es, dem Ruf meiner Mutter nicht viel entgegensetzen zu können. Fakt war, dass sie eine schreckliche Person war, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekam. Lieber suhlte sie sich in Selbstmitleid und ertränkte ihr elendiges Leben in Alkohol, anstatt sich um sich selbst zu kümmern. Oder um mich.
Erziehung im allgemeinen Sinne kannte ich nicht. Fürsorge erst recht nicht. Im Grunde hatte ich mich selbst großgezogen und es grenzte an ein Wunder, dass ich trotzdem nicht auf die schiefe Bahn geraten war, so wie die Minebrooker es gern gesehen hätten.
Mit zittrigen Fingern stopfte ich meine Einkäufe in den Rucksack, bezahlte und verließ ohne ein Wort des Abschieds den Laden. Die Nachmittagshitze empfing mich wie eine sengende Wand. Trotzdem war die Hitze in meinem Inneren noch sehr viel größer.
Ich war wütend. Auf alles und jeden. Doch vor allem auf mich selbst, dass ich nicht eine einzige schlagfertige Antwort zustande gebracht hatte. Aber was hätte das denn geändert? Absolut gar nichts. Es hätte die Konfrontation nur in die Länge gezogen und letztlich wäre ich dann trotzdem mit tränennassen Augen abgehauen.
Verbittert wischte ich mir übers Gesicht und schwang mich auf mein rostiges Fahrrad. Hart trat ich in die Pedale. Das trieb mir zwar innerhalb von Sekunden erneut den Schweiß auf den Rücken, aber es half mir auch mich abzureagieren.
Stacy war es nicht wert, mich aufzuregen. Sie war doch eh nur eine Provinzkuh, die nie aus Minebrooke herauskommen würde und ihre frustrierende Ehe bis an ihr Lebensende mit Klatsch und Tratsch über andere frustrierende Ehen aufbessern würde. Sie hatte nicht einen einzigen meiner Gedanken verdient und ihre Meinung war sowieso einen Scheiß wert.
Nur noch ein Jahr, hallte mein inneres Mantra durch meinen Kopf.
Minebrooke war nicht sonderlich groß und weil ich wie besessen in die Pedale trat, erreichte ich das Diner innerhalb weniger Minuten. Es befand sich am Stadtrand, umgeben von schmucklosen Lagerhallen und kleineren Gewerbebauten. Verschwitzt und außer Atem rollte ich auf den Parkplatz, fuhr zur Hinterseite und sprang im Schatten des kastenförmigen Gebäudes vom Fahrrad. Ich lehnte es wie immer an einen der großen Müllcontainer, bevor ich mir den Rucksack abschüttelte.
Nur wenige Meter neben mir donnerte ein Truck über den Highway. Es war die einzige Bundesstraße, die Minebrooke tangierte. Von daher nicht der schlechteste Ort für ein Schnellrestaurant.
Ich wandte mich zum Hintereingang und zupfte unterwegs an mir herum, um nicht direkt wie eine Aussätzige im Diner aufzuschlagen. Die Uniform klebte mir eklig am Rücken, doch die Klimaanlage im Inneren würde das schnell wieder regeln.
Nachdem mein Spiegelbild nicht mehr aussah, als wäre ich direkt einem Windkanal entstiegen, drückte ich schließlich die Tür auf und betrat den unbeleuchteten Flur dahinter. Sofort legte sich die wohltuende Frische der gekühlten Luft um mich. Der eindringliche Geruch nach Frittierfett war nicht ganz so angenehm, aber erfahrungsgemäß würde ich den in ein paar Minuten gar nicht mehr wahrnehmen.
Ich ging in den winzigen Personalraum, schob meinen Rucksack in den Spind und band mir eine frische Schürze um. Sie war schneeweiß, mit albernen Rüschen an den Rändern, um den Retrostyle des Diners zu wahren. Aber darüber wollte ich mich nicht beschweren, solange wir nicht auf Rollschuhen herumsausen mussten. Ein Gedanke, den mein Chef tatsächlich erst kürzlich an den Tag gelegt hatte, was von der Belegschaft Gott sei Dank schnell abgeschmettert worden war.
Abschließend pinnte ich mir mein silbernes Namensschildchen an die Brust, trat zurück in den Flur und gelangte mit wenigen Schritten in die Küche. Carlos, unser betagter Koch, stand an einer der Edelstahlarbeitsflächen und schälte Zwiebeln. Dabei summte er vergnügt vor sich hin. Das machte er eigentlich immer. Das Gesumme war so etwas wie sein Markenzeichen.
Wir wechselten ein paar Worte auf Spanisch. Carlos war unserer Sprache durchaus mächtig, doch der gebürtige Mexikaner sah es als seine Pflicht an, mir zu einem guten Abschluss in Spanisch zu verhelfen, indem wir uns ausschließlich in seiner Landessprache unterhielten. Ich war durchaus dankbar dafür, doch da sich unsere Dialoge vorwiegend auf die Arbeit bezogen, blieben meine Noten weiterhin eher durchschnittlich. In den Tests wurde eben nur bedingt abgefragt, wie man Cheeseburger ohne Gürkchen auf Spanisch orderte.
Durch eine Schwingtür gelangte ich hinter den Tresen des Gastraums. Jeder Zentimeter des Diners erfüllte das Klischee eines amerikanischen Schnellrestaurants. Angefangen bei der langen Bar mit den runden Hockern über die kunstlederüberzogenen Sitzbänke der Vierertische und die Bodenkacheln im Schachbrettmuster bis hin zu meiner Kollegin Alice, die gerade einem Mann am Tresen Kaffee nachgoss.
Alice war tatsächlich der Inbegriff einer Diner-Bedienung. Sie war Mitte fünfzig, trug ihr braunes Haar stets in der gleichen Hochsteckfrisur und hatte einen imposanten Busen, der ihr mütterliches Gemüt wunderbar untermalte. Genau wie ihre Angewohnheit, jeden mit »Schätzchen« anzusprechen. Wenn sie richtig gut drauf war, benutzte sie auch mal »Darling«. Jedenfalls war sie die Art von Kellnerin, die jedem Gast problemlos das Gefühl vermittelte, zu Hause bei Mama am Tisch zu sitzen.
»Hey, Alice.« Ich trat zur Kasse und nahm einen leeren Geldbeutel aus der Schublade darunter. »Sorry, ich bin ein wenig spät dran.«
»Und trotzdem noch pünktlich. Wie immer, Schätzchen.«
Streng genommen war ich eine Minute zu spät, aber die gutmütige Alice hätte auch nichts gesagt, wäre es eine halbe Stunde gewesen. Zumal ohnehin nichts los war, was zu dieser Uhrzeit der Normalität entsprach. Der große Ansturm würde erst später kommen und selbst das konnte man an den meisten Tagen eher als laues Lüftchen bezeichnen, das zu zweit locker zu bewältigen war.
Wirklich stressig war meine Arbeit selten. Was schade war, denn dementsprechend langsam kroch die Zeit dahin. Außerdem bedeutete weniger Kundschaft auch weniger Trinkgeld und bei meinem lächerlichen Stundenlohn war ich genau darauf angewiesen.
Schon nach kurzer Zeit war die aufwühlende Begegnung im Supermarkt fast vergessen. Das Diner war einer der wenigen Orte, an denen ich mich einigermaßen wohlfühlte. Das lag hauptsächlich daran, dass ich hier akzeptiert wurde. Obwohl all meine Kollegen wussten, wessen Tochter ich war, behandelten sie mich durchweg anständig. Alice hatte ihre Gluckenflügel gleich am ersten Tag über mich ausgebreitet und die wenigen abwertenden Meinungen, von denen ich mitbekommen hatte, im Keim erstickt. Danach hatte ich mich durch viel Fleiß, Pünktlichkeit und notorische Freundlichkeit als allseits beliebte Mitarbeiterin etablieren können.
Im Radio lief ein beliebter Rock-’n’-Roll-Klassiker und ich nickte zum Takt der Musik, während ich im Kassensystem eine bezahlte Rechnung quittierte. Geübt flogen meine Finger über die Tasten und aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass die Vordertüren aufglitten.
Zwei junge Soldaten kamen herein. Die beiden waren nicht viel älter als ich und gehörten vermutlich zu den neueren Rekruten aus Fort Ridge. Sie waren also genau von dem Format, dem die Mädels meiner Jahrgangsstufe reihenweise zum Opfer fielen.
Ich musterte die beiden unauffällig. Der eine war sehr groß und gertenschlank. Die Military-Cap verdeckte einen Großteil seiner kurz geschorenen Haare. Der Namensaufnäher an seiner Uniformjacke nannte ihn in Großbuchstaben Swanson. Vorname oder Rang waren nicht darauf vermerkt. Auf der anderen Brustseite war nur US Army eingestickt.
Sein Kumpane – oder wie auch immer man das nannte – war ein wenig kleiner, überragte mich aber vermutlich trotzdem um fast einen ganzen Kopf. MacElroi stand auf seiner Jacke. Seine breiten Schultern sprachen von ausgedehntem Training und ließen unschwer erahnen, dass sich ein recht ansehnlicher Körperbau unter der Camouflage seiner Uniform verbarg.
Bestimmt ebenso ansehnlich wie sein Gesicht, das vom Schatten eines Dreitagebarts geziert war. Die Stoppel betonten hervorragend den eleganten Schwung seiner Wangenknochen. Braunes Haar lugte unter seiner Cap hervor. Seine Augen waren von einem solch hellen Blau, dass ich die Farbe selbst auf die Entfernung erkennen konnte.
Was vermutlich daran lag, dass ich MacElroi gerade angaffte wie eine Vollidiotin. Zum Glück ertappte ich mich selbst dabei, bevor er es bemerkte.
Hastig senkte ich den Blick wieder zur Kasse vor mir, um den Registriervorgang abzuschließen. Dabei dachte ich bei mir, dass ich doch auch irgendwie verstehen konnte, warum meine Mitschülerinnen so auf die Soldaten flogen. Dieses Auftreten in Uniform hatte schon was. Vermutlich sprach das die verbliebenen Instinkte der Urzeitfrau an, die unbewusst nach einem Krieger Ausschau hielt, der das Feuer in der Höhle zu verteidigen wusste. Oder so was in der Art.
Jedenfalls musste ich Stacy zu meiner Schande ausnahmsweise mal recht geben. Die Jungs an meiner Schule konnten mit diesen Rekruten definitiv nicht mithalten. Es lagen zwar nur wenige Jahre Altersunterschied dazwischen, doch das dort waren zweifellos junge Männer, während meine Mitschüler noch pubertierende Kerle auf dem Weg dorthin waren.
»Ich fasse es nicht«, murrte MacElroi kopfschüttelnd. »Redcliff wird uns die Hölle heißmachen, wenn wir zu spät kommen. Nur wegen eines Cheeseburgers.«
Swanson schnalzte tadelnd mit der Zunge. »Nicht nur irgendein Cheeseburger. Angeblich der beste der ganzen Stadt. Diese Behauptung muss ich natürlich überprüfen.«
»Das hättest du auch beim nächsten Ausgang tun können.«
»O nein, solche Testläufe dulden keinen Aufschub«, erwiderte Swanson vergnügt und trat an den Tresen. »Außerdem sollte man generell jede Gelegenheit am Schopf packen, die einem das Leben bietet. Selbst wenn es nur ein Cheeseburger ist.«
Alice hatte den beiden offen entgegengeblickt und schmunzelte selbstbewusst in ihrer gewohnter Diner-Manier. »Ganz recht, Schätzchen. Vor allem wenn die Gerüchte ausnahmsweise mal wahr sind und es sich tatsächlich um den besten Cheeseburger der Stadt handelt.«
»Hört, hört.« Swanson bedachte MacElroi mit einem überlegenen Blick, den dieser nur mit einem genervten Augenrollen quittierte. Unbeeindruckt davon drehte Swanson sich wieder zu Alice, stützte sich lässig mit den Unterarmen am Tresen ab und lächelte breit. »Nun, Lady, ich hoffe, Sie spielen gerade nicht leichtfertig mit den Erwartungen eines kleinen, hungrigen Mannes.«
»So klein bist du doch gar nicht, Süßer.«
Meine Mundwinkel zuckten amüsiert. Um von Alice »Süßer« genannt zu werden, musste man ihr schon besonders sympathisch sein. Swanson hatte sich diesen Titel mit wenigen Worten verdient. Vielleicht hatte er damit sogar einen Rekord aufgestellt. Verstehen konnte ich es jedenfalls, denn dieser Swanson hatte eine ungemein sonnige Ausstrahlung, die man einfach mögen musste.
Ganz im Gegensatz zu MacElroi, der mit verschränkten Armen im Hintergrund wartete und keinen Hehl daraus machte, dass die kleine Flirterei nur noch mehr kostbare Zeit vergeudete. Seine aufrechte Körperhaltung, gepaart mit den geschmeidigen Wölbungen seiner angespannten Oberarmmuskeln, war ziemlich beeindruckend. Außerdem schaute er so finster drein, dass sogar ich nervös wurde, obwohl ich gar nicht in das Gespräch involviert war.
Ich erschrak, als MacElrois Augen plötzlich zu mir zuckten. Nun hatte er mich doch beim Starren erwischt. Hastig sah ich weg und fragte mich, wann ich eigentlich mitten in der Bewegung innegehalten hatte, um ihn wieder anzuglotzen. Meine Hand schwebte sogar noch über den Tasten.
Mein Gott. Offenkundig war ich keinen Deut besser als meine Mitschülerinnen. Peinlich, echt.
Während ich mich zusammenriss, führten Swanson und Alice ihr lockeres Tresengeplänkel fort.
»Ich mag hochgewachsen sein«, sagte er dramatisch, »aber im Inneren bin ich ein sensibles Kerlchen. Also, liebe Alice, brechen Sie mir ja nicht das Herz.«
»Das würde ich im Traum nicht wagen. Was genau darf ich dir denn nun einpacken, Süßer? Nur einen Cheeseburger?«
»Guter Einwand. Ich nehme wohl besser gleich zwei mit.«
»Eine kluge Entscheidung.« Alice rief die Bestellung durch die Küchendurchreiche zu Carlos. »Delilah? Kannst du bitte kassieren? Ich geh Carlos kurz zur Hand, damit’s schneller geht. Der Hübsche da hinten scheint es ja recht eilig zu haben.«
Swanson lachte auf, während MacElroi nur noch grimmiger dreinblickte. »Sehr umsichtig, Alice, vielen Dank. Aber keine Sorge. Der Hübsche neigt zur Übertreibung und soll sich lieber mal entspannen.«
Alice grinste und verschwand trotzdem in der Küche. Unterdessen tippte ich die zwei Cheeseburger in die Kasse ein und sah erst auf, als Swanson bereits vor mir stand. Der Kerl war echt riesig und ich musste den Kopf in den Nacken legen, um ihm überhaupt in die Augen sehen zu können.
»Hi«, sagte er lächelnd.
»Hi«, erwiderte ich knapp. Er war zweifellos sympathisch, aber dass ich so weit zu ihm hochblicken musste, beunruhigte mich dann doch irgendwie. »Vier Dollar zwanzig.«
Er reichte mir einen Geldschein. Ich spürte, dass er mich eingehend musterte, während ich mit wachsender Nervosität das Wechselgeld herauszählte und ihm anschließend hinhielt. Weil er nicht gleich danach griff, blickte ich erneut zu ihm auf.
»Wow«, staunte er. »Du hast echt große Augen.«
Bitte was?
Ich blinzelte überfordert, weil ich keine Ahnung hatte, was ich mit dieser Aussage anfangen sollte. Wie eine Anmache hatte es jedenfalls nicht geklungen. Eher wie eine bloße Feststellung. Da ich aber nicht sehr erfahren in Sachen Flirt war, könnte ich mich auch irren. Obwohl ich mir durchaus im Klaren darüber war, dass man normalerweise die Schönheit der Augen ansprach und nicht deren Größe.
»Äh«, bekam ich schließlich heraus. »Danke?«
Swanson schmunzelte und zupfte nur die Scheine aus meinen Fingern. »Gern geschehen. Aber dir hat doch sicher schon mal jemand gesagt, dass du besondere Augen hast.«
Besondere Augen oder besonders große Augen? Darin lag schließlich ein kleiner Unterschied. Oder? Gütiger Himmel, wo blieb Alice denn so lange?
Ich räusperte mich verlegen. »Tja, also die Größe meiner Augen hat zuvor noch nie jemand kommentiert.«
»Wirklich nicht?« Swanson legte überrascht den Kopf schief. »Dabei fällt einem doch sofort auf, dass du die Augen einer Mangaprinzessin hast. Ist dir doch auch gleich aufgefallen, oder, Jason?«
Damit war MacElroi gemeint, der mich kurz anschaute und dann genervt mit den Schultern zuckte. »Kann schon sein.«
Eine Mangaprinzessin? Man hatte mich im Laufe meines Lebens schon als vieles bezeichnet, aber das hörte ich zum ersten Mal. Da ich nicht sehr viel über japanische Comics wusste, war ich nicht sicher, ob ich mich nun geschmeichelt oder beleidigt fühlen sollte. Swanson wirkte allerdings nicht so, als hätte er mich damit kränken wollen.
Weil ich nicht den blassesten Schimmer hatte, wie ich darauf reagieren sollte, hielt ich ihm nur auffordernd die Münzen seines Wechselgelds hin. Er schüttelte jedoch mit freundlichem Lächeln den Kopf. »Für eure Trinkgeldkasse.«
»Danke«, murmelte ich und zog meine Hand zurück.
Da kam endlich Alice mit den eingepackten Cheeseburgern aus der Küche. Sofort glitt Swansons Aufmerksamkeit von mir ab, was mir die Gelegenheit gab, mich mit einem tiefen Atemzug zu sammeln. Dabei kreuzte sich zufällig mein Blick mit Jasons. Nur für den Bruchteil einer Sekunde, bevor er auch schon wieder ungeduldig zu Swanson sah, der munter mit Alice schäkerte. Meine großen Augen schienen ihn nicht weiter zu interessieren.
Ich war immer noch verwirrt, als Swanson sich schließlich zum Gruß an die Cap tippte. »Schönen Tag noch, die Damen. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder.«
»Na, das will ich hoffen, Süßer«, erwiderte Alice augenzwinkernd.
Mein schlichtes »Tschüss« klang natürlich bei Weitem nicht so souverän. Wahrscheinlich hörten die beiden es gar nicht mehr, denn Jason MacElroi war bereits zur Tür gestürmt, da hatte Swanson noch nicht einmal die Hälfte der Strecke überwunden.
»Verdammt, Danny!«, herrschte Jason ihn aus dem Rahmen der Schiebetür heraus an. »Du willst unbedingt Ärger mit Redcliff, oder?«
»Jetzt bleib mal locker«, antwortete Swanson tiefenentspannt. »Der soll nicht …«
Den Rest hörte ich nicht mehr, weil sich die Glastüren surrend hinter ihnen schlossen.
Neben mir stieß Alice einen verträumten Seufzer aus. »Hach, nur noch einmal jung sein.«
»Hm«, machte ich nur und dachte bei mir, dass ich diesen Satz garantiert niemals aussprechen würde.
KAPITEL 2
Obwohl ich im Schatten meines Lieblingsbaumes im kühlen Gras saß, trieb mir die Hitze schon wieder Schweißperlen auf die Stirn. Ich seufzte schwer und ließ den Blick über die Getreidefelder schweifen, die mich umgaben. Die üblichen Grillenschwärme zwischen den Halmen veranstalteten einen Mordslärm. Das Gezirpe übertönte problemlos die Motorengeräusche der nahe gelegenen Kiesgrube.
Direkt vor mir konnte ich über den goldbraunen Ähren die Dächer einer kleinen Siedlung am Stadtrand erkennen. Das Slumviertel von Minebrooke. Triste Bungalows mit spröden Holzfassaden und windschiefen Verandadächern, die nur selten dicht waren, umrahmt von ausgedörrten Gärten, in denen eine beeindruckende Vielfalt von Disteln wuchs.
Einwohnerzahl: vierzehn. Mich eingeschlossen.
Mein Handy vibrierte in meiner Hosentasche. Ich zog es heraus und quittierte den Wecker, den ich mir gestellt hatte, um meine heutige Spätschicht im Diner nicht zu verpassen.
Träge schob ich das zerkratzte Telefon zurück in meine Jeansshorts. Es kostete mich einiges an Überwindung, aufzustehen und den einzigen Platz in ganz Minebrooke zu verlassen, an dem ich mich gern aufhielt. Hier, umgeben von nichts als Getreideähren und Grillen, fühlte ich mich am wohlsten. Fernab von allem, was ich verabscheute.
Gemächlich schlenderte ich den Feldweg entlang, der direkt an meiner Siedlung vorbeiführte. Je näher ich den abgewrackten Bungalows kam, desto deutlicher zeigte sich das wahre Elend meiner sogenannten Heimat. Obwohl die Bauten in der prallen Sonne standen, wirkten sie grau und farblos. Deutlich dunkler als die schlichten Einfamilienhäuser nur eine Querstraße weiter, die im Vergleich geradezu erstrahlten.
Nur noch ein Jahr, sagte ich mir in Gedanken. Das packst du auch noch.
Das College stellte bereits seit Jahren meinen Rettungsanker dar. Dummerweise war es gleichzeitig auch die größte Hürde, die ich auf dem Weg in meine bessere Zukunft zu überwinden hatte. Selbst ein Community-College kostete ordentliche Studiengebühren. Dazu kamen noch die Lebenshaltungskosten, Miete und so weiter. Ich brauchte also Geld, das ich nicht hatte. Natürlich versuchte ich ein Stipendium zu ergattern, aber die Aussichten bei meinem bescheidenen Notendurchschnitt waren eher ernüchternd. Die Krux daran war, dass meine Noten sicherlich besser wären, würde ich meine Freizeit zum Lernen nutzen und nicht, um in einem Diner zu arbeiten.
Inzwischen hatte ich die Siedlung erreicht. Von vorn näherte sich ein blitzblank polierter SUV, den ich sofort erkannte. Es war der Wagen unserer Vermieterin. Mrs Keller gehörten alle Bungalows dieser Siedlung, was sie zu so etwas wie dem Minebrooker Immobilienhai machte. Zumindest ihrer Meinung nach. Ich wäre wohl eher nicht stolz darauf, einen Haufen Gebäude zu besitzen, deren Renovierung seit zwanzig Jahren überfällig war. Doch Mrs Keller kümmerte die Instandhaltung ihres Eigentums herzlich wenig. Das Einzige, was sie interessierte, war die monatliche Miete – und dass sie ihren Wagen nun in unsere Einfahrt lenkte, ließ mich nichts Gutes erahnen.
Hastig eilte ich über die Straße. Als ich unser Grundstück erreichte, hopste Mrs Keller gerade aus ihrem Wagen.
Sie hopste wirklich, denn sie war ziemlich klein geraten. Mrs Keller reichte mir gerade mal bis zur Schulter und da war ihre feuerrote Dauerwelle schon mit eingerechnet. In der Breite hatte sie definitiv mehr zu bieten und ihre Vorliebe für Animalprint schmeichelte ihren Rundungen nicht unbedingt.
»Guten Tag, Mrs Keller«, begrüßte ich sie höflich. »Was führt Sie hierher?«
»Ist deine Mutter da?«, entgegnete sie grimmig.
»Ähm, ich weiß nicht genau …«
Das war gelogen. Meine Mom arbeitete drei Vormittage die Woche als Schreibkraft im Kieswerk. Heute hatte sie frei und als ich gegen Mittag das Haus verlassen hatte, war sie gerade dabei gewesen, ihre erste Flasche Wein zu leeren. Erfahrungsgemäß lag sie jetzt auf der Couch und döste, damit sie später wieder fit genug fürs Pub war.
Mrs Keller gab ein unwirsches Geräusch von sich und wollte zur Veranda gehen, doch ich versperrte ihr eilig den Weg. »Ich kann Ihnen sicher auch weiterhelfen.«
Sie schaute verkniffen zu mir auf. »Sie ist also schon wieder besoffen, ja?«
»Sagen Sie mir doch bitte einfach, was Sie brauchen«, erwiderte ich mit gezwungener Ruhe.
»Was ich brauche?« Sie plusterte sich echauffiert auf und lachte schrill. »Die Miete für die letzten vier Monate. Die brauche ich!«
»Was?« Mein Magen krampfte sich zusammen. »Sie hat Ihnen die Miete nicht gezahlt?«
Trotz ihrer Verärgerung blieb Mrs Keller mein ehrlicher Schock nicht verborgen. Sie wurde deutlich ruhiger und sprach in normaler Lautstärke weiter. »Nein, hat sie nicht. Dass sie nie pünktlich bezahlt, konnte ich bisher verkraften, aber vier Monate? Das geht so nicht. Ich muss schließlich auch von etwas leben. Seit Wochen renn ich ihr schon hinterher. Wenn ich das Geld heute nicht bekomme, werde ich den Mietvertrag wohl oder übel auflösen müssen.«
»Das wird nicht nötig sein«, sagte ich schnell. »Bitte warten Sie hier! Ich bin gleich zurück.«
Mrs Keller blieb im Schatten ihres Geländewagens stehen, während ich mit großen Schritten unseren kargen Vorgarten durchquerte. Meine Schultern bebten vor Wut, als ich die knarzenden Dielen der Veranda betrat und die quietschende Fliegengittertür aufzog.
Vier Monate Rückstand … das war echt nicht zu fassen. Bisher hatte ich mich wenigstens darauf verlassen können, dass meine Mutter die Miete bezahlte. Mehr verlangte ich nicht, denn seit ich im Diner jobbte, kaufte ich mir alles, was ich sonst brauchte, von meinem eigenen Geld.
Im Bungalow war es stickig und duster. Die dreckigen Fensterscheiben ließen nicht viel Licht in den spartanischen Wohnraum mit integrierter Küchenzeile hinein. Die wenigen Möbel im Raum bestanden aus billigem Furnierholz. Einen Esstisch hatten wir nicht, dafür aber einen höhenverstellbaren Couchtisch. Wie vermutet standen eine leere Rotweinflasche und ein benutztes Glas darauf. Und auf dem abgewetzten Sofa davor pennte meine Mutter.
»Mom«, sagte ich laut und trat neben den Couchtisch.
Sie rührte sich nicht. Schlief nur seelenruhig ihren Rausch aus, als würden sich all ihre Probleme dadurch in nichts auflösen.
Ihr rabenschwarzes Haar floss weich über die Kissen. Mit ihrem hellen Teint hätte sie als Schneewittchen durchgehen können, wenn man darüber hinwegsah, dass ihre Lippen nur vom Rotwein blutrot verfärbt waren.
Ich war meiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Nur die blauen Augen hatte ich von meinem Vater. Ihre waren braun.
Insgesamt sah meine Mom echt gut aus. Sie hätte wunderschön sein können, doch jahrelanger Alkoholmissbrauch hinterließ natürlich seine Spuren. Hautunreinheiten und tiefe Falten um ihre Augen ließen sie nicht nur zehn Jahre älter aussehen, sondern einfach verbraucht und kaputt. Was sie ja auch war.
»Mom!« Ich nahm die Rotweinflasche und knallte sie auf die Tischplatte. »Wach auf, verdammt!«
Meine Mutter fuhr erschrocken hoch. »Was zum …? Delilah! Was soll der Scheiß?«
»Mrs Keller steht draußen und will ihre Miete. Für ganze vier Monate! Was soll denn der Scheiß?«
»Ja«, erwiderte sie gedehnt. Sie rieb sich müde übers Gesicht. »Sag ihr, ich bring ihr die Kohle morgen vorbei.«
»Sie will das Geld aber jetzt.«
»Ihr Problem«, murmelte sie. »Ich hab es nämlich nicht.«
Ich riss die Augen auf. »WAS? Warum nicht? Wo ist das Geld denn bitte hin?«
»Na, weg eben.«
Mit klopfendem Herzen wandte ich mich ab und ging zur Küchenzeile. Ich holte die alte Kaffeedose aus dem Oberschrank, die meiner Mutter als Bank diente. Was ich schließlich in der Dose fand, brachte mich vollends aus der Fassung.
»Zehn Dollar?«, bellte ich. »Du hast nur noch zehn Dollar?«
»Reg dich ab. Morgen krieg ich meinen Gehaltsscheck.«
»Ich soll mich abregen?«, schnappte ich. »Verflucht, Mom! Wo zum Teufel ist das Geld hin?«
Sie streckte ihre Schultern durch. »Schrei mich nicht so an, ja? Ich war vor einer Weile mit Jeffrey im Casino und hatte eben ein wenig Pech.«
Wer zur Hölle war Jeffrey? Aber das war irrelevant. Die wichtigste Info hatte ich bekommen und für einen Moment starrte ich meine Mutter nur wie versteinert an.
Man sprach oft von dieser besonderen Liebe zwischen Eltern und ihren Kindern. Eine einzigartige Verbindung, die mit nichts zu vergleichen war.
Ich empfand in diesem Augenblick nur pure Abscheu für diese Frau. Liebe zu meiner Mutter war mir schon immer fremd gewesen, doch der tiefe Hass, der sich nun durch meine Brust fraß, erschreckte mich selbst.
Eine Tochter sollte nicht so für ihre Mutter empfinden. So sollte das nicht sein. Und dass es trotzdem so war, trieb mir unwillkürlich die Tränen in die Augen.
Meine Mom bemerkte es nicht, weil sie lieber versuchte sich aus der leeren Weinflasche etwas einzuschenken. Dass nur ein paar Tropfen in ihr Glas fielen, fand sie offensichtlich besorgniserregender als den Fakt, dass unsere Vermieterin draußen immer noch auf ihr Geld wartete.
Es war zwecklos, sie erneut darauf hinzuweisen. Mir blieb keine andere Wahl, als mich aus meiner Starre zu reißen und die Sache selbst zu regeln.
Wortlos verließ ich den Wohnraum und ging in den einzigen Flur, über den man unsere beiden Schlafzimmer und das winzige Bad erreichte. Tränen verschleierten mir immer noch die Sicht, während ich mein Zimmer betrat. Das billige Mobiliar setzte sich auch hier drin fort. Mehr als ein Bett, einen winzigen Schreibtisch und einen Kleiderschrank hatte ich nicht.
Eine Träne rollte heiß über meine Wange, als ich den Schrank öffnete und die kleine Schmuckschatulle hervorholte, die ich sorgfältig unter meinen Pullovern verbarg. Mit zitternden Händen nahm ich ein Geldbündel aus dem Kästchen und zählte vier Monatsmieten ab. Es kostete mich fast die Hälfte meines bislang angesparten College-Vermögens und noch sehr viel mehr an Überwindung, doch ich brauchte schließlich ein Dach über dem Kopf.
Nachdem ich die Schatulle wieder verstaut hatte, wischte ich mir die Tränen aus den Augen, zog die Nase hoch und straffte die Schultern. Dann nahm ich das Geld und ging nach draußen.
Mrs Keller stand auf der Veranda. Ihrer Miene nach zu urteilen, hatte sie alles mit angehört. Obwohl sie sich abmühte, weiterhin die harte Fassade der Geldeintreiberin zu wahren, war das Mitleid in ihren Augen unverkennbar.
Mitleid … Es gab nichts, was ich mehr verabscheute. Lieber sah ich mich mit Spott und Hohn konfrontiert als mit dieser Art von Bedauern. Mitleid vermittelte mir stets das Gefühl, dass ich ohnmächtig und schwach war. Ein Opfer von Umständen, die ich nicht ändern konnte.
Aber das war ich nicht. Noch hatte ich den Kampf gegen ebenjene Umstände nicht verloren.
»Hier«, sagte ich zu Mrs Keller und drückte ihr das Geldbündel in die Hand. »Es tut mir leid. Es wird nicht wieder vorkommen.«
Sie nickte. »Gut.«
Ohne nachzuzählen, steckte sie die Scheine in ihre Tasche, machte aber zunächst keine Anstalten, die Veranda zu verlassen. Sie schien etwas sagen zu wollen, fand aber wohl nicht die richtigen Worte dafür. Die hohlen Phrasen des Mitgefühls konnte sie sich jedoch ohnehin sparen.
»Brauchen Sie noch etwas?«, fragte ich. »Ich muss nämlich gleich zur Arbeit.«
»Nein, nein«, antwortete sie erleichtert. »Das war alles. Schönen Tag noch, Delilah.«
Anschließend floh sie zu ihrem SUV, so schnell ihre kurzen Beine sie trugen.
Ich sah ihr nicht lange nach, weil ich mich jetzt wirklich ein wenig sputen musste, wenn ich nicht zu spät kommen wollte. Meine Mutter war inzwischen aufgestanden und lehnte nun an der Küchenzeile. Ich würdigte sie keines Blickes, als ich den Wohnraum durchquerte. Sie sagte nichts zu mir. Weder Danke noch dass es ihr leidtat. Würde es nach ihr gehen, wäre der Vorfall bereits vergessen.
Aber das war er ganz sicher nicht. Gleich morgen würde ich sie zur Rede stellen. Wenn ich Zeit hatte und sie nüchtern war. Bis dahin hatte ich mich hoffentlich ein wenig beruhigt, denn gerade war ich immer noch so aufgeladen, dass ein Gespräch kaum möglich war. Ich würde vermutlich nur herumschreien, bis meine Mom auch nur herumschrie, und letztlich würde unser Gebrüll überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, bis wir auseinanderstoben, um uns irgendwo die Augen auszuheulen.
Das konnte ich jetzt kurz vor Beginn meiner Schicht wirklich nicht brauchen, darum rang ich meinen Zorn nieder und ging schweigend in mein Zimmer, um mich umzuziehen.
***
Die Spätschicht verlief wie gewohnt. Die Gäste kamen und gingen, während die gleißende Sonne sich draußen stetig tiefer über die Wellblechdächer der umliegenden Lagerhallen senkte und schließlich nur noch als knallrote Scheibe über den Giebel einer Werkstatt lugte.
Alice bemerkte natürlich, dass irgendetwas vorgefallen sein musste. Sie fragte mich, ob ich darüber reden wollte, doch ich schüttelte bloß den Kopf. Danach behandelte Alice mich wieder ganz normal. Keine mitleidigen Blicke oder Ähnliches. Wofür ich sehr dankbar war.
Die Nacht brach herein und um elf Uhr schlossen wir schließlich die Pforten. Carlos hatte sich bereits verabschiedet und ich schickte Alice ebenfalls nach Hause. Den Kassensturz bekam ich auch problemlos allein hin. Sie nahm mein Angebot ohne Zögern an. Wahrscheinlich hauptsächlich deswegen, weil sie ahnte, dass ich nicht nach Hause wollte und mir alles recht kam, womit sich der Heimweg hinauszögern ließ.
Im schwachen Licht der Notbeleuchtung erledigte ich also allein im Diner die Abrechnung. Das Radio hatte ich ausgeschaltet und nur das leise Rascheln der Geldscheine erfüllte den Raum. Ich mochte dieses Geräusch. Ebenso das Gefühl des besonderen Papiers unter meinen Fingerspitzen. Und den typischen Geruch.
Ja, ich liebte Geld eben. Wahrscheinlich machte ich deswegen so gern den Kassensturz, weil ich mir dann vorstellte, das wäre alles mein Geld, das ich da sortierte.
Leider war dem nicht so.
Da ich zudem nicht ewig hier herumstehen und fremdes Geld beschnuppern konnte, packte ich schließlich zusammen und warf die Einnahmen in den Schlitz des Tresors, der sich im Büro des Geschäftsführers befand. Ich hängte meine Schürze im Personalraum an den Haken und steckte mein Handy in die Rocktasche. Einen Rucksack hatte ich heute nicht dabei, denn mehr als mein Telefon trug ich nicht bei mir. Nicht einmal einen Haustürschlüssel, weil unsere Bruchbude grundsätzlich nie abgesperrt war.
Anschließend vergewisserte ich mich noch einmal, dass alle Lichter und Geräte aus waren, bevor ich mich auf den Weg nach draußen machte.
Die aufgeheizte Luft des vergangenen Tages empfing mich wie eine Wand. Nach den vielen Stunden in einem klimatisierten Raum kam es mir vor, als hätte es immer noch an die dreißig Grad.
Es war still um mich herum. Das Gewerbegebiet schlief längst und auf dem Highway war niemand unterwegs. Der magere Schein einer entfernten Straßenlaterne diente mir als einzige Beleuchtung, während ich sorgfältig die Hintertür abschloss und den Schlüssel durch den Briefschlitz zurück ins Innere warf.
Ich ging zu meinem Fahrrad, das im Schatten des Müllcontainers fast nicht zu sehen war. Die Dunkelheit machte mir nichts aus. Minebrooke war immerhin bekannt für seine nahezu nicht existente Kriminalitätsrate. Das letzte Verbrechen war meines Wissens vor einigen Monaten geschehen und war vom alten Farmer Lonehill begangen worden. Genau genommen hatte man nur zufällig entdeckt, dass der Gute sich nie die Mühe gemacht hatte, einen Führerschein zu erwerben.
Unschlüssig blieb ich neben meinem Fahrrad stehen. Ich wollte nicht nach Hause. Mit meiner Mutter würde ich zwar vermutlich eh nicht konfrontiert werden, weil sie entweder noch im Pub herumhing oder bereits wieder auf der Couch im Koma lag. Gerade letzteren Anblick wollte ich mir aber ersparen, weil mir allein der Gedanke daran die Galle hochtrieb.
Doch wo sollte ich nun stattdessen hin? Vielleicht noch mal zu meinem Lieblingsbaum?
Aus dem Schatten heraus konnte ich die unzähligen Sterne am wolkenklaren Himmel besser sehen. Der Mond wachte als dünne Sichel über die dunklen Felder auf der anderen Seite des Highways. Er sah wunderschön aus. Fast schon unnatürlich, als hätte ihn ein perfektionistischer Künstler ans Firmament gepinselt.
Ich lächelte, weil der Schweif einer Sternschnuppe aufleuchtete. Da ich generell viel Zeit damit verbrachte, in den Nachthimmel zu blicken, bekam ich sehr häufig Sternschnuppen zu sehen. So selten waren die nämlich gar nicht. Früher hatte ich mir auch jedes Mal etwas gewünscht, doch damit ich bald aufgehört. Ich hatte längst gelernt, dass es an mir lag, mir meine Wünsche zu erfüllen und nicht an in der Atmosphäre verglühenden Gesteinsbrocken. Aber trotz meiner pragmatischen Grundeinstellung freute ich mich jedes Mal erneut über den Anblick.
Gerade als ich die Hände zu meinem Fahrrad ausstreckte, durchschnitten Scheinwerferkegel die Nacht. Kurz darauf drang das Geräusch schwerer Motoren zu mir hindurch. Dass auch nachts Trucks auf dem Highway unterwegs waren, war natürlich nicht ungewöhnlich. Das schienen aber gleich mehrere hintereinander zu sein und sie hatten es noch dazu ziemlich eilig.
Neugierig verharrte ich in meiner dunklen Nische und blickte den herannahenden Fahrzeugen entgegen. Als der vorderste Wagen von den Straßenlaternen des Gewerbegebiets erfasst wurde, erkannte ich, dass es sich um einen Militärkonvoi handelte.
An sich ja auch nichts Ungewöhnliches. Was mich aber stutzig machte, war zum einen die späte Uhrzeit und zum anderen das überhöhte Tempo der Fahrzeuge. Außerdem bemerkte ich, dass auf einem der Geländewagen ein schweres Geschütz montiert war, hinter dem ein Soldat aufrecht stand. Offensichtlich in Feuerbereitschaft.
Unwillkürlich wurde ich unruhig, weil das nicht nach einer der üblichen Trainingsfahrten aussah. Allerdings fuhr der Konvoi in Richtung Kaserne und ihre eigenen Leute würden sie ja vermutlich nicht angreifen. Oder war dort etwas geschehen, von dem wir in Minebrooke nur noch nichts mitbekommen hatten?
Die ersten drei Fahrzeuge waren bereits an mir vorbei. Dahinter zählte ich noch vier weitere Geländewagen. Der hinterste wieder mit feuerbereitem Geschütz.
Plötzlich begann der Boden unter mir zu vibrieren. Zunächst dachte ich nur die vorbeidonnernden Trucks deutlicher wahrzunehmen, doch das Zittern weitete sich im Nu zu einem unverkennbaren Beben aus.
Ich keuchte erschrocken und stützte mich am Müllcontainer ab.
Was hatte das zu bedeuten?
Mikrobeben kamen durchaus öfter mal in Nebraska vor, aber die meisten waren kaum wahrnehmbar. Das hier war etwas ganz anderes.
Die Erschütterungen wurden immer stärker und ich hatte ernsthaft Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Mein Fahrrad fiel um. Das Scheppern ließ mein Herz kurz aussetzen, bevor es mit doppelter Geschwindigkeit weiterschlug. Die Straßenlaterne flackerte heftig und ging aus. Die Scheinwerferlichter der Militärfahrzeuge auf dem Highway hinter mir warfen zuckende Muster an die Fassade des Diners.
Was passierte hier?
Verängstigt krallte ich mich an dem wackelnden Container fest. Noch während ich fieberhaft überlegte, wie man sich bei einem ernst zu nehmenden Erdbeben am besten verhielt, rollte ein dunkles Grollen durch die Nacht. Ich hörte ein Krachen und unheilvolles Knirschen.
Automatisch duckte ich mich und suchte dabei gehetzt nach dem Ursprung der bedrohlichen Geräusche.
Mir stockte der Atem.
Perplex sah ich mit an, wie sich nur wenige Meter vor mir ein riesiger Spalt im Highway auftat. Erst dachte ich an einen Erdriss, doch dann …
Ich konnte nicht glauben, was ich dann sah. Ein großer Abschnitt des Asphalts löste sich vom Untergrund, rollte sich auf wie das Ende einer Papierrolle und klappte sich auf einmal senkrecht nach oben auf.
Was um alles in der Welt …?
Der Asphalt bildete nun eine Wand, welche die hinteren drei Militärfahrzeuge vom restlichen Konvoi trennte. Der vorderste Geländewagen bremste nicht rechtzeitig und schlitterte mit quietschenden Reifen auf den entstandenen Abgrund zu, wo er schließlich über die Kante kippte.
Das Beben verklang ebenso plötzlich, wie es gekommen war.
Einen Moment herrschte Totenstille. Ich starrte die aufrechte Wand aus Asphalt an. Die Scheinwerfer der beiden Jeeps, die vor dem Abgrund hatten stehen bleiben können, beleuchteten eindrucksvoll die Unterseite des erhobenen Highways.
Wie zum Teufel konnte ein solches Gebilde durch ein Erdbeben entstehen?
Auf einmal flammte gleißendes Licht vor mir auf. Es war reinweiß und so grell, dass es mir in die Augen stach. Hastig wandte ich mich ab und presste mir die Handballen auf meine pochenden Lider.
Dann brach mit einem Mal die Hölle los.
Leute schrien wild durcheinander und das ohrenbetäubende Krachen von Schüssen ließ meine Ohren sirren. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Aus purem Reflex duckte ich mich und presste mich Schutz suchend in die Ecke zwischen Müllcontainer und Wand.
Mein Herz donnerte wild gegen meine Brust und blinde Panik nahm mich gefangen. Ich konnte immer noch nicht klar sehen, weil helle Punkte vor meinen Augen tanzten. Der unsägliche Lärm auf dem Highway ließ aber auf einen erbitterten Kampf schließen.
Das konnte doch nicht sein. Das hier war Minebrooke und nicht irgendein Krisengebiet im Nahen Osten. Warum wurde dann hier geschossen?
Meine Gedanken ergaben genauso wenig Sinn wie die Situation selbst.
Nur wenige Schritte neben mir traf ein Querschläger auf die Gebäudefassade. Ich wimmerte leise und begann zu hyperventilieren, während ich mich so klein wie möglich machte. Meine Sicht normalisierte sich allmählich, doch ich wagte es nicht, hinter meiner Deckung hervorzuspähen, und nahm nur die Geräusche wahr.
Einzelne Explosionen brachten den Boden zum Erzittern. Ich hörte ein zischelndes Sirren, das mir durch und durch ging, obwohl ich es überhaupt nicht identifizieren konnte. Darunter mischte sich immer wieder ein tiefes Grollen, das aus der Erde selbst zu stammen schien.
Schließlich erklang ein lautes Rumpeln, dicht gefolgt von metallischem Kreischen. Das schleifende Geräusch bewegte sich rasant auf mich zu und ehe ich mich’s versah, krachte direkt neben mir ein Geländewagen gegen die Fassade.
Der Jeep lag auf dem Dach. Die Scheiben waren gesplittert und die hintere Beifahrertür fehlte ganz. Im Fahrgastraum war niemand zu sehen. Nur ein Sturmgewehr hing halb bei einem Fenster heraus.
Auf dem Asphalt lag ein kleiner schwarzer Koffer, der soeben aus dem Wagen gefallen sein musste. Das Plastik war gebrochen und ein Lichtschein drang daraus hervor. Er war sehr hell, genau wie das Licht, das mich vorhin geblendet hatte, und pulsierte regelmäßig.
Reglos starrte ich den Koffer an. Die Kampfgeräusche schienen immer mehr in den Hintergrund zu geraten, während ich das Pulsieren beobachtete.
Es war eigenartig, aber auf einen Schlag wurde ich ganz ruhig. Als würde mir dieses wundervolle Licht zuflüstern, dass ich mir keine Sorgen machen brauchte. Dass es nun auf mich aufpasste.
Fasziniert zog ich den kleinen Koffer an mich heran. Der Lichtschein fühlte sich angenehm warm auf meiner Haut an. Ich wollte unbedingt mehr davon. Nein, ich wollte es nicht nur, ich musste sogar. Es war eine Notwendigkeit, ähnlich einem Atemzug.
Hastig entriegelte ich den Koffer und klappte ihn auf. Für einen Augenblick war ich geblendet, doch meine Augen gewöhnten sich überraschend schnell an das nun ungedämmte pulsierende Licht.
Es entsprang einem Kristall, der in die Mitte eines Medaillons eingelassen war. Das Schmuckstück war fast handtellergroß, geformt wie eine flammende Sonne und es bestand aus einem dunklen, beinahe schwarzen Material, in das runenähnliche Symbole eingearbeitet waren.
Das Medaillon war wunderschön. Schöner als alles, was ich je zuvor gesehen hatte.
Gebannt streckte ich eine Hand danach aus. Als meine Fingerspitzen über dem Kristall schwebten, stoppte das Pulsieren und das nun dauerhafte Licht wurde merklich heller. Der Stein reagierte auf mich. Er sprach mit mir. Nicht mit Worten, sondern mehr mit einem Gefühl, das ich klar und deutlich verstehen konnte. Der gleißende Edelstein lud mich ein ihn zu berühren.
Und ich folgte seiner Einladung mit einem Lächeln auf den Lippen. Der Kristall wurde heller und heller, je tiefer ich meine Hand herabsenkte, und als meine Fingerspitzen ihn erreichten, funkelte er wie der Schweif einer Sternschnuppe.
Ich spürte noch, dass sich der Kristall unerwartet kühl anfühlte. Das änderte sich aber schlagartig und im Nu wurde er heiß wie glühendes Eisen.
Zischelnd zog ich meine Hand zurück und schüttelte sie leicht. Der merkwürdige Bann war gebrochen und plötzlich nahm ich die Kampfgeräusche um mich herum wieder in unverminderter Lautstärke wahr.
Die schmerzhafte Hitze blieb an meinen Fingerkuppen haften. Perplex sah ich meine Hand an und sog erschrocken die Luft ein, weil winzige gleißende Linien auf meiner Haut leuchteten.
Nein, nicht auf meiner Haut. Unter meiner Haut.
Verstört starrte ich die feinen Linien an. Im nächsten Augenblick waren sie spurlos verschwunden. Nur der pochende Schmerz einer frischen Verbrennung blieb bestehen. Wahrscheinlich hatte ich mir das Leuchten nur eingebildet.
Aber das brennende Gefühl war noch da und es weitete sich beständig aus.
Keuchend umklammerte ich mein Handgelenk. Äußerlich war überhaupt nichts zu sehen, doch der Schmerz hatte bereits meine ganze Hand erfasst. Es war, als würde pures Feuer durch meine Adern kriechen und langsam, aber sicher meinen Arm hinaufwandern.
Ich schaute mich hektisch um. Der umgedrehte Jeep verbarg einen Großteil meiner Sicht, aber den Klängen nach zu urteilen war der Kampf noch nicht ausgefochten. Das Geschehen schien sich nun jedoch hauptsächlich hinter der Asphaltwand abzuspielen.
Da hörte ich, wie sich mir eilige Schritte näherten. Durch den Fahrgastraum des Geländewagens konnte ich zwei Beine in schweren Kampfstiefeln erkennen. Ich ging davon aus, dass es ein Soldat des Konvois war.
»Hilfe«, stieß ich hervor. »Ich bin …«
Der Rest ging in einem Stöhnen unter, weil die unsichtbaren Flammen nun meinen Brustkorb erreicht hatten. Ich krümmte mich vor Schmerz zusammen und konnte nur hoffen, dass der Soldat eine Ahnung hatte, was zu tun war. Immerhin war der Koffer mit dem Medaillon aus einem der Militärfahrzeuge gefallen. Die GIs hatten dieses Ding transportiert, also musste dieser Soldat doch auch wissen, was es mit dem Feuer auf sich hatte, das mich gerade von innen heraus zerfraß.
»Verfluchte Scheiße!«, stieß eine Frau hervor.
Ich hob den Blick zu ihr an. Die Kampfstiefel gehörten zu ihr, doch ihrer schwarzen Kleidung nach zu urteilen, war die Frau nicht vom Militär. Sie trug außerdem eine schwarze Sturmhaube, darum konnte ich nur ihre Augenpartie sehen.
»Was ist?«, fragte eine männliche Stimme von irgendwo hinter dem Wagen. »O verdammt. Sie wurde doch nicht etwa aktiviert?«
»Offensichtlich transformiert sie sich«, erwiderte die Frau.
Ich konnte den Mann immer noch nicht sehen und hatte nicht den blassesten Schimmer, wovon die beiden redeten. Aber zumindest schienen sie zu wissen, was gerade mit mir passierte, und mehr kümmerte mich im Moment nicht.
»Bitte«, brachte ich hervor. »Helft mir!«
Sofort krampfte ich mich wieder zusammen. Die Flammen tosten nun in meinem gesamten Oberkörper und mein Herz schlug so schnell, dass die Schläge nahtlos ineinander übergingen. Dazwischen machte es immer wieder eine lange Pause, gefolgt von einem rumpelnden Satz, als wollte es sich selbst neu starten.