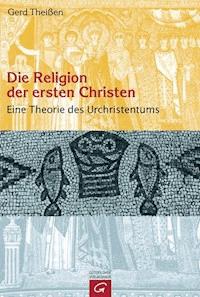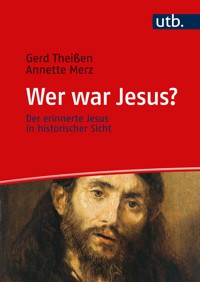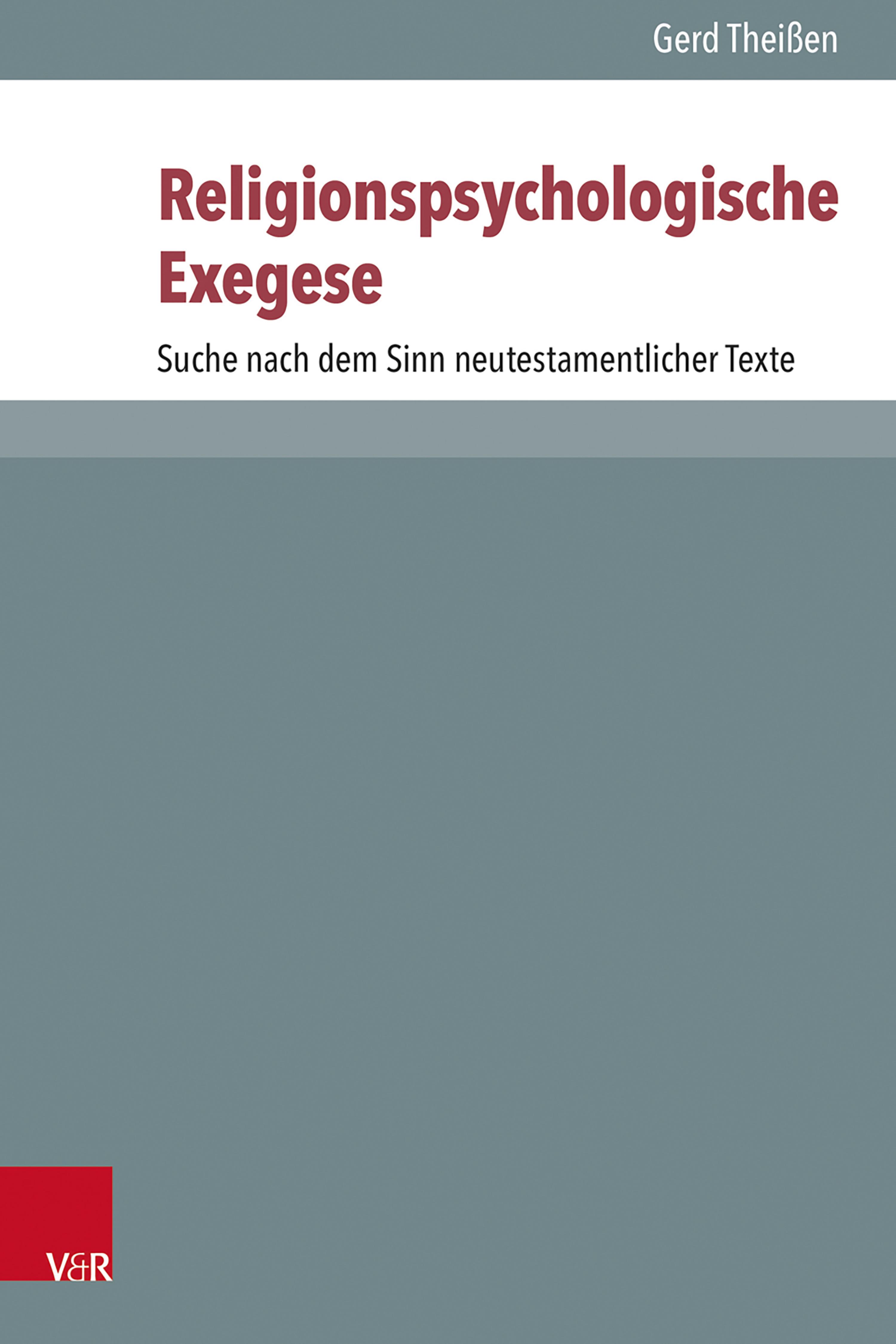Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
1. KAPITEL – Das Verhör
2. KAPITEL – Die Erpressung
3. KAPITEL – Die Entscheidung des Andreas
4. KAPITEL – Der Ermittlungsauftrag
5. KAPITEL – Die Wüstengemeinde
Über die Essener
6. KAPITEL – Ein Mord und seine Analyse
WOZU BIST DU HIER? SEI FRÖHLICH!
7. KAPITEL – Jesus – ein Sicherheitsrisiko?
8. KAPITEL – Nachforschungen in Nazareth
9. KAPITEL – In den Höhlen von Arbela
10. KAPITEL – Terror und Feindesliebe
11. KAPITEL – Konflikt in Kapernaum
12. KAPITEL – Menschen an der Grenze
13. KAPITEL – Eine Frau protestiert
14. KAPITEL – Bericht über Jesus oder: Jesus wird getarnt
ÜBER JESUS ALS PHILOSOPHEN
ÜBER JESUS ALS DICHTER
15. KAPITEL – Tempel- und Sozialreform
16. KAPITEL – Die Angst des Pilatus
17. KAPITEL – Wer war schuld?
18. KAPITEL – Der Traum vom Menschen
Anstatt eines Nachworts
Anhang – Die wichtigsten Quellen zu Jesus und seiner Zeit
Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Verfassers zur Thematik dieses Buches:
Copyright
FÜR OLIVER UND GUNNAR
Anstatt eines Vorworts
Sehr geehrter Herr Kollege Kratzinger,
vielen Dank für Ihren Brief. Es ist wahr, was gerüchteweise bis zu Ihnen gedrungen ist: Ich schreibe an einer Jesuserzählung. Sie beschwören mich, dies Buch nie zu veröffentlichen. Sie fürchten um meinen Ruf als Wissenschaftler und sorgen sich um das Ansehen der neutestamentlichen Exegese. Ihre Sorgen wären berechtigt, handelte es sich um einen jener Jesusromane, in denen mit Phantasie ausgemalt wird, worüber historische Quellen schweigen, und die geschichtliche Wahrheit der Wirkung geopfert wird. Ich darf Sie beruhigen: Ich habe große Scheu, etwas über Jesus zu schreiben, was nicht auf Quellen basiert. In meinem Buch steht nichts über Jesus, was ich nicht auch an der Universität gelehrt habe.
Frei erfunden ist dagegen die Rahmenhandlung. Ihre Hauptgestalt, Andreas, hat nie gelebt, hätte aber in der Zeit Jesu leben können. In der Erzählung von ihm sind viele historische Quellen verarbeitet. Seine Erfahrungen sollen veranschaulichen, was damals Menschen in Palästina immer wieder erleben konnten.
Sie werden fragen: Wird der Leser dies Gewebe von »Dichtung und Wahrheit« durchschauen, wird er Erfundenes von Historischem unterscheiden können? Um dies zu ermöglichen, sind dem Text fortlaufend Anmerkungen beigegeben, in denen die verarbeiteten Quellen zitiert sind. Natürlich steht es jedem Leser frei, diese Anmerkungen zu überschlagen.
Was ich mit dem Buch eigentlich will, fragen Sie. Im Grunde nur eins: Ich möchte in erzählender Form ein Bild von Jesus und seiner Zeit entwerfen, das sowohl dem derzeitigen Stand der Forschung entspricht als auch für die Gegenwart verständlich ist. Die Erzählung soll so gestaltet sein, daß nicht nur das Ergebnis, sondern der Prozeß des Forschens dargestellt wird. Ich wähle die erzählende Form, um Erkenntnisse und Argumente der Wissenschaft auch Lesern nahe zu bringen, die keinen Zugang zu historischen Studien haben.
Vielleicht darf ich Ihnen das erste Kapitel zur Stellungnahme schicken. Ich würde mich freuen, wenn sie nach seiner Lektüre positiver über mein Vorhaben urteilen könnten.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Gerd Theißen
1. KAPITEL
Das Verhör
Die Zelle war dunkel. Eben noch hatten sich Menschen in Panik um mich gedrängt. Jetzt war ich allein. Mein Schädel brummte. Meine Glieder schmerzten. Die Soldaten hatten harmlos ausgesehen, hatten mitdemonstriert und mitgeschrien. Niemand konnte ahnen, daß sie Spitzel waren, bis sie ihre versteckten Knüppel herausholten und auf uns einschlugen. Die meisten von uns flohen. Einige wurden auf der Flucht totgetrampelt, andere wurden von knüppelnden Soldaten erschlagen.
Ich hatte keinen Grund gehabt zu fliehen. War ich doch nur zufällig mit Timon und Malchos vorbeigekommen. Nicht die Demonstration hatte mich interessiert. Mich interessierte Barabbas, den ich unter den Demonstranten entdeckt hatte. Ich wollte gerade zu ihm, als die Panik ausbrach und alles im Durcheinander der Schreie, Prügel, Pfiffe und Tritte unterging. Als ich wieder zu mir kam, war ich inhaftiert. Timon auch. Ob Malchos entkommen war?
Jetzt hockte ich in dieser Finsternis. Ich spürte die Schmerzen in meinem Körper. Es waren nicht nur die Schläge und Fesseln, die weh taten. Was die Glieder verkrampfte, war mehr: Es war die Erniedrigung durch brutale Gewalt. Es war die Angst vor weiterer Erniedrigung, der ich ohnmächtig ausgesetzt sein würde.
Eine Wache ging draußen auf und ab. Ich hörte Stimmen. Jemand schloß auf. Ich wurde in Fesseln zum Verhör geschleppt – irgendwo im Jerusalemer Amtssitz des römischen Präfekten. Ein Offizier saß mir gegenüber. Ein Schreiber führte Protokoll.
»Sprichst du Griechisch?« lautete die erste Frage.
»Alle Gebildeten sprechen bei uns Griechisch«, antwortete ich.
Der Mann, der mich verhörte, hatte ein fein gegliedertes Gesicht. Seine wachen Augen musterten mich eindringlich. Unter anderen Umständen wäre er mir vielleicht sympathisch gewesen.
»Wie heißt du?«
»Andreas, Sohn des Johannes.«
»Woher stammst du?«
»Aus Sepphoris in Galiläa.«
»Beruf?«
»Obst- und Getreidehändler.«
Der Offizier machte eine Pause und wartete, bis der Schreiber alles mit kratzender Feder notiert hatte.
»Was suchst du in Jerusalem?« setzte er sein Verhör fort.
»Ich habe am Pfingstfest teilgenommen.«
Er hob den Blick und sah mir direkt in die Augen: »Warum hast du gegen Pilatus demonstriert?«
»Ich habe nicht demonstriert. Ich bin zufällig in die Demonstration hineingeraten.«
Hätte ich sagen sollen, daß ich einen alten Bekannten in der demonstrierenden Menge erkannt hatte? Auf keinen Fall! Barabbas war ein Römerhasser. Womöglich stand er auf den Fahndungslisten. Ich durfte mit ihm nicht in Verbindung gebracht werden.
»Du behauptest, du hättest nicht mitgeschrien: Kein Geld für Pilatus!«
»Ich weiß nicht einmal, worum es geht«, log ich.
Der Beamte lächelte abfällig. Wußte doch jeder, der sich damals in Jerusalem aufhielt, daß es sich um das Geld handelte, das Pilatus aus dem Tempelschatz nehmen wollte, um eine neue Wasserleitung für Jerusalem bauen zu lassen.1
»Du solltest wissen, daß man sich aus einer demonstrierenden Menge entfernt.«
»Niemand war bewaffnet. Alles verlief friedlich, bis die Soldaten eingriffen«, entgegnete ich hastig.
»Aber die Demonstration richtete sich gegen uns Römer. So was macht verdächtig. Warst du nicht schon einmal in Auseinandersetzungen zwischen Juden und Nichtjuden verwickelt? Kennen wir dich nicht schon?«
»Was für Auseinandersetzungen?«
»Ich meine Konflikte in unseren Städten, bei denen Hitzköpfe in deinem Alter aneinandergeraten. Es fängt mit dummen Streichen an und endet mit Straßenschlachten wie in Cäsarea!«2
»Meine Heimatstadt, Sepphoris, ist ruhig. Die Bewohner sind meist Juden – aber sie sind griechisch gebildet.«
»Sepphoris sagst du? Hat es nicht auch in Sepphoris Unruhen gegeben? Wie war das mit der Revolte nach dem Tod des Herodes? Eure Stadt war ein richtiges Terroristennest!« 3 schrie er mich unvermittelt an.
»Das ist nicht wahr. Vor 33 Jahren gab es in ganz Palästina einen Aufstand gegen Römer und Herodäer. Die Aufständischen eroberten im Handstreich unsere Stadt und zwangen ihre Bewohner zum Krieg gegen die Römer. Die Stadt hat es büßen müssen. Der römische General Quintilius Varus sandte Truppen gegen sie, ließ sie erobern, verbrennen, die Bevölkerung töten oder in die Sklaverei verkaufen. Es war eine schreckliche Katastrophe für unsere Stadt!«
Wie konnte ich ihn nur von diesem Thema wegbringen? Nicht alle waren damals getötet und versklavt worden. Einigen war die Flucht gelungen. Zu ihnen gehörte auch der Vater des Barabbas. Barabbas hatte es mir oft erzählt. Ob sie mich seinetwegen verhörten? Aber was konnten sie von unserer Freundschaft wissen? Auf jeden Fall mußte ich von allem ablenken, was in Verbindung mit ihm stand. Noch einmal betonte ich:
»Alle Bewohner von Sepphoris haben für den Aufstand büßen müssen – auch Varus ereilte sein Schicksal: Wenig später ist er in Germanien mit drei Legionen umgekommen!«
»Worüber man sich in Sepphoris gefreut hat!« Die Stimme des Offiziers klang immer noch wütend.
»Hier konnte sich niemand mehr freuen. Alle waren tot oder versklavt. Die Stadt war ein Ruinenfeld. Sie wurde neu aufgebaut von Herodes Antipas, dem Sohn des Herodes. Er siedelte dort Leute an, die zu den Römern standen. Auch mein Vater ist damals nach Sepphoris gekommen. Wir sind eine neue Stadt. Frag die Galiläer um uns herum: Unsere Stadt gilt als römerfreundlich. Aus diesem Sepphoris komme ich.«4
»Das werden wir alles untersuchen. Noch eine Frage: Welche Stellung hat deine Familie in der Stadt?«
»Mein Vater ist Dekurio, Mitglied des Rates.«
Unsere Stadt war wie eine griechische Stadt organisiert. Es gab eine Bürgerversammlung, einen Rat, Wahlen und städtische Ämter. Ich spielte bewußt darauf an, weil ich wußte: Die Römer unterstützten die republikanischen Städte und die Wohlhabenden in ihnen.
»Dein Vater muß reich sein, wenn er zu den Dekurionen in Sepphoris gehört. Was ist er von Beruf?«
»Getreidehändler wie ich.«
»Mit wem handelt ihr?«
»Galiläa versorgt die Städte an der Mittelmeerküste mit Landwirtschaftsprodukten: Cäsarea, Dor, Ptolemais, Tyros und Sidon. Auch die römischen Kohorten in Cäsarea habe ich schon mit Getreide beliefert.«
»Das läßt sich überprüfen. Habt ihr Geschäftsbeziehungen zu Herodes Antipas?«
»Natürlich! Ihm gehören die größten Güter in Galiläa. Früher hatte er seine Residenz in Sepphoris. Ich habe oft mit seinen Verwaltern zu tun.«
Ich merkte, wie der Untersuchungsoffizier beim Thema ›Herodes Antipas‹ interessiert aufhorchte.
»Was hält man in Sepphoris von Herodes Antipas?«
»Er kann sich auf uns in der Stadt verlassen. Auf dem Land gibt es dagegen immer noch Vorbehalte gegen die Herodäer.«
Der Offizier nahm ein Schriftstück in die Hand. Er schien es schnell durchzulesen, warf einen fragenden Blick auf mich und fuhr fort:
»Hier liegt das Protokoll der Vernehmung eures Sklaven Timon. Da hört sich manches anders an. Willst du wirklich behaupten, daß ihr loyale Anhänger des Herodes Antipas seid?«
Ich erschrak. Sie hatten Timon verhört! Bei Sklaven geschah das auf der Folter. Timon konnte alles mögliche über mich und meine Familie erzählt haben. Ich merkte, wie mir das Blut in den Kopf schoß und spürte Angst im ganzen Körper.
»Also los! Was habt ihr gegen Herodes Antipas?«
»Wir unterstützen seine Herrschaft. Alle angesehenen Leute in Sepphoris und Tiberias unterstützen sie«, beteuerte ich.
»Warum macht man sich dann bei euch zu Hause über ihn lustig?«
»Wieso?«
»Euer Sklave sagt: ihr nennt ihn einen degradierten König, ein schwankendes Rohr, einen Fuchs!«
Ich lachte erleichtert:
»Er sollte einst Nachfolger des Königs Herodes werden. Aber Herodes veränderte mehrfach sein Testament. Antipas erbte weder Königswürde noch Reich, nicht einmal das größte und beste Stück, sondern nur ein Viertel von ihm: Galiläa und Peräa.«
»Und nun träumt er davon, einmal alles zu besitzen?« Plötzlich war es still im Raum. Sogar der Schreiber hatte aufgehört zu schreiben und schaute mich an.
»Vielleicht. Auf jeden Fall hat er einmal davon geträumt«, antwortete ich.
»Und das mit dem schwankenden Rohr?«
Ich hatte das beruhigende Gefühl, daß Antipas wichtiger wurde als ich. Wollte der Beamte über ihn Informationen sammeln? Etwas zuversichtlicher fuhr ich fort:
»Das mit dem ›schwankenden Rohr‹ ist eine Redensart. Als Antipas vor 10 Jahren seine Hauptstadt von unserer Stadt nach Tiberias verlegte, eine Stadt, die er zu Ehren des Kaisers gegründet hatte, gab es Kritik. Natürlich waren wir in Sepphoris nicht glücklich über diese Verlegung der Hauptstadt. In einer Hauptstadt lassen sich bessere Geschäfte machen als in der Provinz. Deswegen wurde Antipas in Sepphoris viel kritisiert.«
»Und was hat das mit dem ›schwankenden Rohr‹ zu tun?«
»Das kam so. Antipas ließ in seiner neuen Hauptstadt Münzen prägen. Normalerweise zeigen Münzen die Bilder der Fürsten. Aber nach jüdischem Gesetz ist es verboten, Menschen oder Tiere abzubilden! Also wählte Antipas ein harmloses Motiv, etwas, was für seine neue Hauptstadt am galiläischen See charakteristisch ist: Schilf, schwankendes Rohr – und das steht nun auf seinen ersten Münzen gerade dort, wo sonst sein Bild gestanden hätte. Daher spottet man über ihn als ein ›schwankendes Rohr‹. Das ist alles.«5
»Zwischen wem schwankt Antipas?«
»Er schwankt zwischen Sepphoris und Tiberias.«
»Nur zwischen Städten?«
»Er schwankt auch zwischen Frauen!«
»Du meinst die Affäre mit Herodias!«
»Ja, sein Schwanken zwischen seiner ersten Frau, der Nabatäerprinzessin, und Herodias.«
»Schwankt er nicht auch zwischen Nabatäem und Römern? Immerhin war er mit einer Tochter des Nabatäerkönigs verheiratet!«
Aha – deswegen interessierten sich die Römer für den schwankenden Antipas! Ruhig sagte ich- und es entsprach der Wahrheit:
»Nein! Antipas ist wie sein Vater Herodes absolut prorömisch.«
»Aber wie reimt sich das dazu, daß er gleichzeitig streng jüdisch ist. Er lehnt Bilder ab, wie du sagtest.«
»Das tun alle Juden.«
»Wirklich? Euer Sklave Timon erzählte uns, in einem Nebenraum stünde in eurem Haus ein Götzenbild!«
»Das ist eine Statue, die uns ein heidnischer Geschäftsfreund geschenkt hat. Wir wollten ihn nicht durch Zurückweisung des Geschenkes verletzen«, sagte ich verlegen.
»Das ist ja interessant: Ihr habt Götterbilder in euren Häusern versteckt!«
»Selbst Antipas hat Tierbilder in seinem Palast!6 Und wie ihr wißt, läßt sein Bruder Philippus auf seinen Münzen sogar den Kaiser abbilden!«
»Was, Tierbilder? Stimmt das wirklich?«
»Ich habe sie selbst gesehen. Sie sind in Tiberias in seinem neuen Palast. Im eigenen Hause sind die wohlhabenden Leute großzügiger mit den jüdischen Gesetzen als in der Öffentlichkeit.«
»Na, wie wäre es, wenn man unters Volk brächte: Antipas treibt heimlich Götzendienst! Und manche Leute in Sepphoris sind nicht viel besser!«
»Bilder sind keine Götter. Die Bilder sind von Handwerkern gemacht. Sie sind Dinge wie alle anderen Dinge. Wenn so ein ›Ding‹ bei uns herumsteht, treiben wir deshalb noch keinen Götzendienst.«
»Das verstehe ich nicht. Alle Welt verehrt die Götter durch Statuen.«
»Nie werden wir verehren, was Menschen geschaffen haben. Gott ist unsichtbar. Man kann sich kein Bild von ihm machen.«
Es entstand eine Pause. Der Offizier schaute mich nachdenklich an. War es nicht eine Dummheit, in meiner Situation zu betonen, was uns Juden von allen Völkern unterscheidet – auch von diesem römischen Offizier vor mir? Endlich sagte er ruhig:
»Darüber, wie es zu diesem bilderlosen Gott kam, habe ich folgende Geschichte gehört: Als in Ägypten vor langer Zeit eine Seuche ausgebrochen war, wandte sich der Pharao an das Orakel des Gottes Ammon um Rat und erhielt die Auskunft, er solle sein Reich von euch gottverhaßten Juden säubern, dann würde die Seuche aufhören. Alle Juden in Ägypten wurden in die Wüste hinausgetrieben, wo man sie ihrem Schicksal überließ. Die meisten von ihnen irrten demoralisiert durch die Wüste. Aber dann hat einer von euch, Mose mit Namen, sie aufgefordert, nicht auf das Eingreifen der Götter oder auf Hilfe von anderen Menschen zu warten. Sie seien ja ohnehin von den Göttern verlassen. Sie sollten auf sich selbst vertrauen und ihr gegenwärtiges Elend überwinden.7 – Als ich diese Geschichte hörte, habe ich mich gefragt: Glaubt ihr überhaupt an einen Gott?«
Was wollte er mit dieser Karikatur der biblischen Geschichte? Wollte er mich provozieren? Hatte er ein Interesse an unserer Religion? Kaum vorstellbar! Was sollte ich antworten? Etwas Vages, Unbestimmtes? Etwas über den unsichtbaren Gott, den niemand verstehen und begreifen kann, weder er noch ich. Den keiner kennt? Etwas, was ablenkt von den großen Fragen? Aber da schoß mir durch den Kopf: Wenn ich ihn in eine Grundsatzdebatte verwickle, dann habe ich endgültig abgelenkt von Barabbas. Und so hörte ich mich trotzig sagen:
»Gott ist anders als die Götter der Völker. Der unsichtbare Gott hält es nicht mit den Mächtigen, sondern mit den Ausgestoßenen, die man in die Wüste jagt.«
Ich merkte, wie der Offizier zusammenzuckte.
»Zweifelst du daran, daß die Götter auf seiten des Römischen Reiches sind? Wie hätte es sich so weit ausbreiten können? Wie hätte aus einer kleinen Stadt ein Weltreich werden können?«
»Alle Völker denken: Die Götter stehen auf seiten der Sieger. Wir aber wissen: Der unsichtbare Gott kann auf seiten der Verlierer stehen!«
Der Offizier schaute mich betroffen an. Seine Stimme klang gepreßt:
»Etwas in eurem Glauben ist aufsässig gegen jede irdische Macht. Aber auch ihr werdet im Römischen Reich euren Platz finden wie alle anderen Völker. Denn unsere Aufgabe ist es, dem Frieden der Welt eine Ordnung zu geben, die Unterworfenen zu schonen, die Aufsässigen zu bekämpfen8 – in diesem Land und überall in der Welt.«
Er fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Dein Fall wird noch etwas Zeit brauchen. Wir werden deine Aussagen überprüfen und dann entscheiden, ob Anklage gegen dich erhoben wird.«
Damit war ich entlassen. Ich wurde in meine Zelle zurückgebracht. Jetzt hieß es: warten! Wie lange würde es wohl dauern, bis sie Erkundigungen über mich eingezogen hatten? Eigentlich war ich zuversichtlich. Ich stammte aus einer angesehenen Familie mit guten Beziehungen zu den Römern. Aber es gab Unsicherheitsmomente: Was würde Timon alles noch aussagen? Würde er den Mund über Barabbas halten? Gesehen hatte er ihn nie. Aber er könnte in Gesprächen von ihm gehört haben. Wenn die Beziehungen zu Barabbas im Dunkeln blieben, konnte eigentlich nicht viel passieren – wenn!
Damals hatte ich dunkle Vorahnungen: Mein Schicksal schien mir Vorbote dunkler Geschicke zu sein, die unser ganzes Volk treffen würden. Jene Spannungen zwischen Juden und Römem, die zur Demonstration gegen Pilatus geführt hatten, würden sich immer mehr steigem – bis hin zum offenen Aufstand gegen die Römer. Namenloses Elend würde über unser Land hereinbrechen, Elend von Krieg und Unterdrückung.9 Gemessen an diesem Elend war das Unglück meiner Inhaftierung gering. Aber darin lag nur wenig Trost. Im dunklen Gefängnis des Pilatus kam mir die Zeit des Wartens endlos lang vor. Es war eine schlimme Zeit für mich.
Sehr geehrter Herr Kratzinger,
vielen Dank für Ihre Stellungnahme zum ersten Kapitel. Sie vermissen in ihm eine Spur, die zu Jesus führt. Haben Sie bitte etwas Geduld! Wenn ich zunächst die Zeit Jesu schildere, so erfülle ich nur die Pflicht jedes Historikers: eine geschichtliche Erscheinung aus ihrem Kontext heraus verständlich zu machen. Dieser Kontext ist bei Jesus die soziale und religiöse Welt des Judentums.
Die Evangelien vermitteln hier ein einseitiges Bild. Sie sind in einer Zeit geschrieben (ca. 70-100 n.Chr.), in der aus der innerjüdischen Erneuerungsbewegung um Jesus eine Religion neben dem Judentum geworden war, die mit ihrer Mutterreligion konkurrierte. Ihre Schriften bieten oft nur ein verzerrtes Bild vom Judentum. Dem Bibelleser wird daher nicht klar, wie tief Jesus im Judentum verwurzelt ist.
Die Evangelien suggerieren ferner, Jesus habe damals im Zentrum der Geschichte Palästinas gestanden. Historisch gesehen war er aber eine Randerscheinung. Man stößt nicht sofort auf seine Spuren, wenn man sich mit dem Palästina des 1. Jhs. n.Chr. beschäftigt. Diese Erfahrung des Historikers soll dem Leser vermittelt werden. Ich verspreche Ihnen aber: Es wird in meiner Erzählung noch viele Spuren geben, die zu Jesus führen.
Ich entnehme Ihrem Brief, daß Sie endgültig über mein Buch erst urteilen wollen, wenn sie mehr gelesen haben. Darf ich das als Aufforderung verstehen, Ihnen weitere Kapitel zu schicken? Das zweite ist soeben fertig geworden.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Gerd Theißen
2. KAPITEL
Die Erpressung
Das Schlimme war, daß ich mit niemandem über meine Lage sprechen konnte. Wer wußte überhaupt von ihr? Ob meine Eltern ahnten, wo ich war? Ob Malchos sich nach Hause durchgeschlagen hatte? Ob Timon in einer anderen Ecke dieser Kellergewölbe lag? Dunkle Bilder stiegen in mir auf: Wie viele Juden waren hier schon eingekerkert, wie viele gefoltert, wie viele getötet worden? Wie viele einfach verschwunden? Und was würde mit mir geschehen?
In diesem Loch, in das keine Sonne drang, und kein Geräusch außer den Schritten der Wachen ging jedes Zeitgefühl verloren. Diese Zelle war wie ein Sarg, in dem ich lebend eingesperrt war. Todesangst erfüllte die stickige Luft. Verzweifelt betete ich:
»Herr, unser Gott, schaffe mir Recht,denn ich bin unschuldig.Ich habe auf dich vertraut.Prüfe mich,erprobe mich.Du kennst mich besser, als ich mich kenne.Verteidige mich vor ihrem Tribunalgegen falsche Aussagen und Verleumdungen.Bewahre mich vor den Intrigen ihrer Geheimpolizei!Ich habe mit den Mächtigen keine Komplizenschaft.Ich verachte,die das Leben der Menschen verachten,die es wie Dreck behandeln,die uns ins Gefängnis werfen,die uns erniedrigen und mißhandeln.Laß mich nicht durch ihre Hände umkommen!An ihren Händen klebt Blut.Durch Bestechung verschaffen sie sich Reichtümer,durch Erpressung üben sie Macht aus.Wer sie kritisiert, verschwindet in ihren Kellern!Wer sich auflehnt, wird beseitigt!Gott, laß mich wieder dein Haus sehen,wo deine Herrlichkeit wohnt.Erlöse mich aus den Händen dieser Banditen.Und ich will dich loben und preisenin der Gemeinde!«10
Ich zählte die Tage an den kargen Essensrationen, die man mir regelmäßig zuschob. Die erste Woche verstrich. Nichts tat sich. Die zweite Woche verstrich. Sie schien mir wie ein Jahr. Endlich, in der dritten Woche wurde ich herausgeholt.
Wollte man mich freilassen? Ich schöpfte Hoffnung. Zunächst ging es durch ein Labyrinth von Gängen. Dann wurde ich in einen großen Raum geschoben. Ich stand geblendet vom Licht, das durch die Fenster hereinflutete. Allmählich erkannte ich Einzelheiten. Vor mir stand ein Richterstuhl auf erhöhtem Podest. Auf ihm saß ein kleiner Mann. Er trug eine kostbare weiße Toga mit Purpurstreifen. An seiner Hand glänzte ein goldener Ring – Zeichen dessen, daß er römischer Ritter war. Der Soldat, der mich hereingeführt hatte, flüsterte mir zu: Der Präfekt. Das also war Pontius Pilatus, der Präfekt von Judäa und Samarien.11
Ein Verhör an höchster Stelle. Hier mußte sich mein Fall entscheiden. Wenn nur nichts von Barabbas rausgekommen war!
Pilatus las in einer Rolle, als ich den Raum betrat. Rechts und links von ihm standen zwei Soldaten der Leibgarde. Ein Schreiber führte Protokoll. Ohne seinen Blick zu heben, begann Pilatus:
»Andreas, Sohn des Johannes, ich habe das Protokoll des Verhörs gelesen. Du behauptest, nur zufällig in die Demonstration gegen mich hineingeraten zu sein. Wir haben inzwischen Informationen über dich eingeholt. Wir haben sehr viel erfahren. Warum hast du uns Wichtiges verschwiegen?«
»Ich habe keine Ahnung, was noch besonders wichtig gewesen wäre«, sagte ich zögernd.
»Es ist wichtig.«
Er schaute mich unbeeindruckt an und fuhr mit monotoner Stimme fort:
»Es fehlt etwas in deinem Lebenslauf.«
»Ich weiß nicht, was die römische Behörde noch interessieren könnte.«
»Wo warst du nach Abschluß der Grammatikschule?«12
Aha, das war es also! Irgendjemand hatte mir einmal gesagt: Vor der Staatspolizei die Wahrheit sagen, aber möglichst wenig von ihr. Also sagte ich:
»Ich war in der Wüste bei einem Asketen, einem gewissen Bannos, – ein Jahr lang.«
»So – und da hast du Askese getrieben und sonst nichts?«
»Ich wollte den Weg zum wahren Leben finden. Ich habe das Gesetz unseres Gottes studiert.«
»Warum hast du das verschwiegen?«
»Warum sollte ich dies Jahr erwähnen? Es war eine rein religiöse Angelegenheit.«
»Diese ›rein religiöse Angelegenheit‹ erlaubt auch andere Deutungen. Erstens: Du warst ein Jahr bei den Widerstandskämpfem untergetaucht. Zweitens: Du wirst bei einer Demonstration gegen den römischen Präfekten inhaftiert. Drittens: Diese Demonstration wird von einigen Scharfmachern aus dem Untergrund gelenkt.«
»Soll ich etwa dieser Scharfmacher und Drahtzieher sein? Das ist Unsinn!«
»Aber es ist möglich.«
»Ich war in der Wüste, um in der Einsamkeit nachzudenken. Nicht jeder, der das normale Leben zeitweise hinter sich läßt, ist ein Unruhestifter und Terrorist. Ich bin für den Frieden.«
»Du hast deinen Wüstenaufenthalt verschwiegen. Das ist verdächtig.«
Ich kam ins Schwitzen. Die Haare klebten auf meiner Stirn. Meine Kleider stanken. Drei Wochen hatte ich sie nicht wechseln können. Man hatte mir nicht gestattet, mich zu waschen. Äußerlich mußte ich ein jämmerliches Bild abgeben. Aber auch in mir geriet alles durcheinander. Ich war zwar wirklich – wie viele andere – aus religiösen Gründen in der Wüste gewesen, um dort in der Einsamkeit einer Oase das Leben zu durchdenken und nach Gottes Willen zu fragen.13 Aber ich hatte dort auch Barabbas kennengelemt. Ob Pilatus davon wußte? Der aber wiederholte nur:
»Das alles ist sehr verdächtig!«
»Alles wird verdächtig, wenn man es mit mißtrauischen Augen ansieht. Ich bin nur durch Zufall in die Demonstration hineingeraten. Ich habe ein gutes Gewissen. Deswegen bin ich auch nicht wie alle anderen weggelaufen«, beteuerte ich.
Pilatus wirkte noch immer völlig teilnahmslos. Was wollte er von mir?
»Ich könnte ein Gerichtsverfahren einleiten«, sagte er nach einer kurzen Pause.
»Man wird mich freisprechen müssen!«
»Vielleicht. Aber ich könnte dich nach Rom zur weiteren Untersuchung schicken.«
»Auch dort wird man mich freisprechen.«
»Das dauert zwei Jahre. Zwei Jahre Gefängnis wären dir sicher!« Er sah mich an und lächelte vielsagend.
Worauf wollte er hinaus? Er konnte nicht jeden Verdächtigen nach Rom schicken. Dann hätte er halb Palästina aufs Schiff verfrachten müssen. Andererseits stand fest, daß er mir schaden konnte, unabhängig davon, ob ich schuldig gesprochen würde oder nicht. Pilatus fuhr fort:
»Ich mache dir ein faires Angebot. Du bist sofort frei, wenn du dich bereit erklärst, uns Material über bestimmte religiöse Bewegungen im Land zu liefern.«
»Das ist Erpressung!«
In mir kochte es vor Wut und Empörung. Ich hätte Pilatus ins Gesicht spucken mögen. Dieser Mensch versuchte, mich schamlos zu erpressen und sprach von Fairneß.
»Sagen wir, es ist ein Geschäft, das auf gegenseitigen Interessen beruht.«
»Ich will nicht spionieren.«
»Das Wort ›Spion‹ sollten wir in diesem Zusammenhang nicht benutzen. Sprechen wir lieber von ›recherchieren‹. Du sollst niemanden anzeigen oder denunzieren.«
Wie zynisch Pilatus redete! Als wüßte er nicht, daß es auf Denunziation hinausliefe, wenn man über eine Gruppe von Menschen berichtet, ihre Ideen seien nicht im Sinne der römischen Besatzung. Ich beherrschte mich und versuchte so ruhig wie möglich zu sagen:
»Keinem meiner Landsleute wird der Unterschied zwischen Spionieren und Recherchieren einleuchten.«
»Wir würden dich als -«, Pilatus wandte den Kopf etwas zur Seite. Dann schien er das richtige Wort gefunden zu haben,»- als Berater in religiösen Fragen betrachten.«
Ich schwieg.
»Gut, wie du willst! Dann werden wir eben ein Verfahren gegen dich in Gang setzen und deine Zeit in der Wüste – oder wo immer du warst – unter die Lupe nehmen!«
»Also doch Erpressung!«
Hatte Pilatus etwas über meine Beziehungen zu Barabbas herausgefunden? Wozu war er fähig? Es gab böse Gerüchte über ihn, Gerüchte von Mißhandlungen und Gewalttaten. Konnte er mich nicht einfach verschwinden lassen? Konnte er nicht jederzeit falsche Aussagen gegen mich arrangieren? Konnte er mich nicht durch Folter zu jedem Geständnis bewegen? Und wenn ich nachgäbe? Aber ich wehrte mich noch mit aller Kraft gegen diesen Gedanken.
»Andreas, du bist empört. Ich verstehe dich. Du bist noch jung. Aber ich habe in einem langen Leben gelernt, daß Menschen freiwillig nur schwer zu nützlichen Handlungen zu bewegen sind. Man muß nachhelfen.«
Seine Stimme klang noch immer so distanziert und nüchtern wie am Anfang unserer Unterhaltung. Ich hatte den Eindruck, daß ihn mein persönliches Schicksal kalt ließ. Im Grunde schien es ihm gleichgültig zu sein, ob ich auf sein Angebot einging oder nicht. Und das machte mir Angst.
»Von mir aus nenne es Erpressung. Versuche es einmal von meiner Warte aus zu sehen: Ich bin in diesem Land für Frieden und Ordnung verantwortlich. Das ist eine schwere Aufgabe. Warum? Weil wir Römer ständig eure religiösen Empfindlichkeiten verletzen, obwohl wir das nicht wollen. Nimm diese Wasserleitungsaffäre als Beispiel. Meine Idee war, für Jerusalem endlich eine vernünftige Wasserversorgung bauen zu lassen. Meine besten Architekten und Bauleute sollten damit beauftragt werden. Nur, zur Finanzierung reichten die Gelder nicht aus. Experten bestätigten mir, daß für die Wasserversorgung in Jerusalem die Tempelkasse zuständig ist.14 Geld ist in ihr genug da. Jeder Jude zahlt jährlich eine Tempelsteuer. Also trat ich an den Tempel mit dem Ansinnen heran, die Wasserleitung aus Mitteln des Tempels zu finanzieren. Völlig in Übereinstimmung mit euren Gesetzen. Was geschah? Ein paar fromme Fanatiker wittem Unheil. Sie geben die Parole aus: Kein heiliges Geld für den unheiligen Pilatus! Keinen Pfennig aus dem Tempelschatz für die Römer! Als wäre es darum gegangen, Geld für gottlose Zwecke zu beschlagnahmen! Als ginge es nicht darum, Geld für eine Wasserleitung bereitzustellen, von der der Tempel und ganz Jerusalem profitieren würden. Nun stehen wir Römer wieder als tyrannische Machthaber da, die eure religiösen Gesetze nicht beachten – und sogar den Tempelschatz plündern wollen!«
Darum war es ihm also gegangen bei seiner Wasserleitung. Er wollte sein Ansehen verbessern. Das war gründlich mißlungen. Sollte ich nun helfen, erfolgreicher Propaganda für ihn zu treiben? Die Erregung, die sich einen Moment lang in seine Stimme eingeschlichen hatte, war wie weggeblasen, als Pilatus fortfuhr:
»Das Ganze war ein Rückschlag. Aber trotz solcher Rückschläge müssen wir weiterhin alles tun, um diesem Land den Frieden zu erhalten. Es gibt Chancen dafür. Meine Zuversicht basiert auf zwei Überlegungen:
Einmal auf den bewährten Prinzipien römischer Politik im Umgang mit unterworfenen Völkern. Wir betrachten es als Geheimnis unseres Erfolges, daß wir Feindschaft in Freundschaft verwandeln können. Denn wen hat das römische Volk zu treueren Bundesgenossen als die, die seine hartnäckigsten Feinde waren? Was wäre heute das Reich, wenn nicht Weitblick Besiegte mit Siegern verschmolzen hätte?15 Die Juden aber waren nicht immer unsere Feinde. Im Gegenteil: Als unsere Bundesgenossen habt ihr euch von der Herrschaft syrischer Könige befreit!16 Mit unserer Unterstützung gelang es euch damals, eure eigene Religion und Kultur zu wahren. Erst später, als eure Nachbarn uns um Schutz vor euren militärischen Übergriffen baten, kamt ihr unter unsere Herrschaft – gerade rechtzeitig, daß wir einen drohenden Bürgerkrieg verhindern konnten, der euer Land in tiefes Elend gestürzt hätte.17 Aber auch in dieser Situation haben wir eure Religion unangetastet gelassen! Unsere Politik wird auch weiterhin sein: Respekt vor eurer Religion, eurem Gott, euren Bräuchen, euren Empfindlichkeiten. Wir respektieren auch das, was uns fremd ist. Wir erwarten nur, daß auch ihr respektiert, was uns heilig ist, daß ihr die Ehrfurcht, die unsere Soldaten für den Kaiser haben, achtet und jedem Menschen zubilligt, überall seine Götter verehren zu dürfen. Respekt muß auf Gegenseitigkeit basieren.
Und nun meine zweite Überlegung. Aus Gesprächen mit euren führenden Priestern weiß ich, daß auch ihr grundsätzlich unsere Herrschaft akzeptiert. Gott hat schon lange zugelassen, daß andere Völker über euch regieren: Ihr habt Babylonier, Perser und Griechen ertragen – warum nicht auch die Römer, die gegenüber unterworfenen Völkern weit entgegenkommender sind als alle Weltreiche vorher? Ihr sagt: Alles, was geschieht, ist von dem einen und einzigen Gott, der in Jerusalem verehrt wird, verfügt.« – Er machte eine Pause, als wollte er mir Zeit zum Nachdenken lassen. – »Dann müßt ihr auch zugeben: Er hat gewollt, daß wir Römer unser Weltreich aufgebaut haben. Er hat gewollt, daß ihr die Unabhängigkeit, die ihr mit unserer Hilfe gegen die Syrer erkämpft habt, durch uns verloren habt.18 Es gibt keinen Grund, warum das jüdische Volk uns nicht als Beherrscher der Welt akzeptieren kann – zumal wir Verständnis dafür haben, daß ihr anders als alle anderen Völker im Osten den Kaiser nicht als Gott verehren könnt.
Grundsätzlich dürfte es also keine Probleme geben. Aber im Konkreten haben wir große Schwierigkeiten. Vor allem folgende Schwierigkeit: Was eure führenden Priester uns sagen, ist nicht das, was das Volk bewegt. Zur Zeit scheint sich in eurer Religion viel zu verändern. Es gärt im Volk. Immer wieder tauchen neue Ideen und Bewegungen auf. Propheten und Prediger ziehen durchs Land. Es ist für uns schwer, sich in diese neuen Bewegungen einzufühlen. Euren führenden Priestern geht es nicht viel besser. Sie haben in einigen Kreisen der Bevölkerung die geistige Führung verloren. Eben von diesen Kreisen hängt aber die Stabilität des Landes ab. Wir brauchen Informationen über sie. Wir sind bereit, so weit es geht, ihre religiösen Gefühle zu respektieren und unnötige Ärgernisse auszuräumen. Aber dazu müssen wir wissen, was im Volk vor sich geht. Experten für das offizielle Judentum haben wir genug. Wir brauchen jemand, der das Ohr näher am Boden hat. Nur dann können wir durch zusätzliche Informationen Konflikte entschärfen, noch ehe sie ins Rollen kommen.«
»Aber warum soll gerade ich der rechte Mann dazu sein!«
»Du bist gebildet. Du sprichst unsere Sprache und ihre Sprache. Du kennst dich in religiösen Fragen des Judentums aus und in unserer Religion. Du stammst aus einer den Römern gegenüber wohlwollend eingestellten Familie. Du bist kein Fanatiker. Du bist für den Frieden. Daß ihr in einem Nebenzimmer einen kleinen Götzen stehen habt, macht euch direkt sympathisch. Ich habe schon lange den Auftrag gegeben, nach so jemandem wie dir zu suchen. Du bist der richtige Mann!«
»Aber ich will nicht!«
Ich wollte wirklich nicht. Es wäre ein unerträgliches Doppelspiel. Wie sollte ich das auf einen Nenner bringen: Meine Freundschaft zu Barabbas und meine Arbeit für die Römer! Wie leicht konnte ich mich zwischen alle Stühle setzen. Pilatus aber sagte ruhig:
»Bedenke: Etwas bleibt immer hängen. Auch wenn du freigesprochen wirst. Ich brauch nur in Cäsarea zu erzählen, du seist verdächtig, Beziehungen zu Terroristen zu haben. Das wird deinem Geschäft nicht gerade nutzen. Es wäre dein Ruin. Und der Ruin deines Vaters.«
Also doch Erpressung! Ich merkte, wie in mir ein tiefes Gefühl der Verachtung hochkam. Bei diesen Mächtigen war alles Taktik. Alles berechnend. Ihre wirklichen Gefühle und Einstellungen blieben verborgen. Sicher war nur, daß sie ihre Macht erhalten wollten! Ob Pilatus meine Gedanken erriet? Er setzte noch einmal an:
»Finde in diesem Land mal jemanden, der ohne Erpressung etwas für uns tut! Du hältst mich jetzt wahrscheinlich für einen ganz schrecklichen Menschen, so wie mich andere für einen Unmenschen halten. Vor kurzem hörte ich, was man unter den Juden in Alexandrien über meine Amtsführung erzählt; sie sei eine Kette von Bestechungen, Gewalttaten, Räubereien, Mißhandlungen, Beleidigungen, Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren, fortwährender unerträglicher Grausamkeit.19 Ich gebe zu: Im Sinne des Friedens bin ich zu vielem bereit. Aber so ein Unmensch bin ich nicht!«
Er grinste. Wahrscheinlich merkte er selbst, daß seine Worte nicht besonders überzeugend wirkten. Doch vielleicht war auch das Taktik. Ich versuchte, Zeit zu gewinnen:
»Wie soll ich Zugang zu all diesen religiösen Bewegungen finden?« Ich durfte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, daß ich schon Kontakte zu ihnen besaß.
»Keine Sorge. Du bleibst noch eine Weile im Gefängnis. Du wirst gut behandelt. Es soll dir an nichts fehlen. Wir sorgen dann dafür, daß überall durchsickert: Die Römer halten einen jungen Mann gefangen, der durch Standhaftigkeit und Treue gegenüber der jüdischen Religion hervorsticht. Ihm geht es schlecht. Trotzdem macht er keinen Hehl daraus, daß die Römer zu Unrecht in diesem Land sind, das allein Gott gehört. Kurzum: Wir verschaffen dir einen Heiligenschein. Dann entlassen wir dich. Alle frommen Kreise werden dir vertrauen. Du sollst lediglich im Lande umherreisen und einen Bericht über die religiöse Stimmung im Volke schreiben. Dabei interessiert uns alles, was die politische Stabilität im Lande gefährden könnte, alles was unsere Herrschaft in Frage stellt. Mein Beamter Metilius, den du schon kennengelernt hast, wird dir deine Aufgabe erläutern. Er versorgt dich mit den Informationen, die wir zur Zeit schon besitzen. Einverstanden?«
»Ich möchte es mir noch einmal überlegen.«
»Gut! Überlege dir die Sache. Bis morgen. Und denk daran: Entgegen anderslautenden Gerüchten bin ich kein Unmensch.«
Wieder erschien ein Grinsen auf seinem Gesicht. War das Gespräch beendet? Nein, Pilatus wandte sich noch einmal an mich:
»Ich las im Protokoll etwas von Bildern des Antipas in seinem Palast. Hast du sie selbst gesehen?«
»Ja, und es gibt auch andere, die sie bezeugen könnten.«
»Dieser Heuchler! Stellt Tierbilder bei sich zu Hause auf, aber protestiert, wenn ich in meinem Jerusalemer Amtssitz Schilde mit dem Namen des Kaisers aufhängen will.20 So etwas widerspräche euren Gesetzen!
Überhaupt diese Heuchelei: Man regt sich über meine Münzen mit harmlosen Opfersymbolen auf21, aber die Tempelsteuer darf man nur in tyrischer Münze zahlen! Und was findet sich dort eingeprägt? Der Gott Melkart – ein Götze!22 Im Tempelvorhof wird alles Geld gegen diese Götzenmünzen eingetauscht. Wenn ich über den Tempelvorhof gehe, kriege ich manchmal Lust, die Tische der Geldwechsler umzustoßen! Über die regt sich keiner auf! Aber über meine harmlosen Kupfermünzen entsteht ein großes Geschrei! Doch lassen wir das!«
Pilatus hatte sich in Zorn geredet. Fast schien es, als hätte er meine Gegenwart vergessen. Doch im nächsten Moment wandte er sich mir zu. Seine Stimme klang wieder nüchtern, kalt und tot. Sie machte mir Angst:
»Überleg dir deine Entscheidung gut! Und vergiß nicht: Ich bin nicht der Unmensch, den andere in mir sehen. Ich bin nur ein römischer Präfekt, der sein Land in Ordnung halten will.«
Ich wurde abgeführt und saß wieder in meiner dunklen Zelle. Man hatte mir einen Weg nach draußen gezeigt. Aber es war eine Sackgasse. Ich saß in der Falle. Ich verwünschte meine Lage, und in meiner Ohnmacht wandte ich mich wieder an den Gott meiner Väter:23
»Befreie uns, Gott, von diesen Schurken!Es gibt keine anständigen Menschen mehr.Verschwunden ist alle Menschlichkeit.Mit Propagandareden umnebeln uns die Mächtigen.Sie machen sich über uns lustig.Von ihren Lippen kommen schöne Worte,aber ihre Gedanken sinnen auf Unterdrückung.Sie sprechen vom Frieden und drohen mit Waffen.Sie reden von Toleranz und meinen ihre Macht.Laß sie ersticken an ihren Reden,an ihren wohlabgewogenen Worten,die so staatserhaltend klingenund uns das Rückgrat brechen wollen.Zerstör die Arroganz ihrer Machtund den Zynismus ihrer Herrschaft.Sprich, Herr:›Um der Unterdrückten willen,um der Gefangenen willenwill ich mich erheben,will ich retten,die nach Freiheit seufzen!‹Gott, du wirst uns bewahren und beschützenvor Verbrechern und Diktatoren!Du bist unser Haltinmitten von Menschen, denen nichts heilig ist!Gemeinheit breitet sich aus unter den Menschen.Aber dein Wort ist zuverlässig,ein Licht im Dunkeln.«
Sehr geehrter Herr Kollege Kratzinger,
Sie »bewundern« meinen Mut, unbefangen Geschichten von Pilatus zu erfinden. Ihnen würde als Historiker und Exeget das gute Gewissen dazu fehlen.
Natürlich hat Pilatus nie die Gespräche geführt, die ich ihm zuschreibe. Aber die Rahmenbedingungen seines Handelns, die in diesem Gespräch sichtbar werden, sind dieselben, die ich gerade in meiner Vorlesung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte analysiere. Gegenstand der Geschichtswissenschaft sind ja nicht nur individuelle Ereignisse, sondern auch typische Konflikte und Strukturen. Sie bilden die »Spielregeln«, nach denen die von mir erfundene Handlung abläuft.
Wenn ich mich einmal unserer akademischen Sondersprache bedienen darf, so würde ich sagen: Voraussetzung »narrativer Exegese« – so nennt man heute Erzählungen wie mein Jesusbuch – ist der Schritt von der Ereignis- zur Strukturgeschichte. Die Tiefenstruktur narrativer Exegesen besteht aus historisch rekonstruierten Verhaltensmustern, Konflikten und Spannungen, ihre Oberflächenstruktur aus fingierten Ereignissen, in denen historisches Quellenmaterial dichterisch verarbeitet wird. Diese Definition von »narrativer Exegese« klingt für meinen Geschmack zu prätentiös. Aber Sie wissen ja: Was nicht kompliziert formulierbar ist, wird in der akademischen Welt nicht ernst genommen.
Übrigens darf man in einer »narrativen Exegese« bei der Verwendung von Quellenmaterial die Chronologie manchmal vernachlässigen. Auch Ereignisse nach Jesu Tod können die strukturellen Bedingungen des Geschehens zur Zeit Jesu illustrieren. Ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich z.B. den Wüstenasketen »Bannos«, der in den 50er Jahren in der Jordanwüste gewirkt hat, um ca. 25 Jahre zurückdatierte. Sie haben das als »Anachronismus« kritisiert. Aber so anachronistisch verfährt die Wissenschaft oft. Würden wir eine wissenschaftliche Abhandlung über Johannes den Täufer nicht mit Recht kritisieren, wenn sie nicht auf den Wüstenasketen Bannos als nächste Analogie hinwiese?
Ihre Meinung zum nächsten Kapitel würde mich sehr interessieren!
Mit freundlichen Grüßen bin ich Ihr Gerd Theißen
3. KAPITEL
Die Entscheidung des Andreas
Andreas – ein Spion des Pilatus? Nie und niemals! Alles in mir bäumte sich dagegen auf! Mochte Pilatus mich jahrelang in diesem Kellerloch einsperren – niemals wollte ich jemanden an die Römer verraten! Diese Römer hatten zwar Ruhe und Frieden in unser Land gebracht. Doch was war das für ein Frieden, der durch Unterdrückung und Erpressung zustande kam! Was war das für eine Ruhe, die nur Bestand hatte, weil Leute gewaltsam zum Schweigen gebracht wurden. In mir tobten die Gedanken hin und her.
Aber was sollte ich tun? Was würde geschehen, wenn ich nein sagte? Würde Pilatus mich foltern lassen, Informationen über Freunde, Familie, möglicherweise auch über Barabbas aus mir herauspressen? Würde er mich heimlich umbringen lassen, damit keiner von seinen Erpressungsversuchen erfuhr? Oder würde er mich zur Abschreckung öffentlich kreuzigen? Würde er meine Familie wirtschaftlich ruinieren? Was würde mit Timon geschehen? Mir klang noch das letzte Wort in den Ohren: Ich bin nicht der Unmensch, den andere in mir sehen! War das nicht ein deutlicher Wink? Sollte es nicht bedeuten: Nimm dich in Acht vor mir, vielleicht bin ich doch der Unmensch, als der ich bei anderen gelte.
Könnte ich mich dieser Qual doch entziehen! Irgendwohin, wo mich keine Erpressung erreichen kann! Wo niemand befiehlt und droht! Wo all die quälenden Stimmen in mir verstummen und alles ganz still ist!
Ich sehnte mich nach dem Tod. Hatte ich nicht von den Philosophen gelernt24: Es gibt auch in den schlimmsten Situationen einen Ausweg. Ein Tor steht immer offen: der Tod. Durch dies Tor konnte man sich den grausamsten Tyrannen entziehen. Aber war Selbstmord die richtige Lösung? Die Römer bewunderten Cato und Brutus, die sich in auswegloser Lage den Tod gegeben hatten. Auch unter Juden war diese Einstellung zu finden. Aber im Grunde dachten wir anders: Wir haben von Gott den Auftrag zum Leben. Wir können ihn nicht zurückgeben, wenn wir meinen, er sei zu schwierig. Denn wer kann wissen, was Gott noch mit uns vorhat – er, der den Verlierern und Ausgestoßenen Mut gibt. Auch unsere Vorfahren waren von allen verlassen gewesen – verlassen von den vielen Göttern, die in der Welt verehrt werden, verlassen von allen Menschen. Sie waren hilflos und verzweifelt durch die Wüste geirrt. Aber sie hatten sich nicht aufgegeben. Sie hatten Mose geglaubt, daß sie einen Auftrag hatten, den sie nicht verraten durften!
Hätte ich wenigstens die Freiheit, in der Wüste herumzuirren! Da durchfuhr mich der Gedanke: Warum sollte ich nicht zum Schein auf das Angebot des Pilatus eingehen – um spurlos in der Wüste zu verschwinden? Ich hatte gelernt, wie man in der Wüste überlebt. Bannos hatte es mir beigebracht. Zu ihm könnte ich gehen. Vielleicht war ich jetzt so weit, seine Lehre zu verstehen. Damals war sie mir fremd geblieben.
Was hatte mich zu ihm hinausgetrieben? Es war eine große Unruhe gewesen, die ich nur schwer erklären kann. Ich war in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen. Wir faßten jüdische Sitten und Überzeugungen philosophisch auf. Mein Vater sagte immer: Die Bibel spricht aus, was die griechischen Philosophen denken. Ich erinnere mich, wie wir einmal den Aufgang der Sonne bewunderten. Wir waren auf einen Berg geklettert, um sie zu erwarten. Da durchbrach sie den morgendlichen Dunst und verwandelte die Landschaft in ein wunderbares Spiel von Farben und Licht. Mein Vater sagte: »Wie gut verstehe ich, daß die Heiden die Sonne verehren. Sie ist nur ein Abglanz des wahren Gottes. Durch seinen Abglanz hindurch spüren sie Gott. Sie verwechseln zwar den Schöpfer mit seinen Geschöpfen, aber sie haben Sinn für die Schönheit dieser Welt.«25
Er liebte schöne Dinge. Deswegen hatte uns ein Gastfreund einmal eine kleine Götterstatue geschenkt. Für meinen Vater war sie die Darstellung eines schönen Menschen, nicht mehr. Er versteckte sie in einem Nebenraum. Seine Überzeugung war: Wenn einmal der Gedanke an die Unvergleichlichkeit Gottes in allen Herzen verankert ist, kann man getrost alle Dinge dieser Welt in Bildern darstellen!26
In solch einer Atmosphäre war ich aufgewachsen. Aber dann hatte ich entdeckt, daß nicht alle so dachten wie meine Eltern. Ich lernte den Glauben einfacher Menschen kennen, die kein Bedürfnis hatten nachzuweisen, daß ihr Glaube mit der griechischen Philosophie gleichwertig war. In fragloser Selbstverständlichkeit glaubten sie an die Einzigkeit Gottes, der keiner Verteidigung und Rechtfertigung bedurfte. Entscheidend war für sie, daß man seinen Willen erfüllte und seine Gebote im Alltag ernst nahm. Ich entdeckte eine neue Welt.
Damals entstand in mir das Verlangen, meinen jüdischen Glauben von Grund auf kennenzulernen. Ich wollte ihn durchbuchstabieren – mit meinem ganzen Leben. Ich sehnte mich nach Entschiedenheit und Klarheit. Da hörte ich von Bannos. Mich zog an, daß er in der Wüste lehrte – jenseits des normalen Lebens. Auch er meinte, wir Juden müßten noch einmal von vorne anfangen: So wie wir aus Ägypten durch die Wüste gezogen waren, um in dieses Land zu kommen, so müßten wir wieder in die Wüste. Wir müßten noch einmal in ihr die Stimme dessen hören, der im Dornbusch gesagt hat: »Ich bin, der ich bin!«
Bannos Ansichten waren radikal: Nicht nur die Juden, nein, die ganze Welt müsse von vorne beginnen. Diese bestehende Welt sei mißraten. Es sei eine Welt von Unrecht und Unterdrückung, Ausbeutung und Angst. Sie würde in einem großen Strafgericht Gottes an ihren Widersprüchen zugrunde gehen. Dann aber werde eine neue Welt beginnen. Ich höre noch seine Stimme:
»Dann wird Gott ein ewiges Königreich für alleMenschen errichten,derselbe Gott, der einst das Gesetz gab.Alle Menschen werden diesen Gott verehrenund zu seinem Tempel strömen.Und es wird nur einen Tempel geben.Von überall werden Wege zu ihm führen.Alle Gebirge werden gangbar,alle Meere schiffbar.Alle Völker werden in Frieden leben.Alle Waffen werden verschwinden.Reichtum wird gerecht verteilt sein.Und Gott wird unter den Menschen sein.Wölfe und Schafe werden auf den Bergen zusammenGras essen,Panther werden mit Böcklein weiden.Bären werden mit Kälbern lagern,und der Löwe wird Stroh aus der Krippe fressenwie ein Ochsund kleine Jungen werden ihn an einem Strick führen.Drachen und Nattern werden mit Säuglingen schlafenund ihnen kein Leid antun.Denn die Hand Gottes wird über ihnen sein.«27
Schöne Träume waren das! Träume von einer Flucht in eine neue, bessere Welt! Nicht viel besser als mein Traum von einer Flucht in die Wüste. Wie unrealistisch war er doch! Die Römer wußten ja von meinem Wüstenaufenthalt. Sie würden mich überall suchen lassen. Bannos würde mit ins Verderben gezogen werden. Und wahrscheinlich würden sie dann erst recht auf die Spuren von Barabbas kommen.
Ich war schon einige Zeit mit Bannos zusammen gewesen, als Barabbas zu uns stieß. Auch der kam aus Galiläa und stammte wie ich aus Sepphoris. Seine Eltern waren als junges Ehepaar mit Mühe der Katastrophe unserer Stadt entkommen. Sie hatten Haus und Besitz verloren. Jetzt wohnten sie in bescheidenen Verhältnissen in Gischala im Norden Galiläas. Die Flucht aus Sepphoris und die barbarische Behandlung der Stadt hatte das Leben der Familie geprägt: Bei ihnen wurden die Römer abgelehnt – ebenso wie die herodäischen Fürsten, in denen sie nur Marionetten der Römer sahen. Nicht daß sie die Fremden ablehnten, weil sie Fremde waren. Sie lehnten sie ab, weil sie Sklaverei und Unterdrückung brachten.
Was hatte Barabbas in der Wüste gesucht? Wollte er sich vor den Römem verstecken? Hatte er ein Verbrechen gegen sie begangen? Ich wußte es nicht. Nur so viel war klar: Während ich unterwegs war, in der großen Welt des Judentums eine Heimat zu finden – war für ihn die Entscheidung gefallen. Er hatte seine Heimat gefunden. Ihm ging es darum, sie gegen die verlockende Welt der Römer und Griechen zu behaupten. Er strahlte Gewißheit aus. Das zog mich an. Er wußte, was seinem Leben Sinn und Inhalt geben sollte. Ich suchte.