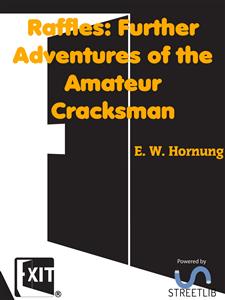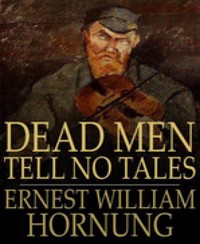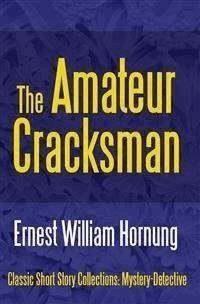Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Rachel Minchin ist angeklagt, den Mord an ihrem Ehemann geplant zu haben. Die Beweise sind erdrückend. Das Urteil nur zu schnell gefällt. Während der Gerichtsverhandlung ist immer ein mysteriöser Fremder zugegen. Dieser Fremde versucht, mit Rachel Kontakt aufzunehmen. Weiß er, was zu ihrer Entlastung beitragen könnte? Parallel dazu versucht ein Detektiv, eine Neuaufnahme des Falles zu erwirken. Wird eine neue Untersuchung, Licht in die Angelegenheit bringen? Dieses Meisterwerk der komplexen Kriminalliteratur macht klar, warum Ernest William Hornung als ein absoluter Könner seines Fachs angesehen wurde. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernest William Hornung
Der Schatten des Stricks
Kriminaldrama in zwei Bänden
Ernest William Hornung
Der Schatten des Stricks
Kriminaldrama in zwei Bänden
(The Shadow of the Rope)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Harvey T. DunnÜbersetzung: Alwina Vischer EV: Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart, 1906 (304 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-71-0
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erster Band
Erstes Kapitel. Das Ende vom Lied
Zweites Kapitel. Die Schwurgerichtsverhandlung
Drittes Kapitel. Der Urteilsspruch
Viertes Kapitel. Der Mann im Eisenbahnzuge
Fünftes Kapitel. »Der Mann aus dem Volke«
Sechstes Kapitel. Eine wandelnde Vorsehung
Siebentes Kapitel. Ein Morgenbesuch
Achtes Kapitel. Taube und Schlange
Neuntes Kapitel. Veränderter Schauplatz
Zehntes Kapitel. Eine leise Missstimmung
Elftes Kapitel. Ein weiterer neuer Freund
Zwölftes Kapitel. Ein geheimnisvoller Gast
Dreizehntes Kapitel. Das australische Zimmer
Vierzehntes Kapitel. Ein ernster Kampf
Zweiter Band
Fünfzehntes Kapitel. Eine zufällige Begegnung
Sechzehntes Kapitel. Ein würdiger Gegner Mrs. Venables’
Siebzehntes Kapitel. Freunde in der Not
Achtzehntes Kapitel. Die geladenen Gäste
Neunzehntes Kapitel. Rachels Ritter
Zwanzigstes Kapitel. Eile – –
Einundzwanzigstes Kapitel. – – mit Weile
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Die dunkelste Stunde
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Es dämmert
Vierundzwanzigstes Kapitel. Ein ungeladener Gast
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Langholm findet eine Spur
Sechsundzwanzigstes Kapitel. Ein Kardinalpunkt
Siebenundzwanzigstes Kapitel. Die volle Wahrheit
Achtundzwanzigstes Kapitel. Der Beweggrund
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erster Band
Erstes Kapitel. Das Ende vom Lied
Es ist vorbei«, sagte die junge Frau mit unnatürlicher Ruhe zu sich selbst. »Nicht einen Tag, nicht eine Nacht mehr bleibe ich hier, wenn ich bis zum Morgen fertig werden kann.«
Sie war allein in ihrem Zimmer, und niemand sah die tödliche Blässe des ovalen Gesichts, das verächtliche Beben der feinen Nasenflügel und den tränenlosen Glanz der funkelnden Augen. Während sie noch dastand, polterten schwere Schritte zwei Treppenabsätze hinunter, worauf im Erdgeschoss eine Doppeltür zugeschlagen wurde.
Es war ein hohes, schmales Haus mit fünf je zwei Zimmer enthaltenden Stockwerken – Erdgeschoss und Mansarde mit eingerechnet – ein Haus, wie man sie in London so häufig findet. In diesem hier aber hatte sich vor kurzem ein ebenfalls nicht allzu ungewöhnliches Drama abgespielt, auf das sich jetzt der Vorhang herniedersenkte. Die Mitwirkenden in diesem Trauerspiel bestanden indes nur aus zwei Personen, obwohl die böse Welt von einer dritten munkelte.
Rachel Minchin war, ehe sie den unglücklichen Schritt unternahm, der ihr diesen Familiennamen eintrug, eine ebenso reizende als blutarme junge Australierin gewesen; das heißt, sie hatte in Heidelberg bei Melbourne das Licht der Welt erblickt, stammte aber von englischen Eltern ab, die, mehr vornehm gesinnt als praktisch veranlagt, bei ihrem frühen Tode der Tochter als einzige Ausrüstung für den Kampf des Lebens ein hübsches Gesicht, einen vortrefflichen Charakter und den Stolz einer reichen Erbin hinterließen. Außerdem hatte Rachel eine recht hübsche Singstimme, die indes nicht groß genug war, um ihr eine gesicherte Zukunft zu versprechen. So war sie denn schon mit zwanzig Jahren als Erzieherin in den Wildnissen Australiens tätig, wo Frauen ebenso rar sind als Wasser, wo sich aber auch kein Mann fand, der Rachels Herz hätte höher schlagen machen. Wenige Jahre später verdiente sie sich die Überfahrt nach England als Gesellschafterin einer Dame, und an Bord dieses Schiffes sollte ihr Schicksal sie ereilen.
Mr. Minchin, der ebenfalls bei den Antipoden geboren und fast vierzig Jahre alt geworden war, bis er es endlich zu einem gewissen Wohlstand gebracht hatte, war trotzdem ein weltgewandter, vielgereister Mann und kein wilder Buschklepper. Als tüchtiger Minenbauingenieur hatte er viel vom Leben sowohl in Südafrika als auch in Westaustralien gesehen, und nun wollte er in Europa als wohlhabender und durch keinen Beruf gebundener Mann so recht sein Dasein genießen. Sich eine Frau zu nehmen, lag durchaus nicht in seiner Absicht, und auch Rachel wünschte sich alles eher als einen Gatten. Aber die lange Seereise, ihre unbefriedigende Stellung und die fortgesetzten Aufmerksamkeiten eines hübschen, unterhaltenden, selbstbewussten Weltmannes bildeten für sie in ihrer Unerfahrenheit eine ebenso verhängnisvolle Versuchung als für Alexander Minchin ihre Schönheit und ihre mit so viel Stolz und Würde getragene Armut. In aller Stille ließen sie sich noch am Tage ihrer Landung in England trauen, wo sie beide weder eine einzige befreundete Seele, noch persönlich mit ihnen bekannte Verwandte hatten. Anfangs empfanden sie diesen Mangel jedoch nicht, da sie sich zunächst einmal Europa ansehen und ihr Leben genießen wollten. Die junge Frau besonders gab sich umso eifriger diesen Genüssen hin, als sie mehr und mehr einsah, dass die Vorteile ihrer Heirat doch vorwiegend materieller Art waren. Alexander Minchin erwies sich nämlich im Laufe des abwechslungsreichen Lebens in den großen Städten durchaus nicht mehr als der aufmerksame, stets gutgelaunte Kavalier, an dessen rücksichtsvolles Wesen sie sich an Bord gewöhnt hatte. Einzelner Vorfälle zu näherer Erläuterung bedarf es nicht; nur so viel sei erwähnt, dass sich Mr. Minchin mehr und mehr dem Spiel und Trunk ergab, bis schließlich alle seine guten Eigenschaften von diesen Lastern verschlungen wurden. Rachels rasch aufbrausende, stolze Natur machte die Sache nicht besser. Da sie sich indes wohl bewusst war, dass auch sie bei den immer häufiger werdenden heftigen Auftritten manchen Fehler machte, so neigte sie umso leichter zum Vergeben, wodurch manch bitterer Streit beschwichtigt und eine Katastrophe hinausgeschoben wurde.
Inzwischen langte das reisemüde und durch die Laster des Gatten in seinen Vermögensverhältnissen zurückgekommene Ehepaar wieder in London an, wo Minchin infolge eines zufälligen Dusels in Minenaktien zu einer höheren Art des Spiels, als das bisher betriebene, überging. Er hatte Blut geleckt. Mit Sachkenntnis und ein wenig barem Gelde konnte bei diesen Spekulationen unter Umständen ein Vermögen verdient werden, und Alexander Minchin ging daran, diese Aufgabe zu lösen. Er ließ sich in London nieder, mietete in einer billigen Gegend ein möbliertes Haus, und dort war es, wo die ehelichen Zwistigkeiten ihren Gipfelpunkt erreicht hatten.
»Nicht einen Tag«, sagte Rachel, »nicht eine Nacht mehr bleibe ich hier, wenn ich bis zum Morgen fertig werden kann.«
Da Mrs. Minchin eine ziemlich energische Frau war, so ließ sie es auch jetzt nicht bei leeren Worten bewenden. Die Pause zwischen dem Zuschlagen von Türen im Erdgeschoss und einem Geräusch auf dem Boden dauerte nur wenige Minuten lang. Und dieses Geräusch wurde von Rachel hervorgerufen, die einen leeren Koffer die oberste schmale Treppe hinunterschleppte, was eines der Dienstmädchen bewog, die Kammertür ein wenig zu öffnen.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe«, sagte ihre Herrin. »Die Treppe ist hier so eng. Nein, danke, lassen Sie nur, ich werde ganz gut allein fertig.« – Kurze Zeit darauf lagen die Mädchen wieder in tiefem Schlaf.
Es war keine kleine Aufgabe, die Rachel sich vorgesteckt hatte. Mit dem nächsten Schiff wollte sie nach Australien zurückkehren, und so musste sie sich noch diese Nacht reisefertig machen. Mit der sich allmählich legenden Aufregung befestigte sich ihr Entschluss nur noch mehr. Je früher sie ihren Gatten verließ, desto geringer würde sein Widerstand; zögerte sie, so machte seine augenblickliche Abgestumpftheit wahrscheinlich bald wieder der Tyrannei des normalen Gatten Platz. Gehen aber wollte sie so oder so. Nicht einmal den nächsten Tag wollte sie mehr hier verleben, wenn sie sich auch sagen musste, dass die Vorbereitungen sie wohl bis zur Morgendämmerung festhalten würden.
Es war im September. Nicht mit leeren Händen wollte sie entfliehen – überhaupt nicht entfliehen. Nach reiflicher Überlegung wollte sie ihn verlassen und einen Koffer mitnehmen, der das für die Reise Notwendige enthalten sollte. Die Auswahl war indes nicht so ganz leicht. In Stunden guter Laune hatte Minchin recht freigebig sein können, und nicht ohne ein gewisses Schmerzgefühl gedachte Rachel beim Hervorholen von manch kostbarem Gegenstand an den Einkauf und an die Freude, die ihr, dem einst so armen Mädchen, der ungewohnte Besitz gemacht hatte.
Trotzdem aber blieb ihr Entschluss unerschüttert. Wohl verletzte es ihren Stolz, seine persönlichen Geschenke mitzunehmen, obgleich dies alles war, was sie je von ihm erhalten hatte; denn niemals war er zu bewegen gewesen, ihr ein Taschengeld auszusetzen. Um jeden Pfennig hatte sie ihn bitten müssen, und dann sollte sie auch noch dankbar dafür sein. Es wäre also nicht ihre Schuld, wenn sie sich jetzt die Überfahrt mit ihrer Hände Arbeit verdienen müsste. Allein diese Geldverlegenheit beunruhigte sie doch. Stillschweigend seine Geschenke mitzunehmen, verletzte ihr Ehrgefühl, von ihrem Stolze gar nicht zu reden, und in ihrer Bedrängnis kam sie in einem Augenblick plötzlicher Entmutigung nun doch zu dem Entschluss, ihrem Mann ihre Bedrängnis anzuvertrauen und sich an seine, allerdings launische, aber manchmal doch unleugbare Großmut zu wenden.
Wohl hatte er ihr erst vorhin versichert, sie könne seinetwegen ins Pfefferland gehen, und wahrscheinlich würde er auch jetzt noch von ihr verlangen, dass sie ihren Unterhalt selbst verdienen solle, trotzdem aber drängte es sie, ihm die Entscheidung anheimzustellen, und zwar sofort.
Sie sah auf ihre Uhr – diese wenigstens stammte von ihrer Mutter – und sie zeigte ihr, dass die erste Stunde ihres letzten Tages unter seinem Dache bereits angebrochen war. Alexander Minchin war ein Nachtvogel, was seine junge Frau nur zu wohl wusste, und diesen Abend hatte er ihr im Zorn zugerufen, dass er in einem der oberen Wohnzimmer zu schlafen beabsichtige. Aber er war bis jetzt noch nicht heraufgekommen. Das betreffende Zimmer war ein nach rückwärts gelegener kleiner Raum, und Rachel warf auf ihrem Wege nach dem Erdgeschoss einen Blick hinein. Es war leer, auch hatten die Mädchen weder das improvisierte Bett in Ordnung gebracht, noch die Vorhänge zugezogen. Rachel besann sich einen Augenblick, ging dann aber doch eine Treppe höher, um reine Betttücher zu holen. Es lag etwas unendlich Rührendes in dieser unwillkürlichen Fürsorge, die ihren Grund durchaus nicht in einem Rest von Liebe, sondern nur in einem gewissen Pflichtgefühl hatte, und die deutlich verriet, was für eine vortreffliche Gattin sie hätte werden können.
Minchin hörte sie nicht, als sie endlich ins Erdgeschoss hinunterschlich, obwohl in dieser mitternächtlichen Stunde die Treppenstufen besonders laut unter ihren Füßen zu knarren schienen – oder wenn er sie auch hörte, so gab er jedenfalls kein Zeichen von sich. Diese Wahrnehmung entmutigte Rachel; ihr wäre der schlimmste Zornesausbruch lieber gewesen. Freilich drangen Laute von außen nur schwer in die hinter dem Esszimmer gelegene Studierstube, da der frühere langjährige Mieter des Hauses, ein berühmter Professor, sich durch Anbringung von Doppeltüren seine Ruhe gesichert hatte. Die äußere, mit dunkelrotem Filz ausgepolsterte Tür machte ebenfalls ein beängstigendes Geräusch, als Rachel sie mit hastigem Ruck öffnete. Lauschend wartete sie. Aber auch jetzt ließ sich kein Ton von innen vernehmen: selbst als seine Frau schließlich ins Zimmer trat, ließ Minchin sich nicht stören. Diese brauchte indes nur einen Blick auf ihn zu werfen, um sich über den Grund dieser Stille im klaren zu sein. Im Lehnstuhl des Professors saß dessen unwürdiger Nachfolger mit auf die Brust gesunkenem Kinn. Auf seinem Schoße lag eine Zeitung, und neben ihm standen eine leere Karaffe und ein Glas, worin sich noch ein kleiner Rest befand; er schien also noch vor dem Austrinken eingeschlafen zu sein. Über das elektrische Licht, bei dessen Schein er gelesen hatte, war der grüne Schirm heruntergezogen, ein Zeichen, dass er die Nacht offenbar hier zubringen wollte.
Beim Anblick seiner unbequemen Lage wollte Rachel etwas wie Mitleid anwandeln, doch ließ die leere Flasche keine Gewissensbisse bei ihr aufkommen. Sie selbst hatte die Flasche am Abend gefüllt, da ihr Mann beim Weggehen in geheimnisvoller Weise von einem längeren Ausbleiben gesprochen hatte. Nun begriff sie diese Heimlichtuerei, und ihr Gesicht verfinsterte sich, als sie an die unerhörte Beschimpfung dachte, die er ihr bei seiner Erklärung entgegengeschleudert hatte. Nein, nicht eine Minute länger als notwendig wollte sie hier bleiben. Er schlief jedenfalls bis in den Morgen hinein. Nicht das erste Mal würde dies der Fall sein, und heute je länger desto besser.
Von einem unüberwindlichen Widerwillen getrieben
Von einem unüberwindlichen Widerwillen getrieben, war sie auf den kleinen Vorplatz zurückgewichen, und dort stand sie nun blass, bebend und von einem Ekel und Abscheu erfüllt, der sich beim letzten Blick auf das beschattete Gesicht und die unbewegliche Gestalt im Lehnstuhl noch verschärfte. Rachel vermochte sich keine Rechenschaft über den Grund dieses plötzlichen, übermäßigen Ekels zu geben, der ihr eine Art Übelkeit verursachte und sie gleichsam an die Schwelle festbannte. Endlich aber fand sie doch die Kraft, einige Schritte zurückzuweichen, das elektrische Licht auszudrehen und die beiden Türen ebenso leise, als sie sie geöffnet hatte, wieder zu schließen. Auf dem Vorplatz brannte ein zweites Licht, und auch dieses löschte Rachel gewohnheitsmäßig aus, ehe sie den Fuß auf die erste Treppenstufe setzte. Einen Augenblick später stand sie, von Entsetzen gepackt, im Dunkeln.
Noch immer kam kein Laut aus dem Studierzimmer, nur ein leises metallisches Klirren ließ sich von dem an der Haustür angebrachten Briefkasten vernehmen. Es mochte der Wind gewesen sein, denn eine Schraube der außerhalb der Tür angebrachten, den Einschnitt schützenden Metallklappe war losgegangen. Und obwohl dieses Geräusch sich nicht wiederholte, so schrieb Rachel es doch dem Winde zu, als sie in einer Aufregung, die sie mit Beschämung und Furcht zugleich erfüllte, die Treppe wieder hinaufrannte. Drohte der Mut ihr zu schwinden, der Mut, den sie doch so notwendig brauchte? Nein, nein, er durfte sie jetzt nicht verlassen, und als ob sie ihn dadurch zu kräftigen hoffte, öffnete sie das Gangfenster und starrte einige Minuten in die kühle, sternhelle Nacht hinaus. Ein weiter Überblick bot sich ihr freilich nicht, denn die Rückseite von Häusern verdeckte zum größten Teil den Sternenhimmel. Die Rückseite dieser Nachbarhäuser bildete im Verein mit der Rückseite des von ihr bewohnten Gebäudes ein geschlossenes Viereck. Dürftige Gärtchen von verschiedener Größe schimmerten aus einem Netzwerk von schmutzigen Mauern hervor, zwischen denen hie und da ein großer, herbstlich zerzauster Baum hervorragte. Rachel aber sah weder nach diesen Gärtchen, noch nach den Sternen, die sie matt beleuchteten. Ihr Auge hing an dem aus einem gegenüberliegenden Fenster scheinenden Licht, das die ganze Nacht hindurch brannte. Es war das einzige irdische Licht, das Rachel sehen konnte, das einzige irdische oder himmlische Licht überhaupt, dem sie Beachtung schenkte. Mit einem Gefühl der Dankbarkeit bemerkte sie es, und als sie den Blick davon abwendete, murmelten ihre Lippen ein Gebet.
Zur rechten Zeit war der Koffer gepackt, den Rachel auch sofort die Treppe hinunterschleppte, eine Anstrengung, von der sie jeder Muskel schmerzte. Viel Lärm aber musste sie dabei doch nicht gemacht haben, denn noch immer blieb es still im Studierzimmer. Kaum dass sie sich Zeit zum Atemholen nahm, machte sie mit einem Drücker die Haustüre leise hinter sich zu und stand nun endlich in der frischen, klaren Luft.
Einen Wagen konnte sie zu dieser Stunde nicht finden, und außer den Straßenkehrern war kein menschliches Wesen zu sehen. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als Rachel auf ihrer Wanderung durch die benachbarten Straßen endlich einen Einspänner entdeckte. Nun aber tat sie etwas höchst Seltsames. Anstatt sich direkt vor ihre Wohnung fahren und ihren Koffer aufladen zu lassen, gab sie dem Kutscher plötzlich eine andere Richtung an und befahl ihm dann, vor einem Hause zu halten, an dessen einem Fenster ein Schild mit einem Zimmerangebot hing. Auf Rachels Klingeln erschien nach auffallend kurzer Zeit eine Frau, deren Gesicht zuerst Schrecken, bei Mrs. Minchins Anblick aber unverkennbar Verdruss ausdrückte.
»So sind Sie also doch nicht gekommen!« rief die Frau in bitterem Tone.
»Ich bin abgehalten worden«, erwiderte Rachel ruhig. »Wie geht es ihm?« kam es dann flüsternd von ihren Lippen.
»Er lebt noch«, sagte die Frau an der Tür.
»Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben?« fragte Rachel mit stockendem Atem.
»Ehe der Arzt nicht hier gewesen ist, kann ich keine weitere Auskunft geben.«
»So hat er doch wenigstens die Nacht überlebt«, fuhr Rachel mit dankbarem Aufseufzen fort. »Ich schaute immer wieder nach dem Licht in seinem Zimmer, selbst zu kommen aber war mir nicht möglich. Haben Sie die ganze Nacht an seinem Bett gesessen?«
»Ja, die ganze Nacht ohne Unterbrechung«, antwortete die andre mit einem Ausdruck unverhohlener Strenge in den starren, rotgeränderten Augen; »kein Auge habe ich zugetan.«
»Wie leid tut es mir, dass ich Sie nicht ablösen konnte!« rief Rachel, die zu betrübt war, um sich über den unfreundlichen Ton der Alten zu ärgern; »aber es war eben unmöglich, vollständig unmöglich. Wir … ich bin im Begriff, England zu verlassen. Armer Mr. Severino! Wenn ich doch irgend etwas für ihn tun könnte! Jedenfalls aber müssen Sie jetzt eine Berufspflegerin zur Hilfe nehmen. Und sobald es ihm besser geht … denn mir ahnt, dass er sich wieder erholen wird … können Sie ihm sagen …«
Eingeschüchtert durch den scharf prüfenden Blick der geröteten Augen, zögerte Rachel.
»Sagen Sie ihm, dass ich bestimmt hoffe, er werde sich bald wieder vollständig erholen«, fuhr sie endlich fort, »merken Sie wohl, vollständig. Und sagen Sie Mr. Severino auch, dass ich für immer fortgehe. Da ich jedoch meinen Plan, Sie in seiner Pflege zu unterstützen, nicht ausführen konnte, so ist es mir lieber, Sie erwähnen davon nichts, und auch nicht, dass ich hier war, um zu sehen, wie es ihm geht.«
Dies war ihr ganzer Abschiedsgruß für den fast noch knabenhaften jungen Mann, mit dem die klatschsüchtige Welt den Namen Rachel Minchin heimlich in Verbindung gebracht hatte. Ihre eben erwähnte Äußerung sollte übrigens, wie die Folge zeigen wird, auch noch in andrer Hinsicht von erheblicher Bedeutung für sie werden. Gleich darauf befand sich Rachel zum letzten Male vor ihrer eigenen Haustür, in deren Schloss sie leise und geschickt den Drücker steckte, während in einem benachbarten Garten die Vögel voll ausgelassener Lustigkeit zwitscherten und die messingene Türklinke, sowie die Klappe des Briefeinwurfs in der Morgensonne funkelten. Da wurde die Tür plötzlich von einem Schutzmann weit aufgerissen, hinter dem auf dem engen Vorplatz ein zweiter auftauchte, während an der Treppe die beiden Dienstmädchen standen. Ohne die geringste vorherige Erklärung wurde Rachel Minchin von den Polizisten zu ihrem Gatten hineingeführt, der noch in derselben Stellung, wie sie ihn verlassen hatte, in des Professors Lehnstuhl saß, nur dass seine Füße jetzt steif ausgestreckt auf einem zweiten Stuhl lagen und man bei dem von Norden her ins Zimmer flutenden Tageslicht deutlich erkennen konnte, dass die Hand des Todes ihn berührt hatte.
Unbeweglich starrte die junge Witwe auf ihren toten Gatten, während vier Augenpaare mit noch prüfenderen Blicken auf ihr selbst hafteten. Allein wenig genug stand auf dem blassen Gesicht mit dem gespannten Ausdruck und den zusammengepressten Lippen, denen nicht ein einziger Schreckensruf entfahren war, zu lesen. Sie hatte nur die Schwelle überschritten und war dann plötzlich mitten auf dem abgetretenen Teppich stehen geblieben, wo sich ihre Gestalt jetzt scharf von dem mit Bücherregalen bedeckten Hintergrund abhob. Weder ein Schwanken der geschmeidigen Gestalt, noch ein Haschen nach einem Stützpunkt war zu sehen, auch wurde keine Frage ausgesprochen. Die Art, wie wir einen unvorhergesehenen, folgenschweren Schlag aufnehmen, setzt uns oft noch mehr in Erstaunen, als der Schlag selbst. Dabei bringt eine solch unvermutete Trennung durch den Tod es uns häufig erst zum Bewusstsein, was wir uns im Zusammenleben mit dem Entschlafenen alles haben zuschulden kommen lassen. So ging es auch Rachel Minchin in den ersten Augenblicken ihrer tragischen Befreiung. Gott selbst hatte also geschieden, was von ihm zusammengefügt worden war! Hier lag er, der Mann, den sie aus Liebe geheiratet hatte! War es möglich, dass sie jetzt ohne Schmerz den Blick auf seinen sterblichen Überresten ruhen lassen konnte? Plötzlich aber nahmen Rachels Gedanken eine andre Richtung, wobei sie, wie die von der Tür aus auf sie gerichteten acht Augen gar wohl bemerkten, entsetzt zusammenschauderte. Er musste schon tot gewesen sein, als sie vom oberen Stockwerk heruntergekommen war und ihn im Dämmerlicht der beschatteten Lampe hatte sitzen sehen. Die Kopfhaltung war unverändert, das Kinn auf die Brust geneigt, der Mund so natürlich geschlossen, wie im Schlafe. Kein Wunder, dass seine Frau sich hatte täuschen lassen. Und doch lag etwas Ungewöhnliches, etwas Edles auf seinen Zügen, das dem lebenden Manne niemals eigen gewesen war. Rachel wunderte sich plötzlich, dass der ihrem Manne so gänzlich fremde Zug von Würde und Vornehmheit, den nur der Tod einem Antlitz in solcher Weise zu verleihen vermag, ihr nicht sogleich aufgefallen war. Sie schlug die Augen zu dem Stückchen Himmel auf, das durch den oberen Teil des Fensters hereinschaute, und schon wollten ihr Tränen in die Augen steigen, als statt ihrer ein Ausdruck des Entsetzens und plötzlicher Erleuchtung daraus hervorbrach. Ein gezacktes Loch befand sich in diesem Fenster und auf dem Schreibpult daneben lag ein umgeworfenes Tintenfass, dessen Inhalt sich mit dem Blute des toten Mannes vermischt hatte. Nun erst bemerkte sie, dass dieser in Blut wie gebadet war, und dass die jetzt neben ihm auf dem Boden liegende Zeitung, die ihn vorhin noch halb verdeckt hatte, steif von Blut war.
»Ermordet!« murmelte Rachel, indem sie endlich, schwer atmend, ihr langes Schweigen brach. »Das Werk von Dieben.«
Die Polizisten wechselten einen raschen Blick.
»So sieht es allerdings aus«, sagte derjenige, der die Tür geöffnet hatte, »das gebe ich zu.«
Eine auffallende Härte klang aus seinem Ton, die Rachel indes ebensowenig beachtete als die neugierig vorgestreckten Köpfe der unter der Haustür sich ansammelnden Menschen.
»Aber ist daran überhaupt zu zweifeln?« rief sie, von dem zerbrochenen Fenster auf die verschüttete Tinte zeigend. »Oder glauben Sie, er habe sich selbst erschossen?«
Ihr Entsetzen steigerte sich bei diesem Gedanken, der für sie noch fürchterlicher war als alles andre. Der Polizist schüttelte jedoch den Kopf.
»Dann hätten wir die Pistole finden müssen«, sagte er. »Aber erschossen ist er, und zwar mitten durchs Herz.«
»Wer könnte es denn aber gewesen sein, wenn es nicht Diebe waren?«
»Das ist es eben, was wir alle gern wissen möchten«, sagte der Schutzmann, und noch immer fand Rachel nicht Zeit, sich über seinen eigentümlichen Ton zu wundern. Die weißen Hände krampfhaft verschlungen, beugte sie sich jetzt über den Leichnam, während ihr totenblasses Gesicht den Ausdruck qualvoller Aufregung trug.
»Sehen Sie nur, sehen Sie!« rief sie, sich zu den Anwesenden wendend. »Gestern Abend trug er seine goldene Uhr, das kann ich beschwören, und nun ist sie verschwunden.«
»Wissen Sie auch ganz gewiss, dass er sie trug?« fragte nähertretend derselbe Schutzmann.
»Ja, ganz gewiss.«
»Nun, wenn dem wirklich so ist«, fuhr er fort, »und sie nirgends gefunden werden kann, so wird dies ein Punkt, sein, der sehr zu Ihren Gunsten spricht.«
Hastig, mit vor Erstaunen weit aufgerissenen Augen, richtete Rachel sich auf.
»Zu meinen Gunsten?« rief sie. »Wollen Sie vielleicht die Güte haben, sich deutlicher auszudrücken?«
Die Polizisten standen jetzt zu ihren beiden Seiten.
»Nun«, begann derjenige, der auch bisher das Wort geführt hatte, »erstens einmal will mir die Art, wie dieses Fenster zerbrochen worden ist, nicht recht gefallen. Wenn Sie es genauer anschauen, so werden Sie sehen, was ich meine. Die Scherben liegen alle draußen auf dem Fensterbrett. Aber das ist nicht alles – da Sie übrigens gerade einen Wagen vor der Tür haben, so können wir wohl nichts Gescheiteres tun, als dass Sie uns sofort zur Polizeistation begleiten, ehe der Auflauf draußen noch größer wird.«
Zweites Kapitel. Die Schwurgerichtsverhandlung
Seit Jahren hatte man nicht mehr mit einer solchen Spannung einer Verhandlung in Old Bailey,1 dem Hauptkriminalgericht Londons, entgegengesehen, und vielleicht noch niemals war eine eifrigere Nachfrage nach den wenigen verfügbaren Plätzen in diesem altertümlichen Gerichtssaale gewesen. In der Tat hätte aber auch selbst der unternehmungslustigste moderne Theaterdirektor, der einen Stern erster Größe für eine kurze Zeit gewonnen hat, nicht mehr Reklame machen können, um die brennende Neugierde des Publikums zu erregen, als es für Rachel Minchin von seiten ihres offiziellen Gegners, der Polizeibehörde, geschehen war.
Ob diese Behörde schon damals, als die Angeklagte in Untersuchungshaft genommen wurde, eingehender über den vorliegenden Fall unterrichtet war, als sie vorgab, oder ob die Beweise der Schuld erst während der letzten vierzehn Tage sich gehäuft hatten, soll dahingestellt bleiben. Immerhin aber bildete diese Frage längere Zeit hindurch den Gegenstand heftiger Debatten. Übrigens wurde bald nach der Verhaftung verbreitet, dass eine Menge neuer Indizien beim Verhör zu Tage kommen werden, wodurch sich der auf der Angeklagten lastende Verdacht noch bedeutend verschärfen werde. Die Zeugen waren so zahlreich, ihre Aussagen so verwickelt, dass man glaubte, ihre Vernehmung werde wohl eine Woche beanspruchen.
Der Fall Minchin sollte als erster während der Herbstsession verhandelt werden, und an einem Montagmorgen Ende November fand denn auch die erste Sitzung statt. Die Annalen des äußerlich unscheinbaren historischen Gerichtsgebäudes hatten wohl selten denkwürdigere Tage als diesen Montagmorgen und die darauffolgenden zu verzeichnen. Das Geschlecht der Angeklagten, ihre Jugend und ihre stolze Haltung, dazu ihre auffallend isolierte Stellung, ohne einen Freund und Beschützer in der Not – dies alles trug dazu bei, die Fantasie des Publikums zu wecken und eine Aufregung hervorzurufen, die durch die allgemeine Ansicht, dass niemand anders das Verbrechen begangen haben könne, nur noch mehr gesteigert wurde. Sowohl die Richter als auch sämtliche mit dem Gerichtshof in Verbindung stehende Personen wurden aus mehr oder weniger berechtigten Gründen um Einlasskarten zu den Verhandlungen gequält. Und als der wichtige Tag dann endlich kam, musste sich der mit Erfolg gekrönte Bewerber jeden Zoll breit seines Weges von der Newgate Street oder von Ludgate Hill bis zum Eingang des Gerichtsgebäudes mit seinen beiden Ellenbogen erkämpfen. Er hatte drei verschiedene, von einer misstrauischen Schutzmannschaft gebildete Sicherheitskordons zu passieren und sich die Gunst des Sherriffs durch dessen gallonierte Lakaien zu erkaufen, um schließlich mit verschiedenen bekannten Persönlichkeiten ein winziges Plätzchen in dem beschränkten Raum fürs Publikum zu erringen, wo man sich nur wenige Fuß von der dichtverschleierten Angeklagten und nicht sehr viel weiter von dem Gerichtspräsidenten im roten Talar befand.
Einer der ersten, der sich am Montagmorgen all dieser Mühe unterzog, und der letzte, der sich nach Vertagung der Sitzung aus der schlechten Luft hinausflüchtete, war ein weißhaariger Herr von auffallendem Äußern, der sich durch keine Widerwärtigkeiten abschrecken ließ, sich auch an den folgenden Tagen zu seinem Platz im Gerichtssaale hindurchzuringen. Hinter ihm tauchten die wohlbekannten Gesichter von Journalisten und Rechtsgelehrten auf, die mit berufsmäßigem Interesse den Fall verfolgten. Dem Herrn im weißen Haar aber waren sie zum größten Teile fremd. Hin und wieder drang gegen seinen Willen eines oder das andre Wort ihrer ununterbrochen im Flüsterton geführten Unterhaltung an sein Ohr, was ihn mehr als einmal bewog, einen ärgerlichen Blick nach rückwärts zu werfen, unbekümmert darum, welche berühmte Persönlichkeit ihn gerade auffing. Er hatte ein wohlkonserviertes Gesicht mit einem schmalen, äußerst energischen Munde, stark ausgebildeten Kinnbacken und einer ungewöhnlich edelgeformten Stirn. Was bei seinem Anblick jedoch am meisten in die Augen sprang, war das üppige, schneeweiße Haar. Bart trug er keinen, und die buschigen Brauen waren so viel dunkler als die Haare, dass man sie für gefärbt hätte halten können. Die Augen selbst aber waren vom tiefsten Schwarz, glänzend wie Mitternachtssterne und von einer Art schlauer Unergründlichkeit, sodass eine gewisse Sanftmut des Ausdrucks auf diesem aus Gegensätzen und Widersprüchen zusammengesetzten Gesicht nicht wenig überraschte.
Niemand im Gerichtssaal hatte diesen Mann schon früher einmal gesehen, niemand außer dem Untersherriff erfuhr während der ganzen Woche seinen Namen. Am dritten Tage jedoch wurde seine Identität zum Gegenstand einer Diskussion sowohl unter den hinter ihm sitzenden berufsmäßigen Kennern menschlicher Gesichter, als unter den verschiedenen Angestellten, die ihn als einen Herrn kennen gelernt hatten, der ebenso freigebig mit Goldstücken umsprang, als andre mit Silbermünzen. So wurde er denn jeden Tag mit großer Höflichkeit nach demselben Platz in der Mitte der untersten Zuschauerreihe geführt, wo er der Angeklagten, die er unausgesetzt beobachtete, noch ein klein wenig näher war als die neben oder hinter ihm Sitzenden. Und einmal nur im ganzen Verlauf der Verhandlungen wurde die aufmerksame Ruhe seiner Züge gestört.
Dies geschah jedoch weder zu Anfang, als die Gefangene hinter ihrem Schleier hervor mit klarer Stimme ihre Unschuldsbeteuerung ablegte und alle Zuhörer atemlos lauschten, noch einige Zeit später, als der höfliche, die Anklage vertretende Generalstaatsanwalt, den Geschworenen mit seinem Zwicker zuwinkend, in zuckersüßen Worten von einem neu entdeckten Indizienbeweis berichtete, den er ihnen vorzulegen im Begriff sei. Die vermisste Uhr und Kette seien gefunden worden, und die Geschworenen würden demnächst Gelegenheit haben, sie zugleich mit einer Zeichnung, die man von dem Kamin des Zimmers, wo der Mord begangen worden war, angefertigt habe, in Augenschein zu nehmen. Denn dort seien nach nochmaliger amtlicher Untersuchung die beiden Gegenstände gefunden worden. Man kann sich die Wirkung dieser Eröffnung vorstellen. Sie bildete den Sensationspunkt des ersten Verhandlungstages.
Der ganze weitere Verlauf der Verhandlung fußte auf der Voraussetzung, dass nur ein Bewohner des Hauses den Mord begangen haben konnte, und dass dieser die sorgfältigsten Vorkehrungen getroffen hatte, um der Sache den Anschein zu geben, als seien Diebe die Urheber des Verbrechens gewesen. Den Grund zu dieser Annahme boten die außerhalb des Fensters gefundenen Glasscherben, das Fehlen jeglicher Fußspuren etwaiger Räuber und die Entdeckung von zwei Revolvern im Schreibtisch des Ermordeten, die beide mit den gleichen Patronen wie diejenige, die seinen Tod herbeigeführt hatte, geladen waren. Man konnte außerdem deutlich sehen, dass seit der letzten Reinigung der Waffen eine davon abgeschossen worden war. Einen so schwerwiegenden Indizienbeweis die Auffindung der vermissten Uhr und Kette auch gegen die Angeklagte bildete, so zeigte der weißhaarige Herr doch keine erhöhte Aufmerksamkeit, was ja auch nicht gut möglich gewesen wäre, ja er war vielleicht der einzige Zuhörer, der bei dieser Ankündigung kein Zeichen der Aufregung verriet.
Das Zeugenverhör begann mit der Vernehmung der Dienstmädchen und der beiden Schutzleute; doch kam nicht viel Neues dabei heraus. Die Mädchen wurden nicht nur über das, was sie während der Nacht des Mordes gesehen und gehört – und es schien, als hätten sie alles, außer dem verhängnisvollen Schuss, gehört – sondern auch über das vorhergehende Verhältnis ihrer Dienstherrschaft zueinander – worüber sie ebenfalls ausgiebigen Bescheid wussten – vernommen. Die Schutzleute dagegen konnten natürlich nur darüber berichten, was sie, nachdem die beiden Mädchen sie zu Hilfe gerufen, entdeckt und beobachtet hatten. In der Schilderung des Benehmens der Angeklagten beim Anblick ihres toten Gatten aber stimmten alle vier Zeugen auffallend überein. Die Angeklagte habe nur wenig oder gar keine Überraschung an den Tag gelegt, und es seien mehrere Minuten vergangen, ehe sie eine Silbe gesprochen habe, dann aber habe sie nur den Mund geöffnet, um zu behaupten, dass Diebe allein den Mord begangen haben könnten.
Während des Kreuzverhörs ließ sich der Verteidiger der Angeklagten ungeschickterweise auch noch in die Karten blicken, ein Spielkenner aber hätte nicht viel Gutes darin entdeckt. Er war überhaupt ein ganz andrer Typus von einem Rechtsgelehrten als sein Gegner, der Generalstaatsanwalt, und auch bedeutend jünger als dieser. Er war von einnehmenderem Wesen und von glänzenderer Beredsamkeit, die er mit zweifelhaftem Geschick dazu benützte, die Geschworenen und den Gerichtshof zu blenden. Seine Methode bestand in erster Linie darin, die Zeugen der Reihe nach dem Spott und Hohn der ganzen Versammlung preiszugeben. So waren die beiden Mädchen denn auch bald in Tränen aufgelöst und die Polizisten in ihrer Würde gekränkt. Trotzdem aber blieben sie in ihren Aussagen unerschüttert. Der Präsident konnte nicht umhin, ein väterlich beruhigendes Wort an die Mädchen zu richten, während unten am Gerichtstisch ein ärgerliches Schütteln der Perücken bemerkbar wurde. Das war entschieden nicht der rechte Weg, um die Herzen ehrbarer, gewissenhafter und dickköpfiger Geschworenen zu gewinnen, die größtenteils derselben Gesellschaftsklasse angehörten wie die Zeugen. Auch die unter den Zuschauern befindlichen Journalisten und Rechtsgelehrten hatten sich längst ihr bestimmtes Urteil über den ganzen Fall gebildet, ohne dasjenige der Herren am Gerichtstisch abzuwarten. Nur auf dem Gesicht des in der ersten Reihe sitzenden Mannes mit dem schneeweißen Haar, der die Angeklagte unausgesetzt beobachtete – auf diesem energischen, glattrasierten Gesicht war ebensowenig irgend eine Ansicht zu lesen als auf dem durch einen undurchdringlichen Witwenschleier verdeckten Antlitz der Angeklagten.
Auch am nächsten Tage, als die Aufmerksamkeit des Gerichtshofes fünf Stunden lang von einem nebensächlichen Umstand in Anspruch genommen war, blieb seine gelassene Aufmerksamkeit dieselbe. Der Verteidiger hatte beigebracht, dass die im Kamin des Studierzimmers gefundene Uhr und Kette nicht die vom Verstorbenen zur Zeit seiner Ermordung getragene gewesen sei. Diese Behauptung wurde durch herbeigebrachte Fotografien Alexander Minchins unterstützt, die eine Uhrkette aufwiesen, deren Muster mit dem der gefundenen nicht ganz übereinzustimmen schien. Sachverständige sowohl in Uhrketten als in Fotografien wurden von beiden Seiten zu Rate gezogen, und selbst deren Meinung ging auseinander. So fesselnd diese Verhandlung aber auch zu Anfang war, so begann das Interesse daran doch allmählich zu erlahmen, nachdem mehrere Tage hintereinander von nichts anderm mehr die Rede gewesen war und die vergrößerten Fotografien immer und immer wieder herumgezeigt worden waren. Selbst die Angeklagte ließ schließlich ermattet den Kopf sinken, als ihr eigener unermüdlicher Verteidiger zum dutzendsten Male nach der Uhrkettenfotografie verlangte.
Auch der Präsident zeigte eine gelangweilte Miene, bis endlich durch den Ausspruch der Geschworenen, dass sie nun in Hinsicht der Uhrkette ihre Ansicht gebildet hätten, das Thema endgültig verlassen wurde. Nur das lebhafte, aufmerksame Gesicht des Mannes mit den weißen Haaren hatte keine Spur von Langeweile verraten.
So war denn Mrs. Minchins Fall von ihrem Anwalt mit glühendem Eifer, wenn auch vielleicht nicht aus innerer Überzeugung verfochten worden. Als er sie dann am Freitag nachmittag, dem Gesetze gemäß, aufforderte, nun selbst das Wort zu ihrer Verteidigung zu ergreifen, tat er es mit der Miene eines Mannes, der seine Sache für verloren hält. Dass er nicht viel Vertrauen auf den Erfolg ihrer Verteidigungsrede hatte, konnte man deutlich auf seinem hübschen, feingeschnittenen, aber für einen Rechtsgelehrten allzu ausdrucksvollen Gesicht sehen. Wie man schon an den vorhergehenden Tagen aus der Art, wie er sich aus seinem Stuhle erhob, hatte schließen können, in welcher Weise sein Kreuzverhör bei jedem einzelnen Zeugen ausfallen würde, so stand auch jetzt deutlich auf seinem Gesicht zu lesen, dass seine Klientin nur auf ihren eigenen, hartnäckig ausgesprochenen Wunsch und ganz gegen den Rat ihres Verteidigers von ihrem Rechte Gebrauch machte.
Es war ein trüber Nachmittag, und in diesem alten Gerichtsgebäude ist die Anklagebank so angebracht, dass die Beschuldigten mit dem Rücken gegen das Licht sitzen. Daher kam es auch, dass sowohl die von den verschiedenen Zeitungen abgeschickten Reporter und Blitzzeichner, als die sonstigen Kenner der menschlichen Physiognomie, die hinter dem weißhaarigen Herrn saßen, noch immer keine Gelegenheit fanden, Rachel Minchin, die den schweren Schleier jetzt endlich zurückgeschlagen hatte, genau zu sehen. Auch jetzt, nachdem Rachel das Wort ergriffen hatte, neigte sich der weißhaarige Herr nicht einen Zoll breit vor, was freilich auch nicht nötig war, da sämtliche Fragen von der Angeklagten mit heller, klarer Stimme beantwortet wurden. Und doch war es eine dieser von ihrem eigenen Verteidiger an sie gerichteten Fragen, die den weißhaarigen Herrn plötzlich bewog, die Hand hinters Ohr zu legen und sich vorzubeugen, als könne die Antwort nicht ohne ein gewisses Zögern erfolgen. Rachel hatte in traurigem, aber festem Tone von dem letzten Wortwechsel mit ihrem Manne berichtet, indem sie unaufgefordert dessen Ursachen enthüllte, ohne dabei die geringste Verlegenheit zu zeigen. Ein Nachbar sei gefährlich krank gewesen, und als sie am Abend habe fortgehen wollen, um ihn während der Nacht zu pflegen, sei ihr Mann ihr an der Haustür entgegengetreten und habe ihr verboten, ihr Vorhaben auszuführen.
»War dieser Nachbar ein junger Mann?«
»Eigentlich noch fast ein Knabe«, antwortete Rachel, »der, ebenso wie wir selbst, keinen einzigen Freund in London hatte.«
»War Ihr Gatte eifersüchtig auf ihn?«
»Ich hatte vor jenem Abend keine Ahnung davon gehabt.«
»Dann aber haben Sie es gemerkt?«
»Allerdings.«
»Und wo hatte Ihr Mann den Abend verbracht?«
»Auch davon hatte ich keine Ahnung, bis er mir selbst sagte, dass er das Haus bewacht habe – und warum.«
Obwohl der Mann tot war, konnte sie ihren Groll doch nicht ganz aus der Stimme bannen, und nun wiederholte sie auch mit gesenktem Kopf seine letzten an sie gerichteten Worte.
Ein Schauder der Entrüstung lief durch die Versammlung.
»War dies das letzte Mal, dass Sie ihn am Leben sahen?« fragte der Verteidiger mit plötzlich aufgeheitertem Gesicht und wieder erwachter Zuversicht, als sei er es gewesen, der die nochmalige Vernehmung seiner Klientin verlangt hatte. Die Antwort erfolgte diesmal jedoch nicht sofort, und in diesem Augenblick war es, dass der weißhaarige Mann die Hand hinters Ohr legte, und das, was jetzt geschah, war auch gerade das, was er gefürchtet zu haben schien.
»War dies das letzte Mal, dass Sie ihn am Leben sahen?« wiederholte Rachels Verteidiger in gewinnendem Tone und mit der Mut einsprechenden Miene, die ihm so leicht zu Gebot stand.
»Ja, das war das letzte Mal«, antwortete Rachel nach nochmaliger kurzer Überlegung.
Nun schlug auch der weißhaarige Mann ausnahmsweise die Augen nieder, und die harten Linien seines Mundes verzogen sich zum ersten Male zu einem Lächeln, in dem sich jedoch alles Böse und Schlechte, das in seinem Gesicht ausgedrückt lag, gleichsam verkörperte.
Gerichtsgebäude in London. Manchmal auch als Synonym für (britsche) Gerichte im Allgemeinen <<<
Drittes Kapitel. Der Urteilsspruch
Die Aussage der Angeklagten schloss mit einem sachlichen, wenn auch etwas zögernd gesprochenen Bericht darüber, wie sie den Rest jener verhängnisvollen Nacht verbracht hatte. Diese Vorgänge sind jedoch bereits ausführlicher beschrieben worden, als sie durch das höfliche, aber grausame Kreuzverhör des Generalstaatsanwalts zu Tage gefördert werden konnten. Die Art, wie Rachel ihre Aussagen machte, war plötzlich anders geworden; ihre Kraft und Energie schienen sie mit einem Male verlassen zu haben, sodass ihr jetzt jedes Wort sozusagen in den Mund gelegt werden musste. Seltsamerweise traf diese Veränderung in Mrs. Minchins Wesen fast unmittelbar mit den nur einmal und dann auf so finstere Weise zur Schau getragenen Empfindungen des weißhaarigen Mannes zusammen, der jedes Wort der Verhandlung verfolgt hatte. Im ganzen aber trug ihre Erzählung indes auch jetzt noch den Stempel der Wahrheit, ein Eindruck, der durch die Kreuzfragen des Generalstaatsanwalts nicht erschüttert wurde.
Außer den Sachverständigen in Uhrketten und Fotografien erschien nur eine einzige Entlastungszeugin. Es war dies die Hauswirtin, bei der Rachel am frühen Morgen auf ihrem Wege nach Hause vorgesprochen hatte. Sie verweilte nur kurze Zeit auf der Zeugenbank, aber während dieser wenigen Minuten lieferte sie der Verteidigung einige ihrer schlagendsten Beweisgründe. Dass eine Frau, die ihren Mann ermordet hatte, kühlen Blutes ihren Koffer packte und dann einen Wagen holte, der sie und ihre Reiseeffekten vom Orte des Dramas fortbringen sollte, war schließlich noch zu begreifen. Wie aber konnte man es für möglich halten, dass eine Frau von so viel Geistesgegenwart, die sich doch der Gefahr jeder verlorenen Minute bewusst sein musste, mit dem endlich gefundenen Wagen auch noch einen Umweg machen würde, um sich nach dem Befinden ihres Kranken – selbst wenn dieser ihr sterbender Liebhaber gewesen wäre – zu erkundigen, und dann erst nach Hause zurückzukehren, um ihr Gepäck zu holen und sich zu vergewissern, ob ihr Verbrechen noch unentdeckt sei? Angenommen, er wäre wirklich ihr Liebhaber gewesen, und sie hätte sich unbedingt noch nach seinem Ergehen erkundigen wollen – würde sie dann diese Erkundigungen nicht bis zuallerletzt aufgespart haben? Aber auch abgesehen davon, ob sie diese Erkundigungen nun zuerst oder zuletzt eingezogen hatte, würde wohl eine Frau, die über die Notwendigkeit einer eiligen Flucht nicht im Zweifel sein konnte, die Torheit begehen, und einer anderen Frau anvertrauen, dass sie gezwungen sei, England so rasch als möglich und für immer zu verlassen?
»Undenkbar!« rief der Anwalt der Angeklagten, indem er sich nach den ersten sachlichen Auseinandersetzungen ausführlich über diesen Punkt verbreitete. Immer wieder ertönte das Wort »undenkbar« in seinem langen, heftigen Plaidoyer, worin er sich vor allem angelegen sein ließ, das Plaidoyer seines Gegners, des Generalstaatsanwalts, von Anfang bis zu Ende ins Lächerliche zu ziehen, anstatt die von diesem vertretenen Ansichten sachlich zu bekämpfen. Für die Handlungen der Angeklagten während der Nacht des Mordes und noch mehr für diejenigen am Morgen darauf gab es – vorausgesetzt, dass sie den Mord begangen hatte – freilich keine bessere Bezeichnung als dieses »undenkbar«. Der einzige Übelstand dabei war nur der, wie der Generalstaatsanwalt in seiner Erwiderung seinem Freunde und Gegner in höflichster Weise zu verstehen gab, dass in jedem mit dem Galgen endigenden Mordprozess das Wort »undenkbar« eine Rolle gespielt habe.
»Anderseits«, fuhr der Generalstaatsanwalt fort, indem er seinen Kneifer mit gemächlicher Ruhe hin und her bewegte und seine Worte mit einer Sorgfalt wählte, die deren Wirkung nach der ungezügelten, polternden Beredsamkeit der Verteidigungsrede noch erhöhte, »anderseits, meine Herren, wenn die Verbrecher keine ungeschickten Handlungen begingen – man mag sie nun für undenkbar halten oder nicht, wenn sie nicht Fehler machten, so würden sie auch niemals auf der Anklagebank sitzen.«
Es war schon spät am Sonnabendnachmittag, als der Präsident endlich mit seinem Resumé begann, doch sollten diejenigen eine angenehme Überraschung erleben, die der Ansicht waren, Seine Exzellenz werde sich sicherlich in einer noch längeren Rede ergehen, als die beiden Rechtsgelehrten, deren Aussprüche er gegeneinander abwägen musste. Seine Rede war jedoch weitaus die kürzeste von allen dreien. Weniger erschöpfend als die herkömmlichen Rekapitulationen eines verwickelten Falles bot sie doch eine überaus klare und gänzlich unparteiische Darstellung der Sachlage. Nur die hervorragendsten Punkte wurden den Geschworenen, und zwar in wenigen Worten zusammengedrängt und ohne seine eigene Ansicht irgendwie erraten zu lassen, noch einmal vorgelegt.
»Wenn«, sagte der Präsident, »die Schlussfolgerungen der Anklage richtig waren, wenn diese unglückselige Frau, von ihrem Gatten zur Verzweiflung gebracht und, den Aufbewahrungsort der Pistolen kennend, ihn mit einer davon erschossen und dann der Sache den Anschein zu geben versucht hat, als seien Diebe die Urheber des Verbrechens gewesen, so liegt doch unzweifelhaft hier ein Mord vor und nicht etwa Totschlag.«
Die Feierlichkeit dieses Ausspruchs machte sich bis in die äußersten Ecken des überfüllten Saals geltend. So würde sie also entweder wegen Mords verurteilt oder ganz freigesprochen werden.
Unwillkürlich wandte sich jedes Auge der schlanken, schwarzen Gestalt auf der Anklagebank zu, und unter all diesen Blicken neigte sich die Gestalt ein ganz klein wenig. Diese Bewegung war indes so schwach und so spontan, dass man sie für unbewusst halten konnte, aber gerade deshalb musste sie doppelt wirken. Trotzdem wurde sie von vielen im Gerichtssaal, besonders von den Schauspielern, die hinter dem Mann mit dem weißen Haar saßen, für einen feinen Zug höchster Verstellungskunst und Selbstbeherrschung angesehen.
»Wenn sie freigesprochen wird«, flüsterte einer von diesen eingebildeten Narren einem anderen zu, »so kann sie ihr Glück auf der Bühne machen!«
Inzwischen war der Präsident auf die eigenen Aussagen der Angeklagten übergegangen, und zwar in recht menschenfreundlicherweise. Auch legte er dabei weniger Zurückhaltung an den Tag als im ersten Teil seiner Rede. Man dürfe nicht vergessen, dass die Aussagen einer Frau, die zwischen Leben und Tod schwebt, deshalb nicht weniger glaubhaft seien, während es anderseits Pflicht der Geschworenen sei, wohl zu bedenken, dass die Behauptungen der Angeklagten außer in nebensächlichen Einzelheiten keine Bestätigung gefunden hätten. An den Geschworenen sei es jetzt, den Hergang der Geschichte an sich, so wie sie ihn selbst gehört hätten, auch in Bezug auf die Zeugenaussagen zu beurteilen. Hegten sie nur den geringsten berechtigten Zweifel, so müsse der Angeklagten der volle Vorteil dieses Zweifels gewährt und sie freigesprochen werden. Wenn aber anderseits die Geschworenen nach Erwägung aller einschlägigen Momente zu der Überzeugung gelangt seien, dass niemand anders als die Angeklagte den Mord begangen haben könne – trotzdem allerdings keiner das Verbrechen habe begehen sehen – so müssten sie, ihrem Eide getreu, sie schuldig sprechen.
Während der Rede des Präsidenten war der kurze Novembertag allmählich in den Abend übergegangen, und in dem finsteren, altersgeschwärzten Saal hatte sich eine große Veränderung vollzogen. Matte Glaskugeln verwandelten sich in blendende Sonnen, und zum ersten Male während der ganzen Woche durchströmten Licht und Wärme den düsteren Ort. Die Wirkung von Licht und Wärme lag aber auch auf allen Gesichtern, als die Zuhörer sich wie auf einen Schlag emporrichteten, während der Präsident die Gerichtsbank verließ, die Geschworenen sich im Gänsemarsch in ihr Beratungszimmer zurückzogen und die Angeklagte, zum letzten Male in Ungewissheit über ihr Schicksal, hinausgeführt wurde. Im nächsten Augenblick schon brauste ein Summen und Schwirren durch den Saal, wie man es eher im Zwischenakt einer Theatervorstellung erwartet hätte, als in einem Gerichtssaal im Augenblick der ernsten Entscheidung. In ein Schulzimmer, aus dem der Lehrer fortgerufen worden ist, hätte man sich versetzt glauben können – kaum eine einzige Zunge stand still. Am Gerichtstisch schüttelten die Schreiber, über ihre rosa Löschblätter und ihre Kielfedern gebeugt, eifrig mit den Perücken; Herren von der Presse spitzten ihre Bleistifte oder ergingen sich in Vermutungen: die wenigen Bevorzugten, die zwischen den Sitzen der Reporter und der Gerichtsbank Platz gesunden hatten, diskutierten die Sachlage mit grausamer Gleichgültigkeit und unerhörtem Cynismus, hinter dem sie indes lediglich ihre innere Erregung zu verbergen suchten.
Der Fremde im weißen Haar schenkte dem Geschwätz um sich her jetzt ausnahmsweise einige Beachtung, jedoch ohne sich umzuwenden. Plötzlich ließ sich der Ruf vernehmen: »St! Still! Sie kommen!« Da verstummte das gedankenlose Geschnatter. Allein, es war ein falscher Alarm gewesen: keine Spur von den Geschworenen ließ sich entdecken, und von neuem schwoll das Stimmengewirr an, wie wenn der Wind allmählich in Sturm übergeht.
»Wir werden uns wohl ein Gläschen gönnen müssen, wenn alles vorüber ist«, flüsterte einer der beiden Advokaten, die vorhin über den Fall diskutiert hatten, dem anderen zu.
»Das will ich meinen, alter Junge«, antwortete sein Freund.
Das Gesicht des weißhaarigen Mannes verfinsterte sich noch mehr. Dies war also die Art, wie die Leute sich unterhielten, während sie auf das Todesurteil eines ihrer Mitmenschen warteten! Freilich, morgen in den Zeitungen, da würde dieses animierte Geplapper im Saale ohne Zweifel mit den schönen Ausdrücken: leises Schwirren, erwartungsvolles, angsterfülltes Flüstern etc. bezeichnet werden. Trotzdem ließ sich nicht leugnen, dass eine tiefe, wenn auch vielleicht unterdrückte, aber aus jeder Stimme herausklingende Erregung in der Luft lag. Auch dem weißhaarigen Manne entging das nicht, und verächtlich verzog er den Mund. So konnten sie also scherzen, diese Menschen, und dabei doch ihre innere Angst nicht loswerden! Ihm selbst war freilich keine Schwäche anzumerken. Geduldig lauschend saß er da mit dem unverändert prüfenden Blick, den er die ganze Woche hindurch abwechselnd auf der Angeklagten und den Geschworenen hatte ruhen lassen. Und als dann zuerst diese und hierauf auch die Angeklagte wieder erschienen, wanderte sein schlaues Auge in gleicher Weise von einem zum anderen.
Alles in allem waren die Geschworenen nicht länger als vierzig Minuten fortgewesen, und ihre eilige Rückkehr schien ein ebenso schlechtes Omen zu sein, als ihre ernsten, aufgeregten Gesichter. Ein Flüstern, ein leises, verheißungsvolles Gemurmel ging einen Augenblick lang durch den Saal, dann aber folgte eine Stille, die ganz derjenigen entsprach, wie man sie am nächsten Tage in jeder Zeitung beschrieben lesen würde. Die Angeklagte blieb aufrecht stehen zwischen den beiden Gefängniswärterinnen, die sie begleitet hatten. Nun endlich konnten auch die Journalisten und Blitzzeichner ihre langgehegte Absicht ausführen, denn Mrs. Minchin hatte nicht nur den Stuhl, auf dem sie die ganze Woche gesessen, verschmäht, sondern auch den schweren Schleier, den sie nur ein einziges Mal während ihrer Verteidigungsrede ein wenig gelüftet hatte, ganz zurückgeschlagen. Nun hing er wie ein schwarzer Nonnenschleier über ihren Witwenhut, und in dieser Umrahmung erschien ihr erschreckend blasses Gesicht noch weißer als das einer Toten.
Sie aber hatte ihren Schleier nur zurückgeschlagen, um dem ihr drohenden Feinde, dem Tode, offen ins Antlitz zu schauen, und wie gebannt hafteten die staunenden Blicke der ganzen Versammlung auf diesem Bilde.
So also sah das Gesicht aus, das all diese Tage her verborgen gewesen war? Ein ganz andres hatten sie hinter der stolz abweisenden Hülle des dichten Schleiers vermutet. War dies das Gesicht einer Mörderin?
Schön konnte man es zwar in diesem Augenblick nicht nennen, wenngleich die Bedingungen der Schönheit unverkennbar unter dem trüben Hauch von Entsetzen und Leiden versteckt waren, so wie eine schöne Landschaft auch in der ungünstigsten Beleuchtung immer noch schön ist. Das Gesicht war schmal, aber von vollendetstem Oval, ein klein wenig in die Länge gezogen durch ein kräftiges Kinn und eine hohe, freie Stirn, augenblicklich auch noch durch Kummer und unnatürliche Abmagerung. Der hübsche Mund mit den blutleeren Lippen hatte einen sanften und zugleich energischen Ausdruck, die Augen waren von warmem, glänzendem Braun, strahlend, beredt, tapfer und – hoffnungslos.
Sie hatte aber auch in der Tat keine Hoffnung. Ein Blick auf das totenblasse, vom grausamen Gaslicht grell beleuchtete Gesicht genügte, um dies zu erkennen. Doch trat diese Hoffnungslosigkeit noch deutlicher hervor, als Rachel mit traurigen, aber unerschrockenen Augen beobachtete, wie die Geschworenen zum letzten Male den Aufruf ihrer Namen beantworteten.
Nun war auch dies geschehen. Erregt wendete sich der Obmann auf seinem Platze hin und her. In der qualvollen Spannung der letzten furchtbaren Pause schien es der dichtgedrängten Menge, als steigere sich die Temperatur im Saale zu der eines türkischen Bades.
»Meine Herren Geschworenen, haben Sie sich über Ihren Urteilsspruch geeinigt?«
»Ja, das haben wir!«
»Erachten Sie die Angeklagte für schuldig oder nicht schuldig?«
»Für nicht schuldig.«
Ein unterdrückter Aufschrei aus Hunderten von Kehlen zugleich ging durch den Saal. Zugleich sah man, wie der Schriftführer die Hand ans Ohr legte und sich vorbeugte, denn die Stimme des Obmanns hatte vor lauter Erregung keinen Klang. Jedermann im Saal beugte sich nun ebenfalls vor, diesmal aber hatten die Empfindungen des aufgeregten Obmanns eine andre Wirkung.
»Nicht schuldig!« brüllte er nun aus vollem Halse.
Totenstille folgte, während die Wanduhr fünf Uhr schlug.
»Ist dies das Urteil von Ihnen allen?«
»Ja, von jedem von uns!«
Die Augen auf das Pult niederschlagend, lehnte sich der Präsident in seinen Stuhl zurück, ohne durch eine Miene oder Bewegung seine persönliche Ansicht zu verraten, die er mit so bewundernswürdiger Unparteilichkeit während des ganzen Verhörs unterdrückt hatte. Immerhin aber vergingen doch einige Augenblicke, ehe er die Augen zugleich mit seiner Stimme erhob.
»Die Angeklagte ist in Freiheit zu setzen!« war alles, was er sagte. In diesen Worten sollte aber ein mürrischer ärgerlicher, dankbarer, empörter, gerührter und auch wieder harter und gleichgültiger Ton gelegen haben. So würde es morgen in den Zeitungen zu lesen sein, dann konnte sich jeder auserwählen, was ihm am besten gefiel.