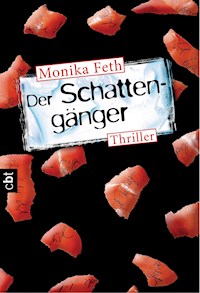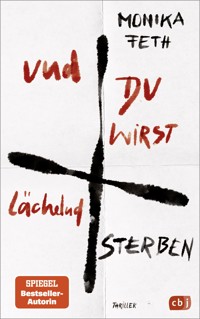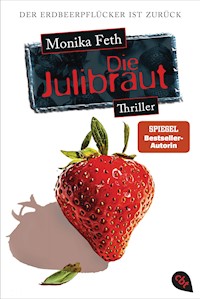8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Erdbeerpflücker-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jette ermittelt wieder!
Minas Vater, das Oberhaupt eines streng religiösen Zirkels, wird ermordet. Während Mina ins Fadenkreuz der Ermittlungen gerät, ist Jette von ihrer Unschuld überzeugt. Auf der Suche nach dem wahren Täter begibt sie sich selbst in tödliche Gefahr …
Fortsetzung der Erfolgsbände „Der Erdbeerpflücker“ und „Der Mädchenmaler“.
Die fulminante Spiegel-Bestsellereihe von Monika Feth begeistert Millionen Leser:innen. Die Jette-Thriller sind nervenzermürbend, dramatisch und psychologisch brilliant erzählt. Atemberaubende Spannung der Extraklasse!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,6 (46 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DIE AUTORIN
Lob
Inschrift
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
DIE AUTORIN
Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren. Nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium arbeitete sie zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie in einem kleinen Dorf in der Voreifel, wo sie für Jugendliche, Erwachsene und Kinder schreibt.
»Der Erdbeerpflücker« und »Der Mädchenmaler«, die Krimis um Jette, machten sie über die Grenzen des Jugendbuchs hinaus bekannt. »Der Scherbensammler« ist der dritte Band der Serie.
Weitere lieferbare Titel von Monika Feth bei cbt:
Der Erdbeerpflücker (30258) Der Mädchenmaler (30193) Das blaue Mädchen (30207) Fee - Schwestern bleiben wir immer (30010) Nele oder Das zweite Gesicht (30045)
Die Presse über die Jette-Thriller:
»Jugendliche Krimileser mit einer Vorliebe für realistische Alltagsschilderungen und psychologischen Hintergrund, wie wir sie in den Krimis aus Skandinavien kennen, finden in diesem Roman alles, was auch in Krimis für Erwachsene fasziniert: außergewöhnliche Charaktere und einen Spannungsbogen, der … fesselt.«
Süddeutsche Zeitung
»Keine billigen Effekte, einfach gut geschrieben und zum sofortigen Verschlingen geeignet.«
Saarbrücker Zeitung
cbt - C. Bertelsmann Taschenbuch Der Taschenbuchverlag für Jugendliche Verlagsgruppe Random House
Alles geschieht nur einmal, aber dieses eine Mal für immer.Henry Miller
Aus: Henry Miller, Land der Erinnerung
1
Es war, als hätte sie sich in ihrem Innern ein Nest gebaut. Als säße sie darin versteckt, sicher und geborgen, während draußen ihr Körper weiter funktionierte. Dunkel war es hier drinnen. Warm. Weich. Sie hatte keinen Hunger und keinen Durst, empfand keine Schmerzen und keine Traurigkeit.
Irgendwer hatte die Kontrolle übernommen. Das war beruhigend. Irgendwer fühlte sich immer verantwortlich. Sie ließen sie nicht im Stich. Zusammengekauert in ihrer Höhle, schloss sie die Augen und horchte auf die Stille. Für eine Weile war alles gut.
»Bis morgen dann!«
Tilo Baumgart sah von den Unterlagen auf und verabschiedete seine Sekretärin mit einem zerstreuten Lächeln. Er war damit beschäftigt, die Notizen der letzten Sitzung zu vervollständigen. Der Patient hatte ihn erregt angebrüllt und die Sitzung vorzeitig abgebrochen. Beim Hinausgehen hatte er mit voller Wucht die Tür hinter sich zugeschlagen.
Der erste Schritt. Er hatte so viel Vertrauen gefasst, dass er loslassen und Gefühle zeigen konnte. Tilo war zufrieden. Er hatte schon gar nicht mehr darauf zu hoffen gewagt.
»Viel Spaß!«, rief er Ruth hinterher, weil ihm eingefallen war, dass sie ja ihre Tochter zu Besuch haben würde. Das Mädchen lebte beim Vater. Ruth holte sie an jedem zweiten Wochenende zu sich und manchmal auch für ein paar Stunden zwischendurch.
Anscheinend hatte Ruth ihn nicht mehr gehört, denn sie antwortete nicht. Ihre Absätze klackerten über den Flur, dann war es ruhig. So ruhig, dass Tilo sich zum ersten Mal an diesem Tag entspannte.
Gähnend schaute er auf die Uhr. Seltsam. Eigentlich müsste Mina längst hier sein. Mit achtzehn Jahren war sie die jüngste seiner Patientinnen. Seit Beginn der Therapie vor zwei Jahren hatte sie keinen Termin versäumt und sich nie verspätet. Verwundert schob er die Papiere in den Hefter, trug ihn ins Nebenzimmer und ordnete ihn in die Kartei ein. Dabei fiel sein Blick auf Ruths Schreibtisch.
Er war ein Spiegel ihrer Persönlichkeit. Der üppige Blumenstrauß in der Vase. Das Foto ihrer kleinen Tochter. Der rote Stein, den sie als Briefbeschwerer verwendete. Die Ansichtskarte aus Irland, die an der Schreibtischlampe lehnte. All das war Ruth. Ein freundliches Durcheinander (Ruth nannte es kreatives Nebeneinander) von Dingen.
Tilo kehrte in sein Zimmer zurück, setzte sich auf seinen Stuhl, legte die Füße auf den Schreibtisch und schloss die Augen. Er liebte die Augenblicke, die ihm ganz allein gehörten, die wenigen Minuten zwischen den Terminen. Träge sah er sich um.
Er nannte seine Räume nicht gern Praxis. So wie er die Menschen, die ihn hier aufsuchten, nicht gern Patienten nannte. Er hatte sich oft andere Begriffe überlegt, doch auch die hatten nicht standgehalten. Die Menschen, die er therapierte, waren in ihrer Vielschichtigkeit unmöglich über einen Kamm zu scheren. Sie waren ihm fast immer lieber als die angeblich Gesunden draußen, ehrlicher, offener, selbst wenn sie sich versteckten. Sie waren zutiefst aufrichtig in ihrem Bemühen, der Welt mit all ihren Ängsten zu begegnen, ohne sich vollends der Panik zu überlassen.
»Du liebst jeden von ihnen«, hatte Imke neulich zu ihm gesagt. »Und ab und zu liebst du den einen oder andern noch ein bisschen mehr.«
Als Schriftstellerin konnte sie gar nicht anders, als genau zu beobachten. Manchmal merkte Tilo, dass er ihr gegenüber vorsichtig wurde. Menschen, Dinge und Situationen waren für Imke oft hauptsächlich Material für ihre Bücher. Er hatte nicht vor, zu einer ihrer Figuren zu werden. Und noch weniger wollte er, dass einer seiner Patienten es wurde.
Nach einem letzten Blick auf die Uhr griff er nach dem Telefon. Mina würde nicht mehr kommen. Er hatte Imkes Nummer eingespeichert. An erster Stelle. Die Taste war schon abgegriffen, die Beschriftung verblasst.
»Thalheim.«
Sie meldete sich immer mit einem leise fragenden Unterton in der Stimme. Als wartete sie auf irgendwas. Oder irgendwen? Er lächelte. Das fehlte noch, dass er auf einmal anfing, eifersüchtig zu werden.
»Ich habe gerade an dich gedacht«, sagte er.
»Wie schön.«
Ihre Stimme hatte sich augenblicklich verwandelt, war zärtlich geworden und ein klein wenig atemlos.
»Soll ich dich heute zu einem fulminanten Abendessen ausführen?«, fragte er.
»Wenn du Frauen mit fulminanten Pfunden begehrenswert findest.« Sie lachte leise. Ihre Figur war einwandfrei. Sie konnte es sich leisten, damit zu kokettieren.
»Ich liebe jedes Pfund an dir«, sagte er, und das stimmte. Diese Frau hatte sein Leben auf den Kopf gestellt. Morgens beim Abschied freute er sich schon aufs Wiedersehen. Die meisten Abende und Nächte verbrachte er inzwischen bei ihr. Nur manchmal zog es ihn noch in seine Wohnung. Ab und zu brauchte er ein paar Stunden des Alleinseins, um sich daran zu erinnern, dass es auch abseits von Imke Thalheim noch ein Leben gab.
»Bist du fertig für heute?«, fragte sie.
»Ja. Mein letzter Termin ist geplatzt.« Er klemmte das Telefon zwischen Schulter und Ohr und fing an, seine Tasche zu packen. »Ich mache mich gleich auf den Weg.«
»Ich freu mich auf dich«, sagte sie und beendete das Gespräch.
Immer hatte sie das letzte Wort. Doch auch das liebte er an ihr. Er öffnete das Fenster und sah hinaus. Draußen verglühte der Sommer. Eine schwarze Katze räkelte sich auf den warmen Steinen am Brunnen. Das Wasser plätscherte. Plötzlich hatte Tilo große Lust, sich Imke zu schnappen und für ein paar Tage ans Meer zu fahren. Einfach so. Spontan, unvernünftig und abenteuerlich.
Aber da war der Terminkalender. Da waren seine Patienten. Und außerdem war Imke nicht die Frau, die sich schnappen und ans Meer entführen ließ. Seufzend machte er das Fenster zu und griff nach seiner Tasche. Er hatte jetzt zwei Jahre nonstop durchgearbeitet. Vielleicht sollte er das Abendessen nutzen, um Imke einen ersten gemeinsamen Urlaub schmackhaft zu machen. Der Gedanke beflügelte ihn. Pfeifend schloss er die Praxis ab und durchquerte beschwingt den langen, angenehm kühlen Flur.
Überall war Blut. Auf dem Boden. An der Wand. An ihren Schuhen. Ihren Kleidern. Entsetzt starrte sie ihre Hände an.
Rot. Klebrig.
Es ließ sich nicht abreiben. Trotzdem fuhr sie wieder und wieder über ihre Jeans. Bis ihr die Hände brannten.
Ein Fenster. Sie musste ein Fenster öffnen! Mühsam rappelte sie sich auf. Jeder Knochen im Leib tat ihr weh. Tief atmen. Sauerstoff in die Lungen schaffen. Kraft sammeln.
Und Mut.
Sie hatte keine Ahnung, wo sie war und warum sie in diesem Zimmer auf dem Boden gekauert hatte. Vor allem aber wusste sie nicht, woher das Blut kam. All das rote, glitschige Blut.
Ihr wurde schwindlig. Sie stützte sich an der Wand ab, bemerkte entsetzt, dass sie schwache rote Abdrücke auf der weißen Tapete hinterließ. Stöhnend setzte sie einen Fuß vor den andern und folgte dem Licht, das sie zu einem Fenster führen musste.
Vielleicht war das ein Traum. Und sie steckte darin fest. In einem seltsam eindrücklichen Traum, der ihr vorgaukelte, dies hier sei die Wirklichkeit. Sie konnte fühlen, hören, Farben sehen. Waren Träume farbig? Oder nur schwarz-weiß?
Hastig riss sie das Fenster auf. Nahm wahr, dass eine Pflanze zu Boden fiel und der Übertopf mit einem Knall in Scherben ging. Und dann lehnte sie sich hinaus und sog gierig die frische Luft ein.
Ich hatte das Geschirr in die Spülmaschine geräumt und mir einen Eimer Seifenwasser geholt, um die Tische abzuwischen. Alles, was mit Küche und Speisesaal zu tun hatte, roch für mich gleich und erinnerte mich an Krankenhaus.
Es war ein muffiger, abgestandener Geruch, der hartnäckig an jedem Gegenstand zu haften schien, erst recht an dem warmen, feuchten Putzlappen. Wenn ich mit dem Dienst fertig war, hatte sich dieser Geruch auch in meinen Kleidern verfangen und in meinem Haar. Er lag sogar auf meiner Haut. Ich konnte abends nicht schnell genug unter die Dusche kommen.
Die Tische waren immer völlig versaut. Die meisten alten Leute waren nicht mehr in der Lage, die Hände ruhig zu halten. Manche mussten gefüttert werden. Ab und zu verschluckten sie sich und spuckten beim Husten das Essen umher. Sie warfen ihr Glas oder ihre Tasse um. Zogen eine Kleckerspur, wenn sie sich Gemüse oder Kartoffeln nahmen.
Heute hatte es zum Abendessen Brot mit Aufschnitt und Käse gegeben. Dazu Tomatensalat. Und Tee in allen Variationen. Besonders beliebt waren Kamille, Fenchel und Pfefferminz. Und schwarzer Tee. Doch der war am Abend nicht mehr erlaubt.
Ich arbeitete gern hier. Schon vor dem Abi hatte ich mich um eine Stelle bemüht. Mir war immer klar gewesen, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr machen wollte. Und ich hatte immer gewusst, dass ich mich am liebsten um alte Menschen kümmern würde.
Meine Großmutter behauptet, das sei mein Helfersyndrom. Sie ist ein großartiger Mensch, fit und vital und mit einer dermaßen spitzen Zunge ausgestattet, dass sie glatt ein zu Boden segelndes, hauchfeines Seidentuch damit spalten könnte.
Das mit dem Helfersyndrom ist natürlich Quatsch. Es ist einfach spannend, sich ein Jahr lang auszuprobieren. Außerdem mag ich alte Leute. Keine Ahnung, warum. Es war schon immer so.
Vielleicht ist ein Heim für Demenzkranke nicht jedermanns Geschmack, aber ich hatte es auf Anhieb sympathisch gefunden. Das St. Marien war klein und familiär. Dreiundfünfzig Bewohner, von denen fünfzehn an Alzheimer litten, der Rest an anderen Formen von Demenz. Der älteste Bewohner war achtundneunzig, die mit Abstand jüngste Bewohnerin, eine krasse, traurige Ausnahme, siebenundvierzig Jahre alt.
Es war eine neue Welt für mich, und die Erfahrungen, die ich hier sammelte, taten mir gut. Das hatte sogar meine Mutter inzwischen eingesehen, nachdem sie lange versucht hatte, mich von diesem Job abzuhalten.
»Du bist jung. Freu dich deines Lebens«, hatte sie gesagt. »Hast du in letzter Zeit nicht genug durchgemacht?«
Das hatte ich allerdings, doch ich hatte auch großes Glück gehabt. Zweimal war ich in Todesgefahr geraten und beide Male hatte ich überlebt. Ich hatte das Gefühl, von diesem Glück einen Teil abgeben zu müssen.
Der leere Speisesaal strahlte etwas Trauriges aus. Das Stimmengemurmel und die Geräusche waren verstummt. Die Bewohner hatten sich zurückgezogen. Die meisten gingen früh ins Bett. Viele von ihnen würden später, wenn alles schlief, durch das Haus geistern. Sie waren wie Katzen, verdösten die Tage und wurden in der Nacht lebendig.
Hinter mir hörte ich leise Schritte. Ich drehte mich um und sah Frau Sternberg zwischen den Tischen umherwandern. Sie wirkte ängstlich und schaute immer wieder über die Schulter zur Tür.
»Kann ich Ihnen helfen, Frau Sternberg?«
Ich legte das Putztuch beiseite und trat langsam auf sie zu. Sie kannte mich mittlerweile gut genug, um nicht schon beim Klang meiner Stimme in Panik zu geraten, trotzdem hob sie die Hand, um mich zu stoppen. Sie konnte körperliche Nähe nicht ertragen.
»Da draußen.« Sie blickte beunruhigt zum Fenster. »Es wird bald dunkel.«
»Soll ich Sie nach oben bringen?«, fragte ich. »Wir machen das Licht an. Dann ist es in Ihrem Zimmer schön hell.«
Sie hörte mich nicht. »Die Nacht ist gefährlich«, flüsterte sie. »Vor allem bei diesem vielen Schnee.«
Dabei neigte sich der August gerade erst seinem Ende zu. Der Sommer schien noch einmal sämtliche Kräfte zu bündeln. Es war in den vergangenen Tagen so heiß gewesen, dass man bei der kleinsten Bewegung in Schweiß ausgebrochen war.
»Kommen Sie, Frau Sternberg.« Ich nahm behutsam ihren Arm. Sie wehrte sich nicht und überließ sich meiner Führung.
Es gab hier überall gemütliche Nischen, in die sich die Bewohner zurückziehen konnten. Sie waren mit alten Möbeln ausgestattet, die Wände mit alten, gerahmten Fotos geschmückt. Auf den Tischen lagen ausgeblichene Klöppeldecken. Hier stand eine vorsintflutliche Nähmaschine, da ein hölzernes Schaukelpferd von früher.
All diese Dinge waren aus einem bestimmten Grund angeschafft worden. Demenzkranke haben die Fähigkeit verloren, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden. Sie kennen sich auch in ihrem Leben nicht mehr aus, vergessen die Namen ihrer Angehörigen, können die Wochentage, die Monate und Jahre nicht unterscheiden und fürchten sich vor ihrem eigenen Spiegelbild.
Aber sie erinnern sich an die Zeit ihrer Kindheit. An einen Zustand des Geborgenseins. Und hier im Heim versuchte man, diese Kindheit mit Möbeln, Bildern und antiquarischen Büchern wieder heraufzubeschwören.
Die Heimbewohner blieben selten in ihren Zimmern. Meistens kamen sie herunter und kuschelten sich in einen der altmodischen Plüschsessel, hörten die Musik von früher und fühlten sich für einige kostbare Momente sicher.
»Ich muss nach Hause«, sagte Frau Sternberg. »Mein Mann wartet aufs Essen.« Aber sie wehrte sich nicht gegen meine Hand, die ihren Arm hielt und sie zum Fahrstuhl lenkte. »Er hätte längst eine Beförderung verdient. Er ist so fleißig.«
Ich nickte. Das Erste, was man hier lernte, waren ein paar wichtige Umgangsregeln. Zum Beispiel durfte man die Bewohner nicht dadurch verwirren, dass man sie in die Gegenwart zu zerren versuchte. Man musste dort auf sie zugehen, wo sie sich gerade befanden, an irgendeinem Punkt in ihrer Vergangenheit.
»Bestimmt«, sagte Frau Sternberg, »wird er noch mal Bundeskanzler. Oder Papst.«
Herr Sternberg war Mitte achtzig. Er besuchte seine Frau, sooft es ihm möglich war. Sie erkannte ihn längst nicht mehr. Der Ehemann, an den sie sich in seltenen Momenten erinnerte, war jung. Sternbergs hatten drei Kinder, die sich hier nie blicken ließen. Sie kamen im Leben ihrer Mutter nicht mehr vor und das hielten sie nicht aus.
Frau Sternberg hasste den Fahrstuhl. Aber die Treppe war für sie unüberwindlich. Während wir nach oben fuhren, bewegten sich ihre Lippen wie bei einem stummen Gebet. Sobald sich die Tür öffnete, drängte sie hinaus.
»Als wär man lebendig begraben.«
Jetzt schaute sie mich direkt an, was sie nur ganz selten tat. Meistens wich sie dem Blick ihres Gegenübers aus. Ihre Augen waren überraschend blau. Ich konnte mir plötzlich vorstellen, wie sie als junges Mädchen ausgesehen haben musste.
Neben den Zimmertüren waren Körbe an den Wänden angebracht. In ihnen befanden sich Kuscheltiere, Massagebälle, Wollknäuel, Stifte. Demenzkranke stöbern gern. Sie öffnen fremde Türen, betreten fremde Zimmer, durchwühlen Schränke und Schubladen. Die Körbe sollten das verhindern. In ihnen durften sie nach Herzenslust kramen. Herausnehmen, was sie wollten. Es gehörte zu meinen Aufgaben, die später überall herumliegenden Sachen wieder in den Körben zu verstauen.
In ihrem Zimmer setzte Frau Sternberg sich in den Sessel und band sich die Schuhe auf. »Mama hat mich ins Bett geschickt«, flüsterte sie, »weil ich ein böses Mädchen war.« Ihre Mundwinkel bebten. Gleich würde sie anfangen zu weinen.
Ich hockte mich neben sie und nahm ihre Hand. Sie war lang und knochig. Zwischen den dicken blauen Adern lag die Haut wie fleckiges Pergament. Ein Hauch von Kölnisch Wasser stieg mir in die Nase.
»Alles ist wieder gut«, sagte ich leise. »Alles ist gut.«
Sie entspannte sich allmählich, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Kurz darauf war sie eingeschlafen. Ich deckte sie mit einer Wolldecke zu und verließ auf Zehenspitzen das Zimmer, um in den Speisesaal zurückzukehren. Ich musste mich beeilen, wenn ich rechtzeitig zu Hause sein wollte. Merle und ich hatten einen Filmabend geplant. Sie hatte versprochen, ein paar schöne DVDs auszuleihen und sich ums Essen zu kümmern. Seit ich diesen Job hatte, verbrachten wir viel zu wenig Zeit miteinander.
»Das werden wir ändern«, murmelte ich und legte mich ins Zeug. Wenn ich so weitermachte, würde ich mit meinem Tempo beim Tischabwischen irgendwann ins Guinnessbuch der Rekorde kommen. Ich grinste vor mich hin und freute mich auf den Feierabend.
Sie kannte diese Wohnung nicht. Sie hatte keine Ahnung, wie sie hergekommen war. Sie drehte sich um.
Eine Küche. Dampfschwaden hingen in der Luft. Auf dem Herd stand ein Kessel mit kochendem Wasser. Anscheinend schon eine ganze Weile. Nicht mehr lange, und er würde anbrennen und mit der Herdplatte verschmelzen. War denn niemand hier?
Sie ging hin und drehte den Schalter. Er klackte leise und sie zuckte bei dem Geräusch zusammen.
»Ruhig«, flüsterte sie. »Ganz ruhig.«
Es nützte nichts. Ihre Nerven lagen bloß. Sie musste hier raus. Sie konnte nicht in all dem Blut hocken bleiben und abwarten, was geschehen würde.
Schritt für Schritt näherte sie sich der Tür. Ihre Nackenhaare sträubten sich. Die Härchen an ihren Unterarmen stellten sich auf. Sie spürte die Gänsehaut, die sie überrieselte, sogar im Gesicht. Es kostete sie alle Kraft, sich vorzubeugen und einen Blick in den Flur zu werfen.
Ein hellgrauer Teppichboden, weiße Wände. Und der Geruch von Blut. Fast meinte sie, das Blut schmecken zu können. Es schien in ihre Nasenlöcher eingedrungen zu sein und sich von da aus in ihrem ganzen Körper auszubreiten.
Rote Abdrücke auf den Wänden. Rote Fußspuren auf dem Teppichboden.
Drei Türen. Alle standen offen. An allen musste sie vorbei. Um rauszukommen. Raus. Nur raus.
Sie schluckte. Trocken. Schmerzhaft. Versuchte, sich zu räuspern, um sich mit ihrer Stimme Mut zu machen. Aber kein Laut kam aus ihrer Kehle.
Und dann tat sie den ersten Schritt.
Merle ließ Wasser in eine Glasschüssel laufen, um die Trauben darin zu waschen. Erst gestern hatte sie gelesen, wie stark Trauben mit Pestiziden belastet waren. Vielleicht sollten sie ganz aufhören, Trauben zu essen. Vielleicht. Vielleicht sollten sie irgendwann überhaupt anfangen mit dem Vernünftigsein.
Donna und Julchen strichen ihr maunzend um die Beine. Sie hatten ihr Trockenfutter nicht angerührt. Warum auch, wenn sie nur ein bisschen zu betteln brauchten, um Fleisch zu bekommen. Angewidert füllte Merle Dosenfutter in zwei Schalen. Als Tierschützerin würde sie niemals das Fleisch von Tieren essen, aber bis jetzt war es ihr noch nicht gelungen, auch die Katzen zu Vegetariern zu erziehen (oder wenigstens einen Versuch in diese Richtung zu unternehmen). So etwas kostete Nerven und Zeit. Von beidem hatte sie gerade mal genug, um ihr Leben in den Griff zu kriegen.
Merle hatte nach dem Abi beschlossen, ein Jahr lang zu jobben. Wenn sie nicht gerade mal wieder Beziehungsstress hatten, half sie Claudio in seinem Pizzaservice aus. Sie engagierte sich mehr als zuvor in ihrer Tierschutzgruppe, organisierte Aktionen und nahm selbst daran teil. Sie brachte die aus den Versuchslaboren befreiten Tiere bei privaten Pflegestellen unter, koordinierte ihre weitere Vermittlung und die Betreuung der Pflegefamilien und übernahm zusätzliche Dienste im Bröhler Tierheim.
»Und ihr liegt den ganzen Tag auf der faulen Haut.« Sie stellte die Futterschalen auf den Boden und sah zu, wie Donna und Julchen sich darüber hermachten.
Sie liebte die Katzen und konnte sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Gäbe es die Tierschutzgruppe nicht, wären Donna und Julchen wahrscheinlich längst tot. Merle konnte sich noch gut daran erinnern, wie ausgemergelt und heruntergekommen die beiden gewesen waren, als man sie aus einem Labor geholt hatte. Nur Haut und Knochen, die Augen glanzlos, das Fell struppig und stumpf.
Inzwischen waren sie richtige Schönheiten geworden. Und selbstbewusste Persönlichkeiten. Die Erinnerung an das Elend, das sie erlebt hatten, zeigte sich nur noch in ihrer extremen Scheu fremden Menschen gegenüber.
Merle warf einen Blick auf die Uhr. Noch eine Stunde, dann würde Jette nach Hause kommen. Zeit genug, den Abend in aller Ruhe vorzubereiten. Sie stellte den Rotwein in den Kühlschrank, obwohl er da zu kalt werden würde. Sie mochten ihn gern so. Zum Teufel mit den Gepflogenheiten der feinen Küche.
Sie deckte den Tisch mit Kerzen und Servietten und stellte den Strauß kleiner Sonnenblumen, den sie unterwegs gekauft hatte, in die Mitte. Sie machte einen Salat und ordnete den Käse auf einem großen Pizzateller an. Sie schnitt das Baguette und legte die Scheiben in den Brotkorb.
Als alles fertig war, setzte sie sich hin und las noch einmal in Ruhe den Brief von Ilka und Mike.
Wenn euch mein verlassenes Zimmer nervt, schrieb Mike, vermietet es ruhig, solange wir weg sind. Bringt euch immerhin ein bisschen Geld, und das könnt ihr ja bestimmt gut brauchen.
»Ach was, vermieten«, murmelte Merle. »Wer weiß, wen wir uns da ins Haus holen würden.«
Mike und Ilka hatten die Messlatte verdammt hoch gelegt. Niemand konnte ihnen das Wasser reichen.
Brasilien ist faszinierend, schrieb Ilka. Ich habe sogar wieder angefangen zu malen. Wenn wir zurückkommen, bringe ich meine Zeichnungen und Bilder mit. Dann werdet ihr es mit eigenen Augen sehen.
Merle nickte. Hoffentlich begriff Ilka in diesem Jahr Auszeit, dass sie ihr Wahnsinnstalent nicht vergeuden durfte. Man brauchte sich ja bloß das Wandgemälde in Mikes Zimmer anzugucken, um zu wissen, dass Ilka auf die Kunstakademie gehörte.
Sie hatte Mike dieses Bild zum Einzug geschenkt. Ein Haus in einem Sonnenblumenfeld. Ein Ort zum Träumen. Wenig später war Ilka selbst Teil der Wohngemeinschaft geworden, sozusagen Dauergast.
»Wenn wir mal ein bisschen mehr Geld haben«, sagte Merle zu den Katzen, »dann sollten wir nach einer größeren Wohnung suchen. Oder nach einem kleinen Haus. Vielleicht gibt es ja auch hier in der Nähe Sonnenblumenfelder.«
Julchen sprang auf einen der Stühle. Sie sah Merle in die Augen, als wollte sie sagen: Okay, ich werd drüber nachdenken. Dann fing sie an, sich zu putzen.
Der einzige Wermutstropfen, schrieb Mike, ist die Trennung von euch. Wir vermissen euch jeden Tag. Warum seid ihr bloß nicht mitgekommen? Love. Mike.
Unter den Brief hatte Ilka Porträts von Mike und sich selbst gezeichnet. Damit ihr uns nicht vergesst, hatte sie daruntergeschrieben. Küsschen! Ilka.
Merle war gerührt. Sie blinzelte das Nasse aus den Augen, faltete den Brief zusammen und lehnte ihn gegen die Vase. So würde Jette ihn beim Betreten der Küche sofort entdecken. Sie holte die DVDs aus ihrer Tasche und legte sie auf den Tisch.
Es würde ein schöner Abend werden. Nur sie beide. Niemand sonst. Schon lange hatten sie sich nicht mehr richtig Zeit füreinander genommen. Sie fing an, laut zu singen. Erschrocken schoss Julchen davon.
Er lag da. Seltsam verdreht. Und vollkommen still.
So konnte nur einer liegen, der tot war. Einer, der sich nicht freiwillig zum Sterben hingelegt hatte. Seine Augen standen offen. Sein Gesicht war bleich. Sein Kopf lag in einer Blutlache.
Irgendwo blitzte eine Erinnerung an dieses Gesicht in ihr auf. An etwas sehr Vertrautes. Und verlosch gleich wieder.
Sie stand zitternd an der Wand und traute sich nicht weiter. Vier, fünf große Schritte, und sie hätte die Haustür erreicht. Vier, fünf Schritte, und sie wäre in Sicherheit.
Doch dazu musste sie an ihm vorbei. Sie wandte den Kopf ab, streckte die Arme aus und tastete sich vorwärts. Immer an der Wand entlang, von der er am weitesten entfernt war. Dann, endlich, fühlten ihre Finger das Holz der Haustür. Sie riss sie auf und stürzte hinaus. Ins Freie. Ans Licht.
Das Blut pulsierte in ihren Schläfen. Ihr Schädel schien zu zerspringen. Sie lehnte sich gegen die Hausmauer und rang nach Atem. Schloss die Augen. Spürte die Sonne auf dem Gesicht und den leichten Wind. Die Mauersteine hatten die Wärme des Tages gespeichert. Sie presste den Rücken dagegen. Fühlte, wie sich ihre Muskeln entspannten.
Was hatte sie hier zu suchen? Sie kannte die Gegend nicht.
Ihr wurde kalt vor Angst, als sie merkte, dass es ihr wieder passiert war - sie hatte Zeit verloren. Wie viele Stunden fehlten in ihrer Erinnerung? Sie wusste nicht, wie sie hierhergekommen war. Hatte keine Ahnung, wie sie nach Hause zurückfinden sollte. War nicht einmal sicher, ob sie überhaupt ein Zuhause besaß.
Ihr Blick fiel auf ihre Hände. Nein. Sie würde sich nicht einreden können, dies sei ein Traum.
Sie sah sich um. Eine verlassene Gegend. Nur dieses Haus, einsam, hoch und still, umgeben von Bäumen, Wiesen und wenigen flachen Gebäuden. Nichts kam ihr bekannt vor.
»Lieber Gott, hilf mir«, flüsterte sie.
Langsam setzte sie sich in Bewegung. Dann wurden ihre Schritte schneller. Schließlich rannte sie über die staubigen Wege, die die mageren Wiesen zerteilten. An einem schmalen Bach kniete sie sich hin, wollte sich die Hände waschen, wimmernd vor Angst. Doch sofort sprang sie wieder auf und lief weiter.
Sie wusste nicht, wohin. Sie wusste nur, dass sie hier nicht bleiben konnte.
2
»Du siehst müde aus.« Imke umarmte Tilo und drückte die Lippen auf seinen Hals. Ganz schwach konnte sie sein Aftershave riechen. Mexx. Sie hatte es ihm zum Geburtstag geschenkt. Wie sie diesen Duft mochte. Er passte zu Tilo. Und machte ihr weiche Knie.
»Bin ich auch. Hundemüde.« Tilo küsste ihren Nacken.
Es überrieselte sie heiß und kalt. »Anstrengende Patienten?« Sie schloss die Haustür, nahm ihm die Tasche ab, legte sie auf einen Sessel in der Eingangshalle und ging voran in die Küche.
»Nicht anstrengender als sonst. Vielleicht bin ich ein bisschen ausgepowert.« Tilo setzte sich an den Tisch und rieb sich übers Gesicht. Er hatte eine Rasur nötig. Wangen und Kinn waren dunkel von den nachwachsenden Stoppeln.
»Möchtest du was trinken?«
»Gern. Ein Glas Wasser. Ein großes.«
Sie stellte ihm die Wasserflasche hin und ein großes Glas. Setzte sich ihm gegenüber. Wie ein altes Ehepaar, dachte sie amüsiert. Der Mann kommt von der Mühsal des Tages heim. Sein Weib empfängt ihn froh mit Speis und Trank.
»Hunger?«, fragte sie.
»Nach einem guten Steak«, sagte er. »Und nach dir.« Er griff über den Tisch nach ihrer Hand.
»Interessante Reihenfolge.« Imke lachte und merkte, wie kühl sich seine Finger anfühlten. Er arbeitete zu viel. Noch mehr als sie. Er war ein richtiger Workaholic.
»Steaks machen stark.« Tilo warf ihr einen dieser Blicke zu, denen sie nicht widerstehen konnte. Kein altes Ehepaar, dachte sie. Wir sind noch himmelweit davon entfernt.
»Dann nichts wie los.« Sie stand auf, um ihre Tasche zu holen. Nach kurzem Überlegen beschloss sie, ihren Mantel mitzunehmen. So warm es tagsüber auch noch war, abends wurde es doch schon empfindlich kalt.
Tilo verschwand im Bad und kam kurz darauf, frisch gekämmt und in eine Wolke von Mexx gehüllt, wieder heraus. Im Wagen erzählte er von seinen Patienten, ohne dabei jedoch etwas auszuplaudern, was der Schweigepflicht unterlag. So war er, verantwortungsbewusst und diskret, und Imke liebte ihn dafür.
»Wie war dein Tag?«, fragte er, als sie im Silberstreif saßen und ihre Bestellung aufgegeben hatten. Es war ihr Lieblingslokal, weit genug von Tilos Praxis entfernt, um nicht alle naselang Leuten zu begegnen, die ihn kannten. Die Tische standen in ausreichendem Abstand voneinander, sodass man sich in angenehmer Lautstärke unterhalten konnte. Man wurde nicht von Musik berieselt, hörte bloß diffuses Stimmengewirr ringsum.
»Ein Telefongespräch nach dem andern«, beklagte sich Imke. »Ich bin kaum zum Schreiben gekommen.« Tatsächlich hatte sie nur eine Seite geschafft. Die ganze übrige Zeit war für Dinge draufgegangen, die am Ende eines Tages vor ihrem kritischen Blick zu nichts zusammenschrumpften.
»Schaff dir eine Sekretärin an«, schlug Tilo vor.
Imke schüttelte den Kopf. »Bis ich der erklärt habe, was sie tun soll, hab ich es auch selbst gemacht. Schriftsteller sind eine eigene Spezies. Nicht ganz unkompliziert.«
»Wem sagst du das?« Tilo grinste sie breit an.
Die Kellnerin brachte den Wein. Er funkelte dunkelrot in den Gläsern und sah aus, als entstammte er einem Märchen. Imke trank den ersten Schluck und sehnte sich nach einem Land, das sie nicht kannte, das aber irgendwo auf sie wartete. Blaugrüne Buchten, weiße Strände und weit und breit nur sie und Tilo, niemand sonst. Lächelnd griff sie nach ihrem Handy.
»Noch nicht genug telefoniert?«
»Ich will nur schnell Jette bitten, die Katzen ins Haus zu lassen. Auf mich haben sie vorhin nicht gehört. Du weißt ja, wie sie sind. Da kannst du rufen, so viel du willst. Sie ignorieren dich einfach. Es sind wieder Tierfänger unterwegs, da sollten sie um diese Zeit nicht draußen sein.«
Jette war schon auf dem Weg nach Bröhl. Sie war nicht begeistert von der Idee, einen Umweg zu fahren, aber sie wusste, dass mit Tierfängern nicht zu spaßen war.
»Danke, liebste aller Töchter.« Imke wandte sich wieder Tilo zu. Sie war entschlossen, dieses Essen zu genießen, Katzen hin, Jette her.
Niemand da. Keiner, der ihr helfen konnte. Und alles so fremd. Das Haus, in dem er wohnte, hatte sie wie von selbst gefunden. Wie von Zauberhand gelenkt. Und jetzt war er nicht da. Der Einzige, mit dem sie hätte sprechen können. Der Einzige, der ihr zuhörte. Nicht da.
Aber würde er sie auch verstehen? Oder würde er die Polizei rufen? Sie hatte etwas Schlimmes getan. Sie war schlecht. Schlecht und verdorben.
Und wenn er ihr doch nicht zuhörte, sich sogar von ihr abwandte? Vielleicht hatte er allmählich begriffen, dass sie es nicht wert war, sich überhaupt mit ihr abzugeben. Vielleicht hatte sie nun auch ihn enttäuscht.
Du bist Abschaum. Ein Fehler der Natur. Du verdienst nichts als Verachtung.
Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis auch er sie so sehen würde. Wie hatte sie sich einreden können, bei ihm wäre es anders? Wie hatte sie ihm vertrauen können?
»Weil er an mich glaubt«, flüsterte sie. »Weil er es gesagt hat. Und weil er nicht lügt. Er hat mich noch nie angelogen.«
Schlampe!, schimpfte jemand in ihrem Kopf. Miststück! Wer sollte schon an dich glauben?
Sie hielt sich die Ohren zu. Obwohl das nichts half, denn gegen die Stimmen in ihrem Kopf war sie machtlos. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Ihre Augen brannten. Und plötzlich war das Haus ein düsterer Scherenschnitt gegen den rötlichen Himmel. Die Dämmerung streckte ihre langen Finger aus. Weit und breit nichts als dunkelnde Wiesen und Weiden und krumme Zäune.
Rasch schlüpfte sie hinter einen Strauch und kauerte sich ins Gras. Von Weitem hörte sie das Blöken von Schafen. Es beruhigte sie ein wenig. Aber der Aufruhr in ihrem Innern ebbte nur ganz allmählich ab. Was blieb, war die Angst. Eine schreckliche, lähmende Angst.
Mein knurrender Magen würde sich gedulden müssen, ebenso wie Merle. Ich hatte ihr eine SMS geschickt und dann den Umweg zur Mühle eingeschlagen. Wenn es um ihre Katzen ging, stellte meine Mutter sich an wie die Urmutter persönlich. Manchmal hatte ich den Eindruck, sie überschüttete Edgar und Molly mit all der Liebe, die sich in ihr staute, seit ich mein eigenes Leben lebte.
Postwendend war eine SMS von Merle zurückgekommen. Sie wusste nur zu gut, was mit den Katzen passierte, die von Tierfängern aufgegriffen wurden. Sie wusste auch, dass diese Kriminellen hauptsächlich in der Dämmerung und bei Nacht aktiv waren. Es störte sie nicht, dass ich mich ein bisschen verspäten würde.
Ich machte das Radio an und merkte, wie die Musik meinen Ärger über die ständigen Extrawünsche meiner Mutter Stück für Stück dahinschmelzen ließ.
Molly saß wartend vor der Terrassentür. Sie begrüßte mich, indem sie sich gegen mein Bein drückte und zärtlich gurrte. Ich sah mich nach Edgar um und wollte gerade nach ihm rufen, als er unter einer Gruppe von Sträuchern hervorkam. Steifbeinig, den Schwanz steil aufgerichtet, stakste er auf mich zu. So bewegte er sich immer dann, wenn er nervös war.
Die Tierfänger? Ich spähte aufmerksam in alle Richtungen, ohne etwas zu entdecken. Inzwischen waren die Katzen ins Haus gelaufen. Wahrscheinlich hatte etwas ganz anderes den Kater aufgeregt, eine Maus oder ein Marder oder was sonst auf dem Land so kreuchte und fleuchte. Ich folgte den Katzen in die Küche und versorgte sie mit Futter und frischem Wasser.
Sie fraßen ein paar Happen und sausten wieder zur Terrassentür. Irgendetwas stimmte nicht. Kaninchen in Gelee verschmähten sie nicht ohne Grund. Ich ging durch alle Räume, guckte durch sämtliche Fenster. Die Katzen vergaßen mich völlig, starrten nur hinaus in den Garten und schlugen erregt mit dem Schwanz.
»Also gut.« Seufzend griff ich nach dem Türhebel. »Dann seh ich mich draußen noch mal um. Aber ohne euch.«
Ich hatte noch nicht mal einen Fuß nach draußen gesetzt, als Edgar schon an mir vorbeizischte und wieder unter den Büschen verschwand, aus denen er kurz vorher aufgetaucht war. Ärgerlich lehnte ich die Tür hinter mir an und ging ihm nach. Ich hörte, wie Molly im Haus lautstark protestierte.
»Schluss jetzt, Eddie! Komm da raus! Ich muss los.«
Ich schob ein paar Zweige zur Seite und fuhr erschrocken zurück.
Da saß ein Mädchen mit angezogenen Beinen, das Gesicht halb hinter den Knien verborgen. Sie starrte mich aus aufgerissenen Augen an. Edgar hockte zu ihren Füßen und rieb vertrauensvoll den Kopf an ihrer Wade.
»Hi«, sagte ich, nachdem ich wieder in der Lage war zu sprechen.
Sie antwortete nicht, wich unmerklich zurück. Ihr Alter konnte ich schlecht schätzen, dazu war ihr Gesicht zu schmutzig. Aber sie war höchstens ein, zwei Jahre älter als ich. Wenn überhaupt. Was hatte sie im Garten meiner Mutter verloren?
»Ich bin Jette. Die Tochter von Imke Thalheim. Und wer bist du?«
Sie fing an zu zittern. Mir fiel auf, dass sie die Ärmel ihres T-Shirts über die Hände gezogen hatte. Als wäre ihr kalt. Edgar rollte sich auf ihren Füßen zusammen und blinzelte mich schmaläugig an. Vorsichtig ging ich in die Hocke.
»Das ist Edgar«, sagte ich leise.
Ich hatte keine Ahnung, ob sie meine Worte verstand. Sie hörte nicht auf zu zittern.
»Und dann gibt es noch Molly. Sie ist im Haus.«
Ich musste das Zauberwort finden. Aber wie?
»Edgar mag dich«, tastete ich mich weiter vor. »Das ist ungewöhnlich. Er schließt nicht schnell Freundschaft mit Fremden.«
Eine kleine, kindliche Hand stahl sich aus dem Ärmel des T-Shirts und legte sich sanft auf Edgars Nacken. Edgar fing an zu schnurren.
»Meine Mutter hat mich gebeten, die Katzen ins Haus zu holen. Es sind zurzeit wieder Tierfänger unterwegs. Sie fangen die Katzen ein und verkaufen sie an Labore.«
Himmel. Was plapperte ich da?
»Sie arbeiten mit den miesesten Tricks. Die Katzen haben keine Chance. Ich weiß das von meiner Freundin Merle. Die ist nämlich Tierschützerin und kennt die ganzen üblen Machenschaften dieser Typen.«
Ihre Hand war rot. Als hätte sie sie lange unter kaltem Wasser geputzt. Oder als hätte sie mit roter Kreide gearbeitet. Ihr Handgelenk war dünn wie das eines Kindes. Und ihre Ärmel …
Meine Augen hatten sich allmählich an das Dämmerlicht zwischen den Sträuchern gewöhnt. Zuerst erkannte ich Flecken auf der Kleidung des Mädchens. Als Nächstes sah ich, dass sie nicht von Kaffee oder Kakao herrühren konnten. Ich weigerte mich hartnäckig, zu begreifen, was meine Augen mir längst verraten hatten - dass dieses Mädchen über und über beschmiert war. Mit Blut.
Mein Herzschlag setzte aus. Ich bekam keine Luft.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich wieder gefangen hatte. Und wahrnahm, dass ihr Zittern unmerklich nachließ. Ein gutes Zeichen. War ich auf dem richtigen Weg? Mochte sie Katzen? Sollte ich da weitermachen? Ich beschloss, so zu tun, als hätte ich nichts bemerkt.
»Merle und ich wohnen zusammen in einer WG. Wir haben auch zwei Katzen. Donna und Julchen. Sie wurden aus einem Labor befreit. Du hättest sie sehen sollen damals. So furchtbar dünn und ängstlich. Inzwischen sind sie wie umgewandelt. Fremden gegenüber sind sie allerdings immer noch sehr scheu. Solche grauenvollen Erfahrungen vergisst man wahrscheinlich nie.«
Hatte sie gestöhnt? Oder war das Edgar gewesen? Er gab manchmal die sonderbarsten Laute von sich.
»Schlimm …«
Der Hauch eines Flüsterns. Aber ich hatte es gehört.
»Ja.« Ich versuchte, meine Erregung zu unterdrücken. »Schlimm.«
Ihr Kinn kam hinter den Knien hervor. Endlich sah ich ihr vollständiges Gesicht. Sogar unter all dem Schmutz war es ziemlich hübsch. Was mir vor allem auffiel, war ihr Mund. Sie hatte volle, herzförmige Lippen, die so gar nicht zu dem schmalen Gesicht passen wollten.
Sie kraulte Edgar hinter den Ohren. An der Sicherheit ihrer Bewegungen erkannte ich, dass sie an den Umgang mit Katzen gewöhnt war. Edgar zerfloss vor Wollust.
Wir konnten nicht ewig hier bleiben. Es rumorte in meinem Magen. Merle wartete. Aber ich durfte dieses Mädchen nicht allein lassen. Sie hatte Angst. Und sie war verwirrt. Ich las es in ihren Augen.
»Verrätst du mir deinen Namen?«, fragte ich.
Sie sah mich an und gleichzeitig durch mich hindurch.
»Mina«, sagte sie so leise, dass ich es beinahe nicht verstanden hätte.
Jetzt musste ich ganz vorsichtig sein. Nichts äußern, was sie wieder verstummen ließe.
»Mina, wolltest du zu meiner Mutter?«
Wieder verging eine ganze Weile, bis sie kaum merklich den Kopf schüttelte. Nicht? Aber was tat sie dann im Garten meiner Mutter?
»Ich … hab … Angst.«
Der erste vollständige Satz. Und plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte. Langsam und vorsichtig erhob ich mich. Ich hatte so schief und verkrampft da gehockt, dass es in meinen Kniegelenken gefährlich knackte. Edgar rappelte sich ebenfalls auf, lief ein paar Schritte auf das Haus zu und schaute sich abwartend nach uns um.
»Ich bringe ihn nur schnell ins Haus«, sagte ich. »Wartest du auf mich?«
Keine Reaktion. Sie hatte die Arme vor der Brust gekreuzt und wiegte sich vor und zurück.
Ich beschloss, das Risiko einzugehen und sie für einen Moment allein zu lassen. Nachdem ich die Haustür abgeschlossen hatte, ging ich wieder in den Garten. Sie saß noch an derselben Stelle.
»Willst du mit mir kommen?«, fragte ich sie.
Ich beugte mich zu ihr hinunter und berührte leicht ihre Schulter.
»Mina?«
Sie hob den Kopf. Ungläubiges Erstaunen spiegelte sich auf ihrem Gesicht. Ich hielt ihr die Hand hin. Sie ergriff sie nicht, stand aber langsam auf.
»Komm«, sagte ich und wahrte vorsichtig Abstand. »Mein Wagen steht vorm Haus.«
Merle nutzte die Wartezeit, indem sie die Anrufe erledigte, die auf ihrer Liste standen. Sie hatte es übernommen, das nächste Treffen der Tierschützer zu organisieren. Diese Treffen fanden an immer wechselnden Orten statt, um es der Polizei nicht zu leicht zu machen, ihnen auf die Schliche zu kommen.
Doch dann war auch das letzte Telefongespräch geführt und allmählich gab es nichts mehr zu tun. Brauchte Jette wirklich so lange, um die Katzen ins Haus zu locken, oder war ihr etwas passiert?
»Blödsinn«, sagte Merle laut zu sich selbst. »Was soll ihr denn passiert sein?« Aber sie wusste, dass sie sich nur zu beschwichtigen versuchte. Man war nicht sicher. Nie. Nirgends. Das hatten sie oft genug erfahren müssen.
Der Tisch war gedeckt. Ein Viertel der Trauben verspeist. Auch vom Baguette fehlten schon ein paar Scheiben. Merle hatte gerade beschlossen, eine SMS abzuschicken, da hörte sie Jettes Schlüssel im Schloss.
»Jette! Endlich! Musstest du einen Suchtrupp aufstellen, um die Katzen …«
Weiter kam sie nicht. Jette stand auf der Türschwelle, eine Hand erhoben, um Merle zum Schweigen zu bringen. Sie sprach leise auf ein Mädchen ein, das noch halb im Dämmerlicht des Treppenhauses verborgen war und den Anschein erweckte, als würde es beim geringsten Anlass die Flucht ergreifen.
»Das ist Merle. Du kannst ihr vertrauen.« Jette betrat den Flur und stellte ihre Tasche ab, ohne das Mädchen aus den Augen zu lassen. »Merle«, sagte sie, »das ist Mina.«
»Hallo, Mina.« Merle bewegte sich nicht. Sie hatte schon viele Tiere gesehen, die sich wie dieses Mädchen verhalten hatten. Zu Tode geängstigte Wesen mit allen Anzeichen eines heftigen Schocks.
»Komm rein«, sagte Jette, »dann stell ich dir Donna und Julchen vor. Ich hab dir doch von ihnen erzählt. Es gibt auch was zu essen. Hast du Hunger?«
Merle ging auf Zehenspitzen in die Küche. Sie hob das schlaftrunkene Julchen vom Sofa auf und trug es in den Flur. Julchen erblickte das fremde Mädchen und fing an zu zappeln.
»Nicht!« Das Mädchen hob die Hände. »Nicht festhalten!«
Merle setzte Julchen ab und die Katze verschwand mit einem Satz hinter dem Garderobenständer.
Mina wagte sich zögernd herein. Ihr Gesicht war schmutzig, die Wimperntusche auf ihren Wangen verlaufen. Ihre Hände waren rot verschmiert. Die Flecken auf Hose und T-Shirt bestanden eindeutig aus getrocknetem Blut.
Merle bemühte sich, nicht auf die Flecken zu starren. Auch nicht auf das schmutzige Gesicht und erst recht nicht auf die roten Hände. Wahrscheinlich war das ebenfalls Blut. Was war diesem Mädchen zugestoßen? Was hatte sie so in Panik versetzt?
»Ich hab einen Bärenhunger«, sagte Jette in Merles Gedanken hinein. »Du auch, Mina?«
Geschickt, dachte Merle. Sie äußert das ganz beiläufig. Die einzig richtige Art, das Mädchen anzusprechen.
Mina antwortete nicht. Sie sah sich in der Küche um, als müsse sie sich erst vergewissern, dass hier keine Gefahr lauerte.
Jette holte ein drittes Gedeck aus dem Schrank, Merle machte den Rotwein auf. Sie setzten sich an den Tisch und fingen an zu essen. Dabei unterhielten sie sich wie immer und taten so, als achteten sie nicht auf Mina, die wie eine fremde Katze durch den Raum strich.
Endlich setzte sie sich zu ihnen. Jette schenkte ihr Wein ein. Mina wollte nach dem Glas greifen und hielt mitten in der Bewegung inne. Sie starrte auf ihre Hände, ihr T-Shirt, die Hose, sprang auf und lief zur Tür.
»Mina!«, rief Jette. »Bleib hier!«
An der Wohnungstür holte sie das Mädchen ein. Sie redete ihr beruhigend zu, legte ihr den Arm um die Schultern und führte sie ins Badezimmer. Merle suchte in ihrem Schrank nach Klamotten, die Mina passen könnten, entschied sich für Jeans und ein T-Shirt und brachte die Sachen ins Bad.
Das Blut von Minas Händen färbte das Wasser rot. Es roch leicht metallisch, ein Geruch, der bei Merle Übelkeit verursachte, seit sie mit schwer misshandelten und verletzten Tieren zu tun hatte. Mina weinte und keuchte und schrubbte ihre Hände mit der Nagelbürste ab, dass es wehtat, ihr dabei zuzusehen.
Jette stand hilflos neben ihr. Sie hielt ein Handtuch bereit, aber Mina konnte nicht aufhören, ihre Hände zu malträtieren. Schließlich drehte Merle den Wasserhahn zu. Erschöpft ließ Mina die Schultern sinken.
Merle gab ihr die frischen Sachen, half ihr beim Umziehen und stopfte die blutbefleckten Kleidungsstücke in die Waschmaschine. Jette säuberte Minas Gesicht behutsam mit einem feuchten Waschlappen. Mina ließ es geschehen. Vielleicht merkte sie es nicht einmal.
Dann kehrten sie in die Küche zurück. Mina starrte vor sich hin. Als hörte sie etwas, das nur für ihre Ohren bestimmt war. Ein Ausdruck von Erstaunen lag auf ihrem Gesicht.
Die Situation war gespenstisch. Da saßen sie mit einem fremden Mädchen am Tisch, das auf kaum etwas reagierte, nichts von sich preisgab und ganz offensichtlich an einem schweren Trauma litt. Dem etwas Unaussprechliches zugestoßen sein musste. Und sie hatten keine Ahnung, wie sie helfen konnten.
Schließlich füllte Merle eine Wärmflasche mit heißem Wasser und brachte Mina in Mikes Zimmer. Mina legte sich angezogen auf das Bett und rollte sich wie ein Fötus zusammen. Merle breitete eine Wolldecke über ihr aus und schob ihr die Wärmflasche darunter. Es gelang Mina gerade noch, die Wärmflasche an sich zu ziehen. Im nächsten Moment war sie eingeschlafen.
Mit angehaltenem Atem schlich Merle aus dem Zimmer. Die Tür ließ sie offen stehen. Sie ließ auch das Licht im Flur brennen. Das vertrieb nicht nur bei kleinen Kindern die bösen Geister.
»Da musst du mir aber einiges erklären«, sagte sie zu Jette, als sie wieder in die Küche kam.
Jette nickte und fing an zu erzählen.
Bevor sie einschlief, hörte sie die Stimmen in ihrem Kopf. Sie hatte sie schon so oft gehört. Es waren immer andere. Als führten irgendwelche Leute in ihrem Kopf Gespräche. Meistens hörte sie nur Schnipsel davon, sodass sie nicht sagen konnte, worum es ging, aber sie konnte die Stimmen voneinander unterscheiden.
Sie machten ihr Angst. Wie Parasiten waren sie und es gab keine Medizin dagegen. Man musste sie auf andere Art bekämpfen. Da konnte nur einer helfen, der das studiert hatte. Einer wie Tilo Baumgart. Sie hatte große Hoffnungen in ihn gesetzt. Aber allmählich war sie sich nicht mehr sicher, ob er ihr wirklich helfen konnte. Vielleicht war sie doch einfach nur verrückt.
Nein. Er würde dich nicht belügen. Er ist ein guter Psychologe und ein guter Mensch. Fast schon ein Freund. Es ist ja nicht so, als ob du unter tausend Freunden die freie Auswahl hättest. Also hör auf mit deinen Zweifeln und vertraue ihm.
Das hasste und fürchtete sie am meisten - wenn eine der Stimmen sie direkt ansprach. Manchmal besetzten sie regelrecht ihr Gehirn. Manchmal wusste sie nicht mehr, wer da eigentlich dachte, sie selbst oder ein anderer in ihr.
Verpiss dich, dachte sie. Lass mich in Ruhe.
Lasst sie schlafen. Sie hat genug durchgemacht. Morgen ist auch noch ein Tag.
Ja, dachte sie. Schlafen. Und nicht mehr aufwachen. Niemals mehr. Sie fühlte sich so kraftlos, so ausgelaugt, dass sie die Augen nicht länger offen halten konnte.
So ist’s gut, Kleines. Mach die Augen zu.
Von Weitem hörte sie, wie jemand ein Schlaflied sang. Es kreiselte sacht in ihrem Kopf und sank dann in ihr nieder wie in eine tiefe, dunkle Höhle.
3
Das Klingeln des Telefons riss ihn aus einem Albtraum. Die Verfolger waren immer näher gekommen. Durch ein kleines Loch in der Wand hatte Bert ihre Gesichter gesehen. Eines hatte er erkannt. Es war Margots Gesicht gewesen.
In sein Entsetzen hinein klingelte das Telefon.
»Melzig.«
Seine Stimme war vom Schlaf belegt. Sie klang unwirsch, das hörte er selbst. Es fiel ihm nicht leicht, den Traum abzuschütteln. Und zuzuhören. Sie waren an diesem Abend schon gegen neun ins Bett gegangen, um endlich einmal genug Schlaf zu bekommen. Blinzelnd schaute er auf den Wecker. Viertel nach zehn. Mehr als diese eine Stunde Schlaf würde ihm heute Nacht wohl nicht vergönnt sein.
»Ich bin in zwanzig Minuten da.«
Er drückte das Gespräch weg und setzte sich auf. Mondlicht floss ins Zimmer. Bettzeug raschelte. Margot wurde jedes Mal wach, obwohl er sich bemühte, leise zu sein.
»Musst du weg?«
»Schlaf weiter.«
Seine Antwort war beleidigend brüsk. Aber wie konnte er liebevoll mit einer Frau umgehen, die ihn gerade verraten hatte? Er glaubte an die Symbolkraft von Träumen. Er glaubte an sein Unterbewusstsein. Und er hatte schon lange das Gefühl, dass seine Ehe nicht mehr zu retten war.
»Willst du einen Kaffee?«
Seine Bedürfnisse waren ihr seit Jahren so gleichgültig, dass er ihre Frage geradezu absurd fand. Seit wann kümmerte es sie, ob er vor einem Nachteinsatz einen Kaffee brauchte oder nicht?
»Nee. Lass mal.«
Sie schlief augenblicklich wieder ein. Ihre regelmäßigen Atemzüge waren das einzige Geräusch im Zimmer.
Bert liebte die Dunkelheit. Im Dunkeln war alles klar und deutlich. Da belog man sich nicht. Da sah man seinen Fehlern ins Gesicht.
Und seinen Gespenstern. Es wurden mehr von Jahr zu Jahr.
Er schlüpfte in Hemd und Hose und schlich zur Tür. Erst im Bad zog er sich fertig an. Er trank ein Glas Wasser in der Küche, horchte auf die Stille und sammelte sich. Dann griff er nach seiner Jacke und verließ geräuschlos das Haus.
Eine Leiche in der Einliegerwohnung der alten Kleiderfabrik, hatten sie gesagt. Männlich. Anscheinend erschlagen. Und erstochen.
Erschlagen und erstochen? Zwei Arten von Verletzungen. Bert spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. Wann würde er sich endlich daran gewöhnen? Würde es ihm jemals gelingen, sich gegen den Schock abzuschotten, der ihn beim Anblick eines ermordeten Menschen überfiel?
Manchmal kam ihm sein Leben ganz und gar unwirklich vor. Es wechselte zwischen Tag und Nacht, Aufregung und Routine, Hoffen und Wissen. Schwankte von einem Extrem zum andern. Es fand in einem Rhythmus statt, den andere vorgaben. Menschen, die eine Grenze überschritten hatten. Straftäter. Das deutsche Strafrecht, dachte Bert oft, hatte ein so distanziertes Vokabular, dass einem bei manchen Wörtern kalt wurde.
Um einen Mörder zu fassen, musste Bert die Gedanken eines Mörders nachvollziehen können. Um einem Psychopathen auf die Spur zu kommen, musste er sich der bizarren Logik eines Psychopathen nähern. Dass ihm das häufig mühelos gelang, bereitete ihm Sorgen.
»Weil du im Grunde selber einer bist«, hatte Margot ihm einmal vorgeworfen. Mit einem Lächeln auf den Lippen zwar, aber der Hieb hatte ihn getroffen. Vielleicht hatte Margot ja recht. Vielleicht war er zu kompliziert für ein Familienleben. Vielleicht war er fürs Alleinsein geschaffen und für die Einsamkeit.
Noch nie war er als Erster zu einem Tatort gekommen. Immer erwarteten ihn bereits die Kollegen von der Schutzpolizei. Die Scheinwerfer ihrer Wagen zerschnitten auch diesmal das Dunkel. Ihre Bewegungen und ihre Stimmen störten den späten Abend. Auch die Kollegen von der Spurensicherung waren bereits da. Und alle entwickelten eine rege Geschäftigkeit.
Sämtliche Fenster der Fabrik waren hell erleuchtet. Bert fühlte eine Gänsehaut auf den Armen. Hinter diesen Mauern erwartete ihn der Mord, der in den kommenden Tagen, Wochen, vielleicht sogar Monaten seinen Alltag beherrschen würde. Alles, was mit Berts Leben zu tun hatte, veränderte sich mit dem Auffinden eines ermordeten Menschen. Am meisten er selbst. Er atmete noch einmal tief ein und betrat das Haus.
Die Leiche lag auf der Schwelle zwischen Wohnzimmer und Flur. Grotesk verdreht. Wie eine übergroße Puppe, vom Kind eines Riesen achtlos beiseitegeworfen. Der Kopf wies eine schwere Verletzung auf. Der Blutverlust war so stark gewesen, dass sich eine breite Lache auf dem Boden gebildet hatte.
Bert trat näher heran. Der Tote trug eine schwarze Hose und ein Hemd, das einmal weiß gewesen war. Jetzt war es blutgetränkt. Und in Fetzen geschnitten. Bert beugte sich vor. Er gab es rasch auf, die Einstiche zählen zu wollen. Der Oberkörper des Mannes war übersät damit.
»Vierundzwanzig«, hörte er Doktor Haubrich hinter sich sagen. »Mit enormer Kraft zugefügt.« Die Stimme des Arztes klang beiläufig. Als gäbe es eigentlich Wichtigeres zu tun.
Bert richtete sich auf und drehte sich um. Der Arzt hatte seine Tasche schon wieder gepackt. Er war einer von der schnellen Truppe. Fuhr an einem Tatort vor, tat seine Arbeit und verschwand. Kein Wort, keine Geste zu viel. Aber Bert warf ihm die Nüchternheit nicht vor. Sie tat ihm sogar gut.
»Etwa zwischen zwölf und sechzehn Uhr. Die Wunde am Kopf stammt von einem massiven, stumpfen Gegenstand. Wahrscheinlich der Kerzenleuchter, den Sie im Wohnzimmer finden werden. Das Messer, das vermutlich verwendet wurde, ist unter die Heizung geschleudert worden. Ein Küchenmesser, sehr scharf. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Noch Fragen?«
»Die Reihenfolge«, sagte Bert.
Der Arzt sah ihn mitleidig an. »Schlag auf den Kopf, um ihn außer Gefecht zu setzen, dann die Stiche. Was eigentlich logisch ist, nicht wahr? Sie haben es mit einem Täter zu tun, um den ich Sie nicht beneide. Dieser Mord zeugt von einer unheimlichen Wut.«
Bert nickte. Ihm war schlecht. Die Wut war überall spürbar. Sie schien im ganzen Haus zu vibrieren. Das Haus. Er würde sich jeden einzelnen Raum vornehmen müssen. An Schlaf war nicht mehr zu denken.
»Der Täter.« Bert tastete nach seinem Notizbuch. »Reden wir hier mit Sicherheit von einem Mann?«
»Oder von einer äußerst kräftigen Frau.«
»Im Sinne von umfangreich?«
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Originalausgabe Mai 2007 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2007 cbt/cbj Verlag, München
Umschlagfoto und -konzeption: init.büro für gestaltung, Bielefeld st · Herstellung: CZ
eISBN : 978-3-641-02324-9
www.cbj-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de