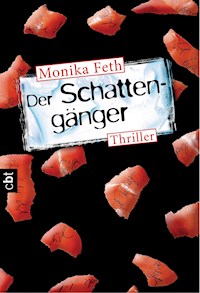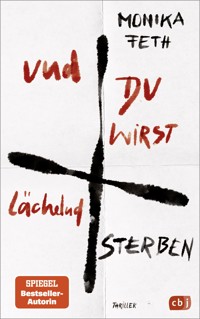8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Erdbeerpflücker-Reihe
- Sprache: Deutsch
Hochspannung für Thriller-Fans: Jettes zweiter Fall
An die Freundin ihres neuen Mitbewohners, Ilka, kommen Jette und Merle nicht wirklich heran. Dann verschwindet sie plötzlich spurlos. Die Polizei tappt im Dunkeln.
Jette beginnt auf eigene Faust zu ermitteln – und kommt bald einem dunklen Kapitel in Ilkas Vergangenheit auf der Spur …
Die fulminante Spiegel-Bestsellereihe von Monika Feth begeistert Millionen Leser:innen. Die Jette-Thriller sind nervenzermürbend, dramatisch und psychologisch brilliant erzählt. Atemberaubende Spannung der Extraklasse!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,4 (54 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DIE AUTORIN
Danksagung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Copyright
DIE AUTORIN
Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren. Nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium arbeitete sie zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einem kleinen Dorf in der Voreifel, wo sie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene schreibt. Ihre Bücher wurden vielfach ausgezeichnet.
Weitere lieferbare Titel von Monika Feth bei cbt: Der Erdbeerpflücker (30258) Fee. Schwestern bleiben wir immer (30010) Nele oder Das zweite Gesicht (30045)
Monika Feth im Urteil der Presse:
• Außergewöhnliche Charaktere und ein Spannungsbogen, der auch dann noch fesselt, als die Leser längst begriffen haben, wer der Mörder ist. Ein ungewöhnlich gelungener Kriminalroman mit drei jugendlichen Heldinnen im Mittelpunkt.
Süddeutsche Zeitung zu »Der Erdbeerpflücker«
• »Der Erdbeerpflücker« ist ein Thriller mit langsam ansteigender Spannungskurve, die es dann jäh in die Höhe treibt. Keine billigen Effekte, einfach gut geschrieben und zum sofortigen Verschlingen geeignet.
Saarbrücker Zeitung zu »Der Erdbeerpflücker«
Ich danke
... Inge Meyer-Dietrich für schottische Mücken, silberne Vögel und winterliche Raubzüge in der Schweiz, für 1738465 Gespräche am Telefon, vor allem aber dafür, dass sie immer da ist, und wenn noch so viele Kilometer zwischen uns liegen, ... Hannelore Dierks für intensive Recherchen in Dormagen und Langenfeld, Lavendelseife, chinesische Nudeln und dafür, dass sie vor Jahren den Entschluss gefasst hat, ein Fest zu besuchen, das sie eigentlich gar nicht besuchen wollte, ... Marliese Arold für den denkwürdigen Spaziergang in Ludwigshafen, wo wir auf einer Lesereise zuerst einander und dann dem weißen Pferd begegnet sind, …den Malern und Malerinnen, deren Bilder mein Leben begleiten, für die Stunden in ihren Ateliers, …meinem Vater für lange Gespräche über die Kunst und das Leben, ... meiner Mutter für eine Kindheit voller Geschichten, ... meinem Mann und unserem Sohn für alles andere.
Monika Feth
1
Lautlos und ohne Licht glitt der graue Mercedes heran und blieb stehen. Es war kurz nach acht. Feiner Nebel zog seine Schleier um die Laternen. Die geparkten Wagen waren vereist. Reif lag auf den Dächern und auf den Ästen der Bäume, kaum zu erkennen, eher zu erahnen.
Die Fenster der Häuser sahen aus wie gelbe Augen. Der Blick dieser Augen war kühl und unbeteiligt.
Ein Hund bellte. Eine Radiostimme drang aus einem trotz der Kälte halb offen stehenden Garagentor. Eine Tür knallte zu. Entfernt war das Signal eines Notarztwagens, der Polizei oder der Feuerwehr zu hören. Der Rauch aus den Schornsteinen wurde zu Boden gedrückt. Es würde ein schwerer, verhangener Tag werden.
Der graue Mercedes wurde von niemandem bemerkt. Keinem fiel auf, dass ein Mann darin saß, der aufmerksam eines der Häuser beobachtete. Er saß da, dunkel und still hinter den getönten Scheiben, reglos, wie aus Stein. Und weil ihn niemand bemerkte, war es, als wäre er überhaupt nicht da.
Ilka fühlte sich frisch und ausgeruht. Die Zwillinge hatten trotz ihrer heftigen Erkältung durchgeschlafen und sie nicht, wie in den Nächten davor, abwechselnd durch Hustenattacken wach gehalten. Nach einem flüchtigen Blick aus dem Fenster hatte sie sich für den dicken Rollkragenpulli entschieden. Er war das letzte Geschenk ihrer Mutter, und sie genoss jeden einzelnen Tag, an dem sie ihn trug. Manchmal meinte sie, noch einen Hauch von dem Parfüm in ihm wahrzunehmen, das ihre Mutter immer benutzt hatte. Doch dann sagte sie sich, dass das unmöglich war. Vielleicht hatte Tante Marei ja Recht, wenn sie behauptete, sie habe eine blühende Phantasie.
Der Pullover war rostrot und passte wunderbar zu Ilkas dunkelroten Haaren. Herbstmädchen hatte die Mutter sie immer genannt. Ilka hatte das Wort schön gefunden. Und sich selbst. Wenigstens dann und wann. Inzwischen war alles anders geworden. Das Herbstmädchen war Erinnerung. Erinnerungen aber ließ Ilka längst nicht mehr zu.
Bevor sie das Licht ausmachte, sah sie sich prüfend um. Alles in Ordnung. Das Tagebuch war versteckt. Es lag nichts herum, was niemand finden durfte.
Ilka lief die Treppe hinunter. Tante Marei saß vor den Frühstücksresten und las Zeitung. Die Zwillinge waren in die Schule gegangen. Zwei Tage Schonzeit mussten bei einer Erkältung ausreichen, da war Tante Marei eisern. Solange man den Kopf nicht unterm Arm trug, hatte man seine Pflicht zu erfüllen. Basta.
»Ich bin dann weg.«
Ilka schlüpfte in die Lammfelljacke. Sie hatte sie in einem Secondhandladen günstig erstanden und liebte sie heiß und innig.
»Willst du denn nicht frühstücken?«
Manchmal hatte Tante Mareis Stimme diesen klagenden Unterton. Als wäre alles, was man tat oder nicht tat, gegen sie gerichtet. Dabei war sie eigentlich eine starke, zupackende Frau. Wehleidigkeit passte gar nicht zu ihr.
»Bin spät dran. Ich nehm mir was mit.«
Ilka inspizierte die Obstschale, entschied sich für zwei Bananen, verstaute sie in ihrem Rucksack und gab Tante Marei einen Kuss auf die Wange.
»Kind! Du bist so dünn geworden!«
Tante Marei hatte Ilka den Arm um die Hüften gelegt und sah besorgt zu ihr auf. In ihrem Blick steckten viele Fragen.
»Heute Abend hau ich rein«, sagte Ilka. »Ehrenwort.«
Tante Marei sah ihr mit einem kleinen Lächeln nach. Es gab Ilka einen Stich. Fast war es, als säße ihre Mutter da am Tisch.
Blühende Phantasie, dachte sie und wickelte sich den Schal um den Hals. Es stimmt schon. Ich sollte besser mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und nicht überall Gespenster sehen.
Sie ging durch den unaufgeräumten Flur und spürte wieder, wie sehr sie dieses Haus liebte. Es war weder besonders schön noch irgendwie außergewöhnlich, nicht modern und nicht so alt, dass es voller Geschichten gesteckt hätte - es war ein Haus wie viele in der Siedlung. Aber sie war darin willkommen. Das machte es zu etwas Einzigartigem. Es war ihr Zuhause, immer bereit, sie aufzunehmen und zu beschützen. War es nicht das, was ein Haus tun sollte? War es nicht das, wonach sie sich gesehnt hatte? Ruhe, Schutz und Geborgenheit. All das bekam sie durch das Haus. Hier fühlte sie sich in Sicherheit. Zum ersten Mal seit langem.
Ilka schloss die Haustür, spürte die Kälte auf dem Gesicht und sog tief die Luft ein. Das Bellen eines Hundes von irgendwoher klang wie ein Versprechen. Das Leben war schön. Fast war sie bereit, daran zu glauben.
Die Scheiben waren beschlagen. Das war gut so. Es hielt neugierige Blicke ab. Vorsichtig wischte Ruben mit den Fingern über die Windschutzscheibe. Und da sah er sie. Atemlos beugte er sich vor.
Sie war wunderschön. Selbst auf diese Entfernung konnte man das erkennen. Ihr Gesicht schimmerte hell im Licht der Laterne, das Haar hatte sie (achtlos, das wusste er) unter eine Wollmütze gestopft. Er mochte es lieber, wenn sie es auf die Schultern fallen ließ. Sie hatte prächtiges Haar, das es nicht vertrug, gebändigt zu werden.
Ruben verstand nicht, warum sie ein solches Leben gewählt hatte. Ein kleines, nichts sagendes Spießerhaus, umgeben von anderen Spießerhäusern. Wie wertlose Glasperlen an einer Schnur zogen sie sich an der Straße entlang, eingebettet in schmale Vorgärten, in denen zurechtgestutzte Sträucher vom kühlen Licht chromfarbener Solarlampen beleuchtet wurden. Was hatte sie verloren in einer Nachbarschaft mit gerafften Tüllgardinen vor den Fenstern? Mit pedantisch aufgereihten Mülltonnen, eine schwarz, eine gelb und eine blau? Wo nichts und niemand aus der Reihe tanzte, nicht mal die gefleckte Katze da, die vor einer der Türen höflich, aber vergeblich um Einlass bat, statt sich woanders ein verständnisvolleres Zuhause zu suchen?
Sein Handy klingelte. Er sah auf das Display. Die Architektin. Das hatte Zeit. Er wollte jetzt nicht gestört werden. Von niemandem. Er schaltete das Handy aus. Alles, jedes Geräusch war eine Störung, wenn er in dieser Stimmung war, an gestern dachte, an heute und an morgen.
Ilka holte ihr Rad aus der Garage. Klein und verloren sah sie aus im ersten grauen Licht, das über die Dächer kroch und sich in den kahlen Ästen der Bäume verfing. Als sie an ihm vorbeiradelte, wandte er den Kopf ab. Sein Herz klopfte zum Zerspringen.
Er schloss die Augen. Allmählich beruhigte er sich wieder. Er würde ihr nicht nachfahren. Das tat er nie. Er hatte es sich abgewöhnt, seinen Gefühlen nachzugeben. Kühl und beherrscht musste er bleiben, dann würde alles gut werden.
Eine Weile starrte er weiter das Haus an, in dem sie wohnte. Nummer siebzehn. Ilkas Lieblingszahl. Doch das war natürlich Zufall gewesen. Obwohl sie es vermutlich für eine Fügung des Schicksals gehalten hatte. Sie vertraute gern auf das Schicksal, die Sterne oder höhere Mächte.
Hinter dem Küchenfenster bewegte sich ein Schatten. Ruben presste die Zähne zusammen. Seine Hände verkrampften sich um das Lenkrad. Nein. Er durfte sich nicht gehen lassen. Es war wichtig, dass er einen klaren Kopf behielt. Seine Gefühle hatten ihm schon so oft einen Streich gespielt. Das durfte nicht noch einmal passieren.
Ilka. Er würde nur an sie denken. An nichts anderes.
Ein Lächeln huschte über sein hageres Gesicht. Er schob die Brille zurück, die er zum Autofahren brauchte. Ilka. Er liebte ihren Namen. Und er war froh, dass wenigstens er ihm geblieben war. Alles andere hatte sie ihm genommen, damals, als sie über Nacht verschwunden war und sich in diesem spießigen Albtraum verschanzt hatte.
Was für ein Leben führte sie hier? Falsch war es und verlogen. Ein Leben, das nicht zählte, weil es nicht ihr wirkliches Leben war. Sie konnte unmöglich glücklich sein. Das spielte sie den anderen doch nur vor.
Merkte jemand, dass sie eine Betrügerin war? Spürte man es, wenn man vor ihr stand und ihr in die Augen blickte? Oder glaubten ihr die Menschen, die sie kannten?
Alle hatten Ilka stets geglaubt. Immer. Auch er selbst. Nur zum Schluss, da waren die Zweifel übermächtig geworden. Aber er hatte zu spät reagiert und nichts mehr ändern können.
Er nahm den Schwamm aus dem Ablagefach in der Tür und wischte damit über die Windschutzscheibe. Dann startete er den Motor. Langsam fuhr er los. Bis zur nächsten Ecke ohne Licht. Er würde seinen Fehler korrigieren. Und darauf achten, keinen zweiten zu machen.
Ich stopfte die Bücher in den Rucksack und sah mich noch einmal in der Küche um. Alle Geräte ausgeschaltet, Fenster zu, warum also war ich nicht längst draußen?
Irgendwie war ich in diesem Winter wie gelähmt. Es kam mir vor, als wären all meine Bewegungen verlangsamt. Nicht eben wie in Zeitlupe, aber auch nicht weit davon entfernt. Alles strengte mich an. Ich musste aufpassen, dass ich beim Gehen die Füße hob und nicht schlurfte.
Ich hatte verschlafen. Nach dem Aufstehen war mir speiübel gewesen. Und schwindlig. Ich hatte mich beim Duschen an der Wand abgestützt, um nicht hinzufallen.
Wahrscheinlich hatte ich niedrigen Blutdruck. Vielleicht kamen meine Beschwerden aber auch nur daher, dass ich unglücklich war. Ich hatte eine Liebe gefunden und verloren und fühlte mich so abgrundtief allein wie niemals zuvor.
Nein. Nein! Ich wollte nicht daran denken. Ich durfte es auch nicht. Wochenlang war ich krank gewesen und hatte mich nur mühsam, Schritt für Schritt, wieder erholt. Ich durfte nicht zurückfallen, nicht wieder zu diesem willenlosen Etwas werden, das nur dank der maßlosen Geduld und Zuwendung von Familie und Freunden überlebt hatte.
Meine Mutter und Merle waren für mich da gewesen. Sie hatten mich abgeschirmt und beschützt. Auch meine Großmutter hatte mir sehr geholfen. Sie hatte mir Bücher und CDs mitgebracht, mir vorgelesen und mit mir zusammen Musik gehört. Und manchmal hatte sie einfach nur bei mir gesessen und mit mir geschwiegen.
Tilo, der Freund meiner Mutter, war mir vertrauter geworden in dieser Zeit.
»Weil du dich irgendwie verändert hast«, hatte ich zu ihm gesagt.
Er hatte den Kopf geschüttelt und mich angelächelt mit diesem ganz speziellen Tilo-Lächeln, die Augen ein bisschen zusammengekniffen, die Lippen beinah spöttisch verzogen. Das typische Psychologenlächeln, wie meine Mutter es nannte.
»Nein«, hatte er gesagt. »Du bist diejenige, die sich verändert hat.«
Wahrscheinlich waren wir alle anders geworden. Durch die schrecklichen Erfahrungen, die wir gemacht hatten, jeder für sich.
Meine Freundin Caro war ermordet worden und ich hatte mich in ihren Mörder verliebt. Merle mit ihrer Hartnäckigkeit hatte mir das Leben gerettet.
Es hatte in sämtlichen Zeitungen gestanden. Jeder hatte sich das Maul darüber zerrissen. Es war nicht mehr Caros, Merles und meine Geschichte gewesen. Plötzlich hatte sie jedem gehört. Sogar auf der Straße hatten die Leute darüber gesprochen. Sie taten es immer noch.
Aufhören! Nicht weiterdenken.
Manche Tage überlebte ich nur dadurch, dass ich jede Erinnerung an damals verdrängte. Dadurch, dass ich meinen Kopf leer machte und keinen Gedanken zuließ, der mich beunruhigen konnte.
Ich sollte nicht alles so schwer nehmen. Es gab einfach diese Tage, an denen alles schief ging, an denen schon der Morgen falsch begann. Das hier war so ein Tag.
Draußen schlug mir die Kälte ins Gesicht. Ich beschloss, den Wagen zu nehmen. Obwohl er aussah wie aus der Gefriertruhe gezogen. Das bedeutete mindestens fünf Minuten Kratzen und war nicht gerade dazu angetan, mein Wohlbefinden zu steigern.
Die Pulswärmer, die meine Großmutter mir zu Weihnachten geschenkt hatte, waren schon nass, und die Windschutzscheibe war immer noch zur Hälfte vereist. Ich merkte, dass ich kaum Kraft in den Fingern hatte, und wäre am liebsten umgekehrt.
Weichei, sagte die lästige, vorwurfsvolle Stimme in mir, die sich immer dann meldete, wenn mir nach Jammern zumute war. Hast du dich nicht lang genug im Bett verkrochen?
Wochenlang, ja. Ganz allmählich erst steckte ich die Nase wieder in die Luft.
Vielleicht war meine Schwäche aber auch gar kein Zeichen für einen Rückfall. Vielleicht brütete ich bloß eine Erkältung aus und war deshalb so wacklig auf den Beinen. Oder das Frühstück fehlte mir. Ich bin nicht der Typ, der auf nüchternen Magen eine Tasse Kaffee runterschüttet, aus dem Haus stürmt und fit ist für den Alltag mit seinen Tücken. Ich brauche mein finnisches Knäckebrot, meinen Käse und meinen Tee, um den Menschen und mir gewachsen zu sein. Vor allem mir.
Im Auto war es genauso kalt wie draußen, jedenfalls kam es mir so vor. Weiß strömte der Atem aus meinem Mund. Das Lenkrad fühlte sich an, als wäre es aus Eis.
»Bitte! Spring an!«, flehte ich und versuchte, den Motor zu starten. Beim fünften Mal gelang es mir. Ich schnallte mich an und fuhr los.
Ich machte das Radio an und drehte die Heizung auf die höchste Stufe. Meine Schultern waren so verkrampft, dass ich kaum schalten konnte. Ein stechender Schmerz kroch mir in den Nacken und von da aus in den Kopf.
Es dämmerte. Die kahlen Bäume standen schwarz vor dem unmerklich hell werdenden Himmel. Ihre Äste und Zweige waren wie Scherenschnitte, die man gegen das Licht hält. Schön. Wunderschön.
Wie schnell war man tot, wenn man mit hundert gegen einen Baum prallte? Spürte man noch Schmerzen oder war es sofort aus? Würde es auch für mich eine Lichtgestalt geben, die mich abholte?
Caro.
Ich durfte nicht so denken. Ich musste mich ablenken. Ich hatte schon viel zu viel Zeit mit dem Tod verbracht.
Caro. Wo war sie jetzt? Ging es ihr gut?
Beim Kreisel kehrte ich um. Meine Kraft reichte nicht aus für einen langen Vormittag in der Schule. Ich brauchte Ruhe. Und Schlaf. Damit ich aufhören konnte mit diesen Gedanken, die mich seit damals quälten.
Damals. Als alles aufgehört hatte.
Ruben hatte sich mit der Architektin verabredet und war auf dem Weg zu ihr. Sie traf keine wichtige Entscheidung, ohne sich vorher mit ihm zu beraten. Es war nicht leicht gewesen, sie zu erziehen. Anfangs hatte sie ganz die erfolgreiche Geschäftsfrau raushängen lassen, die ihre Schritte nicht zur Diskussion stellte. Aber er hatte ihr klar gemacht, dass er es war, der sie bezahlte. Irgendwann hatte sie es begriffen. Geld war letztlich immer ein unschlagbares Argument. Was würde er nur tun, wenn er keins hätte? Ihn fröstelte und er stellte die Heizung höher. Er besäße nicht diesen Wagen, nicht das Haus, in dem er lebte, er hätte das ganze Projekt nicht starten können. Manchmal war ihm danach, auf die Knie zu fallen und den Göttern zu danken. Für sein Talent. Und für das Glück, das ihm den Weg nach oben geebnet hatte.
Vor allem aber war er für die reichen Pinkel dankbar, die so auf seine Bilder abfuhren, dass sie die neuen schon kauften, bevor die alten richtig getrocknet waren. Ruben Helmbach war Kult. Und die gesamte Szene balgte sich dankbar um die Brocken, die er ihnen hinwarf.
Dass er sich selten zeigte, nahm man ihm nicht übel. Im Gegenteil. Es machte ihn erst recht interessant. Ein gewisses Maß an Menschenscheu war gut für die Legende, die sich um ihn zu ranken begann.
Sein Erfolg nahm groteske Formen an. Neulich hatte ihm die Frau eines Fabrikanten sogar Geld für seine farbverschmierte Palette geboten. Demnächst würden sie ihm noch die ausgedienten Pinsel aus der Hand reißen und sie als Skulpturen in ihre Wohnzimmer stellen.
Ruben dachte an die Kollegen, die fast alle einen festen Job hatten, der ihnen die Malerei finanzierte. Die sich Blasen liefen, um eine Galerie zu finden, die ihre Bilder ausstellte. Die jahrelang an Kunsthochschulen studiert hatten.
Anders als sie war Ruben Autodidakt. Zwar hatte er bei Emil Grossack gelernt und bei Elisabeth Schwanau, aber die hatten ihn privat unterrichtet. Ruben konnte keine Urkunde, kein Zeugnis, kein Examen vorweisen. Er hatte nur seine Begabung.
Darüber hatte er sich jedoch noch nie den Kopf zerbrochen. Es war einfach so gekommen. Er war schon ein gefragter Maler gewesen, bevor sich die Frage nach einem Studium überhaupt gestellt hatte.
Die Malerei war alles für ihn. Oder doch beinahe alles. Was ihm fehlte, um wirklich glücklich zu sein, war Ilka, das Mädchen, das er liebte. Sein Mädchen.
Mike sah, wie sie das Fahrrad abstellte, und sein Herzschlag spielte verrückt. Er war in Ilka verliebt, seit er ihr zum ersten Mal begegnet war. Damals war sie aus dem Zimmer der Schulleiterin gekommen und hatte sich bei ihm nach dem Weg in den Musiksaal erkundigt.
Ihre Stimme. Sie war wie ein Blitz in seinen Kopf gefahren und hatte sich dort eingenistet. Er war sie nicht mehr losgeworden. Er hatte es auch gar nicht gewollt.
Aber er liebte nicht nur ihre Stimme. Er liebte auch ihr Lächeln, das immer noch schüchtern war und so, dass er wer weiß was getan hätte, um es zu beschützen. Er liebte alles an ihr. Die Grübchen, die neben den Mundwinkeln sichtbar wurden, wenn sie lachte. Ihre Augen, die braun waren, mit bernsteinfarbenen Sprenkeln. Ihre schmalen Hände. Und natürlich ihr Haar. Noch nie hatte er so schönes Haar gesehen.
»Hi.« Ilka stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
Mike hätte sie zu gern an sich gezogen, ihr die Mütze abgestreift und das Gesicht in ihrem Haar vergraben. Es war so weich. Und es duftete so gut. Stattdessen stupste er mit dem Zeigefinger ihre Nase an. »Hi.«
»Wie ist es gelaufen?« Sie zog die Mütze ab und schüttelte ihr Haar aus.
»Ich hab heute Nachmittag einen Besichtigungstermin.«
»Prima!« Sie strahlte ihn an und drückte seinen Arm.
»Das heißt noch gar nichts.« Er baute nicht gern auf etwas so Wackliges wie Hoffnung. »Ich bin garantiert nicht der Einzige, den sie eingeladen haben. Und dann frag ich mich schon die ganze Zeit, warum zwei Mädchen einen Kerl in ihre Wohngemeinschaft aufnehmen wollen. Findest du das nicht seltsam?«
»Warum?« Ilka hatte sich bei ihm eingehakt. »Sie wollen ja keinen Orden gründen, sondern nur ein Zimmer vermieten.«
Mike fühlte sich von allen Seiten beobachtet. Er wusste, dass die Jungen ihn beneideten. Jeder von ihnen wäre gern an seiner Stelle gewesen. Er begriff ja selbst nicht, was Ilka an ihm fand. Er war in jeder Hinsicht Durchschnitt. Nie hätte er zu hoffen gewagt, dass dieses Mädchen auch nur einen zweiten Blick an ihn verschwenden würde.
»Nimmst du mich mit zur Besichtigung?«
Warum nicht? Ilka hatte eine unglaublich intensive Ausstrahlung. Vielleicht würde ein bisschen davon auf ihn abfärben.
»Ich mische mich auch nicht ins Gespräch ein.«
Mike lachte und drückte sie an sich. »Klar kannst du mitkommen. Und misch dich ruhig ein. Vielleicht bringst du mir Glück. Vielleicht geben sie das Zimmer lieber einem Typen mit Freundin.«
»Vielleicht aber auch nicht.«
»Das riskiere ich.«
Sie waren am Klassenraum angekommen. Zweite Stunde. Mathe. Ilka hängte ihre Lebhaftigkeit mit Jacke und Mütze draußen am Kleiderhaken ab. Ein Ausdruck tiefer Konzentration legte sich auf ihr Gesicht. Sie nahm die Schule sehr ernst. Mike spürte, dass es einen Grund dafür geben musste, aber er hatte keine Ahnung, welchen.
Er wusste überhaupt sehr wenig von Ilka. Vor drei Jahren erst war sie in diese Schule gekommen. Wie aus dem Nichts. Ihre Eltern hatten einen Verkehrsunfall gehabt. Seitdem lebte Ilka bei ihrer Tante. Und das war schon fast alles, was er über sie erfahren hatte.
Sie sprach nicht über ihre Vergangenheit. Nur selten konnte Mike ihr eine Bemerkung entlocken. Es war, als gäbe es da einen Vorhang, den Ilka jedes Mal herunterließ, wenn er einen Schritt in die verbotene Richtung machte.
Mike packte nervös sein Mathebuch aus. Er fieberte der Besichtigung am Nachmittag entgegen. Gleichzeitig hatte er Angst davor. Wohngemeinschaften von Schülern waren in Bröhl nicht gerade dicht gesät. Hoffentlich gefiel ihm die Wohnung. Hoffentlich kam er mit den Mädchen zurecht. Und hoffentlich hatten sie kein Problem mit ihm.
Die Anzeige hatte distanziert geklungen. Nichts sagend eigentlich. Mitbewohner für unsere WG gesucht. Mehr nicht. Am Telefon hatte er sich mit einer Merle unterhalten. Sie war nicht sehr gesprächig gewesen. Er hatte lediglich erfahren, dass die Wohngemeinschaft zurzeit aus zwei Mädchen bestand, beide Schülerinnen am Erich-Kästner-Gymnasium, und dass sie definitiv einen männlichen Mitbewohner wollten.
Das hatte ihn irritiert. Andererseits konnte er sich Skepsis nicht leisten. Er hatte schon so lange nach einem bezahlbaren Zimmer gesucht, dass er diese Chance nicht verschenken durfte. Sie würden ihm den Grund schon verraten.
Er beugte sich zu Ilka hinüber, um die Uhrzeit mit ihr auszumachen. Doch dann bemerkte er, dass sie vor sich hinstarrte. Mit diesem Blick, den er so fürchtete. In solchen Momenten war sie unerreichbar. Auch für ihn.
Behutsam berührte er ihren Arm. Es war, als würde sie wach. Als kämen ihre Gedanken von weither zurück. Sie sah ihn an, schien sich langsam an ihn zu erinnern. Lächelte.
Mike bemühte sich, ebenfalls zu lächeln. In Wirklichkeit war ihm zum Heulen zumute. Er wollte nicht eifersüchtig sein. Wollte sich nicht den Kopf zerbrechen über ihre Gedanken. Aber das, was in ihm wühlte und grub, war dumpfe, hässliche Eifersucht, und er konnte nichts dagegen tun.
2
Imke Thalheim faltete einen Pulli zusammen und legte ihn in den Koffer. Sie hasste Packen. Sie hasste Abschiednehmen. Sie hasste es wegzufahren. Vor allem hasste sie es, woanders zu sein als zu Hause. Diesmal fiel es ihr besonders schwer. Jette war noch nicht so weit. Sie würde allein nicht zurechtkommen.
»Unsinn«, hatte Tilo gesagt, als sie mit ihm darüber gesprochen hatte. »Du solltest mehr Vertrauen zu deiner Tochter haben. Sie ist ein starkes Mädchen. Das hat sie dir und der ganzen Welt bewiesen.«
»Sie wäre beinahe ermordet worden, Tilo!«
Er hatte sie an den Schultern gefasst und sie eindringlich angesehen. »Es sind so viele Menschen da, die auf sie aufpassen. Niemand wird ihr etwas tun.«
»Es ist die erste Lesereise seit... seit...« Sie hatte Tilo die Arme um den Hals geschlungen.
»Ich weiß. Und ich verspreche dir, mich um Jette zu kümmern. Du kannst beruhigt fahren. Es wird nichts passieren, hörst du? Absolut nichts.«
Er hatte ihr den Rücken gestreichelt, und sie hatte gewusst, dass sie auch seinetwegen nicht wegfahren wollte. Auf einer Lesereise war sie der einsamste Mensch weit und breit.
Sie zählte die Slips ab, die Strümpfe, nahm ein paar Wollschals aus dem Schrank. Es war sehr kalt geworden. Sie würde hauptsächlich warme Sachen einpacken.
Edgar und Molly hatten sich verkrochen. Sie verbanden Kofferpacken mit Autofahren und Autofahren mit Tierarzt oder anderen Orten, die sie nicht mochten. Dabei hatte Imke sie schon lange nicht mehr in einer Katzenpension untergebracht. Genau genommen seit dem Tag, an dem sich herausgestellt hatte, dass Frau Bergerhausen nicht nur eine begnadete Putzhilfe, sondern auch eine leidenschaftliche Tierfreundin war.
Imke war mehr als dankbar dafür, dass eine glückliche Fügung ihr vor ein paar Jahren diese Frau über den Weg geschickt hatte. Die alte Mühle, umgebaut zu einem kleinen Paradies, lag zu einsam, um für längere Zeit unbewohnt zu bleiben. Wenn Imke unterwegs war, kam Frau Bergerhausen zweimal täglich ins Haus, ließ die Rollläden rauf und runter, fütterte die Katzen und gab den Pflanzen Wasser. Sie sortierte die Post und nahm auch das eine oder andere Telefongespräch an. Frau Bergerhausen war das, was Imkes Mutter eine Perle nannte.
Auch Jette und Tilo, die beide einen Schlüssel für die Mühle besaßen, hatten versprochen, hin und wieder vorbeizuschauen. Es gab wirklich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Höchstens um den neuen Roman, mit dem Imke vor ein paar Tagen begonnen hatte und den sie nur ungern unterbrach. Warum also fühlte sie dieses starke, quälende Unbehagen?
Sie hatte längst akzeptiert, dass sie die Signale ihres Körpers nicht unbeachtet lassen durfte. Seit vielen Jahren lebte sie mit den Stimmen, die sie vor Katastrophen warnten. Es waren natürlich keine richtigen Stimmen, auch keine Stimmen, die sie in ihrem Kopf hörte. Es waren Zeichen wie Angstgefühle, Kopfschmerzen, eine dumpfe Unruhe. Oft konnte sie die Zeichen nicht deuten und erkannte sie erst im Nachhinein. Aber wenn es um Jette ging, irrte sie sich selten.
Ihr Kind war unglücklich. Zogen unglückliche Menschen das Unheil nicht magisch an? Wie konnte sie Jette in ihrer schlechten seelischen Verfassung nur allein lassen?
Sie faltete eine Jeans zusammen, unterbrach dann das Packen und griff nach dem Telefon. Insgeheim betete sie, dass sich niemand melden würde. Dann wäre alles in Ordnung. Um diese Zeit sollten die Mädchen nämlich in der Schule sein. Sie steckten mitten in den Vorbereitungen fürs Abitur.
»Jette Weingärtner.«
Imke hatte ihre Bücher von Anfang an unter ihrem Mädchennamen veröffentlicht, den sie nach der Scheidung von ihrem Mann auch offiziell wieder angenommen hatte. Dass Jette weiterhin den Namen ihres Vaters trug, störte sie nicht. Nur manchmal empfand sie eine gewisse Fremdheit, wenn sie ihn hörte.
»Du bist zu Hause?«
Das hatte sie eigentlich nicht sagen wollen. Es klang wie ein Vorwurf.
»Mir war nicht gut.«
Jette war nicht der Typ, der schnell jammert. Sie hielt eine ganze Menge aus. Wenn sie nicht in die Schule ging, dann hatte sie dafür ihre Gründe.
»Und jetzt? Geht es dir wieder besser?«
»Ich hab mich in meinem Bett zusammengerollt und ein bisschen geschlafen.«
»Das tut mir Leid. Ich wollte dich nicht wecken.«
»Hast du nicht. Ich bin gerade wach geworden. Außerdem will ich ja auch nicht den ganzen Tag im Bett verbringen.« Sie machte eine kurze Pause. »Warum rufst du an? Wolltest du nicht heute losfahren?«
»Eigentlich schon, aber ich überlege, ob ich nicht lieber zu Hause bleiben soll. Für alle Fälle.«
»Mit anderen Worten - meinetwegen?«
»Jette, du bist noch nicht stabil genug. Du brauchst...«
»Mama! Hör auf, mich in Watte zu packen!«
»Aber Kind! Ich pack dich doch nicht in...«
»Ich komme klar, Mama. Ich hab nur manchmal zwischendurch einen kleinen Absturz. Nicht der Rede wert. Ich möchte nicht, dass du ständig Rücksicht auf mich nimmst.«
»Rücksicht? Ich nehme keine...«
»Doch, Mama! Und ich finde das auch ganz lieb von dir. Aber du hast getan, was du konntest. Jetzt muss ich allein weitergehen.«
Weitergehen? Wohin? Imke schluckte.
»Hast du dir das gut überlegt, Jette?«
»Ich habe deine Handynummer, eine ellenlange Liste mit den Anschriften und Telefonnummern der Hotels und sämtlicher Veranstalter in zeitlicher Reihenfolge, was soll mir denn da passieren?«
»Und du rufst wirklich an, wenn du mich brauchst?«
»Jaaaaa, Mama. Versprochen. Hochheiliges Ehrenwort und dreimal draufgespuckt.«
Jettes Kinderschwur. Imke musste unwillkürlich lächeln.
»Gut. Dann packe ich jetzt weiter. Ich ruf dich von unterwegs noch mal an.«
»Tu das.« Jette seufzte erleichtert auf. »Ich wünsch dir eine schöne Reise.«
Nachdenklich legte Imke das Telefon aufs Bett. Sie nahm ein Jackett aus dem Schrank, trat damit ans Fenster und sah hinaus. Der Winter hatte das Land fest im Griff. Auf einem der Zaunpfosten hockte verfroren der Bussard. Er hatte sich irgendwann auf Imkes Grund und Boden niedergelassen und sie empfand seine Anwesenheit als tröstlich.
Er war ihr Wächter. Solange es ihn gab, würde ihr und denen, die sie liebte, nichts zustoßen. Sie würde weiter fest daran glauben.
Der Bussard drehte den Kopf in ihre Richtung. Als hätte er ihre Gedanken gehört.
»Pass auf meine Tochter auf«, bat sie ihn leise und wandte sich wieder ihrem Koffer zu.
An einem Rasthof hielt Ruben an. Er hatte noch nicht gefrühstückt und allmählich tat ihm vor Hunger der Magen weh. Es war kein besonders schöner Rasthof, aber welcher Rasthof war das schon? Alles auf modern gestylt, hohe, große Fenster, das immerhin, viel Holz und Glas, aber keinerlei Flair.
Die Küchengerüche hatten sich im Raum gesammelt, vermischten sich mit dem Zigarettenrauch, der grau über den Tischen lag, und nahmen Ruben für einen Moment den Atem. Er entschied sich für ein Käsebrötchen, ließ sich einen Kaffee einlaufen und ging mit dem Tablett zur Kasse. Die junge Frau, die dort saß, schäkerte mit einem Gast. Als sie lachte, bemerkte Ruben, dass ihr ein Schneidezahn fehlte. Trotzdem fand er sie hübsch, vor allem ihr Lachen.
Er suchte sich einen Tisch am Fenster, fing an zu essen. Das Brötchen war erstaunlich frisch. Es krachte beim Hineinbeißen und die Krümel spritzten in alle Richtungen. Ruben nahm den ersten Schluck Kaffee und spürte, dass er auf eine geradezu blödsinnige Weise glücklich war. Er hätte die ganze Welt umarmen mögen, angefangen bei der immer noch schäkernden Kassiererin bis hin zu den Businesstypen am Nebentisch, die aussahen wie geklont und deren Stimmen plötzlich etwas geradezu Unwiderstehliches hatten.
»Das machst du«, flüsterte er. Und lächelte.
Nach langer, mühsamer Suche war er fündig geworden. Mit fünf Maklern hatte er in Kontakt gestanden. Jeder hatte sich bei ihrem ersten Treffen das Foto angeschaut und dann den Kopf gehoben. »Wie ähnlich muss das gesuchte Objekt diesem hier denn sein?«
»So ähnlich wie möglich«, hatte Ruben geantwortet.
Sie hatten ihm wenig Hoffnung gemacht, dass ein solches Haus zu finden wäre. Einige hatten ihm geraten, es originalgetreu nachbauen zu lassen. Das sei einfacher und wahrscheinlich auch preiswerter.
Doch ein neu gebautes Haus hätte einen eklatanten Makel gehabt - es wäre ein neues Haus gewesen. Es musste aber ein altes Haus sein. Ein Haus, in dem Menschen gelebt hatten. Das Spuren davongetragen hatte, genau wie das Gesicht eines alten Menschen. Ruben wollte keine Kulisse. Er wollte etwas Echtes.
»Nein«, hatte er mit einem leisen Unterton von Verachtung gesagt. »Ich bin nicht der Typ fürs Häuslebauen.«
»Und warum erwerben Sie nicht einfach das Original?«, hatte einer der Makler gefragt und auf das Foto gezeigt.
»Es existiert nicht mehr.« Ruben hatte das ganz beiläufig geäußert. Er durfte nicht zu viel verraten. Jedes falsche Wort konnte eine Fährte legen, die später zu ihm führen würde. »Um aufrichtig zu sein«, hatte er hinzugefügt, weil der Makler wie ein Mann gewirkt hatte, dem Aufrichtigkeit über alles ging, »um aufrichtig zu sein - es handelt sich um reine Sentimentalität. Ich möchte etwas wiederfinden, was ich verloren habe, verstehen Sie?«
Ruben hatte nicht nach dem exakten Ebenbild seines Elternhauses gesucht. Das Haus sollte ihm nur möglichst ähnlich sein. Es sollte denselben Geist haben, dieselbe Ausstrahlung. Allerdings ohne die Gespenster der Vergangenheit.
Und dann hatte er es gesehen. Fast alles hatte mit dem Bild in seiner Erinnerung übereingestimmt. Es war so überwältigend gewesen, dass er nach Luft gerungen hatte.
Er war angekommen. Endlich.
Ruben tauchte aus seinen Gedanken auf und betrachtete die Leute an den anderen Tischen. Sie alle waren unterwegs. Die meisten von ihnen hatten ein Ziel. Wie Ameisen bewegten sie sich von einem Ort zum nächsten, schleppten ihre Lasten und bauten ihre Nester. Rastlos und unermüdlich.
Er ging hinaus, ohne sein Tablett wegzuräumen. Er fuhr noch ein Stück und verließ dann die Autobahn.
Die Ausfallstraßen waren verstopft. Wie Nebel lagen die Abgase über dem Boden. Ruben machte das Radio an. Er hörte in ein paar Sendungen hinein und schaltete wieder aus. Es gab Tage, da liebte er es, mit Musik zu fahren, da ertrug er es locker, an jeder Ampel halten zu müssen und nur schleppend voranzukommen. Es gab aber auch Tage, da war Autofahren und alles, was damit zusammenhing, die Hölle.
Heute war so ein Tag. Der Stau zerrte an Rubens Nerven. Seine Handflächen fingen an zu schwitzen. Bei der erstbesten Gelegenheit bog er ab und wich auf Nebenstraßen aus. Nach einigen Kilometern fühlte er sich wie von einer Last befreit.
Ruben dachte beim Autofahren gern nach. Es war eine angenehme Art des Denkens, leicht und spielerisch und ohne Konsequenzen. Man musste keinen Einfall zensieren, keine Scham empfinden und keine Skrupel. Gedanken waren frei.
Auf den Weg brauchte er kaum zu achten. Sein Wagen war mit einem Navigationssystem ausgerüstet. Die Strecke wurde ihm optisch über ein Display angezeigt und akustisch von einer angenehm modulierten Frauenstimme angesagt. Die Stimme war ein wenig unterkühlt für seinen Geschmack, aber sie sollte ja auch nicht seine Gefühle berühren, sondern ihn nur sicher und bequem ans Ziel bringen.
An einem Feldweg hielt Ruben an. Er stieg aus und bewegte sich ein bisschen. Schaute sich in der Einsamkeit um. Schneegeruch lag in der Luft. Für einen Augenblick schien es, als wollte die Sonne durchkommen, doch dann wurden die Wolken noch eine Spur dunkler.
Es war eine Landschaft nach Rubens Geschmack, hügelig und dennoch weit. Nicht diese engen, beklemmenden Täler, in denen man nicht atmen konnte und in denen er immer an Via Mala denken musste. Er hatte das Buch als Junge im Bücherschrank seiner Eltern gefunden und es heimlich gelesen.
Sämtliche Bücher der Eltern waren für die Kinder tabu gewesen, doch Ruben hatte sie alle verschlungen, ohne Ausnahme. Bei diesem hatte er den Eindruck gehabt, etwas ganz Unerhörtes zu lesen. Er war in einen Strudel widerstreitender Gefühle geraten, die er nicht kontrollieren konnte, die ihm fremd waren, ihm Angst machten und ihn gleichzeitig erregten.
Heute noch konnte er sich daran erinnern, dass er das Buch im Winter gelesen hatte. Die Tage waren lang und düster gewesen. Es hatte von morgens bis abends genieselt und der harte Schnee war auf den Wegen geschmolzen. Jener Winter war vollständig in das Buch eingegangen.
Es war nur eines von vielen verbotenen Büchern gewesen, aber es hatte Ruben als Einziges nachhaltig geprägt. Er hatte angefangen, sich mit verbotenen Gefühlen auseinander zu setzen. In sich hineinzuhorchen. Sich Fragen zu stellen. Irgendwann war Via Mala für ihn zu einem Bild seines eigenen Lebens geworden. Eng. Finster. Kalt.
Wahrscheinlich konnte er deshalb heute nur noch Landschaften ertragen, die weit waren und frei. So wie diese. Ein Lächeln legte sich auf sein Gesicht. Er hatte allen Grund, nach vorn zu sehen. Und sich zu freuen. Endlich erblickte er Licht am Horizont.
Nach dem Gespräch mit meiner Mutter war ich sofort wieder eingeschlafen. Manchmal staunte ich darüber, wie viel Schlaf ich brauchte. Allerdings wusste ich auch, dass mein Bett ein Zufluchtsort für mich geworden war. Nur hier fühlte ich mich geschützt. Nur in meinem Bett war es mir möglich, für Stunden zu vergessen.
Es sei denn, die Albträume holten mich ein. Dann wachte ich schweißgebadet auf, mit hämmerndem Herzen, meinen eigenen Schrei noch im Ohr. Ich fürchtete mich vor diesen Träumen, die ich nicht loswurde, die mich seit damals verfolgten, nicht bloß in der Nacht.
Sie lauerten überall und überfielen mich, wenn ich nicht darauf gefasst war. Es konnte sein, dass sie in den Schatten eines Zimmers verborgen waren, hinter einer Häuserecke oder am Ende einer Gasse. Sie versteckten sich in einem Buch, einem Lachen oder einem Wort. Für Sekunden nahm ich die Wirklichkeit nicht mehr wahr. Bis ein Geräusch oder eine Berührung mich zusammenfahren ließ.
Am schlimmsten jedoch war die Leere, die ich in mir spürte. Ich bemühte mich wirklich, mich nicht hängen zu lassen. Ich gab Merle nach, die immerzu versuchte, mich abzulenken, ging mit ihr zu den Versammlungen der Tierschützer, begleitete sie ins Kino, lief sogar ab und zu mit ihr über die Felder. Doch dadurch fühlte ich mich nicht weniger leer. Wo Liebe gewesen war, Zärtlichkeit und Verlangen, konnte ich jetzt gar nichts mehr fühlen.
Ich schlüpfte in meinen Jogginganzug und ging in die Küche. Vielleicht würde mir ein Kaffee gut tun. Die Katzen strichen mir maunzend um die Beine. Sie hatten ständig Hunger. Seit sie von Merles Gruppe aus einem Versuchslabor befreit worden waren, hatten sie sich von zitternden, mageren, unansehnlichen Geschöpfen in prächtige, selbstbewusste Persönlichkeiten verwandelt. Ihr Fell glänzte und ihre Augen waren klar und blank.
Wir hatten uns so an ihre Gesellschaft gewöhnt, dass ich mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen konnte. Ich machte eine Dose Katzenfutter auf und füllte einen Napf für Donna und einen für Julchen. Sie waren zwar durchaus bereit, sich ihr Futter schwesterlich zu teilen, aber Donna fraß so schnell, dass für Julchen nie genug übrig blieb.
Die Espressomaschine veranstaltete einen Höllenlärm, doch selbst das ertrugen die Katzen mittlerweile. Sie zuckten nicht einmal, wenn das Getöse losging, sondern fraßen seelenruhig weiter.
Der Kaffeeduft stieg mir in die Nase und machte mich endgültig wach. Ich zog mir einen der Küchenstühle ans Fenster und sah auf die Straße hinunter, während ich langsam und genüsslich trank.
Die Menschen hasteten über die Straße, als wollten sie vor der Kälte davonlaufen. Dabei spürte ich noch die Hitze des Sommers in mir. Ich hatte kein Gefühl für die Zeit, die vergangen war. Es kam mir so vor, als wäre ich monatelang durch einen langen dunklen Flur gekrochen, zu beiden Seiten lauter verschlossene Türen.
Vielleicht sollte ich mich anziehen und ein bisschen aufräumen. Wir bekamen am Nachmittag Besuch von diesem Mike Soundso, der sich die Wohnung angucken wollte. Es widerstrebte mir, ihm unser tägliches Chaos vorzuführen.
Wir hatten nicht vorgehabt, irgendwas an Caros Zimmer zu verändern. Aber dann waren Caros Eltern gekommen und hatten es leer geräumt. Sie hatten keine Beziehung zu ihrer Tochter gehabt, als sie noch lebte. Caros Tod hatte daran nichts geändert. Am Ende zerstörten sie auch noch das, was von ihr übrig geblieben war.
Das leere Zimmer erinnerte uns jeden Tag daran, dass Caro nicht mehr da war. Wir hielten die Tür geschlossen, doch das machte es nur schlimmer. Zu wissen, hinter dieser Tür war nichts... Fast war es, als hätte Caro nie gelebt.
Dann, eines Tages, hatte meine Mutter gesagt: »Ich glaube, Caro hätte gewollt, dass wieder jemand in ihrem Zimmer wohnt. Sie hätte gewollt, dass ihr mit Freude an sie denkt, nicht mit Trauer.«
Merle und ich sahen uns an und wussten, sie hatte Recht. Aber wir konnten uns nicht dazu überwinden, nach einer neuen Mitbewohnerin zu suchen.
»Weil ihr jedes Mädchen mit Caro vergleicht«, sagte meine Mutter.
Auch das stimmte. Und so war die Idee entstanden, das Zimmer nicht an ein Mädchen, sondern an einen Typen zu vergeben. Einen, der besonders war. Der zu uns passte. Obwohl wir keine Ahnung hatten, wie dieser Jemand sein sollte.
»Lasst euch überraschen«, sagte meine Mutter. »Und hört auf euer Gefühl. Dann wird alles gut.«
Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Jedenfalls hatten wir eine Anzeige aufgegeben, das Telefon war heiß gelaufen und wir hatten mit drei Jungen Termine vereinbart. Dieser Mike war der Erste und er würde um vier Uhr kommen. Das war gerade noch genug Zeit, um ein wenig Ordnung zu schaffen.
»Also los jetzt«, sagte ich zu mir selbst und scheuchte mit meiner Stimme die Katzen auf, die sich in der Stille eingerichtet hatten und sich gemütlich putzten. »Schluss mit dem Lotterleben.«
Ganz weit hinten in meinem Kopf flackerte ein vages Interesse auf, und ich versuchte, mir diesen Mike vorzustellen. Vielleicht war es ja wirklich gar nicht so übel, ein bisschen frischen Wind in unser Leben zu bringen. Obwohl - war es nicht zu viel, was ich da von einem Wildfremden erwartete?
3
Nachdem die Architektin die Rollläden hochgefahren hatte, war staubiges Sonnenlicht durch die Fenster gefallen. Hier und da lag noch der eine oder andere Gegenstand auf dem Boden, stand noch das eine oder andere Möbelstück vergessen an der Wand, als hätten die früheren Besitzer das Haus fluchtartig verlassen.
Die Wohnräume hatten Holzböden, glanzlos, zerkratzt und verwohnt, an einigen Stellen brüchig. Ruben hoffte, man würde sie retten können, denn die alten Dielen machten einen großen Teil der Stimmung in diesem Haus aus. Die Fenster waren original Jugendstil, was sein Herz bei jedem Besuch schneller schlagen ließ. Manche Scheiben waren leider blind, aber es hatte sich schon ein Glaser gefunden, der sie aufarbeiten wollte. Einige waren durch einfaches Glas ersetzt worden. Ruben hatte bereits Kontakte geknüpft, um an alte Originale heranzukommen. Geld war kein Problem. Das vereinfachte die Sache.
»Die Rollläden müssen wir erneuern«, sagte die Architektin mit ihrer verrauchten Stimme irgendwo hinter ihm. »Ein völlig veraltetes System.«
Ruben mochte diesen Typ Frau nicht besonders. Hosenanzug, Stilettos, das Haar straff zurückgebunden, die Lippen braunviolett, das Gesicht zu einer bleichen Maske geschminkt, die Brauen gezupft, eine verknautschte Handtasche über der Schulter, das Handy griffbereit in einem Außenfach. Aber sie war gut. Und diskret. Er hatte Erkundigungen über sie eingezogen.
Er betrat die Küche. Das schwarz-weiße Schachbrettmuster der Bodenfliesen. Die Tür, die in den Garten führte. Die grauen Kacheln an der Wand. Es traf ihn jedes Mal mit voller Wucht. Er lehnte sich an die Wand und schloss die Augen. Doch die Erinnerung ließ sich nicht vertreiben.
Es ist Sommer. Sie sitzen beim Abendessen. Draußen im Garten glüht noch die Sonne. Die Tür steht weit offen. Vogelgezwitscher dringt herein. Ilka trägt das blaue Kleid, das er so mag. Es schmiegt sich an ihren Körper. Die silberne Kette, die er ihr zum Geburtstag geschenkt hat, schimmert auf ihrer gebräunten Haut. Ilka ist gerade vierzehn geworden. Sie ist so schön, dass Ruben sie am liebsten immer und immerzu malen will.
Der Vater liest Zeitung. Eine Fliege summt träge am Fenster entlang. Die Mutter erzählt irgendwas. Niemand hört ihr zu, doch das scheint sie nicht zu stören.
Ilka pustet sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Ihr Gesicht ist von der Hitze leicht gerötet. Ruben verspürt eine unbändige Lust, sie zu küssen. Er nimmt sein Glas und hebt es an die Lippen. In diesem Moment sieht Ilka ihn an.
Ihr Blick ist gleichgültig. So gleichgültig, dass es wehtut. Ruben setzt das Glas ab, ohne zu trinken. Er greift nach dem scharfen Messer, das auf dem Teller mit den Tomaten liegt, und drückt sich die Schneide tief in den linken Handballen.
Ilkas Augen weiten sich vor Entsetzen. Die Mutter redet weiter. Sie hat nichts bemerkt. Ruben umschließt die Schnittstelle mit den Lippen und leckt das Blut ab, ohne Ilka aus den Augen zu lassen.
Sie starrt ihn an. Die entsetzliche Gleichgültigkeit ist aus ihrem Blick verschwunden. Ruben bemerkt, dass ihre Hände zittern. Sie versteckt sie unterm Tisch.
»Ist Ihnen nicht gut?«
Ruben sah den besorgten Blick der Architektin, fühlte ihre Hand auf seinem Arm. Das Lächeln fiel ihm schwer, aber es gelang ihm schließlich doch.
»Alles in Ordnung. Ich stehe zurzeit nur ziemlich unter Stress.«
Sie nahm die Hand von seinem Arm, als hätte sie sich verbrannt. Vielleicht war sein Ton zu barsch gewesen. Er hasste es, wenn Menschen ihm zu nahe kamen. Verabscheute Mädchen, die ihn auf der Straße anhimmelten. Frauen, die ihm auf Vernissagen mit ihren Blicken zu verstehen gaben, dass er sie interessierte. Er wollte nichts von ihnen. Warum kapierten sie das nicht?
»Dieser Raum muss bleiben, wie er ist«, sagte er und drehte sich mitten in der Küche einmal langsam um sich selbst.
»Ja. Das denke ich auch.«
Sie bewegten sich wieder auf sicherem Boden, konnten scherzen, lachen und sachlich sein. Sie war ein Profi. Nichts anderes erwartete er von ihr.
Er inspizierte die übrigen Räume. Das tat er jedes Mal und jedes Mal steigerte sich seine Erregung von Zimmer zu Zimmer. Dies hier war das Haus, nach dem er so lange gesucht hatte. Es war dem Haus in seiner Erinnerung verblüffend ähnlich. Er stieg die Treppe hinauf. Zu dem Raum unterm Dach. Sein Herz klopfte schmerzhaft. Fast konnte er es hören.
Imke Thalheim geriet in den dritten Stau und fluchte vor sich hin. Nach zwei Kilometern Stop-and-go beschloss sie, sich nicht weiter zu ärgern. Man konnte so einiges tun in einem Stau. Die Leute beobachten. Automarken und -kennzeichen studieren. Radio hören. Oder einfach denken.
Sie hatte schon ganze Romane entworfen, während sie Meter um Meter auf einer Autobahn vorankroch. Im Zug funktionierte das nicht so gut. Da drangen von überall her Stimmen und Geräusche an ihr Ohr, die sie störten. Im Auto hatte sie ihre Ruhe. Da klingelten keine Handys, piepten keine Laptops, spielte niemand sich auf, indem er seinen Fensterplatz zum Büro umfunktionierte.
Eigentlich hatte sie es ja auch gar nicht eilig. Es war der Tag der Anreise. Sie würde ihr Hotelzimmer beziehen, zu Abend essen, kurz noch einmal mit dem örtlichen Veranstalter telefonieren und sich dann mit einem Buch ins Bett verkriechen. Das war das beste Mittel gegen Heimweh.
Vielleicht würde sie noch Jette anrufen. Oder doch lieber nicht. Womöglich hatte Jette Recht und sie benahm sich tatsächlich wie eine Glucke. Wann würde sie endlich das schlechte Gewissen einer berufstätigen Mutter los? Wenn ihre Tochter fünfzig wurde? Sie befand sich nicht auf einer Weltreise. Sie war jederzeit erreichbar. Von überall käme sie rasch zurück. Was machte sie so unruhig? Ihr Verstand sagte ihr, dass sie sich kindisch aufführte. Ihr Gefühl behauptete das Gegenteil.
»Wenn du nicht wegfahren willst, dann bleib zu Hause«, hatte ihre Mutter gesagt. Sie war einfach und direkt und dachte nicht um zwölf Ecken herum. »Du hast Geld genug, es zwingt dich also niemand zu dieser Lesereise.«
Warum hatte sie dennoch nicht darauf verzichten wollen?
Weil Lesereisen zwei Seiten hatten. Da waren einerseits die enormen Anstrengungen, die Einsamkeit in der Öde der Hotelzimmer, die tausend kleinen Orte, die sie sah und gleich darauf wieder vergaß, die Austauschbarkeit von Menschen und Situationen. Da waren andrerseits die Lesungen selbst, die Auftritte, die sie genoss, Gespräche, die ihre Phantasie anregten, Menschen, denen sie für Stunden näher kam.
Am schlimmsten war die Einsamkeit. Und doch war sie auch faszinierend. Imke fürchtete und brauchte sie. Sie war etwas anderes als die Abgeschiedenheit in der Mühle. Die Einsamkeit auf Lesereisen war vollkommen. Sie wurde von nichts und niemandem wirklich unterbrochen. Gespräche waren nur Einsprengsel, Episoden. Danach schlug die Stille der Einsamkeit wieder über einem zusammen.
In dieser Einsamkeit drang Imke zu etwas in sich vor, an das sie nicht gern rührte. An das sie auch jetzt nicht rühren wollte. Rasch machte sie das Radio an, suchte einen Sender, der Musik brachte, und schnippte im Takt dazu mit den Fingern. Alles war in Ordnung. Es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
Mike hatte den Arm um sie gelegt. Fast konnte Ilka durch die dicken Winterjacken hindurch die Wärme seines Körpers spüren. Sie mochte diese Wärme, mochte seinen Körper. Sie liebte den Geruch seiner Haut. Mike war der einzige Mensch, dem sie die eine oder andere Tür zu ihrem Innern geöffnet hatte. Wenige nur, ganz vorsichtig und bloß auf einen schmalen Spalt, jederzeit bereit, sie bei der geringsten Irritation wieder zuzuschlagen. Sie kannte Mike nun seit drei Jahren, aber sie bewegte sich noch immer wie auf Eis.
Es war nicht so, dass sie ihm nicht vertraute. Im Gegenteil. Keinem vertraute sie mehr als ihm. Sie war nur nicht daran gewöhnt, so zu empfinden, wie sie es für ihn tat. Die Panik saß ihr bei jeder Berührung, jedem Wort im Nacken.
Mike respektierte ihre Zurückhaltung und ihre Scheu, von sich zu erzählen, und wenn er ihr Verhalten manchmal sonderbar fand, so sagte er es nicht. Er war immer für sie da, wenn sie ihn brauchte, und er bot ihr Schutz. Niemand würde ihr zu nahe kommen, solange sie und Mike ein Paar waren.
Ein Paar. Sie sagte es sich manchmal vor. Voller Sehnsucht. Vielleicht würde es ja irgendwann so sein, dass sie wirklich ein Paar wären. Mit allem, was dazugehörte. Vielleicht. Es fiel ihr schwer, daran zu glauben.
Ihr war auf einmal kalt. Ein Schauer lief ihr über die Haut. Mike gab ihr seinen Schal. Sie sah ihn an. Wollte lächeln. Doch dann bemerkte sie die Sehnsucht in seinem Blick. Das Lächeln misslang. Sie senkte den Kopf. Was, wenn sie ihn nur unglücklich machte?
Natürlich waren es andere Zimmer gewesen, die hier zu einem großen Raum verschmolzen waren, und andere Menschen hatten sie bewohnt, aber wenn Ruben nicht auf die Details achtete, konnte er sich einreden, er habe hier seine Kindheit und Jugend verbracht. Es schien ihm, als klebten die Gefühle von damals noch an den Wänden: Unsicherheit, Trostlosigkeit, Glück, Liebe, Ekel, Hass.
Und Angst. Fast konnte er das Toben seines Vaters noch hören und das Weinen seiner Mutter. Fast die Schläge noch spüren, die ihn gefügig machen sollten. Auch das Gerede der Nachbarn hatte seinen Weg in diese Zimmer gefunden, in seins und in das nebenan. Unmöglich, es nicht zu hören. Man konnte sich die Ohren zuhalten und hörte es doch.
Band 30193 cbt - C. Bertelsmann Taschenbuch
Der Taschenbuchverlag für Jugendliche Verlagsgruppe Random House
www.cbj-verlag.de
Umwelthinweis:Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.
1. Auflage Originalausgabe September 2005 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2005 cbt/cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Marion Schweizer, Textpraxis Hamburg Umschlagfoto: Getty Images / init Umschlagkonzeption: init.büro für gestaltung, Bielefeld st · Herstellung: CZ/SZ
eISBN : 978-3-641-02320-1
Leseprobe
www.randomhouse.de