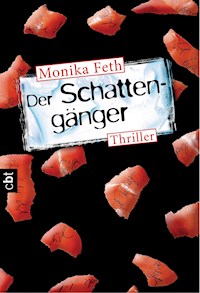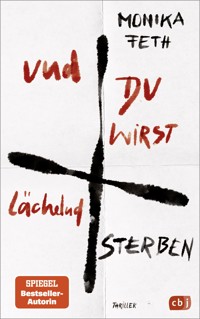8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Romy-Thriller
- Sprache: Deutsch
Sie kann ihm nicht entkommen. Er liebt sie.
Romy ist leidenschaftlich verliebt, als eine Recherche ihr vor Augen führt, was aus Liebe werden kann: Sie begegnet der neunzehnjährigen Fleur, die sich vor ihrem Freund Mikael und seiner gefährlichen Eifersucht in ein Kölner Frauenhaus geflüchtet hat. Gerade als Fleur beginnt, sich dort sicher zu fühlen, geschieht ein Mord, und sie weiß, dass Mikael sie gefunden hat. Für Romy beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Monika Feth
»On ne naît pas femme: on le devient.« (Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.)
– SIMONEDEBEAUVOIR
»Mach dich hübsch«, hatte er ihr ins Ohr geflüstert. »Ich lade dich zu einem zweiten Frühstück ein.«
Er war so fürsorglich gewesen.
Unheimlich fürsorglich.
Sie hatte fest daran geglaubt, dass er ihr wirklich eine Freude bereiten wollte.
Zuerst liefen sie ein bisschen durch die Stadt. Er steuerte die Schaufenster viel zu teurer Läden an, den Arm um ihre Schultern, den Kopf hoch erhoben, als gehörte ihm die Welt.
Ein mohnrotes Kleid mit tiefem Ausschnitt ließ seine Augen glänzen. Wortlos zog er die Tür auf und stieß sie in ein Geschäft, in dem selbst die Kleiderbügel vornehm wirkten.
Es passte nicht. War ihr um die Hüften zu weit und schlackerte um die Taille.
Seine Enttäuschung war nicht zu übersehen.
Sie probierte andere Kleider an. Trat aus der Umkleidekabine, ausgebeulte Socken an den Füßen, und drehte sich verlegen unter seinem kritischen Blick.
Keines gefiel ihm.
Er zerrte sie so grob aus dem Laden, dass sie beinah hingefallen wäre. Vereinzelte Schneeflocken schwebten aus dem braunen Himmel herab. Eine setzte sich auf ihre Wimpern, hauchzart.
Sie schloss die Augen.
»Was hast du dir gewünscht?«
»Das darf man nicht verraten, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung.«
Das Café war bis auf den letzten Platz besetzt. Ein stetiges Murmeln erfüllte den überheizten Raum, ab und zu durchbrochen von einem Lachen oder dem Scharren eines Stuhls, der zurechtgeschoben wurde.
Er hatte einen Tisch am Fenster reservieren lassen. Von ihrem Platz aus konnte sie den Schneefall beobachten, der stärker geworden war. Dicke Flocken fielen sanft und gemächlich nieder und malten den vorübereilenden Menschen Pelze auf die Jacken und Mäntel.
»Was hast du dir gewünscht?«
Sie antwortete mit einem Lächeln, doch hinter dem Lächeln wurde die Angst wach, die immer und überall auf der Lauer lag.
Nicht hier, dachte sie. Bitte. Nicht hier.
Je angestrengter sie versuchte, nicht an ihren Wunsch zu denken, desto größer wurde er in ihrem Kopf.
Nein. Nein!
Manchmal konnte er Gedanken lesen.
»Du weißt, ich kriege es sowieso raus.«
Es lag jetzt etwas Schmeichelndes in seiner Stimme, dem sie jedoch nicht trauen durfte. Ebenso wenig wie der Heiterkeit, die er plötzlich ausstrahlte.
Die beiden Schulschwänzerinnen am Nebentisch himmelten ihn an. Ihre Aufmerksamkeit ließ ihn zur Höchstform auflaufen. Er war fast wie am Anfang. Seine Worte, seine Gesten, sein Lachen, seine lockere, lässige Art, all das hatte sie bezaubert.
Damals.
Es war noch gar nicht so lange her.
Der Schnee blieb liegen. Die Autos trugen schon weiße Hauben. Die Menschen hatten Schirme aufgespannt.
»Was hast du dir gewünscht?«
Er schlug mit der Faust auf den Tisch, dass die Tassen auf den Tellern hüpften und sämtliche Köpfe sich zu ihnen umdrehten.
Und sie hatte sich schon in Sicherheit gewähnt.
»Sag es mir!«
»Bitte …«
»Wieso flüsterst du?«
»Die Leute …«
»Was du dir gewünscht hast, will ich wissen!«
Sie musste sich einen Wunsch ausdenken. Etwas aus dem Ärmel ziehen, das ihn besänftigen würde.
Es schien, als würde das gesamte Café die Luft anhalten und auf ihre Antwort warten.
»Ich hab mir gewünscht, mit dir zu verreisen.«
»So. Das hast du dir gewünscht.«
Sie nickte.
»Sie hat sich gewünscht, dass wir verreisen«, sagte er mit einem Zwinkern zu den Mädchen am Nebentisch.
Er wandte sich ihr wieder zu. Seine Augen verengten sich.
»Ist das die Wahrheit?«
Sie nickte. Ihr Mund war trocken vor Angst.
Die Mädchen packten ihre Sachen zusammen und schlüpften eilig in ihre Jacken.
Der Wunsch …
Sie durfte nicht an ihn denken …
»Es ist eine verdammte Lüge!«
Nicht an ihn denken …
»Du bist eine verdammte Lügnerin!«
Durch ihre Augen starrte er in ihren Kopf.
»Sag es!«
Tief in ihn hinein. Dorthin, wo all ihre Geheimnisse lagen.
»Sag, dass du eine Lügnerin bist!«
Seine Finger griffen nach ihrem Arm. Gruben sich ihr ins Fleisch.
»Wird’s bald?«
»Ich …«
»Weiter!«
»Ich … bin eine … Lügnerin.«
»Lauter!«
»Ich …«
»Lauter!«
»Ich. Bin. Eine. Lügnerin.«
Es war totenstill im Café. Alle hatten den Blick abgewandt.
Ihre Worte zitterten noch in der Luft, die so trügerisch nach Kaffee, Kuchen und Behaglichkeit roch.
»Entschuldige dich dafür!«
»Es …«
»Lauter!«
»Es … tut mir … leid.«
»Na siehst du.«
Seine Stimme war mit einem Mal zärtlich und sanft. Mit dem Daumen wischte er ihr die Tränen von den Wangen.
»War doch gar nicht so schwer.«
Sein Blick streichelte ihr Gesicht. In seinen Augen sah sie sein Verlangen.
»Und jetzt sagst du mir, was du dir gewünscht hast.«
Ich habe mir gewünscht, du wärst tot.
Sie dachte es nur.
Und schwieg.
Noch eine Lüge würde er ihr erst recht nicht glauben.
Er knüllte seine Serviette zusammen, warf das Geld auf den Tisch und zog sie vom Stuhl. Durch das Spalier befremdeter Blicke stolperte sie hinter ihm her, hinaus in den Schnee, der so weiß und rein und schön vom Himmel fiel.
1
Schmuddelbuch, Montag, 2. Mai, sechs Uhr früh
Björn duscht gerade. Sein Rucksack steht schon gepackt im Flur. Wenn ich heute aus der Redaktion komme, werde ich wieder allein in meiner Wohnung sein. Ich kann mir das kaum noch vorstellen, nachdem Björn die vergangenen Wochen bei mir gelebt hat.
Ich habe alles getan, um ihn von seiner Trauer um Maxim abzulenken. Doch alles ist nicht genug, wenn eine Liebe tot ist. Wer wüsste das besser als ich.
Fluchend trat Romy auf das Bremspedal. Fast wäre sie bei Rot über die Ampel gerauscht.
»Hey«, sagte Björn, den es heftig nach vorn geworfen hatte. Er lockerte den Sicherheitsgurt und sah seine Schwester forschend an. »Was ist los mit dir?«
»Ich will nicht, dass du wegfliegst!«
»Du hast mich selbst dazu überredet.«
»Weiß ich.«
»Und?«
»Ich will ja, dass du fliegst …«
Romy ließ die Ampel nicht aus den Augen. Das half gegen die Tränen, die sich wieder mal für einen großen Auftritt sammelten. Dabei hatte sie sich vorgenommen, nicht zu heulen. Bloß nicht. Sonst würde Björn seinen Flug sofort canceln.
»Halt mal bitte an«, bat er sanft.
»Scherzkeks! Wo denn?«
Sie befanden sich mitten auf der Severinsbrücke und quälten sich, Stoßstange an Stoßstange, im Schneckentempo voran. Der grandiose Blick auf den Dom und die Kranhäuser ließ Romy keine Sekunde lang vergessen, dass sie sich beeilen mussten, wenn Björn seine Maschine rechtzeitig erreichen wollte.
Björn legte die Hand auf Romys Arm.
»Soll ich bleiben?«
»Nein.«
»Würd ich aber gern.«
Romy spürte sein Lächeln, ohne hinzugucken.
»Das könnte dir so passen! Du machst dir gefälligst ein paar schöne Tage bei unseren Eltern und kommst frisch und munter zurück.«
Sie waren Zwillinge und von Geburt an unzertrennlich, auch wenn Romy sich für ein Leben in Köln entschieden hatte, während Björn in Bonn gelandet war. Sie telefonierten täglich, und das Bewusstsein, dass nur etwa eine halbe Stunde Autobahn zwischen ihnen lag, ließ sie die Trennung gar nicht als solche empfinden.
»Frisch und munter? Machst du Witze?«
Ihre Eltern waren halbe Nomaden. Mittlerweile waren sie in einer Finca auf Mallorca gestrandet, wo sie eine Kunstgalerie eröffnet hatten. Das erste ihrer unzähligen Projekte, das funktionierte.
Ihre Elternrolle hatten sie so gut wie nie ausgefüllt. Sie waren Paradiesvögel, die es nicht lange an einem Ort hielt. Obwohl das für Romy und Björn schwere Jahre im Internat bedeutet hatte, eine schmerzhafte Abnabelung in der Kindheit und ein vorzeitiges Erwachsenwerden, hatten die Eltern auch ihre guten Seiten. Sie waren fantasievoll, optimistisch und humorvoll.
Wenigstens das.
»Sie sind so furchtbar anstrengend«, stöhnte Björn.
Das waren sie wirklich, aber Björn brauchte dringend einen Tapetenwechsel.
Er hatte Schlimmes durchgemacht. Es war noch keine zwei Monate her, da hatte er seine große Liebe verloren und beinah sein Leben.
Es war ein Thema, das sie nur selten berührten. Björn hatte beschlossen, nicht darüber zu sprechen. Obwohl die meisten ihrer Freunde der Meinung waren, er solle eine Therapie machen und sich helfen lassen, konnte Romy ihren Bruder gut verstehen. Warum sollte er nicht zunächst einmal versuchen, allein damit fertig zu werden?
»Ich muss das alles erst sacken lassen«, hatte er gesagt.
Romy fürchtete sich vor dem Tag, an dem Maxim seinen Platz in Björns Leben erneut beanspruchen würde.
Unter dem verhangenen Morgenhimmel war der Rhein wie flüssiges Blei. Selbst die Luft wirkte grau. Das passte zu Romys Stimmung. Sie hätte gern etwas Komisches gesagt, um Björn zum Lachen zu bringen, doch ihr fiel nichts ein.
Als der Flughafen vor ihnen auftauchte, hätte sie am liebsten auf der Stelle kehrtgemacht.
Was, wenn das Flugzeug abstürzte?
Wenn es entführt wurde?
»Ich möchte allein reingehen«, sagte Björn. »Lass mich einfach hier raus.«
Romy nickte. Sie hatten sich in ihrem Leben schon so oft von Menschen verabschieden müssen. Vielleicht fielen ihnen deswegen selbst kleine Abschiede so furchtbar schwer.
Sie hielt an, und sie stiegen aus, um den Rucksack aus dem Kofferraum zu holen.
»Jetzt hast du deine Wohnung wieder für dich allein«, sagte Björn mit einem schiefen Grinsen.
»Darauf hab ich echt hingefiebert«, antwortete Romy. »Was glaubst du, warum ich dich zu diesem Trip überredet habe?«
Björn nahm sie in die Arme.
»Pass auf dich auf!«
Romy nickte. Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Und du auf dich.«
»Klar.«
»Und wenn das Flugzeug abstürzt, setzt du dich auf eine Wolke und wartest, bis sie dich da runterholen, ja?«
»Wird gemacht.«
»Grüß Mama und Papa.«
Björn hielt sie ein Stück von sich ab und musterte sie, als wollte er sich ihren Anblick einprägen. Im nächsten Augenblick hatte er sich den Rucksack geschnappt und eilte mit langen Schritten auf das Flughafengebäude zu.
Er drehte sich nicht mehr um.
Romy fuhr los. Sie nahm sich vor, nicht zurückzublicken. Doch dann tat sie es doch. Sie sah einen Haufen Menschen im Rückspiegel. Von Björn keine Spur.
Gut so, dachte sie. Gut.
Aber warum fühlte sie sich dann so mies?
Um halb neun kam sie in der Redaktion an, im Grunde zu früh, denn sie musste erst um zehn da sein. Dafür konnte sie vielleicht heute mal früher Schluss machen.
Sie arbeitete nun schon seit über einem halben Jahr beim KölnJournal und bekam immer noch Gänsehaut, wenn sie durch das geschäftige Treiben zu ihrem Schreibtisch ging, der hinten im Raum in einer Ecke stand.
Ein perfekter Platz, von dem aus sie alles sehen konnte.
Heute war noch nicht viel los. Romy stellte ihre Tasche ab und warf einen Blick zu der Glasfront, die Gregs Büro abgrenzte. Er war immer der Erste in der Redaktion. Auch jetzt saß er an seinem Schreibtisch und telefonierte. Mit der freien Hand machte er ihr ein einladendes Zeichen. Sie nickte und schaltete ihren Computer an.
Als Greg mit Telefonieren fertig war, ging sie hinüber und klopfte an seine Tür.
»Ja!«
Seine Stimme klang ziemlich einschüchternd, wenn er schlecht drauf war, und das war er oft. Er lebte allein, aus Überzeugung, wie er behauptete, und er trank zu viel. Keine gute Mischung, dachte Romy wieder, als sie die Tränensäcke unter seinen Augen bemerkte. Aber vielleicht hatte er auch nur mit seinen Dämonen zu kämpfen.
»Setz dich.«
Gregory Chaucer, Journalist und Verleger aus Leidenschaft, rieb sich nachdenklich über seinen Dreitagebart, während er Romy aus schmalen Augen betrachtete.
»Du siehst fertig aus, Mädchen.«
Niemandem außer Greg würde Romy erlauben, sie Mädchen zu nennen. Bei ihm war es keine Herabsetzung. Es war auf verquere Art und Weise sogar so etwas wie Wertschätzung.
»Ich hab in aller Herrgottsfrühe meinen Bruder zum Flughafen gefahren.«
Greg nickte.
»Er fliegt nach Mallorca. Vielleicht gelingt es meinen Eltern ja, ihn auf andere Gedanken zu bringen.«
Greg nickte wieder.
»Oder er verliebt sich neu.«
Doch daran glaubte Romy selbst nicht. Wie oft im Leben begegnete man einer großen Liebe?
Greg wusste von der Geschichte. Alle wussten davon, denn jede Zeitung hatte sich darüber hergemacht.
Ein Schwulenmörder geht um im Raum Köln-Bonn.
Brutaler Mörder sagt Schwulen den Kampf an.
Der Schwulenmörder hat wieder zugeschlagen.
Schwulenmörder endlich gefasst.
Auch das KölnJournal hatte darüber berichtet, doch weil Greg das Thema zur Chefsache erklärt hatte, war die Berichterstattung knapp und objektiv gehalten worden, sehr zum Ärger der Mitarbeiter, die sich um die Story gerissen hatten.
»Wie geht es dir?«, fragte Greg.
»Ich bin okay.«
Romy hatte nicht vor, sich über ihre Gefühle auszulassen. Vor allem jetzt nicht, wo Björn gerade irgendwo da oben in der Luft war und sie sich wie amputiert vorkam. Vielleicht war das hier ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues vorzuschlagen.
»Ich wollte sowieso mit dir reden, Greg. Ich hätte da ein Thema, das mir schon eine Weile durch den Kopf geht.«
Seine Augen wurden noch ein wenig schmaler. Ihre Alleingänge in der Vergangenheit hatten ihn misstrauisch gemacht.
»Wir haben doch zum Weltfrauentag am achten März eine große Sache gebracht.«
Er nickte.
»Ich finde aber, das Thema ist noch nicht erschöpfend behandelt worden.«
Greg runzelte die Stirn. Er griff nach einem Kugelschreiber und drehte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger.
» In dem Artikel ging es um alles Mögliche: Unterdrückung und Emanzipation, Frauenrechte und die Frauenquote, um veränderte Moralvorstellungen und die neuesten Scheidungszahlen und was weiß ich nicht noch alles. Aber es ging nicht um Frauenhäuser, nicht darum, dass wir überhaupt Frauenhäuser brauchen, um Frauen und Mädchen vor ihren Vätern, Ehemännern und Freunden zu schützen. Das ist ein Skandal, über den viel zu wenig gesprochen wird.«
»Was stellst du dir vor?«
»Ich möchte über solche Frauen schreiben. Ihre Geschichte kennenlernen, Einblick in ihr verstecktes Leben gewinnen.«
»Und du glaubst, die gewähren einer Journalistin Zutritt zu einem ihrer Häuser?«
»Es ist meine Aufgabe, sie dazu zu bringen.«
Die Falten auf Gregs ohnehin schon zerfurchter Stirn vertieften sich. Er begann am Ende des Kugelschreibers zu knabbern. Nachdenklich fingerte er mit der freien Hand an einem Papierstapel herum. Offenbar erwog er, inwieweit die Sache für sie gefährlich werden konnte.
Ungeduldig knibbelte Romy an ihrem Daumennagel, den sie sich in der Hektik heute früh eingerissen hatte.
Endlich hob Greg den Kopf und sah ihr in die Augen.
»Okay.«
Einfach so?
Romy hatte mit mehr Gegenwehr gerechnet. Verblüfft stand sie auf und ging zur Tür.
»Vielen Dank, Greg.«
»Und … Romy …«
Sie drehte sich um, die Klinke in der Hand.
»Ja?«
»Du bist vorsichtig, verstanden?«
»Bin ich doch immer, Chef.«
»Sehr witzig.«
»Diesmal bin ich es. Du kannst dich auf mich verlassen, Greg.«
»Wieso beruhigt mich das nicht?«
Romy hob lächelnd die Schultern und schlüpfte aus dem Büro, bevor er es sich anders überlegen konnte.
*
Fleur hasste überfüllte Straßenbahnen. Sie ertrug es nicht, Fremden so nah zu sein. Sie hielt ja nicht einmal die Nähe zu den Menschen aus, die sie kannte.
Neben ihr stand ein abgerissener Typ mit komplett tätowiertem Hals. Obwohl er sich an einer Halteschlaufe festhielt, schwankte er hin und her und rückte ihr bedrohlich auf die Pelle.
Anscheinend war er gerade aus dem Fitnessstudio gekommen. Dafür sprachen seine ausgeprägten Muskeln, die das enge Shirt beinah sprengten, die abgewetzte Sporttasche zu seinen Füßen und der riesige dunkle Fleck unter seiner Achselhöhle.
Er hatte sich großzügig mit Deo eingesprüht, das jedoch den scharfen Schweißgeruch nicht überdeckte.
Fleur hielt die Luft an.
Als sie nicht mehr konnte, drehte sie sich zur Seite und blickte direkt in das hochrote Gesicht einer älteren Frau, die sie missmutig anstarrte, als nähme sie ihr höchstpersönlich übel, keinen Sitzplatz abgekriegt zu haben.
Rasch schaute Fleur wieder aus dem Fenster.
Ihr Herz schlug viel zu schnell.
Graue Häuser glitten vorbei, graue Straßen und graue Menschen. Es war einer dieser Tage, die falsch anfingen und nur falsch enden konnten.
Lass dich nicht hängen, sprach sie sich selbst Mut zu. Man kann aus allem was machen, selbst aus so einem Tag.
Sie konzentrierte sich auf einzelne Menschen da draußen, auf Schaufenster und Plakate. Sog jede Farbe auf, jedes Lächeln, jeden einzelnen Grund, das Leben schön zu finden.
Allmählich beruhigte sich ihr Herzschlag wieder.
Sie atmete so flach wie möglich, um dem säuerlichen Schweißgeruch ihres Nachbarn zu entgehen, schmunzelte unwillkürlich über einen Hundewelpen, der sich auf dem Bürgersteig erbittert gegen die Leine wehrte, die ihn weiterzog.
Ein Lächeln!
Na bitte. Der Anfang war gemacht.
Noch drei Stationen, dann war sie zu Hause.
Zu Hause.
Früher hätte sie ein fremdes Zimmer nicht ihr Zuhause genannt. Früher. Als ihr Leben noch ganz gewesen war.
Sie konnte sich kaum noch an die Zeit erinnern. Als hätte ihr wirkliches Leben erst mit dem Abend begonnen, an dem sie … ihn kennengelernt hatte.
Vorsicht!
Es war nicht gut, an ihn zu denken. Oder gar seinen Namen auszusprechen.
Ihre Großmutter hatte immer behauptet, man könne Dinge durch die bloße Kraft der Gedanken heraufbeschwören, im Guten wie im Bösen.
Besonders im Bösen.
»Und wenn sich die gefährlichen Gedanken erst einmal in dir ausgebreitet haben, kannst du sie mit positiven nicht mehr unschädlich machen.«
Aber Mikael pflegte ohne jede Vorwarnung in Fleurs Gedanken aufzutauchen und ließ sich nur schwer wieder daraus vertreiben.
Fleur lockerte das Tuch, das sie um den Hals geschlungen trug. Panik stieg in ihr auf und katapultierte sie in den Abschnitt ihres Lebens zurück, den sie unbedingt vergessen wollte. Ihr wurde übel. Sie zitterte am ganzen Körper.
Zog sich in sich selbst zurück. Baute eine Mauer aus Abwehr.
Als sie den irritierten Blick des Tätowierten wahrnahm, war sie bereits einige Haltestellen zu weit gefahren, ohne es zu bemerken. An der nächsten Station drängte sie aus der Bahn.
Draußen legte sie den Kopf in den Nacken und sog die kühle Luft ein. Es war ihr gleichgültig, dass sie von Abgasen geschwängert war. Hauptsache, ihre Lunge füllte sich wieder mit Sauerstoff.
Sie schaute sich um. Versuchte herauszufinden, wo sie gelandet war.
Fleur kannte sich in Köln noch nicht besonders gut aus. Sobald sie die vertrauten Pfade verließ, die man ihr gezeigt hatte, verlor sie die Orientierung.
Kein Problem, versicherte sie sich selbst.
Überhaupt kein Problem.
Sie ging zu der Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite und wartete auf die Bahn, die in die Gegenrichtung fuhr.
Gut gelöst.
Kein Problem.
Doch die Angst, die sie immer noch spürte, würde erst aufhören, wenn sie wieder in ihrem Zimmer und in Sicherheit war.
*
Mikael war nicht bei der Sache. Schon den ganzen Morgen nicht.
»Entschuldigung«, sagte er. »Ich war mit den Gedanken woanders. Was hatten Sie gefragt?«
»Vergessen Sie’s!«
Verärgert wandte der Patient sich ab, humpelte auf seinen Krücken zur Glastür, öffnete sie und trat auf den Balkon hinaus. Dort zog er ein zerknittertes Päckchen und ein Einwegfeuerzeug aus der Tasche seines ausgeblichenen Bademantels und zündete sich eine Zigarette an. Der Rauch zerwehte ihm vor den Lippen.
Mikael wäre am liebsten auf den Balkon gestürmt und hätte dem Arschloch eine reingezogen. Was bildete der sich eigentlich ein? Glaubte er, etwas Besseres zu sein, bloß weil er Privatpatient war?
Er riss sich zusammen.
In letzter Zeit war er schon mit zu vielen aneinandergeraten. Die Zicke von Oberschwester hatte ihm bereits mit einer Abmahnung gedroht.
Das durfte er nicht riskieren.
Er brauchte das Geld, das er hier verdiente, auch wenn es lächerlich wenig war.
Dennoch knallte er beim Verlassen des Zimmers die Tür. Irgendwie musste er Druck abbauen. Vielleicht sollte er nach seinem Dienst ein paar Kilometer laufen. Oder ins Fitnessstudio gehen. Er kam viel zu selten dazu.
Das alles war Beas Schuld.
Dass sein Leben aus dem Ruder gelaufen war und er vor einem Scherbenhaufen stand.
Sie hatte ihn nicht nur verlassen – sie hatte sich förmlich in Luft aufgelöst. War aus der Wohnung verschwunden, dem Haus, der Straße und der Stadt.
Als hätte es sie nie gegeben.
Aber es hatte sie gegeben und es gab sie immer noch.
Er musste sie nur finden.
Mikael ging ins Stationszimmer. Er machte sich eine Tasse Tee und hoffte, er würde ihn diesmal auch trinken können, bevor er kalt geworden war.
Die ganze Nacht hatte er zu Hause am PC gesessen, wie immer auf der Suche nach einer Spur. Deshalb war er jetzt hundemüde.
Doch daran war er inzwischen gewöhnt. Er würde erst wieder schlafen können, wenn er Bea gefunden hatte.
Wenn er so weitermachte, würde es mit seinem Studium nicht mehr klappen. Dann konnte er sich gleich als Vollzeitpfleger einstellen lassen. Er wusste sowieso kaum noch, warum er Arzt werden wollte.
Ohne Bea machte nichts mehr einen Sinn.
Gerade hatte er den Teebeutel aus der Tasse gefischt, als mit lautem Summen wieder der Notruf aufleuchtete. Diesmal war es die Alte aus Zimmer 117. Zitierte ihn wegen jeder Kleinigkeit an ihr Bett, um ihn anzuschmachten und jede seiner Bewegungen mit hungrigem Blick zu verfolgen.
Seufzend machte Mikael sich auf den Weg. Er schlurfte vor Erschöpfung. Gleichzeitig spürte er diese Wut in sich, die ihn in letzter Zeit so gut wie nie verließ. Was hatte er davon, dass die Weiber verrückt nach ihm waren, wenn die eine, die einzige, die ihn interessierte, seine Liebe nicht wollte?
An manchen Tagen hatte er nicht übel Lust, sich eine Knarre zu besorgen und sämtliche Leute in dieser Klinik wegzuballern.
2
Schmuddelbuch, Montag, 2. Mai, neun Uhr
Die ersten Worte eines Artikels sind die Keimzelle des Ganzen. In ihnen ist alles Weitere angelegt. Deshalb muss man sich mit der Entscheidung für sie Zeit lassen und sie gründlich bedenken. (O-Ton Greg.)
Meistens halte ich mich daran, doch diesmal sind sie da, meine ersten Worte, bevor ich überhaupt mit der Recherche angefangen habe:
Frauenhaus.
Ein Haus für Frauen.
Aus aller Herren Länder flüchten sie sich hierher.
Aus aller HERREN Länder!!!
Es stimmt. In den ersten Worten ist bereits alles enthalten…
Die Anschrift der beiden autonomen Frauenhäuser der Stadt wurde geheim gehalten, um die Bewohnerinnen zu schützen. Lediglich das Büro als Anlaufstelle war allgemein bekannt. Es lag mitten in Köln-Ehrenfeld.
Romy hatte das unverschämte Glück, einen Parkplatz in der Körnerstraße zu finden, ganz in der Nähe eines kleinen Cafés, das den Namen CaféSehnsucht trug. Der gefiel ihr, und so beschloss sie, hier die halbe Stunde Wartezeit zu überbrücken, die sie ursprünglich für Stau und Parkplatzsuche einkalkuliert hatte.
Das Café war gut besucht. Romy setzte sich an einen freien Tisch im Wintergarten. Er war reserviert, jedoch erst ab elf. Jetzt war es kurz vor halb.
Während sie auf ihren Cappuccino wartete, nahm sie die Einzelheiten in sich auf. Die plaudernden und lachenden Mädchen zu ihrer Linken. Den älteren Mann am Tisch gegenüber, der immer wieder über den Rand seiner Zeitung spähte und ihren Blick suchte. Die drei gestriegelten und gebügelten Businesstypen, die ihr Gespräch ständig unterbrachen, um ihr Smartphone-Orakel zu befragen: Wie wird das Wetter? Wie steht der DAX? Wo ist Stau?
Über allem lag ein Hauch von Verwahrlosung, der aber nicht störte, dem Café im Gegenteil einen besonderen Reiz verlieh. Da machte es nichts, dass die weißen Gartenmöbel auf der Terrasse ihre frische Farbe verloren hatten und die Fensterscheiben vom Regen der vergangenen Wochen schmutzig waren.
Romy hätte dieses Café allein schon wegen des riesigen Posters gemocht, das an der Trennwand von Innenraum und Wintergarten hing – eine Fotografie des farbenfrohen Fensters, das Gerhard Richter für den Dom geschaffen hatte.
Es war Romys Lieblingsfenster und seit Jahren ein Zankapfel der Kölner, von denen etliche es unbegreiflicherweise immer noch für misslungen hielten.
Nachdem sie ihren Cappuccino getrunken und bezahlt hatte, schulterte Romy mit einem Gefühl des Bedauerns ihre Tasche und machte sich auf den Weg.
Zwei Minuten später betrachtete sie das weiße, schmucklose Haus, das sich genau auf der Ecke Stammstraße/Körnerstraße befand und dadurch ein bisschen wirkte wie ein Schiff, dessen Bug die Wellen zerteilt.
Das Büro lag im Erdgeschoss. Die hohen Fensterscheiben waren von innen mit Plakaten beklebt und mit Hinweisen auf Veranstaltungen, Bücher und Theaterstücke von Frauen für Frauen.
Einfache, transparente Vorhänge schützten vor zu viel Neugier.
Vor der Bar an der gegenüberliegenden Ecke standen ein paar Männer, die sich rauchend unterhielten. Was dachten sie wohl über dieses Büro, in dem die Geschicke der beiden anonymen Frauenhäuser Kölns verwaltet wurden und dessen bloße Existenz ja eigentlich ein Vorwurf an ihre Geschlechtsgenossen war?
Rose Fiedler öffnete Romy die Tür. Sie telefonierte, während sie sie in ihr Büro führte, und bat sie mit einer Geste, auf dem Besucherstuhl vor ihrem Schreibtisch Platz zu nehmen.
Ihre Stimme klang angenehm, nicht zu hoch und nicht zu tief. Sie strahlte Ruhe und Gelassenheit aus, was bei diesem Job bestimmt sehr hilfreich war. Romy bemerkte kaum wahrnehmbare Reste eines niederländischen Akzents.
Sie sah sich um.
Alles in diesem Raum wirkte irgendwie provisorisch. Als hätte man es nur kurz hier abgestellt, um es bei der ersten Gelegenheit durch die richtigen Möbel zu ersetzen, die richtigen Bücher, die richtigen Kinderspielsachen.
Dennoch empfand Romy eine unerwartete Behaglichkeit, unter der sie sich allmählich entspannte.
Als Rose Fiedler das Telefongespräch beendet hatte, legte sie das Handy weg und streckte die Hand aus, um ihre Besucherin zu begrüßen.
»Wir haben eine Dokumentation über unsere Häuser gedreht«, kam sie gleich zur Sache und rückte sich auf ihrem Schreibtischsessel zurecht. »Wir können sie gemeinsam anschauen, wenn Sie mögen.«
Romy begriff, dass die Zeit hier knapp war, weil man sie mit Wichtigerem füllen musste als mit Worten.
»Wir holen die Presse gern ins Boot, um auf uns aufmerksam zu machen«, erklärte Rose Fiedler. »Auf unsere Arbeit überhaupt und auf einen eklatanten Missstand: Köln braucht dringend ein drittes Frauenhaus. Im vergangenen Jahr haben wir über fünfhundert Frauen abweisen müssen. Über fünfhundert! Das ist unerträglich.«
Die Tür ging auf und eine junge Frau in Romys Alter trat ein.
»Das ist Jelena. Sie macht ein Praktikum bei uns und möchte gern an unserem Gespräch teilnehmen.«
»Hallo, Jelena. Ich bin Romy.«
Jelena reichte Romy eine schlanke, kühle Hand und lächelte sie strahlend an.
»Magst du einen Tee?«
»Du kannst zwischen schwarzem, grünem und Roibuschtee wählen«, erklärte Rose Fiedler, ebenfalls zwanglos zum Du übergehend.
Romy entschied sich für Roibusch. Wenig später folgte sie den beiden mit einem dampfenden Becher in der Hand in ein weiteres Büro, in dem ein Fernseher auf einem niedrigen weißen Tisch stand. Sie zogen sich Stühle heran und waren Sekunden später in die Dokumentation vertieft, in der ehemalige Bewohnerinnen der beiden Häuser ihre Geschichte erzählten und Mitarbeiterinnen über ihre Arbeit sprachen.
Romy war dankbar für diesen Film, denn er vermittelte ihr ein Gespür für das Innere der Frauenhäuser, das sie möglicherweise doch nicht zu Gesicht bekommen würde.
Die Frauen, die in dem Film gemeinsam in der Küche standen und kochten, wirkten wie die Mitglieder einer zwanglosen Wohngemeinschaft. Man sah ihnen nicht an, dass es Gewalt gewesen war, die sie hierhergetrieben hatte.
»Dann hat er mir gedroht, die Kinder und mich zu verbrennen«, berichtete eine der Frauen mit gefasster Stimme. »Da hab ich ein paar Sachen gepackt, für jeden eine Garnitur zum Wechseln, und bin mit den Kindern weggelaufen.«
Der Absturz von den farbenfrohen, beinah fröhlichen Bildern bis zu dieser Schilderung war ungeheuerlich. Romy saß wie erstarrt. Fröstelnd hörte sie einer anderen Frau zu, die in einfachen, eindringlichen Worten ihr jahrelanges Martyrium beschrieb.
»Er hat mich geschlagen und getreten. An den Haaren hat er mich durch die Wohnung geschleift. Mich tagelang eingesperrt. Irgendwann kamen zufällig Freundinnen vorbei, die mich und die Kinder da rausgeholt haben. Ich hatte immer behauptet, schon von der kleinsten Berührung blaue Flecken zu kriegen. Aber sie glaubten mir schon eine ganze Weile nicht mehr.«
Auch die Kinder kamen zu Wort.
»Einmal hat Papa im Wohnzimmer geschlafen und ich wollte etwas aus dem Schrank holen. Da ist Papa wach geworden. Er war sehr böse. Er hat mich hochgehoben und aus dem Fenster gehalten und gesagt, dass er mich das nächste Mal, wenn ich ihn aufwecke, runter auf die Straße fallen lässt.«
Das Mädchen war elf oder zwölf. Sie beschrieb den Vorfall äußerlich vollkommen unbewegt, was Romys Grauen nur verstärkte.
Was musste dieses Mädchen ausgehalten haben, bis ihr Weg sie mit der Mutter und den Geschwistern ins Frauenhaus geführt hatte. Und wie viele Therapiesitzungen hatte sie wohl gebraucht, um über das sprechen zu können, was ihre Welt aus den Angeln gehoben hatte.
Nach zwanzig Minuten war der Film zu Ende. Romy merkte, dass sie den Atem angehalten hatte. Sie würde die Bilder nie mehr aus ihrem Kopf vertreiben können.
Sie rückten die Stühle zurecht und kehrten in das Büro zurück, in dem sie zuerst gewesen waren.
Der Tee war kalt geworden.
Zuerst redeten sie kein Wort.
»Ich bin gespannt auf deine Meinung«, brach Rose schließlich das Schweigen. »Du bist die Erste, die den Film gesehen hat. Sogar für Jelena war es eine Premiere, obwohl sie in ein paar Einstellungen zu sehen war.«
»Er ist sehr gut«, sagte Romy. »So unaufgeregt. Und dadurch macht er die Gewalt erst recht spürbar.«
Rose lächelte.
»Eigentlich hat er die meisten meiner Fragen schon beantwortet. Aber ein paar habe ich noch.«
Romy klappte ihr Notizbuch auf.
»CaféSehnsucht. Und dann dein Vorname. Rose. Das klingt, als wäre beides eigens für dieses Haus gemacht, das für so viele Frauen der einzige Hoffnungsschimmer ist.«
»Stimmt.« Rose lächelte. »Auch einige unserer Mitarbeiterinnen haben Namen, die in diese Richtung gehen. Deniz (das Meer), Ikbal (das Glück) oder Akina (Frühlingsblume). Deniz ist Türkisch, Ikbal Arabisch und Akina Japanisch.«
Romy schob das Diktafon ein bisschen näher an Rose heran.
»Ich halte es für extrem wichtig, dass wir Mitarbeiterinnen aus möglichst vielen Ländern haben«, erklärte Rose. »Die Frauen müssen sich das Erlebte von der Seele reden, und wir müssen in der Lage sein, sie zu verstehen und ihnen zu antworten.«
»Gibt es einen Ort, den die Frauen besonders mögen?«
»Die Küche«, antwortete Jelena prompt. »Das ist der Dreh- und Angelpunkt in beiden Häusern. Hier trifft man sich, um zu kochen, zu essen und Zeit miteinander zu verbringen.«
»In jedem Haus gibt es nur eine Küche«, erklärte Rose. »Auf diese Weise sind die Frauen gezwungen, am sozialen Leben teilzunehmen. Es ist sehr problematisch, wenn sie sich abkapseln, denn sie alle haben Traumata davongetragen. Oft tröstet es ein wenig, wenn man sieht, dass auch andere mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben.«
»Und sie überwinden?«
»Ja. Natürlich ist es wunderbar, wenn man Fortschritte bei den Frauen beobachten kann.«
»Habt ihr mehr mit Fortschritten oder mit Rückschlägen zu tun?«
»Das kann man nicht so einfach beantworten. Immer wieder kommt es vor, dass Frauen einknicken und zu ihrem Mann zurückkehren. Und nicht selten geht das schlimm aus.«
Romy schauderte. Zu wissen, dass es Frauenhäuser gibt, war das eine. Jemandem gegenüberzusitzen, der dem Elend dieser Frauen ganz nah kam, das andere.
»Wie geht ihr damit um?«, fragte sie.
Rose hob die Schultern.
»Man darf die Probleme nicht mit nach Hause nehmen, sonst wird man verrückt. Zu Hause ist zu Hause. Da lebe ich mit meiner Familie, unserem Hund und niemandem sonst. Bis zum nächsten Morgen. Dann stehe ich auf, fahre hierher, öffne die Tür zu meinem Büro – und bin voll und ganz wieder im Einsatz.«
Jelena nickte bestätigend.
»Am Anfang«, gestand sie, »konnte ich kaum noch schlafen, weil ich immer wieder über das nachdenken musste, was ich tagsüber erlebt hatte.«
»Wie verkraftet ihr es, wenn einer der Frauen … etwas zustößt?«
»Vornehm formuliert.« Rose runzelte die Stirn. »Wenn ihnen etwas zustößt, bedeutet das furchtbare Gewalt, ausgeübt von dem Menschen, den sie trotz allem oft noch lieben. Wie ich damit umgehe?« Sie blickte aus dem Fenster, vor dem draußen ein paar kichernde Schülerinnen vorbeischlenderten. Gab sich einen sichtbaren Ruck. »Ich ertrage das nur, wenn ich mich an dem Positiven festhalte, das ja Gottseidank auch passiert.«
Es klopfte.
Zaghaft.
Fast hätten sie es überhört.
Dann öffnete sich die Tür einen Spaltbreit und ein Mädchen, etwa in Romys Alter, steckte den Kopf herein. Lange blonde Haare fielen ihr wie ein Vorhang um das Gesicht.
»Fleur!«
Rose stand auf und ging dem Mädchen mit ausgebreiteten Armen entgegen. Das Mädchen schob die Tür ganz auf und trat schüchtern ein.
»Da bin ich.«
»Wie schön, dass du dich zu diesem Schritt entschlossen hast.« Rose berührte sie sacht an der Schulter. »Das ist Romy Berner, von der ich dir erzählt habe. Sie recherchiert über das Leben in unseren Häusern. Romy? Das ist Fleur.«
Romy stand auf und streckte die Hand aus. Fleur ergriff sie und drückte sie leicht. Ihre Hand war zart wie die Hand einer Elfe und ihr Lächeln war hinreißend. Es schien von innen heraus zu glühen.
»Fleur. Ein schöner Name.«
»Hab ich mir ja auch selbst ausgesucht.«
Etwas überschattete plötzlich Fleurs Gesicht. Ein Gedanke. Eine Erinnerung.
Oder Angst.
Auch Jelena schien es wahrzunehmen.
»Hast du es dir anders überlegt?«, fragte sie.
Fleur schüttelte den Kopf. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und verschränkte die Arme vor der Brust. Scheu beobachtete sie Romy.
»Möchtest du es Romy selbst erzählen?«, fragte Rose.
»Ja.«
Offenbar hatte sie eine Entscheidung gefällt. Ihr Blick wurde offener, versteckte sich nicht mehr hinter Vorsicht.
»Ich würde dir von meinem Leben berichten … wenn du willst.«
»Was?« Romy starrte sie überrascht an. »Befürchtest du denn nicht, dass der Mann, vor dem du dich versteckst, sich an dir rächt, wenn er jemals davon erfährt?«
»Das wird er sowieso tun, falls er mich hier findet.«
»Fleur ist schon eine ganze Weile auf der Flucht«, sagte Rose. »Sie ist verdammt tapfer. Das ist für sie ein großer Schritt nach vorn. Sie hofft, dass sie etwas bewirken kann, wenn sie ihre Geschichte öffentlich macht.«
»Verabreden könntet ihr euch über uns«, schlug Jelena vor.
Romy war überwältigt. Sie konnte es immer noch nicht so recht glauben. Sie stand auf und streckte wieder die Hand aus.
»Ich danke dir für dein Vertrauen, Fleur. Und ich verspreche dir, es nicht zu enttäuschen.«
Fleur ergriff ihre Hand und sah ihr in die Augen, als wollte sie abschätzen, ob man sich auf Romys Wort verlassen konnte. Dann kehrte das umwerfende Lächeln auf ihr Gesicht zurück.
»Ich melde mich bei dir«, sagte sie und verließ das Büro.
Es war, als wäre es im Raum dunkler geworden.
Romy stellte den Rest der Fragen, die sie sich notiert hatte, und Rose nahm sich die Zeit, sie ausführlich zu beantworten.
Als sie später auf die Straße trat, war ihr Kopf schwer von all den Eindrücken und Informationen. Gleichzeitig fühlte sie sich leicht wie ein Schmetterling. Sie hatte mehr erreicht, als sie in ihren kühnsten Träumen erhofft hatte.
Manchmal lief es wirklich wie geschmiert.
*
Mikael hatte schon immer gefunden, dass nichts über ein gutes Netzwerk ging. Er kannte Land und Leute und wusste bei jedem Problem genau, wen er ansprechen konnte. Seit Jahren bastelte er unermüdlich daran.
Jetzt zahlte sich seine Hartnäckigkeit aus.
Mit Juri hatte er die Schulbank gedrückt und den Kontakt nach dem Abi nicht abbrechen lassen. Obwohl er ihn nicht als Freund bezeichnen würde, ihn nicht mal besonders schätzte. Er war ein Kumpel, mit dem er sich ab und zu auf ein Bier traf.
Aber auch Kumpel waren wichtig.
Juri hatte nach dem Abi eine Ausbildung bei der Polizei angefangen, sie jedoch nicht durchgehalten. Mehrmals war er mit seinen Ausbildern zusammengerasselt, bis er schließlich selbst die Reißleine gezogen hatte. Eine Zeitlang hatte er herumgehangen, bevor er sich dazu entschlossen hatte, eine Ausbildung zum Detektiv zu machen.
Mikael war bis dahin nicht klar gewesen, dass es überhaupt möglich war, diesen Beruf von der Pike auf zu erlernen, und er war sich nicht sicher, ob Juri mit dem Besuch einer privaten Detektivschule nicht in irgendeine windige Sache hineingeraten war, die ihm letztlich nichts bringen würde.
Er hatte jedoch beschlossen, auf die Charaktereigenschaften seines alten Kumpels zu vertrauen. Juri war neugierig, zäh und skrupellos. Wenn nötig, ging er über Leichen.
Sie hatten sich in Juris Wohnung in der Alaunstraße verabredet. Juri lebte dort in einer WG mit zwei Freunden, die offiziell an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft BWL studierten, in Wirklichkeit jedoch als Türsteher in einer der angesagtesten Diskos der Stadt arbeiteten.
In ihrer Nähe hatte man das Gefühl, vom einen auf den andern Augenblick geschrumpft zu sein. Sie waren das Klischee von Türstehern – groß, muskulös und mit tätowiertem Bizeps. Zu einem Studium passten sie wie eine Heavy Metal Band zu den Wiener Sängerknaben.
Juri führte Mikael in die unaufgeräumte Wohnküche, wo noch das Geschirr vom Vorabend auf den Abwasch wartete. Leere Bierflaschen drängten sich auf der Spüle zwischen Tellern, Töpfen, Salatresten und vertrockneten Toastscheiben. Das Pfand hätte einen Obdachlosen für einen ganzen Tag satt gemacht.
Während Juri den Tisch freiräumte, stand Mikael am Fenster und schaute auf den großen Innenhof hinunter.
Ein Gewirr von Mauern, die zum großen Teil von Efeu und anderem Kletterzeug bewachsen waren. Ein Golden Retriever wälzte sich ausgelassen auf einem winzigen Rasenstück. Eine bunte Katze balancierte auf dem Dach eines weißen Pavillons. Verlockende Essensgerüche drangen durch das gekippte Fenster.
Dreizehn Uhr.
Allmählich kamen die Kinder aus der Schule.
Mikael wandte sich vom Fenster ab und beobachtete Juri, der mit einem bakteriell hochgradig verseucht wirkenden Lappen den Holztisch abwischte.
»Bier?«, fragte Juri über die Schulter. »Oder Kaffee?«
»Nichts«, antwortete Mikael.
Er war nicht zum Trinken hierhergekommen. Erst recht nicht, um seinem Kumpel beim Aufräumen zuzusehen.
»Kannst du mal kurz mit dem Hausputz aufhören?«
»Hab noch nicht gefrühstückt«, erklärte Juri. »Du weißt, dass ich ungenießbar bin, wenn ich nichts im Magen hab.«
Eigentlich war Juri in fast jedem Zustand ungenießbar, aber Mikael wollte das jetzt nicht diskutieren. Ihm blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis Juri die Kaffeemaschine in Gang gebracht und Brot, Butter und Wurst auf den Tisch gestellt hatte.
»Setz dich.«
Juri säbelte ein paar dicke Scheiben von einem schon angebrochenen Fleischwurstring ab und belegte eine Scheibe Brot damit. Als er hineinbiss, schloss er für einen Moment genießerisch die Augen.
»Alles paletti bei dir?«, erkundigte er sich kauend.
Seine Lippen glänzten von Fett. Davon konnte einem glatt übel werden.
»Eher nicht.«
»Sorry.«
»Das mit Bea kotzt mich an.«
»Was ist denn diesmal anders als all die Male zuvor?«
Juri hatte völlig recht. Es war eine unendliche Geschichte: Bea haute ab und Mikael klaubte sie irgendwo wieder auf. Er hatte sie noch jedes Mal aufgestöbert.
Aber diesmal nicht!
Verdammt, er konnte sie nirgends finden!
»Über kurz oder lang wird sie von selbst wieder auftauchen, Mann. Das tun sie doch immer, die Weiber. Streunen eine Weile rum und kehren schließlich treu zu ihrem Herrn und Meister zurück.«
Treu!
Ein Wort, das im Zusammenhang mit Bea direkt anstößig wirkte. Bea war die Untreue in Person. Ihr ganzes Wesen war Sinnlichkeit und Verführung. Sie brachte es nicht fertig, einen Mann anzuschauen, ohne erotische Signale auszusenden.
»Quatsch nicht, Juri! Was hast du für mich?«
Juri stand auf und holte den Kaffee.
»Willst du nicht doch eine Tasse?«
Mikael schüttelte genervt den Kopf.
»Okay.« Juri schenkte sich ein und nahm den ersten Schluck. »Ahhh. Endlich kehren die Lebensgeister zurück.«
Aus dem Nebenzimmer war ein Poltern zu hören, dann die Wasserspülung.
»Bei uns«, erklärte Juri, »fängt der Morgen ein bisschen später an als im Rest der Welt.«
Das zweite Brot belegte er üppig mit Salami und leckte sich schmatzend die Finger ab.
»Also, ich hab eine gute Nachricht für dich und eine schlechte. Welche zuerst?«
Mikael stieß gereizt den Atem aus.
»Lass die Spielchen. Hast du sie gefunden?«
»Unmögliches wird sofort erledigt«, sagte Juri beleidigt. »Wunder dauern ein bisschen länger.«
»Bist du nun ein Schnüffler oder nicht?«
»Du weißt, dass ich noch …«
»Geschenkt. Komm zur Sache, Mann!«
Aus reinem Prinzip und nur, um sein Gesicht zu wahren, widmete Juri sich noch eine Weile seinem Frühstück. Er kaute geräuschvoll, wobei er Mikael nicht aus den Augen ließ.
Es zerriss Mikael beinah vor Ungeduld, aber er zwang sich, Juris Blick ungerührt zu erwidern.
Endlich lehnte Juri sich zurück. Er stülpte die Lippen vor. Seine Hände lagen auf dem Tisch. Die Finger trommelten einen nervösen Rhythmus auf dem zerkratzten Holz.
»Okay.«
Er angelte sein Smartphone unter einer zerlesenen Zeitschrift hervor, pustete Krümel vom Display und rieb es mit dem Ärmel seines Pullis blank. Seine Daumen fingen an, über die Tasten zu tanzen, während er mit der Zunge seine Zähne von Speiseresten befreite.
»Die gute Nachricht ist: Ich weiß, wo Beas Spur endet.«
Mikael beugte sich mit klopfendem Herzen vor.
»Die schlechte: Ich weiß nicht, wohin sie von da aus weiterführt.«
»Hör auf, in Rätseln zu reden, Juri! Hast du sie gefunden oder nicht?«
Mikaels Stimme hatte etwas Drohendes bekommen. Er hörte es selbst. Er konnte sehen, wie Juri unbehaglich zumute wurde.
»Ja. Und nein.«
Mikael schlug mit der Faust auf den Tisch, dass das Geschirr klirrte. Erschrocken zuckte Juri zusammen.
»Was soll das heißen, verdammt?«
»Ich hab rausgefunden, dass sie in Köln war. Oder ist. Ich sag ja: Da endet ihre Spur.«
»Wann war sie dort? Und wo genau?«
Um nicht klein beizugeben, griff Juri nach der Kaffeetasse und demonstrierte Gelassenheit. Er spülte sich mit einem Schluck Kaffee den Mund.
»Sie hat vor zwei Monaten mit einer Streetworkerin telefoniert, mit der sie mal eine Weile Kontakt hatte, und sich verplappert.«
»Bea verplappert sich nicht. Dazu ist sie zu gewieft.«
»Dann hat sie ihr eben verraten, wo sie war. Mehr aber nicht. Vielleicht ist sie irgendwo in Köln untergekommen, vielleicht ist sie bloß durchgereist. Ich sag ja: Für Wunder brauch ich mehr Zeit.«
»Nicht nötig.« Mikael betrachtete angewidert eine dicke schwarze Fliege, die über Juris Teller spazierte. »Ich weiß, wo sie untergekrochen ist.«
»Kennt sie jemanden in Köln?«
»Nein, aber ich weiß, wie sie tickt. Sie hat es schon mal versucht, allerdings blöderweise hier in der Gegend, ausgerechnet. Offenbar hat sie dazugelernt.«
Juris Augen verengten sich.
»Kannst du mal deutlicher werden?«
»Wohin wenden sich die Weiber, wenn sie Angst vor ihren Kerlen haben?« Mikael grinste. »Exakt! Und da werde ich sie rausholen.« Er stand auf und schlug Juri auf die Schulter. »Du bist ein Genie, Mann! Wie bist du ihr auf die Schliche gekommen?«
»Kontakte, Mik. Das A und O in meinem Job.«
Mikael nickte.
»Was das Geld angeht …«, sagte er.
Alarmiert hob Juri den Kopf.
»Sag jetzt bloß nicht …«
»Muss ein paar Quellen anzapfen. Übermorgen hast du’s.«
Als er durch das schmierige Treppenhaus nach unten ging, pfiff Mikael eine Melodie, die ihm gerade in den Sinn gekommen war. Die Trübsal der vergangenen Wochen hatte sich schlagartig in Luft aufgelöst.
KÖLN!
Mein Mädchen, dachte er. Mein Mädchen.
Er lachte leise.
Und beschloss, das nächste Café anzusteuern. Jetzt war er hungrig. Und wie!
*
Rose Fiedler ließ das Gespräch mit der jungen Volontärin noch einmal nachwirken. Sie war sich auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich gut war, dass Fleur und Romy Berner sich verabreden und über Fleurs Geschichte sprechen wollten. Nicht, weil sie Romy misstraute, nein. Sie hatte einen in langen Jahren geübten Blick für Menschen entwickelt und spontan Sympathie für sie empfunden. Sie konnte sich ihre Vorbehalte nicht so recht erklären.
Vielleicht war es zu früh und sie hielt Fleur für noch nicht stark genug. Vielleicht wäre ihr eine gestandene Journalistin für diese heikle Geschichte lieber gewesen. Vielleicht hegte sie die Befürchtung, die Dinge könnten entgleisen.
Vielleicht. Vielleicht.
Vielleicht war es aber auch wieder bloß ihr Instinkt, der sie warnte, ohne dass sie das an irgendetwas Konkretem festmachen konnte. Sie hatte sich angewöhnt, auf ihn zu hören. Auch diesmal folgte sie ihm. Sie schnappte sich ihre Tasche, meldete sich für eine Stunde ab, stieg in ihr Auto und fuhr zu dem Frauenhaus, in dem Fleur untergebracht war.
Sie musste sich noch einmal in Ruhe mit ihr unterhalten und das nicht am Telefon. Sie wollte Fleur in die Augen schauen, wenn sie mit ihr redete, wollte verstehen, was in ihr vorging und ob sie sich der Tragweite ihrer Entscheidung bewusst war.
Noch war die junge Frau nicht in Sicherheit. Niemand konnte sagen, wie es um den Mann stand, vor dem sie geflohen war. Ob er aufgegeben hatte oder noch immer nach ihr suchte.
Und niemand konnte sagen, wie nah er Fleur womöglich bereits war.
3
Schmuddelbuch, Montag, 2. Mai, dreizehn Uhr dreißig
Bin durch das Viertel gelaufen, in dem das Frauenhausbüro liegt, und habe fotografiert. Kaum vorstellbar, wie verwunschen manche Winkel in dieser Großstadt sind.
Von Efeu umrankte Fenster. Tauben auf bröckelnden Gartenmauern. In der Sonne leuchtende Graffiti. Kleine Designerläden, in denen genäht, gestrickt und entworfen wird. Eine winzige Buchhandlung mit einer Katze, die auf einem roten Sofa schlief.
»Zuerst hab ich diese italienischen Schuhe online verkauft«, erzählte mir die Inhaberin einer Modeboutique. »Im Januar dann hab ich den Schritt gewagt und den Laden gemietet.«
Das günstigste Paar Schuhe kostet lockere dreihundert Euro. Eine einfache Bluse in Schwarz oder Weiß fast sechshundert.
»Können sich die Leute hier das leisten?«, hab ich gefragt.
»Einige schon.« Eine Strähne ihres blondierten Haars, das ihren Kopf umgab wie ein Helm, hatte sich in ihrem linken Auge verfangen und sie blinzeln lassen. »Und es werden immer mehr. Viele kommen auch aus anderen Vierteln. Ehrenfeld ist längst Szene geworden.«
Und mittendrin gibt es eine Anlaufstelle für geschlagene, misshandelte und gequälte Frauen…
Im Literaturcafé Goldmund habe ich Chana Masala gegessen und sichte jetzt meine Notizen. Die ersten Sonnenanbeter sitzen schon draußen, aber ich schnuppere lieber die Atmosphäre hier drinnen.
Regale bis zur Decke, vollgestopft mit Büchern, die man kaufen, in denen man aber auch einfach nur blättern kann. Fast alle Tische besetzt. Eine originelle Speisekarte und ein verführerischer Duft im Raum.
Unzählige Nationalitäten sind hier in friedlicher Eintracht versammelt. Es wird mit Händen und Füßen erzählt. Der Typ, der mich bedient, flirtet mich an. Ich schenke ihm ein Lächeln und bestelle eine aufgeschäumte Schokolade mit Chili, obwohl ich bezweifle, dass sie zu dem Gericht passt, das ich gegessen habe.
Kein Flirt.
Keine neue Geschichte.
Hab ja die mit Cal noch nicht verdaut.
Plötzlich liegt ein grauer Schleier über diesem besonderen Ort, und ich nippe von der Schokolade, die so scharf ist, dass sie auf der Zunge brennt.
Fleur hatte den Rest der Nudeln vom Vortag verzehrt. Kühlschrankkalt. Sie hatte keine Lust gehabt, sie aufzuwärmen. Nun saß sie in der Gemeinschaftsküche, trank eine Tasse Tee und genoss die Stille, die hier so selten war.
Offenbar waren alle ausgeflogen oder in ihren Zimmern. Gut so.
Es gab Augenblicke, in denen Fleur dankbar war, wenn sie jemanden zum Reden fand. Es überwogen jedoch die Momente, in denen sie Ruhe brauchte.
Um nachzudenken.
Die Vergangenheit einzuordnen, die Gegenwart zu begreifen und vorsichtig an einer Zukunft zu basteln.
Allerdings – basteln war reichlich übertrieben. Es gelang ihr gerade mal, sich eine Zukunft vorzustellen, und das auch nur an Tagen, an denen sie sich stark genug fühlte.
Die Gemeinschaftsküche war ein wichtiger Bestandteil dieser zufällig und eigentlich unfreiwillig entstandenen Wohngemeinschaft, vielleicht der wichtigste überhaupt. Durch sie wurden die Frauen daran gehindert, sich in ihren Zimmern zu verkriechen. Jede musste sich etwas zu essen zubereiten, mehrmals täglich, und dabei kam man zwangsläufig miteinander ins Gespräch.
Anfangs hatte Fleur darunter gelitten. Sie hatte sich so erbärmlich gefühlt, so entwurzelt und heimatlos, dass sie am liebsten unsichtbar gewesen wäre. Still hatte sie erledigt, was erledigt werden musste, und war so schnell wie möglich wieder in ihr Zimmer zurückgekehrt.
Hier fühlte sie sich am sichersten.
Obwohl sie es nicht allein bewohnte. Hatte man keinen Anspruch auf ein Mutter-Kind-Zimmer, musste man sich ein Zimmer mit einer anderen Frau teilen. In jedem der beiden Frauenhäuser lebten zehn Frauen und noch einmal so viele Kinder.
Fleurs Mitbewohnerin hieß Amal. Ihre Eltern waren schon als Jugendliche von Riad nach Köln gekommen und Amal war hier geboren und aufgewachsen. Nur ihr Name erinnerte noch an ihre Herkunft, ebenso wie ihre großen tiefbraunen Augen und ihr prächtiges schwarzes Haar, das ihr in glänzenden Locken über die Schultern fiel.
Amal war erst zwanzig, ein Jahr älter als Fleur, und hatte bereits drei Jahre Ehe mit einem fünfzigjährigen Mann hinter sich, den ihre Eltern für sie ausgesucht hatten. Er hatte sie eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt und war im Begriff gewesen, sie nach Saudi-Arabien zu verschleppen.
Da hatte sie sich endlich ein Herz gefasst und ihre Flucht vorbereitet.
In einem kostbaren, unbeobachteten Augenblick während der Hochzeitsfeier einer Cousine war sie mitten in der Nacht in ihrem Festkleid weggelaufen, hatte ein Auto angehalten und den Fahrer angefleht, sie zur nächsten Polizeistation zu fahren. Die Beamten dort hatten den Kontakt zum Frauenhaus hergestellt.
Amal war als Zimmergenossin ein Glücksfall.
Sie hatte das Zeug zu einer Freundin.
Einer richtigen, nicht nur einer für den Übergang in ein anderes Leben. Sie war ruhig und diskret, redete nur, wenn sie etwas zu sagen hatte, und drängte ihrerseits Fleur nicht zum Reden.
Nachts hörte Fleur sie manchmal leise weinen. Sie wusste, dass dieses einsame Weinen nötig war, um all den Kummer und all das Unglück auszuschwemmen. Dennoch kostete es sie ihre ganze Kraft, nicht aufzustehen, um Amal in die Arme zu nehmen.
Für manches gab es keinen Trost. Das konnte man nur allein überwinden.
So wie die Angst.
Sie alle wurden von ihr heimgesucht, kannten sie in sämtlichen Facetten. Die leichte, schleichende Form, die immer da war, wie ein feiner Kopfschmerz, an den man sich beinah gewöhnt hatte. Die heftigere, situationsbedingte Variante, die durch böse Erinnerungen entstand. Und dann die panische Angst, die den Herzschlag rasen und den Schweiß aus sämtlichen Poren treten ließ.
Todesangst.
Und dann war da die Angst, die einen bei jedem Schatten zusammenzucken ließ. Die Angst, die Fleur heute draußen empfunden hatte. Sie machte einen zum wehrlosen Spielball der Gefühle. Da nützte es nichts, das Gehirn einzuschalten. Dieser Angst war mit Vernunft nicht beizukommen.
Die Tür ging auf und Mariella kam herein. Sie hatte heute mit Nadja und Esmeralda Dienst.
Bis zum Abend.
Nachdem die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses gegangen waren, gab es nur noch die Frauen und Kinder im Haus.
»Hallo, Fleur. So ganz allein?«
»Tut manchmal gut«, antwortete Fleur.
Sie überlegte kurz, ob sie sich Mariella anvertrauen sollte, entschied sich jedoch dagegen. Nicht, dass sie ihr misstraut hätte, ganz im Gegenteil. Mariella konnte ausgezeichnet zuhören. Sie verlor so gut wie nie die Geduld und machte Fleur allein schon mit ihrer Gegenwart Mut.
»Wolltest du nicht ein bisschen bummeln?«
»Hab ich gemacht.«
»Und bist so früh wieder da?«
Mariella besaß den sechsten Sinn. Sie erspürte jede Stimmung und sei sie noch so gut verborgen.
»Angst?«
Sie setzte sich zu Fleur an den Tisch, musterte ihr Gesicht und nickte nachdenklich.
Fleur war froh, dass Mariella nicht behauptete, man würde sich daran gewöhnen. Zum einen bezweifelte sie stark, dass man sich überhaupt an Angst gewöhnen konnte, zum andern wollte sie es auch gar nicht.
Sie wollte einfach leben. Wie andere Frauen.
War das zu viel verlangt?
»Was machst du, wenn die Angst dich überfällt?«, fragte Mariella.
Flüchten, dachte Fleur. Völlig sinn- und ziellos flüchten. Weglaufen, bloß weg. Doch sie sprach es nicht aus, denn in der Mehrzahl der Beratungsgespräche ging es immer wieder darum, die Frauen darin zu unterstützen, die Angst nicht zu verdrängen.
Sie wehrte mit einer müden Handbewegung ab. Ihr war nicht nach Reden. Sie hatte nur noch das Bedürfnis, sich auf ihrem Bett zusammenzurollen und ihre Wunden zu lecken.
So fingen Depressionen an. Aber so konnte auch Heilung beginnen. Wer durfte denn von sich behaupten, zu wissen, was richtig war?
Mariella reagierte sofort.
»Ich lass dich dann mal ein bisschen allein«, sagte sie und schob ihren Stuhl zurück. »Wenn du mich brauchst – ich bin für dich da.«
Fleur glaubte ihr. Doch an manchen Tagen half das nicht gegen die Gewissheit, niemals und nirgendwo hundertprozentig sicheren Schutz zu finden.
Der Hals wurde ihr eng. Sie lief aus der Küche, stürzte in ihr Zimmer, warf sich auf ihr Bett und kroch unter die Decke. Ihr Herzschlag war völlig außer Kontrolle geraten. Das Blut dröhnte ihr in den Ohren. Nahm ihr die Luft.
Sie schloss die Augen. Und riss sie sofort wieder auf.
Er konnte überall sein.
Im Schatten der Möbelstücke. Hinter den Vorhängen. Unter dem Bett.
Sich plötzlich auf sie stürzen.
Aus den Augenwinkeln nahm sie eine Bewegung wahr. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Als sie es endlich wagte, den Kopf zu drehen und das Zimmer mit aufmerksamen Blicken abzutasten, stellte sie fest, dass da nichts war, wovor sie Angst haben musste.
Nichts und niemand.
Nur sie selbst.
Aber die Angst blieb.
Sie nistete sich in den Winkeln des Zimmers ein, um auf die Stille der Nacht zu warten und dann erneut und mit aller Wucht über Fleur herzufallen und sie in Stücke zu reißen.
*
Als Romy in die Redaktion zurückkehrte, fühlte sie sich von allen Seiten beäugt. Sie wusste, dass die Kollegen ihr vorwarfen, Gregs Liebling zu sein und ihn um den Finger wickeln zu können. Dagegen kam sie nicht an. Jedes Wort der Erklärung würde die Vorurteile nur zementieren.
Also ließ sie es bleiben, sich dazu zu äußern. Gegen Voreingenommenheit konnte man nicht kämpfen. Sie war kein fairer Gegner.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und checkte ihre Mails.
»Keine Mittagspause heute?«
Susan Schilling, Wirtschaftsredakteurin und Urgestein des KölnJournals, konnte so viel beißenden Spott in ihre Stimme legen und so viel Verachtung, dass einem ganz kalt wurde, wenn man zu ihrer Zielscheibe geworden war.
»Hab unterwegs gegessen. Aber lieb, dass du fragst.«
Romy hatte mittlerweile gelernt, sich mit feiner Ironie aus der Schusslinie zu ziehen. Susan hatte Romy noch nie eingeladen, mit ihr in die Mittagspause zu gehen. Ebenso wenig wie die andern das getan hatten. Einzig Ilja Weiler fragte sie ab und zu, ob sie ihn begleiten wollte.
Ilja war um die dreißig, arbeitete nur halbtags beim KölnJournal und schrieb den restlichen Tag Theaterstücke, die nie aufgeführt wurden. Seine Beiträge für den Kulturteil waren erste Sahne. Innerhalb der Redaktion war er der ruhende Pol, der Streitigkeiten mit viel Feingefühl deeskalieren konnte.
Susan rauschte kommentarlos ab und schloss sich zwei Kolleginnen an, die vor der Tür auf sie warteten. Romy klappte ihren Laptop auf und begann, Fragen für das erste Treffen mit Fleur zu sammeln.
Fleur schien kaum älter zu sein als sie selbst und hatte bereits ein Leben gelebt, das sie ins Frauenhaus gebracht hatte. Für Romy war das geplante Gespräch mit ihr der Zugang zu einer gänzlich anderen, fernen, erschreckenden Welt.
Während sie das Interview mit Rose auf ihren Laptop spielte, blätterte sie in ihren Notizen.
Die Frauen mussten volljährig sein, um in einem der Frauenhäuser aufgenommen zu werden. Das Durchschnittsalter lag zwischen fünfundzwanzig und dreißig. Die älteste Bewohnerin war einundsechzig Jahre alt.
Romy war selbst über die Fülle an Informationen verwundert, die sie für ihren Artikel in den Griff bekommen musste. Es würden noch viel mehr sein, nachdem sie Fleur befragt hatte.
Sie wollte wissen, was sie ins Frauenhaus gebracht hatte. Wie sie sich unter all den vor Gewalt geflüchteten Mitbewohnerinnen fühlte. Wie lange sie schon untergetaucht war. Wie das Leben in einem Haus für misshandelte Frauen aussah. Romy konnte gar nicht so schnell tippen, wie die Fragen ihr in den Sinn kamen.
Sie überlegte, wo sie sich mit Fleur treffen sollte.
Die Redaktion war kein geeigneter Ort. Zu hektisch. Zu laut. Zu viele neugierige Kollegen. Ihre Wohnung? Würde Fleur zu ihr in die Wohnung kommen? Oder brauchte sie Öffentlichkeit, um sich sicher zu fühlen?
Man fiel in der Masse nicht auf, deshalb wäre ein Café wahrscheinlich der am besten geeignete Ort.
Oder das Büro der Frauenhäuser. Aber würden sie sich da ungestört unterhalten können?
Möglicherweise bestanden Rose und ihre Kolleginnen ja sogar darauf, dass eine von ihnen bei dem Gespräch anwesend war. Um Fleur zu schützen. Und sie daran zu hindern, zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Romy dachte an Björn und die Eltern und wäre jetzt gern bei ihnen gewesen, um zu reden, zu lachen und sich die Sonne aufs Gesicht scheinen zu lassen.
Wenn sie heute Abend nach Hause kam, würde sie ihre Wohnung leer vorfinden.
Auf einmal hielt sie es nicht mehr am Schreibtisch aus. Sie packte ihre Sachen und machte sich auf den Weg zum Alibi. Um ihr Gesprächskonzept konnte sie sich auch bei einem Cappuccino oder einem Glas Tee kümmern.
Sie hatte den halben Weg schon hinter sich, als ihr einfiel, wie einsam es dort ohne Ingo sein würde. Der bekannteste Redakteur der Konkurrenz. Der sie genervt hatte wie niemand sonst. Eingebildet, arrogant und unverschämt. Ein unverbesserlicher Einzelkämpfer, der jeden Konkurrenten ausschaltete, wo er nur konnte. Ingo, der sie mit seiner Begabung, seinem sensationellen Riecher und seiner begnadeten Schreibe alle locker in die Tasche steckte.
Der aber für sie da gewesen war, als sie dringend Hilfe gebraucht hatte.
Der sie für ein paar Tage in seiner Wohnung aufgenommen hatte.
Der ihr den Ring seiner Großmutter geschenkt hatte.
Den sie von einer ganz anderen Seite kennengelernt hatte.
Ingo würde nicht im Alibi sein, dem beliebtesten Kollegentreff in Köln. Ausgerechnet er würde nicht dort sein und auf sie warten, denn er war direkt nach der schrecklichen Sache mit Björn und Maxim in die USA geflogen, um an einem Journalistenkongress teilzunehmen. Und anschließend eine lange geplante Recherchereise zu machen.
Aber Cal war da.
Ausgerechnet.
Seit er mit der Schauspielschule angefangen hatte, jobbte er hier, und Romy hatte die Entscheidung treffen müssen, ihre Begegnungen auszuhalten oder das Alibi komplett aufzugeben.
Sie hatte sich für das Alibi entschieden.
»Hi«, sagte er mit der verführerischen Stimme, in die sie sich einmal rettungslos verliebt hatte. »Wie geht es dir?«
»Ausgezeichnet«, log sie und hoffte, dass es überzeugend klang.
Es war ihr ungeheuer wichtig, den Eindruck zu erwecken, als sei sie über ihn und seine Untreue hinweg. Als mache es ihr nichts aus, dass er jetzt mit Lusina zusammen war, die mit ihm die Schauspielschule besuchte. Und dass sie gegen diese Schönheit im ganzen Leben nicht ankommen würde, selbst wenn sie es wollte.
Dabei wollte sie gar nicht.
Ihr Herz war Cal aus den Händen gerutscht. Er hatte es fallen lassen und es war in tausend Stücke zersprungen.
Sie packte ihren Laptop aus und stellte ihn auf den Tisch. Vermied es, Cal in die Augen zu blicken. Tat geschäftiger, als ihr zumute war.
»Ich hätte gern einen Kakao mit Ingwer«, sagte sie leichthin und klappte den Laptop auf.
»Okay«, murmelte Cal.
Hier war er nichts anderes als ein Kellner. Nahm Bestellungen auf und brachte den Gästen das Gewünschte. Romy brauchte sich nicht auf ein Gespräch einzulassen und erst recht nicht auf Gefühle.
Die Distanz tat ihr gut.
Sie versenkte sich in die Arbeit, und nach einer Weile gelang es ihr wirklich, Cal aus ihren Gedanken zu verdrängen.
Als sie doch einmal hinsah, wandte er wie ertappt den Blick ab, und ihr wurde klar, dass er sie die ganze Zeit aus den Augenwinkeln beobachtet haben musste.
Ärger im Paradies, vermutete sie schadenfroh und erinnerte sich daran, dass Cal und sie selten oder nie Streit gehabt hatten. Bis zu dem Tag, an dem sie von Lusina erfahren hatte.
Da hatte sich auch ihr Paradies in einen kalten, hässlichen Ort verwandelt.
»Willst du noch was?«, fragte Cal, der leise und unbemerkt an ihre Seite getreten war.
Romy zuckte zusammen. Wie unheimlich nah er plötzlich war.
Und wie fern.
Ihr wurde bewusst, wie doppeldeutig seine Frage klang.
Ihr Smartphone klingelte und beim Anblick von Ingos Namen hüpfte etwas in ihr voller Freude auf.
Verwundert starrte sie auf das Display.
Verwundert suchte sie Cals Blick.
Er hatte es auch gesehen.
Es war, als hätten sie beide gleichzeitig begriffen.
Dass es zwischen ihnen zu Ende war.
Endgültig.
Cal wandte sich ab. Romy nahm das Gespräch an.
»Noch dreiundzwanzig Stunden«, sagte Ingo. »Dann bin ich wieder … zu Hause.«
Romy spürte, wie sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitete.
»Bei … mir«, sagte sie.
Die Zeit der Ungewissheit war vorbei. Ihr Herz hatte die Sache entschieden.
Wahnsinn.
»Ja. Bei dir«, sagte Ingo.
Ihr kurzes Gespräch war ein Versprechen und es machte Romy glücklich. Sie hatte das Glück schon lange nicht mehr gespürt.
*
Es drehte Calypso den Magen um. Bisher hatte alles noch irgendwie in der Schwebe gehangen. Nun hatte er Romy verloren.
An Ingo.
Ausgerechnet.
Dabei hatte er es kommen sehen. Er hatte die Nähe zwischen den beiden gespürt, lange bevor sie ihnen selbst bewusst geworden war.
Fast war er wütend auf Lusina. Wäre er ihr nicht begegnet, könnte alles noch so sein wie zuvor.