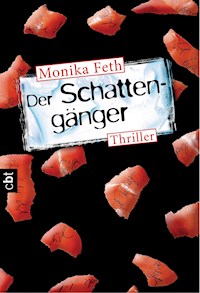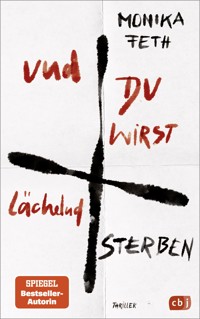5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Thema: Gefangen in einer Sekte
"Ich darf nicht zweifeln", schreibt Jana in ihr Tagebuch, als sie sich innerlich schon längst von der Sekte gelöst hat, der sie angehört. Dann verliebt sie sich in Marlon, einen Jungen aus dem Dorf. Kontakte zur Außenwelt sind den "Kindern des Mondes" jedoch strengstens untersagt. Jana muss sich entscheiden: absoluter Gehorsam wider das eigene Gefühl oder lebensgefährliche Flucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2002
Sammlungen
Ähnliche
Monika Feth
DU auf der anderen SEITE
Copyright
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2001 C. Bertelsmann Jugendbuch Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Marion Schweizer
Coverdesign: Geviert Grafik & Typografie
Copyright Covermotiv: Shutterstock (Natalia Toropova, mrsmargo, Elenarts)
ISBN 978-3-894-80701-6V003
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
12345678910111213141516171819Über das BuchÜber die AutorinCopyright
Personen und Handlungen, insbesondere der Aufbau und die Lehrsätze der hier beschriebenen Sekte, sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit Personen oder Organisationen sind nicht beabsichtigt, sondern rein zufällig.
Für Hans und Hanno, die Jana und mich geduldig auf unserem Weg begleitet haben.
Offensichtlich ist es gar nicht gut, empfindsam zu sein!
Rolf Dieter Brinkmann
1
Die Stille war schrecklich. Sie schien von dem Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster fiel und sich bunt auf dem hellen Granitboden brach, noch verstärkt zu werden. Keine Bewegung. Kein Laut. Nur die schwere, lastende Stille, die sich über den Raum gelegt hatte wie eine unsichtbare Decke.
Als wäre die Zeit stehen geblieben.
Jana hielt die Luft an. So musste es sein, wenn man aus einem Boot fiel und lautlos niedersank, über sich das Licht und unten die dunkle Tiefe.
Sie erlebte es immer wieder in ihren Träumen. Musste es immer wieder erklären. Obwohl sie lieber nicht darüber geredet hätte. Alles wollten sie wissen. Was war das Besondere an diesem Traum? Was quälte sie darin am meisten?
Und Jana musste Antworten finden.
Nicht das Fallen, nicht das Niedersinken machte ihr in diesen Träumen zu schaffen. Was sie vor allem entsetzte, war die furchtbare Stille.
Aber das hier war kein Traum, es war die Wirklichkeit. Aus den Augenwinkeln beobachtete Jana die anderen. Alle hatten den Kopf gesenkt, genau wie sie. Die Arme waren über der Brust gekreuzt, genau wie ihre.
Nur eine hatte die Arme erhoben. La Lune.
Vor ihr kniete Mara in ihrem schlichten blauen Gewand, die Hände auf dem Boden, ein Opferlamm. Sie kniete reglos und wartete. Und alle warteten mit ihr.
Marlon trieb den Pfahl mit wenigen kräftigen Schlägen in den Boden. Der Regen der vergangenen Tage hatte die Erde aufgeweicht, das erleichterte ihm die Arbeit. Sein Vater saß auf dem Traktor. Er hatte sich halb umgedreht, den rechten Arm über der Lehne des Fahrersitzes, und sah seinem Sohn zu.
Seit einiger Zeit hatte er Probleme mit dem Rücken und konnte nicht mehr so gut arbeiten wie früher. Aber er hielt nicht viel von Ärzten und ging erst hin, wenn er, wie seine Frau es ausdrückte, den Kopf unterm Arm trug. Solange er noch kriechen konnte, würde er keinen Fuß in die Praxis von Doktor Jahn setzen.
Sie hatten erst etwa vierzig Meter geschafft. An die zweihundert lagen noch vor ihnen. Und nirgendwo Schatten, überall pralle Sonne.
Im letzten Sommer hatten sie den Zaun immer wieder flicken müssen, notdürftig, weil kein Geld für einen neuen da war. Beinah jede Woche hatten sie nach Kühen suchen müssen, die ausgerissen waren und sich dann verlaufen hatten. Dabei wuchs ihnen die Arbeit sowieso schon über den Kopf. Auf solche Zwischenfälle konnten sie verzichten.
Die meisten der alten Pfähle waren morsch gewesen. Sie hatten sie entfernt und beim Hof gelagert. Immerhin konnten sie sie wenigstens noch als Brennholz benutzen. Das Holz war teuer geworden. Das ganze Leben war teuer geworden. Man sah es an dem erbärmlichen Zustand des Hauses. Feuchte Wände, ein schadhaftes Dach und tausend andere Stellen, die dringend renoviert werden mussten.
Marlon liebte körperliche Arbeit. Sie war ein guter Ausgleich zu den Stunden in der Schule und zu Hause am Schreibtisch und tat ihm gut. Sein Körper war daran gewöhnt. Es machte ihm nicht viel aus, dass solche Arbeit nicht mehr sehr angesehen war. Bauern wurden immer gebraucht. Ohne Getreide kein Brot und kein Kuchen. Die Menschen tranken weiterhin Milch, aßen Eier, Fleisch und Gemüse. Und trotzdem sahen sie verächtlich auf die Bauern herab, die ihre Grundnahrungsmittel produzierten.
Marlon war bis an den Traktor herangekommen und sein Vater wartete, bis er eine Reihe neuer Pfähle vom Anhänger abgeladen hatte, dann tuckerte er mit dem Traktor ein paar Meter weiter.
Sie unterhielten sich kaum. Hin und wieder ein Wort, knapp, nur das Notwendigste. Marlon war es recht. Er misstraute den Plapperern, die das Herz auf der Zunge trugen. Bei Licht besehen, verloren viele Worte an Gewicht.
Der Schweiß lief ihm über Stirn, Schläfen und Kinn, tropfte auf seine Stiefel. Das Hemd klebte ihm am Körper. Fliegen umsurrten seinen Kopf. Er schlug nach ihnen, vertrieb sie alle paar Sekunden. Ohne Erfolg. Von Jahr zu Jahr wurden sie aggressiver. Neuerdings gab es welche, die richtig bissen. Die Bisse – oder waren es Stiche? – schwollen übel an. Tagelang war die Haut heiß und gerötet und nicht einmal Essigumschläge verschafften Erleichterung. Selbst Marlon, der nicht zu Allergien neigte, hatte nach einem solchen Biss unterhalb des Knöchels neulich einen Tag lang mit hohem Fieber im Bett gelegen.
Er nahm die Kappe ab, wedelte sich ein wenig Luft zu und setzte sie wieder auf. Noch eine Stunde, dann würden sie zum Kaffeetrinken fahren. Seine Mutter hatte Rosinenbrot gebacken. Schon am Morgen war der Duft durch das Haus gezogen. Die Mutter machte nahezu alles selbst, um zu sparen. Und das Ersparte ging sofort wieder drauf. Heute war es der neue Zaun, morgen ein Ersatzteil für eine der Maschinen. Sie konnten die Löcher gar nicht so schnell stopfen, wie sie entstanden.
Marlon holte aus und schlug, holte aus und schlug. Pfahl für Pfahl trieb er in die Erde. Wenn er Glück hatte, würde es heute vielleicht noch für ein, zwei Stunden am Schreibtisch reichen.
Er hatte große Pläne, aber die konnte er nur in die Tat umsetzen, wenn er dafür lernte. Mehr als die andern, denn er hatte weniger Zeit.
Und plötzlich hatte er es eilig, mit der Arbeit voranzukommen. Er steigerte sein Tempo, holte mit dem Hammer aus und schlug und schlug, bis er die Muskeln in seinen Armen nicht mehr spürte.
In dem Moment, als Jana meinte, es keine Sekunde länger aushalten zu können, genau in diesem Augenblick senkte La Lune die Arme und legte Mara die Hände auf die Schultern.
Zitterte Mara? Schwankte sie nicht sogar ein wenig?
»Du bist in die Irre gegangen«, sagte La Lune sanft.
Der Klang ihrer Stimme war das Zeichen.
Jana hob den Kopf. Vor, neben und hinter ihr hoben sich die anderen Köpfe. Nur Mara blieb in der Stellung, in der sie sich befand.
»Du hast dich von unseren Gesetzen entfernt«, sagte La Lune.
Jana war froh, dass die Stille durchbrochen wurde. Gleichzeitig empfand sie ein tiefes Gefühl der Scham, denn La Lune würde Mara bestrafen. Es gab keinen Grund, froh zu sein, wahrhaftig nicht.
Das Ausmaß der Strafe hing von vielen Dingen ab. Vom Gesetzbuch. Vom Stand der Gestirne. Von der Stimmung La Lunes. Und von der Stimmung der Mitglieder des engsten Kreises.
La Lune hatte sich mit ihnen beraten. Diese Beratungen fanden meistens in der Nacht statt. La Lune hieß nicht umsonst La Lune. Der Mond war die Quelle ihrer Weisheit, ihrer Inspiration.
»Bist du dir dessen bewusst?«, fragte La Lune.
Mara durfte sich jetzt aufrichten, durfte La Lune ansehen und ihr antworten. Aber sie durfte sich nicht erheben, noch nicht.
»Ja«, sagte sie.
Sie sagte es leise, flüsterte es beinah.
La Lune runzelte die Stirn, aber nur kurz, dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus, dieses verständnisvolle, gütige Lächeln, für das man sie einfach lieben musste. Ein Lächeln, von dem man sich, nachdem es einmal einem selbst gegolten hatte, wünschte, es würde niemals mehr aufhören.
Mara begann zu weinen. Man konnte ihre Tränen nicht sehen, weil sie der Versammlung den Rücken zugewandt hatte. Aber Jana wusste, dass Mara weinte. Sie waren Freundinnen. Niemanden kannte Jana besser als Mara. Es war, als könnte sie Maras Tränen in der Kehle spüren.
Sie widerstand dem Impuls, zu ihr zu laufen und sie in die Arme zu nehmen. Das würde nur die eigene Bestrafung nach sich ziehen. Niemandem wäre damit geholfen, schon gar nicht Mara. Im Gegenteil – ihre Strafe würde nur umso härter ausfallen.
»Was muss ein Kind des Mondes tun, das sich von den Gesetzen entfernt hat?«, fragte La Lune mit ihrem verstehenden Lächeln.
Sie sah wunderschön aus. Die Sonne spielte auf ihrem schwarzen Haar und ihrem ebenmäßigen Gesicht. Das weiße Gewand floss an ihrem Körper herab. Auf dem Ring an ihrer linken Hand glomm der große Mondstein.
»Bereuen«, sagte Mara.
»Und was ermöglicht die Reue?«, fragte La Lune.
»Die Bestrafung«, sagte Mara.
Es lief Jana kalt über den Rücken. Das war nicht Maras Stimme. Das war die Stimme einer Schlafwandlerin, schleppend, fern, gar nicht bei sich.
Die Mitglieder des engsten Kreises erhoben sich, traten auf La Lune zu und bildeten einen Halbkreis um sie. Auch sie trugen weiße Gewänder. Das Gewand La Lunes jedoch war von Goldfäden durchwirkt, das der Mitglieder des engsten Kreises von Silberfäden.
»Ich werde dir jetzt deine Strafe verkünden«, sagte La Lune. »Bist du bereit?«
»Ja«, sagte Mara mit dieser sonderbar fremden Stimme.
»Du wirst für dreißig Tage ins Strafhaus verbannt«, sagte La Lune. »Nutze die Zeit.«
Mara sackte in sich zusammen. Jetzt konnte man hören, dass sie weinte.
Jana spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Sie atmete flach, ihre Fingernägel gruben sich in ihre Oberarme. Dreißig Tage! Ein ganzer Monat!
Man konnte eine Welle der Unruhe spüren.
Das Ritual war noch nicht zu Ende. Mara musste sich für die Strafe bedanken.
La Lune sah auf sie hinab. In ihr Lächeln hatte sich Traurigkeit gemischt. Es fiel ihr nicht leicht zu strafen, das sagte sie immer wieder. Jedes Mal sei es, als schnitte ihr etwas ins Herz.
Mara richtete sich auf.
»Ich danke dir, La Lune, und der Mondheit«, sagte sie.
Zwei Gesetzesfrauen traten an sie heran, fassten sie an den Armen und führten sie hinaus. Ihre roten Gewänder glühten im Sonnenlicht.
Als sie Mara hinausführten, suchte sie meinen Blick. Ihre Augen waren voller Tränen. Ich weiß nicht, ob sie mich wirklich gesehen hat.
Hätte ich ihr nur ein Wort sagen können!
Dreißig Tage ohne Mara. Dreißig Tage ohne die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen.
La Lune ist die Güte.
La Lune ist das Verständnis.
La Lune ist unser Leben.
Ich darf nicht zweifeln.
Die Gesetzesfrauen sprachen kein Wort, auf dem ganzen Weg nicht. Sie hatten Mara losgelassen, gingen jedoch dicht neben ihr, Karen rechts, Elsbeth links. Ein Fluchtversuch war undenkbar.
Wohin hätte Mara auch fliehen können? Beinah das ganze Dorf gehörte den Kindern des Mondes und in den wenigen Häusern, die noch von den ursprünglichen Dorfbewohnern bewohnt wurden, wäre sie nicht willkommen gewesen.
Jeder, der versucht hatte, die Gemeinschaft zu verlassen, war wieder zurückgebracht worden. Die Strafe, die auf einen Fluchtversuch folgte, war wesentlich härter als das Strafhaus. Mara hatte welche nach ihrer Bestrafung gesehen. Gebrochene Menschen. Sie hatte sie nicht wieder erkannt.
Vorm Kinderhaus spielten die Kinder, ein fröhliches Gewimmel von orangefarbenen Hosen, Röcken und Pullis. Die Kinderfrauen saßen im Schatten eines Kastanienbaums und beaufsichtigten ihre Schützlinge.
Die Kinder sind unser kostbarster Besitz. Die Kinder sind unsere Zukunft. Die Kinder sind die Strahlen des Mondes.
Auch Mara war einmal ein Kind gewesen. Sie hatte nur wenige Erinnerungen daran. Erinnerungen führten fort von der Gegenwart. Sie waren nicht auf die Zukunft gerichtet. Erinnerungen konnten gefährlich sein. Besonders für die Älteren. Es gab welche, die ein Leben vor La Lune gehabt hatten.
Der Weg zum Strafhaus war viel zu kurz. Die Sonne brannte von einem ganz und gar blauen Himmel. Mara hob den Kopf und sah nach oben. Wieder kamen ihr die Tränen, diesmal von der blendenden Helligkeit. Die Vögel zwitscherten. Von weitem konnte Mara ein Hämmern hören und das Tuckern eines Traktors. Sie sog die Geräusche und den Duft des Sommers in sich ein. Das würde sie nun lange nicht mehr können.
Marlons Mutter hatte das Rosinenbrot in dicke Scheiben geschnitten und sie in den Brotkorb gelegt. Sie hatte Butter, Quark und Hagebuttengelee auf den Tisch gestellt und schenkte nun den Kaffee ein.
Marlon rieb sich die schmerzenden Hände. Er hatte Handschuhe benutzt, so waren ihm wenigstens Blasen erspart geblieben. Sein Vater las Zeitung. Die Zwillinge machten sich über das Brot her. Sie pulten die Rosinen heraus, die sie seit neuestem nicht mehr mochten, schichteten sie vor ihren Tellern zu kleinen Häufchen.
Greta und Marlene waren wie eine Person mit zwei Körpern. Sie teilten alles miteinander, einschließlich ihrer Vorlieben und Abneigungen. Für Außenstehende waren sie nicht zu unterscheiden, selbst ihre Stimmen hatten denselben Klang, ein Vorteil, den sie in der Schule hemmungslos ausnutzten. Sie zogen sich nie gleich an, aber sie tauschten oft ihre Kleider untereinander aus. Und so war es mit den Jahren nicht leichter geworden, sie auseinander zu halten, eher schwerer.
Trotzdem hatte Marlon niemals Probleme damit gehabt. Er hätte nicht erklären können, wie er die beiden unterschied. Er wusste ganz einfach, wen er gerade vor sich hatte. Auch die Eltern verwechselten die Zwillinge nie. Deshalb gab es kein Versteckspiel innerhalb der Familie, keine Täuschungsmanöver.
Marlon nahm sich zuerst die Rosinen von Marlene, dann die von Greta und steckte sie in den Mund. Wie konnte man Rosinen nicht mögen?
»Ihr könntet mal ein bisschen bei der Arbeit mit anpacken«, sagte er. »Wieso renn ich mir eigentlich die Hacken ab und ihr macht euch ein gemütliches Leben?«
»Weil du der Hoferbe bist«, sagte Marlene.
»Das verpflichtet«, sagte Greta.
»Scheiß drauf«, sagte Marlon.
»Euer Bruder hat Recht«, mischte die Mutter sich ein. »Ihr könntet ruhig ein bisschen mehr Interesse für andere Dinge aufbringen als immer nur Jungs und Make-up und die neuesten Frisuren.«
Sie hatte im Garten gearbeitet. Unter ihren Fingernägeln waren schwarze Ränder. Auf ihrer Nase zeigten sich Spuren eines Sonnenbrands. Marlon betrachtete ihre kräftigen, braunen Hände und dann die Hände seiner Schwestern, hell und feingliedrig, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Zwillinge waren richtige Schmarotzer. Nahmen sich von jedem, was sie kriegen konnten, und gaben nur selten etwas zurück, hielten sich abseits, verkapselt in ihrer eingeschworenen Gemeinschaft.
»Wenn's ihm doch Spaß macht...«, sagte Marlene.
»...und uns nicht...«, ergänzte Greta.
Selbst ihre Sätze teilten sie sich mitunter. Als sie noch klein gewesen waren, hatten sie eine eigene Sprache erfunden, die sie noch ab und zu benutzten, seltsam verkürzte Sätze und kompliziert verschlüsselte Wörter, die keiner außer ihnen verstand.
Marlon nahm sich die vierte Scheibe Rosinenbrot. Er konnte essen, so viel er wollte, es setzte nicht an. Kein Wunder bei seinem Arbeitspensum. Alles, was er zu sich nahm, verwandelte sich in Muskeln. Ein Fitnessstudio hatte er nicht nötig.
»Hier steht wieder ein Artikel über die Irren drin.« Der Vater faltete verärgert die Zeitung zusammen. »Die reinste Lobeshymne. Wahrscheinlich haben sie inzwischen sogar die Leute von der Presse gekauft.«
Mit den Irren meinte er die Mitglieder der Sekte. Auch ihn hatten sie schon zu kaufen versucht. Sie wollten das Land und den Hof. Einen verführerisch hohen Preis hatten sie geboten, doch der Vater hatte ihnen die Tür vor der Nase zugeschlagen. Immer wieder machten sie Vorstöße. Aber der Vater blieb hart.
»Jeder hat seinen Preis«, hatte Heiner Eschen vom Nachbarhof neulich gesagt. Er kam abends hin und wieder vorbei, um mit dem Vater ein Bier zu trinken.
»Da würd ich meinen Arsch nicht drauf verwetten«, hatte der Vater erwidert. »Es gibt einen Preis, den kann keiner zahlen, nicht mal die da.«
So bezeichnete er sie am liebsten. Die da waren etwas ganz Unbestimmtes, etwas beruhigend Vages. Dadurch verloren sie ihre Bedrohlichkeit.
Heiner Eschen hatte das Thema gewechselt und der Vater hatte ihm ein neues Bier hingestellt.
Viele waren schwach geworden. Hatten Land verkauft, mehr Land, noch mehr Land und schließlich sogar ihren Hof. Waren in die Stadt gezogen und hatten den Kindern des Mondes im wahrsten Sinn des Wortes das Feld überlassen.
Marlon wusste, dass sein Vater nicht käuflich war. Niemals und unter keinen Umständen. Lieber würde er mitsamt seiner Familie verhungern, als denen da auch nur einen Misthaufen zu überlassen. Marlon war sich jedoch nicht sicher, ob das auch für ihn selbst galt. Hatte er einen Preis? Wenn ja, wie hoch wäre er?
Nach dem Kaffeetrinken legte sein Vater sich hin. Sein Rücken brannte, wie er sagte, und Marlon fuhr allein wieder auf die Weide hinaus, um weiter am Zaun zu arbeiten.
Von weitem sah er das Haus mit den vergitterten Fenstern und er bekam trotz der Hitze eine Gänsehaut. Strafhaus nannten sie es. Niemand im Dorf wusste, was dort vor sich ging, aber jeder hatte seine Vorstellungen davon.
Das Gebäude war im Stil aller Gebäude der Kinder des Mondes gebaut, ebenerdig, mit weichen, abgerundeten Formen. Es schmiegte sich an den Hügel wie ein großes Tier, das nicht entdeckt werden will, und war in diesem kalten, milchigen Weiß verputzt, als schiene mitten am Tag der Mond mit seinem unwirklichen Licht darauf.
Die Frauen, die darin ein und aus gingen, trugen rote Gewänder, aber es war kein heiteres Rot, es war das erschreckende Rot einer frischen, klaffenden Wunde.
Plötzlich kam Marlon die Stille des Nachmittags bedrohlich vor. Er stellte sich den ersten Pfahl zurecht und holte weit mit dem Hammer aus. Brach die lähmende Stille mit seinen Schlägen auf.
Dann, irgendwann, hörte er nur noch, wie der Hammer gleichmäßig auf das Holz traf.
Plock. Plock. Plock.
Was gingen ihn diese Verrückten an?
2
Jana entschied sich für Hose und Bluse. Das Gewand war nicht Vorschrift, obwohl einige es immerzu trugen. Nur an den Mondtagen und bei Veranstaltungen war es Pflicht, das Gewand anzuziehen.
Die Mondtage waren das, was in der Welt draußen die Sonntage waren. Die Welt draußen war eine verkehrte Welt, sagte La Lune. Eine gesetzlose Welt ohne Moral. Viele der Regeln, die man sich dort geschaffen hatte, konnten mit Phantasie und Geschick beliebig umgangen, sogar gebrochen werden.
Und die Menschen in der Welt draußen, sagte La Lune, waren verlorene Seelen. Sie betrogen einander, unterdrückten einander, schlugen sich die Köpfe ein. Die Politik, die das Zusammenleben lenken sollte, war nicht mehr als ein Zirkus der Mächtigen.
Brot und Spiele. Bestechungen. Affären. Skandale.
Es ging um nichts als das eigene Wollen.
Bei den Kindern des Mondes war eigenes Wollen undenkbar. Es gab nur einen Willen und das war der Wille der Mondheit, repräsentiert durch La Lune.
Die Mondheit war weder Mann noch Frau. Sie war eine Gottheit mit zwei Gesichtern. Ihre Statuen standen überall, ein Gesicht nach rechts gewandt, eins nach links, der Ausdruck des einen voller Güte, der des anderen abweisend und streng.
Jana beeilte sich. Sie verlor sich oft in Gedanken und war deshalb immer in Gefahr, zu spät zu kommen. Sie warf noch rasch einen Blick in den Spiegel. Die Farbe der Mädchen war blau. Nicht das zarte Blau des Himmels an einem Sommermorgen, sondern das tiefe Blau von Kornblumen. Jana war froh darüber, denn dieses Blau passte gut zu ihren Augen, die mal blau waren, mal grau. Es hing von ihren Stimmungen ab.
Heute waren sie grau.
Jana war zu eitel, das hatte La Lune ihr schon mehrmals gesagt. Sie betrachtete gern ihr Gesicht, mochte ihr Spiegelbild. Manchmal beneidete sie die Dorfmädchen, die sich kleiden durften, wie sie wollten, denen es sogar erlaubt war, sich zu schminken und das Haar kurz zu tragen.
Es gab Zwillingsschwestern im Ort, die ihr besonders gefielen. Sie waren nicht voneinander zu unterscheiden. Beide hatten blondes, streichholzkurzes Haar und dunkle Augen. Fast immer waren sie zu zweit, und schon bevor man sie sah, hörte man ihr Lachen und ihre hellen Stimmen.
Im Sommer trugen sie kurze Hosen oder Röcke, ihre langen Beine waren sonnengebräunt. Ihre Lieblingsfarbe schien Schwarz zu sein und Jana fragte sich oft, wieso die beiden sich für eine einzige Farbe entschieden (die noch nicht mal eine war), wo sie doch die Wahl hatten. Sie konnten alles tragen, Rot, Blau, Gelb, Weiß, Orange, Grün oder Pink. Sie konnten die Farben sogar mischen.
Man will immer das, was man nicht darf, dachte Jana. Es juckte ihr in den Fingern, ihr Tagebuch unter der Wäsche hervorzuziehen und zu schreiben. Aber dazu würde sie erst später Zeit haben.
Späterspäterspäter.
Sie hasste es, immer alles aufschieben zu müssen. Und da war er schon, der Gongschlag, der durch das Haus hallte. Wenn sie sich jetzt nicht beeilte, würde sie wirklich zu spät kommen und alle würden sich nach ihr umdrehen.
Mara hatte schlecht geschlafen und wirr geträumt. Im Traum war sie durch das Dorf geirrt und dann durch eine kleine Stadt. Obwohl die Sonne geschienen hatte und überall Sand lag wie in einer Wüstenstadt, hatte sie vor Kälte gezittert. Und dann hatte sie bemerkt, warum. Sie war nackt. Und überall standen Männer und starrten sie an.
In einer verlassenen Scheune fand sie ein Kleid und zog es an. Mitten im Traum wunderte sie sich darüber, dass ein so prächtiges Kleid in einer aufgegebenen, leeren Scheune hing. An einem goldenen Bügel. Es war ein Kleid, wie es die Frauen in alten Romanen auf Bällen trugen, seidig glänzend, weit ausgeschnitten, der Rock in üppige Falten drapiert. In einem staubigen Spiegel hatte sie sich betrachtet, die Arme gehoben und getanzt. Denn plötzlich war auch Musik da gewesen. Und dann, als sie sich gedreht und wieder dem Spiegel zugewandt hatte, war hinter ihrer Schulter La Lunes Gesicht aufgetaucht.
Da war sie zum ersten Mal wach geworden. Voller Angst war sie aufgeschreckt und hatte sich kaum getraut, wieder einzuschlafen.
Sie hatte den Traum weitergeträumt. War aus der Scheune gelaufen und in einen Wald gekommen. Schlangen hingen von den Bäumen wie abgeknickte Äste. Sie musste durch einen See schwimmen, um die Welt draußen zu erreichen. Aber das Kleid sog sich mit Wasser voll und zog sie in die Tiefe.
Wieder war sie entsetzt hochgefahren und wieder hatte sie den Traum weitergeträumt. Sie sank auf den Grund, konnte dort merkwürdigerweise atmen und sich bewegen, als befände sie sich gar nicht unter Wasser. Ein Dschungel, dessen grüne Arme hin und her wogten. Viele Stimmen riefen ihren Namen. Sie waren weit weg, leise, und trotzdem ganz nah.
»Ich heiße nicht Mara«, beteuerte sie. »Ich habe meinen Namen weggeworfen.«
Die Stimmen glaubten ihr nicht. Sie glaubte sich selbst nicht.
Aber La Lune glaubte ihr. Sie erschien in all dem dunklen Grün, ihr Gewand blendend weiß, nur auf den Schultern Algen wie ein Pelz, sah durch Mara hindurch, als wäre sie mit einem Mal unsichtbar geworden, drehte sich um und ging davon.
Mara war wieder aufgewacht und hatte sich im Bett aufgesetzt, um bloß nicht wieder einzuschlafen. Vielleicht wäre La Lune zurückgekehrt. Sie wünschte sich, der letzte Teil des Traums wäre Wirklichkeit. Dann wäre sie frei.
Aber die Wirklichkeit war anders. Mara befand sich im Strafhaus und würde einen langen Monat dort bleiben müssen. Ohne Jana. Ohne Gespräche mit ihr. Ohne ein Gespräch mit irgendjemandem außer den Gesetzesfrauen und die waren alles andre als gesprächig.
Die Nacht war vergangen. Mara hatte im Sitzen vor sich hin gedöst. Jetzt fühlte sie sich müde und zerschlagen. Die ersten Geräusche wurden wach. Das kalte Licht des Morgens sickerte ins Zimmer. Die Welt gehörte den Vogelstimmen, die anders klangen als am Tag, irgendwie hohl, als würden sie von irgendwem nur nachgemacht.
Vielleicht werde ich allmählich verrückt, dachte Mara. Wer sollte denn die Stimmen von Vögeln nachmachen? Sie hatte plötzlich Sehnsucht nach der Musik, die sie im Traum gehört hatte. Und nach ihrer Mutter.
Sehnsucht nach den Eltern war streng verboten. Obwohl sie ebenfalls Kinder des Mondes waren. Sehnsucht überhaupt war verboten. Bedeutete sie nicht, dass man nicht glücklich und zufrieden war? Kinder des Mondes waren aber glückliche, zufriedene Menschen.
Mara versuchte, den Traum zu vergessen. Sie wusste nicht genau, was er verriet, aber sie ahnte, dass er zu viel preisgab und das war nicht gut für sie. Solche Träume durfte sie nicht haben, Träume vom Nacktsein, von fremden Männern. Und dann das Kleid auf dem goldenen Bügel! Die Flucht!
»Ich habe nicht geträumt«, flüsterte Mara. »Ich habe nicht geträumt.«
Erschrocken sah sie nach oben, suchte im grauen Dämmerlicht Decke und Wände ab. Vielleicht konnten sie draußen hören, was sie sagte?
Ihre Augen fanden nichts Verdächtiges, aber vorsichtshalber dachte sie von jetzt an nur noch: Ich habe nicht geträumt, nicht geträumt, nicht geträumt.
Als die Gesetzesfrauen sie zum Morgengebet abholten, war sie so erleichtert, dass sie ihnen am liebsten um den Hals gefallen wäre.
Die Tür knarrte und alle Gesichter wandten sich ihr zu. Jana wurde rot und ärgerte sich darüber. Was war denn schon dabei, sich eine Minute zu verspäten? Selbst La Lune passierte das hin und wieder. Dann war sie, wie sie erklärte, von einer Inspiration aufgehalten worden. Gut, dachte Jana, hatte ich eben auch eine Inspiration. Sie hob trotzig den Kopf und ging zu ihrem Platz.
Jeden Morgen hatte sie Mühe, das Gebet zu überstehen, weil sie so hungrig war, dass ihr der Magen wehtat. Meistens sprach La Lune das Gebet. Ganz selten kam es vor, dass sie ein Kind des Mondes nach vorn bat und ihm diese Aufgabe übertrug. Es war eine Ehre, eine Belohnung, die man sich verdienen musste.
Jana hatte noch nie das Gebet gesprochen. Allerdings hatte sie auch kein Bedürfnis danach. Wenn sie in der Schule etwas vortragen musste, verhaspelte sie sich jedes Mal. Allein die erwartungsvollen Blicke machten sie nervös.
Nach dem Gebet sangen sie ein Lied, die Stimmen noch morgendünn und von Schlaf belegt, danach verließen sie das Gebetshaus und gingen in den Speisesaal.
Endlich durfte gesprochen werden und Stimmengemurmel erfüllte den riesigen Raum. La Lune saß mit den Mitgliedern des engsten Kreises an dem runden Tisch in der Mitte. Um diesen Kern herum waren strahlenförmig die langen Tische der Erwachsenen, der Jugendlichen und der Kinder angeordnet. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen saßen voneinander getrennt.
An diesem Morgen hatte Jana die Aufsicht am Tisch der Kleinen. Sie freute sich immer darauf. Wenn La Lune nicht eine andere Zukunft für sie plante, würde sie gern Kinderfrau werden und im Kinderhaus arbeiten. Vielleicht auch Lehrerin, aber im Augenblick hatte sie genug von der Schule und konnte sich nicht vorstellen, als Erwachsene dorthin zurückzukehren.
»Ich hab keinen Hunger.« Miri schob ihren Teller weg.
Eigentlich hieß sie Miriam, aber sie hatte beschlossen, ihren Namen abzukürzen, und es gab inzwischen kaum noch jemanden, der sie beim vollen Namen nannte.
»Wie wär's mit einem leckeren Honigbrot?«, versuchte Jana, sie zu locken.
»Bäh!« Miri verzog das Gesicht. »Wieso muss ich essen, wenn ich keinen Hunger hab, und wenn ich dann Hunger hab, krieg ich nichts?«
»Weil das die Regel ist«, sagte Jana ohne viel Überzeugungskraft. »Ich muss zum Beispiel auch lernen, wenn ich gerade mal keine Lust dazu habe, und habe ich später am Tag Lust zum Lernen, muss ich was anderes machen.«
»Ich hab Lust zu spielen«, sagte Miri. »Und dann hab ich vielleicht Lust zu essen. Aber vielleicht auch nicht.«
»Du wirst Hunger bekommen«, probierte Jana es noch mal. »Bis zum Mittagessen dauert es ganz lange.«
»Egal«, sagte Miri. »Jetzt ist mein Bauch noch voll jedenfalls.«
Manchmal benutzte sie die Wörter wie Bauklötze, setzte sie zusammen, wie es ihr gerade in den Kopf kam. Jana hörte ihr gern zu. Sie war überhaupt sehr gern mit Miri zusammen. Viel zu gern. Sie hütete sich davor, es jemandem zu erzählen. Die Kinder des Mondes liebten alle Menschen gleichermaßen, sie bevorzugten keinen.
»Und dann heulst du wieder, weil du was essen willst«, sagte Indra. »Du bist sowieso eine Heulsuse.«
»Bin ich nicht!«
»Bist du wohl!«
»Hört doch auf zu streiten«, sagte Jana. »Kinder des Mondes streiten nicht.«
»Tun sie wohl«, sagte Miri.
»Tun sie gar nicht«, sagte Indra.
Miri rückte ganz nah an Jana heran. »Muss ich Indra auch lieb haben?«, flüsterte sie ihr ins Ohr.
»Ja«, flüsterte Jana zurück.
»Wenn ich die aber nicht leiden kann?« Miris Atem floss wie eine kleine warme Welle an Janas Hals entlang.
»Kinder, die flüstern, lügen«, sagte Indra.
»Und Kinder auch, die nicht flüstern«, sagte Miri.
Jana tastete unter dem Tisch nach ihrer Hand und drückte sie zärtlich.
»Jetzt ess ich was«, sagte Miri.
Jana schob ihr den Brotkorb hin und sah zu, wie sie eine Scheibe Brot umständlich mit Butter bestrich und dann Honig darauf träufelte.
Drei Mahlzeiten am Tag, daran hatten sich alle zu halten. Auch die, die morgens keinen Bissen herunterbekamen. Denn sie alle waren Teile einer Gemeinschaft, keine Individuen. Zumindest sollten sie keine sein. Sie lernten, sich zurückzunehmen, ein Glied in der großen Kette der Kinder des Mondes zu werden. Und ein Glied der Kette musste haargenau so sein wie das andere, sonst wäre die Kette nicht vollkommen.
Eine Kette, dachte Jana, während sie ihren Tee trank, kann einen Hals schmücken. Eine Kette kann aber auch Hände und Füße fesseln. Unter dem Tisch spreizte sie die Beine und wackelte mit den Füßen, um sicher zu sein, dass sie sich noch bewegen konnte.
Marlon fuhr mit dem Roller zur Schule. Er hatte ihn gebraucht gekauft und wieder auf Vordermann gebracht. Stunde um Stunde hatte er daran herumgebastelt. Technische Dinge gingen ihm leicht in den Kopf, auch der Traktor und die Maschinen mussten so gut wie nie in die Werkstatt, weil Marlon sich darum kümmerte. Wenn er nicht mehr damit zurechtkam, konnte man davon ausgehen, dass auch in der Werkstatt nicht mehr viel zu machen war.
Es würde ein heißer Tag werden. Schon jetzt tanzten die Mücken und es war drückend und schwül. Marlon schwitzte unter dem Helm. Er nahm ihn ab, hängte ihn an den Lenker und ließ sich den Fahrtwind um die Nase wehen. Am liebsten wäre er immer weiter gefahren, nicht nur bis in den Nachbarort, in dem sich die Schule befand.
Er hatte bis Mitternacht über seinen Büchern gesessen. Sie würden heute eine Deutschklausur schreiben. Die Lehrerin hatte eine Kurzgeschichte von Böll angekündigt. Interpretationen waren für Marlon ein Drahtseilakt. Ohne Netz. Was ein Autor zu sagen hatte, stand doch in der Geschichte. Warum Worte dazu machen?
Nachkriegszeit.
Trümmerliteratur.
Marlon grinste, als er daran dachte, was er sich zuerst darunter vorgestellt hatte. Eine zertrümmerte Literatur, vielleicht wie die der Dadaisten, aus Lust zerstört, zerhackt, die Kapitel in großen Brocken auf dem Boden liegend, die Sätze in Scherben, die Worte in Splittern. Das würde ihm Spaß machen, hatte er gedacht, eine zertrümmerte Geschichte wieder zusammenzusetzen, so wie er einen auseinander genommenen Motor wieder zusammenbaute, Stück für Stück, ruhig und gelassen, eins nach dem anderen.
Interpretation funktionierte genau anders herum: Die Geschichte wurde zerlegt, man pickte sich Stücke heraus, drehte und wendete sie – und dann bekam Marlon sie nicht wieder zu einem Ganzen. Jedenfalls nicht zu irgendwas, mit dem seine Lehrerin zufrieden war.
Für ihn ergaben seine Gedankengänge durchaus Sinn, doch was er in der Geschichte gesehen hatte, war niemals das, was andere darin sahen. Dabei war es mit einer Geschichte doch nicht anders als mit einem Bild – es sagte jedem Betrachter etwas anderes.
Auch in Kunst hatten sie interpretiert. Stauffer hatte ein Bild an die Wand gepinnt und sie aufgefordert, es zu deuten. Marlon hatte schweigend dabeigesessen. Fasziniert hatte er den anderen zugehört und sich darüber gewundert, was sie alles entdeckten. In ihm selbst wurden nur diffuse Gefühle ausgelöst, die er nicht in Worte fassen konnte.
In der Oberstufe hatte er Fotografie gewählt. Auch dieser Kurs wurde von Stauffer geleitet. Marlon sei begabt, hatte er ihm neulich gesagt. Das Lob hatte Marlon verlegen gemacht. Er hatte schnell gelernt, mit der Kamera umzugehen, und es war ihm fast peinlich, wie einfach die Bilder zustande kamen.
Eine ganze Serie seiner Aufnahmen schmückte inzwischen den Flur zur Aula. Es waren Dorfbilder, nichts Besonderes eigentlich. Schläfrige Höfe in der Nachmittagssonne. Morgendunst auf den Weiden. Ein Baum, dessen Stamm in den Stacheldraht eines Zauns gewachsen war. Die vom Wetter gegerbten Gesichter der Dorfbewohner, ihr Lachen und ihr Ernst. Aus einiger Entfernung die Gebäude der Kinder des Mondes, die tatsächlich ebenso gut auf dem Mond hätten stehen können, bizarr und unwirklich, beinah wie geträumt.
Auf Marlons Lieblingsbild sah man im Hintergrund das Mädchen in der blauen Hose und der blauen Bluse, wie sie einen Hügel hinaufstieg.
Dieses Foto hatte Marlon eigentlich gar nicht abgeben wollen. Dann hatte er es doch getan. Weil Stauffer es schon gesehen hatte und der Meinung war, es gehöre unbedingt dazu. Für Stauffer war es nur irgendein Mädchen aus der Sekte.
Für Marlon nicht. Jedes Mal, wenn er an dem Foto vorbeiging oder wenn er auch nur daran dachte, hüpfte etwas in ihm auf. Er hatte das Mädchen oft gesehen, wenn er auf der Weide beschäftigt war, die dem Gelände der Sekte am nächsten lag. Er kannte ihren Gang und die Art, wie sie manchmal den Kopf in den Nacken legte und ihr Haar ausschüttelte, das ihr bis zu den Schulterblättern reichte. Er kannte auch ihre Stimme, hatte sie ein paar Mal gehört, wenn sie jemandem etwas zurief.
Und ihr Lachen, das ihn an den Flug eines Vogels erinnerte. Es schwang sich auf und schien hoch in der Luft zu zerplatzen. Es war häufig vorgekommen, dass Marlon sich länger auf der Weide zu schaffen gemacht hatte als nötig, nur um dieses Lachen zu hören.
Was er nicht kannte, war die Farbe ihrer Augen, aber er hätte wetten mögen, dass sie blau waren, vielleicht mit einem Stich ins Graue.
3
Nach dem Morgengebet war Mara wieder in ihr Zimmer zurückgebracht worden. Sie hatte seine Ausmaße in der vergangenen Nacht gründlich erforscht, war es unzählige Male abgegangen. Sechs Schritte von der Tür bis unter das Fenster. Fünf Schritte von der einen Wand bis zur anderen. Acht Schritte in der Diagonalen. Ein kleiner Raum ohne eine Spur von Leben darin.