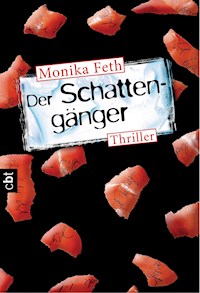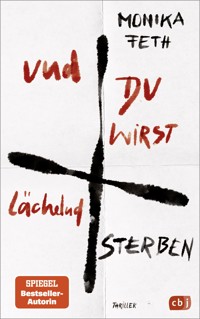8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Erdbeerpflücker-Reihe
- Sprache: Deutsch
Endlich: Der siebte Band der SPIEGEL-Bestsellerserie
Jettes Freundin Merle ist Tierschützerin mit Leib und Seele. Als sie für einen Artikel zum Thema Tierquälerei recherchiert, wird sie mit einem Fall aus ihrer Vergangenheit konfrontiert: Ein Hund, den sie einst vermittelt hatte, starb wenige Wochen später auf grausame Weise. Der neue Besitzer wurde angeklagt und aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Nun kreuzen sich ihre Wege erneut und Merle kommt einem weit gefährlicheren Geheimnis auf die Spur…
Die fulminante Spiegel-Bestsellereihe von Monika Feth begeistert Millionen Leser:innen. Die Jette-Thriller sind nervenzermürbend, dramatisch und psychologisch brilliant erzählt. Atemberaubende Spannung der Extraklasse!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
© Isabelle Grubert
Die Autorin
Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren, arbeitete nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie in der Nähe von Köln, wo sie vielfach ausgezeichnete Bücher für Leser aller Altersgruppen schreibt.
Der sensationelle Erfolg der »Erdbeerpflücker«-Thriller machte sie weit über die Grenzen des Jugendbuchs hinaus bekannt. Ihre Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Mehr über die Autorin unter:
www.monikafeth-thriller.de
www.monika-feth.de
www.facebook.com/Monika.Feth.Schriftstellerin
Weitere lieferbare Bücher bei cbt:
Die »Erdbeerpflücker«-Thriller:
Der Erdbeerpflücker (Band 1)
Der Mädchenmaler (Band 2)
Der Scherbensammler (Band 3)
Der Schattengänger (Band 4)
Der Sommerfänger (Band 5)
Der Bilderwächter (Band 6)
Die »Romy«-Thriller:
Teufelsengel (Band 1)
Spiegelschatten (Band 2)
Du auf der anderen Seite
Fee– Schwestern bleiben wir immer
Nele oder Das zweite Gesicht
Die blauen und die grauen Tage
Monika Feth
Der Libellenflüsterer
»Kann man jemanden lieben, vor dem man Angst hat?«, fragte ich.
»Du kannst Angst vor jemandem haben, den du liebst«, antwortete Merle.
Der Erdbeerpflücker
Beim Laufen stelle ich mir immer vor, hinter den Feldern sei das Meer. Weite bis zum Horizont, hier und da eine Scheune aufs Grün getupft, knorrige Obstbäume entlang der Wege, vom ständigen Wind gegen den Strich gebürstet.
Im Sommer und im Herbst kommen die Leute aus der Stadt hierher und ernten die Äpfel, Birnen und Pflaumen, die niemandem gehören und allen. Viele schlagen die Früchte brutal mit Stöcken von den Zweigen, während auf der Erde das Fallobst vergammelt, umsurrt von betrunkenen Wespen.
Doch noch war April, und das Wetter wechselte von einem Moment auf den andern, so, wie es sein muss.
Heute brauchte ich mir das Meer nicht vorzustellen, denn es umgab mich von allen Seiten. Die Felder waren kilometerweit mit durchsichtiger Folie abgedeckt, um das Reifen der Erdbeerpflanzen voranzutreiben. In regelmäßigen Abständen war sie mit Sandsäcken beschwert, um zu verhindern, dass sie davonflatterte.
Der Wind trieb Wellen in das künstliche Meer, das so intensiv im Sonnenlicht glitzerte, dass ich fast meinte, Salz auf den Lippen zu schmecken und die Schreie der Möwen hoch oben in der Luft zu hören. Er blies mir das Haar aus dem Gesicht, kühlte den Schweiß auf meiner Haut und erzeugte dieses Glücksgefühl in mir, nach dem ich süchtig geworden war. Es ließ mich so beschwingt laufen, dass meine Füße den Boden kaum zu berühren schienen.
Nach dem langen Winter freute ich mich über jeden Sonnenstrahl. Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke auf und schlug den Weg zu dem kleinen Wäldchen ein, das ich jedes Mal umrundete, ohne es je zu betreten.
Etwas daran war mir unheimlich. Es war, als würden sämtliche Geräusche in seiner Nähe verstummen. Es gab nur noch die Bäume und Sträucher, seltsam unberührt von dem Wind, der über die Felder fegte, das Geräusch meiner Schritte und mein Keuchen, das ich vergeblich zu unterdrücken versuchte.
Wie war dieser Flecken inmitten der Felder entstanden? Hatte ihn jemand angelegt? Gab es darin verborgen ein Gebäude, das man von außen nicht sehen konnte? War es ehemaliges militärisches Gebiet? Hatte man hier einen Bunker gebaut?
Aber warum gab es dann keinen Zaun? Keine Mauer? Und wieso wirkte es trotzdem so abgeschottet?
Es verschluckte den Tag und das Licht.
Sogar den Gesang der Vögel.
Schaudernd beschleunigte ich das Tempo und machte mich auf den Heimweg.
Unser Bauernhof war das schönste Haus in Birkenweiler. Ich dachte es jedes Mal, wenn ich es von Weitem erblickte. Seit wir in diesen Stadtteil Bröhls gezogen waren, hatte ich den Schritt noch keinen Tag bereut. Im Gegenteil. Hier befand sich alles, was mir wichtig war.
Ich streifte die durchgeschwitzten Sachen ab und stellte mich unter die Dusche. Während mir das Wasser auf den Kopf prasselte und über den Körper rann, spürte ich, wie sich die Nervosität, die ich beim Laufen komplett verloren hatte, leise wieder meldete.
Zehn Minuten später war ich angezogen und betrat mit feuchten Haaren Lukes Zimmer, das noch vor Kurzem Teil des Stalls gewesen war.
»Möchtest du, dass ich dich begleite?«, fragte Luke und hielt mitten in der Bewegung inne, einen schweren Umzugskarton mit Büchern vor dem Bauch. Die Sehnen an seinen Unterarmen traten von der Anstrengung hervor, und ich merkte wieder, wie sehr ich alles an ihm liebte, selbst den Schweiß auf seiner Stirn.
»Besser nicht.« Ich ließ den Blick über das Chaos wandern. »Mach lieber hier weiter.«
»Die Arbeit läuft mir nicht weg«, widersprach er. »Ich hab noch den ganzen Tag vor mir.«
Und morgen, dachte ich glücklich.
Und übermorgen.
Und überübermorgen.
Ab jetzt haben wir alle Zeit der Welt.
Ich setzte mich auf eine der an der Wand entlang gestapelten Kisten und beobachtete, wie er den Bücherkarton auf einen der übrigen wuchtete. Er richtete sich auf und rieb sich mit dem Handrücken über die Schläfe. Ein Schmutzstreifen blieb zurück.
»Das muss ich ohne dich hinkriegen.« Ich widerstand der Versuchung, zu ihm zu laufen und ihn zu küssen, ihm den hinreißenden Schmutzstreifen abzuwischen und ihn noch einmal zu küssen. »Es gibt Dinge, da muss man alleine durch.«
»Ich will ja nicht mit rein.« Luke stützte sich mit beiden Händen auf den Schreibtisch, der mitten im Zimmer stand und als Ablagefläche für alles Mögliche diente, hauptsächlich für das Werkzeug, das er benötigte, um seine Möbel aufzubauen. Er sah mich auf diese Weise an, die meine Knie weich werden ließ. »Ich will dich nur hinfahren und auf dich warten, bis du fertig bist. Und dich dann zu einem Eis einladen.«
»Wünsch mir einfach Glück«, bat ich ihn, fest entschlossen, mich nicht umstimmen zu lassen. Das hatten Merle und Mike bereits versucht. Anscheinend waren sie alle versessen darauf, den Chauffeur für mich zu spielen. Ich glitt von der Kiste und trat auf Luke zu. »Spuckst du mir mal über die Schulter?«
Er zog mich an sich und küsste mich, bevor er neben meinem Ohr dreimal leise »toitoitoi!« rief.
An der Tür drehte ich mich noch einmal um. Er stand ein wenig unschlüssig zwischen seinen Sachen, als hätte er vergessen, was er als Nächstes tun wollte.
»Du schaffst das.« Er reckte den Daumen in die Luft. »Wenn nicht du – wer dann?«
Da war ich mir gar nicht so sicher. Ich hatte Isa den Grund für meinen Besuch nicht verraten, hatte sie nur gebeten, vorbeikommen zu dürfen, um etwas mit ihr zu besprechen. Falls sie verwundert gewesen war, so hatte sie mich das nicht spüren lassen. Möglicherweise, dachte ich jetzt wieder, lacht sie sich gleich über meine Bitte tot oder wirft mich nach dem ersten Satz raus.
In der Küche saß Mike bei einem späten Frühstück. Er hatte die ganze Nacht in seiner Werkstatt gesägt und geschraubt. Mittlerweile hatte sich herumgesprochen, wie gut er arbeitete. Er hatte ein paar schöne alte Möbelstücke für einen stinkreichen Typen in Bad Godesberg restauriert. Seitdem konnte er sich über mangelnde Aufträge nicht beklagen.
»Lässt du die Uni heute dann sausen?«, fragte er.
Ich holte den Orangensaft aus dem Kühlschrank und füllte ein Glas bis zum Rand. Nachdem ich die Hälfte getrunken hatte, setzte ich mich zu Mike an den Tisch. Schwitzwasser bildete sich am Glas. Ich nahm noch einen Schluck.
»Hallo?« Mike beugte sich zu mir vor. »Jemand zu Hause?«
»Entschuldige. Was hast du gefragt?«
»Ob du heute blaumachst.«
»Nein. Nach dem Gespräch mit Isa fahr ich direkt nach Köln.«
»Nervös?«
»Tierisch.«
»Kann ich mir vorstellen.« Mike betrachtete das Brötchen in seiner großen Hand, als überlegte er, ob und wie er hineinbeißen sollte. Schließlich legte er es unverrichteter Dinge auf den Teller zurück. »Und du willst wirklich nicht …«
»Wirklich nicht.« Ich strich ihm über die Schulter, trank den Saft aus und ging in mein Zimmer, um meine Tasche zu holen.
Ich hätte jetzt gern ein paar Worte mit Merle gewechselt, aber die war längst im Tierheim. Für heute standen Impfungen an, zu denen die Tierärztin ins Heim kam, weil der Transport mehrerer Tiere einfach zu schwierig war und der einzelner Tiere zu kostspielig. Den Gedanken, sie kurz anzurufen, verwarf ich, weil ich wusste, wie sehr die Mitarbeiter an den Arzttagen rotierten.
Die Sonne verausgabte sich, und der Himmel war zum ersten Mal so blau, dass man fast schon den Frühling riechen konnte. Erwartungsvoll stieg ich in meinen Peugeot. Ich hatte große Lust, mit offenem Verdeck zu fahren, doch dazu war es noch zu kalt. Stattdessen machte ich das Fenster auf und drehte das Radio so laut, dass ich die Vibration der Bässe bis in die Fingerspitzen spüren konnte.
An einer Ampel versuchte ein Typ in einem Land Rover, mit mir zu flirten. Er schob sich die bombastischste Sonnenbrille ins Haar, die ich je gesehen hatte, kniff die Augen zusammen und schickte mir ein Lächeln rüber, das womöglich auf Frauen wirkte, die auf fette Autos standen. Mich ließ es kalt, und als die Ampel auf Grün sprang, schoss sein Wagen beleidigt davon.
Mein Handy klingelte. Ein Blick auf das Display zeigte mir, dass meine Mutter versuchte, mich zu erreichen. Sie rief fast jeden Morgen an, um mir einen schönen Tag zu wünschen. Ich hatte beschlossen, diese Angewohnheit nicht als Einmischung in mein Leben zu betrachten, sondern einfach als freundliche Geste.
Doch jetzt konnte ich das Gespräch unmöglich annehmen. Ich würde mich verplappern und sie würde mich von meinem Vorhaben abbringen wollen. Es war besser, das Treffen mit Isa abzuwarten, bevor ich mich unter die Argusaugen meiner Mutter traute, die offenbar die Fähigkeit besaß, mich selbst durchs Telefon zu beobachten.
Ich fand eine Lücke auf dem Parkstreifen vor dem Polizeigebäude, atmete tief durch und stieg aus. Isa wartete vor der Tür auf mich, wie sie es versprochen hatte. Sie lotste mich an dem telefonierenden Beamten in der Halle vorbei und führte mich über einen schwarzen Fliesenboden, der glänzte wie ein unbewegter See in der Unterwelt.
»Fahrstuhl oder Treppe?«, fragte sie. »Mein Büro ist ganz oben.«
Das waren sechs oder sieben Stockwerke, wenn ich draußen richtig hingeguckt hatte.
»Treppe.«
»Prima.« Sie wirkte erleichtert. »Dieses ewige Sitzen ist die Hölle.«
Sie nahm die Stufen locker. Erst in der dritten Etage beschleunigte sich ihr Atem ein wenig, aber sie konnte sich immer noch mit mir unterhalten, ohne nach Luft zu schnappen.
»Sie machen Sport, stimmt’s?« Prüfend musterte sie mich.
»Ja. Ich laufe.«
»Ich auch.« Sie nickte mir anerkennend zu. »Schon immer?«
»Absolut nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich damit angefangen habe. Irgendwann hab ich es ausprobiert und jetzt bin ich davon abhängig.«
»Kenn ich. Wenn ich nicht zum Laufen komme, bin ich ungenießbar. Dann hält es keiner mit mir aus.«
Wir hatten den obersten Treppenabsatz erreicht und gingen einen Flur entlang, hinter dessen Türen man Stimmen hörte und das Klingeln von Telefonen. Niemand begegnete uns. An einem Kaffeeautomaten blieb Isa stehen.
»Kaffee, Cappuccino oder Kakao?« Sie zog zwei Münzen aus ihrer Hosentasche. »Sie haben die Wahl. Aber irgendwie schmeckt sowieso alles gleich.«
»Cappuccino, bitte.«
Isa schob zwei dunkelbraune Plastikbecher ineinander, bevor sie sie unter die Düsen stellte. »Sie sind sonst so heiß, dass man sie kaum anfassen kann«, erklärte sie. Vorsichtig balancierte sie einen Cappuccino und einen Kaffee zu der hintersten Tür und drückte mit dem Ellbogen die Klinke runter.
In ihrem Büro stellte sie die Becher auf einem weißen Schreibtisch ab. Durch das Fenster sah man auf die Straße, auf der es von Menschen wimmelte. Rechts blickte man auf ein Bürogebäude. Ein Flugzeug brummte hoch oben in der Luft und hinterließ einen weißen Streifen auf dem Stück Blau, das sich trotzig gegen schnell heranziehende Wolken behauptete.
Volle, aber aufgeräumte Regale, die vom Boden bis zur Decke reichten. Fachliteratur, wie ich sie von Tilo kannte. Zeitschriften, die auch in seinen Regalen lagen. Weiße, halbhohe Aktenschränke an der Fensterwand.
Kein Foto auf dem Schreibtisch, dafür jede Menge Unterlagen, Stifte, aufgeklappte Bücher. In einer Ecke ein runder weißer Tisch mit vier weißen Stühlen. In der Mitte des Tischs eine Vase mit einem Strauß kurzstieliger gelber Rosen.
Isa deutete auf einen der Stühle. Ich entschied mich für den Platz, von dem aus ich das Zimmer im Blick hatte. Isa holte die Kaffeebecher und zog eine Packung Kekse aus der Schreibtischschublade.
»Schokotaler aus dem Weltladen«, sagte sie. »Da könnte ich mich glatt reinlegen.«
Ein Spruch, den man im Rheinland häufig hört. Auch Merle verwendete ihn oft. Ich musste mir immer das Lachen verkneifen.
»Was kann ich für Sie tun?« Isa hob den Kaffee an die Lippen und sah mich durch den aufsteigenden Dampf hindurch aufmerksam an.
Der kümmerliche Schaum auf meinem Cappuccino sackte bereits in sich zusammen, doch als ich trank, merkte ich, dass es mir schmeckte.
Obwohl ich mir hundert Mal überlegt hatte, wie ich meine Bitte möglichst geschickt vortragen sollte, tat ich jetzt das genaue Gegenteil: Ich fiel plump mit der Tür ins Haus.
»Ich will Polizeipsychologin werden«, sagte ich ohne Vorwarnung. »Genau wie Sie. Ich studiere Psychologie, aber das reicht mir nicht. Ich möchte die Praxis kennenlernen. So schnell wie möglich.«
»Welches Semester?«
Isa wirkte nicht im Mindesten überrascht.
»Zweites.«
Ich hörte selbst, wie blöd das klingen musste. So als ob sich ein Grundschüler nach dem Abi erkundigt.
Aber Isa schien sich auch darüber nicht zu wundern. Sie musterte mich nachdenklich und nahm einen Schluck Kaffee.
Es war noch kein Jahr her, dass sie mir und Luke das Leben gerettet hatte. Sie selbst hatte sich dabei eine Kugel eingefangen und wäre beinah gestorben.
Ihr Gesicht war schmaler geworden, und ich meinte, ihm noch Spuren der Strapazen anzusehen, die sie im Krankenhaus und in der Reha hatte durchmachen müssen. Und plötzlich fand ich es unverzeihlich, dass ich ausgerechnet sie mit meiner Bitte behelligte. Ich hatte nur noch das Bedürfnis, aufzustehen und so rasch wie möglich ihr Büro zu verlassen.
»Entschuldigung. Ich hätte nicht herkommen sollen.«
Ich stellte den Cappuccino ab.
Sie betrachtete ihre Hände, die sich um den Kaffeebecher gelegt hatten, als wollten sie sich daran wärmen. Als sie wieder aufschaute, war ein Lächeln in ihren Augen und so etwas wie … Respekt.
»Für ein Praktikum ist es zu früh«, sagte sie. »Das geht ja nur in den Semesterferien. Ihr Stundenplan sieht, wie Sie wissen, so etwas auch noch gar nicht vor. Allerdings …« Ihr Zögern ließ mein Herz schneller schlagen. Meine Hände wurden feucht. »… bin ich tatsächlich gerade auf der Suche nach ein bisschen Hilfe, weil die Studentin, die bisher ab und zu für mich gearbeitet hat, an eine andere Uni gewechselt ist. Ich muss das natürlich noch mit meinem Chef abklären. Aber wären Sie an einem kleinen Job interessiert?«
Wieder hatte ich das dringende Bedürfnis, aus dem Zimmer zu stürzen.
Diesmal vor Glück.
Ich musste Merle anrufen. Luke und Mike. Und Ilka und Mina.
Mein Puls brauchte eine Weile, bis er sich beruhigt hatte, dann war ich endlich in der Lage, mit Isa über meinen neuen Job zu sprechen.
*
Merle liebte ihre Arbeit. Leidenschaftlich.
Sie hatte nie etwas anderes tun wollen, als sich um Tiere zu kümmern, die auf der Schattenseite des Lebens geboren waren. Obwohl sie das Abi wider Erwarten locker geschafft hatte, war ihr nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen, ein Studium anzufangen. Sie plante nicht gern in die Zukunft, lebte lieber im Hier und Jetzt und das mit allen Konsequenzen.
Doch so wohl sie sich bei der Arbeit im Tierheim auch fühlte – eines machte sie fertig: mit anzusehen, wenn den Tieren Schmerzen zugefügt wurden, was sich mitunter nicht vermeiden ließ.
Natürlich wusste sie, dass Impfungen notwendig waren, denn es gab Krankheiten, die Hunde und Katzen innerhalb weniger Tage dahinraffen konnten. Katzenseuche. Staupe. Oder Tollwut, die von vielen Tierhaltern noch immer unterschätzt wurde.
Die Tiere verstanden jedoch nicht, was mit ihnen passierte. Sie gerieten in Panik, versuchten verzweifelt, sich aus dem Griff der Hände zu befreien, die sie festhielten. Ihre Herzen pochten, als wollten sie zerspringen.
Merle hasste es, diejenige zu sein, die sie dieser Tortur auslieferte. Es schnürte ihr jedes Mal die Kehle zu.
Mit den Hunden waren sie rasch durch. Nun kamen die Katzen an die Reihe. Sie wehrten sich heftiger, deshalb floss bei ihrer Behandlung häufig Blut.
Diesmal erwischte es Merle. Sie fing sich einen Kratzer ein, der quer über ihren linken Handrücken lief und höllisch brannte.
Es war ausgerechnet Karlchen gewesen, der sie gekratzt hatte. Karlchen, der keiner Fliege etwas zuleide tat, der nicht mal wusste, dass es sich bei einer Maus um einen Leckerbissen handelte oder dass man Vögel auch jagen konnte, statt ihnen nur sehnsüchtig nachzuschauen.
Merle nahm es ihm nicht übel. Karlchen hatte sich längst in ihr Herz geschlichen und sogar in das der Heimleiterin.
Frau Donkas, die bei den Tieren stets eisern Distanz wahrte, hatte bei Karlchens Anblick die Segel gestrichen. Immer häufiger tauchte sie unter fadenscheinigen Gründen im Katzenhaus auf, um Sekunden später mit seligem Blick Karlchen umherzutragen.
Er war ein zierlicher roter Kater im besten Alter, der sein bisheriges Leben bei einem Schauspieler verbracht hatte, der plötzlich und unerwartet verstorben war. Merle hatte den Mann einmal im Theater am Dom auf der Bühne gesehen. Seine Stimme war ihr durch Mark und Bein gegangen. Ob er laut oder leise gesprochen, geschrien oder geflüstert hatte – sie war in jede Zelle ihres Körpers gekrochen.
Vielleicht hatte Karlchen von ihm gelernt. Selten war Merle einer Katze begegnet, die auf so vielerlei Arten sprechen konnte und die Menschen so mühelos für sich einnahm.
Die Tierärztin desinfizierte Merles Wunde und klebte ein Pflaster darauf, bevor sie weitermachten. Man durfte mit solchen Verletzungen nicht spaßen. Sie konnten sich böse entzünden.
Nach seinem Ausbruch hatte Karlchen sich beruhigt, und er sah Merle mit einem Ausdruck an, als wollte er sich für seine Grobheit entschuldigen.
»Schon gut«, murmelte sie, als sie ihn wieder in den Katzenkorb setzte. »Alles okay, mein Kleiner.«
Sie sehnte sich nach frischer Luft. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln und dem Angstschweiß der Tiere war ihr so tief in die Nase gedrungen, dass sie befürchtete, für den Rest des Tages nichts anderes mehr wahrnehmen zu können.
Die Tür wurde aufgestoßen und mit den für sie typischen energischen Schritten betrat Frau Donkas den Behandlungsraum. Sie hatte ein Gespür dafür, Augenblicke zu erwischen, in denen sie störte.
»Merle?«
Merle. Und ein langes, deutlich hörbares Fragezeichen. Nicht: Merle, hätten Sie wohl einen Moment Zeit für mich? Oder: Komme ich ungelegen, Merle? Nein. Mit Höflichkeit hielt sie sich nicht auf.
Aber sie hatte ein unerschöpfliches Herz für Tiere. Ständig war sie unterwegs, um Geld für das Heim aufzutreiben, auch wenn ihr Privatleben dabei auf der Strecke blieb.
»Ich bin gleich weg. Kommen Sie hier klar?«
Das fragst du doch sonst auch nicht, dachte Merle, während sie behutsam Marylin auf dem Behandlungstisch absetzte, eine wilde Katzenschönheit, die erst vor wenigen Wochen im Keller einer Berufsschule eingefangen worden war.
Marylin fauchte und spuckte. Um ein Haar hätte Merle sie losgelassen.
»Klar komm ich klar«, sagte sie.
Ihr Blick begegnete dem belustigten Blick der Tierärztin.
»Klar«, wiederholte die Ärztin schmunzelnd.
Merle lachte leise. Marylin unter ihren Händen entspannte sich ein wenig.
»Ich bin über Handy erreichbar«, verkündete Frau Donkas, als wäre das eine unerhörte Neuigkeit, riss die Tür auf und verschwand.
»Und nun schmeißen Sie den Laden hier ganz allein?«, fragte die Tierärztin. »Alle Achtung.«
Wie anstrengend der Tag werden würde, hing davon ab, wie lange die Impfungen noch dauern, wie viele Besucher am Nachmittag erscheinen und ob es einen Notfall geben würde oder nicht. Ann hatte sich krankgemeldet. Robbie kämpfte gegen eine Erkältung an. Kein Wunder, denn die beiden waren mittlerweile ein Paar geworden und lebten zusammen. Wenn der eine von einem Virus heimgesucht wurde, gab er es sofort an den andern weiter.
»Siehst du, Marylin.« Merle verschloss behutsam das Törchen des Katzenkorbs. »Schon passiert. War doch gar nicht so schlimm, oder?«
Die Katze, die nicht daran gewöhnt war, von Menschen berührt zu werden, starrte sie aus weiten Augen an. Merle seufzte. Das Erlebnis bedeutete einen Rückschlag. Sie würden sich Marylins Vertrauen mühsam wieder erarbeiten müssen.
Sie schaute auf die Uhr. Kurz nach zehn. Die Zeit kroch nur so dahin. Noch eine halbe Stunde, bevor sie das hier hinter sich hatte und sich anderen Arbeiten widmen konnte.
Das Diensttelefon vibrierte in ihrer Hosentasche. Sie ignorierte es, weil sie gerade den lautstark protestierenden, sich mit allen vieren sträubenden Jumper aus seinem Korb zu heben versuchte. Danach würde sie telefonieren müssen. Sie hoffte inständig, dass keine der hinterlassenen Nachrichten sie zu einem Notfall rief.
Nur das nicht, dachte sie. Nicht heute, nach diesem fürchterlichen Morgen.
Ihre Hand, die immer noch brannte, begann jetzt zu schmerzen. Ihr Magen knurrte. Der Kopf tat ihr weh. Sie lechzte nach einem Kaffee und hätte gern für ein paar Minuten Ruhe gehabt. Doch die würde sie nicht finden. Irgendwas sagte ihr, dass es nur noch schlimmer werden würde.
Sie vertrieb den Gedanken und sprach besänftigend auf den vor Angst hechelnden Jumper ein. Augenblicklich beruhigte er sich, schmiegte sich an sie und ließ die Untersuchung in ihren Armen über sich ergehen, ohne aufzumucken.
»Sie machen das fantastisch«, lobte die Tierärztin, aber Merle hörte ihre Worte nur noch von Weitem. Der Vormittag war ins Wanken geraten, ohne dass sie hätte sagen können, warum.
*
Mama hat geweint. Lo erkennt es an ihren Augen.
»Kakao?«, fragt Mama.
Lo nickt und steckt den Daumen in den Mund.
Mama gießt Milch in den kleinen Topf auf dem Herd. Sie tut das jeden Morgen. Es macht Lo ein warmes, kuschliges Gefühl, wenn sie Mama dabei zusieht.
Sogar heute.
Gerade heute.
Mama räumt Papas Teller und seine Tasse in die Spülmaschine. Die aus dem letzten Loch pfeift. Das hat Mama gestern Abend gesagt. Und dann hat sie Papa vorsichtig gefragt, ob sie nicht eine neue kaufen können.
»Hast du sie noch alle?«, hat Papa sie angeschrien. »Glaubst du, ich drucke das Geld im Keller?«
Mama hat ihm ein zweites Stück Fleisch auf den Teller gelegt und sich über ihren eigenen Teller geduckt.
»Ob du das glaubst?«, hat Papa gebrüllt.
»Nein«, hat Mama gesagt. »Entschuldige. Das war dumm von mir.«
Papa hat seinen Teller leer gegessen und mit Brot die Soße aufgetunkt. Dann hat er Mama lange angeguckt.
Lo hat sich nicht getraut, den Daumen in den Mund zu schieben. Sie hat Angst gehabt, Papa würde ihn wieder mit Senf bestreichen.
»Wozu hast du einen Kopf auf dem Hals, wenn du ihn nicht zum Denken benutzt?«
»Es tut mir leid …«
»So«, hat Papa mit gefährlich leiser Stimme gesagt. »Es tut dir leid, ja?«
Er hat sein Glas leer getrunken und sich neuen Wein eingeschüttet. Sein Arm hat Teller und Schüsseln vom Tisch gewischt. Mit einem lauten Knall ist alles in Scherben gegangen und durch die Küche gespritzt.
Papa hat auf die Scherben, Fleischstücke, Kartoffeln und Blumenkohlröschen gezeigt.
»Mach das weg!«
Da ist Lo längst schon unsichtbar gewesen.
Keiner konnte sie finden.
Keiner berühren.
Keiner ihr wehtun …
Sie hat sich auf ihr Bett verkrochen und von unten die Fernsehgeräusche aus dem Wohnzimmer gehört. Hat Amanda ganz fest an sich gedrückt.
Irgendwann in der Nacht ist sie wach geworden.
Von Papas Schreien.
Mamas Weinen.
Den Geräuschen …
»Hier. Dein Kakao.«
Mama streicht ihr übers Haar. Sie setzt sich zu ihr an den Tisch. Trinkt von ihrem Kaffee. Lächelt.
Lo hält Amanda auf dem Schoß. Früher konnte Amanda Mama sagen. Aber ihre Puppenstimme ist kaputtgegangen.
Genau wie Los Stimme.
Weg. Einfach weg.
Nur die Wörter sind noch da. Fest verschlossen in ihrem Kopf.
Ich hatte das Polizeigebäude gerade verlassen, als mein Handy sich meldete. Es war Zarah, eine Studentin, mit der ich die Vorlesung Sozialpsychologie I bei Professor Staplak besuchte.
»Die Vorlesung ist auf ein Uhr verschoben worden«, erzählte sie mir. »Ich bin auf dem Weg in die Cafeteria. Treffen wir uns da?«
Vielleicht war das ein Wink des Schicksals, denn jetzt hatte ich Zeit genug, um bei meiner Mutter vorbeizufahren. Wenn man schon eine unbequeme Nachricht zu überbringen hat, dachte ich, dann lieber so rasch wie möglich.
»Du, ich würd gern lieber was erledigen«, antwortete ich. »Können wir uns später zusammensetzen?«
»Sorry. Heute bin ich sonst den ganzen Tag verplant«, sagte Zarah und beendete das Gespräch.
Ihre Enttäuschung war nicht zu überhören gewesen, aber ich konnte es nicht ändern. Ich musste endlich Schluss damit machen, ständig everybody’s darling sein zu wollen. Dadurch stand ich mir nur selbst auf den Füßen.
Auf der Fahrt zu der alten Mühle, in der meine Mutter mit Tilo lebte, überfielen mich Zweifel, und ich überlegte, ob ich ihr den Job bei Isa nicht besser verschweigen sollte. Eigentlich ging er sie ja auch gar nichts an.
Keine Chance.
Dann nämlich würde Isa garantiert bei irgendeiner Psychologentagung Tilo über den Weg laufen, und was daraus werden würde, konnte ich mir lebhaft vorstellen.
Im Dorf kamen mir die ersten Saisonarbeiter auf ihren Fahrrädern entgegen. Bis zur Erntezeit war es noch eine Weile hin, aber der Erdbeerbauer brauchte schon jetzt, bei den vorbereitenden Arbeiten, Unterstützung.
Das Geschäft schien zu boomen. Es wurden immer größere Flächen bepflanzt und die Zahl der Erntehelfer wuchs von Jahr zu Jahr.
Sie kamen hauptsächlich aus Rumänien und blieben bis zum späten Herbst. Dann kehrten sie in vollbepackten Bussen und Autos wieder zu ihren Familien zurück. Auf den Dächern der Fahrzeuge waren Sofas, Sessel und Schränke notdürftig festgeschnallt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurden.
Die Natur begann in sämtlichen Farben zu explodieren. Die Bäume waren in weißen und rosafarbenen Tüll gehüllt und ließen selbst die strengen, dunklen Häuser heiter wirken.
Ich wusste nicht, warum ich den Weg durch das Dorf gewählt hatte. Wahrscheinlich, weil es mir immer fremd geblieben war. Ich war hier nicht aufgewachsen und hatte nicht lange genug in seiner Nähe gelebt, um mich inmitten seiner Bewohner heimisch zu fühlen. Immer wieder suchte ich in mir so etwas wie ein Zugehörigkeitsgefühl, doch es wollte und wollte sich nicht einstellen.
Als ich in die lange gewundene Auffahrt einbog und auf die Mühle zufuhr, ging mir jedoch das Herz auf. Ich liebte den Anblick dieses schönen alten Gebäudes, das meine Mutter so hingebungsvoll hatte restaurieren lassen, selbst wenn sie des Guten hier und da zu viel getan hatte und manches mir zu prunkvoll erschien.
Edgar und Molly kamen angerannt, kaum dass meine Füße im weißen Kies versunken waren. Sie strichen mir um die Beine, die Schwänze steil in die Luft gestreckt, und schnurrten wie kleine Rasenmäher um die Wette.
»Kommt ihr mit rein?«, fragte ich. Doch da waren sie schon wieder weg, auf Mäuse-, Vogel- oder Maulwurfsjagd. Das Land hier war für sie wie ein gedeckter Tisch.
Ich störte meine Mutter beim Schreiben, das erkannte ich auf den ersten Blick. Sie hatte sich die rote Lesebrille ins Haar geschoben und betrachtete mich eine Weile zerstreut, bevor sie die Tür weiter aufmachte, um mich einzulassen.
»Jette!«, sagte sie überrascht und mit einer kleinen Verzögerung, als hätte sie mich eben erst erkannt. Ihr Lächeln brauchte noch länger. Offenbar hatte mein unerwartetes Erscheinen sie aus dem Konzept gebracht.
Ich küsste sie auf die Wange.
»Komme ich sehr ungelegen?«
»Nein, nein. Ganz und gar nicht«, behauptete sie, doch ihr Gesichtsausdruck strafte ihre Worte Lügen. »Ich freu mich ja, dass ich dich überhaupt mal wieder sehen darf.«
»Wir telefonieren ständig, Mama.«
»Das ist nicht dasselbe.«
Sie ging in die Küche und ich folgte ihr. Der kurze Schlagabtausch hatte mich wieder in meine Rolle als Tochter verwiesen, und fast bereute ich schon, überhaupt hierhergekommen zu sein.
An der Garderobe hing eine von Tilos Jacken und auf dem Küchentisch lag ein Buch über KlinischePsychologie. Abgesehen davon deutete nichts darauf hin, dass auch er hier lebte. Er war ein ruhiger, zurückhaltender Mann, dem es nichts auszumachen schien, meine Mutter die erste Geige spielen zu lassen.
Meinem Vater war das nicht gelungen. Als erfolgreicher Steuerberater, der von seinen weiblichen Angestellten und den Klientinnen angehimmelt wurde, war er daran gewöhnt gewesen, selbst im Mittelpunkt zu stehen.
Doch dann hatte meine Mutter angefangen, Krimis zu schreiben. Sie wurde berühmt und er hatte nicht das Zeug zum Prinzgemahl. Er schwängerte seine Sekretärin und verschwand aus meinem Leben, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.
»Möchtest du was trinken?«, fragte meine Mutter.
»Ein Wasser.«
Sie reichte mir die Flasche und nahm zwei Gläser aus dem Schrank. Alles war sauber und aufgeräumt. Die neue Putzfrau schien eine Rakete zu sein. Meine Mutter sang ihr Loblied von früh bis spät.
Wir setzten uns in den Wintergarten, der die Wärme der Sonne gespeichert hatte und einem das Gefühl gab, es sei mindestens schon Juni. Meine Mutter streifte die Schuhe ab und zog die Beine an. Sie trug eine weite schwarze Hose aus einem weichen Wollstoff und über dem schwarzen Top ein sandfarbenes Baumwollsakko. Um den Hals hatte sie sich einen hauchdünnen schwarzen Leinenschal geschlungen, unter dem eine schwere dunkelrote Korallenkette hervorblitzte.
»Gut siehst du aus«, sagte ich.
Was untertrieben war. Sie strahlte regelrecht.
Mit einer Handbewegung tat sie mein Kompliment ab. Ich war in ihr Heiligtum eingedrungen, ihre morgendliche Schreibklausur. Sie hatte nur einen Gedanken – so rasch wie möglich wieder an den Computer zu kommen.
»Was führt dich zu mir?«, fragte sie, als wär ich nicht ihre Tochter, sondern irgendwer, der gleich sein Anliegen vortragen würde.
Seltsamerweise verletzte mich das nicht. Es verblüffte mich nur.
Glückwunsch, dachte ich. Du wirst erwachsen, Prinzessin.
»Eine Vorlesung ist verschoben worden«, erklärte ich, als wär das allein Grund genug, unangemeldet hier reinzuschneien.
»Ach …«
Viel länger würde ich den wirklichen Grund für meinen Besuch nicht hinausschieben können, also brachte ich es besser gleich hinter mich.
»Ich hab einen Job angenommen.«
»Einen Job?« Sie zog die Stirn in Falten und sah selbst damit noch hinreißend aus. »Wozu? Wenn du mehr Geld brauchst, ist das kein Problem, das weißt du doch.«
Ein schmerzlicher Zug hatte sich auf ihr Gesicht gelegt. Sie empfand es noch immer als Kränkung, dass ich nur so viel Geld von ihr annahm, wie ich unbedingt zum Leben brauchte.
»Es ist ein Problem. Wir haben oft genug darüber gesprochen, Mama.«
»Was willst du dir mit deiner … Unabhängigkeit beweisen, Jette? Und mir?«
Sie hatte nichts begriffen.
»Ich will keinem etwas beweisen«, sagte ich.
Es war ja nur ein Hauch von Unabhängigkeit, und doch war sie mein Schutzschild gegen die Dominanz meiner Mutter, gegen ihre übertriebene Fürsorglichkeit – und gegen ihren Reichtum, vor dem alle in die Knie gehen mochten, aber nicht ich.
»Du solltest deine Energie in dein Studium stecken und die Zeit nicht mit einem unnützen Job verplempern.«
Es war die Art, wie sie das Wort Job betonte, die mich aufbrachte. Es waren das unnütz und das verplempern. Und das dusolltest. Es war die durch nichts zu erschütternde Sicherheit, mit der sie über mich und mein Leben urteilte.
»Willst du denn gar nicht wissen, für wen ich arbeiten werde?«
»Für deinen Vater wahrscheinlich.« Sie setzte sich gerade hin und zupfte eine unsichtbare Fluse von ihrer Hose. Dann blickte sie in den blühenden Garten hinaus, wahrscheinlich, um nicht mich anschauen zu müssen.
Das sah ihr ähnlich, dass sie mir nicht mal zutraute, allein einen Job an Land zu ziehen. Ich trank mein Wasser aus und stellte das Glas so behutsam wie möglich auf dem Tisch ab, weil ich es am liebsten durch die spiegelblanke Glasfront des Wintergartens geschmettert hätte.
»Nein. Ich werde für Isa arbeiten.«
Sie fuhr zu mir herum. »Wie bitte?«
»Nur Studium reicht mir nicht. Ich will die Praxis kennenlernen.«
»Bei der Polizei?«
Ich nickte. Sie so erregt zu sehen, machte mich sonderbar ruhig.
»Wenn du Einblick in die Praxis eines Psychologen willst, hättest du Tilo fragen können.«
»Ich schlage aber eine ganz andere Richtung ein als Tilo.«
»Hör auf, in Rätseln zu sprechen, Jette.«
Da war er wieder, dieser Unterton, den ich so hasste. Bei dem ich mich wieder fühlte wie damals, als ich an der Hand meiner Mutter zum Kindergarten ging. Wo ich nicht hinwollte. Doch es hatte nichts genützt, mich zu sträuben. Ihre Hand hatte mich unerbittlich zur Tür dirigiert.
»Ich werde Polizeipsychologin.«
Zuerst saß sie da wie erstarrt. Dann nahm sie die Brille aus dem Haar, klappte die Bügel zusammen und legte sie auf den Tisch. Sie sah mir in die Augen.
»Warum tust du mir das an, Jette?«
Ihre Theatralik gab mir den Rest. Ich musste mich dazu zwingen, sitzen zu bleiben.
»Das hat nichts mit dir zu tun, Mama.«
»Warum, Jette? Was willst du mir damit heimzahlen, dass du die Gefahr förmlich suchst?«
Sie betrachtete sich als Nabel meiner Welt. Noch immer. Doch das war sie schon lange nicht mehr.
»Du stellst die falschen Fragen«, sagte ich. Enttäuscht. Müde. Ich hatte es so satt, immer wieder von meiner Mutter in die Enge getrieben zu werden.
Kopfschüttelnd saß sie da und ihre Finger schoben die Brille auf dem Tisch hin und her. Endlich hob sie den Kopf. »Und welche Frage wäre die richtige?«
»Eine, die mit mir zu tun hat, nicht mit dir.«
»Anscheinend bin ich als Mutter eine absolute Fehlbesetzung.«
Ihre Wehleidigkeit war mehr, als ich ertragen konnte. Ich stand auf, schnappte mir meine Tasche und ging zur Tür. Offenbar hatte ich für dieses Gespräch den ungeeignetsten Augenblick von allen gewählt. Mein Fehler.
»Wir können ja später noch mal drüber reden«, sagte ich. »Jetzt muss ich los.«
Ich gab meiner Mutter keinen versöhnlichen Kuss und spürte ihren Blick im Nacken, bis ich von der Auffahrt abgebogen war. Erst da bekam ich wieder Luft. Ich fuhr die Seitenfenster runter, damit der Wind mir das Haar zerzausen und den Kopf durchlüften konnte.
Trat aufs Gaspedal.
Ich hatte den Anfang gemacht. Jetzt vertraute ich auf Tilo. Er kannte meine Mutter. Er kannte mich. Er kannte das Problem. Vielleicht würde es ihm gelingen, sie davon zu überzeugen, dass sie loslassen musste. Es war höchste Zeit, denn sonst würden wir einander verlieren.
*
Merle sichtete die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und teilte sie in Kategorien ein, die sie wiederum nach Dringlichkeit staffelte. Es gab Anfragen potenzieller Abnehmer von Tieren. Werbeangebote von Futtermittelfirmen. Hinweise auf wilde Katzen, die ein stillgelegtes Fabrikgelände mitsamt seiner Umgebung unsicher machten. Und natürlich die üblichen internen Nachrichten von Mitarbeitern anderer Tierheime, mit denen sie im regen Kontakt standen, weil immer wieder Probleme auftauchten, die mit vereinten Kräften besser gelöst werden konnten.
Ganz oben auf der Liste ihrer Notizen stand der Anruf eines Mannes, der einen offenbar ausgesetzten Hund am Pingsdorfer See meldete. Das Tier gebärde sich hochgradig aggressiv und lasse niemanden an sich heran.
Merle schlug gerade ihren Terminkalender auf, als Robbie ihr Büro betrat.
»Keiner hält sich an die Öffnungszeiten«, schimpfte er, wobei sein Akzent deutlicher zutage trat als sonst. »Kommen, wann sie wollen, und nerven so lange, bis man schließlich doch aufmacht und ihre Fragen beantwortet.«
Merle sah ihn nur an.
»Okay. Ich hätte sie einfach vorm Tor stehen lassen sollen.«
Er räumte einen Stuhl frei und setzte sich Merle gegenüber. Die Probepackungen von Hunde- und Katzensnacks lagen jetzt auf dem Boden. Ein weiterer Stolperstein in diesem Durcheinander, das Merle nicht in den Griff bekam, sosehr sie sich auch darum bemühte.
Merle mochte Robbie sehr. Er stammte aus Yorkshire, war der Liebe wegen nach Deutschland gekommen und hier hängen geblieben, obwohl sich die Sache mit der Liebe bald erledigt hatte.
Und nun war er mit Ann zusammen. Ein Glücksfall für das Tierheim und ein Glücksfall für Merle. Sie vertraute den beiden blindlings und hätte die Hand für sie ins Feuer gelegt.
»Now then«, sagte er. »Was liegt an?«
Sein Deutsch war hervorragend. Nur manchmal verhedderte er sich noch in der Satzstellung oder transportierte eine englische Redensart ins Deutsche, wo sie häufig keinen erkennbaren Sinn mehr ergab.
»Ein ausgesetzter Hund.«
»Wo?«
»Pingsdorfer See.«
Robbie runzelte die Stirn. »Schon wieder?«
Das dichte Waldgebiet der Ville-Seenkette war ideal, wenn man ein lästig gewordenes Tier loswerden wollte. Fand man die richtige Stelle, konnte es durchaus ein, zwei Tage dauern, bis es gefunden wurde.
»Er soll groß sein. Und dunkel. Mehr konnte der Finder nicht sagen. Er versteht nichts von Hunden.«
Robbie nickte ergeben. Die wenigsten Menschen waren in der Lage, Angaben zu machen, die ihnen die Arbeit erleichterten.
»Hab schon rumtelefoniert, aber es scheint so, als bliebe der Job an uns hängen.«
»Dann los.« Robbie schob den Stuhl zurück und stand auf. »Wer weiß, wie lange der arme Kerl schon auf Erbarmen wartet.«
»Erlösung«, korrigierte Merle ihn unwillkürlich.
»Sag ich doch.«
Sie hoben die große Transportbox in den alten Sprinter des Tierheims. Merle setzte sich ans Steuer und fuhr vom Hof, Robbie verschloss das Tor und schwang sich neben sie. Während der kurzen Fahrt hingen sie ihren Gedanken nach.
Fünf Minuten später bogen sie von der L194 ab und folgten dem langen Wehrbachsweg, der auf die Maiglerstraße mündete. An der Kreuzung hinter den letzten Häusern hielt Merle an und schaltete den Motor aus.
Robbie zeigte auf zwei Paare um die sechzig, die mit Rucksäcken und Nordic-Walking-Stöcken ausgestattet waren und alle die gleichen neongelben Allwetterjacken trugen. Einer der beiden Männer winkte, löste sich von der Gruppe und kam auf sie zu.
»Da sind Sie ja endlich!«
Merle beschloss, nicht auf den Vorwurf einzugehen, der in seinen Worten lag. Die Kälte hatte die Nase des Mannes bläulich verfärbt. Vielleicht war es auch der Inhalt des Flachmanns gewesen, der seine Jackentasche wölbte. Merle konnte Alkohol in seinem Atem riechen.
»Vielen Dank, dass Sie uns informiert haben«, sagte sie. »Wo genau haben Sie den Hund gefunden?«
»Die Richtung.« Er wies in den Wald. »Wir hatten kein Netz und mussten ein Stück laufen, um Sie anrufen zu können.«
»Zeigen Sie uns den Weg?«, fragte Merle.
Er nickte und stieg seufzend zu ihnen in den Wagen. Diesen Tag hatte er sich offensichtlich ganz anders vorgestellt.
Sie ließen den Wasserturmweg rechts liegen, fuhren bis zum Waldrand und folgten den Anweisungen des Mannes, der sie ohne zu zögern über die Waldwege lotste.
Der Hund empfing sie mit heiserem Bellen. Jemand hatte ihn mit einer starken Kette an einem Baum festgebunden. Weil jeder Zug an der Kette ihm die Luft abschnürte, bewegte er sich kaum. Allerdings verwandelte sich das Bellen rasch in ein grollendes Knurren aus tiefster Kehle.
Eine Mischung aus Rottweiler und Labrador, wie Merle feststellte, ein wunderschönes Tier, aber kraftlos und im Augenblick absolut unberechenbar.
»Brauchen Sie mich noch?«, fragte der Mann. »Ich würde nämlich gern mit meinen Freunden weiterlaufen.«
»Nein. Gehen Sie ruhig. Und vielen Dank noch mal für Ihre Hilfe. Das ist nicht selbstverständlich.« Merle reichte ihm die Hand. »Finden Sie allein zurück?«
»Das fragen Sie einen alten Pfadfinder?«
Er drückte Merle die Hand und machte sich in einem flotten Tempo auf den Weg.
Mittlerweile hatte Robbie die Fleischwurst aus dem Papier gewickelt, die er mitgenommen hatte. Er warf dem Hund ein Stück davon zu. Ohne ihn und Merle aus den Augen zu lassen und obwohl die Kette ihm die Luft abschnürte, stürzte das ausgehungerte Tier sich darauf und wartete gierig auf den nächsten Happen. Robbie brach ein weiteres Stück ab und warf es. Dabei sprach er leise auf den Hund ein und verfiel in seine Muttersprache.
»Come on. It’s alright. We’ll get you out of here.«
Der Hund entspannte sich ein wenig. Doch das bedeutete nicht, dass er jetzt ungefährlich war. Wachsam beobachtete er, wie Robbie Handschuhe aus der Tasche seiner Jacke zog und sie überstreifte, einen Moment innehielt und sich ihm dann Schritt für Schritt langsam näherte. Dabei warf er ein weiteres Stück Wurst.
Sie hatten verschiedene Gerätschaften im Wagen, mit deren Hilfe sie den Hund ohne Verletzungsrisiko für ihn oder sich selbst einfangen konnten. Damit würden sie ihm allerdings zusätzlich Angst bereiten. Sie würden seinen Widerstand brechen müssen und das war bei einem bereits traumatisierten Tier mehr als problematisch.
Merle hielt sich zurück und ließ Robbie machen. Anscheinend sprach der Hund auf ihn an.
»Good old boy. Look at me, I’m your friend. Don’t be afraid.«
Den Rest der Wurst nahm das Tier aus Robbies Hand. Der Bann war gebrochen.
»Du hast da echt was drauf«, sagte Merle, als sie wieder im Auto saßen und dem Labyrinth der Waldwege folgten, vorsichtig, um unnötige Erschütterungen zu vermeiden. »Respekt, mein Lieber.«
»Quatsch.« Robbie grinste verlegen. »Hab bloß meinen Job gemacht.«
»Und wie«, sagte Merle mit neidloser Bewunderung.
»Er ist ein guter Hund.« Robbie schüttelte verständnislos den Kopf. »Was bringt so einen Idioten dazu, sein Tier auszusetzen?«
»Frag mich was Leichteres.«
»Genau das sollte man mit dem Typen auch machen. Ihn im Wald an einem Baum festbinden und sich selbst überlassen. Da kann er dann in aller Ruhe über den Mist nachdenken, den er angezapft hat.«
»Verzapft«, sagte Merle.
»You know what I mean.«
In der Tat, das wusste Merle. Sie reagierte selbst oft mit Hass auf Tierquäler und solche, für die ein Tier nur eine Ware war. Nicht umsonst war sie militante Tierschützerin geworden. Die Hunde, Katzen, Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse, die sie schon aus Versuchslaboren rausgeholt hatten, konnte sie gar nicht mehr zählen. Sie war dankbar dafür, dass es immer noch Menschen gab, die bereit waren, solchen geschundenen Kreaturen ein Zuhause zu bieten.
»Irgendwann erhält auch der seine gerechte Strafe«, sagte sie.
»Das glaubst du wirklich?« Robbie stieß zornig den Atem aus. »Wie viele von denen werden denn von den Bullen gefasst?«
Zu wenige. Viel zu wenige, dachte Merle.
»Anzeige gegen Unbekannt«, murmelte Robbie, »und nach sechs Wochen wird das Verfahren eingestellt. So läuft das doch.«
»Das Leben vergisst nichts.« Sobald sie Asphalt unter den Reifen hatten, wagte Merle es, zu beschleunigen.
»Du meinst, das Leben bestraft einen für die Sünden, die man begangen hat?«
Merle nickte. Sie wollte zu gern daran glauben. Doch dann schüttelte sie den Kopf.
»Wahrscheinlich nicht«, gab sie zu. »Aber ich wollte, es wär so. Ich wollte, es gäbe eine höhere Gerechtigkeit.«
Sie brachten den Hund in einem Zwinger der Quarantänestation unter. Zuerst musste er gründlich untersucht werden, um auszuschließen, dass er unter einer ansteckenden Krankheit litt. Dann musste Merle mit der Polizei Kontakt aufnehmen und auf der Website des Tierheims eine Suche nach eventuellen Zeugen der Tat starten.
Und den Halter des Tiers ermitteln.
Der in der Regel auch der Täter war.
Seufzend griff sie nach dem Telefon. Es würde ein langer Tag werden. Hoffentlich war Jette da, wenn sie nach Hause kam. Was sie dringend brauchte, war ein langer, schöner Weiberabend mit Essen, Trinken, Reden. Und vielleicht einem guten Film.
Doch bis dahin gab es noch einiges zu tun.
*
Abel Burggraf liebte das schattige Licht und den Duft nach Erde und Laub. Die kalte, saubere Luft erfrischte ihn. Sanft gab der weiche Boden unter seinen Schritten nach. Dann und wann knackte ein Zweig, auf den er trat. Das Geräusch wurde von der tiefen Stille verschluckt, kaum dass er es wahrgenommen hatte.
Der Wald war Balsam für seine Nerven. Vielleicht würde er irgendwann die Wunden heilen können, aus denen Abel immer noch blutete.
Alles ist möglich, hatte seine Mutter ihm immer wieder eingeschärft. Du musst nur daran glauben.
Als Kind war ihm das Glauben leichtgefallen. Er hatte daran geglaubt, dass seine Eltern immer für ihn da sein würden. Dass er ihre Liebe verdient hatte und sie niemals verlieren würde. Dass ein glückliches, erfülltes Leben auf ihn wartete.
Doch dann, mit fünfzehn, hatten sie ihn abgeschoben. In ein auf schwererziehbare Jugendliche spezialisiertes Internat.
Plötzlich war er auf sich allein gestellt. Den Schülern ausgeliefert, die ihn in der Hackordnung auf den letzten Platz verwiesen. Und den Lehrern, die nicht zu bemerken schienen oder nicht bemerken wollten, was sich Tag für Tag vor ihren Augen abspielte.
Er lernte, was Willkür und Sadismus waren.
Mit einem scharfen Pfiff rief er die Hündin zurück, die sich zu weit entfernt hatte. Auch und gerade als Förster sollte er sie an der Leine führen, doch er hatte seine eigenen Ansichten darüber, wie ein Hund zu erziehen war. Die Praxis gab ihm recht. Jeder seiner Münsterländer gehorchte aufs Wort.
Abel schwor auf diese Rasse. Die Sanftmut und Treue der Tiere waren sprichwörtlich. Sie eigneten sich nicht nur für die Jagd, sondern waren außerdem absolut unproblematische Familienmitglieder.
Die Hündin war heute nervös. Sie spürte, ob es ihm gut ging oder nicht, reagierte auf die leiseste Veränderung. Manchmal war ihm das fast unheimlich. Seismografisch genau registrierte sie Nuancen in seiner Stimmung und richtete ihr Verhalten danach aus.
»Braves Mädchen«, sagte er, als sie an seine Seite zurückgekehrt war. Er tätschelte ihren Hals und sie drückte sich für einen Moment dankbar an sein Knie.
An diesem Morgen verzichtete er nicht aus Erziehungsgründen darauf, sie anzuleinen. Er hatte sich in der Nacht die rechte Hand verletzt. Bei jeder Bewegung schoss ihm ein Schmerz durch Arm und Schulter, der ihm die Tränen in die Augen trieb.
Deshalb hatte er sich einen Verband angelegt, was nicht leicht gewesen war ohne Hilfe. Er war mies gewickelt und würde sich bei der erstbesten Gelegenheit lösen. Aber Abel hatte null Bock gehabt, das Dinah tun zu lassen.
Sie würde versuchen, ihm heute aus dem Weg zu gehen, und das war gut so. Ihre verheulten Augen waren eine einzige Anklage. Selbst mit ihrer ängstlichen Schweigsamkeit versuchte sie nur, ihm die Schuld an dem Vorfall zuzuschieben.
Manchmal konnte er sie einfach nicht mehr sehen.
An der ersten Weggabelung befahl er der Hündin, sich zu setzen.
»Bleib!«
Er wandte ihr den Rücken zu und ging weiter, bis er außer Sichtweite war. Dann erst pfiff er nach ihr, und sie kam mit wehenden Ohren angerannt, nein, angeflogen.
Das Zurückbleiben war eine der schwierigsten Übungen für sie. Es hatte lange gedauert, bis sie es aushielt, ihn auch nur für eine Weile aus den Augen zu verlieren.
Sie freute sich, als wäre er Stunden fort gewesen. Es rührte ihn jedes Mal. Nie im Leben würde er auch nur einen einzigen Menschen mit einer solchen Treue finden.
Er öffnete die speckige braune Tasche, die er an einem breiten Lederriemen über der Schulter trug, und hielt sie ihr hin, damit sie Witterung aufnehmen konnte. Noch vor der Morgendämmerung war er unterwegs gewesen, um Köder zu verteilen, kleine, je mit einem Hundesnack gefüllte Stoffkissen, die er jenseits der Wege unter Laub und Zweigen versteckt hatte.
»Such!«
Sie senkte die Nase auf den Boden und benötigte nur einen Moment der Orientierung, bis sie die Spur aufgenommen hatte und ihr in den Wald hineinfolgte.
Irgendwo stieg mit lautem Flügelschlag ein Vogel auf, doch sie ließ sich davon nicht ablenken, folgte unbeirrt weiter der Spur, bis sie auf den ersten Köder stieß. Sie grub ihn aus und setzte sich, um auf ihren Herrn zu warten.
Abel belohnte sie mit dem Snack, den er aus dem Stoffkissen wickelte, und lobte sie, bevor er sie weiterschickte. Seine Anstrengungen hatten sich ausgezahlt. Sie wurde von Tag zu Tag besser.
Allmählich hob sich seine Stimmung. Er folgte der Hündin durch die Streifen goldenen Lichts, das durch die Baumkronen fiel, spürte, wie der Ärger von ihm abglitt und einer Gelassenheit Platz machte, wie er sie von früher kannte.
Hier war er. In seinem Wald. Dem einzigen Ort auf der Welt, an dem er sich lebendig fühlte. An dem er beinah so etwas empfand wie Glück.
Er hätte den Tag gern in seiner Hütte verbracht, doch für den frühen Nachmittag hatte er ein Gespräch mit einem Kollegen vereinbart, das er schlecht absagen konnte. Außerdem hatte sich jemand angemeldet, der Holz kaufen wollte.
Vor allem jedoch durfte er Dinah nicht allein lassen. Sonst kam sie noch auf den Gedanken, zum Arzt zu gehen und ihm ihr blaues Auge zu zeigen.
Grimmig ballte er die Fäuste und stöhnte auf, als der Schmerz in seiner rechten Hand wieder aufloderte.
Warum reizte sie ihn auch immer so?
Er merkte gerade, wie erneut die Wut in ihm zu rumoren begann, als die Hündin anschlug. Sie hatte den nächsten Köder gefunden.
Diesmal lobte er sie mechanisch.
Die Freude an dem Morgen war ihm abhandengekommen.
Dinah hatte es wieder einmal geschafft.
Während Kriminalhauptkommissar Bert Melzig langsam an den gut bestückten Regalen entlangging, die die Wände der drei großen Räume bis zur Decke einnahmen, versuchte er, kein Geräusch zu verursachen. Doch in dieser für alte Bibliotheken so typischen Stille übertrieb sich jeder Laut ganz von allein.
Die Gummisohlen seiner Schuhe hafteten bei jedem Schritt eine Spur zu lange auf dem schönen Holzfußboden und lösten sich widerwillig mit einem leisen Schmatzen. Der Stoff seiner Hose begleitete seine Bewegungen mit einem wispernden Rascheln. Sogar sein Atem klang ihm laut in den Ohren.
Hier lagerte das Ehrfurcht gebietende Wissen von Jahrhunderten.
Ihm wurde bewusst, dass seine Lebenszeit nicht ausreichen würde, um auch nur einen Bruchteil dessen zu lesen, was sich ihm hier bot. Und dass sein Bildungsgrad erschreckend unzulänglich war. Mit seinem lange vernachlässigten Englisch, seinem halb vergessenen Französisch und den nur noch in dürftigen Ansätzen vorhandenen Lateinkenntnissen würde er hier nicht weit kommen.
Es roch nach stockfleckigem Papier, uraltem Leder und nach dem Staub, der in schrägen Streifen von Sonnenlicht flirrte. Berts Blick spazierte über rote, braune und grüne Buchrücken mit goldenen Lettern, deren mattes Schimmern ihn magisch anzog.
Das Draußen hinter den zum Teil heruntergelassenen Rollos schien in dem Halbdunkel dieser Räume gar nicht mehr zu existieren. Man hörte keinen Verkehrslärm, keine Stimmen, kein Telefonklingeln, nicht mal den Gesang der Vögel, von denen es hier auf dem Land nur so wimmelte.
Er atmete tief ein. Es war gut, dass er es durchgezogen hatte.
Der Chef war nicht begeistert gewesen, als Bert ihm mitgeteilt hatte, dass er zwei Wochen Urlaub brauchte. Nicht nächsten Monat, nicht in einem halben Jahr, nicht irgendwann, sondern sofort. Doch nach einigem Hin und Her hatte er schließlich widerstrebend zugestimmt.
Der Grund für Berts Wunsch ging den Chef schlichtweg nichts an. Einzig Rick Holterbach gegenüber, dem jungen Kollegen, der mittlerweile sein Freund geworden war, hatte Bert das, was er vorhatte, beim Namen genannt:
Er brauchte eine Auszeit.
Und das dringend.
Diesen Teil des Plans hatte Rick nachvollziehen können. Den Rest allerdings nicht.
»In einem Kloster?«, hatte er gefragt und Bert ungläubig angestarrt. »Warum, zum Teufel, ausgerechnet in einem Kloster?«
»Ich brauche Ruhe«, hatte Bert ihm zu erklären versucht. »Keinen Lärm. Keine Hektik. Keinen Mord. Keinen Totschlag. Nur Ruhe.«
»Und was willst du da den ganzen Tag lang machen?«
»Denken«, hatte Bert entgegnet.
Denken.
Den Dingen auf die Spur kommen. Vielleicht sogar sich selbst.
»Denken«, hatte Rick mit leiser Verwunderung wiederholt, als hätte er das Wort zum ersten Mal gehört. Er hatte Bert besorgt betrachtet und nichts mehr dazu gesagt.
Und hier war Bert nun.
Im Kloster St. Paul.
Tief in der Eifel.
Kurz hatte er überlegt, ans Meer zu fahren, doch er liebte das Meer zu sehr und hatte befürchtet, es werde ihn bloß ablenken.
Er hatte sich für das Kloster St. Paul entschieden, weil es nicht eines dieser kommerzialisierten Tagungshäuser war, die längst den Kontakt zu ihrem Ursprung verloren hatten. In denen ausgebrannte Manager versuchten, wieder auf die Spur zu kommen, erfolgsverwöhnte Geschäftsfrauen ein Wellness- oder Fastenwochenende mit ihren Freundinnen verbrachten und Menschen, die von allem zu viel hatten, den nächsten Kick suchten.
Im St. Paul tickten die Uhren noch anders. Es hatte sich zwar der Welt geöffnet, war jedoch in erster Linie Kloster geblieben, in dem Benediktinermönche ihr strenges Klosterleben lebten.
Am Morgen war Bert angereist, hatte brav Handy und Laptop an der Pforte abgegeben und seine karge Zelle bezogen, die er für sich lieber Kammer nannte, um nicht an seinen Beruf erinnert zu werden, den er ebenso zurücklassen wollte wie alles andere.
Zehn Quadratmeter.
Bett, Schrank, Tisch, Stuhl und ein kleines Fenster, das zum Klostergarten hinausging. Nackter Holzfußboden, dünnes Bettzeug. Keine Wolldecke, kein Fernseher, keine Annehmlichkeiten.
Beklommen hatte er die Arme vor der Brust verschränkt und das schlichte Holzkreuz über der Tür betrachtet, an dem ein Christus hing, der ihn an Skulpturen von Barlach erinnerte.
Von den zwölf Kammern auf diesem Flur waren, wie er erfahren hatte, vier belegt. Die Bewohner mussten sich eine Toilette und ein winziges Badezimmer mit Waschbecken und Dusche teilen. Die einfachen Mahlzeiten nahmen sie gemeinsam mit den siebzehn Ordensbrüdern ein.
Schweigend.
Als Bert nach einem geeigneten Kloster Ausschau gehalten hatte, war ihm wichtig gewesen, dass er am täglichen Leben der Mönche teilnehmen durfte. Dafür hatten sich offenbar auch die übrigen Gäste entschieden.
Bruder Sebastian, der ihn bei der Ankunft in Empfang genommen hatte, war nicht sehr gesprächig gewesen. Er hatte ihm nur das Notwendigste erklärt und ihn dann mit einer Liste allein gelassen, die knapp über den Tagesablauf informierte.
5.00 Uhr: Gebet.
Kontemplation
6.30 Uhr: Frühstück
Arbeit
12.00 Uhr: Gebet
12.30 Uhr: Mittagessen
Kontemplation
Ab 15.00 Uhr: Arbeit
18.00 Uhr: Gebet
19.00 Uhr: Abendbrot
Kontemplation
24.00 Uhr: Gebet
Die Gebete finden in der Kapelle statt. Zu den Mahlzeiten treffen wir uns im Refektorium. Sie werden schweigend eingenommen. Die Einteilungen für die Arbeit werden jeweils nach dem Frühstück bekannt gegeben. Wir bitten darum, auch während der Arbeit nur das Nötigste zu sprechen.
Sobald Bert sich in seiner Kammer eingerichtet hatte, waren ihm Bedenken gekommen. Er hatte sich mit Büchern eingedeckt, die ihn plötzlich überhaupt nicht mehr interessierten. Sie stellten im Grunde lediglich die letzte Verbindung zu seinem eigentlichen Leben dar.
Die er kappen musste, um zu finden, was er hier suchte.
Doch auch das war ihm mit einem Mal gar nicht mehr klar gewesen.
Wasgenausuchteer denn?
Er hatte ausgepackt und seine Kleidung im Schrank untergebracht, in dem es nach altem Holz und einem mit Lavendel gefüllten Leinensäckchen roch, das an einem Haken innen an der Schranktür hing. Er hatte die Bücher und sein Schreibzeug auf Tisch und Fensterbank verteilt, sich ans Fenster gestellt und hinausgesehen.
Das Klostergelände war von einer hohen Sandsteinmauer umgeben. Die Beete wurden von niedrigen, schmalen Buchsbaumhecken eingefasst. Unter dem Frühlingskleid schimmerte noch der lange Winter hervor, doch die ersten Arbeiten waren bereits getan, davon zeugte nicht nur die verbeulte Schubkarre, die wartend auf einem der Wege stand, als sei sie nur kurz dort abgestellt worden.
Bert hatte einen kurzen Fluchtimpuls verspürt, hinaus aus der Enge dieses eingeschränkten Lebens, die nach seinem Hals griff und sacht zuzudrücken begann. Doch dann hatte er die Kammer verlassen und sich auf Erkundungsreise begeben. Für ihn würde das Klosterleben erst ab Mittag beginnen. Bis dahin hatte er Zeit, sich umzusehen.
Es hatte nicht lange gedauert, und er war in der Bibliothek gelandet, wo er jetzt weiter an den Regalen entlangging. Er fand die Schriften von Sokrates, Platon und Aristoteles. Eine nahezu erschlagende Vielzahl an kirchentheoretischen und philosophischen Werken sämtlicher Jahrhunderte. Die unterschiedlichsten Ausgaben der Bibel.
Die Confessiones des Augustinus. Thomas von Aquin. Immanuel Kant. Kierkegaard. So viele Namen. So viele Geheimnisse, in die er sich würde versenken können.
Falls neben den Gebeten, der Kontemplation und der Arbeit Zeit dafür blieb.
Berts Blick glitt über die einfache, zweckmäßige Einrichtung der Bibliothek. Hier und da waren Tisch und Stuhl aufgestellt worden, damit die Ordensbrüder sich in die Lektüre der Bücher vertiefen konnten. Vielleicht hatte der eine oder andere unter ihnen sogar selbst eines der Werke verfasst, die hier in den Regalen standen.
Im dritten Raum befand sich die moderne Abteilung. Auch hier fand Bert hauptsächlich philosophische und theologische Schriften. Ein alter Mönch war damit beschäftigt, Bücher einzuordnen. Er lächelte Bert kurz zu und machte mit seiner Arbeit weiter.
Wir bitten darum, auch während der Arbeit nur das Nötigste zu sprechen.
Anscheinend nahm man das Schweigegebot hier sehr ernst.
Bert war es recht. Er hätte die Stille in diesen schönen Räumen nur ungern mit Worten gestört. Sicherlich würde man sich später einander vorstellen. Bis dahin würde er, aufgehoben in der wohltuenden Ruhe dieses Gebäudes, für sich bleiben und seine Entdeckungen machen.
Er merkte jetzt schon, wie gut ihm das tat.
Andächtig strich er mit der Hand über einen Buchrücken. Dann wandte er sich ab und ging weiter. Es gab noch so vieles zu erkunden, und er war froh, dass er es allein tun konnte.
Allein sein. Denken.
Fühlen.
Mehr wollte er nicht.
*
Imke Thalheim konnte sich nicht auf das Schreiben konzentrieren. Der Besuch ihrer Tochter hatte sie rausgebracht, und sie fand den Faden nicht wieder, an dem sie gesponnen hatte, bevor Jette mit ihren Neuigkeiten hereingeplatzt war.
Sie war wütend wie lange nicht mehr.
Wie konnte eine Polizeipsychologin, die etwas von ihrem Fach verstand, Jette einen Job anbieten? Ihr Tür und Tor zu den schrecklichsten Verbrechen öffnen, sie geradezu mit der Nase auf Fälle stoßen, die Jettes verhängnisvolle Neugier wecken würden?
Denn dass es so kommen musste, war nur eine Frage der Zeit. Jette hatte sich schon mehrmals in gefährliche Situationen begeben, die sie beinah das Leben gekostet hätten. Allerdings war sie immer nur zufällig hineingeraten. Jetzt aber gab diese Isa ihr die Möglichkeit, ganz offiziell Einblick in ihre Fälle zu bekommen.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte Tilo, der zwischen zwei Terminen nach Hause gekommen war, um mit Imke ein etwas verfrühtes Mittagessen einzunehmen. Er hatte eine Vorspeisenplatte mitgebracht, üppig gefüllt mit den verführerischsten Leckerbissen, die Claudios Pizzaservice zu bieten hatte.
Merles Freund ließ es sich nicht nehmen, die Bestellungen für Imke und Tilo höchstpersönlich herzurichten, was jedoch nichts daran änderte, dass Imke ihm sein Machogehabe verübelte, mit dem er Merle sehr oft verletzte.
»Wieso nicht?«, fragte Imke und stellte Teller und Gläser auf den Tisch.
Sie deckten im Wintergarten. Das Licht der Sonne hob die grauen Fäden in Tilos Haar hervor und ließ sie wie Silber glänzen.
»Isa hat nicht umsonst einen so tadellosen Ruf in unserer Branche.« Tilo setzte die Wasserflasche ab und reichte Imke Messer, Gabeln und Servietten. »Sie wird Jette mit unverfänglichen Aufgaben betreuen und sie genau im Auge behalten.«
»Das möchte ich ihr auch raten.«
Imke nahm sich Parmaschinken, gefüllte Oliven und ein wenig gegrilltes Gemüse. Sie brach ein Stück Brot ab und aß es dazu. Nachdenklich schaute sie auf das Land, das sie zusammen mit der alten Mühle erworben hatte.
Zwanzigtausend Quadratmeter im Landschaftsschutzgebiet. Das meiste davon an einen Bauern verpachtet, der seine Schafe hier grasen ließ. Imke mochte die sanften, friedfertigen Tiere. Sie waren ein wohltuender Kontrast zu den Krimis, die sie schrieb, den Tätern und ihren Grausamkeiten, die ihr im Kopf herumspukten.
»Schau dir das an«, sagte sie und wies lächelnd nach draußen.
Hinter dem niedrigen Holzzaun, der den Garten eingrenzte, sprangen zwischen den Muttertieren die Lämmer umher. Noch waren ihre Bewegungen unbeholfen und eckig, und ihre langen, dünnen Beine wirkten furchtbar zerbrechlich. Doch von Tag zu Tag wurden sie sicherer.
Auch Tilo lächelte. Man konnte gar nicht anders.
»Ich würde am liebsten bei ihr anrufen«, gestand Imke.
»Bei Isa?«
»Ja.«
»Aber du wirst es nicht tun.« Tilo musterte sie eindringlich. »Es wäre nämlich der sicherste Weg …«
»… einen Keil zwischen Jette und mich zu treiben«, führte Imke seinen Satz fort. »Ich weiß.«
Sie waren einander mittlerweile so vertraut, dass sie sich oft in halben Sätzen unterhielten. Imke war sich nicht klar darüber, ob sie das mochte. Den andern so gut zu kennen, nahm ihm seine Geheimnisse. Und waren die nicht das Salz in der Suppe?
»Oder ich rufe den Kommissar an«, sagte sie.
»Bitte! Imke!«
»Jette Einblick in die Arbeit einer Polizeipsychologin zu gewähren, ist so, als würde man ein Pulverfass in ein Feuer rollen.«
»In deinen Büchern verwendest du bessere Bilder«, sagte Tilo schmunzelnd.
»Sie will selbst Polizeipsychologin werden!« Es ärgerte Imke, dass Tilo ihre Befürchtungen nicht ernst nahm. »Ich will mir nicht bis an mein seliges Ende Sorgen um meine Tochter machen.«
Tilo, der die ganze Zeit mit gutem Appetit zugelangt hatte, wischte sich mit seiner Serviette den Mund und lehnte sich zurück.
»Dann hör damit auf. Jette ist eine erwachsene junge Frau, die ihre Erfahrungen machen muss. Deine Aufgabe ist es, da zu sein, wenn sie dich braucht.«
Er hatte recht und er wusste das. Sein Lächeln war freundlich und liebevoll, aber Imke konnte es nicht erwidern. Sie hasste es, wenn er den Psychologen raushängen ließ.
»Jaja«, sagte sie, »ganz wie im Lehrbuch.«
Sie schob ihren Teller weg und griff nach der Zeitung, die sie noch nicht gelesen hatte.