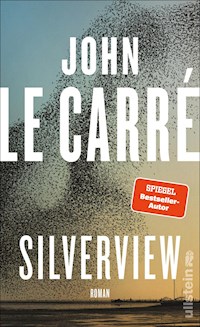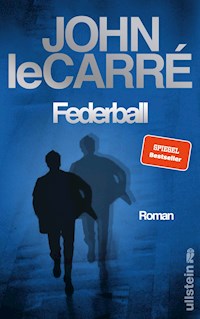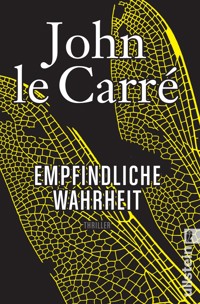14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - In Panama bahnt sich eine Verschwörung an, um den Panama-Vertrag zunichte zu machen. Dieser sieht vor, die Kontrolle über den Kanal 1999 den Panamaern zu überlassen. Der gutmütige Herrenschneider Harry Pendel wird von dem britischen Spion Andy Osnard gezwungen, für den Geheimdienst zu arbeiten. Er soll das amerikanische Militär ködern, die schmutzige Arbeit zu tun – nämlich Panama erneut zu besetzen und den Vertrag für null und nichtig zu erklären. Pendel verfolgt jedoch ein ganz anderes Ziel. Der Weltbestseller vom Meister des Spionagethrillers Große TV-Doku "Der Taubentunnel" 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Mit einem kniffligen Auftrag betritt der britische Spion Andrew Osnard die elegante Herrenschneiderei Pendel & Braithwaite in Panama City: Der unverdächtige Herrenschneider Harry Pendel, der durch seine Tätigkeit Zugang zu den höchsten Kreisen Panamas hat, soll die Großen und Mächtigen des korrupten Staates aushorchen und seine brisanten Beobachtungen nach London melden. Harry Pendel, der hoch verschuldet ist, bleibt nichts anderes übrig, als sich zu fügen und das Gewünschte zu liefern. Doch was tun, wenn es nichts zu berichten gibt?
John le Carré gelang nach dem Kalten Krieg die erfolgreiche Wiederbelebung des Spionageromans. Der Schneider von Panama wurde ein Bestseller und mit Starbesetzung verfilmt.
Der Autor
John le Carré wurde am 19. Oktober 1931 in Poole, Dorset geboren. Nach seinem Studium in Bern und Oxford war er in den sechziger Jahren in diplomatischen Diensten u. a. in Bonn und Hamburg tätig. Mit Der Spion, der aus der Kälte kam begründete er 1963 seinen Weltruhm als Bestsellerautor. John le Carré lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Von John le Carré sind in unserem Hause bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Der Schneider von Panama
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0842-5
Neuausgabe im List Taschenbuch
1. Auflage Dezember 2008
2. Auflage 2011
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008
© 1996 by David Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: The Tailor of Panama
(Hodder and Stoughton, London)
Übersetzung von Werner Schmitz mit freundlicher Genehmigung
des Verlages Kiepenheuer & Witsch, Köln
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
»Quel Panamá!«
Anfang des 20. Jahrhunderts
in Frankreich gebräuchlicher Ausdruck.
Bezeichnet ein unauflösliches Durcheinander.
1
Es war ein vollkommen gewöhnlicher Freitagnachmittag im tropischen Panama, doch dann stapfte Andrew Osnard in Harry Pendels Laden, um sich Maß für einen Anzug nehmen zu lassen. Als er hereinkam, war Pendel noch der alte. Als Osnard dann wieder ging, war Pendel ein anderer. Dazwischen vergingen siebenundzwanzig Minuten auf der Mahagoni-Uhr von Samuel Collier, Eccles, einem der vielen historischen Gegenstände im Hause Pendel & Braithwaite Co., Limitada, Hofschneider, ehemals Savile Row, London, derzeit Via España, Panama City.
Beziehungsweise ganz in der Nähe. Der Via España so nahe, daß es keine Rolle mehr spielte. Der Kürze halber P & B genannt.
Der Tag begann pünktlich um sechs, als der Lärm von Bandsägen, Baustellen und Verkehr und der zackige Sprecher des Armeesenders Pendel aus dem Schlaf rissen. »Ich war nicht da, das waren zwei andere, sie hat mich zuerst geschlagen, und zwar mit ihrem Einverständnis, Herr Richter«, erklärte er dem Morgen aus einem vagen Gefühl drohender Bestrafung heraus. Dann fiel ihm der für halb neun angesetzte Termin mit seinem Bankdirektor ein, und er sprang im selben Augenblick aus dem Bett, als seine Frau Louisa »Nein, nein, nein« jammerte und sich die Decke über den Kopf zog, weil die Morgenstunden für sie am schlimmsten waren.
»Warum nicht zur Abwechslung mal ›ja, ja, ja‹?« fragte er sie im Spiegel, während er wartete, daß das Wasser warm wurde. »Ein bißchen mehr Optimismus könnte nicht schaden, Lou.«
Louisa stöhnte, doch ihr Leib unter dem Laken rührte sich nicht; also gönnte sich Pendel zur Hebung seiner Laune einen schnoddrigen Schlagabtausch mit dem Nachrichtensprecher.
»Der Oberbefehlshaber des US-Kommandos Süd hat gestern abend erneut betont, daß die Vereinigten Staaten ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Panama in Wort und Tat nachkommen werden«, verkündete der Nachrichtensprecher mit männlicher Majestät.
»Alles erstunken und erlogen, Lou«, gab Pendel zurück, während er sich das Gesicht einseifte. »Wenn’s nicht gelogen wäre, würden Sie’s nicht so oft wiederholen, stimmt’s, General?«
»Der Präsident von Panama ist heute in Hongkong eingetroffen, der ersten Station seiner zweiwöchigen Reise durch mehrere Hauptstädte Südostasiens«, sagte der Nachrichtensprecher.
»Achtung, jetzt kommt dein Boß!« rief Pendel und hob eine seifige Hand, um seine Frau aufmerksam zu machen.
»Er reist in Begleitung einer Gruppe von panamaischen Wirtschafts- und Handelsexperten, darunter sein Berater für die Zukunftsplanung des Panamakanals, Dr. Ernesto Delgado.«
»Gut gemacht, Ernie«, sagte Pendel beifällig und warf seiner ruhenden Frau einen Blick zu.
»Am Montag reist die Präsidentendelegation nach Tokio weiter, wo wichtige Gespräche über eine Ausweitung japanischer Investitionen auf der Tagesordnung stehen«, sagte der Nachrichtensprecher.
»Und diese Geishas werden gar nicht wissen, was da plötzlich über sie gekommen ist«, sagte Pendel mit gedämpfter Stimme, während er sich die linke Wange rasierte. »Wenn dein Ernie auf Beutezug geht …«
Mit einem Schlag war Louisa wach.
»Harry, ich will nicht, daß du so von Ernesto redest, nicht mal im Scherz, bitte.«
»Gewiß, meine Liebe. Tut mir schrecklich leid. Es soll nicht wieder vorkommen. Niemals«, versprach er, während er die schwierige Stelle unmittelbar unter den Nasenlöchern bearbeitete.
Aber Louisa war noch nicht zufrieden.
»Warum soll Panama nicht in Panama investieren können?« schimpfte sie, schlug die Decke zurück und richtete sich kerzengerade in dem weißen Leinennachthemd auf, das sie von ihrer Mutter geerbt hatte. »Warum müssen das Asiaten für uns tun? Sind wir nicht reich genug? Haben wir nicht allein in dieser Stadt einhundertundsieben Banken? Warum können wir nicht unser Drogengeld nehmen und unsere Fabriken und Schulen und Krankenhäuser selber bauen?«
Das ›wir‹ war nicht wörtlich gemeint. Louisa war Bürgerin der Kanalzone, dort aufgewachsen, als die Zone durch den damals geltenden Knebelvertrag als für alle Zeiten amerikanisches Gebiet galt, auch wenn das Gebiet nur zehn Meilen breit und fünfzig Meilen lang war und links und rechts von den verachteten Panamaern bewohnt wurde. Ihr verstorbener Vater war bei einer Pioniereinheit gewesen und, als er an den Kanal versetzt wurde, vorzeitig aus dem Dienst geschieden, um als Angestellter der Kanalgesellschaft zu arbeiten. Ihre ebenfalls verstorbene Mutter hatte an einer der konfessionsgebundenen Schulen in der Zone als liberale Religionslehrerin gewirkt.
»Lou, du weißt doch, was man sagt«, antwortete Pendel; er zog ein Ohrläppchen hoch und schabte die Stoppeln darunter ab. Er rasierte sich, wie andere Leute Bilder malen, er liebte seine Tuben und Pinsel. »Panama ist kein Land, sondern ein Kasino. Und wir kennen die Kerle, die es führen. Du arbeitest schließlich für einen von denen.«
Er hatte es wieder getan. Wenn er ein schlechtes Gewissen hatte, war er ebenso charakterschwach wie Louisa, wenn es ums Aufstehen ging.
»Nein, Harry, das ist nicht wahr. Ich arbeite für Ernesto Delgado, und Ernesto ist nicht einer von denen. Ernesto ist ein anständiger Mensch, er hat Ideale, er kämpft für Panamas Zukunft als freies und souveränes Mitglied im Kreis der Nationen. Im Gegensatz zu denen ist er nicht auf Beute aus, er will nicht das Erbe seines Landes verschachern. Und deshalb ist er etwas Besonderes, ein sehr, sehr ungewöhnlicher Mensch.«
Heimlich beschämt, drehte Pendel die Dusche an und prüfte mit einer Hand das Wasser.
»Der Druck ist mal wieder weg«, sagte er munter. »Das haben wir davon, daß wir auf einem Hügel wohnen.«
Louisa stieg aus dem Bett und zerrte sich das Nachthemd über den Kopf. Sie war groß und schmalhüftig, hatte langes, widerspenstiges Haar und die hoch angesetzten Brüste einer Sportlerin. Wenn sie sich einmal vergaß, war sie eine Schönheit. Aber sobald sie sich ihrer selbst wieder bewußt wurde, ließ sie die Schultern hängen und machte ein mürrisches Gesicht.
»Ein einziger guter Mann, Harry«, fuhr sie fort, während sie ihr Haar in die Duschhaube stopfte. »Mehr ist gar nicht nötig, um dieses Land in Schwung zu bringen. Ein einziger guter Mann von Ernestos Kaliber. Wir brauchen keine Redner mehr, keine Egomanen, sondern bloß einen einzigen moralisch handelnden Christen. Einen einzigen anständigen, fähigen Verwalter, der nicht korrupt ist, der Straßen und Kanalisation erneuert, der etwas gegen Armut und Verbrechen und Drogenhandel unternimmt und den Kanal instandhält und nicht an den Meistbietenden verhökert. Ernesto möchte aufrichtig dieser Mann sein. Es steht dir nicht zu, es steht niemandem zu, schlecht von ihm zu reden.«
Rasch, aber mit der ihm eigenen Sorgfalt, zog Pendel sich an und eilte in die Küche. Die Pendels hatten zwar wie alle anderen gutbürgerlichen Bewohner Panamas mehrere Dienstboten, aber das Frühstück mußte nach strenger alter Sitte vom Oberhaupt der Familie zubereitet werden. Pochiertes Ei auf Toast für Mark, Bagel mit Rahmkäse für Hannah. Dazu sang Pendel gutgelaunt Stellen aus dem Mikado, denn er liebte die Musik. Mark saß schon angezogen am Küchentisch und machte seine Hausaufgaben. Hannah mußte aus dem Bad gelockt werden, wo sie besorgt einen Makel an ihrer Nase untersuchte.
Dann Hals über Kopf gegenseitige Vorwürfe und Abschiedsrufe, als Louisa angekleidet, aber reichlich spät zur Arbeit bei der Panamakanal-Kommission aufbricht und zu ihrem Peugeot rennt, während Pendel und die Kinder in den Toyota steigen und die Hetzjagd zur Schule antreten, links, rechts, links den steilen Hang zur Hauptstraße hinunter, wobei Hannah ihr Bagel verspeist und Mark in dem holpernden Geländewagen mit den Hausaufgaben kämpft und Pendel sich wegen der Hektik entschuldigt, aber Kinder, ich habe einen frühen Termin mit den Jungs von der Bank, und insgeheim wünscht, er hätte sich seine abfälligen Bemerkungen über Delgado verkneifen können.
Dann ein Spurt auf der falschen Fahrspur, zu verdanken dem morgendlichen operativo, der den stadteinwärts fahrenden Pendlern die Benutzung beider Spuren erlaubt. Dann in lebensgefährlichem Gekurve durch aggressiven Verkehr in engere Straßen hinein, vorbei an amerikanisch anmutenden Häusern, die ihrem eigenen sehr ähnlich sehen, und hinein in das aus Glas und Plastik gebaute Dorf mit seinen Charlie Pops und McDonald’s und Kentucky Fried Chickens und dem Rummelplatz, wo Mark sich am vorigen 4. Juli nach der Attacke eines feindlichen Autoskooters den Arm gebrochen hatte – und als sie ins Krankenhaus gekommen waren, hatte es dort von Kindern mit Brandwunden von Feuerwerkskörpern gewimmelt.
Dann ein Pandämonium, als Pendel nach einem Vierteldollar für den schwarzen Jungen sucht, der an einer Ampel Rosen verkauft, dann wildes Winken aller drei, als sie den alten Mann passieren, der seit sechs Monaten an derselben Straßenecke steht und mit demselben Schild für zweihundertfünfzig Dollar einen Schaukelstuhl zum Verkauf anbietet. Dann wieder durch Nebenstraßen, Mark wird heute als erster abgesetzt, und weiter durch das stinkende Inferno der Manuel Espinosa Batista, vorbei an der National-Universität, wehmütige Blicke auf langbeinige Mädchen in weißen Blusen und mit Büchern unterm Arm, Pendel grüßt die kitschige Pracht der Kirche del Carmen – guten Morgen, lieber Gott –, überquert todesmutig die Vía Espana, verschwindet mit einem Seufzer der Erleichterung in der Avenida Federico Boyd, gelangt durch die Vía Israel auf die San Francisco, schiebt sich mit der Menge zum Flughafen Paitilla, grüßt die Damen und Herren vom Drogenhandel, denen die meisten der zahlreichen neben den baufälligen Gebäuden parkenden hübschen kleinen Privatflieger gehören, zwischen denen streunende Hunde und Hühner herumlaufen, und jetzt anhalten, etwas vorsichtig, bitte, tief durchatmen, die Welle antisemitischer Bombenanschläge in Lateinamerika ist nicht unbemerkt geblieben: mit diesen finsteren jungen Männern am Eingang der Albert-Einstein-Schule ist nicht zu spaßen, da muß man sich vorsehen. Mark springt aus dem Wagen, ausnahmsweise einmal pünktlich, Hannah schreit: »Du hast was vergessen, Blödi!« und wirft ihm seinen Ranzen nach. Mark stelzt los. Bekundungen von Gefühlen sind nicht erlaubt, nicht einmal ein leichtes Winken, denn das könnte ja von seinen Mitschülem als Wehleidigkeit interpretiert werden.
Dann zurück ins Gewühl, das frustrierte Jaulen der Polizeisirenen, das Knurren und Knattern von Bulldozern und Preßlufthämmern, das ewige sinnlose Hupen, Furzen und Fuchteln einer Tropenstadt der Dritten Welt, die es nicht erwarten kann, sich selbst zu ersticken; zurück zu den Bettlern und Krüppeln und den Verkäufern von Handtüchern, Blumen, Trinkbechern und Keksen, die einen an jeder Ampel belagern – Hannah, mach mal dein Fenster auf, und wo ist die Büchse mit den halben Balboas? –, heute ist der beinlose, weißhaarige Senator dran, der in seinem Rollwägelchen durch die Gegend paddelt, und nach ihm die schöne schwarze Mutter mit dem fröhlichen Baby auf der Hüfte, fünfzig Cent für die Mutter, einmal Winken für das Baby, und da kommt auch schon wieder der weinende Junge auf Krücken an, dessen eines Bein wie eine überreife Banane herunterhängt, aber weint er den ganzen Tag oder nur zur Hauptverkehrszeit? Hannah gibt auch ihm einen halben Balboa.
Dann kurzfristig freie Fahrt, als wir mit vollem Tempo den Hügel hoch zur Maria Immaculada jagen, auf deren Vorhof Nonnen mit staubigen Gesichtern um die gelben Schulbusse wuseln – Señíor Pendel, buenas días! und Buenas días, Schwester Piedad! Und Ihnen auch, Schwester Imelda! –, und hat Hannah an die Kollekte für den Tagesheiligen gedacht, wer auch immer das heute sein mag? Natürlich nicht, sie ist ja auch ein Blödi, also hier hast du fünf Dollar, Kleines, du kommst noch rechtzeitig, und laß dir den Tag nicht verderben. Hannah, ein pummeliges Mädchen, gibt ihrem Vater einen feuchten Kuß und begibt sich auf die Suche nach Sarah, ihrer dieswöchigen Busenfreundin, während ein schmunzelnder, überaus fetter Polizist mit goldener Armbanduhr dreinschaut wie der Weihnachtsmann.
Und kein Mensch findet etwas dabei, denkt Pendel fast schon zufrieden, als er sie in der Menge verschwinden sieht. Weder die Kinder noch sonst jemand. Nicht einmal ich. Ein Judenjunge, nur daß er keiner ist, ein katholisches Mädchen, nur daß sie keins ist, und wir alle finden das normal. Und entschuldige, meine Liebe, daß ich so schlecht von dem unvergleichlichen Ernesto Delgado geredet habe, aber heute ist nicht der Tag, an dem ich brav sein kann.
Worauf Pendel, gutgelaunt und endlich ungestört, auf die Hauptstraße zurückkehrt und seinen Mozart einschaltet. Und sogleich ist er deutlich wacher, wie meistens, wenn er allein ist. Gewohnheitsmäßig sieht er nach, ob die Türen verschlossen sind, und achtet mit einem Auge auf Straßenräuber, Polizisten und andere zwielichtige Gestalten. Aber nervös ist er nicht. Nach der US-Invasion herrschten ein paar Monate die Revolverhelden unbehelligt in Panama. Zöge heute jemand mitten im Verkehrsgewühl eine Waffe, würden sämtliche Fahrer, außer Pendel, aus ihren Autos auf ihn losballern.
Hinter einem der vielen halbfertigen Hochhäuser hervorkommend, springt ihn die grelle Sonne an, die Schatten werden tiefer, der Krach der City nimmt zu. Ein Regenbogen aus Wäsche erscheint im Dunkel der baufälligen Wohnhäuser in den engen Straßen, durch die er sich kämpfen muß. Auf den Bürgersteigen sind Afrikaner, Inder, Chinesen und alle denkbaren Mischungen zu sehen. In Panama gibt es ebenso viele Menschen wie Vogelarten, eine Tatsache, die das Herz des Mischlings Pendel täglich von neuem erfreut. Manche stammten von Sklaven ab, andere sehr wahrscheinlich auch, denn ihre Vorfahren waren zu Zehntausenden hierher verfrachtet worden, um für den Kanal zu arbeiten und manchmal auch zu sterben.
Die Straße wird breiter. Am dämmrigen Pazifik herrscht Ebbe, und die dunkelgrauen Inseln jenseits der Bucht hängen wie ferne chinesische Berge im dämmrigen Nebel. Pendel spürt den heftigen Wunsch, dorthin zu gehen. Vielleicht liegt das an Louisa, denn manchmal macht ihre furchtbare Unsicherheit ihn fix und fertig. Vielleicht kommt es auch daher, daß nun direkt vor ihm bereits die knallrote Spitze des Wolkenkratzers der Bank auftaucht, der sich mit seinen ähnlich scheußlichen Nachbarn um die Wette in den Himmel reckt. Ein Dutzend Schiffe treibt in gespenstischer Linie über dem unsichtbaren Horizont, wartet mit laufenden Maschinen die Totzeit ab, um in den Kanal einlaufen zu können. Pendel kann die Langeweile an Bord nur zu gut nachvollziehen. Er vergeht vor Hitze auf dem reglosen Deck, er liegt in einer miefigen Kajüte voller fremder Körper und Ölgestank. Ich werde keine Zeit mehr totschlagen, nimmt er sich schaudernd vor. Nie mehr. Für den Rest seines Erdendaseins will Harry Pendel jede Stunde jeden Tages genießen, das ist amtlich. Frag Onkel Benny, tot oder lebendig.
Als er in die prachtvolle Avenida Balboa kommt, glaubt er plötzlich zu fliegen. Rechts schwebt die Botschaft der Vereinigten Staaten vorbei, größer als der Präsidentenpalast, größer sogar als seine Bank. Aber nicht, zu diesem Zeitpunkt, größer als Louisa. Ich bin einfach zu großkotzig, erklärt er ihr, als er auf den Vorplatz der Bank hinabgleitet. Wenn ich nicht so großkotzige Vorstellungen hätte, würde ich jetzt nicht in diesem Schlamassel stecken, hätte ich mich nie als Krösus gefühlt und würde jetzt niemandem einen Haufen Geld schulden, den ich nicht habe, und ich würde auch nicht mehr gegen Ernie Delgado oder sonstwen sticheln, den du gerade für einen moralischen Saubermann hältst. Schweren Herzens stellt er seinen Mozart aus, greift nach hinten und nimmt sein Jackett vom Bügel – heute hat er sich für das dunkelblaue entschieden –, zieht es an und richtet im Rückspiegel seine Denman-&-Goddard-Krawatte. Ein strenger uniformierter Bursche bewacht das riesige Glasportal. Er hält eine Halbautomatik im Arm und salutiert vor jedem, der einen Anzug trägt.
»Don Eduardo, Monseñor, wie geht es uns heute, Sir?« ruft Pendel ihm auf Englisch zu und reißt den Arm hoch. Der Bursche strahlt vor Vergnügen.
»Guten Morgen, Mr. Pendel«, antwortet er. Mehr Englisch kann er nicht.
Für einen Schneider ist Harry Pendel überraschend athletisch. Vielleicht ist er sich dessen bewußt, denn er geht wie mit unterdrückter Kraft. Er ist groß und stabil gebaut, sein angegrautes Haar ist kurzgeschnitten. Er hat einen breiten Brustkorb und die runden Schultern eines Boxers. Sein Gang jedoch ist staatsmännisch und diszipliniert. Die Hände, die zunächst locker an den Seiten schwingen, legt er nun sittsam auf dem kräftigen Rücken zusammen. In solch einer Haltung schreitet man eine Ehrengarde ab oder geht man mit Würde seiner Hinrichtung entgegen. In der Vorstellung hat Pendel schon beides getan. Ein einziger Schlitz hinten im Jackett, mehr darf nicht sein. Er nennt es das Braithwaitesche Gesetz.
Am deutlichsten freilich zeigten sich Lebensfreude und Behagen auf seinem Gesicht, einem Gesicht, dessen er mit vierzig würdig war. Unbekümmerte Unschuld leuchtete aus seinen babyblauen Augen. Auf seinen Lippen lag, auch wenn sie entspannt waren, ein freundliches, offenes Lächeln. Wer es unvermutet sah, fühlte sich gleich ein bißchen besser.
Hohe Tiere in Panama haben hinreißende schwarze Sekretärinnen in züchtigen blauen Busschaffner-Uniformen. Sie haben getäfelte, mit Stahl verstärkte kugelsichere Türen aus Teakholz mit Messingklinken, die man nicht bewegen kann, weil die Türen sich nur von innen mit Summern öffnen lassen, damit die hohen Tiere nicht entführt werden können. Ramón Rudds Zimmer im sechzehnten Stock war enorm groß und modern und hatte getönte, auf die Bucht hinausgehende Fenster vom Boden bis zur Decke und einen Schreibtisch so groß wie ein Tennisplatz, an dessen hinteres Ende Ramón Rudd sich klammerte wie eine winzige Ratte an ein riesiges Floß. Er war klein und dick, hatte eine dunkelblaue Kinnpartie, glänzend schwarzes Haar, schwarzblaue Koteletten und gierig funkelnde Augen. Zur Übung bestand er darauf, Englisch zu sprechen, hauptsächlich durch die Nase. Er hatte für die Erforschung seiner Ahnentafel beträchtliche Summen bezahlt und behauptete, von schottischen Abenteurern abzustammen, die nach der Katastrophe von Darién zurückgelassen worden waren. Vor sechs Wochen hatte er einen Kilt im Schottenmuster der Rudds bestellt, um an den schottischen Tanzveranstaltungen im Club Unión teilnehmen zu können. Ramón Rudd schuldete Pendel zehntausend Dollar für fünf Anzüge. Pendel schuldete Rudd einhundertfünfzigtausend Dollar. Als Zeichen des Entgegenkommens zählte Ramón die rückständigen Zinsen zum Kapital hinzu, weshalb das Kapital denn auch weiterwuchs.
»Pfefferminz?« fragte Rudd und schob ihm einen Messingteller mit eingewickelten grünen Bonbons hin.
»Danke, Ramón«, sagte Pendel, nahm aber keins. Ramón bediente sich.
»Warum geben Sie so viel Geld für einen Anwalt aus?« fragte Rudd nach zweiminütigem Schweigen, in dem er an seinem Pfefferminz gelutscht und sie beide, jeder für sich, über den aktuellen Kontoauszügen der Reisfarm gestöhnt hatten.
»Er hat gesagt, daß er den Richter bestechen will, Ramón«, erklärte Pendel demütig wie ein Schuldiger, der seine Zeugenaussage macht. »Er hat gesagt, er sei mit ihm befreundet. Er wolle mich da lieber raushalten.«
»Aber warum hat der Richter die Anhörung vertagt, wenn Ihr Anwalt ihn bestochen hat?« fragte Rudd. »Warum hat er Ihnen nicht wie versprochen das Wasser zuerkannt?«
»Weil es inzwischen ein anderer Richter war, Ramón.«
Nach der Wahl wurde ein neuer Richter eingesetzt, und das Bestechungsgeld war nicht vom alten auf den neuen übertragbar. Der neue Richter wartet jetzt erst einmal ab, welche Partei ihm das höhere Angebot macht. Der Sekretär meint, der neue Richter sei ehrlicher als der alte; das heißt natürlich, daß er auch teurer ist. Bedenken sind in Panama eine kostspielige Sache, sagt er. Und es wird immer schlimmer.«
Ramón Rudd nahm die Brille ab, hauchte auf die Gläser und säuberte sie mit einem Polierleder aus der Brusttasche seines Pendel-&-Braithwaite-Anzugs. Dann schob er die goldenen Bügel wieder hinter die glänzenden kleinen Ohren.
»Warum bestechen Sie nicht jemand beim Ministerium für Landwirtschaftliche Entwicklung?« empfahl er mit überlegener Nachsicht.
»Das haben wir versucht, Ramón, aber die Leute dort sind richtige Moralapostel. Sie sagen, sie seien bereits von der anderen Partei bestochen, und sie fänden es unmoralisch, die Seiten zu wechseln.«
»Könnte Ihr Farmverwalter nicht was arrangieren? Sie zahlen ihm ein hohes Gehalt. Warum wird er nicht selbst aktiv?«
»Na ja, Angel tickt ehrlich gesagt nicht ganz richtig, Ramón«, gestand Pendel und erweiterte damit unbewußt Rudds Wortschatz um eine Redewendung. »Um es nicht noch deutlicher zu sagen, ich halte es für nützlicher, wenn er nicht dort auftaucht. Nehme an, ich werde mich selbst aufraffen und da mal vorsprechen müssen.«
Ramón Rudds Jackett kniff noch immer in den Achseln. Die beiden standen einander vor dem großen Fenster gegenüber, Rudd kreuzte die Arme vor der Brust, ließ sie dann sinken und verschränkte die Hände auf dem Rücken, während Pendel mit den Fingerspitzen konzentriert an den Nähten zupfte und wie ein Arzt zu ermitteln suchte, wo der Schmerz herkam.
»Nur eine Kleinigkeit, Ramón, falls überhaupt etwas«, befand er schließlich. »Ich will die Ärmel nicht unnötig auftrennen, weil das dem Jackett nicht guttut. Aber wenn Sie das nächstemal vorbeikommen, kann ich’s richten.«
Sie setzten sich wieder.
»Produziert die Farm überhaupt noch Reis?« fragte Rudd.
»Wenig, Ramón, möchte ich einmal sagen. Wir konkurrieren, wie man so sagt, mit dem Weltmarkt, also mit billigem Reis aus anderen Ländern, in denen die Regierung den Anbau subventioniert. Ich war voreilig. Sie auch.«
»Sie und Louisa?«
»Na ja, eigentlich Sie und ich, Ramón.«
Ramón Rudd furchte die Stirn und sah auf seine Uhr, was er nur bei Klienten tat, die kein Geld hatten.
»Schade, daß Sie die Farm nicht als eigene Firma deklariert haben, als es noch möglich war, Harry. Eine gutgehende Schneiderei als Sicherheit für eine Reisfarm herzugeben, der das Wasser ausgegangen ist, das war schon ziemlich unklug.«
»Aber, Ramón – Sie selbst haben damals darauf bestanden«, widersprach Pendel. Doch schon untergrub die Schmach seine Entrüstung. »Sie haben gesagt, Sie könnten das Risiko mit der Reisfarm nur übernehmen, wenn wir die beiden Geschäftszweige zusammenlegten. Das war eine der Bedingungen für das Darlehen. Na schön, es war mein Fehler, ich hätte nicht auf Sie hören sollen. Aber ich habe auf Sie gehört. Wahrscheinlich haben Sie damals für die Bank gesprochen, nicht für Harry Pendel.«
Sie sprachen über Rennpferde. Ramón besaß ein paar. Sie sprachen über Landbesitz. Ramón besaß ein Stück Küste an der Atlantikseite. Vielleicht sollte Harry mal an einem Wochenende hinausfahren und eine Parzelle erwerben, auch wenn er dort nicht gleich in den ersten Jahren bauen würde; Ramóns Bank könne mit einer Hypothek behilflich sein. Aber Ramón sagte nicht, daß er Louisa und die Kinder mitbringen solle, dabei ging auch seine Tochter auf die Maria Immaculada, und die beiden Mädchen waren miteinander befreundet. Und, zu Pendels enormer Erleichterung, hielt er es auch nicht für angebracht, die zweihunderttausend Dollar zu erwähnen, die Louisa von ihrem Vater geerbt hatte und die Pendel für sie hatte anlegen sollen.
»Haben Sie versucht, Ihr Konto auf eine andere Bank zu transferieren?« fragte Ramón Rudd, nachdem alles Unsagbare ungesagt geblieben war.
»Ich kann mir nicht denken, daß man sich derzeit um mich reißt, Ramón. Warum fragen Sie?«
»Ich hatte einen Anruf von einer Handelsbank. Man hat mich über Sie ausgefragt. Kreditwürdigkeit, Verbindlichkeiten, Umsatz. Alles Dinge, über die ich niemandem Auskunft erteile. Selbstverständlich nicht.«
»Die spinnen. Die müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Welche Handelsbank war denn das?«
»Eine britische. Aus London.«
»Aus London? Die haben Sie angerufen? Meinetwegen? Wer? Welche? Ich denke, die sind alle pleite.«
Ramón Rudd bedauerte, keine näheren Auskünfte geben zu können. Selbstverständlich habe er ihnen nichts gesagt. Abwerbungen interessierten ihn nicht.
»Was für Abwerbungen, um Himmels willen?« rief Pendel.
Aber Rudd schien die Sache schon fast vergessen zu haben. Referenzen, sagte er vage. Empfehlungen. Kein Thema. Harry sei doch ein Freund.
»Ich hätte gern einen Blazer«, sagte Ramón Rudd, als sie sich die Hände schüttelten. »Marineblau.«
»Ein Blau wie das hier?«
»Dunkler. Zweireihig. Messingknöpfe. Schottische.«
In einem Anfall von Dankbarkeit erzählte ihm Pendel von den sagenhaften neuen Knöpfen, die er von der Londoner Badge & Button Company geliefert bekommen habe.
»Die könnten Ihnen welche mit Ihrem Familienwappen machen, Ramón. Oder wie wär’s mit einer Distel? Dem Emblem Schottlands? Und dazu dann noch die passenden Manschettenknöpfe.«
Ramón sagte, er werde darüber nachdenken. Da Freitag war, wünschten sie sich ein schönes Wochenende. Und warum auch nicht? Noch war es ein ganz gewöhnlicher Tag im tropischen Panama. Gewiß, es gab ein paar Wolken an seinem privaten Horizont, aber mit dergleichen war Pendel noch immer fertiggeworden. Eine Londoner Fantasiebank hatte mit Ramón telefoniert – aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ramón war sicher ein ganz netter Bursche, ein geschätzter Kunde, solange er zahlte, und sie hatten schon manches Glas miteinander geleert. Aber wenn man dahinterkommen wollte, was in seinem spanisch-schottischen Schädel wirklich vorging, mußte man schon den Doktor in außersinnlicher Wahrnehmung gemacht haben.
Wenn er in seiner kleinen Nebenstraße ankommt, fühlt Harry Pendel sich jedesmal wieder in Sicherheit. An manchen Tagen quält er sich mit der Vorstellung, sein Geschäft könnte verschwunden sein, ausgeraubt oder von einer Bombe zerstört. Oder er malt sich aus, es habe überhaupt nie existiert, sein verstorbener Onkel Benny habe ihm damit nur ein Hirngespinst in den Kopf gesetzt. Aber der heutige Besuch bei der Bank hat ihn beunruhigt, und sein suchender Blick heftet sich an die Ladenfront, sobald er in den Schatten der hohen Bäume einbiegt. Eigentlich bist du ja ein Haus, sagt er zu den rostrosa spanischen Dachziegeln, die ihm durchs Laubwerk entgegenschimmern. Du bist gar kein Geschäft. Du bist ein Haus, wie ein Waisenkind es sich sein Leben lang erträumt hat. Wenn Onkel Benny dich jetzt nur sehen könnte:
»Siehst du den blumengeschmückten Eingang?« fragt Pendel seinen Onkel und stößt ihn an. »Lädt das nicht zum Eintreten ein, verheißt das nicht angenehm kühle Räumlichkeiten, wo du bedient wirst wie ein Pascha?«
»Harry, mein Junge, das ist fantastisch«, erwidert Onkel Benny und berührt mit beiden Handflächen die Krempe seines Homburgs, wie er es immer getan hat, wenn er etwas ausheckte. »Bei einem solchen Geschäft könnte man glatt ein Pfund Eintritt nehmen.«
»Und das gemalte Ladenschild, Benny? P & B, zu einem Wappen verschlungen. Das macht den Namen des Ladens in der ganzen Stadt bekannt, überall, ob im Club Unión oder in der gesetzgebenden Versammlung oder gar im Palast der Reiher. ›Mal wieder bei P & B gewesen? – Da geht der alte Soundso in seinem Anzug von P & B.‹ So reden die Leute hier, Benny!«
»Ich habe es bereits gesagt, Harry, und ich sag’s noch einmal. Du hast rednerisches Talent. Du bist ein Tausendsassa. Ich frage mich nur, von wem du das haben könntest.«
Nachdem er sich so halbwegs wieder Mut gemacht und Ramón Rudd halbwegs vergessen hat, geht Harry Pendel die Stufen hoch und beginnt seinen Arbeitstag.
2
Osnards Anruf, etwa um halb elf, löste keinerlei Unruhe aus. Er war ein neuer Kunde, und neue Kunden mußten zu Señor Harry durchgestellt werden oder wurden, wenn er beschäftigt war, gebeten, ihre Nummer anzugeben, damit Señor Harry umgehend zurückrufen konnte.
Pendel war gerade im Zuschneidezimmer, wo er aus braunem Papier die Schnittmuster für eine Marineuniform anfertigte und dabei Gustav Mahler hörte. Das Zuschneidezimmer war sein Allerheiligstes, niemand außer ihm durfte dort arbeiten. Den Schlüssel dazu trug er stets in der Westentasche. Um den Luxus dieses Schlüssels zu genießen, schob er ihn manchmal ins Schloß und sperrte sich ein, zum Beweis, daß er der Herr im Hause war. Und bevor er die Tür wieder aufschloß, bevor er den schönen Tag fortsetzte, verharrte er manchmal noch einen Augenblick in unterwürfiger Haltung, den Kopf gesenkt und die Füße nebeneinander. Niemand sah ihn dabei, außer jenem Teil seiner selbst, der bei seinen theatralischeren Handlungen den Zuschauer spielte.
Hinter ihm, in ähnlich großen Räumen, unter hellen neuen Lampen und elektrischen Ventilatoren, nähten und bügelten und schwatzten seine verwöhnten Angestellten aus aller Herren Länder mit einem Ausmaß an Freiheit, von dem andere Arbeitnehmer in Panama gewöhnlich nur träumen können. Doch niemand arbeitete mit mehr Hingabe als ihr Arbeitgeber Pendel, wenn er innehielt, um einer Melodie Mahlers zu folgen, und dann mit geschickten Schnitten seiner Schere an dem gelben Kreidestrich entlangfuhr, aufgezeichnet nach den Schulter- und Rückenmaßen eines kolumbianischen Flottenadmirals, der nur von dem Wunsch beseelt war, seinen geschaßten Vorgänger an Eleganz zu übertreffen.
Die Uniform, die Pendel für ihn entworfen hatte, war ganz besonders prächtig. Die weiße Kniebundhose – bereits bei seinen italienischen Hosenschneiderinnen in Arbeit, die ein paar Türen weiter untergebracht waren – sollte am Gesäß hauteng anliegen, so daß man zwar darin stehen, aber nicht sitzen konnte. Der Rock, den Pendel jetzt eben zuschnitt, war weiß und marineblau mit goldenen Epauletten und betreßten Manschetten, goldenem Schnurbesatz und hohem Nelson-Kragen, bestickt mit eichenlaubumkränzten Schiffsankern – eine phantasievolle Dreingabe Pendels, die dem Privatsekretär des Admirals auf Pendels gefaxter Skizze sehr gefallen hatte. Pendel hatte nie so recht verstanden, was Benny mit dem »Tausendsassa« gemeint haben könnte, aber wenn er sich diese Skizze ansah, wußte er, daß er einer war.
Und während er weiter zur Musik zuschnitt, begann sich sein Rücken emphatisch zu wölben, bis er zum Admiral Pendel wurde und die große Treppe zu seinem Antrittsball hinabschritt. Solch harmlose Fantasien konnten seiner Kunstfertigkeit nichts anhaben. Der ideale Schneider, dozierte er gern – in dankbarer Erinnerung an seinen verstorbenen Partner Braithwaite –, ist ein geborener Imitator. Seine Aufgabe ist es, sich in die Kleider desjenigen zu versetzen, für den er arbeitet, und darin zu leben, bis der rechtmäßige Besitzer sie abholt.
In diesem glücklichen, abgehobenen Zustand ereilte ihn Osnards Anruf. Zunächst hatte Marta abgenommen. Marta war seine Empfangsdame, Telefonistin, Buchhalterin und Sandwichmacherin, eine verdrießliche, loyale kleine Mulattin, deren schiefes, narbiges Gesicht von Hauttransplantationen und stümperhaften Operationen entstellt war.
»Guten Morgen«, sagte sie mit ihrer schönen Stimme auf Spanisch.
Nicht »Harry«, nicht »Señor Pendel« – das sagte sie nie. Schlicht Guten Morgen mit der Stimme eines Engels, denn Stimme und Augen waren die einzigen Teile ihres Gesichts, die unversehrt überlebt hatten.
»Auch dir einen Guten Morgen, Marta.«
»Ich habe einen neuen Kunden in der Leitung.«
»Von welcher Seite der Brücke?«
Ein häufig gehörter Scherz in diesem Land.
»Von deiner Seite. Ein gewisser Osnard.«
»Wie bitte?«
»Señor Osnard. Ein Engländer. Er macht Witze.«
»Was denn für Witze?«
»Das müßtest du mir schon erklären.«
Pendel legte die Schere beiseite, drehte Mahler fast unhörbar leise und griff nach einem Terminkalender und dann nach einem Bleistift. An seinem Schneidetisch, das war bekannt, legte er auf Ordnung größten Wert: hier das Tuch, da die Muster, Rechnungen und Auftragsbuch dort drüben, alles picobello. Wie immer beim Zuschneiden trug er eine selbstentworfene und selbstgeschneiderte schwarze Weste mit seidenem Rückenteil und verdeckter Knopfleiste. Ein solches Kleidungsstück drückte Dienstfertigkeit aus, und das gefiel ihm.
»Könnten Sie mir das bitte buchstabieren, Sir?« bat er freundlich, als Osnard ihm noch einmal seinen Namen nannte.
Wenn Pendel telefonierte, lag ein Lächeln in seiner Stimme. Vollkommen Fremde hatten unmittelbar das Gefühl, mit jemandem zu sprechen, der ihnen sympathisch war. Doch Osnard verfügte offenbar über das gleiche ansteckende Talent, denn zwischen den beiden entstand sofort eine behagliche Atmosphäre, aus der sich ein längeres, unbefangenes und sehr britisches Gespräch entspann.
»Beginnt mit O-S-N und endet mit A-R-D«, sagte Osnard, und Pendel muß das als besonders geistreich empfunden haben, denn er notierte den Namen genau so, wie Osnard ihn diktierte: zwei Dreiergruppen in Großbuchstaben mit einem »&« dazwischen.
»Und Sie, sind Sie Pendel oder Braithwaite?« fragte Osnard.
Worauf Pendel, wie oft auf diese Frage, mit einer beiden Identitäten angemessenen Großzügigkeit antwortete: »Nun, Sir, ich bin gewissermaßen beide in einer Person.
Mein Partner Braithwaite ist bedauerlicherweise schon vor vielen Jahren verstorben. Ich kann Ihnen jedoch versichern, daß sein Vorbild noch sehr lebendig ist und zur Freude aller, die ihn gekannt haben, bis zum heutigen Tag die Politik unseres Hauses bestimmt.«
Wenn Pendel die Register seiner Zunft zog, sprach aus seinen Sätzen der Elan eines Mannes, der nach langem Exil in die Heimat zurückkehrt. Und diese Sätze waren, besonders zum Ende hin, komplexer als man meinen sollte, ähnlich wie gewisse Stellen in einem Konzert, bei denen der Hörer schon den Schlußakkord erwartet, dann aber getäuscht wird.
»Ach, wie bedauerlich«, sagte Osnard etwas leiser und nach respektvoller Pause. »Woran ist er denn gestorben?«
Und Pendel dachte bei sich: Komisch, wie oft ich das gefragt werde, aber wenn man bedenkt, daß das früher oder später auf uns alle zukommt, ist es wohl ganz natürlich.
»Nun, man sagt, an einem Schlaganfall, Mr. Osnard«, antwortete er in jenem verwegenen Ton, den gesunde Männer anschlagen, wenn sie von solchen Dingen reden. »Aber, um ehrlich zu sein, für mich ist er eher an gebrochenem Herzen gestorben, nachdem wir angesichts exorbitanter Steuerbelastung unser Geschäft in der Savile Row schließen mußten. Darf ich fragen, ohne aufdringlich sein zu wollen, ob Sie in Panama wohnhaft sind, Mr. Osnard, oder lediglich auf der Durchreise?«
»Bin vor ein paar Tagen in die Stadt gekommen. Nehme an, daß ich eine ganze Weile bleiben werde.«
»Dann willkommen in Panama, Sir, und könnten Sie mir wohl eine Nummer geben, unter der ich Sie erreichen kann, falls wir, was hierzulande leider zur Normalität gehört, unterbrochen werden?«
Beiden Männern war ihre Herkunft an der Sprache anzumerken; schließlich waren sie Engländer. Für jemanden wie Osnard war Pendels Herkunft ebenso unverkennbar wie sein Bestreben, ihr zu entrinnen. Seine Stimme hatte trotz aller Fortschritte nie die Färbung der Leman Street im Londoner East End verloren. Wenn er die Vokale richtig traf, ließen ihn Tonfall und Hiatus im Stich. Und selbst wenn das alles perfekt zusammenkam, konnte ihm immer noch die Wortwahl ein wenig zu prätentiös geraten. Für jemanden wie Pendel wiederum hatte Osnard die nuschelige Ausdrucksweise jener privilegierten Grobiane, die Onkel Bennys Rechnungen schlicht zu ignorieren pflegten. Doch während die beiden Männer redeten und einander zuhörten, kam es Pendel so vor, als entwickle sich zwischen ihnen, wie zwischen zwei Verbannten, so etwas wie eine behagliche Komplizenschaft, in welcher jeder der beiden seine Vorurteile einer förderlichen Koalition zuliebe gern beiseite schob.
»Bin im El Panama, bis meine Wohnung fertig ist«, erklärte Osnard. »Hätte schon vor einem Monat fertig sein sollen.«
»Immer das alte Lied, Mr. Osnard. So sind die Handwerker auf der ganzen Welt. Ich habe es schon oft gesagt, und ich sage es auch jetzt. Ob in Timbuktu oder New York, das spielt gar keine Rolle. Die unzuverlässigsten Handwerker sind immer die vom Bau.«
»Gegen fünf ist doch nicht viel bei Ihnen los, oder? Kein großer Massenandrang?«
»Um fünf Uhr haben wir unsere blaue Stunde, Mr. Osnard. Da ist meine mittägliche Kundschaft wieder bei der Arbeit, und die anderen, die Vorabendgesellschaft, wie ich sie nenne, ist noch nicht aus dem Bau gekrochen.« Er korrigierte sich mit einem selbstkritischen Lachen. »Aber nein. Was sage ich denn da? Heute ist ja Freitag, da geht meine Vorabendgesellschaft nach Hause zu Frau und Kind. Um fünf Uhr kann ich Ihnen voll und ganz zur Verfügung stehen.«
»Sie persönlich? Leibhaftig? Die meisten Nobelschneider lassen sich die Arbeit von ihren Handlangern abnehmen.«
»Ich bin wohl leider noch einer von der altmodischen Sorte, Mr. Osnard. Für mich stellt jeder Kunde eine Herausforderung dar. Ich nehme Maß, ich schneide zu, ich nehme die Anproben vor, und es kümmert mich nicht, wie viele nötig sind, weil mich nur ein perfektes Ergebnis zufriedenstellt. Kein Teil eines Anzugs verläßt dieses Haus, solange es nicht vollständig fertig ist, und ich überwache jede Phase der Herstellung von Anfang bis Ende.«
»Okay. Wieviel?« wollte Osnard wissen. Es klang freilich eher launig als grob.
Pendels Lächeln wurde breiter. Wenn er jetzt Spanisch gesprochen hätte, jene Sprache, die ihm zur zweiten Natur geworden war und die er sogar lieber sprach, wäre ihm die Antwort auf diese Frage sehr leichtgefallen. Das Thema Geld bringt in Panama niemanden in Verlegenheit es sei denn, man hat keins. Doch bei jemandem aus der englischen Oberschicht wußte man nie, wie er reagierte, wenn es um Geld ging, und gerade die Reichsten waren oft auch die Sparsamsten.
»Ich liefere Spitzenprodukte, Mr. Osnard. Einen RollsRoyce gibt es auch nicht umsonst, sage ich immer, und das ist bei einem Pendel & Braithwaite nicht anders.«
»Also wieviel?«
»Nun, Sir, mit zweitausendfünfhundert Dollar für einen herkömmlichen Zweiteiler muß man schon rechnen, es könnte aber je nach Stoff und Zuschnitt auch mehr werden. Ein Jackett oder ein Blazer kommen auf fünfzehnhundert, eine Weste auf sechshundert. Und da wir leichteres Material bevorzugen und demgemäß ein zweites Paar Hosen dazu empfehlen, gilt für das zweite Paar ein Sonderpreis von achthundert. Vernehme ich da ein schockiertes Schweigen, Mr. Osnard?«
»Ich dachte, für’n Anzug wären normal zwei Riesen fällig.«
»Das war auch so, Sir, bis vor drei Jahren. Aber dann ist leider Gottes der Dollar in den Keller gegangen, während wir von P & B in der Pflicht waren, auch weiterhin die besten Stoffe einzukaufen, edelste Stoffe, wie ich Ihnen wohl nicht erst zu erklären brauche, die wir ausschließlich verwenden, ungeachtet der Kosten und meist aus Europa importiert und das alles« – er war kurz davor, irgendein Fantasiewort wie »Währungsrelationen« zu gebrauchen, hielt sich aber zurück. »Obwohl ich gehört habe, Sir, daß ein guter Anzug von der Stange – nehmen wir einmal einen Ralph Lauren zum Maßstab – auch bereits auf die zweitausend zugeht und gelegentlich sogar schon darüber hinaus. Darf ich ferner darauf hinweisen, Sir, daß wir auch hinterher immer für unsere Kunden da sind? Zu einem gewöhnlichen Herrenausstatter kann man wohl kaum zurückgehen und reklamieren, daß der Anzug ein wenig eng in der Schulter ist, habe ich recht? Jedenfalls geht das nicht ohne zusätzliche Kosten ab. Was genau können wir denn eigentlich für Sie tun?«
»Für mich? Na, so das Übliche. Erstmal vielleicht zwei Straßenanzüge, und sehen, wie die sitzen. Danach dann eine komplette Ausstattung. Mit allem Pipapo.«
»Mit allem Pipapo«, wiederholte Pendel ehrfürchtig, während zahllose Erinnerungen an Onkel Benny auf ihn einstürzten. »Es ist gewiß zwanzig Jahre her, seit ich diesen Ausdruck das letztemal gehört habe, Mr. Osnard. Du liebe Zeit. Mit allem Pipapo. Nicht zu glauben.«
Hier hätte wahrscheinlich jeder andere Schneider seine Begeisterung in Zaum gehalten und sich wieder seiner Marineuniform zugewandt. Und Pendel an jedem anderen Tag wohl auch. Ein Termin war vereinbart, der Preis abgemacht, ein erster Kontakt geknüpft. Aber Pendel war jetzt gut gelaunt. Nach dem Besuch bei der Bank hatte er sich einsam gefühlt. Er hatte nur wenige englische Kunden und noch weniger englische Freunde. Louisa, vom Geist ihres verstorbenen Vaters geleitet, wußte das zu verhindern.
»Und P & B ist tatsächlich immer noch der einzige Laden in der Stadt?« fragte Osnard. »Schneider der Kapitalisten und Krösusse und so weiter?«
Über die Krösusse mußte Pendel lächeln. »Ein netter Gedanke, Sir. Gewiß sind wir stolz auf das Erreichte, doch überheblich sind wir nicht. Die letzten zehn Jahre waren für uns kein Zuckerschlecken, das kann ich Ihnen versichern. Offen gesagt es gibt in Panama nur wenig Sinn für guten Geschmack. Das heißt, es gab wenig davon, bis wir dann gekommen sind. Wir mußten die Leute erziehen, bevor wir ihnen etwas verkaufen konnten. Soviel Geld für einen Anzug? Die haben uns für verrückt gehalten, oder noch Schlimmeres. Aber dann ist das Geschäft nach und nach in Gang gekommen, bis es kein Halten mehr gab, wie ich erfreut vermelden kann. Die Leute begriffen allmählich, daß wir ihnen nicht bloß einen Anzug hinwerfen und Geld dafür haben wollen, sondern daß wir auch Service zu bieten haben, daß wir Änderungen vornehmen, daß wir immer für sie da sind, daß wir Freunde und Helfer sind, Menschen. Sie sind nicht rein zufällig von der Presse, Sir? Kürzlich ist ein recht schmeichelhafter Artikel über uns in der hiesigen Ausgabe des Miami Herald erschienen, der Ihnen vielleicht ins Auge gefallen ist.«
»Muß ich übersehen haben.«
»Nun, ich will einmal so sagen, Mr. Osnard. Mit allem gebührenden Ernst, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir kleiden Präsidenten und Anwälte ein, Bankleute und Bischöfe, Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung, Generäle und Admirale. Wir kleiden jeden ein, der einen Maßanzug zu schätzen weiß und bezahlen kann, ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Religion und Ansehen. Wie finden Sie das?«
»Klingt vielversprechend. Sehr vielversprechend. Also dann, um fünf Uhr. Blaue Stunde. Osnard.«
»Fünf Uhr, in Ordnung, Mr. Osnard. Ich freue mich auf Ihren Besuch.«
»Ich mich auch.«
»Mal wieder ein guter neuer Kunde, Marta«, sagte Pendel, als sie mit einigen Rechnungen eintrat.
Aber wie immer fiel es ihm schwer, ganz ungezwungen mit Marta zu reden. Und auch ihre Art, ihm zuzuhören, war alles andere als normal: den mißhandelten Kopf von ihm abgewandt, die klugen dunklen Augen auf etwas anderes gerichtet, das Entsetzliche hinter dem Schleier ihres schwarzen Haars verborgen.
Und das war’s. Eitler Narr, wie er sich hinterher schimpfte, fühlte sich Pendel belustigt und geschmeichelt zugleich. Dieser Osnard war offensichtlich ein Witzbold, und Witzbolde hatte Pendel ebenso gern wie Onkel Benny, und was auch immer Louisa und ihr verstorbener Vater dazu sagen mochten, die Briten brachten nun einmal die besten Witzbolde hervor. Nach all den Jahren, seit er der alten Heimat den Rücken gekehrt hatte, war Panama am Ende vielleicht doch gar nicht so übel. Daß Osnard sich über seine berufliche Tätigkeit ausgeschwiegen hatte, machte ihm nichts aus. Viele seiner Kunden waren ähnlich verschwiegen, andere, denen es angestanden hätte, waren es nicht. Pendel war belustigt, er war kein Hellseher. Und nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, befaßte er sich wieder mit der Admiralsuniform, bis der mittägliche Ansturm des frohen Freitags begann, wie er den Freitagmittag nannte, bis Osnard kam und ihm den Rest seiner Unschuld raubte.
Und wer hätte heute die Prozession anführen sollen, wenn nicht der unvergleichliche Rafi Domingo höchstpersönlich, bekannt als Panamas Playboy Nummer eins und einer von denen, die Louisa ganz und gar nicht ausstehen konnte.
»Señor Domingo, Sir!« – Pendel breitete die Arme aus – »Welch Glanz in meiner Hütte! Und in dem Anzug sehen Sie ja geradezu verboten jugendlich aus, wenn ich so sagen darf!« – er senkte rasch die Stimme – »Und darf ich Sie daran erinnern, Rafi, wie der selige Mr. Braithwaite den perfekten Gentleman definiert hat?« – er zupfte respektvoll am Ärmel von Rafis Blazer – »Die Hemdmanschetten dürfen nie mehr als einen Fingerbreit zu sehen sein.«
Danach wird Rafis neue Smokingjacke anprobiert, was freilich nur geschieht, um sie den anderen Freitagskunden vorzuführen, die allmählich mit ihren Handys und qualmenden Zigaretten und ihren Zoten und Prahlereien über Geschäfte und sexuelle Eroberungen im Laden zusammenkommen. Als nächster erscheint Aristides der braguetazo, was bedeutet, daß er nach dem Geld geheiratet hat; seine Freunde halten ihn aus diesem Grund für einen Märtyrer des Mannestums. Dann kommt Ricardo, der sich Ricki nennen läßt und während einer kurzen aber einträglichen Amtszeit in den höheren Rängen des Ministeriums für Öffentliche Bauten sich selbst das Recht verliehen hatte, von nun an bis in alle Ewigkeit sämtliche Straßen Panamas zu bauen. Mit ihm ist Teddy gekommen, auch der Bär genannt, der meistgehaßte und zweifellos auch der häßlichste Zeitungskolumnist von Panama; wo er auftaucht, breitet sich eisige Kälte aus, aber Pendel bleibt davon unberührt.
»Teddy, ruhmreicher Schreiber, Hüter von Reputationen. Gewähren Sie dem Leben eine Pause, Sir, und unsrer müden Seele Ruh.«
Ihnen auf den Fersen folgt Philip, vormals Gesundheitsminister unter Noriega – oder Erziehungsminister? »Marta, ein Glas für Seine Exzellenz! Und einen Tagesanzug, bitte, ebenfalls für Seine Exzellenz – eine letzte Anprobe, dann dürften wir fertig sein.« Er senkt die Stimme. »Und meinen Glückwunsch, Philip. Wie ich höre, ist sie ja ein höchst mutwilliges Wesen, dazu wunderschön und sehr in Sie verliebt«, murmelt er in taktvoller Anspielung auf Philips neueste chiquilla.
Diese und andere wackere Männer kommen und gehen aufgeräumt am letzten frohen Freitag der Menschheitsgeschichte in Pendels Bekleidungshaus. Und Pendel, der leichtfüßig von einem zum andern schreitet, lacht, verkauft und die Weisheiten des guten alten Arthur Braithwaite zitiert, behandelt diese Leute voller Ehrerbietung und läßt sich von ihrer guten Laune anstecken.
3
Es war, wie Pendel später meinte, vollkommen angemessen, daß Osnards Eintreffen bei P & B von einem Donnerschlag mit, wie Onkel Benny gesagt haben würde, allem Drum und Dran begleitet wurde. Bis dahin war es ein funkelnder panamaischer Nachmittag in der Regenzeit gewesen, mit einem freundlichen Spritzer Sonnenschein und zwei hübschen Mädchen vor dem Schaufenster von Sallys Geschenkboutique auf der anderen Straßenseite. Und die Bougainvillea im Garten nebenan war so wunderschön, daß man hätte hineinbeißen können. Dann kommt um drei Minuten vor fünf – Pendel hatte aus irgendeinem Grund nie bezweifelt, daß Osnard pünktlich sein würde –, ein brauner Ford Kombi mit einem Avis-Aufkleber auf der Hecktür vorgefahren und hält auf dem für Kunden reservierten Parkplatz. Und dieses unbekümmerte Gesicht mit dem schwarzen Haarschopf, das wie ein Halloween-Kürbis hinter der Windschutzscheibe hing. Wieso Pendel plötzlich an Halloween denken mußte, konnte er sich selbst nicht erklären, aber so wars. Es muß an den runden schwarzen Augen gelegen haben, sagte er sich später.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!