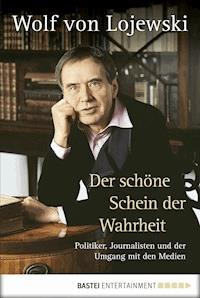
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Politiker machen Fehler, die Medien nicht. Sie liegen immer im Trend, denn der Trend sind sie selbst." Eine beängstigende Aussage. Aber trifft sie wirklich zu? Kritisch und selbstkritisch blickt der "Künstler der Nachricht", einst selbst ein einflussreicher Mitspieler in der Medienarena, auf das tägliche Menü der Krisen und Katastrophen und auf die Welt des schönen Scheins, die insbesondere das Fernsehen Abend für Abend in unsere Wohnstuben zaubert. Denn auch wenn der seriöse Journalist sich berufen fühlt, nichts als die Wahrheit zu berichten, eines ist klar: Bereits die Auswahl der Nachrichten unterliegt Trends, und der Wettbewerb, schneller zu sein als die Konkurrenz und keine Sensation zu verpassen, verführt zu Klischees und Kompromissen. Das Ringen zwischen Politik und Medien, zwischen seriöser Berichterstattung und dem Sog der Unterhaltung - Wolf von Lojewski weiß, wovon er spricht. Aufschlussreiche Erlebnisse und Anekdoten aus seinem reichen Journalistenleben und seine scharfen Beobachtungen fügen sich zu einer brillanten Analyse, die zum Nachdenken über die Grenzen der Politik und die Medien als Machtfaktor anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolf von Lojewski
DER SCHÖNE SCHEINDER WAHRHEIT
Politiker, Journalistenund der Umgang mit den Medien
Lübbe Digital
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG erschienenen Werkes
Lübbe Digital in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Originalausgabe:
Copyright © 2006 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Textredaktion: Sibylle Auer, München
Lektorat: Regina Maria Hartig
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe, vorbehalten
ISBN 978-3-8387-3233-6
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
INHALT
Die Medien sind wir
Der schönste Beruf der Welt
Wie werde ich Moderator?
Vom Hasen und vom Igel
Stars und Prominente
Einsatz in Krieg und Katastrophen
Das Karussell der Krisen
Leben mit dem Zensor
Warum sind wir nicht happy?
Her mit dem Kriterien-Katalog!
Blöd is beautyful
Mit dem Strom und gegen den Strom
Der Herr Bundeskanzler schläft
Bruder Martins Geschichte
Eine Welt ohne Journalisten
Zwischen Jütland und Aleppo
Die Kunst zu fragen
Recherche und der schöne Schein
Wie der Bulle pisst
Die Macht der Medien oder: Eine enttäuschte Liebe
Leben im Internet
Wahrheit A und Wahrheit B
Globale Spieler und lokale Helden
Das achte Gebot
Auf der Suche nach der Heimat
Personen- und Sachregister
Ach, wer kann in unsern Tagen
denn noch wagen, nein! zu sagen,
der mit kindlichem Gemüt
morgens in die Zeitung sieht?
Wilhelm Busch, Der heilige Antonius von Padua (1870)
Die Medien sind wir
Nehmen wir mal an, die Geschichte sei frei erfunden. Sie geistert in meinem Kopf herum – als Warnung, dass man im Umgang mit Leuten wie mir nicht vorsichtig genug sein kann. Sie geht so: Der päpstliche Gesandte besucht Chicago, der Anlass ist eher protokollarischer Art. Keine Sensationen zu erwarten, keine Emotionen, keine Skandale, kein kirchlicher Streit, nichts, das im harten Wettbewerb der Chicagoer Zeitungen Aussicht hätte, Schlagzeilen zu machen… Da brüllt einer der auf dem Flughafen wartenden Reporter dem ehrwürdigen Gast die respektlose Frage zu: »Eminenz, werden Sie in Chicago auch einen Nachtclub besuchen?«
Der Nuntius zögert, doch dann besinnt er sich auf seine langjährige Erfahrung im Entschärfen delikater Situationen, droht ein wenig neckisch mit dem Zeigefinger und ruft in einer Mischung aus frommer Naivität und väterlicher Strenge in Richtung der lauten Schar: »Mein Sohn, gibt es denn bei euch auch Nachtclubs?« Am nächsten Morgen die Schlagzeile im Lokalteil der Chicago Daily News: »Gibt es bei euch auch Nachtclubs? – Das war die erste Frage des päpstlichen Nuntius nach seiner Landung in Chicago!«
Vorfälle dieser Art würde man heute als Kommunikationsdefizit bezeichnen. Politiker, Wirtschaftsführer und bedeutende Zeitgenossen aller Art stellen immer wieder mit Verbitterung fest, dass ihre Ideen und wunderbaren Programme auf eine vertrackte Art die Öffentlichkeit nicht so erreichen, wie sie es eigentlich verdienten. Auf dem Wege zum Zuschauer, Hörer oder Leser werden sie entstellt und zerrupft. Kaum dass sie gedruckt oder gesendet sind, wird das Urteil der üblichen Kritiker und politischen Gegner eingeholt, selbst Parteifreunde lassen sich hinreißen, Mäkliges in die Debatte einzuwerfen, und so dreht sich das Karussell der Krisen, ein neuer Hoffnungsstrahl verblasst, und nirgendwo ist eine Lösung in Sicht. Jene, für die die Politiker sich so plagen – eine verwirrte, undankbare Öffentlichkeit –, rufen schließlich nach Rücktritt oder wählen die unglücklichen Erretter ab.
So stellt sich die Frage, wie sich solche Niederlagen vermeiden lassen und wie man klugerweise mit jener launischen Meute umgehen sollte, die sich »die Medien« nennt. Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Da gibt es allerlei nützliche Rezepte, aber keine Garantie, dass sie im Einzelfall auch funktionieren.
Zugegeben, wir Journalisten sind auf dem Wege zu strahlenden Horizonten den Politikern selten eine Hilfe, sondern eher Experten im Kritisieren, im Herausfinden von Skandalen, Schwächen und Widersprüchen. Aber wahrscheinlich ist es gerade das, was die Öffentlichkeit von uns erwartet. Wären die Leser, Zuhörer, Zuschauer und die Internet-Gemeinde stets auf der Suche nach dem Harmonischen und Guten, hätte all unser Treiben doch keinen Sinn. Schlimmer noch für die Medienbranche: Wir hätten keinen Markt! Die Zeitungen würden Politikerreden in ganzer Länge drucken und brauchten keinen mehr, der darin kürzt und redigiert und dann in langen Kommentaren alles viel besser weiß. Die Fernsehsender würden jeglichen Schund und Skandal, jede Grausamkeit und sexuelle Verirrung aus ihren Programmen streichen und von morgens bis abends Gottesdienste, frohe Lieder und Bundestagsdebatten übertragen. Automatisch müsste sich dann auch die Politik dem neuen Trend anpassen: kein Streit, kein böser Vorwurf gegen das andere Lager, CSU-Abgeordnete und die Linken reichen sich die Hand, die Grünen spenden artig Beifall, wenn jemand von der FDP das Rednerpult betritt…
Machen wir uns nichts vor: Die Medien sind wir! Wir als Zuschauer, Hörer und Leser, und wir als Journalisten und Programmdirektoren. Hätten wir, das Publikum, einen anderen Geschmack oder ein sanfteres Gemüt, es würde niemand wagen, uns von morgens bis abends mit Unheil und Katastrophen und dem Treiben von Terroristen, Diktatoren und Kinderschändern zu überhäufen. Zeitungen und Fernsehschirm wären vollgepackt mit Geschichten von Menschen und Institutionen, die der Gesellschaft ein Vorbild sind.
Alle Versuche mit den sogenannten »guten Nachrichten« sind jedoch nach kurzer Verzückung wieder im allgemeinen Desinteresse versickert. Und so muss man die Presse und all die Medien, die aus ihr hervorgegangen sind, auch nicht als Beifallskulisse der Demokratie ansehen, sondern eher als ihren Prüfstand und Härtetest, der vor allem das Schlingern und Rattern und alle ungewöhnlichen Geräusche im öffentlichen Raum mit Alarm registriert. Schon als junger Reporter hatte ich schnell die Fähigkeit entwickelt, in Pressekonferenzen und auf Feierstunden all die pathetischen Passagen der Ministerreden entspannt an mir vorbeiwehen zu lassen. Aber wenn einer plötzlich etwas Neues und Überraschendes sagte oder etwas, das auch nur in leisesten Tönen anders klang als die Lehrsätze und Parolen seiner Partei, seines Regierungschefs oder Fraktionsvorsitzenden, dann meldete sich so eine Art Autopilot, und ich war hellwach.
Aber zurück zu der Frage, wie man denn nun als Politiker oder Wirtschaftsführer im Zeitalter der Kommunikation mit Leuten wie mir am besten auskommt. Manager nehmen Lehrgänge in diesem Fach, und gelegentlich wird mir angeboten, vor einem solchen Publikum Dozent zu sein. Dies habe ich stets dankend abgelehnt, denn meinen Rat hätten sie ja doch nicht angenommen: »Sagen Sie einfach nur die Wahrheit – kurz und in klaren, verständlichen Sätzen! Und wenn Sie etwas nicht wissen oder Ihrer Sache nicht sicher sind, dann geben Sie es zu!«
Ich höre schon die Antwort, ein solcher Ratschlag sei naiv. Im Umgang mit der Wahrheit gebe es eine Menge zu bedenken: den Zorn des Ministers, die Enttäuschung der Aktionäre, die Unruhe in der Belegschaft, in der Partei oder in der Öffentlichkeit, den Umsatz, die nächsten Wahlen, die Karriere, das Wohl der Familie und tausend andere übergeordnete Werte und Gefahren. Daraus lernen wir, dass für Menschen, die Verantwortung tragen, vieles einfach wichtiger ist als die Wahrheit. Und so müssen wir damit leben, dass es eben schwierig bleibt mit uns Journalisten und der Kommunikation.
Und noch ein Hinweis – gleichsam eine Gebrauchsanweisung für die folgenden Kapitel. Es gibt immer mehr Frauen in unserem Beruf, eine positive Entwicklung. Denn während man bei Baggerführern oder Möbelpackern noch nach Argumenten fahnden könnte, weshalb Männer für diese Arbeit eine größere Eignung haben, fallen mir solche Bedenken für den Journalistenberuf nicht ein. Eine solche Erkenntnis verlangt natürlich nach Konsequenzen– auch vom Autor eines Buches. Gesellschaftliche Realität und präziser Umgang mit der Sprache fordern beispielsweise Formulierungen wie diese: »Das Verhältnis des Politikers/der Politikerin zu Journalisten und Journalistinnen ist manchmal etwas verklemmt, weil jeder/jede aus ihrer/seiner besonderen Interessenlage heraus in stetiger Versuchung ist, den anderen/die andere zu manipulieren.« Meiner Faulheit kämen solche Sätze durchaus entgegen, das Buch würde mit geringerem Aufwand erheblich an Umfang gewinnen. Ich will stattdessen ein Gleichnis – etwas Juristisches, Politisches und Praktisches – heranziehen: die alte »Schleswig-Holsteinische Schokoladen-Verordnung«.
Es geschah kurz nach der Währungsreform, und ein noch junger Landtag machte seine ersten tastenden Gehversuche auf dem Weg zurück in die Demokratie. Seit kurzem erst gab es wieder Schokolade. Es erscholl der Ruf an die Obrigkeit nach Kriterien. Wie viel Zucker im Verhältnis zum viel leichteren und teureren Kakao? Mehlzusatz gestattet oder nicht? Aromen ja oder nein, und wenn ja, welche? Das Problem muss wohl kurz vor einem Weihnachtsfest auf den schleswig-holsteinischen Landtag zugerollt sein, die Schokoladen-Weihnachtsmänner waren bereits im Anmarsch.
Als endlich alles geklärt und korrekt verordnet war, ist jemandem gerade noch rechtzeitig eingefallen, dass man aus Schokolade ja noch mehr formen kann als nur Weihnachtsmänner und dass der Gesetzgeber spätestens zu Ostern wieder an die Arbeit müsse. So setzte man eine Schlussklausel in diese denkwürdige Verordnung, die uns im nun Folgenden ein Leuchtfeuer sein soll zur absoluten und uneingeschränkten Gleichstellung von Journalistinnen und Journalisten und Politikerinnen und Politikern, Männern und Frauen: »Weihnachtsmann im Sinne des Gesetzes ist auch der Osterhase!«
Der schönste Beruf der Welt
Fliegen, fliegen, fliegen… Die Nacht war kurz. Wie spät mag es jetzt wohl am Zielort in Adelaide sein? Die Außentemperatur beträgt laut Bordcomputer minus vierzig Grad. Die vierstrahlige Maschine schwebt in zehn Kilometern Höhe nach Südosten. Auf dem kleinen Bildschirm vor mir leuchtet eine Weltkarte in Grün, Blau und rötlichem Braun. Ein kleines Flugzeugsymbol ruckelt sanft Stück für Stück vorwärts. Die indische Hauptstadt Delhi haben wir links liegen lassen und steuern jetzt auf den Golf von Bengalen zu. Das rötliche Braun muss der Himalaya sein. Etwa acht Stunden sind wir schon unterwegs, und wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Strecke nach Australien hinter uns.
Die chinesische Stewardess gibt sich alle Mühe, ihre Gäste mit Namen anzusprechen. Bei meinem ist das eine besondere Herausforderung. Wir haben es geübt, und nun kommt sie in regelmäßigen Abständen vorbei, um ihre Fortschritte überprüfen zu lassen. All die verknautschten, im Halbschlaf versunkenen Gesichter um uns herum blinzeln erheitert unter ihren Decken hervor, dankbar für jede Abwechslung auf der langen Reise.
Australien! Die ersten Reisenden waren britische Strafgefangene, die man am anderen Ende der Welt ans Ufer kippte, um die Gefängniskosten zu sparen. Vier Monate dauerte die Überfahrt, und von denen, die das wilde Geschaukel eingepfercht im engen Bauch des Schiffes überlebten, war mit Gewissheit anzunehmen, dass sie niemals wiederkehren würden. Die ersten Nicht-Engländer, die sich im frühen 19. Jahrhundert freiwillig auf die lange Reise machten, kamen aus Brandenburg und Schlesien und weigerten sich, ihrem König in Glaubensfragen zu folgen. Auch für sie war es ein Abschied für immer.
Gemessen am Reisekomfort jener Zeit ist das sanfte Geschaukel durch eine milchige Wolkenlandschaft heute ein Genuss. Wir leben in einer rasend modernen, von Unsicherheit und Ängsten geprägten und dennoch überaus spannenden Zeit. Und die interessanteste Art, diese Welt zu erleben, ist für mich zweifellos der Journalistenberuf.
Techniker, Chemiker und Mediziner dringen bei ihren Forschungen in immer intimere Bereiche der Schöpfung vor, um die Baupläne des Lebens und des Universums zu entschlüsseln. Und Journalisten und Politiker müssen versuchen, mit dem schwindelerregend Neuen in der Welt Schritt zu halten, den Nutzen zu erkennen, die Gefahren abzuwägen. Beide verbindet das Talent, von allem etwas, aber von wenigem viel zu verstehen. Und während der Politiker herausgefordert ist, für all die faszinierenden oder auch gefährlichen Entdeckungen der Wissenschaft Weichen zu stellen, Entscheidungen zu treffen, sie zu fördern oder zu verbieten, so ist es Auftrag des Journalisten, hier eine Art Übersetzer zu sein, ein Experte, dessen Horizont im Einzelfall begrenzt sein mag, der aber das Prinzipielle an einer Sache so weit überschauen sollte, dass es ihm gelingt, bei seinem Publikum Neugier, Interesse oder auch Zweifel zu wecken.
Langstreckenflüge sind immer dazu angetan, Gedanken über das Große und Ganze anzustellen. Man sieht vielleicht noch einen Film, liest, klappert auf dem Laptop herum, döst, trinkt und isst alles Mögliche durcheinander, um schließlich müde und philosophisch gestimmt in den Sessel zu sinken. In solchem Schweben über Meeren und Kontinenten, kilometerhoch über den Eiswüsten von Grönland, packte mich gar einmal das Verlangen, einen Roman zu schreiben: über große Ideale und bittere Enttäuschung, über Schicksale und Krisen, an denen der Journalist vorüberzieht, angelockt vom Glück oder Unglück anderer, persönlich nur für kurze Zeit hineingezogen, mehr Zuschauer und professioneller Betrachter als persönlich Beteiligter am Leben… Jeder Reiz und jeder Gedanke werden schon bald vom nächsten überdeckt. Man ist immer unterwegs, immer auf dem Sprung und jederzeit bereit, vor ein Publikum zu treten – ein Medium, das Signale auffängt und weitergibt in der Hoffnung, dass sie irgendjemand versteht.
Nun also unterwegs nach Australien. Immer schon wollte ich einmal dorthin. Stopover in Singapur, der Drehscheibe zwischen den Kontinenten. Jedes Mal, wenn man als Reisender in den kleinen Stadtstaat kommt, gibt es ein paar Wolkenkratzer mehr. Wo einst zu Kolonialzeiten abenteuerliche Kulisse war, ist es heute sauber und ordentlich. Alle Spuren früherer Sünde und Exotik sind zubetoniert und weggescheuert. Straßenüber- und unterführungen sind mit Palmen und tropischen Blumen bepflanzt, nirgendwo gibt es Abfall oder Schmierereien. Rauchern wird man hier nicht mehr begegnen, Kaugummi gibt es in den Läden nicht mehr zu kaufen. Wer böswillig die Straße verschmutzt, muss mit einer behördlich verordneten Prügelstrafe rechnen, auf Drogenhandel steht die Todesstrafe.
Singapur brodelt von jungen Menschen – strebsam, höflich, einkaufswütig. Die Orchard Road, die zu Somerset Maughams und Rudyard Kiplings Zeiten tatsächlich noch ein Obstgarten gewesen sein mag, ist heute eine Schlucht aus Shopping-Arkaden. Der Europäer läuft durch diese geschäftige Kulisse wie der Zauberlehrling, der darüber staunt, mit welcher Wucht Asien den Pulsschlag der Wirtschaft erhöht. Lernen, arbeiten, einkaufen – das ist der Takt des Lebens.
Zurück zum Flughafen, einsteigen in die Düsen- und Zeitmaschine, Tür zu und noch mal sieben Stunden Schaukeln und Gleiten. Dann wird die Klappe sich wieder öffnen, und wir sind endlich am Ziel…
Beim Blick aus dem Fenster sieht der Flugreisende Wasser. Und plötzlich eine Küste und üppiges Grün, aber nur für ein paar Augenblicke. Dann leuchtet es von unten steingrau und rot. Eine menschliche Siedlung ist nirgends auszumachen. Keine Wolken mehr, jedenfalls nicht zwischen März und Oktober. Nur Sonne, blauer Himmel und darunter dieses unendliche Rot und Grau. Etwa fünfzehn Mal so groß wie Deutschland ist der Kontinent, und dennoch leben bei uns viermal mehr Menschen als in ganz Australien.
Den übermüdeten, aber nun doch erwartungsfroh einschwebenden Europäer beschleicht die Frage: Was hat Gott, als er die Welt erschuf, für Pläne mit Australien gehabt? Sind ihm gegen Ende der Schöpfung die Materialien ausgegangen und nur noch Wüste und Eukalyptussträucher übrig geblieben, die irgendwo zu entsorgen waren? Oder wollte er vielleicht ein abstraktes Kunstwerk schaffen? Australien ist so völlig anders als der Rest der Welt: üppig blühend an den Rändern und innen von bizarrer Schönheit, trocken, heiß und leer.
Beim Landeanflug auf Adelaide im Süden kommt mir der Häuserbrei dort unten wie eine Stadt in Amerika vor. Der Empfang ist freundlich, der Passbeamte kennt meine Daten schon aus dem Internet, die Sonne strahlt, der Taxifahrer ist als Kind aus Griechenland gekommen und erzählt voller Stolz, dass seine Landsleute hier in Adelaide die größte Einwanderergruppe stellen. Die zweitgrößte seien die Deutschen. Und der nächste gebürtige Grieche, der mir über den Weg läuft, erklärt mir das Lebensgefühl in seiner neuen Heimat so: »Wenn du arbeitest, lebst du hier wie ein König. Und wenn du nicht arbeitest auch!«
Ganz so ist es natürlich nicht. Wer einmal – und sei es nur kurz – seine Nase in das »wahre« Australien steckt, der entdeckt dort freies, aber auch hartes und gefährliches Leben. Er wird »Städte« kennen lernen, die zehn, höchstens zwanzig Einwohner haben, und die nächste Siedlung ist etwa zweihundert Kilometer entfernt. Zentrum solcher Inseln der Zivilisation ist jeweils der Pub. T-Shirts, Mützen und Büstenhalter zieren diese Kneipen. Und Tausende von Visitenkarten, die Zeugnis ablegen: »Auch ich war in Mataranka oder William Creek!«
Die großen Highways sollte man hier tunlichst nicht verlassen. An jedem Tresen in jedem Pub kursieren Geschichten von Touristen, die irgendwo auf staubiger Piste eine Panne hatten, und niemand kam vorbei. Als man sie fand, lagen sie verdurstet unter irgendwelchen Büschen. Die Hitze im Outback kann gnadenlos sein, die Einsamkeit geradezu außerirdisch, Sonnenauf- und Sonnenuntergänge sind überwältigend. Man kann auch mit dem Zug quer durch das Buschland und die Wüsten reisen, in zwei Tagen und zwei Nächten von Süd- nach Nordaustralien oder umgekehrt.
Du schaust aus dem Fenster, und draußen immer das gleiche Bild: Wüste, Büsche, Termitenhügel… Du fängst an zu grübeln über Geborgenheit und Abenteuerlust, über Zivilisation und Natur, über die Weite des Universums und über dich selbst. Schon in der Schule wurde uns eingetrichtert, dass die Erde eine Kugel sei. So theoretisch im Klassenraum nimmt man das ja noch gutmütig hin. Doch hier, am anderen Ende der Welt, erfordert es einen festen Glauben an die kosmischen Gesetze, um sich vorzustellen, dass die Lieben daheim in Europa in diesem Augenblick verkehrt herum an der Decke hängen. Offenbar fordern unsere Instinkte eine klare Orientierung, wo oben und wo unten ist, und suchen einen festen Halt.
Spätestens an dieser Stelle wird dem Journalisten wieder einmal bewusst, wie interessant, wie schön sein Beruf ist, wie vollgepackt mit Eindrücken und Erlebnissen, die eigentlich für mehrere Leben reichen. Vielleicht sollte man ja nicht zu sehr über einen Planeten ins Schwärmen geraten, der so viel Unrecht und Grausamkeit, Gleichgültigkeit und zerstörerische Kraft unter seinen Bewohnern duldet. Der Journalist kommt immer wieder in Situationen, in denen er solch düstere Gedanken unterdrücken oder beiseite schieben muss. Er will sich einreden und unverdrossen daran glauben, dass jeder Missstand zu beseitigen sei, wenn es ihm oder einem seiner Kollegen wieder einmal gelingen sollte, einen Skandal aufzudecken. Denn das ist ja das Glaubensbekenntnis dieses Berufes: Information schafft öffentliches Bewusstsein, rüttelt auf und weckt die guten Kräfte in uns Menschen.
Die Erfahrung spricht natürlich dagegen. Ich habe während vieler Jahrzehnte über Skandale und Kriege, über Leid und Unrecht berichtet. Doch dass die Welt durch meine Berichte, Reportagen oder Moderationen erkennbar besser geworden wäre, kann ich nicht behaupten. Verbrechen und Katastrophen wiederholen sich; ein Krieg geht zu Ende, und der nächste beginnt; immer neue Regierungen versprechen soziale Gerechtigkeit, eine blühende Wirtschaft und für jeden einen Arbeitsplatz. Am Ende kommt meist etwas dazwischen. Mal sind es die weltweite Wirtschaftsschwäche und die schlechten Rahmenbedingungen, mal ist der politische Gegner schuld, mal ist ein Glück wie die deutsche Einheit nur schwer zu verkraften. Und jedes Mal ist es die Presse, die alles durcheinander bringt und mit ihrem Pessimismus und Gemäkel die Stimmung verdirbt.
Etwas getröstet hat mich jüngst die Begegnung mit Schwester Agnes. Sie lebt im Konvent Mariannhill in der Nähe der südafrikanischen Stadt Durban. In ihrem Kloster ist sie zuständig für »Kommunikation«, den Kontakt mit der Außenwelt im weitesten Sinn. Schwester Agnes ist klein, gedrungen, dynamisch, etwa im gleichen schon etwas gehobenen Alter wie ihre Mutter Oberin, aber nicht so feingliedrig und blass, hat eine kräftige Stimme und einen klaren Blick, die Antennen sind voller Mitgefühl auf eine deprimierende Außenwelt gerichtet.
Das Leid, das sie am Rande der großen afrikanischen Hafenstadt täglich zu lindern sucht, ist mit unseren Sorgen nicht zu vergleichen. Es würde die Kräfte und die Weisheit nicht nur afrikanischer Regierungen übersteigen, ein solches Meer von Armut trockenzulegen. Die Kriminalitätsrate ist hoch; junge Männer haben nach dem Ende der Rassentrennung hohe Erwartungen, die der Arbeitsmarkt nicht erfüllen kann; die Familienstrukturen in den sogenannten Townships sind nicht so stark, um die soziale Misere aufzufangen. Was immer es an Vorschlägen gibt, Südafrikas Wohlstand und Bodenschätze gerechter zu verteilen – alle haben ihre Schwächen. Es sind die Frauen in den Ghettos, die das Leben irgendwie aufrechterhalten. Und dass der ärmste Kontinent auch noch mit besonderer Heftigkeit von der Seuche Aids heimgesucht wurde, ist selbst theologisch schwer zu erklären. Das Kloster hilft, wo es kann. Die Schwestern schaffen Wohnraum für Familien, unterhalten Arbeitsprogramme, bringen den Kindern Lesen und Schreiben bei. Und mit den Erwachsenen versuchen sie das auch.
Als wir die weitläufige Anlage besichtigt haben – hier und da mit einem unsicheren Blick auf die vielen Stacheldrahtzäune –, nimmt Schwester Agnes uns beim Abschied zur Seite, um uns eine Botschaft nach Europa mitzugeben. Neckisch zupft sie mich am Ärmel und fragt: »Wenn ich einmal sterbe und dem lieben Gott gegenübertrete – was glauben Sie, wird seine erste Frage sein?« Etwas Gescheites fällt mir nicht ein, und so gebe ich zu bedenken, dass ich doch Journalist sei und wohl eher Fragen an ihn hätte als er an mich. Gott wisse doch sowieso schon alles.
Doch Schwester Agnes gibt nicht nach. »Also gut«, versuche ich mein Glück, »er wird wahrscheinlich fragen: ›Hast du auch immer fest an mich geglaubt? Warst du demütig und gehorsam?‹« – »Ach wo!«, ruft lachend die Frau, die täglich so viel Elend sieht. »Er wird fragen: ›Hat dir das Leben Spaß gemacht?‹ – Und ich werde aus vollem Herzen antworten: ›Ja!‹«
Wie werde ich Moderator?
Wissen Sie«, klagte mir eines Tages ein netter Herr auf dem Golfplatz sein Leid, »mit meiner Tochter ist es nicht ganz leicht. Sie sieht gut aus, ist sehr intelligent, aber sie kann sich einfach nicht entscheiden, was sie einmal werden möchte. Als wir neulich wieder einmal darüber sprachen, meinte sie, so was wie Moderatorin im Fernsehen könnte sie eventuell interessieren. Sie kennen sich doch da ein wenig aus: Wie wird man das? Wie kommt man da ran? Bei wem müsste sie sich vorstellen oder bewerben?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























