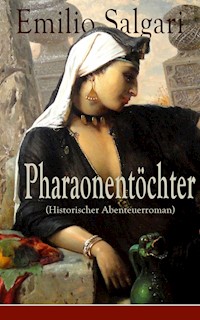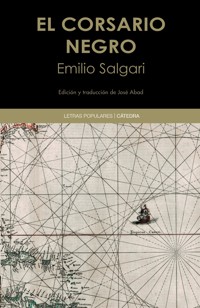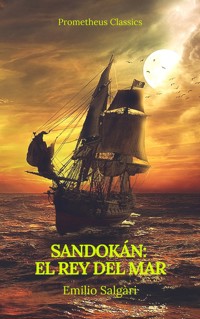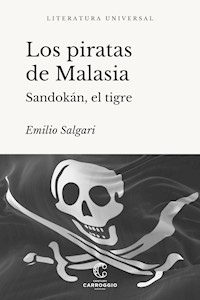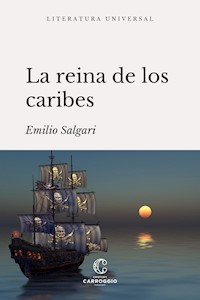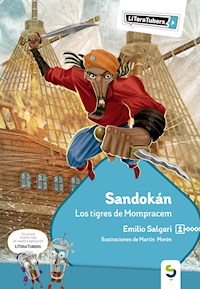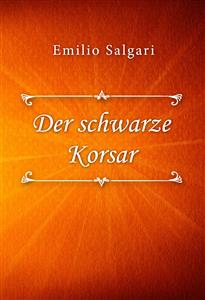
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist die Geschichte von vier Brüdern der Familie Ventimiglia, die an der Seite des Herzogs von Savoyen, für Frankreich gegen die Spanier kämpfen. Während der Kämpfe in Flandern wird eine Marineeinheit, zu der auch die vier Brüder der Familie Ventimiglia gehören, von einer zehnfachen Übermacht eingeschlossen und muss sich in einer Festung verbarrikadieren. Der Anführer dieser Einheit ist der flämische Herzog van Gould. Dieser setzt sich allerdings mit den Spaniern in Verbindung und verspricht ihnen, ihnen die Festung in die Hände zu spielen, wenn sie ihm im Gegenzug den Posten eines Gouverneurs in den amerikanischen Kolonien und eine große Summe Geld geben würden. Als van Gould den Spaniern die Tore öffnete, wird er von dem ältesten der Brüder Ventimiglia überrascht. Er schießt den Ventimiglia nieder und flüchtete dann nach Amerika, wo er den Posten des Gouverneurs von Maracaibo bekleidet. Doch die drei noch lebenden Brüder Ventimiglia stöbern ihn schon nach kurzer Zeit auf und bekämpfen ihn als der „Rote Korsar“, der „Grüne Korsar“ und der „Schwarze Korsar“. Als erstes gelingt es dem Grünen Korsaren, van Gould nahe zu kommen. Dabei fällt er in die Hände der Spanier und wird gehängt. Das gleiche Schicksal erleidet kurz darauf auch der Rote Korsar. Der letzte der Brüder, der schwarze Korsar, schwört blutige Rache und es beginnt eine gnadenlose Auseinandersetzung zwischen den Piraten und Herzog van Gould. Kurz nach der Beisetzung des roten Korsaren wird ein spanisches Schiff geentert. An Bord befindet sich die flämische Herzogin Honorata Willerman, Herzogin von Weltendrem. Der schwarze Korsar beschließt, sie als Geisel mit nach Tortuga mitzunehmen. Die Herzogin fühlt sich unwiderstehlich zu dem Piraten hingezogen und auch er kann sich ihr nicht verschließen. Doch die Herzogin umgibt ein Geheimnis, dass dem schwarzen Korsaren niemals offenbar werden darf...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Emilio Salgari
DER SCHWARZE KORSAR
Copyright
First published in 1898
Copyright © 2019 Classica Libris
Die Flibustier der Insel Tortuga
Eine kraftvolle Stimme erscholl durch Dunkelheit und Wogen Gebraus. Sie rief einem auf den Wogen schaukelnden und sich mühsam vorwärts bewegenden Boote ein drohender Halt zu. Die zwei Seeleute darin zogen die Ruder ein und schauten besorgt auf den riesigen Schiffsschatten, der urplötzlich aus den Fluten vor ihnen aufgetaucht war.
Beide Männer hatten markante, energische Züge, die durch den dichten, struppigen Bart noch kühner erschienen. Sie mochten wohl über die Vierzig sein. Ihre großen Filzhüte waren an vielen Stellen durchlöchert, und ihre zerrissenen, ärmellosen Wollhemden ließen die kräftige Brust sehen. Der rote Schal, den sie als Gürtel umgeschlungen hatten, war ebenfalls in miserablem Zustand, aber er enthielt ein Paar dicke, schwere Pistolen von jenem Ende des 16. Jahrhunderts gebrauchten Kaliber. Barfuß, mit Schlamm bedeckt, saßen sie in ihrem Kanu.
„Was siehst du?“ fragte der eine von ihnen. „Du hast schärfere Augen als ich.“
„Ich sehe nur ein Schiff, kann aber nicht erkennen, ob Freund oder Feind, ob es von der Tortuga oder von den spanischen Kolonien kommt.“
„Nun, wer es auch sein mag – jedenfalls haben sie uns entdeckt, und werden uns nicht entschlüpfen lassen. Ein Kartätschenschuß würde genügen, um uns alle beide zum Teufel zu jagen.“
Jetzt erscholl dieselbe sonore Stimme von vorhin: „Wer da?“
Carmaux, der eine der Bootsleute, stieg auf die Bank und schrie aus Leibeskräften: „Wen die Neugierde plagt, der steige zu uns herab! Unsere Pistolen werden ihm antworten!“
Diese Entgegnung schien den Frager auf der Schiffsbrücke drüben nicht zu erzürnen. Im Gegenteil, er erwiderte belustigt: „Kommt nur herauf, ihr Helden! Die Küstenbrüder wollen euch ans Herz drücken.“
Die beiden Seeleute in dem Boot stießen einen Freudenschrei aus. „Die Küstenbrüder, also Freunde!“
„Das Meer soll mich verschlingen, wenn ich diese Stimme nicht kenne!“ fügte Carmaux hinzu, der die Ruder wiederergriffen hatte. „Nur einer ist so verwegen, bis zu den spanischen Festungen vorzudringen. Der Schwarze Korsar!“
„Donnerwetter! Ja, wirklich, er ist es!“ sagte sein Gefährte aus Hamburg, mit Namen Stiller. „Aber was für eine schreckliche Nachricht müssen wir ihm bringen: Dass die Spanier nun auch seinen zweiten Bruder, den Roten Korsaren, an den Galgen gehängt haben! Vielleicht hoffte er, ihn noch zu retten. Wenn er ihn hängen sieht, wird er sich rächen wollen.“
„Und ich glaube, wir sind dabei, Stiller. Der Tag, an dem der verdammte Gouverneur von Maracaibo seine Strafe erleiden wird, soll der schönste Tag meines Lebens sein! Dann werde ich die beiden Smaragde, die ich in meine Hosen eingenäht habe, zu einem Schmause für die Kameraden spendieren. Sie müssen mindestens tausend Piaster bringen!“
Das Schiff, das man in der Dunkelheit nicht erkennen konnte, befand sich jetzt nur noch ein halbes Ankertau von der Schaluppe entfernt.
Es war eins jener Freibeuterfahrzeuge von der Insel Tortuga, die Jagd auf die großen spanischen Kauffahrteischiffe machten. Letztere wurden oft ihrer Ladung beraubt, wenn sie Schätze aus Mittelamerika, aus Mexiko oder den Gegenden am Äquator nach Europa brachten. Die Flibustier Fahrzeuge waren gute, sehr stark bewaffnete Segler mit hohen Masten zur Ausnutzung der leichtesten Brisen. Sie hatten einen schmalen Kiel und ein sehr hohes Vorder- und Hinterteil. Zwölf lange Kanonen ragten mit ihren schwarzen Hälsen an Backbord und Steuerbord drohend empor, während auf der hohen Schiffsschanze zwei dicke Kanonen steckten, bestimmt, die Brücken der anderen Schiffe mit Kartätschen kugeln zu säubern.
Das Korsaren Fahrzeug hatte sich back gelegt, um das Boot zu erwarten.
Am Bug sah man beim Lichte einer Schiffslaterne zehn bis zwölf Mann mit ihren Flinten schussbereit stehen.
Die beiden Kanufahrer ergriffen das Seil, das ihnen, zusammen mit einer Strickleiter, zugeworfen wurde, sicherten das Boot und zogen sich nun mit großer Geschicklichkeit in die Höhe.
Zwei Männer streckten ihnen die Flintenläufe entgegen, während ein dritter auf sie zutrat und ihnen mit einer Laterne ins Gesicht leuchtete.
„Wer seid ihr?“ fragte er.
„Beim Beelzebub, meinem Schutzpatron!“ rief Carmaux aus. „Erkennt ihr eure Freunde nicht mehr?“
„Ein Haifisch möge mich fressen, wenn das nicht der Biskayer Carmaux ist!“ rief der Mann mit der Laterne. „Wie kommt es, dass du noch lebst, während man dich auf der Tortuga schon für tot hielt? Was? Da ist ja noch einer...! Bist du nicht der Hamburger Stiller?“
„In Fleisch und Blut steht er vor dir“, antwortete dieser.
„Auch du bist dem Strang entgangen?“
„Ja, der Tod wollte mich nicht haben. Und ich dachte auch, besser noch einige Jahre leben!“
„Und wie steht’s mit dem Kapitän?“
„Still, still“, sagte Carmaux leise.
„Du kannst ruhig sprechen! Ist er tot?“
„Bande, ihr! Seid ihr noch nicht fertig mit Schwatzen?“ rief jetzt eine metallisch klingende Stimme.
„Donnerwetter! Der Schwarze Korsar!“ murmelte Stiller mit einem Schreckensschauder.
Carmaux dagegen rief laut: „Hier bin ich, Kommandant!“
Der von der Kommandobrücke Abgestiegene schritt auf sie zu. Die Hand hatte er auf dem Kolben der ihm am Gürtel hängenden Pistole. Er war ganz schwarz gekleidet und mit einer Eleganz, die man bei den Flibustiern des Golfs von Mexiko sonst nicht fand. Letztere begnügten sich gewöhnlich mit Hemd und Hose und kümmerten sich mehr um ihre Waffen als um ihre Gewänder.
Der Kapitän trug einen Kasack aus schwarzer Seide, mit Spitzen von derselben Farbe. Die auch aus schwarzer Seide bestehenden Beinkleider wurden durch eine breite, mit Fransen versehene Schärpe zusammengehalten. Hohe Stulpenstiefel und ein großer Schlapphut aus Filz, von dem eine lange, schwarze Feder bis auf die Schulter niederhing, vervollständigten seinen Anzug.
Auch das Äußere des Mannes hatte etwas von ernster Trauer an sich. Das marmorbleiche Gesicht stach seltsam ab von den schwarzen Spitzen des Kragens und der breiten Hutkrempe. Sein kurzer, schwarzer Bart war etwas gelockt und wie ein Christusbart geschnitten.
Es war ein schöner Mann mit regelmäßigen Zügen und der hohen, leichtdurchfurchten Stirn, die dem Antlitz etwas Melancholisches gab. Die kohlschwarzen Augen unter den langen Brauen blitzten zuweilen in einem solchen Feuer auf, dass sie selbst dem unerschrockensten Flibustier Furcht einflößten. Durch seine große, schlanke Gestalt, sein feines Benehmen und die aristokratischen Hände machte er den Eindruck eines Mannes von hoher Stellung. Vor allem merkte man ihm den Befehlshaber an.
„Wer seid ihr, und wo kommt ihr her?“ fragte er die beiden Bootsleute.
„Wir sind Freibeuter von der Insel Tortuga, zwei Küstenbrüder“, antwortete Carmaux, „und kommen jetzt aus Maracaibo.“
„Seid ihr den Spaniern entwischt?“
„Ja, Kommandant!“
„Zu welchem Schiff gehört ihr?“
„Zu dem Roten Korsaren.“
Kaum hatte der andere diese Worte vernommen, als er auffuhr und die beiden mit sprühenden Blicken maß.
„Zum Schiff meines Bruders?“ fragte er mit bebender Stimme.
Dann legte er einen Arm um Carmaux’ Schultern und zog ihn fast gewaltsam zum Heck. Unter der Kommandobrücke wandte er den Kopf zu einem in straffer Haltung stehenden jungen Manne, seinem Oberleutnant.
„Wir wollen immer kreuzen, Morgan! Die Leute bleiben unter Waffen! Gebt mir sofort Nachricht, wenn sich ein Schiff oder eine Schaluppe naht!“
„Zu Befehl, Kommandant!“ entgegnete der andere.
Der Schwarze Korsar stieg mit Carmaux in eine kleine Kabine hinunter. Dieselbe war behaglich eingerichtet. Eine vergoldete Lampe brannte, obgleich es an Bord der Piratenschiffe verboten war, nach neun Uhr abends noch Licht zu brennen.
Er wies dem Bootsmann einen Stuhl an und stand bleich, mit verschränkten Armen, vor ihm.
„Jetzt erzähle!“ befahl er kurz. „Sie haben ihn getötet, meinen Bruder, den ihr den Roten Korsaren nanntet, nicht wahr?“
„Es ist so“, bestätigte Carmaux. „Sie haben ihn umgebracht, wie früher seinen anderen Bruder, den Grünen Korsaren.“
Ein heiserer, fast wilder Ton kam von den Lippen des Kommandanten.
Er führte die Hand zum Herzen und ließ sich in einen Stuhl fallen, indem er mit der Rechten die Augen bedeckte und laut aufschluchzte.
Dann aber sprang er auf, als ob er sich der Schwäche schämte. Die Erregung, die ihn für einen Moment ergriffen, war überwunden. Die Züge des marmornen Gesichts waren ruhiger, die Stirn freier geworden, aber in den Augen flammte es drohend.
Nachdem er mehrmals in der Kabine auf und ab gegangen, setzte er sich wieder und sagte: „Ich fürchtete schon, dass ich zu spät käme... Sprich, haben sie ihn erschossen?“
„Nein, gehenkt!“
„Bist du dessen sicher?“
„Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen am Galgen gesehen.“
„Wann war das?“
„Noch heute Nachmittag. Aber mutig ist er gestorben, Herr.“
„Rede!“
„Als der Strick ihn umschnürte, hatte er noch die Kraft, dem Gouverneur ins Gesicht zu spucken.“
„Dem Hunde?“
„Ja, dem flämischen Herzog van Gould.“
„Erst hat er einen meiner Brüder durch Verrat getötet und dann den zweiten gehenkt!“ Der Kapitän knirschte mit den Zähnen. „Ich aber werde nicht eher ruhen, bis ich ihn und seine ganze Familie vernichtet habe!“
„Ja, es waren zwei der kühnsten Golfkorsaren!“
„Und die Stadt Maracaibo soll meine Rache spüren!“ fuhr der Kommandant tonlos fort. „Ich lasse keinen Stein mehr dort, wo sie gestanden. Alle Flibustier der Tortuga und alle von San Domingo und Cuba sollen helfen...! Erzähle weiter! Wie haben sie euch gefangengenommen?“
„Wir sind nicht mit Waffengewalt besiegt, sondern überrascht und verhaftet worden, weil wir wehrlos waren. Wie Ihr wisst, hatte sich Euer Bruder nach Maracaibo begeben, um Vergeltung zu üben für den Tod des Grünen Korsaren. Wir waren achtzig Mann, alle mutig und zu jedem Wagnis entschlossen. Aber wir hatten das schlechte Wetter nicht in Betracht gezogen. In der Mündung des Golfs brach ein furchtbarer Sturm los, jagte uns wie rasend von Klippe zu Klippe, bis unser Schiff jämmerlich zerschellte. Nur sechsundzwanzig von unseren Leuten gelang es, unter unendlichen Anstrengungen die Küste zu erreichen. Wir hatten keine Waffen mehr und waren auch körperlich in so übler Verfassung, dass wir nicht den geringsten Widerstand leisten konnten. Der Kapitän führte uns durch die Sümpfe am Strande, uns immer Mut zusprechend. Schon glaubten wir, einen Unterschlupf gefunden zu haben, fielen aber stattdessen in einen Hinterhalt. Leider waren wir auf dem gescheiterten Wrack von den Spaniern entdeckt worden. Dreihundert Soldaten, van Gould an der Spitze, umzingelten uns, griffen uns an und töteten alle, die sich widersetzten. Die andern wurden als Gefangene nach Maracaibo geschleppt.“
„Und mein Bruder war unter diesen?“
„Ja, Kommandant! Er hat sich mit dem einzigen Dolch, der ihm bei dem Schiffbruch geblieben, verteidigt wie ein Löwe, da er den Tod im Kampfe dem Galgen vorzog, aber der Flame hatte ihn erkannt! Als wir unter den Misshandlungen der Soldaten und Beschimpfungen des Volks in Maracaibo ankamen, wurden wir zum Galgen verurteilt. Mein Freund Stiller und ich schienen mehr Glück zu haben als die anderen Gefährte. Gestern Morgen war es uns beiden in der Haft gelungen, unsern Wächter zu überwältigen und zu entfliehen. Von dem Dach einer Negerhütte, in der wir auf der Flucht Unterkunft gefunden hatten, haben wir das grausige Schauspiel der Hinrichtung eures Bruders und der andere Flibustier mit angesehen. Dann erhielten wir am Abend durch Hilfe des Negers ein Boot, mit dem wir über den Golf von Mexiko nach der Tortuga gelangen wollten. Das ist alles, Kommandant.“
„Wird mein Bruder noch heute am Galgen hängen?“ fragte der Kapitän mit dumpfer Stimme.
„Drei Tage lang soll er dableiben.“
„Und dann wird man ihn in eine Grube werfen?“
„Sicher.“
Nach einer Pause wandte sich der Korsar in verändertem Tone an Carmaux: „Hast du Angst?“
„Selbst nicht vor dem Teufel.“
„Du fürchtest auch nicht den Tod?“
„Nein, Kommandant!“
„Wirst du mir folgen?“
„Wohin?“
„Nach Maracaibo!“
„Wann?“
„Diese Nacht!“
„Sollen wir die Stadt angreifen?“
„Nein, dazu sind wir vorläufig nicht stark genug. Aber später wird Morgan zu diesem Zweck meine Befehle erhalten. Wir beide und dein Kamerad gehen vorerst allein.“
„Was gedenkt Ihr zu tun?“
„Die Leiche meines Bruders holen.“
„Seid auf der Hut, Kapitän! Ihr könntet dabei verhaftet werden!“
„Du kennst den Schwarzen Korsaren nicht.“
„Tod und Teufel! Er ist ja der kühnste Flibustier der Tortuga!“
„Geh jetzt und erwarte mich an der Schiffsbrücke! Ich lasse eine Schaluppe zurechtmachen.“
„Das ist nicht nötig, wir haben ja unser Boot. Das läuft wie der Wind.“
Ein verwegenes Unternehmen
Carmaux gehorchte sofort, da er wusste, dass mit dem Schwarzen Korsaren nicht zu spaßen war.
Stiller harrte seiner vor der Kajütenluke. Er stand mit dem Obermaat und einigen Flibustiern zusammen, die ihn über das unglückliche Ende des Roten Korsaren und seines Gefolges befragten. Sie entwickelten ihre Rachepläne gegen die Spanier von Maracaibo und besonders gegen den Gouverneur. Als der Hamburger hörte, dass das Boot zur Küste zurückkehren sollte, der man mit Mühe und Not entronnen war, murmelte er: „Dabei werden wir unsere Haut lassen müssen, Carmaux.“
„Bah, wir gehen ja diesmal nicht allein, der Schwarze Korsar fährt mit.“
„Dann hab’ ich keine Sorge! Der Satansbruder kommt hundert Flibustiern gleich!“
Hierauf wandte sich Carmaux an den Obermaat: „He, Freundchen, lasse drei Gewehre, Munition, ein paar Säbel und etwas Lebensmittel ins Boot legen! Man weiß nie, was einem zustößt und wann wir zurückkehren können.“
„Es ist schon geschehen“, antwortete der Angeredete. „Auch der Tabak ist nicht vergessen worden.“
„Danke, du bist wirklich ein Prachtkerl!“
Jetzt trat der Korsar hinzu. Er hatte noch sein Trauergewand an, hatte sich aber einen langen Säbel umgeschnallt und in den Gürtel ein paar Pistolen gesteckt, dazu einen jener langen, scharfen, Misericordia genannten Dolche. Über dem Arm trug er einen weiten schwarzen Mantel.
Er näherte sich dem Vizekapitän Morgan auf der Kommandobrücke und wechselte einige Worte mit ihm. Dann sagte er kurz zu den beiden Flibustiern: „Los!“
Alle drei stiegen ins Kanu. Der Korsar wickelte sich in seinen Mantel und setzte sich an den Bug, während die Bootsleute wieder angestrengt zu rudern begannen.
Das große Schiff, die Fólgore Fólgore: Blitz, hatte sofort die Laterne gelöscht und war, die Segel nach der Winde richtend, dem Boote gefolgt, indem es immer lavierte, um ihm nicht voranzulaufen.
Wahrscheinlich wollte der Vizekapitän seinen Befehlshaber bis zur Küste begleiten, um ihn bei Gefahr schützen zu können.
Der Kommandant hatte sich halb ausgestreckt und den Kopf auf die Hand gestützt. So verharrte er schweigend, aber seine Blicke, scharf wie die eines Adlers, schweiften unablässig an dem noch finstern Horizont entlang. Noch konnte er die amerikanische Küste nicht erspähen. Von Zeit zu Zeit wandte er sich nach seinem Schiffe um, das ihm in einer Entfernung von sieben bis acht Ankertauen folgte.
Stiller und Carmaux ruderten indessen das leichte, flinke Kanu über die Fluten, dass es nur so flog. Beide schienen jetzt ohne Sorge über die Rückkehr nach dem feindlichen Ufer zu sein, so groß war ihr Vertrauen zu der Kühnheit und Tapferkeit des Schwarzen Korsaren, dessen Name allein schon genügte, um alle Küstenstädte des mexikanischen Golfs in Schrecken zu setzen.
Da das Meer in der Bucht von Maracaibo glatt wie Öl war, konnten die beiden Ruderer jetzt schneller vorwärtskommen.
Der Ort lag zwischen zwei Landzungen eingeschlossen, die ihn vor den breiten Wogen des großen Golfs schützten. Da es dort keine steilen Küsten gab, trat selten Flutwasser ein.
Schon ruderten die beiden eine Stunde lang, als der Schwarze Korsar, der sich bisher kaum bewegt hatte, sich plötzlich erhob, um den ganzen Horizont abzusuchen.
Ein Licht, das nicht von einem Stern herrühren konnte, leuchtete in südwestlicher Richtung in minutenlangen Zwischenräumen.
„Maracaibo!“ sagte er in dumpfem Ton, der einen inneren Grimm verriet. „Wie weit sind wir noch entfernt?“
„Vielleicht drei Meilen“, antwortete Carmaux.
„Also werden wir um Mitternacht da sein?“
„Ja, Kapitän!“
„Liegen Kreuzer vor?“
„Ja, die Zollbeamten!“
„Die müssen wir natürlich vermeiden!“
„Wir kennen einen Platz, Kapitän, wo wir ruhig landen und unser Boot verstecken können. Es sind Sumpfpflanzen dort.“
„Also los!“
„Aber es wäre besser, dass Euer Schiff jetzt nicht so nahekäme, Kommandant“, meinte Stiller.
„Es hat schon gewendet und wird uns draußen erwarten“, entgegnete der Korsar.
Nach einigen Augenblicken des Schweigens begann er wieder: „Ist es wahr, dass ein Geschwader im See liegt?“
„Ja, dass des Konteradmirals Toledo, der über Maracaibo bis Gibraltar Wache hält.“
„Aha, haben sie Furcht? Nun, der Olonese befindet sich auf der Tortuga. Bald werden wir zusammen das Geschwader in den Grund bohren. Warten wir noch ein paar Tage, dann wird van Gould wissen, mit wem er es zu tun hat!“
Er wickelte sich von neuem in seinen Mantel, zog den Filzhut über die Augen und setzte sich wieder, indem er seine Blicke fest auf jenen glänzenden Punkt gerichtet hielt, der den Hafenleuchtturm anzeigte.
Das Boot nahm seinen Kurs wieder auf. Es wandte den Bug aber nicht der Mündung von Maracaibo zu, da es den Zollkreuzer umgehen musste, der die Insassen sicher festgehalten und verhaftet hätte.
Nach einer halben Stunde wurde die nur drei bis vier Ankertaue entfernte Golfküste deutlich sichtbar. Das Ufer fiel sanft zu den Meeren ab. Es war ganz mit Sumpfpflanzen bedeckt, jener Vegetation, die meist an Wassermündungen wächst und das gefürchtete gelbe Fieber erzeugt. Weiterhin sah man unter dem Sternenhimmel dunkle Sträucher, aus denen riesige Blätterbüschel in die Luft ragten.
Carmaux und Stiller hatten die Ruderschläge verlangsamt. Sie näherten sich der Küste, indem sie jedes Geräusch vermieden und aufmerksam nach allen Richtungen ausschauten, als erwarteten sie eine Überraschung.
Der Schwarze Korsar saß schweigend, unbeweglich. Die drei Flinten, die er mitgenommen hatte, lagen zugriffbereit vor ihm, um jedes sich nahende Boot mit einer Ladung Schrot begrüßen zu können.
Es musste Mitternacht sein, als das Boot inmitten der Sumpfpflanzen und verschlungenen Wurzeln landete.
Der Korsar hatte sich erhoben. Nachdem er die Küste genau beobachtet hatte, sprang er behänd ans Land und band das Boot an einen Baum.
„Lasst die Flinten drin!“ sagte er zu den beiden Ruderern. „Habt ihr eure Pistolen? Und wisst ihr, wo wir uns befinden?“
„Ja, zehn oder zwölf Meilen von Maracaibo entfernt.“
„Liegt die Stadt hinter diesem Wald?“
„Gerade am Rande desselben!“
„Können wir bei Tag hinein?“
„Unmöglich!“
„Also sind wir zu warten gezwungen.“ Hierauf schwieg er, wie in Gedanken versunken...
„Werden wir meinen Bruder noch finden?“ fragte er nach einer Weile.
„Er sollte drei Tage auf dem Granada Platz hängen!“
„Dann haben wir Zeit. Habt ihr Bekannte in Maracaibo?“
„Ja, einen Neger, der uns gestern das Kanu zur Flucht bot. Er wohnt am Waldessaum in einer einsamen Hütte.“
„Wird er uns auch nicht verraten?“
„Wir setzen unseren Kopf für ihn ein!“
„Gut! Vorwärts!“
Sie stiegen das Ufer hinauf, die Ohren gespannt und die Hände auf dem Knauf ihrer Pistolen.
Der Wald ragte vor ihnen auf wie eine dunkle Höhle: Baumstämme jeder Form und Größe mit ungeheuren Blättern, durch welche man das gestirnte Himmelszelt nicht mehr sehen konnte.
Bogenförmige Lianen Gehänge wanden sich rechts und links von den Palmenstämmen in tausenderlei Verschlingungen hinauf und hinunter, während am Erdboden unzählige miteinander verwickelte Wurzeln entlangkrochen, welche das Vorwärtskommen der drei Piraten sehr erschwerten. Sie waren gezwungen, weite Umwege zu machen, um einen Durchgang zu finden, oder sie müssten selbst Hand anlegen, um die Hemmnisse mit den Enterwaffen zu zerschneiden. Zwischen jenen tausend Stämmen liefen unstete Lichter hin und her wie leuchtende Punkte, welche ab und zu Strahlenbündel warfen. Bald tanzten sie auf dem Boden, bald im Blätterwerk. Jäh erloschen sie, um sich dann von neuem zu entzünden und wahre Lichtwellen von unvergleichlicher Schönheit zu bilden. Es waren die großen Leuchtkäfer Südamerikas. Bei ihrem Scheine kann man selbst die kleinste Schrift in einer Entfernung von mehreren Metern lesen. Drei oder vier dieser Tiere, in einer Kristallvase eingeschlossen, genügen zur Beleuchtung eines ganzen Zimmers.
Auch andere, wie Phosphor leuchtende Insekten schwirrten in Schwärmen herum.
Die drei Flibustier setzten schweigend ihren Marsch fort. Es war höchste Vorsicht geboten, da sie, außer den Menschen, auch die Tiere des Waldes zu fürchten hatten, die blutgierigen Jaguare und vor allem die Schlangen, besonders die Jararacaca genannten giftigen Reptilien, die man auch bei Tage schwer erkennen kann, da ihre Haut der Farbe der trockenen Blätter ähnelt.
So mussten sie schon zwei Meilen gegangen sein, als Carmaux, der als bester Kenner dieser Waldungen immer voranging, plötzlich stehenblieb und blitzschnell eine seiner Pistolen zog.
„Ist es ein Jaguar oder ein Mensch?“ fragte der Korsar, ohne die mindeste Furcht.
„Es könnte ein Spion sein“, antwortete der Bootsmann. „In diesem Lande weiß man nie, ob man den nächsten Tag noch erlebt. Nur zwanzig Schritt von hier ist jemand vorbeigehuscht.“
Der Korsar bückte sich zur Erde und horchte aufmerksam, den Atem anhaltend. Er hörte ein leichtes Blätterrascheln, das aber so schwach war, dass es nur ein äußerst feines Ohr vernehmen konnte.
„Es wird ein Tiger gewesen sein“, sagte er, sich wieder erhebend. „Bah, lassen wir uns nicht so leicht erschrecken!“
Plötzlich blieb er bei einer Baumgruppe mit gigantischem Blätterwerk stehen. Sein scharfer Blick durchforschte die Dunkelheit. Das Geraschel hatte aufgehört, aber ein metallischer Ton, gleich einem tauben Gewehrschuss, drang an sein Ohr.
„Halt, es ist ein Spion hier, der den günstigen Moment abwartet, um hinterrücks auf uns zu schießen!“
„Möglich, dass man unsere Landung bemerkt hat“, sagte Stiller beunruhigt. „Diese Spanier haben überall Späher!“
Der Korsar suchte, mit der Pistole in der Hand, das Blätterdickicht ganz leise zu umgehen. Mit einem Sprung stand er einem Manne gegenüber, der sich im Gebüsch versteckt hatte.
Der Angriff des Korsaren war so ungestüm, dass der Späher, der gegen den Degenknauf des Gegners geprallt war, zur Erde fiel.
Carmaux und Stiller eilten sofort herbei. Sie nahmen ihm das Gewehr ab und setzten ihm die Pistole auf die Brust.
„Natürlich einer unserer Feinde!“ sagte der Korsar, sich über ihn beugend. „Wenn du dich rührst, bist du des Todes!“
„Ein Soldat des verdammten van Gould!“ rief Stiller. „Ich möchte nur wissen, warum du dich hier versteckst!“
Der Spanier, der von dem Angriff erst ganz verblüfft war, begann sich wieder zu erholen. Er machte Miene aufzustehen. „Carrai!“ stammelte er. „Bin ich in die Hände des Teufels gefallen?“
„Erraten!“ lachte Carmaux. „So werden wir Flibustier von euch genannt!“
Den andern überlief ein Schauder. Carmaux bemerkte es.
„Ich habe keine Furcht, Freundchen!“ sagte er. „Den Teufelsstrick sparen wir uns für später auf, wenn wir im Freien den Fandango tanzen werden mit einem hübschen, festen Hanf um die Kehle!“
Dann wandte er sich fragend zu dem Korsaren um, der schweigend den Gefangenen betrachtete.
„Oder soll ich ihm jetzt mit einem Pistolenschuss den Garaus machen?“
„Nein!“
„Oder an einen Baumzweig hängen?“
„Noch weniger!“
„Vielleicht gehört er zu denen, die meinen Kapitän, den Roten Korsaren, an den Galgen gebracht haben!“
Bei dieser Erinnerung schoss ein Blitz aus den Augen des Schwarzen Korsaren, aber er erlosch sofort.
„Er soll nicht sterben, weil er uns lebend mehr nützen kann!“
„Dann wollen wir ihn gut binden!“ riefen die beiden Piraten.
Sie nahmen die roten Wollbinden, die ihnen seitlich am Gürtel hingen, und drückten die Arme des Gefangenen zusammen, ohne dass dieser Widerstand wagte.
„Jetzt möchten wir auch mal sehen, wie du aussiehst!“ sagte Carmaux.
Er zündet ein Stück Lunte an, das er in der Tasche hatte, und näherte sich damit dem Gesicht des Spaniers.
Der arme Teufel mochte kaum dreißig Jahre sein. Er war lang und mager wie sein Landsmann Don Quichote und hatte gleich diesem ein eckiges Gesicht mit grauen Augen und rötlichem Bart. Sein Anzug bestand aus einem Kasack von gelbem Leder, weiten, schwarz und rot gestreiften Hosen und hohen, schwarzen Stiefeln. Auf dem Kopfe hatte er einen Stahlhelm mit einer arg zerzausten Feder, und vom Gürtel hing ihm ein langes Schwert herab, dessen Scheide am Ende verrostet war.
„Beim Beelzebub, meinem Schutzpatron!“ rief Carmaux lachend. „Wenn der Gouverneur von Maracaibo mehr von diesen Helden hat, so wissen wir, dass er sie nicht mit Kapaunen füttert, denn dieser hier ist ja mager wie ein geräucherter Hering. Ich glaube, Kapitän, dass es sich gar nicht der Mühe lohnt, ihn zu hängen.“
Der Schwarze Korsar berührte den Gefangenen mit seiner Degenspitze und sagte: „Jetzt sprich, wenn dir deine Haut lieb ist!“
„Die Haut ist schon verloren“, erwiderte der Gefangene trocken. „Ich werde ja nicht lebendig aus Euren Händen hervorgehen. Und wenn ich auch erzähle, was Ihr wissen wollt, bin ich ja doch nicht sicher, den morgigen Tag noch zu erleben.“
„Der Spanier scheint Mut zu haben“, meinte Stiller.
„Durch seine Antwort kann er begnadigt werden“, fügte der Korsar hinzu. „Los, willst du antworten?“
„Nein!“ entgegnete der andere.
„Ich habe dir das Leben versprochen!“
„Wer glaubt daran!“
„Wer? Weißt du auch, wer ich bin?“
„Ein Pirat!“
„Ja, aber man nennt mich den Schwarzen Korsaren!“
„Bei der heiligen Jungfrau von Guadalupe!“ rief der Spanier erblassend. „Ihr hier? Wollt Ihr Euren Bruder rächen und uns alle vernichten?“
„Wenn du nicht sprichst, so werden alle umgebracht! Es soll kein Stein auf Maracaibo bleiben!“
„Por todos santos!“ sagte der Gefangene, der sich noch nicht von seiner Überraschung erholt hatte.
„Sprich!“
„Ich bin dem Tode verfallen. Also wozu?“
„Der Schwarze Korsar ist ein Ehrenmann, und ein solcher hält sein Wort“, sprach der Kapitän feierlich.
„Gut, fragt mich aus!“
Der Gefangene
Der Korsar hatte sich dem Gefangenen gegenüber auf eine Baumwurzel gesetzt, während die beiden Flibustier sich als Wachen am Ende des Wäldchens aufgestellt hatten, weil man nicht sicher war, ob der Verhaftete noch Kameraden in der Nähe hatte. „Sage mir, hängt mein Bruder noch?“ fragte er nach kurzem Schweigen.
„Ja“, antwortete der Spanier. „Der Gouverneur hat befohlen, ihn drei Tage und drei Nächte hängen zu lassen, bevor man ihn den wilden Tieren im Walde vorwirft.“
„Glaubst du, dass man seinen Leichnam rauben kann?“
„Vielleicht. Bei Nacht ist nur eine einzige Schildwache auf der Plaza de Granada. Die fünfzehn Gehenkten können doch nicht entfliehen.“
„Fünfzehn!“ rief der Korsar. „Hat der grausame van Gould nicht einen einzigen am Leben gelassen?“
„Keinen!“
„Und fürchtet er nicht die Rache der Tortugapiraten?“
„Maracaibo ist gut mit Truppen und Kanonen versehen.“
Ein verächtliches Lächeln umschwebte die Lippen des stolzen Korsaren.
„Was tun uns die Kanonen“, sagte er. „Unsere Enterwaffen sind mehr wert. Ihr habt es doch bei den Angriffen von San Francisco di Campeche, von Sant’Agostino de Florida und andern Kämpfen gesehen!“
„Es ist wahr, aber van Gould hält Maracaibo für sicher.“
„Gut. Wir werden es sehen, wenn ich es mit dem Olonesen überfallen werde.“
„Mit dem Olonesen?“ rief der Verhaftete mit Schaudern aus.
„Was suchst du in diesem Walde?“
„Ich überwachte das Ufer!“
„Allein?“
„Ja, allein!“
„Fürchtet man eine Überraschung von unserer Seite?“
„Ja, da ein im Golf kreuzendes, verdächtiges Schiff signalisiert war!“
„Also mein Schiff?“
„Da Ihr hier seid, wird es wohl Euer Schiff gewesen sein.“
„Und der Gouverneur...“
„Er hat einige seiner Vertrauten nach Gibraltar geschickt, um den Admiral davon zu unterrichten.“
Diesmal wurde der Korsar unruhig. Dann zuckte er leicht mit den Schultern: „Bah, wenn die Schiffe des Admirals nach Maracaibo kommen, sind wir schon längst an Bord der Fólgore.“
Er stand auf und rief durch einen Pfiff die beiden am Waldesrand postierten Flibustier herbei: „Wir wollen weiter!“
„Aber was sollen wir mit diesem Mann anfangen?“ fragte Carmaux.
„Wir nehmen ihn mit!“
Es begann schon zu dämmern. Die Schatten der Nacht wichen rasch, verscheucht von einem rosigen Licht, das den ganzen Himmel einnahm und das sich auch unter den gigantischen Bäumen des Waldes ausbreitete. Die Affen, die in Südamerika, besonders in Venezuela, so zahlreich sind, erwachten und erfüllten die Gebüsche mit ihrem seltsamen Geschrei.
Allerlei Vierfüßler bevölkerten die Wipfel der, Assai genannten, leichtstämmigen Palmen, wie das grüne Blätterwerk der riesigen Eriodendren. Sie bewegten sich wie Kobolde zwischen den, auch Sipos genannten, großen Lianen, welche die Bäume umklammerten oder an den Luftwurzeln der Arioden hängen.
Da erblickte man Affen, die so klein und niedlich waren, dass man sie in die Tasche stecken könnte, Scharen roter Sahui, die etwas größer als Eichhörnchen sind und mit ihrem schönen Schweif an kleine Löwen erinnern, ferner Scharen von Monos, den magersten aller Affen, die mit ihren langen Armen und Beinen an Riesenspinnen erinnern.
In ihr Geschrei mischten sich die Stimmen der Vögel. Laut plapperten die blauköpfigen Papageien auf den großen Blättern der Pomponasse, die zur Fabrikation der leichten Panamahüte verwandt werden, oder sie stolzierten auf den eigenartigen Palmen mit den Purpurblüten einher. Auf den Laransiabüschen mit den starkduftenden Blumen saßen die großen, ganz roten Papageien, die vom Morgen bis zum Abend ihr eintöniges Ará-Ará ertönen lassen. Auch die Klagevögel fehlten nicht, so genannt, da ihre Laute einem Klagen oder Weinen gleichen.
Die Flibustier und der Spanier, die an die seltsamen Geräusche in den dortigen Wäldern gewöhnt waren, hielten sich nicht auf, um Pflanzen, Vierfüßler oder Vögel zu bewundern. Sie suchten so schnell wie möglich aus dieser Wildnis herauszukommen.
Der Korsar schritt mit düsterer Miene einher. So sah man ihn fast immer, sowohl an Bord eines Schiffes wie an Land, selbst bei den Schmausereien auf der Tortuga. Die beiden Piraten kannten schon seine Gewohnheiten und hüteten sich, ihn zu fragen oder aus seinen Gedanken herauszureißen. So marschierten sie zwischen Palmen, Schlingpflanzen und Tieren wohl zwei Stunden lang, bis Carmaux bei einem Gebüsch seltsamer Gewächse stehenblieb. Sie hatten lederartige Blätter, die, wenn der Wind wehte, sonderbare Töne hervorbrachten.
„War es nicht hier?“ fragte er seine Gefährten. „Ich glaube, mich nicht zu irren.“
In diesem Augenblick hörte man aus der Mitte des Gehölzes süße, melodische Flötentöne.
Der Korsar wandte sich um. „Was ist das?“ fragte er.
„Mokkos Flöte!“ antwortete Carmaux lächelnd. „Es ist der Neger, der uns zur Flucht verhalf. Seine Hütte befindet sich inmitten dieser sonderbaren Pflanzen. Er wird jetzt seine Schlangen meistern.“
„Ein Zauberer?“
„Ja, Kapitän!“
„Diese Flöte kann uns aber verraten!“
„Wir können sie ihm ja wegnehmen und die Schlangen in den Wald jagen!“
Carmaux, der schon in das Gebüsch eingedrungen war, wich mit einem Schreckensruf wieder zurück.
Vor einer armseligen Hütte aus verschlungenen Baumzweigen stand ein Neger von herkulischen Formen. Er war hochgewachsen, mit kräftigen Schultern und breiter Brust. Seinen Muskeln sah man die Riesenkraft an. Obgleich die Nase platt, die Lippen dick waren und die Backenknochen vorstanden, konnte das Gesicht nicht hässlich genannt werden. Im Gegenteil, es hatte etwas Gutes, Freimütiges, Kindliches, nicht eine Spur von dem wilden Ausdruck, den viele andere afrikanische Rassen zeigen.
Seine Behausung lag, wie die meisten Indianerhütten, halb versteckt hinter einem mächtigen Baume, umgeben von Kürbispflanzen.
Mokko stand an einem abgehauenen Baumstamm und blies eine Flöte aus leichtem Bambusrohr, der er seltsam weiche, langgezogene Töne entlockte. Vor ihm krochen ganz sanft und ruhig etwa zehn der gefährlichsten Reptilien Südamerikas.
Es waren einige Jararacaca, die selbst die Indianer wegen ihres Giftes fürchten, kleine tabakfarbene Schlangen mit abgeplattetem, dreieckigem Kopf und feinem Hals. Auch mehrere Klapperschlangen, einige ganz schwarze Nattern, die fast blitzartig ihr Gift ausspritzen, und etliche Reptilien mit weißen, kreuzförmigen Streifen auf dem Kopfe, deren Biss eine Lähmung des betreffenden Gliedes bewirken kann.
Als der Neger Carmaux’ Aufschrei hörte, richtete er seine großen, porzellanähnlichen Augen auf die Flibustier. Dann nahm er seine Flöte aus dem Munde und sagte erstaunt: „Ihr seid noch hier? Ich glaubte euch schon in Sicherheit.“
„Ja doch, ja... aber der Teufel hole mich, wenn ich nur einen Schritt in dein gefährliches Revier wage!“
„Meine Tiere tun den Freunden nichts Böses an“, antwortete Mokko lachend. „Warte einen Augenblick, ich werde sie schlafen legen!“
Er nahm einen aus Blättern geflochtenen Korb, legte die Schlangen hinein, ohne dass diese sich sträubten, und schloss ihn darauf sorglich mit einem großen Stein.
„Jetzt kannst du ohne Furcht in meine Hütte treten, weißer Bruder! Bist du allein?“
„Nein, ich komme mit meinem Schiffskapitän, dem Bruder des Roten Korsaren!“
„Mit dem Schwarzen Korsaren? Da kann Maracaibo sich freuen!“
„Still, Mokko! Überlass uns deine Hütte, und du wirst es nicht bereuen!“
Jetzt war der Korsar mit Stiller und dem Gefangenen hinzugetreten. Er grüßte den Neger mit einem Wink der Hand und wandte sich an Carmaux: „Ist das der Mann, der euch zur Flucht verholfen hat?“
„Ja, Kapitän!“
„Hasst er die Spanier?“
„Wie wir!“
„Und kennt er Maracaibo?“
„Wie wir Tortuga!“
Der Korsar betrachtete die mächtige Muskulatur des Afrikaners und sagte: „Er wird uns nützlich sein!“
Sein Blick schweifte in der Hütte umher. Als er in einer Ecke einen aus Baumzweigen roh hergestellten Stuhl fand, setzte er sich, um von der beschwerlichen Wanderung auszuruhen.
Indessen beeilte sich der Neger, den Fremden Gastfreundschaft zu erweisen. Er brachte Backwerk, das aus dem Mehl der Manioca Knollen hergestellt war, die im zerriebenen und zerdrückten Zustand ihre giftige Eigenschaft verlieren.
Außer aromatischen Goldbananen holte er Früchte des Flaschenbaums herbei, die wie Tannenzapfen aussahen und unter ihren Schuppen einen ausgezeichneten, weißlichen Saft enthielten. In einem ausgehöhlten Kürbis setzte er Pulque vor, ein der Agave entnommenes gegorenes Getränk.
Die drei Flibustier, die während der ganzen Nacht keinen Bissen zu sich genommen hatten, ließen sich das Frühstück schmecken. Sie gaben auch dem Gefangenen davon ab. Dann streckten sie sich sorglos auf einem Haufen frischer Blätter aus, die der Neger in die Hütte geschleppt hatte. Sie konnten ruhen, denn der Neger hielt indessen Wache.
Während des ganzen Tags rührte sich keiner von ihnen. Kaum aber war die Dunkelheit wieder angebrochen, da sprang der Korsar auf. Er blieb vor dem gefangenen Spanier stehen.
„Ich habe dir versprochen, dich leben zu lassen. Dafür musst du mir sagen, ob ich unbeobachtet in den Palast des Gouverneurs gelangen kann!“
„Ihr wollt ihn ermorden?“
„Ermorden“, entgegnete der Flibustier zornig. „Ich töte nie durch Verrat.“
„Er ist alt, der Gouverneur, während ihr jung seid. Ihr würdet auch nicht in sein Zimmer gelangen, denn eine Menge Soldaten bewachen ihn und würden euch sofort verhaften.“
„Ich weiß, dass er mutig ist.“
„Wie ein Löwe!“
„Gut, ich werde ihn schon finden!“
Dann drehte er sich zu den beiden Bootsleuten um, die sich ebenfalls erhoben hatten, und sagte zu Stiller: „Du wirst hierbleiben und diesen Mann bewachen!“
„Würde nicht der Neger genügen, Kapitän?“
„Nein! Er ist stark wie Herkules und muss mir helfen! Komm, Carmaux, lasse uns erst eine Flasche spanischen Weins in Maracaibo leeren!“
„Zu dieser Stunde, Kapitän?“
„Hast du Angst?“
„Mit Euch würde ich selbst in die Hölle fahren und Meister Beelzebub an die Nase fassen! Nur fürchte ich, dass wir entdeckt werden.“
Ein Lächeln umspielte die Lippen des Korsaren. „Wir werden sehen. Komm nur!“ sagte er.
Ein Zweikampf zwischen vier Wänden
Obgleich Maracaibo nur zehntausend Einwohner zählte, war es in jener Zeit doch eine der wichtigsten Städte, die Spanien an der mexikanischen Goldküste besaß.
Durch die herrliche Lage am südlichen Ende der Bucht und nahe dem gleichnamigen See, der es mit dem Festland verband, hatte es schnell große Bedeutung erlangt, so dass es ein Stapelplatz aller Erzeugnisse Venezuelas wurde.
Die Spanier hatten es mit einer mächtigen Festung versehen und diese mit einer großen Zahl von Kanonen ausgestattet. Auch auf den beiden Inseln, die es von der Golfseite schützten, hatten sie starke Garnisonen angelegt, da man immer einen plötzlichen Einfall der gefürchteten Flibustier der Tortuga befürchtete.
Schon die ersten Abenteurer, die ihren Fuß auf jenes Ufer setzten, hatten dort schöne Häuser errichtet. Viele Paläste waren von spanischen Baumeistern erbaut worden, die in der Neuen Welt ihr Glück suchten. In den zahlreichen repräsentativen Gebäuden versammelten sich die reichen Bergwerksbesitzer, und hier tanzte man bei öffentlichen Festen den Fandango und Bolero.
Als die Flibustier und der Neger ohne Hindernisse in Maracaibo ankamen, waren die Straßen noch belebt und die Tavernen, wo man den spanischen Wein ausschenkte, noch voll, denn die Spanier verzichteten auch in ihren Kolonien nicht auf ihren heimatlichen Malaga und Jerez Sherry.
Der Schwarze Korsar hatte den Schritt verlangsamt. Den Filzhut tief über die Augen gezogen und fest in seinen Mantel gehüllt, obgleich der Abend noch warm war, beobachtete er aufmerksam die Straßen und Häuser, als ob er sie seinem Gedächtnis einprägen wollte.
Auf der Plaza de Granada, die den Mittelpunkt der Stadt bildete, blieb er, sich an eine Mauer lehnend, stehen, als ob ihn ein Schwächeanfall ergriffen hätte. Der Platz bot ein schreckliches Schauspiel: Fünfzehn Galgen waren im Halbkreis vor einem die spanische Flagge tragenden Palaste errichtet. Die Leichen, die daran hingen, waren alle barfuß, nur mit Fetzen bekleidet, mit Ausnahme einer einzigen, die hohe Wasserstiefel und einen feuerroten Anzug trug. Über die Galgen zogen kleine schwarzgefiederte Geier, die nur die Fäulnis jener Unglücklichen abzuwarten schienen, um sich auf die Leichname zu stürzen.
Carmaux hatte sich dem Korsaren genähert und sagte mit tiefer Bewegung: „Unsere Gefährten, Kapitän!“
„Ja, sie schreien nach Rache, und ich werde sie rächen!“
Schnell schüttelte der Kommandant die Rührung ab, die ihn übermannt hatte, und trat mit raschen Schritten in eine nahegelegene Posada ein. Es war ein Gasthaus, wo sich die Nachtkumpane zu versammeln pflegten, um noch einige Becher zu leeren. Dort setzte er sich an einen leeren Tisch. Da er stumm blieb, bestellte Carmaux Wein. „Gib aber von deinem besten Xeres!“ rief er dem Wirt im reinsten Biskayer Dialekt zu. „Die Golf Luft hat mir einen solchen Durst gemacht, dass ich deinen ganzen Keller austrinken könnte!“
Der Wirt eilte herbei und füllte drei Becher. Der Korsar rührte jedoch seinen nicht an. Er war in seine Gedanken vertieft.
Carmaux stieß den Neger an und sagte leise: „Er träumt von Sturmangriffen.“
Dann sah er sich neugierig um, und seine Blicke begegneten sechs mit gewaltig langen Navajas Navaja: sehr langer, säbelartiger Dolch bewaffneten Individuen, die ihn aufmerksam betrachteten.
„Wer sind die denn?“ fragte er den Neger.
„Basken in den Diensten des Gouverneurs.“
„Also Landsleute unter anderer Fahne. Bah, die schrecken mich nicht!“
Die Basken, die sich die Kehle mit einige Bechern Malaga angefeuchtet hatten, fingen jetzt an zu schwatzen. Sie sprachen so laut, dass Carmaux sie verstehen konnte.
„Habt ihr die Gehenkten gesehen?“ fragte der eine.
„Ich bin extra dazu hergekommen“, antwortete der andere. „Diese Kanaillen bieten immer einen besonderen Anblick. Dem einen hängt die Zunge halb aus dem Munde. Man muss wirklich lachen!“
„Und dem Roten Korsaren hat man eine Zigarette in den Mund gesteckt“, sagte ein dritter.
„Und morgen will ich ihm einen Schirm in die Hand geben, damit er sich vor der Sonne schützen kann“, spöttelte ein anderer.
Plötzlich schlug Carmaux, der sich nicht mehr beherrschen konnte, mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser aneinander klirrten.
Er war aufgesprungen, noch ehe der Kapitän daran dachte, sich einzumischen.
„Rayos de Dios!“ rief er. „Schämt euch! Das ist ja ein schöner Beweis von Mut, sich über Tote lustig zu machen! Verhöhnt doch lieber die Lebenden!“
Die Trinker waren, überrascht von dem plötzlichen Wutausbruch des Unbekannten, aufgestanden und hatten die Hand an die Waffe gelegt.
„Wer seid Ihr, Caballero?“ fragte einer von ihnen mit scheelem Blick.
„Ein guter Biskayer, welcher die Toten achtet, der aber den Lebenden auch Löcher in den Bauch treiben kann!“