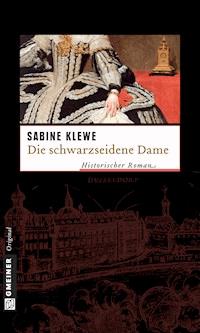7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Louis und Salomon ermitteln
- Sprache: Deutsch
Eine zu Tode gesteinigte Frau im Wald und rätselhafte Zeichen am Tatort. Der Beginn einer alptraumhaften Mordserie
Nach einer durchzechten Nacht wird Hauptkommissarin Lydia Louis im Morgengrauen zum Tatort gerufen: Eine grauenvoll zugerichtete Frauenleiche, halb im Waldboden eingegraben und zu Tode gesteinigt. Schnell scheint klar: Hier handelt es sich um einen Ehrenmord. Doch das Opfer hat keinen muslimischen Hintergrund. Und wie passen die rätselhaften Zeichen dazu, die in den Baumstamm neben der Leiche eingeritzt sind? Louis und ihr neuer Partner Christopher Salomon sind dem Mörder dicht auf den Fersen. Doch der Killer hat sein Werk längst nicht vollendet – und die Kommissarin fällt genau in sein Beuteschema …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
In einem Waldstück bei Düsseldorf macht die Polizei einen grausigen Fund: Eine junge Frau wurde bis zum Hals im Waldboden eingegraben und zu Tode gesteinigt. Kriminalhauptkommissarin Lydia Louis wird nach einer durchzechten Nacht im Morgengrauen zum Tatort gerufen und macht sich gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen, dem Kölner Christopher Salomon, an die Ermittlungen. Schnell scheint klar: Hier handelt es sich um einen Ehrenmord. Doch das Opfer war eine Tischlerin, Mitte zwanzig, ohne jeden muslimischen Hintergrund. Und auch die rätselhaften Zeichen, eingeritzt in den Baumstamm neben der Leiche, sprechen gegen eine Bluttat im Namen der Ehre. Als ein weiterer Mord nach gleichem Muster geschieht, wird klar, dass es sich um einen Serientäter handelt. Doch die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Was ist das Motiv des Täters? Weshalb diese makabre Inszenierung? Und warum musste gerade jene Frau sterben, die die erste Leiche entdeckt hat?
Louis und Salomon ermitteln fieberhaft, denn sie wissen: Der Killer hat sein Werk längst nicht vollendet. In ihrem Kampf gegen die Zeit sind sie ihm dicht auf den Fersen. Der Mörder ist nah, sehr nah. Und Louis fällt genau in sein Beuteschema …
Autorin
Sabine Klewe, Jahrgang 1966, arbeitet als Schriftstellerin, Übersetzerin und Dozentin in Düsseldorf und hat zahlreiche Kriminalromane veröffentlicht. »Der Seele weißes Blut« ist der erste Fall für das Ermittlerduo Lydia Louis und Christopher Salomon.
Sabine Klewe
Der Seele
weißes Blut
Roman
Die Augen sind der Seele klare Fenster,
Und Tränen sind der Seele weißes Blut.
Heinrich Heine
Prolog
Angst ist die dunkle Schwester der Liebe. Wie ein Schatten folgt sie ihr auf Schritt und Tritt.
Sandra Thierse stand am Gartentor und kaute nervös an ihren Fingernägeln. In der letzten Viertelstunde hatte sie beobachtet, wie die Konturen des Waldes immer mehr mit dem Horizont verschmolzen und die Nacht hereinbrach, die hier am Rand der Großstadt nie wirklich schwarz wurde. Die Straßenlaternen gossen trübes Gelb auf den regenfeuchten Asphalt, die Wolkendecke, die den Sternenhimmel verbarg, schimmerte rötlich. Allein der Wald ragte vor ihr auf wie der Eingang zu einer gewaltigen lichtlosen Höhle.
Irgendwo in diesem gähnenden Loch trieb Jakob sich herum. Hundert Mal hatte sie ihm eingeschärft, rechtzeitig zu Hause zu sein. Nach seiner letzten Verspätung hatte er eine Woche Stubenarrest bekommen, aber das hatte den Jungen nicht davon abgehalten, sich gleich nach Ablauf der Strafe wieder davonzustehlen. Die Verlockungen des Waldes waren unwiderstehlich. Knorrige Kletterbäume. Kaninchenhöhlen. Tausende geheime Verstecke.
Sandra seufzte. Sie verstand ihren Sohn nur zu gut. Wie gern hätte sie als Kind in einem solchen Paradies herumgetollt, sich einen Unterschlupf aus Ästen und Zweigen gebaut, in dem sie die Prinzessin war, die Herrscherin eines magischen Reiches. Aber sie hatte Angst. Der Wald war nicht nur ein aufregender Spielplatz, er war auch Hort zahlloser Gefahren: frei umherlaufender, angriffslustiger Köter, für die ein fünfjähriger Junge eine leichte Beute war. Oder schlimmer noch, Menschen, die grausame Dinge anstellten mit hilflosen Kindern. Die psychiatrische Klinik war kaum mehr als einen Steinwurf von hier entfernt. Niemand wusste, wer dort alles untergebracht war. Nicht die gefährlichen Fälle, das hatte Daniel ihr versichert, bevor sie hierher gezogen waren. In Grafenberg saßen keine Straftäter ein. Doch möglicherweise waren einige Patienten lediglich noch nicht straffällig geworden.
»Jakob!«, rief sie in die Dunkelheit. »Jakob, komm sofort her!«
Endlose Minuten lang geschah nichts. Der rote Kombi der Schröders passierte sie. Erika Schröder glotzte neugierig durch das Seitenfenster. Ein Uhu schrie. In der Ferne klingelte die Straßenbahn. Die Zivilisation war zum Greifen nah. Und doch so fern.
Da knackte es und eine helle Gestalt tauchte zwischen den schwarzen Stämmen auf.
»Jakob, na endlich! Du solltest doch längst zu Hause sein.« Sie breitete die Arme aus. Eigentlich sollte sie streng sein, mit ihm schimpfen, doch die Erleichterung, dass er wohlauf war, fegte all ihren Ärger hinweg.
»Mama, guck mal, was ich gefunden habe!« Er rannte auf sie zu, etwas Langes, Helles schwenkend.
»Was ist das, ein Stock?« Sie ließ die Arme sinken.
Er wurde langsamer. »Aber du darfst ihn mir nicht wegnehmen«, forderte er.
»Wir legen den Stock in den Garten, okay? Dann kannst du morgen wieder damit spielen. Heute ist es zu spät. Jetzt geht es in die Wanne und danach ins Bett.«
»Das ist aber kein Stock«, maulte Jakob.
»Was denn dann?«
Er war fast bei ihr, das Ding in seiner Hand nahm Gestalt an. Sandra stutzte. Dann schluckte sie. »Wo hast du das her?«, stieß sie entsetzt hervor.
»Nicht wegnehmen!«, schrie Jakob, als sie den Arm ausstreckte. »Das ist meiner. Ich hab ihn gefunden.«
»Wo hast du das her?«, wiederholte sie.
»Ausgegraben«, erklärte Jakob. »Zusammen mit Tim. Aber ich hab ihn zuerst gesehen. Er gehört mir.«
»Wo ist Tim denn?« Beunruhigt heftete sie ihren Blick auf den Waldsaum. Aber da war niemand.
»Abgehauen. War sauer, weil ich den Schatz gefunden habe und nicht er.«
»Das ist kein Schatz.«
»Ist es wohl.«
»Jakob, gib ihn mir!«
Er versuchte wegzurennen, doch sie erwischte ihn, entriss ihm den Gegenstand. »Bestimmt ist er von einem Tier«, murmelte sie, doch sie ahnte, dass sie sich irrte.
1
Zwei Wochen später
Dienstag, 8. September
Die Morgendämmerung kroch eben erst über die Hügel. Ein feiner Dunstschleier verbarg das Tal mit der langsam erwachenden Stadt. Es roch nach Moder und feuchtem Laub.
Ellen Dankert ließ sich in einen gemächlichen Trab fallen. Mit jedem Schritt, den sie sich von der Haustür entfernte, bröckelte Last von ihren Schultern, so als würde sie kleine Gewichte auf dem Waldweg verstreuen. Tief sog sie die kalte Luft ein, bis ihre Lungen brannten. Sie liebte diese Morgenstunde, die einzige des Tages, die ihr ganz allein gehörte. Und das auch nur, wenn Philipp Frühschicht hatte. Dann konnte sie laufen, bevor sie die Kinder wecken musste. Sobald die Rücklichter seines Wagens um die Straßenecke verschwunden waren, hatte sie sich in aller Eile umgezogen und war aus dem Haus geschlichen. In der Einfahrt hatte noch der Geruch nach Abgasen gehangen wie eine letzte Erinnerung an Philipps Präsenz.
Plötzlich durchzuckte sie der Gedanke, er könne etwas vergessen haben und noch einmal zurückkehren. Ins Haus stürmen, sie überall suchen, die Kinder aus dem Schlaf reißen. Nein, er war noch nie umgekehrt. Sie durfte sich nicht verrückt machen. Vielleicht sollte sie ihm einfach erzählen, dass sie morgens gern eine Runde durch den Wald lief. Womöglich hatte er gar nichts dagegen. Warum sollte er auch? Joggen war schließlich vollkommen harmlos. Andererseits, wenn sie ihm nichts sagte, und er kam ihr auf die Schliche, konnte sie immer noch die Ahnungslose spielen. Ihm versichern, dass sie nicht gewusst habe, dass er es missbillige. Allerdings würde das seine Wut kaum eindämmen.
Ellen erreichte die Gabelung unterhalb der großen Weide und bog nach rechts ab. Inzwischen hatte sich eine angenehme Wärme in ihrem Körper ausgebreitet, ihre Beine liefen wie von allein. Sie ließ ihre Gedanken schweifen, stellte sich vor, wie sie immer weiter rannte, aus der Stadt hinaus, durch mannshohe Maisfelder, dichte Laubwälder, fremde Dörfer und Städte. Weiter und weiter. Wie sie nicht zurückkehrte, ein neues Leben anfing. Einfach so. Sie würde sich Carola nennen. Als Kind hatte sie immer Carola heißen wollen. Carola war die Starke, die Mutige, die alles schaffte, was sie sich vornahm. Carola ließ sich von niemandem herumkommandieren, alle respektierten und achteten sie. Als Nachname wäre ein Allerweltsname am besten. Müller oder Meier. Dahinter konnte man sich gut verstecken. Müller oder Meier, das war wie eine Tarnkappe. Carola Müller. Das klang gut. Sie würde einfach behaupten, sie habe ihre Papiere verloren. Oder besser noch: ihr Gedächtnis. Carola Müller, die Frau ohne Vergangenheit. Die mutige, starke Frau ohne Vergangenheit. Der Gedanke gefiel ihr.
Ellen hatte die kleine Holzbrücke am Bach erreicht. Von hier aus ging es im Bogen nach Hause zurück. Der Weg stieg leicht an, doch sie merkte es kaum. Sie kam in der Nähe der Landstraße vorbei, Autos rauschten heran, nur durch das anschwellende Brüllen des Motors und das umherzuckende Licht der Scheinwerfer zu erkennen, und tauchten zurück ins Dämmerlicht. Endlich führte der Weg von der Straße weg, es wurde stiller, die Geräusche des Waldes, das Knacken der Äste und das leise Stöhnen der mächtigen Baumstämme, übernahmen wieder das Regiment. Ellen hörte ein Rascheln neben sich im Unterholz. Sie zuckte zusammen und beschleunigte ihre Schritte. Ein Reh brach aus dem Dickicht hervor, starrte sie einen Moment lang verschreckt an und verschwand behände zwischen den Stämmen auf der anderen Seite des Weges. Erleichtert drosselte Ellen das Tempo. Ihr war jetzt heiß, Schweiß stand kalt auf ihrer Stirn.
Eine kleine Lichtung tauchte vor ihr auf. In der Mitte lag ein eigenartiges schwarzes Bündel. Ellen warf einen flüchtigen Blick darauf und rannte weiter. Vermutlich ein totes Tier, dachte sie. Aber schwarz? Sie stockte, stolperte und wäre beinahe gestürzt. Die Lichtung lag bereits hinter ihr. Sie zögerte, dann lief sie das kurze Stück zurück. Nur eben nachschauen, sagte sie sich. Sonst würde sie den ganzen Tag herumrätseln, was sie da wohl Merkwürdiges gesehen hatte.
Dort lag es. Ein Tier war es nicht, das erkannte Ellen jetzt. Vielleicht eine Decke, die jemand liegen gelassen hatte, oder eine Jacke. Nein, es sah eher aus wie Fell. Langes dunkles Fell. Behutsam schlich Ellen näher. Eine unerklärliche Furcht lähmte mit einem Mal ihre Glieder und ließ jeden Schritt zu einem ungeheuren Willensakt werden. Unter dem schwarzen Fell schimmerte eine unförmige Masse. Braun. Oder Rot. Sie erinnerte ein wenig an einen Klumpen rohes Fleisch.
Fleisch mit Haaren.
Ellen stockte und presste die Hände vor den Mund. Ein Rauschen, das von überallher zu kommen schien, erstickte alle anderen Laute des Waldes, krabbelte wie ein Bienenschwarm in ihre Ohren, wo es zu einem unerträglich lauten Surren wurde. Sie wankte, stolperte rückwärts und stieß gegen einen Buchenstamm. Mit fahrigen Fingern tastete sie nach der Rinde und krallte sich daran fest.
»Weg hier«, flüsterte eine Stimme tief in ihrem Inneren. »Weg! Nur weg!«
Sie gehorchte mechanisch, löste widerwillig ihre Hände von dem sicheren Stamm und taumelte los. Zurück auf den Weg.
Irgendwo hinter ihr knackte es.
Sie schrie.
Zwischen ihren Schenkeln wurde es nass. Keuchend stürmte sie den Weg hinauf, so schnell, wie sie noch nie in ihrem Leben gerannt war. Die feuchte Hose klebte auf ihrer Haut, ihre Brust stach bei jedem Atemzug wie tausend Nadeln, ein seltsames, lähmendes Kribbeln wand sich ihre Beine hoch. Doch sie blieb nicht stehen.
Erst vor der Haustür brach sie zitternd zusammen.
2
Die Übelkeit überfiel sie, als sie an einer Ampel halten musste. Lydia Louis schluckte, um den Brechreiz zu unterdrücken, und schloss die Augen. Langsam zählte sie rückwärts. Zehn, neun, acht … Manchmal half es. Hinter ihren Schläfen pochte es, dafür beruhigte sich ihr Magen vorübergehend. Erleichtert atmete sie durch. Als sie die Augen wieder öffnete, war die Ampel auf Grün gesprungen.
Lydia umklammerte das Lenkrad, gab Gas und versuchte, sich auf den Weg zu konzentrieren. Irgendwo hier musste sie abbiegen. Was hatte der Kollege über Funk gesagt? Nach dem Baumarkt die zweite Kreuzung links und dann auf die Landstraße. Das Pochen in ihrem Schädel verstärkte sich. Verdammt! Warum war sie nicht erst nach Hause gefahren? Sie hätte kurz duschen, sich umziehen und zwei Aspirin nehmen können. Auch wenn ihr Magen ihr Letzteres vermutlich übel genommen hätte.
Schon von Ferne sah sie das blinkende Blaulicht. Sie schlug das Lenkrad ein und rollte langsam auf den holprigen Waldweg. Ein Kollege in Uniform trat auf ihren Wagen zu. Sie ließ die Scheibe herunter und kramte in ihrer Jacke nach dem Dienstausweis, doch das erwies sich als unnötig.
»Guten Morgen, Frau Louis.« Er tippte sich in einer militärischen Geste an die Mütze. »Einfach dem Weg folgen. An der Gabelung links, danach sind es nur noch ein paar Meter. Ist nicht zu verfehlen.«
Sie brummte ein Danke und schloss das Fenster. Hier im Wald war es noch dämmrig, Zweige knisterten unter den Reifen, ein Schatten huschte vor ihr über den Weg. An der Gabelung kam die Übelkeit wieder. Sie fluchte. Das würde ihr gerade noch fehlen, auf die Leiche zu kotzen! Es hatte sie Jahre gekostet, sich bei den männlichen Kollegen Respekt zu verschaffen, ihnen zu beweisen, dass sie eine gute Ermittlerin war, dass sie Instinkt hatte, Ausdauer und starke Nerven. Doch eine kleine Panne, ein winziges Aufblitzen weiblicher Schwäche, und die jahrelange mühevolle Arbeit wäre zunichte gemacht. Von dem Moment an, wo sie an einem Tatort ihr Frühstück ins Gebüsch spuckte, hätte sie ihren Spitznamen weg: »das Sensibelchen«, »unsere Zarte« oder einfach nur »die kotzende Lydia«.
Funkstreifen, Notarzt und Leichenwagen tauchten vor ihr auf. Kreuz und quer parkten die Fahrzeuge auf dem schmalen geschotterten Waldweg. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Ohne allzu große Eile lenkte sie den Toyota hinter den BMW ihres Chefs und stellte den Motor ab.
Bevor sie ausstieg, warf sie einen raschen Blick in den Rückspiegel. Glücklicherweise hatte sie einen Haarschnitt, dem man nicht ansah, ob sie frisch frisiert war oder drei Tage keine Bürste in die Hand genommen hatte. Sie fuhr sich mit den Fingern ein paarmal durch die dunkelblonden, kurzen Strähnen und kniff sich in die Wangen, um nicht so blass auszusehen. Kurz schloss sie die Augen und massierte ihre hämmernden Schläfen. Danach stieß sie mit einem Seufzer die Wagentür auf.
Weynrath löste sich aus dem Gewusel, als sie über den knirschenden Untergrund lief. Er war einen halben Kopf kleiner als Lydia, von behäbiger Statur und wirkte immer ein wenig elektrisiert. Manchmal erinnerte er sie an den Schauspieler Danny de Vito, heute jedoch sah er eher wie einer von diesen Aufziehweihnachtsmännern aus, die Jingle Bells dudelnd über den Wohnzimmerteppich marschierten. Dabei trug er weder Bart noch einen roten Mantel.
»Louis! Da sind Sie ja! Verdammt beschissene Sache.«
Sie straffte die Schultern. »Was ist passiert?«
»Leiche. Vermutlich weiblich. Da vorne auf der Lichtung. Kommen Sie mit!«
»Vermutlich weiblich?«, fragte Lydia, während sie ihrem Chef durch das Unterholz folgte.
»Warten Sie’s ab.«
Sie gelangten an den Bereich, der mit Flatterband abgesperrt war. Gestalten in weißen Overalls huschten zwischen den Stämmen umher. Jemand machte Fotos. Überall im Boden steckten kleine Schildchen. Obwohl es inzwischen fast hell war, tauchten zwei riesige Scheinwerfer das Waldstück in grelles Kunstlicht.
Einer der weiß Gewandeten löste sich aus der Menge.
»Morgen, Louis. Schöne Scheiße.«
Sie nickte. »Kann ich durch, Spunte?«
Spunte hieß mit vollem Namen Gerald Spuntenmayer und war Chef der Spurensicherung. Er allein bestimmte, wer sich wo an einem Tatort aufhalten durfte.
»Hier vorne ist der Pfad markiert«, antwortete er und deutete vor sich auf den Boden. »Aber wir sind sowieso gleich durch. Hansi macht gerade noch die letzten Bilder.«
Lydia stieg über die Absperrung und folgte Spunte in die Mitte einer kleinen Lichtung, wo eine Frau mit Pferdeschwanz über einem dunklen Bündel kauerte.
»Was haben wir denn?«, fragte Lydia.
Die Rechtsmedizinerin blickte zu ihr hoch. Sie war nur wenige Jahre älter als Lydia, vielleicht Anfang vierzig, hatte große ausdrucksvolle Augen und ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen. Lydia wusste, dass sie unter den Kollegen einen ähnlichen Ruf genoss wie sie selbst. Spröde, aber kompetent. Eigentlich hätte sie so etwas wie Solidarität ihr gegenüber empfinden müssen, immerhin waren sie Leidensgenossinnen in dieser brutalen Männerwelt. Doch das Gegenteil war der Fall. Lydia konnte Maren Lahnstein nicht ausstehen. Und sie wusste nicht einmal, warum.
»Gute Frage«, antwortete die Ärztin. Sie deutete auf das Bündel zu ihren Füßen. Jetzt erkannte Lydia, dass es Haare waren, an denen eine blutige Masse haftete. Das Pochen in ihren Schläfen verstärkte sich, sie kniff die Augen zu, um den Schmerz einzudämmen.
Maren Lahnstein sprach inzwischen weiter. »Ein vollkommen zertrümmerter Schädel, ein Ohrring, langes dunkles Haar, vermutlich eine Frau. Der Rest des Körpers ist in den Waldboden eingegraben, deshalb kann ich noch nicht viel zur Todesursache sagen. Die Verletzungen am Kopf hätten aber in jedem Fall ausgereicht, um sie zehnmal zu töten.«
»Irgendeine Vorstellung, wie ihr die Verletzungen beigebracht wurden?« Lydia bückte sich, um sich den zertrümmerten Schädel näher anzusehen. Sie erkannte die ovale Gesichtsform, ein zerfetztes Ohr mit einem kleinen Perlenohrring. Ein Auge war blutunterlaufen, das andere fehlte.
»Ich halte es für möglich, dass sie gesteinigt wurde«, sagte Maren Lahnstein zögernd. »Aber das ist zunächst einmal eine vorsichtige Hypothese. Ihre Kollegen haben jedenfalls haufenweise blutverschmierte Steine rings um den Schädel sichergestellt.«
»Was für ein Mist.« Lydia richtete sich wieder auf. Ihrem Magen ging es erstaunlich gut angesichts des grausigen Anblicks, doch ihr Schädel fühlte sich an, als hätte man ihr Ähnliches angetan wie dem Opfer.
Hinter ihr räusperte sich Weynrath. »Sie wissen, was ich denke?«
Lydia drehte sich um. »Wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier stehen.«
»Haha. Das ist weder der Ort noch der Zeitpunkt für Scherze. Frau. Jung. Dunkelhaarig. Todesursache Steinigung. Dämmert es jetzt?«
»Sie meinen, das war ein Ehrenmord?«
»Was sonst? Islamisten. Terroristen. Dieses durchgeknallte Pack. Bomben werfen. Hände abhacken. Steinigen. Die stehen doch auf so was.«
»Ich glaube, in der Bibel ist auch von Steinigungen die Rede.«
»Sparen Sie sich ihre religionsphilosophischen Betrachtungen für nach dem Dienst auf, Louis. Das hier ist ein beschissener Ehrenmord. Darauf verwette ich meinen Arsch. Sie müssen nur die Tote identifizieren und sich ihre Brüder vorknöpfen.«
»Am besten den jüngsten, der noch nicht strafmündig ist. Meinen Sie das?«
»Ich kann nichts dafür, dass diese Kameltreiber so fanatisch drauf sind.«
»Kameltreiber?«
»Verdammt, Louis.« Er trat näher und fixierte sie von unten. Lydia konnte riechen, dass er mit einem starken Mundwasser gegurgelt hatte. Vielleicht hatte er ähnliche Probleme wie sie. »Ich möchte, dass Sie diesen Fall ganz schnell wasserdicht machen. Bevor er großes Aufsehen erregt. Verstanden?«
Er wandte sich ab und stiefelte durch den Wald davon, bevor sie etwas erwidern konnte. Sie wollte ihm hinterherlaufen, aber Maren Lahnstein hielt sie zurück.
»Frau Louis? Was ist mit der Leiche?«
Irritiert drehte sie sich um. Dann warf sie einen kurzen Blick zu Spunte, der dem Schlagabtausch zwischen ihr und Weynrath schweigend gelauscht hatte. Er nickte stumm.
»Okay.« Sie winkte ein paar Kollegen, die, mit Klappspaten bewaffnet, hinter der Absperrung warteten. »Ausgraben!«
Sie blieb nicht, um zuzusehen, sondern folgte ihrem Chef, der irgendwo zwischen den Einsatzwagen verschwunden war. Sie entdeckte ihn, ins Gespräch mit einem Mann vertieft, den sie noch nie gesehen hatte. Der Fremde lehnte an einem der Streifenwagen und hatte die Hände lässig in den Taschen seiner Lederjacke vergraben. Lydia runzelte die Stirn. Ein neuer Staatsanwalt?
Danny de Vito winkte ihr.
Sie trat zu den beiden und stellte fest, dass der Fremde sie an den jungen Paul Newman erinnerte. Nur dass seine Augen nicht stahlblau waren, sondern braun.
»Das ist Kriminalhauptkommissar Christopher Salomon«, erklärte ihr Chef. »Ihr neuer Partner, Louis. Seien Sie nett zu ihm. Er ist aus Köln.«
Lydia unterdrückte mühsam einen Fluch. »Ich dachte …«, begann sie. Ihr Magen meldete sich plötzlich wieder vehement zu Wort. Säure fraß sich ihre Kehle hinauf. Sie hatte eine Vereinbahrung mit Weynrath. Was dachte dieser Scheißkerl sich dabei, sich einfach nicht daran zu halten und ihr diesen Schönling aufs Auge zu drücken? Wollte er damit seine Macht demonstrieren?
»Ich weiß, was Sie dachten, Louis«, fuhr Weynrath dazwischen. »Vergessen Sie’s. Glauben Sie mir, Salomon ist genau der Richtige für Sie. Sie beide werden ein wunderbares Paar abgeben.« Er grinste anzüglich.
Lydia ignorierte seine kindliche Freude. Sie würde sich nicht die Blöße geben, hier vor allen Kollegen eine Diskussion mit ihm anzufangen. Sie würde Paul Newman schon loswerden. Auf ihre Art. Rasch wechselte sie das Thema.
»Wie viele Leute kriege ich für die Moko?«
»Meier und Schmiedel. Und der Köster kann die Akte führen.«
»Meier, Schmiedel und Köster?« Lydia sah ihn ungläubig an, Salomon zeigte zum ersten Mal eine Regung und zog erstaunt die Augenbrauen hoch.
»Gibt es damit ein Problem?« Weynrath fingerte ein Taschentuch aus der Jacketttasche und fuhr sich damit über die Stirn.
»Drei Leute für einen Mord mit einer noch nicht identifizierten Leiche, die grausam verstümmelt wurde? Allerdings gibt es da ein Problem.«
»Fünf Leute«, korrigierte Weynrath. »Mit Ihnen und dem Kölner sind es fünf.«
Er zwinkerte Salomon zu, der jedoch ernst blieb.
»Verdammt, das reicht nicht!«, fluchte Lydia. »Und das wissen Sie ganz genau.«
»Das sehe ich anders. Sobald Sie rausgefunden haben, wer die Frau ist, haben Sie Ihren schönen kleinen Kreis von Tatverdächtigen. Vielleicht hat sie ja sogar nur einen Bruder. Dann geht das ratzfatz.«
»Ist Ihnen vielleicht schon mal in den Sinn gekommen, dass auch etwas ganz anderes dahinterstecken könnte? Die Leiche ist noch nicht mal ausgegraben, und Sie wissen bereits, was passiert ist!«
»Okay, okay.« Weynrath hob abwehrend die Hände. Er schaute sich suchend um und entdeckte einen jungen Kollegen, der etwas linkisch eine der Lampen im Wagen verstaute.
»Hey, Sie!«
Der junge Beamte sah verwirrt zu ihnen herüber, nicht sicher, ob er gemeint war.
»Ja, Sie«, schrie Weynrath. »Nun kommen Sie schon.«
Der Mann knallte die Wagentür zu und trat näher. Er hatte glatt gekämmtes, rotblondes Haar und ein rundes Kindergesicht.
»Wie heißen Sie, junger Mann?«
»Kommissaranwärter Sebastian Mörike.«
»Oh, ein Dichter.« Weynrath lachte schallend. Mörike blinzelte verängstigt. »Verstehe ich nicht.«
»Macht nichts, mein Freund«, erklärte Weynrath jovial. »Sie dürfen sich freuen. Ab sofort gehören Sie zur ›Moko Kameltreiber‹. Frau Louis wird Ihnen sagen, was Sie zu tun haben.« Er blickte triumphierend in die Runde. »Viel Vergnügen allerseits!«
Ohne sich noch einmal umzudrehen marschierte er auf seinen BMW zu, stieg ein und brauste davon.
»Netter Zeitgenosse«, stellte Salomon fest.
Lydia zuckte mit den Schultern. Eine erneute Schmerzwelle wogte durch ihren Schädel, und sie biss sich auf die Unterlippe. Was für ein beschissener Morgen. Eine Leiche ohne Gesicht, eine Mordkommission, die aus drei Kommissaren, einem grinsenden Kölner und einem Praktikanten bestand, und ein Chef, der von nichts eine Ahnung hatte, aber alles besser wusste. Am liebsten hätte sie ihre Dienstwaffe gezückt und Weynraths schickem Wagen ein paar Kugeln hinterhergeschickt.
Mörike sah sie verunsichert an. »Was soll ich jetzt tun?«
Lydia zwang sich, ein paarmal tief ein- und auszuatmen. »Finden Sie raus, wer die Tote entdeckt hat.«
»Das weiß ich.« Ein Funken Stolz blitzte in seinen blauen Augen auf.
»Und?«
»Eine junge Frau, die oben in Erkrath wohnt. Sie war joggen, und dabei ist ihr aufgefallen, dass etwas auf der Lichtung lag.«
»Und wo steckt sie?«, fragte Lydia ungeduldig. »Ich sehe hier keine junge Frau.«
»Ich glaube, sie ist erst nach Hause gelaufen und hat von dort die Kollegen angerufen.«
»Aha. Wer hat ihre Adresse?«
»Ich weiß nicht.« Er zögerte. »Aber ich kümmere mich drum.« Er eilte davon.
Lydia schaute zu Salomon. Der nahm die Hände aus der Jackentasche und streckte ihr die rechte entgegen.
»Chris.«
Lydia ignorierte die ausgestreckte Hand.
»Ich werfe noch mal einen Blick auf die Leiche. Müsste ja inzwischen ausgegraben sein.«
Sie wandte sich ab.
»Lydia?«
Sie fuhr herum.
»Ich darf Sie doch Lydia nennen?«
»Alle nennen mich Louis. Wäre nett, wenn Sie sich auch daran halten würden.«
Er zuckte mit den Schultern. »Kein Problem. Louis, also.«
Wieder streckte er ihr die Hand entgegen. Diesmal lag etwas Silbernes darin.
»Leider habe ich nichts, womit Sie das Zeug runterspülen können.«
Lydia starrte auf die Tablettenpackung.
»Woher …«, stammelte sie. Dann fasste sie sich. »Was soll das?«
Er antwortete nicht, hielt ihr nur weiter die Tabletten hin.
Schließlich griff sie danach, drückte zwei heraus und warf sie in den Mund. Danach gab sie ihm das Päckchen zurück.
»Finden Sie raus, wie dieses Waldstück genutzt wird, Salomon. Jogger, Förster, Wandervereine. Der Killer hat die Lichtung nicht zufällig gefunden. Er kannte sie. Er wusste, dass sie ideal für sein Vorhaben war.«
Sie drehte sich um und ging durch den Wald zurück zum Fundort. Die Leiche war jetzt freigelegt. Schweigend trat Lydia auf das Loch zu. Der weiße, vom Waldboden verschmutzte Körper lag leicht nach vorne gekrümmt in der Grube, fast so, als würde die Frau sitzen. Rechts und links türmten sich Wälle aus frisch ausgeworfener, feuchter Erde auf. Die Tote war nackt und schien auf den ersten Blick unversehrt. Abgesehen von dem zertrümmerten Schädel. Ihre Knöchel waren mit einer Wäscheleine zusammengebunden, und auch die Hände, die hinter dem Rücken verborgen waren, schienen gefesselt zu sein.
Maren Lahnstein erhob sich gerade, als Lydia hinter sie trat.
»Und?«, fragte Lydia.
»Sie wurde eingegraben, bis nur noch der Kopf herausguckte, und dann so lange mit Steinen beworfen, bis der Tod eingetreten ist. So zumindest stellt es sich im Augenblick dar.«
»Wie lange hat es gedauert, bis sie tot war?«
»Ich weiß nicht. Das kann ich erst nach der Obduktion sagen. Ich habe ja keine Ahnung, in welchen zeitlichen Abständen die Steine geworfen wurden.«
Lydia nickte. »Okay. Wir sehen uns später.«
Sie marschierte zu Spunte, der gerade einen kleinen Gegenstand eintütete. »Was gefunden?«
Spunte zuckte mit den Schultern. »Kaugummi. Kann vom Täter sein, vom Förster oder von meinem Sohn. Wir waren letztes Wochenende hier, meine Frau, die Jungs und ich. Schöne Bescherung.«
»Sonst nichts?«
»Komm mit, Louis.«
Er ging ein Stück tiefer in den Wald hinein. »Siehst du das?« Er deutete auf einen Baum. In die Rinde waren ein paar Zeichen eingeritzt.
RI1924
»Ist das frisch?«, fragte Lydia.
»Ein paar Stunden alt, schätze ich«, antwortete Spunte. »Dort, wo die Rinde weggekratzt wurde, ist das Holz noch ganz feucht und hell.«
»Du meinst, es könnte unser Täter gewesen sein?«
»Schon möglich.«
»Irgendeine Idee, was das heißen könnte?«
Spunte zuckte mit den Achseln. »Initialen und ein Jahr vielleicht. Rudolf und Irmgard, 1924.«
»1924? Ich denke, das ist frisch.«
»Vielleicht haben sie sich 1924 kennengelernt?«
»Und ritzen im zarten Alter von über einhundert Jahren ihre Initialen in einen Baum?«
»War nur so ’ne Idee. Vielleicht ist es ja auch eine Markierung des Försters.«
Lydia nickte. »Wir müssen ihn auf jeden Fall fragen. Habt ihr Fotos gemacht?«
»Klar.«
»Dann lasst diesen Mist verschwinden. Sollte es Nachahmungstäter oder geständige Irre geben, hilft uns das vielleicht, die Spreu vom Weizen zu trennen.«
»Vorausgesetzt, diese Hieroglyphen haben was mit dem Mord zu tun.«
Lydia fuhr sich durch das Haar. Ein Wunder war geschehen, die Tabletten schienen bereits zu wirken, und auch ihr Magen hatte sich beruhigt. »Das haben sie, Spunte. Da könnte ich wetten.«
»Willst du auch deinen Arsch setzen wie der Chef?«
Lydia warf ihm einen ärgerlichen Blick zu, dann musste sie grinsen. »Den brauch ich noch, Spunte, da will ich mal lieber kein Risiko eingehen.«
Als sie zurück zum Weg kam, stand Christopher Salomon neben ihrem Wagen. »Nehmen Sie mich mit, Louis?«
»Wie sind Sie denn hergekommen?«
»Taxi.«
»Haben Sie kein Auto?«
»Motorrad.«
Sie zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Die Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben«, erklärte er. »Aber wenn sie wieder flott ist, können wir gern mal eine Spritztour machen.«
Sie fror plötzlich. Rasch schloss sie den Toyota auf und rutschte auf den Fahrersitz. Salomon schaffte es gerade noch, zur Beifahrerseite zu hechten und hineinzuspringen, bevor sie Gas gab und in einer dicken Staubwolke zurück zur Landstraße bretterte.
3
Ellen Dankert schloss die Augen. Das heiße Wasser hüllte sie ein wie eine schützende Decke. Sie ließ die Tropfen auf sich niederregnen, versuchte, an nichts zu denken, und für einen Augenblick gelang es ihr sogar. Doch viel zu schnell kamen die Gedanken zurück. Und die Bilder. Das seltsame Bündel im Wald. Das Knacken.
Sie hatte den Jogginganzug samt Unterwäsche in die Waschmaschine gestopft, obwohl sie sich im Moment nicht vorstellen konnte, je wieder etwas davon anzuziehen. Am liebsten hätte sie alles in die Mülltonne geworfen. Doch was würde Philipp denken, wenn er die Sachen zufällig entdeckte?
Ellen drehte das Wasser ab und griff nach dem Handtuch, das auf einem Stuhl bereitlag. Der Spiegel war beschlagen. Sie wischte einen Streifen frei und betrachtete ihr Gesicht. Blass und dünn wirkte sie, beinahe knochig. Sie hatte abgenommen in den letzten Wochen.
Ellen wickelte sich enger in das Handtuch. Wieder sah sie das Bündel vor sich. Die Haare und die blutige Masse darunter. Ob es tatsächlich das gewesen war, wofür sie es gehalten hatte? Was, wenn nicht? Wenn die Polizei ganz umsonst in den Wald gefahren war? Mit einem Mal wurde ihr heiß. Warum hatte sie sich das schwarze Ding nicht genauer angesehen? Carola hätte das sicherlich getan. Carola Müller hätte nachgeschaut, was dort auf dem Waldboden lag, sie wäre nicht einfach kopflos davongestürmt.
Aber sie war nicht Carola Müller. Es gab überhaupt keine Carola Müller. Es gab nur sie, Ellen, eine kindische, feige Idiotin, die sich vermutlich gerade bis auf die Knochen blamiert und blinden Alarm ausgelöst hatte wegen eines toten Hundes. Oder schlimmer noch, wegen eines alten Putzlappens. Sie hätte am Telefon einen falschen Namen angeben sollen. Wie konnte sie nur so blöd sein? Bestimmt war es strafbar, die Polizei wegen einer vermeintlichen Leiche in den Wald zu bestellen, auch wenn kein böser Vorsatz dahintersteckte. Sie würde eine saftige Geldbuße zahlen müssen. Doch das war nicht einmal das Schlimmste. Philipps Wut würde grenzenlos sein.
Der Spiegel hatte sich wieder beschlagen. Ihr Gesicht wurde von den feuchten Schwaden verschlungen, bis es nicht mehr zu sehen war. Sie wünschte, sie könnte sich tatsächlich unsichtbar machen. Einfach verschwinden. In den Spiegel steigen und nie wieder zurückkehren.
Sie war anders, als Chris erwartet hatte. Und auch wieder nicht. Viel härter und viel zerbrechlicher. Er hatte auf dem Präsidium, oder wie es unter den Düsseldorfer Kollegen hieß, in der Festung, ein paar Gerüchte über Lydia Louis aufgeschnappt: ist extrem spröde. Launisch. Zieht immer ihr eigenes Ding durch. Lässt sich von niemandem in die Karten schauen. Und vor allem: lässt keinen Kerl an sich ran. Nachdem er Lydia kennengelernt hatte, wusste er, was die Kollegen meinten. Und er war überzeugt davon, dass sie recht hatten. In allen Punkten. Bis auf einen. Da täuschten sie sich. Ihm war sofort klar gewesen, was mit ihr los war. Nicht nur wegen der blassen Haut, der dunklen Ringe unter den übermüdeten blauen Augen. Sondern vor allem wegen des Geruchs. Man sagte ihm nach, dass er eine besonders feine Nase besitze. In Lydias Fall war sie allerdings nicht vonnöten. Was sie ausdünstete, auch jetzt noch, während sie neben ihm auf dem Fahrersitz saß, war penetrant und unverkennbar: eine aparte Mischung aus Alkohol, Schweiß und Sex.
Er sah zu ihr, beobachtete, wie sie den Wagen über die Landstraße lenkte. Ihr Fahrstil war so rau wie sie selbst. Sie traktierte Kupplung und Gaspedal, als steuere eine tiefe, mühsam unterdrückte Wut ihre Bewegungen. Ihr Blick war starr auf die Fahrbahn geheftet. Eine Strähne ihrer dunkelblonden Haare hing ihr in die Augen, bis sie sie mit einer ungeduldigen Bewegung aus der Stirn strich. Sie hatte einen zersausten Kurzhaarschnitt, der ihr schmales Gesicht betonte. Sie war nicht sein Typ, aber sie war attraktiv. Ausgesprochen attraktiv sogar. Trotz des angeschlagenen Zustands. Und trotz der eher jungenhaften Kleidung. Sie trug Jeans, braune Lederstiefel und einen grobmaschigen schwarzen Strickpulli mit Rollkragen. Den dunkelgrünen Parka hatte sie auf den Rücksitz geworfen.
Er versuchte sich vorzustellen, mit was für einem Typen sie wohl die letzte Nacht verbracht hatte. Hatte sie einen Liebhaber, von dem die Kollegen nichts wussten? Oder war sie mit einem Fremden ins Bett gestiegen? Chris konnte nicht sagen, welche Variante ihm wahrscheinlicher erschien. So oder so hatte die Vorstellung, wie Lydia Louis es zwischen zerwühlten Laken mit einem Unbekannten trieb, etwas seltsam Irritierendes.
Mörike, der Praktikant, meldete sich per Funk. Sofort verlagerte Chris seine Aufmerksamkeit auf den Fall und auf das, was das Babyface mitzuteilen hatte. Er gab ihnen den Namen und die Anschrift der Zeugin durch. Ellen Dankert, Fabershof in Erkrath. Lydia unterbrach die Verbindung, ohne sich zu bedanken.
Wenige Minuten später hielten sie vor einem schmucken Reihenhaus in einer Siedlung mit lauter schmucken Reihenhäusern. Das Heim von Ellen Dankert unterschied sich lediglich in den Details von dem ihrer Nachbarn. Ein Tonschild, das selbst getöpfert aussah, hing an der Tür. »Hier wohnen Ellen, Philipp, Maja und Lukas Dankert« stand mit verschnörkelter Schrift darauf geschrieben.
Der Anblick traf Chris wie ein elektrischer Schlag. Unwillkürlich dachte er an das Schild, das an seiner eigenen Haustür hing und das diesem hier stark ähnelte. Lediglich die Namen waren andere: Stefanie, Christopher und Anna Salomon. Was längst nicht mehr stimmte. Er biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste in den Taschen seiner Lederjacke. Dann folgte er seiner neuen Kollegin durch den winzigen Vorgarten zur Tür.
Die Frau, die ihnen öffnete, war noch keine dreißig und sah grau und verschreckt aus. Irgendwo im Haus plärrte der Fernseher, die Waschmaschine schleuderte lautstark. Ohne recht hinzusehen warf Ellen Dankert einen Blick auf die Ausweise und machte Platz, um die beiden einzulassen. Sie hatte das dünne Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, trug einen blauen Jogginganzug und Turnschuhe, und Chris fragte sich, ob sie sich noch nicht umgezogen hatte, seit sie aus dem Wald zurückgekommen war.
Die Küche prahlte mit hochmodernem Mobiliar und war mit neuester Technik vollgestopft, eine Sitzgruppe in Chrom und Leder dominierte den Raum. Alles wirkte unangenehm steril, so als sei es für einen Katalog zusammengestellt. Lediglich die Fenster verbreiteten ein wenig menschliche Wärme. An den Scheiben klebte herbstliche Dekoration, buntes Laub und ein Drachen aus Tonpapier, möglicherweise im Kindergarten gebastelt. Der Fensterschmuck passte ebenso wenig zu der seelenlosen Designereinrichtung wie die mausgraue junge Frau mit dem verängstigten Gesicht.
Sie ließen sich in der Sitzecke nieder. Die Stühle federten bequem, die gläserne Tischplatte glänzte makellos, kein Schokoladenfleck, nirgendwo ein winziger Abdruck von Kinderfingern. Ellen Dankert verschwand kurz, der Fernseher verstummte, und auch die Geräusche der Waschmaschine waren mit einem Mal nur noch gedämpft zu hören. Sie kam zurück und setzte sich zu ihnen.
»Frau Dankert, wir haben da noch ein paar Fragen«, begann Lydia.
Die Frau nickte stumm.
»Wann genau heute Morgen haben Sie die Tote entdeckt?«
Ellen Dankert zuckte zusammen. »Es ist also wirklich eine Leiche?«
Erstaunt registrierte Chris, dass sie erleichtert zu sein schien.
Lydia nahm das offenbar nicht wahr. »Ja«, erwiderte sie knapp. »Also, um wie viel Uhr war das?«
»Ich – ich weiß nicht so genau. Mein Mann ist um halb sechs aus dem Haus. Er ist Chirurg, arbeitet in der Uniklinik. Danach habe ich mich schnell umgezogen und bin losgelaufen. Bis zu der Stelle brauche ich vielleicht zehn oder zwölf Minuten.« Sie zuckte unsicher mit den Schultern.
»Also gegen viertel vor sechs?«, fragte Chris.
»So in etwa.«
»Was genau haben Sie gesehen?«, setzte Lydia die Befragung fort.
»Nur etwas Schwarzes. Haare.«
»War jemand außer Ihnen im Wald? Haben Sie irgendwen gesehen?«
»Nein. Nein, ich war ganz allein.« Ihre Stimme klang mit einem Mal schrill. Hektisch rieb sie sich mit den Handflächen über die Oberarme. Ihr Blick huschte zur Uhr, die an der Wand über der Tür hing. »Ich muss einkaufen. Sonst bekomme ich das Essen nicht rechtzeitig fertig. Philipp – er besteht darauf, pünktlich zu essen.«
»Es ist doch erst zehn«, wandte Lydia ein. »Wann kommt denn Ihr Mann nach Hause?«
Die Frau sah erneut zur Uhr.
»Er kommt erst am frühen Abend. Aber es ist noch viel zu tun bis dahin. Und um eins muss ich die Kinder aus dem Kindergarten holen. Eine Nachbarin hat sie heute mitgenommen. Ich – ich habe mich nicht getraut, das Haus zu verlassen. Albern, finden Sie nicht?«
»Das ist ganz und gar nicht albern«, widersprach Chris. »Sie stehen unter Schock.«
Die Frau lächelte ihn dankbar an. »Jetzt geht es mir auch schon besser«, versicherte sie. »Nur heute morgen, da hat mich plötzlich die Panik gepackt. Ständig habe ich dieses schwarze Bündel vor mir gesehen. Ich weiß auch nicht, warum. Also, stellen Sie Ihre Fragen, bitte, damit ich los kann. Philipp ist sehr eigen, wissen Sie, was Essenszeiten und solche Dinge angeht.«
»Es wird nicht lang dauern«, sagte Chris. »Außerdem hat Ihr Mann sicherlich Verständnis dafür, dass heute nicht alles nach Plan läuft.«
Wieder fuhr sie über ihre Arme. »Sie müssen wissen, mein Mann hat keine Ahnung, dass ich jogge. Er …«
»Sie haben also niemanden gesehen und niemanden gehört?«, fuhr Lydia dazwischen.
Chris warf ihr einen verärgerten Blick zu. Konnte sie nicht ein wenig einfühlsamer mit der Frau umgehen? Es war doch offensichtlich, dass es ihr nicht gut ging. »Denken Sie noch einmal nach, Frau Dankert«, sagte er sanft.
»Da war ein Knacken«, erzählte sie langsam.
Lydia kniff die Augen zusammen. »Ein Knacken?«
»Ja. Nein, eigentlich hat es zweimal geknackt. Erst ein Stück vor der Lichtung. Dann kam ein Reh über den Weg gelaufen. Und danach, als ich auf der Lichtung war und – und dieses Ding gefunden hatte, da knackte es im Unterholz, und ich lief weg.«
»Gesehen haben Sie nichts?«, fragte Lydia, jetzt ein wenig freundlicher.
Sie schüttelte stumm den Kopf.
Wenig später verabschiedeten sie sich von Ellen Dankert. Sie hatten nichts weiter aus der nervösen jungen Frau herausbekommen. Wortlos fuhren sie ins Präsidium. Lydia kaute während der ganzen Fahrt auf ihrer Unterlippe, und Chris starrte aus dem Fenster, dachte an Anna und versuchte die Tränen wegzuzwinkern, die in seinen Augen brannten.
4
Sie hatten im kleinen Besprechungsraum alle Fenster aufgerissen, trotzdem wich der muffige Gestank nur langsam. Gerade eben hatte die »Soko Pumps«, wie sie inoffiziell hieß, das Zimmer geräumt. Die Beamten aus dem Raubdezernat waren auf der Jagd nach einem Unbekannten, der alte Damen überfiel, ihnen die Handtasche und die Schuhe klaute. Handtaschenräuber gab es viele, aber einer, der ein Faible für Damenschuhe hatte, vor allem für solche von älteren Damen, war bisher bei der Düsseldorfer Kripo nicht aktenkundig. Offenbar hatten den Mitgliedern der »Soko Pumps« ganz schön die Köpfe geraucht, zumindest, wenn man vom Zustand der Luft Rückschlüsse zog.
Lydia ordnete die Notizen auf dem Tisch und versuchte, sich zu konzentrieren. Sie hatte Salomon in der Festung abgesetzt mit dem Auftrag, sich um die Inschrift in dem Baumstamm zu kümmern, und war kurz nach Hause gefahren, um zu duschen. Keine halbe Stunde später war sie in ihrem Büro gewesen, hatte mit dem Staatsanwalt und der Rechtsmedizin telefoniert. Ihr Haar war noch feucht, ihr Magen launisch, aber die hämmernden Kopfschmerzen hatten sich bis auf weiteres verzogen, und sie fühlte sich halbwegs frisch und sauber.
»Jungs«, sagte sie, »es geht los. Zuerst möchte ich euch den Neuen im Team vorstellen. Das ist Christopher Salomon. Er kommt von der Kripo Köln.«
Freundliches Gemurmel war die Reaktion. Selbst Reinhold Meier, dem sonst kein Witz über die ungeliebte Nachbarstadt zu blöd war, hielt sich zurück.
Gerd Köster sah seinen Tischnachbarn überrascht an. »Der Chris Salomon?«
Salomon hob die Schultern. »Ich glaube nicht, dass der Name sehr häufig ist«, erwiderte er grinsend. »Also muss ich wohl der Chris Salomon sein.«
Er klang lässig, doch Lydia hatte bemerkt, dass ihn Kösters Worte unangenehm berührt hatten. Für den Bruchteil einer Sekunde erwog sie nachzuhaken, doch dann unterdrückte sie ihre Neugier. Sie hatten viel zu tun, und wenn Köster etwas Interessantes über Salomon wusste, würde sie es auch später noch aus ihm herausbekommen. »Salomon, das sind Gerd Köster, Reinhold Meier und Erik Schmiedel. Sebastian Mörike kennen Sie ja schon.«
»Freut mich.« Er lächelte in die Runde. »Und bitte, nennt mich Chris, okay?«
Die anderen nickten zustimmend.
»Willkommen im Team, Chris«, sagte Gerd Köster und klopfte ihm auf die Schulter.
»Dann zur Sache«, fuhr Lydia fort. Sie hatte nicht die geringste Lust, Paul Newman zu duzen, aber wenn sie jetzt querschoss, kam das einem offenen Affront gleich. Widerwillig unterdrückte sie ihren Ärger und wandte sich an ihren Nebenmann. »Köster, du führst die Akte?«
Gerd Köster klopfte auf einen Stapel Blätter. »Habe schon angefangen.«
»Ich fasse zusammen, was wir bisher wissen«, erklärte Lydia. »Eine junge Frau ist – vermutlich irgendwann letzte Nacht – gefesselt, bis zum Hals im Waldboden eingegraben und zu Tode gesteinigt worden. Heute Morgen gegen sechs wurde ihre Leiche gefunden. Es ist möglich, dass der Täter noch in der Nähe war, die Zeugin, die die Tote fand, hat ein Knacken gehört. Andererseits knackt es in einem Wald ständig, das muss also nichts heißen. Die Identität der Frau ist noch nicht ermittelt. Außer einem kleinen Perlenohrring haben wir keine persönlichen Gegenstände bei ihr gefunden. Sie war nackt. Doktor Lahnstein beginnt noch heute Nachmittag mit der Obduktion, ich werde selbst dabei sein.« Lydia holte Luft. »Und dann haben wir noch etwas sehr Spezielles im Wald entdeckt, von dem wir allerdings nicht wissen, ob es mit dem Mord zu tun hat: In einen Baumstamm in der Nähe des Tatorts war etwas eingeritzt.« Sie stand auf, griff nach einem der bereitliegenden Stifte und schrieb die Buchstaben- und Zahlenfolge an das Whiteboard hinter ihr an der Wand. RI1924. »Die Inschrift war frisch, das Holz noch feucht.«
»Ich habe mal gegoogelt«, unterbrach Salomon sie. »Man kriegt eine Reihe Treffer, wenn man RI1924 eingibt, aber nichts, was einen direkt anspringt. Die meisten Seiten sind auf Englisch. Jede Menge über Rhode Island und das Jahr 1924 und etwas über einen amerikanischen Radiomoderator.«
»Es könnte auch was Persönliches sein«, meinte Erik Schmiedel. »Etwas, das man nicht im Internet findet, weil es nur für den Täter oder das Opfer Bedeutung hat. Oder irgendein Code.«
»Klar«, sagte Lydia. »Im Augenblick ist alles möglich. Wir sammeln Ideen. Okay? Egal, wie absurd sie erscheinen. Und Salomon, du suchst weiter im Internet. Vielleicht findest du doch noch etwas Interessantes.«
»Und wenn das am Anfang gar keine Buchstaben sind?«, warf Reinhold Meier ein. Er verschränkte die Arme vor seiner breiten, muskulösen Brust, sodass sein schwarzes T-Shirt sich spannte. »Das ›I‹ zumindest könnte auch eine missglückte Eins sein.«
»Und das ›R‹?«, fragte Schmiedel und grinste seinen Freund an.
»Was weiß ich«, schnauzte der zurück. »Du bist doch der Professor. Sag du’s mir.«
Erik Schmiedel war bekannt dafür, dass er immer mit einem Buch herumlief. Er las in jeder freien Minute, meistens Kriminalromane. Wofür ihn so mancher Kollege schief ansah. Die meisten wollten sich in ihrer kostbaren Freizeit nicht auch noch mit Mord und Totschlag beschäftigen, und außerdem ärgerten sie sich darüber, wie viel Unsinn in solchen Romanen verzapft wurde. Schmiedel störte das nicht. Er liebte Krimis. Er hatte sogar schon einmal versucht, seine Quittungen aus der Buchhandlung als Fortbildungskosten einzureichen, doch er war jämmerlich gescheitert. Weynrath hatte ihn unter wüsten Beschimpfungen aus seinem Büro gejagt und mit hochrotem Kopf über den ganzen Flur gebrüllt, ob er seine Besuche im Puff vielleicht auch von Vater Staat finanziert haben wolle.
»Meier hat recht«, fuhr Lydia dazwischen. »Wir sollten für alles offen bleiben. Etwas in die Baumrinde ritzen ist nicht das Gleiche wie eine Notiz auf ein Blatt Papier schreiben. Vor allem, wenn man gerade jemandem mit einem Haufen Steine den Schädel zertrümmert hat. Da kann schon mal ein Zeichen nicht ganz so werden wie geplant. Deshalb seht euch die Fotos an und sagt, was euch dazu einfällt.« Sie blickte in die Runde. »Was gibt es sonst noch?«
»Ich habe mich ein bisschen informiert«, sagte Köster. Er nahm die Brille ab und rieb sich die Augen, dann setzte er sie wieder auf. Lydia knetete ungeduldig ihre Finger. Köster war manchmal etwas umständlich, aber sie wusste, dass es sich normalerweise lohnte, auf das zu warten, was er zu sagen hatte. »Ich habe Weynraths These überprüft. Von wegen Steinigung als Ehrenmord und so.«
»Und?«, fragte Lydia.
»Ziemlich grausig, was man zu dem Thema findet. Steinigung gibt es sowohl im Judentum als auch im Christentum und im Islam. Ist eine uralte Hinrichtungsart. Angewendet zumeist bei den klassischen Delikten, vor allem Gotteslästerung und Ehebruch.«
Meier schnaubte, Lydia warf ihm einen warnenden Blick zu. Köster blätterte in den Computerausdrucken, die vor ihm auf dem Tisch lagen, und fuhr fort. »Im Gegensatz zu den anderen beiden Religionen wird die Steinigung in einigen islamischen Ländern heute noch – oder besser gesagt – heute wieder praktiziert. Beispielsweise in Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabien, im Iran und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Betroffen sind überwiegend Frauen. Das liegt daran, dass es zur Verurteilung einer bestimmten Anzahl männlicher Zeugen bedarf. Die sind bei weiblichen Angeklagten natürlich viel leichter aufzutreiben. Besonders perfide ist auch, dass sogar die Beschaffenheit der Steine vorgeschrieben ist. Sie dürfen nicht größer als die Wurfhand sein, damit der Tod nicht zu schnell eintritt.«
»Das ist ja pervers«, murmelte Salomon.
»Und es trifft auf die Steine zu, die in unserem Fall verwendet wurden«, ergänzte Schmiedel trocken. »Gibt es sonst noch Parallelen zwischen unserem Mord und Steinigungen in islamischen Ländern?«
Köster nickte. »Das Eingraben ist auch üblich. Damit der oder die Verurteilte nicht weglaufen kann. Allerdings gewöhnlich nur bis zur Hüfte oder bis zur Brust. Nicht bis zum Hals.«
»Unser Opfer war nackt und an Armen und Beinen gefesselt«, sagte Lydia. »Wie ist es damit?«
»Keine Übereinstimmung«, antwortete Köster. »Im Gegenteil, ein gewisser al-Dschaziri, ein Theologe, hat vorgeschrieben, dass der Verurteilte nicht gefesselt werden soll. Und der Körper einer Frau darf unter keinen Umständen entblößt werden, weshalb man ihr die Kleider am Leib festbinden muss.«
»Na ja, da teilt offenbar jemand die Meinung dieses al-Dschaziri nicht«, bemerkte Meier sarkastisch.
Salomon klopfte nachdenklich mit seinem Kugelschreiber auf die Tischplatte. »Wenn das wirklich eine Hinrichtung nach der Scharia war, dann könnten wir es mit einer Gruppe von Tätern zu tun haben. Mit irgendwelchen durchgeknallten Islamisten, die eigenmächtig Recht sprechen.«
»In dem Fall sitzen wir richtig in der Scheiße«, ergänzte Meier. »Wenn das publik wird, geht es wieder los mit Kopftuchdebatte und Moscheebau und all dem Mist. Die große Spielwiese für Fanatiker aller Couleur. Und morgen ruft der Innenminister an und mischt sich in unsere Ermittlungen ein. Prost Mahlzeit.« Er sprang auf und begann, vor dem Fenster hin und her zu laufen.
»Nun mal nicht den Teufel an die Wand«, sagte Schmiedel. »Noch wissen wir nichts. Vielleicht hat unser Mord einen ganz anderen Hintergrund. Wir wissen ja nicht einmal, ob die Frau tatsächlich Muslimin war.«
»Gab es da nicht vor einigen Jahren einen Fall in Frankreich?«, fragte Lydia. Sie sah Köster an. »Da wurde doch eine Frau von ein paar Jugendlichen gesteinigt.«
Gerd Köster nickte und fischte ein Blatt aus den Unterlagen. »Das war 2004. Sie hieß Ghofrane Haddaoui und stammte aus Tunesien. Wurde von drei jugendlichen Landsleuten zu Tode gesteinigt. Das Motiv war unklar, doch offenbar fühlte sich der Haupttäter von ihr zurückgewiesen. Also keine Steinigung auf Grundlage der Scharia. Eher eine besonders brutale Einzeltat. Ihr Tod gilt als die erste Steinigung in Europa und hat entsprechend Aufsehen erregt.«
»Und jetzt haben wir hier die zweite. Ausgerechnet in Düsseldorf. Na prima.« Meier ließ sich wieder auf seinen Stuhl fallen.
»Bitte spar dir deine zynischen Kommentare, Meier«, fuhr Lydia ihn an. »Die helfen uns nicht weiter. Wir haben einen Mord aufzuklären. Der Rest interessiert erst mal nicht.« Sie räusperte sich. »Wir halten die Details über die Todesart, so lange es geht, vor der Presse zurück. Ich möchte, dass wir ohne Druck von Seiten der Medien oder der Politik arbeiten können. Mord ist Mord, und ich will den Täter finden. Sein Motiv interessiert mich nur insoweit, wie es mich zu ihm führt. Punkt.« Sie sah Köster an. »Köster, du behältst das mit der Steinigung im Auge. Vielleicht findest du ja eine Verbindung zu der Schnitzerei in dem Baum. Einen islamischen Gesetzestext mit dem Kürzel RI1924. Was weiß ich. Hat jemand weitere Anmerkungen oder Ideen?«
»Ja, ich«, sagte Salomon. »Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, mit was wir es zu tun haben, falls es kein Ehrenmord war. Und, ehrlich gesagt, die Vorstellung gefällt mir nicht.«
»Die Vorstellung, dass es kein Ehrenmord gewesen sein könnte, gefällt dir nicht?«, fuhr Meier ihn an. »Was ist das denn für eine rassistische Scheiße?«
»Mensch Reinhold, komm runter«, sagte Schmiedel ärgerlich. »Lass den Mann doch erst mal ausreden! Mach zehn Liegestützen, und dann setz dich wieder zu uns.«
Meier hob die Hände. »Schon okay. Einwand zurückgezogen. Trotzdem kapier ich nicht, was du meinst, Chris.«
Salomon trommelte wieder mit dem Kuli auf den Tisch. »Ein Ehrenmord ist eine Einzeltat. Schrecklich und unentschuldbar, keine Frage. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, was in den Köpfen von solchen Typen vorgeht. Aber wenn das hier etwas anderes ist …« Er machte eine Pause, drehte den Kuli hin und her, während Meier unruhig zuckte. »Dann könnte es der Anfang von etwas viel Schlimmerem sein.« Er ließ die Worte sacken, bevor er noch eins draufsetzte. »Rituelle Steinigung. Sorgsam ausgesuchter Tatort. Geheimnisvolle Zeichen am Baum. Das riecht nach einem astreinen Serienkiller.«
Einen Moment lang sagte niemand etwas. Eine Thermoskanne, die die »Soko Pumps« zurückgelassen hatte, zischte ungehalten, unter dem Fenster ratterte die Straßenbahn vorbei.
»Eigentlich hätte ich so eine Horrorvision von unserem Bücherwurm erwartet«, sagte Meier schließlich und warf dabei einen Blick auf Schmiedel. »Der hat manchmal zu viel Phantasie. Aus deinem Mund, Chris, klingt sie verdammt real.«
Schmiedel knüllte ein Blatt zusammen und warf es nach Meier. »Ich Bücherwurm – du Analphabet«, grummelte er, doch sein Gesicht blieb ernst.
Lydia sah zu Sebastian Mörike hinüber, der mit einem Bleistift in seinem Notizblock herumkritzelte. »Du hast noch gar nichts gesagt, Mörike. Was meinst du zu alldem?«
Mörikes Kopf schoss hoch. Seine Jungenbäckchen färbten sich feuerrot. »Ich weiß nicht«, stotterte er. »Ich finde, es ist noch zu früh, um etwas sagen zu können.«
»Eine sehr kluge Ansicht«, antwortete Lydia, und Mörike wurde noch eine Spur roter. »Solange wir noch so wenig wissen, sollten wir uns mit Theorien zurückhalten. Lasst uns lieber Fakten sammeln. Schmiedel und Meier, ihr kümmert euch um mögliche Zeugen, organisiert die Befragung der Anwohner. Vielleicht gibt es ja weitere Jogger oder Hundebesitzer, die heute früh unterwegs waren und irgendetwas gesehen haben. Salomon, du sorgst bitte dafür, dass eine Beschreibung der unbekannten Toten an die Presse geht. Mit einem Foto können wir ja leider nicht dienen.« Sie seufzte. »Köster, du beschäftigst dich mit den Vermisstenmeldungen. Und ich fahre mit Mörike in die Rechtsmedizin.« Sie blickte auf ihre Uhr. »Halb eins. Um siebzehn Uhr treffen wir uns wieder hier. Hoffentlich wissen wir bis dahin mehr. Und jetzt an die Arbeit, Jungs.«
Die Männer erhoben sich und verließen nacheinander den Raum. Schmiedel und Meier wollten sich erst in der Kantine im Erdgeschoss stärken, bevor sie sich an die Befragung der Anwohner machten, eine mühsame und zeitraubende Laufarbeit, um die sich niemand riss. Köster trottete in sein Büro. Salomon blieb an der Tür stehen, Lydia spürte, dass er sie abschätzend ansah. Sie ahnte, was er dachte. Eigentlich hätte er als ihr Partner mit in die Rechtsmedizin fahren sollen. Sie hatte ihn mit einer Anfängerarbeit bedacht. Ein bisschen Internetrecherche und eine Personenbeschreibung für die Presse. Das hatte er in zwanzig Minuten erledigt. Es war eine Machtdemonstration, eine Kampfansage, und beide wussten es.
Sie reckte das Kinn vor und fixierte ihn. »Gibt es noch etwas, Salomon?«
Er schüttelte langsam den Kopf, während sein Blick zu dem Greenhorn wanderte. »Schon mal bei einer Obduktion dabei gewesen?«
Mörike zuckte mit den Schultern. »Noch nicht so richtig«, gab er zu. »Aber ich habe schon jede Menge Leichen gesehen.«
»Es ist was anderes, wenn sie vor deiner Nase aufgeschnippelt und zersägt werden.« Chris klopfte ihm auf die Schulter. »Also, halt die Ohren steif.«
Er marschierte aus dem Besprechungsraum, ohne Lydia noch einmal anzusehen, und sie starrte ihm wütend hinterher.
5