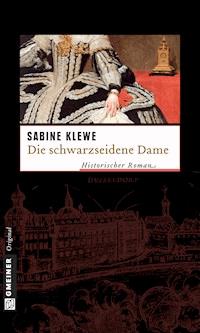Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fotografin Katrin Sandmann
- Sprache: Deutsch
Ein plötzlicher Wintereinbruch stürzt das Rheinland ins Chaos. Ausgerechnet an diesem Nachmittag gelingt Mario Brindi die Flucht aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Viersen-Süchteln. Er hat acht Frauen entführt und brutal gequält. Am gleichen Abend verschwindet die Fotografin Katrin Sandmann spurlos. Sie wurde zuletzt in einem Parkhaus in der Düsseldorfer Altstadt gesehen. Was ist geschehen? Hat Brindi sich bereits sein neuntes Opfer gesucht? Ist Katrin in seiner Gewalt? Die Polizei glaubt nicht an einen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen. Doch dann entdeckt ein Spaziergänger im Wald die grauenvoll zugerichtete Leiche einer jungen Frau …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Sabine Klewe
Wintermärchen
Der dritte Katrin-Sandmann-Krimi
Impressum
Alle Personen und Namen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig
und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2006
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von www.aboutpixel.de
Gesetzt aus der 9.6/14 Punkt GV Garamond
ISBN 13: 978-3-8392-3290-3
Bibliografische Information
der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Widmung
Für Bärbel
Zitat
»Auch das Zufälligste ist nur ein auf entfernterem Weg herangekommenes Notwendiges.«
Arthur Schopenhauer
Prolog
Die eisige Dezembernacht hatte die Stadt in ein silbrig weißes Laken gehüllt. Eine schimmernde Schicht Reif bedeckte den Gehweg, verzauberte die Dächer und das Geländer am Flussufer. Der Atem des Winters.
Gary Davids zog den Mantel enger um die Schultern und bog um die Ecke. Vor ihm lag der imposante historische Gebäudekomplex des Royal Naval College im fahlen Morgenlicht. Dahinter erstreckte sich die Themse, grau und träge. Die Straßen von London waren noch fast menschenleer. Er hörte ein paar vereinzelte Autos auf der Romney Road, und irgendwo in der Ferne ertönte die Sirene eines Polizeiwagens.
Gary wandte sich nach rechts und ging die Park Row entlang. Mit entschlossenen Schritten marschierte er Richtung Themse-Ufer. Wie jeden Morgen war sein Ziel der Fußgängertunnel, der hinüber zur Isle of Dogs führte, nach Millwall, dem ehemaligen Hafengelände, dort, wo in der Blütezeit des britischen Imperiums Segelschiffe aus aller Welt festgemacht hatten, um Rum, Zucker und Gewürze zu entladen. Dort war er aufgewachsen. Sein Vater hatte noch in den Docks gearbeitet. Das war lange her. Heute gab es in Millwall nur noch Arbeit für dynamische, junge Männer in Anzug und Krawatte. Schon lange legten hier keine Schiffe mehr an; stattdessen zierten Bürotürme und exklusive Eigentumswohnungen die ehemaligen Docklands.
Gary blieb vor dem Geländer stehen und starrte hinüber ans andere Ufer. Das Millwall, in dem er aufgewachsen war, existierte nur noch in seiner Erinnerung. Als Kind hatte er oft dort drüben gestanden, nach Greenwich hinüber gesehen und das Royal Naval College bestaunt, den Ort, an dem früher die britischen Seefahrer ausgebildet wurden. Er hatte davon geträumt zur See zu fahren, ein Held zu werden, so wie Lord Nelson. Aber in Greenwich wurden keine Helden mehr ausgebildet. Die Gebäude des Royal Naval College beherbergten heute eine Universität und eine Musikhochschule. Doch sie waren noch immer respekteinflößend und erinnerten mit stiller, an einigen Stellen ein wenig abblätternder Würde an Englands große Vergangenheit.
Gary schlug den kleinen Weg ein, der am Ufer entlang führte. Die Kälte schnitt ihm in die Haut, und sein Atem stand wie eine Eiswolke vor seinem Gesicht. Eine Möwe schrie. Das Meer war nicht weit. Man konnte sogar den Gezeitenwechsel am Stand der Themse erkennen. Es war Ebbe. Unterhalb des Uferweges befand sich ein schmaler Sandstreifen, ein winziger Strand, der immer nur in den Stunden existierte, in denen das Wasser niedrig stand.
Gary stellte resigniert fest, dass die Flut wieder einmal allerhand Müll angeschwemmt hatte. Ein paar Bierdosen, ein alter Lederstiefel und eine weiße Plastiktüte lagen auf dem glatten, reifüberzogenen Untergrund. Er betrachtete einen besonders dicken Haufen Dreck, der wie ein Bündel alter Kleider aussah, und schüttelte ärgerlich den Kopf. Dann blieb er plötzlich stehen. Ihm stockte der Atem. Er beugte sich über das Geländer und kniff die Augen zusammen, denn er hatte seine Brille nicht dabei.
Aus dem Gewirr aus Stoffen ragte etwas heraus, das aussah wie eine menschliche Hand.
1
»Du träumst ja mit offenen Augen!«
Katrin grinste ihre Freundin an, die mit selbstvergessenem Blick in das Schaufenster eines Reisebüros starrte, in dem mannshohe Fotos von schneeweißen Stränden, türkisgrünem Wasser und azurblauem Himmel verlockend der mitteleuropäischen Winterkälte trotzten.
Roberta seufzte. »Mir ist kalt«, fasste sie ihre Träumereien zusammen. Und fügte dann pragmatisch hinzu: »Gehen wir da rein und trinken ’ne heiße Schokolade?« Sie deutete auf ein Café, dessen kleine, weihnachtlich dekorierte Tischchen eine gemütliche Wärme ausstrahlten.
Katrin nickte. »Klingt unwiderstehlich. Meine Finger sind schon ganz steif gefroren. Wenn ich die Tüten noch weit schleppen muss, fallen sie wahrscheinlich einfach ab.«
Demonstrativ hielt sie die Einkaufstüten verschiedener Kaufhäuser und Geschäfte hoch. Katrin hatte den Nachmittag mit ihrer Freundin Roberta in der Stadt verbracht, um für deren drei Kinder Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Da Roberta für die ganze Verwandtschaft alles mitbesorgen musste – »Roberta, Liebes, kauf du das doch für die Kleinen, ich hol doch sowieso immer das Falsche« – war der Einkauf entsprechend umfangreich ausgefallen.
»Immerhin ist Geschenke kaufen ungefährlicher als Mörder jagen, und mehr als ein paar abgefrorene Finger riskiert man nicht«, konterte Roberta, »also beschwer dich nicht. Die Freizeitbeschäftigungen, in die du mich gelegentlich mit reinziehst, bergen definitiv ein größeres Risiko für Leib und Leben.«
Katrin Sandmann war Fotografin und schlug sich mit verschiedenen Aufträgen freiberuflich durch. Allerdings hatte sie in letzter Zeit ihre Leidenschaft fürs Detektivspielen entdeckt und bereits zwei Kriminalfälle auf eigene Faust gelöst, auch wenn ihr dabei weniger ihr kriminalistischer Spürsinn als vielmehr eine eigenwillige Kombination aus Intuition, sträflicher Waghalsigkeit und Anfängerglück bei der Aufklärung geholfen hatte. Die letzte Mordserie, in die sie verwickelt gewesen war, lag erst wenige Wochen zurück. Auch Roberta und ihr Mann Peter waren darin verstrickt gewesen.
Katrin war gerade im Begriff, mit der mit Tüten behängten rechten Hand die Glastür des Cafés aufzuziehen, als ihr jemand auf die Schulter klopfte.
Überrascht wandte sie sich um. Ein Mann stand vor ihr und lächelte. Er sah unverschämt gut aus, schlank, dunkelhaarig und mit leuchtenden, wasserblauen Augen. Er lächelte sie mit einer Mischung aus Charme und Frechheit an, der anzumerken war, dass er sich seiner Wirkung auf Frauen sehr wohl bewusst war.
Katrin runzelte verwirrt die Stirn, dann lächelte sie. »Kennen wir uns?«, fragte sie unsicher.
Das charmant-freche Grinsen wurde eine Spur breiter. »Bedauerlicherweise nicht.« Die Andeutung eines Zwinkerns. »Ich glaube, das hier gehört Ihnen.« Er schwenkte einen gestreiften Handschuh vor Katrins Gesicht.
»Oh.« Katrin setzte die Tüten auf dem Boden ab und griff mit unsicheren Fingern nach dem Handschuh. »Danke.«
»Keine Ursache.« Diesmal zwinkerte er ganz deutlich. »Und passen Sie demnächst besser auf. Sonst frieren Ihnen die zarten Finger ab.« Er nickte zum Abschied, warf einen kurzen, abschätzenden Blick auf Roberta, die die Begegnung sprachlos verfolgt hatte, wandte sich ab und verschwand in der Menge.
Zwei ältere Damen drängten sich in diesem Augenblick aus dem Café. Katrin und Roberta nutzten die Gelegenheit und schlüpften hinein. Sie fanden einen freien Tisch in der hintersten Ecke, drapierten ihre Tüten um sich herum und ließen sich nieder. Ein Kellner kam, und Roberta bestellte zweimal heiße Schokolade mit Sahne. Katrin starrte auf den Handschuh, den sie vor sich auf den Tisch gelegt hatte.
»Was war denn das?!«, wollte Roberta schließlich wissen. »Du hast geglotzt wie eine Vierzehnjährige, der irgend so ein Pseudo-Superstar begegnet. Es hätte nur noch gefehlt, dass du auf die Knie sinkst. Geht es dir gut?«
Katrin blickte sie verärgert an. »Quatsch. Ich war nur verwirrt. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass mir der Handschuh aus der Tasche gefallen war.«
»Offensichtlich nicht.«
»Du spinnst wohl.«
»Du hättest dich mal sehen sollen. Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Aschenputtel begegnet dem Märchenprinzen.«
»Hör auf jetzt!«, Katrin warf den Handschuh nach Roberta, aber er flog zu hoch und traf den Kellner, der gerade die Schokolade brachte.
»Nicht so stürmisch, junge Frau«, scherzte er, »oder soll das ein Fehdehandschuh sein?« Er schwenkte das Objekt der Auseinandersetzung grinsend hin und her.
Katrin murmelte eine Entschuldigung und starrte Roberta wütend an. »Daran bist du schuld. Warum musstest du mich auch so provozieren«, zischte sie empört. Allerdings konnte sie sich ein schwaches Grinsen nicht verkneifen.
»Sind wir etwas dünnhäutig heute?« Roberta zog die Augenbrauen hoch. Katrins ungewöhnliche Empfindlichkeit irritierte sie ein wenig. Normalerweise war ihre Freundin selbstbewusster und ließ sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Aber Roberta ahnte auch, was dahintersteckte. »Hat das etwa was mit dem Schmalspur-Casanova von eben zu tun oder vielleicht doch eher mit dieser Studienfreundin, die da jetzt seit zwei Wochen bei Manfred haust?«
Katrin zuckte die Schultern. »Die ist eigentlich ganz nett«, antwortete sie bedächtig. »Aber es geht mir auf die Nerven, wenn sie ständig auf ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit Manfred rumreitet. Sie scheint sich einen Sport daraus zu machen, immer wieder neue Gesprächsthemen zu finden, bei denen ich nicht mitreden kann. Erinnerst du dich noch an Professor Sowieso, der immer sein Kännchen Kamillentee mit in die Vorlesung brachte?«, Katrin sprach näselnd und schwenkte affektiert die Hände. »Und weißt du noch, die Fete bei Rudi, Mann, haben wir’s da wild getrieben, sind nicht am Ende sogar noch die Bullen aufgetaucht? Blabla – blöde Ziege.« Katrin schnaubte verächtlich.
Roberta lächelte. Manfred war Katrins Freund, ein Journalist, der für eine kleine lokale Tageszeitung arbeitete. Er war gelegentlich ein wenig rücksichtslos und unsensibel, vor allem, wenn es darum ging, an Informationen für eine gute Story zu gelangen. Aber Roberta wusste, wie viel Katrin ihm bedeutete, Studienfreundin hin oder her.
Gudrun war aus Berlin zu Besuch gekommen. Eigentlich hatte sie nur übers Wochenende bleiben wollen. Sie hatte einen Job bei einer Produktionsfirma, die Vorabendserien fürs Fernsehen drehte, und brauchte dringend einmal, wie sie es nannte, ein paar normale Menschen um sich. Aus dem Wochenende waren mittlerweile fast zwei Wochen geworden, und es war kein Ende abzusehen.
»Sollen wir uns morgen einen gemütlichen Frauennachmittag machen?«, schlug Roberta vor. »Ich schicke Peter mit den Kindern ins Kino, die wollten sowieso in Harry Potter gehen, und danach sollen sie noch irgendwo ’ne Pizza essen. Du kommst zu mir, und wir frischen unsere eigenen Erinnerungen an wilde Feten, coole Jungs und ähnlich schreckliche Dinge auf. Was meinst du?«
Katrin grinste jetzt. »Klingt nach ’ner verdammt guten Idee.«
***
Der Regen vereiste mehr und mehr. Wurde zu Schnee. Dagmar starrte durch die Scheibe und beobachtete, wie die Tropfen, die gegen das Glas schlugen, allmählich fester wurden, langsam Konsistenz bekamen. Erst entstanden winzige, matschige Klümpchen, dann bildete sich nach und nach eine Struktur heraus, ein Muster, Kristalle, feingliedrig, zart; mikroskopisch kleine Konstruktionen, keine wie die andere, jede für sich ein Kunstwerk der Natur.
»Verdammt, jetzt schneit es auch noch.« Rothmann stieß einen ärgerlichen Laut aus. »Und ich habe noch die Sommerreifen drauf. Außerdem bedeutet das bestimmt Verkehrschaos. Und heute ist Freitag. Na, wunderbar.«
Dagmar riss sich vom Anblick der Fensterscheibe los. Es hatte etwas Beruhigendes, zu sehen, wie gut durchdacht die Natur ans Werk ging. Es flößte ihr Vertrauen ein, Zuversicht. Irgendwie würde sich alles regeln. Aber Rothmann hatte sie mit seiner Bemerkung zurück in die Realität geholt. Die Nervosität war wieder da. Bilder blitzen vor ihren Augen auf, Staus, Unfälle, liegengebliebene Wagen. Das konnte sie jetzt gar nicht gebrauchen. Es durfte nichts schief gehen. Nicht heute. Sie spürte Rothmanns erwartungsvollen Blick. Hatte er ihr eine Frage gestellt? Sie riss sich zusammen und sah ihn an. »Wie bitte? Ich war gerade abgelenkt wegen des Wetters. Ich muss noch zurück nach Düsseldorf. Wenn es richtig zu schneien anfängt und es wird nicht sofort gestreut, dann sitze ich möglicherweise erst mal fest und kann nicht nach Hause.« Sie verzog das Gesicht.
»Ja, schöne Scheiße«, pflichtete Rothmann ihr bei. »Ich wollte wissen, wie das mit dem Artikel über die Schulschließung ist. Eigentlich wäre das was für die nächste Ausgabe. Aber dann müsste ich ihn spätestens Montag haben. Schaffen Sie das?«
Dagmar Ülzcin war freiberufliche Journalistin. Sie schrieb Artikel, Reportagen und gelegentlich auch Buchrezensionen für verschiedene Zeitschriften. Mit Winfried Rothmann, dem Herausgeber des Tempo Magazins, einer gesellschaftskritischen, wenn auch ein wenig oberflächlichen Zeitschrift, arbeitete sie seit über zehn Jahren zusammen. Trotzdem war ihre Beziehung zu dem etwas grobschlächtigen Verleger immer äußerst distanziert geblieben, rein geschäftlich. Sie mochte ihn nicht, verabscheute seinen Hang zu schlüpfrig-reißerischen Themen, aber sie war auf ihn angewiesen. Nicht alle Magazine hatten Interesse an ihren engagierten, etwas emotionalen Texten. Rothmann nahm fast alles, was sie schrieb, auch wenn sie es meistens noch ein wenig aufpeppen musste, damit es seinem und dem Geschmack seiner Leserschaft entsprach.
Dagmar seufzte. Mit dem Schulartikel hatte sie noch gar nicht richtig angefangen. Als sie davon gehört hatte, war sie Feuer und Flamme gewesen und hatte sich voller Begeisterung in die Arbeit gestürzt, Schüler, Eltern und Lehrer interviewt, Hintergründe recherchiert, und sie war sogar auf eine heiße Spur gestoßen. Es wurde gemunkelt, dass es bereits Pläne gab, die das Grundstück betrafen, auf dem die Schule stand. Ein Skandal. Aber dann war diese andere Sache dazwischengekommen, die so viel wichtiger schien.
»Ich weiß nicht, ob ich das schaffe«, begann Dagmar zögernd. »Ich bin da auf was gestoßen. Aber mir fehlen noch ein paar Fakten.«
»Ganz wie Sie meinen«, antwortete Rothmann. »Allerdings weiß ich nicht, ob es danach noch was wird. Für die Februarausgabe steht nämlich ein Artikel an, der sich mit ’ner ähnlichen Sache beschäftigt. Das wird mir zu viel Schule für eine Ausgabe.« Er stand auf, ein Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet war. »Dann sehen Sie mal zu, dass sie noch vor dem großen Schnee nach Hause kommen.« Er reichte ihr die Hand.
Dagmar hastete aus Rothmanns Büro. Sie hätte sich wirklich um die Schulsache kümmern sollen. Den Artikel konnte sie vergessen. Es war Freitagabend. Keine Chance mehr, vor Montag an irgendwelche Informationen zu kommen. Zu blöd. Sie hätte das Honorar wirklich brauchen können. Gerade jetzt.
Sie zog die Glastür des Bürogebäudes in der Kölner Innenstadt auf, in dem sich die Redaktion des Tempo Magazins befand, und trat hinaus. Der Himmel war dunkel, und die Schneeflocken tanzten im Schein der tausend Großstadtlichter einen winterlichen Tanz. Eigentlich mochte Dagmar den Schnee. Er erinnerte sie an ihre Kindheit, an Weihnachten zu Hause, mit selbstgebackenen Plätzchen, einer knusprigen Gans im Backofen und einem riesigen Tannenbaum mit echten Kerzen, der nach Wald duftete und nach Bienenwachs. Schnee bedeutete Geborgenheit und Wärme.
Einen Augenblick lang gab sie sich dem Gefühl hin, legte den Kopf in den Nacken, spürte die weichen Flocken auf ihrem Gesicht landen und ließ sich fallen.
Dann kam die Nervosität zurück, schnell, zu schnell, kroch sie in ihren Magen, in ihre Fingerspitzen. Sie ging zu ihrem Wagen, kramte den Schlüssel aus ihrer Handtasche, schloss auf und schlüpfte hinein. Drinnen machte sie kurz das Licht an und warf einen Blick auf die Armbanduhr. Bisher hatte sie es sich verkniffen, aber jetzt musste es einfach sein. Halb acht. Ob alles glatt gelaufen war?
***
Der Anruf aus der Klinik war um 17.13 Uhr bei der Polizei eingegangen, noch bevor das Schneechaos einsetzte. Es wurde sofort eine interne Fahndung ausgelöst. Beamte des zuständigen Kommissariats fuhren nach Süchteln und machten sich vor Ort ein Bild von der Lage. Das Gelände selbst und die nähere Umgebung wurden gründlich durchsucht, zunächst ohne Erfolg. Es war bereits stockdunkel.
Um 17.48 Uhr informierte man per Fax das LKA und die Staatsanwaltschaft. Dann wurden weitere Schritte eingeleitet. Nachdem die Suche im näheren Umfeld der Klinik in Viersen-Süchteln erfolglos verlaufen war, bat man die Fahnder in Düsseldorf um Amtshilfe. Der Mann war nämlich vor zwei Monaten bereits einmal entwichen. Damals hatte man ihn schon nach wenigen Stunden wieder aufgegriffen. Er war dorthin geflohen, wo er sich auskannte, wo er aufgewachsen war. In den Düsseldorfer Stadtteil Unterrath.
2
»Also dann, bis morgen. Ich ruf dich an.« Katrin umarmte ihre Freundin. Sie hatte ihr noch geholfen, alle Tüten im Auto zu verstauen.
»Und, danke noch mal.« Roberta schlug die Kofferraumklappe zu. »Du bist eine unschlagbare Einkaufsassistentin. Ohne dich hätte ich dreimal so lange gebraucht.«
»Du darfst dich morgen mit Glühwein revanchieren. Und mit Plätzchen. Zimtsterne mag ich besonders gern.«
Katrin grinste, dann wandte sie sich ab, um zu ihrem eigenen Auto zu gehen, das sie ein Parkdeck höher abgestellt hatte. Sie war gerade dabei, den Wagenschlüssel aus ihrer Handtasche zu kramen, als sie Schritte hörte.
»Entschuldigen Sie bitte.«
Sie fuhr erschrocken herum. Dann blinzelte sie verwundert. Da stand er wieder, der Mann, der ihr den Handschuh gereicht hatte. Bei der dämmrigen Parkhausbeleuchtung war sein Gesicht nicht genau zu erkennen, aber sie war sich ganz sicher, dass er es war. Was für ein merkwürdiger Zufall. Auch er schien überrascht zu sein.
»Sie?«
Katrin lächelte. »Habe ich etwa schon wieder was verloren? Den anderen Handschuh vielleicht?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, diesmal brauche ich Ihre Hilfe. Mein Wagen springt nicht an, und ich habe gleich eine sehr wichtige Verabredung. Haben Sie vielleicht ein Handy dabei? Dürfte ich es eventuell benutzen? Es ist wirklich wichtig.«
Katrin holte ihr Mobiltelefon aus der Handtasche und reichte es ihm. »Natürlich. Gern.«
Während der Mann eine Nummer wählte und dann in verhaltenem Tonfall in das Telefon sprach, schloss Katrin die Fahrertür ihres Cabriolets auf und warf die Handtasche auf den Beifahrersitz. Dann stieg sie ein.
Der Mann beendete das Gespräch, näherte sich der Tür, beugte sich in den Wagen und gab ihr das Handy zurück.
»Ich danke Ihnen vielmals. Jetzt sind wir quitt. Handschuh gegen Telefongespräch.«
Er zwinkerte, so wie er es bereits bei ihrer ersten Begegnung vor dem Café getan hatte. Katrin zögerte. Dann fragte sie: »Kann ich vielleicht noch irgendwas für Sie tun?«
Der Mann beugte sich noch ein Stück weiter vor und sah sie eindringlich an. »Es gäbe da etwas«, begann er zögernd, »aber nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
***
»Kommt Katrin noch nach?« Gudrun öffnete das Päckchen Tabak, das vor ihr auf dem Tisch lag, und drehte sich mit geübten Handgriffen eine Zigarette.
»Weiß nicht«, antwortete Manfred achselzuckend. »Vielleicht ist sie mit Roberta noch was essen gegangen. Ich habe ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie weiß auf jeden Fall, wo wir sind.«
»Vielleicht nicht ganz ihre Kragenweite hier«, meinte Gudrun, und ließ zweifelnd ihren Blick durch den Schankraum wandern. Manfred und Gudrun saßen in der Blende, einer Kneipe in Bilk. Die Einrichtung hatte schon bessere Tage gesehen und die Musik dröhnte so laut aus den Boxen, dass man sich fast anschreien musste. Gudrun steckte sich die Zigarette in den Mund, zündete sie an und zog daran, dann fuhr sie sich mit der freien Hand über die kurzrasierten, pechschwarz gefärbten Haare.
»Quatsch«, gab Manfred zurück, »wir sind öfter hier. Warum auch nicht?«
Gudrun zuckte die Achseln. »Ich dachte nur.«
Einen Augenblick lang schwiegen beide. Fred Durst sang mit heiserer Stimme und eine junge Kellnerin in Jeans und hautengem, ärmellosem Top kam an den Tisch und griff nach den zwei leeren Gläsern. »Wollt ihr noch zwei?«
Manfred nickte. »Klar.«
Gudrun streifte die Asche von der Zigarette, indem sie sie langsam auf dem Rand des Aschenbechers hin und her drehte. »Sie mag mich nicht.«
Manfred blickte sie überrascht an. »Wer?«
»Mensch, Katrin. Tu nicht so blöd.«
»Sei nicht albern. Das ist doch Quatsch.«
»Ich bin nicht albern. Aber ich bin auch nicht blind. Ich schätze mal, sie ist eifersüchtig. Ist doch eigentlich ein nettes Kompliment an dich, oder?«
Die Kellnerin brachte die beiden Alt, und Manfred hielt ihr seinen Deckel hin. Sie zog einen Bleistift hervor, den sie unter das Lederarmband an ihrem linken Handgelenk geklemmt hatte, und malte zwei weitere Striche darauf. Es waren jetzt insgesamt zwölf. Es reichte langsam. Manfred warf einen Blick auf die Uhr. Zwanzig vor zehn. Gudrun hatte recht. Katrin würde wohl nicht mehr kommen. Vermutlich war sie noch mit zu Roberta gefahren, oder sie war, müde vom stundenlangen Laufen durch die Stadt, zu Hause auf dem Sofa eingeschlafen, ihren Kater Rupert als Wärmkissen auf dem Bauch, ein halb leergetrunkenes Glas Rotwein auf dem kleinen Tischchen daneben – auf dem wackeligen, dreibeinigen Holztisch, den sie mit ihm gemeinsam auf dem Trödelmarkt am Aachener Platz ausgesucht hatte.
»Na, was für süßen Gedanken hängst du denn gerade nach?« Gudrun grinste ihn an.
»Ich? Wieso?«
»Du hast gelächelt wie ein verliebter Teenager.«
»Ha, ha.« Manfred verzog das Gesicht und nahm einen tiefen Schluck aus dem Bierglas. Er überlegte, ob er noch mal versuchen sollte, Katrin anzurufen, entschied sich dann aber dagegen. Wenn sie wirklich schon schlief, würde er sie nur stören.
***
Peter Wickert starrte konzentriert in die Dunkelheit. Die Scheibenwischer gaben ein knurrendes Geräusch von sich, während sie die weißen Flocken aus seinem Sichtfeld fegten. Das Schneetreiben war stärker geworden, und mittlerweile bedeckte eine schmutzigweiße Decke die Autobahn, ein matschiger Brei, der zu einer spiegelglatten Fläche zu gefrieren drohte, falls die Temperaturen weiter sanken.
Peter war froh, dass sein Auto Allradantrieb hatte. Sollte seine Frau Roberta ruhig über seinen exotischen Japaner lästern. Er würde auf jeden Fall heute sicher zu Hause ankommen. Er warf einen kurzen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Schon nach zehn. Aber immerhin hatte er seine Arbeit beendet, der Auftrag war abgeschlossen, und er würde das Wochenende in Ruhe genießen können.
Peter zuckte zusammen, als ein Wagen hinter ihm wie aus dem Nichts auftauchte, die Scheinwerfer hell aufgeblendet, und mit viel zu hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeischoss. Es war ein grauer Opel Omega, der ein wenig seitwärts schlitterte, als er sich vor Peters Subaru auf der rechten Spur einordnete.
»Idiot«, schimpfte Peter. »Du wirst schon sehen, was du davon hast. Gleich sehe ich dich vermutlich irgendwo im Straßengraben liegen.« Er schaltete das Radio ein, in der Hoffnung, die Verkehrsdurchsagen noch zu erwischen, aber es lief bereits Musik, irgendein alter Schlager, dessen Melodie er mitsummen konnte, ohne dass er den Titel oder die Band hätte nennen können. Zehn Minuten lang fuhr er weiter durch die winterliche Nacht. Gelegentlich überholte er einen Wagen, der ihm zu langsam durch den Schnee kroch, ansonsten war alles ruhig.
Plötzlich stieg er in die Bremsen. Vor ihm waren unvermittelt rote Rückleuchten aufgetaucht. Erst glaubte er, jemand kröche im Schneckentempo über die Autobahn, doch dann wurde ihm klar, dass ihm nicht ein einziges Auto, sondern eine ganze Schlange den Weg versperrte.
Er seufzte. Ein Stau. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Vielleicht war weiter vorn ein Wagen liegen geblieben, oder es hatte einen Auffahrunfall gegeben. Peter nahm sein Handy vom Beifahrersitz und wählte eine Nummer.
»Hier Familie Wickert. Johanna Wickert am Apparat.«
Peter lächelte. Seine Tochter meldete sich perfekt wie die Chefsekretärin eines großen Unternehmens. »Hier ist Papa, Hanna. Du bist noch wach?«
»Ich musste noch mal aufs Klo. Außerdem ist doch Wochenende. Wo bleibst du denn, Papa?«
»Ich stecke im Stau fest. Wahrscheinlich ein Unfall.«
»Ein Unfall?«, wiederholte Johanna laut. Dann meldete sich plötzlich eine andere Stimme am Telefon. »Peter? Du hattest einen Unfall?« Es war Roberta.
»Nein, nein«, antwortete er und musste lächeln. »Mir geht es gut. Ich stecke nur im Stau fest.«
Roberta seufzte erleichtert auf. »Na, das war ja zu erwarten bei dem Schneechaos. Alle wissen, dass Winter ist, aber keiner rechnet mit Schnee. Es ist jedes Jahr das gleiche. Wo steckst du denn?«
»A 46. Kurz hinter dem Kreuz Hilden. Ich habe gerade die Autobahn gewechselt.«
»Du Ärmster.«
»Ich werd’s überleben. Wie war’s in der Stadt?«
Roberta stöhnte. »Anstrengend. Aber dafür habe ich auch fast alles gekriegt, was ich besorgen wollte. Katrin war echt hartnäckig. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe: »Komm, lass, das erledige ich dann eben nächste Woche«, hat sie darauf bestanden, noch in den nächsten Laden zu ziehen. Sie war eine echte Hilfe.«
Peter konnte sich lebhaft vorstellen, wie Katrin Roberta von Geschäft zu Geschäft gelotst hatte, bis alle Besorgungen erledigt waren. Das passte zu Katrin. In mancher Hinsicht konnte sie sehr vernünftig und pragmatisch sein. In anderer allerdings wiederum überhaupt nicht. Er mochte die Freundin seiner Frau, ihre unkomplizierte, herzliche Art, und die Unmittelbarkeit, mit der sie sagte, was sie meinte, auch wenn sie damit gelegentlich ein wenig zu weit ging.
»Freut mich, dass eure Einkaufstour ein Erfolg war.« Peter sah, wie sich weiter vor ihm die Schlange ein Stück in Bewegung setzte. »Ich muss Schluss machen. Ich glaube, es geht weiter.«
»Na, dann viel Spaß noch«, scherzte Roberta, »wenn du nach Hause kommst, warten ein Glas Wein und ein Stück Pizza auf dich, wenn du magst.«
»Klingt sehr verführerisch. Bis gleich dann.«
»Bis gleich.«
Peter legte das Handy wieder auf den Beifahrersitz. Langsam gab er Gas. Es ging stockend weiter. Nach einer Weile sah er in der Ferne blaue und gelbe Blinklichter, die in den schwarzen Nachhimmel strahlten wie eine gigantische Weihnachtsbeleuchtung. Ein Unfall also.
Es dauerte noch einmal eine geraume Zeit, bis er schließlich die Unfallstelle erreicht hatte. Ein Lastwagen hing schräg im Straßengraben. Zwei Kleinwagen parkten stark verbeult auf dem Seitenstreifen. Ein dritter PKW stand immer noch quer auf der rechten Fahrbahn. Er war eingedrückt wie eine achtlos weggeworfene Zigarettenschachtel. Peter konnte nicht viel erkennen, ein Polizist winkte ihn durch, er musste zügig weiterfahren. Aber dennoch war er sich ziemlich sicher, dass es der graue Opel war, der ihn vorhin so rasant überholt hatte. Peter spürte einen Stich. Hatte er dem Fahrer nicht gewünscht, er möge im Straßengraben enden? Nein, so hatte er das nicht gemeint. Er versuchte den Gedanken abzuschütteln.
Aber so leicht wurde er ihn dennoch nicht los. Als er eine halbe Stunde später endlich im Wohnzimmer auf der Couch saß, ein Glas Wein in der Hand, und Roberta ihm Stück für Stück präsentierte, was sie in der Stadt alles ergattert hatte, tauchte vor seinen Augen immer wieder der Anblick des völlig zerstörten Wagens auf, und er fragte sich, was wohl aus dem Fahrer geworden war.
3
Manfred erwachte von dem Pochen in seinem Schädel. Er blinzelte. Es war grauenhaft hell draußen – und das am siebzehnten Dezember. Es war bestimmt schon mindestens zehn Uhr. Er drehte sich auf die andere Seite, damit ihn das Tageslicht nicht blendete. Vorsichtig öffnete er ein Auge und schielte in Richtung Uhr. Die digitale Anzeige strahlte in leuchtendem Rot. 10:23 Uhr. Er stöhnte und grub sein Gesicht ins Kissen. Dann fiel ihm der gestrige Abend wieder ein. Die Kneipe. Katrin war nicht mehr nachgekommen. Dafür hatte er auf dem Heimweg auf seinem Handy eine Nachricht entdeckt, die sie ihm bereits gegen neun Uhr geschickt hatte: »Bin übers Wochenende verreist. Brauche ein bisschen Abstand. Bitte ruf nicht an. Katrin.«
Er hatte die Nachricht wieder und wieder gelesen, aber er konnte sich einfach keinen Reim darauf machen. Erst war er verwirrt gewesen, dann besorgt, und schließlich nur noch wütend. Ihm so etwas auf diesem Weg mitzuteilen! Und was sollte das Ganze überhaupt? Womöglich hatte Gudrun doch recht, und Katrin war eifersüchtig. Aber war das die richtige Art, damit umzugehen? Das war doch total kindisch. Er hatte sich furchtbar aufgeregt, und Gudrun hatte ihn beruhigt und überredet, vom Büdchen noch ein paar Flaschen Alt mitzunehmen. Die hatten sie dann auf der Wohnzimmercouch geleert. Sie hatten schweigend dagesessen, aus den Boxen dröhnte Musik, und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Bis alle Flaschen leer waren. Irgendwann gegen zwei. Was für ein Abend!
Manfred öffnete die Augen erneut und bewegte vorsichtig den Kopf. Ein höllischer Schmerz fuhr ihm durch die Schläfen und donnerte gegen seine Schädeldecke. Er biss die Zähne zusammen und kroch aus dem Bett. Auf dem Weg ins Bad kam er an der Wohnzimmercouch vorbei, auf der Gudrun lag und laut schnarchte. Er grinste und marschierte tapfer weiter.
Er fand die Aspirintabletten nicht sofort. Er hatte lange keine mehr gebraucht. Ein kurzer Blick auf die Packung verriet ihm, dass sie zwei Monate zuvor abgelaufen waren. Er zuckte die Achseln, drückte zwei Tabletten aus dem Päckchen auf seine Handfläche, warf sie in den Mund und schluckte. Dann hängte er sich unter den Wasserhahn und trank eine volle Minute lang ohne abzusetzen.
Erst jetzt wagte er einen Blick in den Spiegel. Er streckte dem zerknautschten Gesicht die Zunge heraus und wandte sich ab.
Manfred brauchte einen Moment, bis er sich erinnerte, dass er das Handy am Abend zuvor in den Kühlschrank gepfeffert hatte. Das Bücken jagte ihm ein höllisches Stechen durch die Schläfen und er fluchte leise. Zuerst entdeckte er nichts, und er dachte schon, dass seine Erinnerung ihn trog, aber dann fand er das Telefon im Gemüsefach. Es war eiskalt.
Hoffentlich funktionierte es noch! Er setzte sich an den Küchentisch. Brotkrümel und eingetrocknete braune Kaffeekränze bildeten ein schmuddeliges Muster und erinnerten ihn daran, dass er seit Längerem nicht mehr darübergewischt hatte. Er schüttelte sich. Er war nicht besonders ordentlich, aber er war sauber. So sah sein Tisch normalerweise nicht aus. Es war verrückt. Jedes Mal, wenn Gudrun ihn besuchte, verfiel er zurück in die Gewohnheiten seines Studentenlebens. Er machte die Nächte durch, trank zuviel, und seine Wohnung sah schon nach wenigen Tagen dem winzigen, vergammelten Zimmer zum Verwechseln ähnlich, das er während seines Studiums bewohnt hatte. Damals hatte es ihn überhaupt nicht interessiert, wie er wohnte. Ordnung erinnerte ihn viel zu sehr an seine Kindheit. Er war in einem kleinen Städtchen in der Nordeifel
aufgewachsen, in dem es weder ein Kino noch eine Disco gab und wo man sich für ein wenig Abwechslung aufs Mofa setzen und in die nächste Stadt fahren musste. Jeden Samstagvormittag hatte er sein Zimmer gründlich aufräumen müssen. Sein Vater war dann vor dem Mittagessen hereingekommen und hatte alles genau inspiziert. Wenn er zufrieden war, gab es das Taschengeld für die kommende Woche und die Erlaubnis, abends auszugehen. Aber nur dann.
Manfred tippte auf dem Handy herum, aber er fand die Nachricht nicht mehr. Verdammt! Er erinnerte sich doch ganz genau. Er konnte sie auswendig. »Brauche ein bisschen Abstand.« Abstand! Abstand wovon? Von ihm? Und was bitte ist ein ›bisschen Abstand‹?!
Er spürte, wie die Wut wieder in ihm hoch kochte, und stand abrupt vom Tisch auf. Am besten, er würde erst einmal einen starken Kaffee kochen. Als er die Kaffeemaschine einschaltete, fiel es ihm wieder ein. Er hatte die Nachricht gelöscht. Nachdem er sie fassungslos wieder und wieder gelesen hatte, hatte er sie gelöscht, und das Handy wutentbrannt ins Gemüsefach verfrachtet.
Mit der dampfenden Tasse in der Hand setzte er sich wieder an den Tisch. Probleme waren dazu da, dass man sie löste, und genau das würde er jetzt tun. Er wählte Katrins Nummer. Sollte sie doch sauer sein, weil er sie anrief, obwohl sie ihn gebeten hatte es nicht zu tun. Er musste wissen, was das alles sollte. Außerdem konnte er immer noch den Ahnungslosen spielen. Er hatte diese blöde SMS nie gekriegt. Punkt.
»Der gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.«