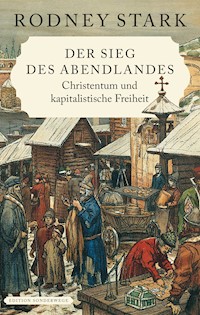
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Manuscriptum
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Mittelalter, die menschheitsgeschichtlich gigantische Epoche zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert, soll also "finster" und "dumpf" gewesen sein? Eine Karenzzeit der geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Stagnation, die erst durch Reformation und Aufklärung beendet werden konnte? Alles Unfug! Das abwertende Mittelalter-Klischee, das wir alle seit Schultagen mehr oder weniger verinnerlicht haben, ist für den "Gegenaufklärer" Rodney Stark eine bloße Auswirkung anti-katholischer Propaganda des 18. Jahrhunderts und geht vollkommen fehl. Das europäische Mittelalter, weist Stark mit vitaler Entschiedenheit nach, war vielmehr eine Epoche größter erfinderischer und wirtschaftlicher Blüte. Und das aus einem Grund: weil es das Christentum gab, dessen Theologie sich (etwa bei der Bibelauslegung) als ausgesprochen anpassungsfähig an stets sich verändernde Lebensumstände erwiesen hat. Diese der zukunftsorientierte Theologie brachte ein Element immanenter Vernunft und Logik in die mittelalterliche Welt, was konsequent das rationale Wirtschaften und den kapitalistischen Fortschritt nach sich zog. Auf diese Weise, so Stark, konnte das Abendland in puncto ökonomischer Freiheit und Wohlstandsgewinnung alle anderen Zivilisationen auf die Plätze verweisen – mit Recht, auch wenn das heutige Europa, moralische Selbstzersetzung betreibend, das nicht wahrhaben will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rodney Stark
DER SIEG DESABENDLANDES
Christentum und kapitalistische Freiheit
Aus dem Englischen von Stefan Flach
INHALT
EINFÜHRUNG: VERNUNFT UND FORTSCHRITT
TEIL I: FUNDAMENTE
Kapitel 1: Die Segnungen der rationalen Theologie
Kapitel 2: Fortschritt im Mittelalter – technisch, kulturell und religiös
Kapitel 3: Die Tyrannei und die »Wiedergeburt« der Freiheit
TEIL II: ERFÜLLUNG
Kapitel 4: Die Perfektionierung des italienischen Kapitalismus
Kapitel 5: Der Kapitalismus zieht nordwärts
Kapitel 6: »Katholischer« Antikapitalismus: spanischer und französischer Despotismus
Kapitel 7: Feudalismus und Kapitalismus in der Neuen Welt
FAZIT: GLOBALISIERUNG UND MODERNE
Danksagungen
Anmerkungen
Verwendete Literatur
EINFÜHRUNG:VERNUNFT UND FORTSCHRITT
Als die Europäer den Erdball zu erkunden begannen, überraschte sie weniger die Existenz der westlichen Hemisphäre, als vielmehr das Ausmaß ihrer eigenen technologischen Überlegenheit über den Rest der Welt. Nicht nur die stolzen Völker der Maya, Azteken und Inka waren den europäischen Invasoren gegenüber vollkommen hilflos, sondern ebenso die legendären Zivilisationen des Ostens: China, Indien und sogar die islamische Welt waren unterentwickelt gegenüber dem Europa des 17. Jahrhunderts. Wie war das möglich? Wie kam es, dass zwar viele Völker die Alchemie betrieben, sie aber nur in Europa die Chemie zur Folge hatte? Warum besaßen über Jahrhunderte nur die Europäer solche Dinge wie Brillen, Kamine, präzise Uhrwerke, schwere Kavallerien oder ein System der musikalischen Notation? Wie konnten Völker, die aus der Barbarei und dem Schutt des untergegangenen römischen Reiches erwachsen waren, den Rest der Welt derart überflügeln?
Verschiedene Autoren haben den westlichen Erfolg in jüngster Zeit an örtlichen Gegebenheiten festgemacht. Doch hatte der gleiche Kontinent schon lange Zeit europäische Kulturen beherbergt, die wiederum den asiatischen weit unterlegen waren. Andere Autoren verbinden den Aufstieg des Westens mit Stahl, Waffen oder Segelschiffen; noch andere führen ihn auf einen besonders ertragreichen Ackerbau zurück. Doch ist das Problem dabei, dass all diese Begründungen auf etwas aufbauen, was zuvor einmal geklärt werden müsste: Warum waren und sind die Europäer solche Meister der Metallurgie, des Schiffbaus oder der Landwirtschaft? Um hierauf die richtige Antwort zu finden, muss die Dominanz des Westens zusammen mit dem Aufstieg des Kapitalismus gesehen werden, schon weil letzterer ausschließlich in Europa entstand. Selbst die ärgsten Feinde des Kapitalismus gestehen ihm eine vormals ungeahnte Produktivität und eine nie gekannte Fortschrittsfähigkeit zu. In ihrem »Kommunistischen Manifest« schreiben Karl Marx und Friedrich Engels, dass die Menschen vor dem Kapitalismus »in der trägsten Bärenhäuterei« verharrten und dass das kapitalistische System »massenhaftere und kolossalere Produktivkräfte geschaffen hat, als alle vergangenen Generationen zusammen«. Der Kapitalismus macht dieses »Wunder« möglich, indem er erzielte Erträge immer wieder neu investiert, um damit die Produktivität zu erhöhen – sei es durch größere Leistung oder verbesserte Technologie – und gleichermaßen Führungs- wie Arbeitskräfte mittels steigender Löhne anzuspornen.
Doch auch wenn man annimmt, dass der Kapitalismus für Europa den einen großen Schritt nach vorn bedeutete, bleibt immer noch zu klären, warum er gerade dort gemacht wurde. Manche erkennen die Wurzeln des Kapitalismus in der Reformation, andere in diversen politischen Umständen. Gräbt man jedoch etwas tiefer, wird deutlich, dass das eigentliche Fundament des Kapitalismus sowie des westlichen Erfolges überhaupt in einem besonders starken Glauben an die Vernunft bestand.
Dieses Buch erkundet eine Reihe von Entwicklungen, in denen die Vernunft jeweils den Sieg davontrug und der abendländischen Kultur ihr spezifisches Gepräge gab. Der wichtigste dieser Siege fand innerhalb des Christentums statt. Während die anderen Weltreligionen besonderen Wert auf das Mysterium und die Intuition legten, machte allein das Christentum die Logik und Vernunft zu Orientierungshilfen für seine religiöse Wahrheit. Das christliche Vertrauen in die Vernunft war zwar von der griechischen Philosophie beeinflusst. Wichtiger jedoch ist, dass diese Philosophie sich nicht auch auf die griechischen Religionen auswirkte. Diese verharrten in der altbekannten Sphäre des Mysterien-Kults, in der man sich mit Doppeldeutigkeiten und logischen Widersprüchen zufriedengab, da man in ihnen Grundbausteine der heiligen Ursprünge erkannte. Ähnliche Annahmen, die die grundsätzliche Unerklärlichkeit der Götter betrafen, ebenso die intellektuelle Überlegenheit der Introspektion, dominierten auch alle anderen Weltreligionen. Demgegenüber lehrten die Kirchenväter von Anfang an, dass das größte Geschenk Gottes die Vernunft ist, welche es gerade ermöglicht, das Verständnis der Bibel und der Offenbarungen progressiv zu vergrößern. Folglich war das Christentum immer auch der Zukunft zugewandt, wohingegen die anderen Religionen der Vergangenheit den Vorzug gaben. Im Grundsatz, wenn auch nicht immer in der Praxis, konnte die christliche Glaubenslehre stets im Namen des Fortschritts, so er nur vernünftig erschien, modifiziert werden. Ermutigt durch die Scholastiker und verkörpert durch die großen, von der Kirche gegründeten Universitäten, durchdrang der Glaube an die Kräfte der Vernunft die gesamte westliche Kultur und befeuerte die Wissenschaft wie die Entwicklung der Demokratie in Theorie und Praxis. Der Aufstieg des Kapitalismus war nicht zuletzt ein Sieg jener durch die Kirche inspirierten Vernunft. Denn in seiner Essenz ist der Kapitalismus nichts anderes als eine systematische und fortwährende Anwendung der Vernunft auf dem Gebiet des Handels – etwas, das zunächst in den großen Klöstern betrieben wurde.
Im vergangenen Jahrhundert haben westliche Intellektuelle häufig den europäischen Kolonialismus auf seine christlichen Ursprünge zurückgeführt. Dagegen sahen sie nur sehr ungern ein, dass das Christentum in keiner Weise (es sei denn durch Intoleranz) den westlichen Dominanz-Ansprüchen zugearbeitet hat. Stattdessen wird behauptet, der Erfolg des Westens habe sich erst dann wirklich eingestellt, als er die religiösen Fortschritts-Schranken hinter sich ließ, besonders solche, die die Wissenschaft behinderten. Das ist jedoch Unsinn. Der Erfolg des Westens einschließlich des Emporkommens der Wissenschaft hatte zur Gänze eine religiöse Grundlage; ebenso waren die Menschen, die ihn herbeiführten, fromme Christen. Leider sehen selbst solche Historiker, die dem Christentum eine formende Kraft im westlichen Fortschritt zugestehen, günstige Faktoren allein auf Seiten der protestantischen Reformation, wobei selbst diese bloß religiöser Natur gewesen sein sollen. Es klingt dann so, als wären die vorangegangenen fünfzehnhundert Jahre der Christenheit entweder unwichtig oder gar schädlich gewesen. Akademischer Anti-Katholizismus dieser Prägung war verantwortlich für das berühmteste Buch, das je über den Kapitalismus geschrieben wurde.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlichte der Soziologe Max Weber eine Studie1, die schon bald große Wirkung haben sollte: Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus.1 Darin vertritt er die Ansicht, dass der Kapitalismus deshalb seinen Ursprung in Europa hatte, weil von allen Weltreligionen allein der Protestantismus den Menschen eine moralische Vision darbot, in der sie einerseits ihren materiellen Konsum beschränkten und andererseits entschieden Glück und Reichtum suchten. Vor der Reformation, so Weber, sei die Konsumbeschränkung notwendig mit Askese und folglich mit einer Verurteilung des Handels einhergegangen. Im Umkehrschluss habe man das Streben nach Reichtum stets mit verschwenderischem, liederlichem Konsum gleichgesetzt. Weder das eine noch das andere Muster hätte sich mit dem Kapitalismus vertragen. Laut Weber wurden diese althergebrachten Verknüpfungen erst durch die protestantische Ethik über den Haufen geworfen, indem diese nämlich eine ganze Kultur sparsamer Unternehmer hervorbrachte, die es zufrieden waren, ihre Profite systematisch zu reinvestieren, um so noch größere Gewinne zu erzielen. Und genau darin liege der Schlüssel zum Kapitalismus und zum Aufstieg des Abendlandes.
Es mag an der Eleganz dieser These gelegen haben, dass sie im großen Stil übernommen wurde, selbst wenn sie offensichtlich falsch ist. Noch heute wird der Protestantischen Ethik unter Soziologen2 ein fast heiliger Status zuerkannt, auch wenn Wirtschaftshistoriker Webers erstaunlich schlecht dokumentiertes3 Werk schon seinerzeit auf der unbestreitbaren Grundlage abqualifizierten, dass der europäische Aufstieg des Kapitalismus bereits Jahrhunderte vor der Reformation stattgefunden hatte. Hugh Trevor-Roper sagt es so: »Die Vorstellung, dass der großangelegte Kapitalismus vor der Reformation ideologisch unmöglich gewesen sei, wird schon dadurch ausgehebelt, dass es ihn ja gegeben hat.«4 Nur eine Dekade nach Webers Buch trug der berühmte Henri Pirenne5 eine Vielzahl von Literaturnachweisen zusammen, die allesamt »den Umstand belegen, dass das gesamte Grundinventar des Kapitalismus – Alleinunternehmertum, Kreditvorschüsse, kommerzieller Profit, Spekulationen usw. – bereits vom 12. Jahrhundert an in den Stadtrepubliken Italiens, Venedig, Genua oder Florenz, zu finden war«. Eine Generation später beklagte der ebenfalls vielgefeierte Fernand Braudel, dass »zwar alle Historiker dieser dürftigen Theorie (der protestantischen Ethik) entgegengetreten sind, es aber keiner geschafft hat, sie ein für allemal zu widerlegen. Und das obwohl sie eindeutig falsch ist. Die Länder des Nordens übernahmen einfach eine Position, die zuvor lange und wirkungsvoll von den alten kapitalistischen Zentren des Mittelmeerraumes besetzt worden waren. Sie selbst haben keinerlei Erfindungen gemacht, weder in technologischer noch betriebswirtschaftlicher Hinsicht.«6 Darüber hinaus waren diese kapitalistischen Zentren des Nordens in der kritischen Phase ihrer Wirtschaftsentwicklung allesamt katholisch, nicht protestantisch – die Reformation lag noch in ferner Zukunft.
John Gilchrist, ein führender Historiker des Wirtschaftslebens in den mittelalterlichen Kirchen, hat von einem anderen Punkt aus dargelegt, dass die ersten Beispiele für den Kapitalismus in den großen christlichen Klöstern zu finden waren.7 Ebenso ist es bewiesen, dass noch im 19. Jahrhundert die protestantischen Regionen und Länder des Kontinents8 den katholischen Gegenden keineswegs voraus waren, vom »rückständigen« Spanien abgesehen.9
Aber auch wenn Weber falsch lag, ging er völlig zu Recht davon aus, dass religiöse Vorstellungen beim Aufstieg des Kapitalismus in Europa eine höchst vitale Rolle gespielt haben. Die materiellen Vorbedingungen für den Kapitalismus waren auch in anderen Zivilisationen gegeben, etwa in China, der islamischen Welt, Indien, Byzanz und vermutlich auch im alten Rom und in Griechenland. Doch ging keine dieser Gesellschaften voran und entwickelte den Kapitalismus, da keine von ihnen eine ethische Vision besaß, die mit einem dynamischen Wirtschaftssystem kompatibel gewesen wäre. Stattdessen huldigten die führenden Religionen fernab des Westens der Askese und prangerten das Profitstreben an, während gleichzeitig habgierige Eliten die von Kleinbauern und Handeltreibenden erwirtschafteten Gewinne zu einem Gutteil wieder einstrichen.10 Warum haben sich die Dinge in Europa anders entwickelt? Weil sich die Christen dort einer rationalen Theologie anheimgaben – ein Umstand, der später zwar auch die Reformation hervorgebracht haben mag, der dieser jedoch um mehr als ein Jahrtausend vorausging.
Gleichwohl hat sich der Kapitalismus nur an manchen Orten entwickelt. Warum nicht überall? Weil es in manchen europäischen Gesellschaften wie auch im großen Rest der Welt viele gierige Despoten gab, die ihn verhindern wollten. Was dort fehlte, war ein Grundbestandteil der kapitalistischen Entwicklung, nämlich die Freiheit. Hier schließt sich eine weitere Frage an: Warum war die Freiheit fast überall auf der Welt ein so seltenes Gut und wie kam es, dass einige Staaten des europäischen Mittelalters sie gehegt und gepflegt haben? Auch hierfür war ein Sieg der Vernunft verantwortlich. Noch lange bevor einer dieser europäischen Staaten seine Regierung in die Hände einer gewählten Versammlung legte, hatten christliche Theologen bereits Theorien über Fragen der Gleichheit und der individuellen Rechte aufgestellt. So beruhen etwa die späteren Arbeiten eines solch »säkularen« politischen Theoretikers des 18. Jahrhunderts wie John Locke auf egalitären Axiomen, die bereits vorher von Kirchengelehrten erarbeitet worden waren.11
Um es zusammenzufassen: der Aufstieg des Westens beruhte auf vier grundlegenden Siegen der Vernunft. Der erste war die Genese des Fortschrittsglaubens in der christlichen Theologie. Der zweite war die Übertragung und Einspeisung dieses Glaubens in technologische und organisatorische Innovationen, von denen viele aus dem Klosterleben stammten. Der dritte Sieg beruhte darauf, dass die Vernunft dank der christlichen Theologie ebenso die politische wie die praktische Philosophie durchdrang, und zwar bis zu dem Punkt, an dem hierfür empfängliche Staaten im mittelalterlichen Europa den Weg für ein großes Ausmaß an persönlicher Freiheit ebneten. Der letzte Sieg beinhaltete die Anwendung der Vernunft auf den Handelsverkehr, was schließlich zur Entwicklung des Kapitalismus in den sicheren Häfen jener willigen Staaten führte. Durch genau diese Siege wurde das Abendland groß.
Der Plan des Buches
Der Sieg des Abendlandes besteht aus zwei Teilen. Der erste wendet sich den Fundamenten zu. Er untersucht die Rolle der Vernunft im Christentum und zeichnet nach, wie sie der politischen Freiheit und dem Aufkommen von Wissenschaft und Kapitalismus den Weg bereitet hat. Teil zwei befasst sich damit, wie die Europäer auf diesen Fundamenten etwas errichteten.
Kapitel 1 widmet sich den Ursprüngen und Konsequenzen des christlichen Zuspruchs zu einer rationalen Theologie. Wie kam es dazu? Und warum resultierte es in dem revolutionären Umstand, dass die Anwendung der Vernunft auf das Verständnis der Bibel zu einem theologischen Fortschritt führte? Es wurde zu einem Grundsatz der christlichen Theologie, dass das Verständnis Gottes mit der Zeit besser und größer werden könne und auch feststehende Doktrinen durchaus radikal veränderbar seien. Nachdem ich die rationalen und fortschrittlichen Aspekte der christlichen Theologie dargelegt habe, wende ich mich Beispielen und Folgeerscheinungen zu. Zunächst behandele ich die absolut zentrale Rolle, die die rationale Theologie beim Aufkommen der Wissenschaft gespielt hat und zeige auf, warum die Wissenschaft sich zwar sehr wohl in Europa entwickelte, nicht aber in China, der islamischen Welt oder im alten Griechenland. Danach wird der Fokus auf wichtige moralische Innovationen gerichtet, die von der mittelalterlichen Kirche geleistet wurden. So begünstigte das Christentum eine sehr nachdrückliche Konzeption des Individualismus, die dennoch mit den eigenen Doktrinen bezüglich des freien Willens und der Erlösung vereinbar war. Daneben kultivierte das mittelalterliche Mönchswesen den Respekt vor Tugenden wie Arbeit oder einfachen Lebensweisen, der der protestantischen Ethik fast um ein Jahrtausend vorausging. Dieses Kapitel umreißt zudem den Anteil des Christentums bei der Heranbildung neuer Ideen der Menschenrechte. Denn für die Entwicklung des Kapitalismus war es erforderlich, dass Europa nicht länger eine Zusammenballung von Sklavengesellschaften war. Wie auch in Rom und allen anderen damaligen Zivilisationen existierte die Sklaverei überall im frühen mittelalterlichen Europa. Unter allen führenden Glaubensrichtungen bildete einzig das Christentum einen moralischen Widerstand gegen die Sklaverei aus, welcher ab dem 7. Jahrhundert dann wiederum in eine religiöse Opposition überging. Ab dem 12. Jahrhundert war die Sklaverei fast überall im Westen verschwunden und hielt sich nur hier und da in Grenzgebieten.12 Dass die Sklaverei einige Jahrhunderte später wieder eingeführt werden sollte, ist ein anderes Thema, doch auch dann bemühte sich das Christentum erneut um ihre Abschaffung.13
Kapitel 2 blickt auf die religiösen Grundlagen des Kapitalismus, die im sogenannten finsteren Mittelalter statuiert wurden. Es wird aufgezeigt, dass diese Epoche alles andere als ignorant und rückständig war, sondern im Gegenteil eine Zeit spektakulären technologischen und intellektuellen Fortschritts darstellte, sobald die Innovation einmal aus den Klauen des römischen Despotismus befreit worden war. Der christliche Einsatz für den Fortschritt spielte nicht nur eine wichtige Rolle bei der Suche nach neuen Technologien, sondern ebenso bei deren zügiger und großflächiger Anwendung. Obendrein führte die Bejahung des Fortschrittsgeschehens durch viele Kirchenführer und Gelehrte zu einigen bemerkenswerten theologischen Revisionen. Nicht anders als die übrigen Weltreligionen hatte auch das Christentum über Jahrhunderte die moralische und spirituelle Überlegenheit des Asketismus betont und auf dessen Gegensatz zu Kommerz und Finanzwesen hingewiesen. Doch wurden diese Grundhaltungen im 12. und 13. Jahrhundert von katholischen Theologen verworfen, die nun stattdessen den privaten Besitz und das Profitstreben verteidigten. Wie konnte das geschehen? Ganz einfach dadurch, dass Theologen das Handelstreiben, das in den großen klösterlichen Anwesen begonnen hatte, moralisch neu beurteilten, da sie dessen früheres Verbot nun theologisch nicht mehr angemessen fanden.
Kapitel 3 beginnt mit einer kurzen Darstellung der Planwirtschaft: es wird gezeigt, wie despotische Regierungen regelmäßig Innovation und Handel unterdrücken, indem sie zwar Reichtum anhäufen, verbrauchen und enteignen, ihn aber kaum je reinvestieren. Da der Aufstieg des Kapitalismus den Sieg über despotische Staaten erforderlich machte, widmet sich der Rest des Kapitels der Ausbreitung der Freiheit in Europa, die die Form kleiner und häufig überraschend demokratischer politscher Einheiten annahm. Zuerst wird die christliche Grundlage des westlichen Demokratie-Konzepts untersucht, d.h. die Genese der Doktrinen von individueller moralischer Gleichheit, der Rechte des Privatbesitzes und der Trennung von Kirche und Staat. Danach wird erklärt, wie in einigen italienischen Stadtstaaten und in Nordeuropa eine relativ demokratische Gesetzgebung entstehen konnte.
Kapitel 4 geht der Perfektionierung des Kapitalismus in den italienischen Stadtstaaten nach und zeigt, wie die für das Funktionieren von großen, rationalen und industriellen Unternehmen erforderlichen Organisationsstrukturen und Finanztechniken entwickelt wurden. Kapitel 5 zeichnet die Ausbreitung von »kolonialen« kapitalistischen Unternehmen aus Italien in die Städte des Nordens nach. Am Ende des Kapitels befasst sich ein längerer Abschnitt mit der Frage, wie die Engländer das leistungsstärkste kapitalistische Wirtschaftssystem in Europa entwickeln konnten.
Kapitel 6 blickt auf die wichtigsten negativen Fälle, schon weil eine umfassende Erörterung der Frage, warum der Kapitalismus sich in bestimmten Regionen Europas ausbreiten konnte, ebenfalls erklären muss, warum das Gleiche andernorts misslang. Wie kam es, dass Spanien, das reichste und mächtigste Land Europas im 17. Jahrhundert, stets ein vor-kapitalistischer, feudaler Staat blieb? Warum wollte Spanien die kapitalistische Vitalität der italienischen Stadtstaaten sowie der spanischen Niederlande zerstören? Und was waren die Gründe dafür, dass Spanien in der Folge rasch zu einer drittrangigen Macht wurde und sein Herrschaftsgebiet verlor? Was Frankreich angeht – warum stagnierten der Kapitalismus und die Freiheit auch dort? Um diese Fragen zu beantworten, wende ich mich erneut den erdrückenden wirtschaftlichen Folgen des Despotismus zu.
Vor diesem Hintergrund wechselt Kapitel 7 den Standort und blickt auf die Neue Welt sowie auf das dramatische ökonomische Gefälle, das die Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika voneinander absetzen sollte. Die Schilderung dieser Geschichte wird nicht zuletzt als Zusammenfassung des ganzen Buches dienen, da die hier wirksamen Faktoren praktisch eine Wiederholung der wirtschaftlichen Historie Europas darstellen. Auch hier spielten das Christentum, die Freiheit und der Kapitalismus die entscheidenden Rollen. Im Fazit wird die Frage gestellt, ob das heute wohl immer noch so ist. Oder können durch die Globalisierung alternativ auch völlig andere moderne Gesellschaften entstehen, die weder christlich noch kapitalistisch oder auch nur frei sind?
TEIL I:FUNDAMENTE
KAPITEL 1:DIE SEGNUNGEN DER RATIONALEN THEOLOGIE
Die Theologie steht bei den meisten westlichen Intellektuellen in schlechtem Ruf. Das Wort wird verstanden als eine Vergangenheitsform religiösen Denkens, das auf Irrationalität und Dogmatismus beruht. Das Gleiche gilt für die Scholastik. Welche Ausgabe des Merriam-Webster-Wörterbuchs man auch immer bemüht, »scholastisch« bedeutet »pedantisch und dogmatisch« und kennzeichnet die Sterilität der mittelalterlichen Kirchenlehre. John Locke, der britische Philosoph des 18. Jahrhunderts, lehnte die Scholastiker ab und bezeichnete sie als »große Münzpräger« nutzloser Begriffe, die letztlich doch nur »die eigene Unwissenheit verschleiern« sollten.1 Aber weit gefehlt! Die Scholastiker waren vielmehr brillante Gelehrte, die für die Gründung der großen europäischen Universitäten und den Aufstieg der westlichen Wissenschaft verantwortlich waren. Was die Theologie betrifft, hatte sie wenig gemein mit dem ansonsten vorherrschenden religiösen Denken, sondern war eine hochentwickelte und höchst rationale Disziplin, wie sie so nur im Christentum entwickelt wurde.
Die Theologie, die manchmal auch als »Wissenschaft des Glaubens«2 bezeichnet wird, stellt ein rationales Nachdenken über Gott dar. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Aufspüren der Natur Gottes, seiner Absichten und Forderungen, sowie dem Verständnis der Art und Weise, wie die Beziehung zwischen Gott und den Menschen von diesen definiert wird. Auf den Göttern des Polytheismus könnte dagegen nie eine Theologie aufbauen, da sie viel zu widersprüchlich sind. Die Theologie erfordert das Gottesbild eines bewussten und rationalen übernatürlichen Wesens mit unbeschränkter Kraft und Reichweite, welches die Menschen ernst nimmt und ihnen moralische Codes und Verantwortlichkeiten auferlegt. Dabei werden höchst gewichtige intellektuelle Fragen aufgeworfen, zum Beispiel: Warum erlaubt uns Gott zu sündigen? Verbietet das Fünfte Gebot auch den Krieg? Ab wann hat ein Kleinkind eine Seele?
Um das Wesen der Theologie wirklich zu verstehen, ist es sinnvoll, in den Osten zu schauen und zu erkennen, warum es dort niemals Theologen gegeben hat. Nehmen wir etwa den Taoismus. Das Tao wird als eine übernatürliche Essenz begriffen, ein unter den Dingen liegendes mystisches Kraft-Prinzip, das das Leben reguliert. Dabei ist es jedoch unpersönlich, unnahbar, es hat kein Bewusstsein und ist nimmermehr ein Wesen. Vielmehr ist es der »ewige Weg«, eine kosmische Kraft, die Harmonie und Gleichgewicht herstellt. Nach Lao-Tse ist das Tao zugleich »niemals da« und »immer da«, es ist »namenlos«, hat aber auch »den Namen, der genannt werden kann«. Ebenso »klang- wie formlos« hat es »niemals ein Begehr«. Man kann ewig über eine solche Essenz meditieren, doch lässt sie sich logisch kaum durchdenken. Das Gleiche gilt für den Buddhismus und den Konfuzianismus. Selbst wenn die volkstümlichen Varianten dieser Glaubensrichtungen polytheistisch sind und über ein enormes Personal an kleinen Gottheiten verfügen (was auf den gemeinverständlichen Taoismus ebenfalls zutrifft), so sind die »reinen« Formen dieser Glaubensrichtungen, wie sie von den intellektuellen Eliten aufgefasst werden, letztlich gottlos und beziehen sich auf eine nur vage heilige Essenz. Buddha etwa negierte ausdrücklich die Existenz eines bewussten Gottes.3 Im Osten existieren schon deswegen keine Theologen, weil all jene, die eine solche intellektuelle Aufgabe ansonsten erfüllen würden, nicht einmal deren erster Grundvoraussetzung Rechnung tragen können, nämlich der Existenz eines Gottes, der ebenso bewusst wie allmächtig ist.
Im Gegensatz dazu haben christliche Theologen jahrhundertelang darüber nachgedacht, was Gott in spezifischen Stellen der Bibel wirklich sagen will, und manche dieser Interpretationen haben im Laufe der Zeit höchst dramatische und weitreichende Diskussionen nach sich gezogen. Zum Beispiel verbietet die Bibel die Astrologie nicht nur nicht, sondern die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die dem Stern von Bethlehem folgen, belegt sogar deren Statthaftigkeit. Andererseits legte Augustinus im 5. Jahrhundert vernünftig dar, dass die Astrologie falsch sein müsse, da der Glaube an ein vorbestimmtes Schicksal nicht vereinbar sei mit dem freien Willen, den Gott uns geschenkt habe.4 Ähnlich war es mit der theologischen Konzeption von Maria: obwohl viele frühe Christen, darunter der Apostel Paulus, die Annahme stützten, dass Jesus Brüder gehabt habe,5 ihrerseits gezeugt von Josef und geboren durch Maria, geriet diese Ansicht in energischen Konflikt mit ihrer weiteren Auslegung durch spätere Theologen. Das Problem wurde dann im 13. Jahrhundert gelöst, als Thomas von Aquin die Doktrin von Mariens Jungfrauengeburt dergestalt definierte, dass Maria keine anderen Kinder zur Welt gebracht habe: »So behaupten wir ohne Vorbehalt, dass die Mutter Gottes als Jungfrau schwanger wurde, als Jungfrau gebar und auch nach der Geburt Jungfrau geblieben ist. Die Brüder des Herrn waren keine natürlichen Brüder, die von der gleichen Mutter geboren wurden, sondern Blutsverwandte.«6
Dies und ähnliches waren nicht nur bloße Erweiterungen der Bibeltexte, sondern Beispiele für sorgfältige und vernünftige Schlussfolgerungen, aus denen dann wiederum neue Doktrinen entstanden: die Kirche verbot die Astrologie, die Immerwährende Jungfräulichkeit Mariens wurde zur offiziellen katholischen Lehre. Wie diese Beispiele zeigen, vermochten große Geister oftmals eine Kirchendoktrin durch logisches Denken erheblich zu verändern oder gar umzudrehen. Niemand konnte dies besser und hatte größeren Einfluss als die Heiligen Augustinus und Thomas von Aquin. Natürlich haben auch tausende anderer Theologen versucht, den Doktrinen ihren Stempel aufzudrücken. Manchen gelang es, die meisten wurden übergangen und noch andere wurden als Häretiker ausgesondert. Es geht aber stets darum, dass hinter jeder Darlegung gleich welchen Aspekts der christlichen Theologie eine hohe Autorität stehen muss. Es ließen sich problemlos in den Arbeiten tausender unbedeutender Theologen Zitate finden, die die bizarrsten Standpunkte belegen. Entsprechend haben Historiker oft diesen Ansatz gewählt; doch ist es nicht meiner. Ich werde geringere Persönlichkeiten nur dann zitieren, wenn ihre Ansichten auch von großen Theologen bestätigt worden sind, wobei ich im Hinterkopf behalte, dass die maßgebende Position der Kirche sich in vielen Fällen weiterentwickelte und das mitunter so sehr, dass ihre früheren Lehren ins Gegenteil verkehrt wurden.
Führende christliche Theologen wie Augustinus und Thomas von Aquin entsprachen nicht eben dem, was heutzutage mit strenger Bibel-Exegese in Verbindung gebracht wird. Vielmehr bedienten sie sich stets ihrer Vernunft, um größere Einsicht in die göttlichen Pläne zu gewinnen. Tertullian sagte es im 2. Jahrhundert so: »Die Vernunft ist insofern ein Ding Gottes, als es nichts gibt, das Gott der Schöpfer uns nicht durch Vernunft verliehen oder auferlegt hat. Und so soll auch nichts von dem, was er nicht will, mit Mitteln der Vernunft verstanden und gehandhabt werden.«7 Im gleichen Geiste sprach Clemens von Alexandria im 3. Jahrhundert die Warnung aus: »Denkt nicht, dass wir behaupten, diese Dinge könnten durch den Glauben allein empfangen werden, stattdessen muss die Vernunft sie zunächst immer bestätigen. Denn tatsächlich ist es ein Wagnis, diese Dinge dem bloßen Glauben zu überlassen, da die Wahrheit sicherlich nie ohne die Vernunft existieren kann.«8
Daher drückte Augustinus in erster Linie etwas aus, das bloß dem letztgültigen allgemeinen Stand der Weisheit entsprach, als er sagte: »Der Himmel bewahre, dass Gott in uns gerade das zu hassen beginnt, mit dem er uns den Tieren überlegen gemacht hat. Der Himmel bewahre, dass unser Glaube nicht die Vernunft begehre oder zumindest akzeptiere, da uns der Glaube ja gar nicht möglich wäre, besäßen wir keine vernunftbegabten Seelen.« Augustinus hatte erkannt, dass »der Glaube der Vernunft vorangehen und zunächst das Herz reinigen muss, damit es bereit ist das helle Licht der Vernunft zu empfangen und auszuhalten«. Und er fügte hinzu, dass, obwohl es nötig sei, »dass der Glaube der Vernunft vorangeht, in gewissen, bis dahin noch nicht begreifbaren Momenten, der sehr kleine Anteil der Vernunft, der uns von diesem Umstand überzeugt, wiederum dem Glaube vorausgehen muss«.9 Die scholastischen Theologen setzten weitaus mehr Glauben in die Vernunft, als die meisten Philosophen es heutzutage tun.10
Natürlich widersetzten sich manche einflussreiche Kirchenmänner diesem Primat der Vernunft und hielten dagegen, dass die besten Diener des Glaubens der Mystizismus und das spirituelle Erleben seien.11 Ironischerweise hat der inspirierendste Fürsprecher dieses Standpunkts seine Thesen auf eine Weise formuliert, die ganz besonders elegant und vernunftdurchtränkt war.12 Der Widerspruch gegen die Vernunft war natürlich in manchen religiösen Orden sehr populär, besonders bei den Franziskanern und den Zisterziensern. Doch konnten sich ihre Ansichten nicht durchsetzen – und wenn auch nur aus dem einen Grund, weil an den Universitäten, in denen die Vernunft im Besonderen regierte, die offizielle Theologie der Kirche den Ton angab.13
Der christliche Glauben in seinem Fortschritt
Auch das Judentum und der Islam haben sich das Bild eines Gottes zu eigen gemacht, dem eine Theologie hätte zur Seite gestellt werden können, doch ließen ihre Gelehrten dieses Feld unbestellt. Stattdessen sehen sowohl das traditionelle Judentum14 wie die Muslime in der Heiligen Schrift vor allem einen Gesetzestext, der verstanden und angewandt werden muss und nicht eine Grundlage für Untersuchungen in der Frage nach dem letzten Sinn. Daher fassen Gelehrte das Judentum und den Islam oft als »orthopraktische« Religionen auf, denen es vor allem um die korrekte (ortho) Anwendung (praxis) von Glaubenssätzen geht und die »ganz fundamental die Einhaltung von Gesetzen und Regeln im Gemeinschaftsleben betonen«. Dagegen bezeichnen die Gelehrten das Christentum als »orthodoxe« Religion, weil es das korrekte (ortho) Fürwahrhalten (doxa) hervorhebt und »das Hauptaugenmerk auf den Glauben und seine intellektuelle Strukturierung durch das Credo, den Katechismus und die Theologien« legt.15 Bei einer typischen Kontroverse zwischen jüdischen und muslimischen Denkern geht es darum, ob eine bestimmte Handlung oder Erfindung (etwa die Reproduktion der Heiligen Schrift durch die Druckerpresse) im Einklang mit dem bestehenden Gesetz ist. Eine typische christliche Kontroverse ist dagegen doktrinär und befasst sich etwa mit Themen wie der Heiligen Dreifaltigkeit oder der Immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens.
Natürlich haben auch führende christliche Denker sich mit dem Gesetz beschäftigt und manch jüdischer wie muslimischer Gelehrter sich mit theologischen Fragen auseinandergesetzt. Und doch haben die drei Glaubensrichtungen an dieser Stelle sehr verschiedene Stoßkräfte und besondere Konsequenzen.
Rechtsauslegungen beziehen sich auf Präzedenzfälle und werfen daher sozusagen ihre Anker in die Vergangenheit, während das Bemühen um ein besseres Verständnis der göttlichen Natur dagegen von einer Möglichkeit des Fortschritts ausgeht. Und genau diese Annahme des Fortschritts ist es, die den entscheidendsten Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen ausmachen dürfte. Sieht man vom Judentum ab, begreifen die anderen großen Glaubensrichtungen die Geschichte entweder als endlos wiederholten Kreislauf oder als unabwendbaren Niedergang – so soll Mohammed gesagt haben: »Die beste aller Generationen ist meine eigene, gefolgt von der nächsten und dann wiederum der nächsten.«16 Im Gegensatz dazu haben Judentum und Christentum eine richtungsweisende Konzeption der Geschichte, die in die Wiederkehr Christi und das Millennium mündet. Allerdings betont die jüdische Vorstellung der Geschichte nicht so sehr den Fortschritt, als vielmehr das Moment der Sequenz, des Nacheinanders, wohingegen das Christentum die Idee des Fortschritts verinnerlicht hat. John Macmurray schrieb dazu: »Daß wir überhaupt an so etwas wie Fortschritt denken, zeigt das ganze Ausmaß des christlichen Einflusses.«17
Die Dinge lägen vielleicht anders, hätte Jesus eine schriftliche Mitteilung hinterlassen. Doch anders als Mohammed und Moses, deren Schriften als göttliche Übermittlungen aufgefasst wurden, hat Jesus nie etwas verfasst, so dass die Kirchenväter von Anfang an aus den Implikationen seiner Worte – einer Sammlung von Aussagen, die nur der Erinnerung der Evangelisten entstammten – ihre Schlüsse ziehen mussten. Das Neue Testament ist kein vereinheitlichtes Dokument, sondern eine Sammelschrift.18 Demzufolge steht im Hintergrund aller theologischen Deduktion stets das Wort des Paulus: »Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk ist unser prophetisches Reden.«19 Man vergleiche dies mit der zweiten Sure des Korans: »Dies ist die Schrift, an der nicht zu zweifeln ist.«20
Von Anfang an gingen christliche Theologen davon aus, dass der Gebrauch der Vernunft zu einem umso genaueren Verständnis des Willen Gottes führe. Augustinus bemerkte, dass, obwohl »es in der Heilslehre gewisse Dinge gibt, die wir uns noch nicht erschließen können […], wir eines Tages dazu fähig sein werden«.21 Doch Augustinus rühmte nicht nur den theologischen, sondern auch den weltlichen, materiellen Fortschritt. Bereits im 5. Jahrhundert schrieb er: »Sind nicht durch den Menschengeist so viele und großartige Künste erfunden und betätigt worden, teils unentbehrliche, teils dem Vergnügen dienende, dass die überragende Kraft des Geistes und der Vernunft selbst auch in ihren überflüssigen oder sogar gefährlichen und verderblichen Strebungen davon zeugt, welch herrliches Gut sie ihrem Wesen nach ist, welches es ihr ermöglichte, derlei Dinge zu erfinden, sich anzueignen und zu betätigen. Zu welch wunderbaren, staunenswerten Erzeugnissen ist menschliche Betriebsamkeit im Bekleidungs- und Baugewerbe gelangt; wie weit hat sie es in der Bodenbebauung, in der Schifffahrt gebracht …« Und weiter hob er hervor, »welch große Kenntnis hat diese Kraft des Geistes und der Vernunft in Maß und Zahl erlangt, mit welchem Scharfsinn die Bahnen und Stellungen der Gestirne erfasst; welche Unsumme von Wissen über die Dinge der Welt hat sie gespeichert!« All das gehe zurück auf das »höchste und unwandelbare Gute«, das Gott seinem Geschöpf mitgegeben habe, nämlich eine »vernunftbegabte Natur«.22
Augustinus’ Zuversicht war typisch; der Fortschritt lockte die gesamte Christenheit. Gilbert de Tournai schrieb im 13. Jahrhundert: »Niemals werden wir die Wahrheit finden, wenn wir uns mit dem begnügen, was wir bereits wissen … Was vor unserer Zeit geschrieben wurde, sind keine Gesetze, sondern Wegweiser. Die Wahrheit steht uns allen offen, da wir sie noch nicht zur Gänze besitzen.«23 Daran schließt sich an, was Fra Giordano 1306 in Florenz gepredigt hat: »Weder sind alle Künste bereits ausgeschöpft worden, noch werden wir mit ihnen je an ein Ende kommen. Man sollte jeden Tag eine neue Kunst freilegen.«24 Vergleichen wir dies mit der zur gleichen Zeit vorherrschenden Überzeugung in China, wie Li Yen-Chang sie charakterisierte: »So die Gelehrten dahin gebracht werden, ihre Aufmerksamkeit einzig auf die Klassiker zu richten und man sie davon abhält, sich mit dem vulgären Tun späterer Generationen zu befassen, wird es dem Kaiserreich fürwahr wohlergehen!«25
Das christliche Bekenntnis zum Fortschritt mittels der Rationalität erreichte seinen Höhepunkt in der Summa theologica des heiligen Thomas von Aquin, die im späten 13. Jahrhundert in Paris veröffentlicht wurde. Dieses Monument der rationalen Theologie besteht aus logischen »Beweisen« christlicher Doktrinen und diente allen späteren christlichen Theologen als Maßstab. Da Thomas zufolge allen menschlichen Wesen der hinreichende Intellekt fehle, um direkt in das Wesen der Dinge zu blicken, sei es nötig, dass sie sich ihren Weg in die Erkenntnis Schritt für Schritt mit Hilfe der Vernunft bahnen. Aus diesem Grund sprach sich Thomas, selbst wenn er die Theologie als die höchste der Wissenschaften betrachtete, da sie sich unmittelbar mit göttlichen Offenbarungen befasse, für den Gebrauch der Werkzeuge der Philosophie aus, besonders für logische Prinzipien, mit denen erst eine Theologie begründet werden sollte.26 Folgerichtig gelang es ihm, mit der Kraft der Vernunft in Gottes Schöpfung den profundesten Humanismus auszumachen.27
Doch hätten sich Thomas von Aquin und seine vielen begabten Kollegen niemals in der rationalen Theologie hervortun können, wenn sie Jehova als ein unerklärliches Wesen betrachtet hätten. Sie konnten ihre Bemühungen nur rechtfertigen, indem sie in Gott die Verkörperung der Vernunft schlechthin sahen.28 Überdies mussten sie, da sie Gottes Willen auf fortschrittliche Weise zu erschließen suchten, akzeptieren, dass die Bibel nicht stets und nicht wörtlich zu verstehen sei. Auch dies entsprach der konventionellen christlichen Sichtweise, da, wie Augustinus anmerkte, »unterschiedliche Dinge unter diesen Worten zu verstehen seien, die wiederum alle wahr sind«. Augustinus gestand sogar offen ein, dass späteren Lesern mit Gottes Hilfe einmal ein Verständnis gewisser Bibelstellen möglich sein werde, obwohl derjenige, der sie niederschrieb, »sie gar nicht verstanden hat«. Und er fährt fort: »Wenn also jeder sich bestrebt, in der heiligen Schrift das zu erkennen, was der Verfasser dachte, wie kann es dann böse sein, wenn er darin findet, was du, Licht aller derer, welche die Wahrheit aufrichtig suchen, ihm als wahr zeigst, wenn auch der, dessen Worte er liest, dies nicht dachte, so dachte er doch Wahres, wenn auch nicht gerade dieses.«29 Da Gott darüber hinaus unfähig sei, Fehler zu machen, könne der Grund, warum die Bibel der Erkenntnis zu widersprechen scheine, nur an einem Verständnisproblem des »Verfassers« liegen, welcher Gottes Worte fixierte.
Diese Ansichten standen in völligem Einklang mit dem christlichen Grundsatz, dass Gottes Offenbarungen sich stets am jeweils aktuellen menschlichen Verständnisvermögen orientierten. Im 4. Jahrhundert schrieb der heilige Johannes Chrysostomos, dass selbst die Seraphe Gott nicht als das erkennen könnten, was er ist. Stattdessen sähen sie »etwas, das an ihre Natur angepasst ist und sich zu dieser herablässt. Zu dieser Herablassung kommt es, wenn Gott erscheint, allerdings nicht als der, der er ist. Stattdessen zeigt er sich dem, der ihn doch nicht ganz zu erschauen vermag, gerade soweit, dass dieser ihn ein stückweit erblickt. Auf diese Weise lässt Gott sich proportional zu der Schwäche derer erkennen, die seiner gewahr werden.«30 Angesichts dieser langen Tradition gab es auch nichts ansatzweise Ketzerisches an der These Johannes Calvins, dass Gott seine Offenbarungen den Grenzen des menschlichen Verständnisses anpasse und etwa der Autor der Genesis »ordiniert war, ein Lehrer der Ungelernten und Primitiven zu sein, nicht anders als der bereits Wissende; ohne auch krude Mittel der Instruktion zu verwenden, hätte er sein Ziel nicht erreichen können«. Das heißt, Gott »offenbart sich uns entsprechend unserer Grobheit und Schwäche«.31
Das christliche Gottesbild ist das eines Wesens, das an den menschlichen Fortschritt glaubt und sich umso vollständiger offenbart, desto mehr die Menschen ein Vermögen zu besserem Verständnis gewinnen. Da Gott zudem als vernunftbegabtes Wesen das Universum geschaffen hat, hat auch dieses notwendigerweise eine rationale, gesetzmäßige, stabile Struktur, die nur darauf wartet, von den Menschen besser verstanden zu werden. Hierin lag der Schlüssel zu manchen intellektuellen Vorhaben, von denen die Wissenschaft ein wesentlicher Teil war.
Theologie und Wissenschaft
Die sogenannte wissenschaftliche Revolution des 16. Jahrhunderts ist von all jenen fehlinterpretiert worden, die stets eine Art Ur-Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft ausmachen wollen. Es sind höchst wunderbare Dinge in dieser Epoche geschaffen worden, doch lag das nicht an einem jähen Ausbruch säkularen Denkens. Im Gegenteil waren diese Errungenschaften der krönende Abschluss eines jahrhundelangen systematischen Fortschritts durch mittelalterliche Scholastiker, die ihrerseits unterstützt wurden von der singulär christlichen Erfindung des 12. Jahrhunderts, der Universität. Nicht nur stellten sich Wissenschaft und Religion als kompatibel heraus, sie waren sogar nicht voneinander zu trennen – denn der Aufstieg der Wissenschaft wurde von zutiefst religiösen christlichen Gelehrten ermöglicht.32
Es ist wichtig zu erkennen, dass Wissenschaft nicht bloß aus Technologie besteht. Eine Gesellschaft kann sich nicht deshalb der Wissenschaft rühmen, weil sie in der Lage ist, Schiffe zu bauen, Eisen zu schmelzen oder weil sie das Essen auf Porzellantellern serviert. Die Wissenschaft ist eine Methode, die in organisierten Versuchen benutzt wird, um der Natur einer Sache auf den Grund zu gehen und um sie zu formulieren. Dabei ist sie stets Modifizierungen und Korrekturen durch systematische Beobachtung unterworfen.
Anders gesagt, besteht die Wissenschaft aus zwei Bausteinen: Theorie und Forschung. Die Theorie ist der erklärende Teil der Wissenschaft. Wissenschaftliche Theorien sind abstrakte Aussagen darüber, warum und wie bestimmte Teile der Natur (einschließlich des menschlichen Gemeinschaftslebens) ineinander passen und funktionieren. Allerdings gehen nicht alle abstrakten Aussagen, und selbst nicht alle erklärenden, als wissenschaftliche Theorien durch. Ansonsten wäre auch die Theologie eine Wissenschaft. Abstrakte Theorien sind vielmehr nur dann wissenschaftlich, wenn man von ihnen einige verbindliche Vorhersagen positiver wie negativer Art darüber ableiten kann, was überhaupt beobachtet werden wird. Und hier kommt die Forschung ins Spiel. Bei ihr geht es darum, Beobachtungen anzustellen, die für die empirischen Vorhersagen relevant sind. Dabei wird klar, dass die Wissenschaft auf Aussagen über die natürliche und materielle Wirklichkeit beschränkt ist – also über Dinge, die zumindest grundsätzlich beobachtbar sind. Aus diesem Grund gibt es auch manche diskursiven Gefilde, die die Wissenschaft überhaupt nicht erreichen kann – etwa die Frage nach der Existenz Gottes.
Man beachte auch, dass die Wissenschaft eine organisierte, gemeinschaftliche Bestrebung darstellt und nicht auf Zufallsfunden beruht oder in der Abgeschiedenheit stattfindet. Freilich haben manche Wissenschaftler auch allein gearbeitet, jedoch niemals in der Isolation. Seit den ersten Tagen haben Wissenschaftler Netzwerke gegründet und unterhielten durchweg viele Kontakte.
In Übereinstimmung mit der Ansicht heutiger Historiker und Wissenschaftstheoretiker schließt diese Definition der Wissenschaft alle Versuche aus, die es im Laufe der Menschheitsgeschichte gab, um die materielle Welt zu erklären und zu kontrollieren, selbst solche, die mit dem Übersinnlichen nichts zu tun hatten. Die meisten dieser Bemühungen kann man deshalb aus der Kategorie der Wissenschaft herausnehmen, da bis vor kurzem, wie Marc Bloch sagte, »technischer Fortschritt, selbst großen Ausmaßes, auf bloßer Empirie beruhte«.33 Das heißt, der Fortschritt war das Ergebnis von Beobachtung sowie praktischem Herumprobieren, doch fehlte ihm die Erklärung – die Theorie. Aus diesem Grund stellen die frühen technischen Innovationen aus griechischrömischen Zeiten, der islamischen Welt oder aus China, ganz zu schweigen von solchen aus der Vorzeit, keine Wissenschaft dar und beruhten vielmehr auf überliefertem Wissen, Geschicklichkeit, Weisheit, Technik, Handwerk, Technologie, Ingenieursbegabung, Bildung oder einfachen Kenntnissen. Auch ohne Teleskope waren die Menschen der Antike zu großartigen astronomischen Beobachtungen fähig, doch bevor diese mit nachprüfbaren Theorien verknüpft waren, verharrten sie in der Sphäre bloßer Gegebenheiten. Charles Darwin hat diesen Aspekt anschaulich beschrieben: »Vor dreißig Jahren wurde oft gesagt, dass die Geologen beobachten und nicht theoretisieren sollten; und ich erinnere mich noch gut an jemanden, der meinte, dass man ebenso gut in einer Kiesgrube die Steine zählen und ihre Farben beschreiben könnte. Wie seltsam ist das, dass jemand nicht versteht, dass alle Beobachtung immer für oder gegen eine bestimmte Ansicht sprechen muss, so sie überhaupt von Nutzen sein will!«34
Was die intellektuellen Errungenschaften der griechischen oder östlichen Philosophen angeht, war ihr Empirismus so a-theoretisch, wie ihre Theorien nichtempirisch. Schauen wir auf Aristoteles. Obwohl er für seinen Empirismus gerühmt wird, hielt er diesen doch von seinen Theorien fern. So lehrte er zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit, mit der Objekte auf den Boden fallen, proportional zu ihrem Gewicht sei – dass ein Stein, der doppelt so schwer als ein anderer sei, darum auch zweimal so schnell falle.35 Schon ein Besuch auf den Felshängen in seiner Nachbarschaft hätte ihn eines Besseren belehren können.
Gleiches lässt sich auch von den anderen berühmten Griechen sagen – entweder sind ihre Werke ausschließlich empirisch oder aber sie erfüllen nicht die Kriterien der Wissenschaft, da es ihnen an Empirie mangelt. Auf diese Weise bleiben sie rein abstrakte Thesen, die keinerlei feststellbare Folgen miteinbeziehen oder die diese sogar ignorieren. Als Demokrit erklärte, dass die gesamte Natur aus Atomteilchen bestehe, bewegte er sich damit keineswegs in Richtung der wissenschaftlichen Atomtheorie. Sein Modell war rein spekulativ und beruhte weder auf Beobachtungen noch auf Empirie. Dass es sich dennoch als richtig herausstellte, ist nicht mehr als ein linguistischer Zufall, der Demokrits Annahme ebenso viel oder wenig Bedeutung zukommen lässt, wie der seines Zeitgenossen Empedokles, als dieser behauptete, die Natur bestehe einzig aus Feuer, Luft, Wasser und Erde, oder Aristoteles’ Variante aus dem Folgejahrhundert, welche besagte, die Natur sei ein Gemisch aus Hitze, Kälte, Trockenheit, Feuchte und Quintessenz. Das Gleiche betrifft Euklid: trotz seiner analytischen Bravour und seines Scharfsinns war er doch kein Wissenschaftler, da sein Steckenpferd, die Geometrie, an und für sich keine Substanz hat und sie bloß einige Aspekte der Wirklichkeit beschreibt, jedoch nicht zu erklären vermag.
Die echte Wissenschaft erhob sich nur ein einziges Mal: in Europa.36 China, die islamische Welt, Indien und das alte Griechenland hatten zwar ihrerseits die Alchemie entwickelt, doch wurde sie nur in Europa zur Chemie. Analog dazu hatten zwar viele Gesellschaften elaborierte Systeme der Astrologie entwickelt, doch führte nur in Europa die Astrologie zur Astronomie. Warum? Die Antwort darauf hat erneut mit verschiedenen Gottesbildern zu tun.
In den Worten des großen, wenn auch missachteten mittelalterlichen Wissenschafts-Theologen Nikolaus von Oresme ist die Schöpfung Gottes »ungefähr so wie die eines Menschen, der eine Uhr baut und ihren Gang in der Folge ihr selbst überlässt«.37 Im Gegensatz zu den religiösen und philosophischen Doktrinen der nichtchristlichen Welt entwickelten Christen die Wissenschaft, weil sie glaubten, dass sie entwickelt werden konnte und sollte. Alfred North Whitehead sagte im Rahmen seiner Lowell-Vorlesungen 1925 in Harvard, dass die Wissenschaft in Europa entstanden sei aufgrund des breit gefächerten »Glaubens in die Möglichkeit der Wissenschaft … welcher von der mittelalterlichen Theologie abgeleitet war«.38 Whiteheads Erklärung schockierte nicht nur seine distinguierte Zuhörerschaft, sondern westliche Intellektuelle im Allgemeinen, sobald seine Vorlesungen veröffentlicht waren. Wie konnte dieser große Philosoph und Mathematiker, Bertrand Russells Co-Autor der bahnbrechenden Principia Mathematica (1919–1913), etwas so Obskures behaupten? Wusste er denn nicht, dass die Religion der Todfeind der wissenschaftlichen Untersuchung ist?
Whitehead wusste etwas viel Besseres. Er hatte verstanden, dass die christliche Theologie für den Aufstieg der Wissenschaft im Westen ganz unerlässlich gewesen war, und ebenso, dass nicht-christliche Theologien das wissenschaftliche Streben überall sonst abgewürgt hatten. Er erklärte: »Der größte Beitrag des mittelalterlichen Geistes zur Wissenschaftsbewegung war der unbezwingbare Glauben, dass … da ein Geheimnis war, ein Geheimnis, das gelüftet werden konnte. Wie kam es, dass diese Überzeugung so tief in den europäischen Geist eingewurzelt war? … Es muss mit der mittelalterlichen Fixierung auf die Vernunft Gottes zu tun gehabt haben, die man sich als persönliche Energie Jahwes verbunden mit der Rationalität eines griechischen Philosophen ausmalte. Jedes Detail wurde überwacht und kontrolliert: die Suche nach den Geheimnissen der Natur konnte nur in einer Bekräftigung des Glaubens an die Vernunft resultieren.«39
Whitehead schloss mit der Anmerkung, dass die in anderen Religionen zu findenden Gottesbilder, zumal die asiatischen, zu unpersönlich und zu irrational waren, als dass sie die Wissenschaft hätten stützen können. »Gleich welches Geschehnis könnte gerade auch auf den willkürlichen Befehl eines despotischen Gottes zurückzuführen sein« oder einen »unpersönlichen und völlig undurchschaubaren Ursprung haben. Es gibt da nirgends das gleiche Zutrauen in die begreifliche Rationalität eines persönlichen Wesens.«40
Tatsächlich gehen die meisten nicht-christlichen Religionen sowieso nicht von einer Schöpfung aus: das Universum ist vielmehr ewiglich oder bewegt sich bestenfalls zyklisch, es hat jedenfalls weder Anfang noch Ende und, das Wichtigste dabei, es kennt keinen Schöpfer. Infolgedessen betrachtet man das Universum als allwaltendes Mysterium, als widersprüchlich, unvorhersehbar und beliebig. Für jemanden mit diesen religiösen Prämissen verläuft der Pfad der Weisheit über Meditation und mystische Erkenntnis. Der Vernunft zu huldigen, besteht hier kein Grund.
Der kritische Punkt in all dem ist methodologisch. Ganze Jahrhunderte der Meditation werden niemals ein empirisches Wissen hervorbringen. In dem Maße dagegen, wie die Religion Anstöße dazu gibt, das Werk Gottes zu begreifen, wird das Wissen immer größer werden. Und da man, sofern man etwas gründlich verstehen will, es auch erklären können muss, agiert die Wissenschaft hier als »Magd« der Theologie. Nicht anders sahen sich all jene, die an den großen Errungenschaften des 16. und 17. Jahrhunderts beteiligt waren: als Fährtensucher in den Geheimnissen der Schöpfung. Newton, Kepler und Galileo sahen in der Schöpfung ein Buch41, das sich der steten Lektüre und Durchdringung darbot. Das wissenschaftliche Genie des 17. Jahrhunderts René Descartes begründete sein Forschen nach den »Gesetzen« der Natur damit, dass es solche Gesetze ja schließlich geben müsse, da Gott vollkommen sei und sich daher »auf eine Weise verhält, die so konstant und unveränderbar wie nur möglich ist«, abgesehen von gelegentlichen Wundern, die er wirkt.42 Umgekehrt gab es solche kritischen religiösen Auffassungen in anderen Gesellschaften nicht, die ansonsten das gleiche Potential zur wissenschaftlichen Entfaltung gehabt hätten – aber eben doch nicht hatten: den chinesischen, griechischen und islamischen.
China
Nur drei Jahre bevor sein Co-Autor Alfred North Whitehead erklärte, dass das Christentum die Basis für das wissenschaftliche Streben gelegt habe, wunderte sich Bertrand Russell über das Ausbleiben der Wissenschaft in China. Von seiner militant atheistischen Warte aus betrachtet, hätte es die Wissenschaft in China lange vor Europa geben müssen. Er schrieb: »Obwohl die chinesische Zivilisation bis dato in Dingen der Wissenschaft unzulänglich geblieben ist, steht sie dieser doch nicht feindselig gegenüber, so dass der Ausbreitung ihres Wissens keine Hürden in den Weg gelegt sind wie seitens der Kirche in Europa.«43
Trotz seiner Überzeugung, dass China bald darauf den Westen bei weitem überrunden werde,44 konnte Russell nicht erkennen, dass es sehr wohl religiöse Hindernisse waren, die die chinesische Wissenschaft beeinträchtigten. Obwohl die einfachen Leute in China über Jahrhunderte sehr viele und verschiedenartige Gottheiten verehrten, allesamt von kleinem Rang und oft mit nur wenigen Charaktermerkmalen versehen, rühmten sich die chinesischen Intellektuellen, dass sie »gottlosen« Religionen folgten. In diesen stellt das Übernatürliche eine Essenz dar, vielleicht auch ein das Leben bestimmendes Prinzip – wie etwa das Tao –, das unpersönlich ist, unnahbar, aber ganz bestimmt kein Wesen. Wie kleine Gottheiten kein Universum erschaffen, bewerkstelligen unpersönliche Essenzen oder Prinzipien dies ebenso wenig – das Tun schlechthin scheint ihnen fernzuliegen.
Das Universum, so wie die chinesischen Philosophen es auffassen, ist und war einfach schon immer da. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es rationalen Gesetzen entsprechend funktioniere oder man es eher unter physikalischen, denn mystischen Gesichtspunkten betrachten sollte. Demzufolge haben chinesische Intellektuelle über Jahrtausende hinweg »Erleuchtung« gesucht und keine Erklärungen. Zu diesem Schluss kam die große Autorität auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte, Joseph Needham, der fast seine ganze Laufbahn und viele Bücher der chinesischen Technologie-Entwicklung widmete. Nachdem er jahrzehntelang eine materialistische Erklärung gesucht hatte, kam er schließlich zu der Einsicht, dass die Chinesen bei der Entwicklung ihrer Wissenschaft aus religiösen Gründen gescheitert sind und die chinesischen Intellektuellen deshalb nicht an Naturgesetze glauben konnten, weil »die Vorstellung eines himmlischen Gesetzgebers, der einer nicht-menschlichen Natur Befehle erteilt, sich nie entwickelt hat«. Und Needham fuhr fort: »Es war nicht so, dass es für die Chinesen keine Ordnung in der Natur gegeben hätte. Doch war das keine Ordnung, die ein rationales, persönliches Wesen festgelegt hatte, weshalb es auch keinen Glauben daran gab, dass andere rationale und persönliche Wesen in ihren unbedeutenderen weltlichen Sprachen den göttlichen Gesetzestext ausbuchstabieren könnten, den Er einstmals festgelegt hatte. Die Taoisten hätten eine solche Idee schon deshalb abgelehnt, weil sie gegenüber der Feinsinnigkeit und Komplexität des Universums, so wie sie es sich vorstellten, zu naiv sei.«45 Ganz genau.
Graeme Lang, respektierter Anthropologe der städtischen Universität Hongkong, verwarf vor einigen Jahren die Ansicht, dass der Einfluss von Konfuzianismus und Taoismus auf die chinesischen Intellektuellen für die Fehlentwicklung der dortigen Wissenschaft verantwortlich gewesen seien. Kultur sei stets flexibel, so Lang, und »wenn chinesische Gelehrte wissenschaftlich hätten arbeiten wollen, hätte die Philosophie allein nie ein ernsthaftes Hindernis sein können«.46 Das mag sein. Doch stellte Lang die Grundfrage nicht: Warum wollten die Gelehrten denn keine Wissenschaft betreiben? Weil, wie Whitehead, Needham und viele andere festgestellt haben, den Chinesen die Möglichkeit der Wissenschaft gar nicht bewusst wurde. Grundlegende theologische und philosophische Annahmen entscheiden sehr wohl darüber, ob jemand die Wissenschaft in Angriff nehmen will. Die westliche Wissenschaft entstand aus der enthusiastischen Überzeugung heraus, dass der menschliche Intellekt die Geheimnisse der Natur entschlüsseln könne.
Griechenland
Über Jahrhunderte schienen die alten Griechen an der Schwelle zum wissenschaftlichen Aufbruch zu stehen. Es gefiel ihnen, die natürliche Welt mit angemessen abstrakten und allgemeinen Prinzipien zu erklären. Einige von ihnen beleuchteten die Natur systematisch – und das, obwohl Sokrates Empirismen wie die astronomische Beobachtung als »Zeitverschwendung« abtat und Platon ihm nur zustimmen konnte, wobei er seinen Studenten empfahl, »den Sternenhimmel in Frieden zu lassen«.47 Auch bildeten griechische Gelehrte Netzwerke – die berühmten philosophischen »Schulen«. Doch war alles, was sie letztlich zustande brachten, nicht- oder sogar anti-empirische, spekulative Philosophie, nicht-theoretische Kompilationen von Tatsachen, isolierte Zünfte und Technologien – ein wissenschaftlicher Durchbruch hat nie stattgefunden.
Dafür gab es drei Gründe. Erstens waren die Götter, wie die Griechen sie sich vorstellten, nicht wirklich als bewusste Schöpfer aufzufassen. Zweitens begriffen die Griechen das Universum nicht nur als ewig und unerschaffen, sondern als eingeschlossen in endlose Zyklen von Fortschritt und Verfall. Drittens verwandelten die Griechen, die ja auch die Himmelskörper als echte Götter ansahen, leblose Objekte in lebendige Kreaturen mit Zielen, Gefühlen und Wünschen – wodurch sie dem Streben nach physikalischen Theorien einen Strich durch die Rechnung machten.48
Von all den Göttern, die das himmlische Pantheon der Griechen bevölkerten, brachte keiner und nicht einmal Zeus die nötige Befähigung als Schöpfer eines Gesetzen unterworfenen Universums mit. Nicht anders als die Menschen waren auch die Götter dem unerbittlich waltenden Kreislauf aller Dinge unterworfen. Einige griechische Gelehrte, etwa Aristoteles, postulierten zwar einen allmächtigen »Gott«, in dessen Betätigungsfeld das gesamte Universum fällt, doch sahen sie in ihm, ähnlich wie das Tao, lediglich eine Essenz. Ein solcher Gott verlieh einem zyklischen Universum und dessen hypothetischen, abstrakten Eigenschaften eine gewisse spirituelle Aura, doch blieb »Gott«, da er ja nur eine Essenz war, praktisch immer tatenlos. Platon wiederum ging von einem sehr geringwertigen Gott als Schöpfer der Welt aus, dem Demiurgen, denn für ein solches Unternehmen sei der höchste »Gott« allzu vergeistigt und entrückt gewesen. Aus diesem Grund sei die Welt auch so unvollkommen.
Viele Gelehrte hatten Zweifel daran, ob Platons Postulat des Demiurgen wörtlich zu verstehen sei.49 Doch gleichgültig, ob er ein wirklicher oder metaphorischer Schöpfer war – der Demiurg Platons erblasst vor einem allmächtigen Gott, der das Universum aus dem Nichts hat entstehen lassen. Außerdem war für Platon das Universum nicht im Einklang mit wirkmächtigen Prinzipien erwachsen, sondern mit Idealen. Diese stellten vor allem musterhafte Formen dar. So gesehen, konnte das Universum nichts Handfestes, sondern bloß eine Sphäre sein, denn diese war seine symmetrische und perfekte Form.50 Auch konnten die Himmelskörper nur in einem Kreis rotieren, da diese Bewegungsform als die allerperfekteste angesehen wurde. Als Sammlung apriorisch angestellter Mutmaßungen war Platons Idealismus für die Entdeckung und Erkenntnis lange Zeit ein echtes Hindernis – noch Jahrhunderte später war es sein unerschütterlicher Glaube an ideale Formen, der Kopernikus von dem Gedanken abhielt, dass die Planetenbahn nicht kreisförmig, sondern elliptisch sein könnte.
In mancherlei Hinsicht ist es seltsam, dass die Griechen überhaupt nach Wissen und Technologie gestrebt haben, da sie die Idee des Fortschritts doch für das Seins-Modell eines endlosen Kreislaufs aufgaben. Platon war immerhin noch der Ansicht, dass das Universum geschaffen wurde. Andere griechische Gelehrte betrachteten es stattdessen als unerzeugt und einfach ewig. Aristoteles verurteilte die Vorstellung, »dass das Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Dasein gekommen ist … als undenkbar«.51 Obwohl die Griechen das Universum als ewig und unveränderlich ansahen, berücksichtigten sie die unübersehbare Tatsache, dass Geschichte und Kulturen sich ständig veränderten, dies aber nur in den Grenzen einer endlosen Wiederholung. In seinem Werk Über den Himmel schrieb Aristoteles, dass »die Menschen die gleichen Ideen nicht ein- oder zweimal haben, sondern immer und immer wieder« und in seiner Politik betonte er, dass alles »mehrfach im Laufe des Weltalters erfunden wurde, oder im Laufe einer Zeit ohne Ziffern«. Da er außerdem in einem Goldenen Zeitalter lebte, war die Technologie auf einem höchsten zu erreichenden Niveau, was weiteren Fortschritt entbehrlich machte. Was Erfindungen betraf, galt auch für Individuen – ein und derselbe Mensch wurde wieder und wieder geboren, während die blinden Zyklen des Universums vor sich hin kreisten. Laut Chrysippos in seinem verschollenen Werk Über den Kosmos lehrten die Stoiker, dass »der Unterschied zwischen einer früheren und jetzigen Existenz bloß äußerlich und zufällig ist; doch führen diese Unterschiede nicht zu einem neuen Menschen, der sich von seinem Gegenstück aus einem früheren Weltalter unterscheidet«.52 Im Universum selbst sei, Parmenides zufolge, jeder Eindruck von Veränderung bloße Illusion, da das »unerschaffene und unzerstörbare« Universum sich in einer konstanten Perfektion befinde, »in dem alles vollständig, ortsfest und endlos ist«.53 Andere einflussreiche Griechen wie die Ionier lehrten, das Universum sei zwar unbegrenzt und ewig, jedoch seinerseits der Abfolge unendlicher Kreisläufe unterworfen. Platon sah das etwas anders, doch glaubte auch er felsenfest an Zyklen und dass, durch ein ewiges Gesetz bewirkt, auf jedes Goldene Zeitalter Chaos und Zusammenbruch folgen müssten.
Schließlich ließen die Griechen es sich nicht nehmen, den Kosmos sowie unbelebte Dinge im Allgemeinen in lebende Wesen zu verwandeln. Platon lehrte, der Demiurg habe den Kosmos als »einzelnes sichtbares lebendiges Gebilde« geschaffen, wodurch auch der Welt eine Seele zukomme. Obwohl sie »alleinsteht«, sei sie »durch ihre Vortrefflichkeit in der Lage, sich selbst Gesellschaft zu leisten, wobei sie keine weiteren Bekanntschaften oder Freunde braucht, sondern sich selbst genügt«.54
So man aber Mineralien Leben zuerkennt, geht die Erklärung natürlicher Phänomene notwendig in eine falsche Richtung. Man schreibt dann den Grund, warum ein Gegenstand sich bewegt, Motiven zu und nicht natürlichen Ursachen. Von den Stoikern, insbesondere von Zenon, dürfte die Idee stammen, den Gang des Kosmos auf der Basis seiner willentlichen Vorsätze zu erklären, doch wurde sie bald Allgemeingut. So bewegten sich Aristoteles zufolge die Gestirne in Kreisen, weil ihnen diese Bewegung so gut gefiel und Dinge fielen deswegen zu Boden, »weil sie eine angeborene Liebe für den inneren Kern der Welt empfinden«.55
Letztlich wurden die griechischen Denkschulen durch ihre eigene innere Logik auf ein totes Gleis gefahren. Nach Platon und Aristoteles gab es bis auf einige Erweiterungen der Geometrie kaum mehr Neues. Als Rom die griechische Welt in sich eingliederte, begrüßte es die griechischen Denkschulen – ihre Gelehrten hatten den gleichen Erfolg unter der Republik wie unter Caesar.56 Auch im Byzantinischen Reich sollten die Denkschulen nicht untergehen, doch misslang ihnen hier erneut jede Innovation.57 Der Niedergang Roms behinderte die Ausbreitung des menschlichen Wissens nicht mehr als die »Genesung« des griechischen Denkens, die diesen Prozess wieder neu beginnen ließ. Das griechische Denken war ein Hindernis für den Aufstieg der Wissenschaft! Es führte weder die Griechen noch die Römer zu einem wissenschaftlichen Verständnis und erstickte zudem den intellektuellen Fortschritt im Islam, wo es ebenfalls sorgfältig studiert und aufrechterhalten wurde.
Der Islam
Man könnte denken, dass die Vorstellung, die sich der Islam von Gott macht, dem Aufstieg der Wissenschaft hätte günstig sein müssen. Aber so war es nicht.58 Allah wird nicht als gesetzgebender Schöpfer angesehen, sondern als ein extrem tatkräftiger Gott, der genau so weit in die Welt eindringt, wie er es für angemessen hält. Über diese Vorstellung entstand im Islam ein großer theologischer Block, der alle Versuche, Naturgesetze zu formulieren, als Blasphemie verurteilt, da sie ja Allahs Handlungsfreiheit leugnen würden. So machte der Islam sich nie wirklich die Idee zu eigen, dass das Universum auf bestimmten, von Gott zu Anfang festgelegten Grundprinzipien beruhe, sondern er glaubt vielmehr, dass Gott mittels seines Willens kontinuierlich auf die Welt einwirke. Als Beleg hierfür gilt eine Aussage des Korans: »Wen Allah will, leitet er irre, und wen er will, den führet er auf den rechten Pfad«. Obwohl die Zeile sich auf Gottes Beeinflussung individueller Schicksale bezieht, wurde sie zumeist so verstanden, als bezöge sie sich praktisch auf alle Dinge.
Wann immer es um islamische Wissenschaft und Bildung geht, betonen die meisten Historiker, dass das griechische Denken schon seit Jahrhunderten lebendiger Teil des Islams war, während es in der christlichen Welt noch lange nicht ankam. Das ist sicher richtig, nicht anders als der Umstand, dass etliche klassische Schriften das christliche Europa erst über den Kontakt mit dem Islam erreichten. Und doch hat der Besitz der griechischen Erkenntnisse zu keinem bedeutenden intellektuellen Fortschritt im Islam geführt, ganz zu schweigen von einer Entwicklung islamischer Wissenschaften. Stattdessen sahen muslimische Intellektuelle im griechischen Denken, zumal in den Arbeiten von Aristoteles, gewissermaßen eine heilige Schrift,59 der man vielmehr glaubte, als dass man sie auslotete.
Das griechische Denken unterband jede Möglichkeit eines Aufstiegs der islamischen Wissenschaft, und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem es selbst zum Stillstand kam: der Annahme von Thesen, die im fundamentalen Gegensatz zur Wissenschaft standen. Das Rasa’il Ichwan as-Safa
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























