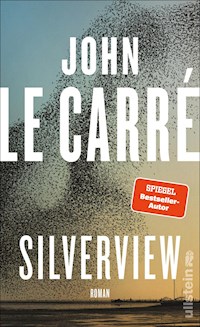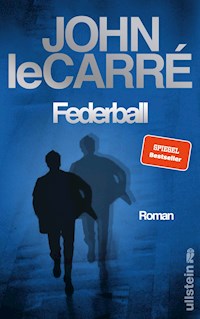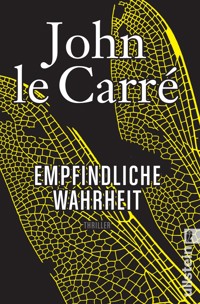13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
»Mitreißend, unterhaltsam und spannend wie einen Thriller erzählt le Carré in Der Taubentunnel sein Leben.« Eckart Baier, Buchjournal Was macht das Leben eines Schriftstellers aus? Mit dem Welterfolg Der Spion, der aus der Kälte kam gab es für John le Carré keinen Weg zurück. Er kündigte seine Stelle im diplomatischen Dienst, reiste zu Recherchezwecken um den halben Erdball — Afrika, Russland, Israel, USA, Deutschland —, traf die Mächtigen aus Politik- und Zeitgeschehen und ihre heimlichen Handlanger. John le Carré ist ein exzellenter und unabhängiger Beobachter, mit untrüglichem Gespür für Macht und Verrat. Aber auch für die komischen Seiten des weltpolitischen Spiels. In seinen Memoiren blickt er zurück auf sein Leben und sein Schreiben. Die Memoiren eines Jahrhundertautors Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Was macht das Leben eines Schriftstellers aus? Mit dem Welterfolg Der Spion, der aus der Kälte kam gab es für John le Carré keinen Weg zurück. Er kündigte seine Stelle im diplomatischen Dienst, reiste zu Recherchezwecken um den halben Erdball – Afrika, Russland, Israel, USA, Deutschland –, traf die Mächtigen aus Politik- und Zeitgeschehen und ihre heimlichen Handlanger. John le Carré ist bis heute ein exzellenter und unabhängiger Beobachter, mit untrüglichem Gespür für Macht und Verrat. Aber auch für die komischen Seiten des weltpolitischen Spiels. In seinen Memoiren blickt er zurück auf sein Leben und sein Schreiben.
Der Autor
John le Carré, 1931 geboren, studierte in Bern und Oxford. Er war Lehrer in Eton und arbeitete während des Kalten Kriegs kurze Zeit für den britischen Geheimdienst. Seit nunmehr fünfzig Jahren ist das Schreiben sein Beruf. Er lebt in London und Cornwall.
JOHN LE CARRÉ
Der Taubentunnel
GESCHICHTEN AUS MEINEM LEBEN
Aus dem Englischen von Peter Torberg
ULLSTEIN
Die Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel The Pigeon Tunnel
bei Viking, einem Imprint
von Penguin Random House UK, London
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1342-9
© 2016 by David Cornwell
© der deutschsprachigen Ausgabe
2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Umschlagfoto: Anton Corbijn
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Vorwort
Fast allen meinen Büchern habe ich irgendwann einmal den Arbeitstitel Der Taubentunnel gegeben. Wie es dazu kam, ist schnell erklärt. Ich war noch ein halbes Kind, als mein Vater beschloss, mich auf einen seiner Ausflüge nach Monte Carlo mitzunehmen, wo er seiner Spielleidenschaft frönte. In der Nähe des alten Casinos lag der Sportclub, und auf dessen Gelände gab es eine Schießanlage, die aufs Meer hinausging. Unter einer der Grünflächen waren parallel zueinander Rohre verlegt worden, die zur See hin an die Oberfläche führten. In diese Tunnel wurden nun Tauben geschickt, die auf dem Dach des Casinos ausgebrütet und dort in einem Schlag gehalten worden waren. Sie mussten durch den stockfinsteren Tunnel flattern, bis sie in den mediterranen Himmel aufstiegen, als Ziel für die Gentlemen, die zuvor gut gegessen hatten und nun stehend oder liegend mit ihren Schrotflinten warteten. Die Tauben, die nicht oder nur leicht getroffen waren, taten das, was Tauben im Allgemeinen tun. Sie kehrten in den Schlag auf dem Casinodach zurück, wo sie geschlüpft waren, und alles begann von neuem.
Warum dieses Bild mir nun schon so lange nachgeht, können Sie als Leser womöglich besser beurteilen, als ich es kann.
John le Carré, Januar 2016
Einleitung
Ich sitze an meinem Schreibtisch im Souterrain des kleinen Chalets, das ich mir mit den Erlösen aus meinem Buch Der Spion, der aus der Kälte kam in einem Bergdorf in der Schweiz gebaut habe. Es liegt neunzig Zugminuten entfernt von Bern, jener Stadt, in die ich mit sechzehn aus meiner englischen Privatschule floh und wo ich mich an der Universität einschrieb. An den Wochenenden strömten wir jungen Männer und Frauen ins Oberland hinauf, um in Berghütten zu kampieren und bis zum Umfallen Ski zu fahren. Soweit ich mich erinnere, waren wir die Bravheit in Person, die Studenten schliefen auf der einen Seite, die Studentinnen auf der anderen, und niemals kamen wir miteinander in Berührung. Falls doch, ich war jedenfalls nicht dabei.
Das Chalet befindet sich hoch über dem Dorf. Wenn ich den Kopf in den Nacken lege, sehe ich durch das Fenster die Berggipfel von Eiger, Mönch und Jungfrau weit über mir; am schönsten aber ist der Blick auf das Silberhorn und das Kleine Silberhorn in halber Höhe: zwei sich malerisch zuspitzende Eiskegel, die in regelmäßigen Abständen unter dem Föhnwind ergrauen, nur um Tage später wieder ihre hochzeitlich weiße Pracht anzulegen.
Zu unseren örtlichen Schutzpatronen zählen wir den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, dem man auf Schritt und Tritt begegnet – ja, es gibt auch einen Mendelssohn-Wanderweg –, Johann Wolfgang Goethe, auch wenn er es wohl nur bis zu den Wasserfällen im Lauterbrunnental geschafft haben dürfte, und Lord George Byron. Letzterer drang bis zur Wengernalp vor, die er furchtbar fand, und wetterte, der Anblick der von Stürmen verwüsteten Wälder »erinnerte mich an mich selbst und meine Familie«.
Besonders verehrt wird aber zweifellos Ernst Gertsch, der dem Dorf Ruhm und Reichtum brachte, als er 1930 das erste Lauberhornrennen veranstaltete und dort selbst den Slalom gewann. Ich war mal verrückt genug, an einem solchen Rennen teilzunehmen, und erlitt, wie nicht anders zu erwarten, aus Unvermögen und purer Angst eine Schlappe. Meinen Nachforschungen zufolge beließ es Gertsch nicht bei der Rolle als Vater dieses Skirennens, sondern erfand später die Stahlkanten an den Skiern und die Plattenbindung, wofür wir ihm alle dankbar sein sollten.
Es ist Mai, wir haben also in einer Woche das Wetter eines ganzen Jahres: gestern einen halben Meter Neuschnee, doch gab es nicht einen einzigen Skifahrer, der ihn hätte genießen können; heute klarer Himmel und eine sengende Sonne; der Schnee ist schon fast wieder geschmolzen, und die Frühlingsblumen melden sich zurück. Heute Abend wiederum marschierten paynesgraue Gewitterwolken das Lauterbrunnental hinauf wie einst Napoleons Grande Armée.
Ihnen wird sich wohl der Föhn anschließen, der uns in den letzten Tagen verschont hat, Himmel, Almen und Wälder werden alle Farbe verlieren, das Chalet knarzt und ruckelt, und der Qualm des Feuers zieht nicht ab, sondern quillt aus dem Kamin auf den Teppich, für den wir an einem regnerischen Nachmittag in Interlaken in jenem schneelosen Winter anno dazumal zu viel bezahlt haben; das Klappern und Hupen aus dem Tal hört sich an wie mürrische Protestrufe, und die Vögel können ihre Nester nicht verlassen, mit Ausnahme der Alpendohlen, die sich von nichts und niemandem etwas vorschreiben lassen. Fahren Sie bei Föhn nur ja nicht Auto, machen Sie niemals einen Heiratsantrag. Wenn Sie Kopfschmerzen haben oder gar den Drang verspüren, Ihren Nachbarn umzubringen, keine Sorge. Sie haben keinen üblen Kater, es liegt am Föhn.
Das kleine Chalet nimmt in meinem nun 84 Jahre währenden Leben einen Raum ein, der in keinem Verhältnis zu seiner realen Größe steht. In den Jahren vor seinem Bau kam ich als junger Mann in dieses Dorf, um im Winter auf Skiern aus Esche oder Hickory zu fahren, mit Seehundfellen unter den Brettern bergauf zu steigen und mit Lederbindungen wieder hinunterzugleiten, und um im Sommer mit Vivian Green, meinem weisen Ziehvater aus Oxford, durch die Berge zu wandern. Green, der spätere Rektor des Lincoln College, diente mir als Vorbild für das Seelenleben George Smileys.
Es ist also kein Zufall, dass Smiley seine Schweizer Alpen ebenso sehr liebte wie Vivian Green, dass er, wie Vivian, Trost in der Natur fand oder, wie ich, eine lebenslange, widersprüchliche Beziehung zur deutschen Muse hegte.
Vivian war es, der mein jugendliches Geschwafel über meinen unberechenbaren Vater Ronnie über sich ergehen ließ; und wenn mein Vater mal wieder eine seiner größeren Pleiten hinlegte, war er es, der das nötige Geld auftrieb und mich drängte, auf jeden Fall zu Ende zu studieren.
In Bern lernte ich den Nachkommen der ältesten Hoteliersfamilie im Oberland kennen. Ohne seinen Einfluss hätte ich später niemals die Erlaubnis erhalten, das Chalet überhaupt zu bauen, denn damals wie heute ist es Ausländern untersagt, auch nur das kleinste Fleckchen Land in meinem Dorf zu besitzen.
Meine allerersten Schritte im britischen Geheimdienst unternahm ich ebenfalls in Bern und überbrachte ich weiß nicht was ich weiß nicht wem. Heute frage ich mich manchmal, was wohl aus mir geworden wäre, wenn ich nicht aus der Privatschule weggelaufen wäre oder eine andere Himmelsrichtung eingeschlagen hätte. Heute kommt es mir so vor, als sei alles, was mir später im Leben widerfahren ist, aus dieser einen im jugendlichen Überschwang getroffenen Entscheidung erwachsen, England auf dem kürzesten Weg zu verlassen und die deutsche Muse als Ersatzmutter anzunehmen.
Ich war kein Schulversager, ganz im Gegenteil: Anführer in vielem, mit Schulpreisen ausgezeichnet, hatte ich das Zeug zum Vorzeigeschüler. Und der Ausstieg ging sehr diskret vonstatten. Ich tobte nicht, ich brüllte nicht herum. Ich sagte nur: »Vater, du kannst machen, was du willst, aber ich gehe nicht zurück.« Sehr wahrscheinlich gab ich der Schule – und England gleich dazu – die Schuld an meinem Kummer, dabei war mein eigentliches Motiv wohl, mich um jeden Preis dem Einfluss meines Vaters zu entziehen, aber das konnte ich ihm nicht ins Gesicht sagen. Seither habe ich die gleiche Erfahrung mit meinen eigenen Kindern gemacht, wenn sie auch sehr viel eleganter vorgingen und erheblich weniger Wirbel verursachten.
Das alles beantwortet aber noch lange nicht die zentrale Frage, welchen Verlauf mein Leben sonst genommen hätte. Wäre ich an einem anderen Ort als Bern jemals vom britischen Geheimdienst angeworben worden, um als Botenjunge das zu tun, was man in der Branche ›alles Mögliche‹ nennt? Ich hatte Somerset Maughams Ashenden damals noch nicht gelesen, aber ganz sicher Rudyard Kiplings Kim und jede Menge chauvinistischer Abenteuergeschichten von G. A. Henty und seinesgleichen. Dornford Yates, John Buchan und Rider Haggard waren über jeden Zweifel erhaben.
Natürlich war ich gerade mal vier Jahre nach Kriegsende der größte britische Patriot, den man sich nur vorstellen kann. In meiner Schulzeit hatten wir Jungen uns einen Sport daraus gemacht, in unseren Reihen deutsche Spione zu entdecken, und ich galt als guter Agent der Spionageabwehr. In der Privatschule dann blieb unser patriotischer Eifer ungebrochen. Zwei Mal in der Woche hatten wir »Corps«-Militärtraining in voller Montur. Unsere jungen Lehrer waren gebräunt aus dem Krieg heimgekehrt und trugen an den »Corps«-Tagen ihre Ordensbänder. Mein damaliger Deutschlehrer berichtete aus einem wunderbar geheimnisvollen Krieg. Unsere Berufsberater bereiteten uns auf den lebenslangen Einsatz auf weit entfernten Außenposten des britischen Königreichs vor. Die Abtei im Zentrum unserer Kleinstadt hing voller Regimentsfahnen, die in den Kolonialkriegen in Indien, Südafrika und dem Sudan zu Fetzen zerschossen und dann von liebevoller, weiblicher Hand zu altem Glanz zurückgeführt worden waren.
Es ist also nicht weiter überraschend, dass der siebzehnjährige englische Student, der an einer ausländischen Universität eine Gewichtsklasse über der eigenen boxte, strammstand und »Zu Ihren Diensten, Ma’am!« sagte, als ihn der Ruf in Gestalt einer eher mütterlichen Dreißigjährigen namens Wendy aus der Visaabteilung der britischen Botschaft in Bern ereilte.
Weniger einfach zu erklären ist meine völlige Hingabe an die deutsche Literatur, und das zu einer Zeit, als für viele Menschen schon allein das Wort Deutsch ein Synonym für das Böse an sich war. Doch wie schon die Flucht nach Bern, bestimmte auch diese Hingabe meinen weiteren Lebensweg. Ohne sie hätte ich Deutschland 1949 nicht auf Drängen meines geflohenen jüdischen Deutschlehrers besucht, nicht die dem Erdboden gleichgemachten Städte an der Ruhr gesehen oder hundeelend auf einer alten Wehrmachtsmatratze in einem deutschen Notlazarett in einem Berliner U-Bahnhof gelegen; ich hätte auch nicht die Konzentrationslager in Dachau und Bergen-Belsen aufgesucht, in denen der Gestank noch immer in den Baracken stand, um dann in die gelassene Beschaulichkeit Berns zurückzukehren, zurück zu meinem Thomas Mann und meinem Hermann Hesse. Ganz sicher hätte ich für meinen nationalen Sicherheitsdienst keine Spionageaufgaben im besetzten Österreich übernommen, weder hätte ich deutsche Literatur und Sprache in Oxford studiert und beides später in Eton unterrichtet, noch wäre ich unter dem Deckmantel eines angehenden Diplomaten an die britische Botschaft in Bonn versetzt worden, und ich hätte wohl auch keine Romane mit deutschen Themen geschrieben.
Die Früchte dieses frühen Versenkens in alles Deutsche habe ich nun klar vor Augen. So hatte ich mein ureigenes vielschichtiges Terrain zu beackern; es befeuerte meine unheilbar romantische Ader und meine Liebe zur Lyrik; es weckte in mir die Vorstellung, dass die Reise des Menschen von der Wiege bis zur Bahre die einer nicht endenden Wissensaneignung ist – nicht sonderlich originell und möglicherweise auch fragwürdig, aber so war es nun mal. Als ich dann die Dramen von Goethe, Lenz, Schiller, Kleist und Büchner studierte, fiel mir auf, dass ich ihre klassische Strenge und den neurotischen Überschwang ebenfalls sehr gut nachvollziehen konnte. Der Trick, so schien es mir, bestand darin, das eine hinter dem anderen zu verbergen.
Das Chalet ist nun bald fünfzig Jahre alt. Jeden Winter kamen die Kinder, als sie heranwuchsen, zum Skifahren her, und hier erlebten wir gemeinsam die schönsten Zeiten. Manchmal blieben wir bis in den Frühling. Hier war ich auch im Winter 1967, wenn ich mich recht erinnere, für vier höchst amüsante Wochen in Klausur mit Sydney Pollack (dem Regisseur von Tootsie, Jenseits von Afrika und – mein Lieblingsfilm von ihm – Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss), in denen wir ein Drehbuch nach meinem Roman Eine kleine Stadt in Deutschland zusammenzuzimmern versuchten.
In jenem Winter war der Schnee einfach perfekt. Sydney war noch nie Ski gefahren und noch nie in der Schweiz gewesen. Der Anblick der fröhlichen Skifahrer, die ganz lässig an unserem Balkon vorbeisausten, war unwiderstehlich. Er musste es selbst versuchen, und zwar auf der Stelle. Er wollte, dass ich es ihm beibrachte, doch Gott sei Dank rief ich stattdessen Martin Epp an: Skilehrer, legendärer Bergführer, einer der wenigen, die die Eiger-Nordwand allein bezwungen haben.
Der berühmte Filmregisseur aus Southbend, Indiana, und der berühmte Bergsteiger aus Arosa verstanden sich auf Anhieb. Sydney tat nichts halbherzig. Nach wenigen Tagen war er bereits ein ordentlicher Skifahrer. Schnell erwachte in ihm auch der Wunsch, einen Film über Martin Epp zu drehen, was seine ursprüngliche Idee, Eine kleine Stadt in Deutschland zu verfilmen, bald überlagerte. Der Eiger selbst sollte Schicksal spielen. Ich sollte das Drehbuch schreiben, Martin würde sich selbst spielen, und Sydney würde ihn, auf halber Höhe des Eiger abgeseilt, selbst filmen. Er rief seinen Agenten an und erzählte ihm von Epp. Er rief seinen Analysten an und erzählte ihm von Epp. Die Schneeverhältnisse blieben weiter so perfekt, und Sydney verausgabte sich beim Skifahren. Wir entschieden, die beste Zeit zum Schreiben sei abends nach einem Bad. Ob das nun stimmte, sei dahingestellt, jedenfalls wurde keiner der beiden Filme jemals gedreht.
Später überließ Sydney für mich etwas überraschend das Chalet Robert Redford, der Erkundungen für seinen Film Schussfahrt anstellen wollte. Leider lernte ich ihn nie kennen, doch eilte mir einige Jahre lang bei jedem Besuch im Dorf der Ruf voraus, mit Robert Redford befreundet zu sein.
Ich werde Ihnen in diesem Buch wahre Geschichten nach meiner Erinnerung erzählen, so wie diese – Sie können also mit Fug und Recht fragen, was ist für einen Schriftsteller an seinem Lebensabend, um es taktvoll auszudrücken, denn Wahrheit, was Erinnerung? Für den Juristen besteht die Wahrheit aus ungeschminkten Tatsachen. Ob sich solche Tatsachen jemals finden lassen, ist eine andere Frage. Für den Schriftsteller sind Fakten das Rohmaterial, nicht sein Lehrmeister, sondern sein Instrument, und seine Aufgabe besteht darin, dieses Instrument zum Klingen zu bringen. Die eigentliche Wahrheit ist, wenn überhaupt, nicht schwarz oder weiß, sondern verbirgt sich in den Nuancen.
Hat es jemals so etwas wie ein absolutes Gedächtnis gegeben? Ich bezweifle es. Selbst wenn wir uns einreden, wir seien unvoreingenommen und würden uns nur an die nackten Tatsachen halten, ohne diese zum eigenen Vorteil zu schönen oder etwas auszulassen, ist so etwas wie das absolute Gedächtnis so schlecht zu packen wie ein Stück nasser Seife. Zumindest gilt das für mich, schließlich habe ich mein ganzes Leben damit verbracht, Erfahrungen mit Erfundenem zu mischen.
Hier und da, wo es mir sinnvoll erschien, habe ich Gesprächsfetzen oder Auszüge aus Zeitungsartikeln übernommen, die ich vor langer Zeit geschrieben habe, weil ihre Frische mir gefällt und mir das Gedächtnis nichts Vergleichbares liefern konnte; wie zum Beispiel meine Beschreibung von Wadim Bakatin, dem ehemaligen Chef des KGB. In anderen Fällen habe ich einen Artikel fast so belassen, wie ich ihn damals geschrieben habe, ihn nur hier und da überarbeitet und ab und zu eine Bemerkung angefügt, um mich klarer auszudrücken oder etwas auf den neuesten Stand zu bringen.
Ich setze bei meinem Leser keine große Kenntnis meiner Romane voraus – eigentlich gar keine, um ehrlich zu sein, deshalb findet sich unterwegs der eine oder andere erklärende Abschnitt. Doch auf eines können Sie sich verlassen: An keiner Stelle habe ich bewusst ein Ereignis oder eine Geschichte verfälscht. Verschleiert, wenn nötig. Verfälscht, auf gar keinen Fall. Und wo immer meine Erinnerung mich trügen könnte, räume ich dies auch ein. Eine vor kurzem veröffentlichte Biographie über mich widmet sich kurz ein, zwei der Geschichten, die auch in diesem Buch vorkommen. Es war mir, ehrlich gesagt, ein Vergnügen, sie selbst zu erzählen und sie, so gut ich kann, mit meinen eigenen Empfindungen auszustatten.
Manche Geschichten haben mit den Jahren eine Bedeutung bekommen, die mir in ihrer Zeit nicht bewusst war, zum Beispiel durch den Tod eines der Beteiligten. Mein ganzes langes Leben lang habe ich kein Tagebuch geführt, sondern mir nur hier und da Reisenotizen gemacht oder unwiederbringliche Zeilen aus Gesprächen notiert, wie zum Beispiel in meinen Tagen mit Jassir Arafat, dem Vorsitzenden der PLO, vor seiner Ausweisung aus dem Libanon; später dann auch von meinem ergebnislosen Besuch in seinem weißen Hotel in Tunis. Mehrere Mitglieder seines Oberkommandos, die ein paar Meilen entfernt von ihm in dieser Stadt einquartiert waren, wurden ein paar Wochen nach meiner Abreise von einem israelischen Kommando ermordet.
Einflussreiche Männer und Frauen haben mich angezogen, weil ich wissen wollte, wie sie tickten. In ihrer Gegenwart jedoch scheine ich, im Nachhinein betrachtet, nur weise genickt, den Kopf an den richtigen Stellen geschüttelt und ein, zwei witzige Bemerkungen gemacht zu haben, um die Atmosphäre aufzulockern. Erst hinterher, wieder zurück in meinem Hotelzimmer, habe ich meinen übel zugerichteten Notizblock hervorgeholt und versucht zu verstehen, was ich gehört und gesehen hatte.
Alles andere hastig Hingeschriebene, das von meinen Reisen übriggeblieben ist, stammt größtenteils nicht von mir, sondern von meinen Romanfiguren, die ich zum Schutz mitgenommen hatte, als ich mich in die Welt hinauswagte. Diese Notizen erzählen ihre Sicht der Dinge, nicht meine, in ihren Worten. Als ich mich in einem Unterstand am Mekong zusammenkauerte und zum ersten Mal hörte, wie die Kugeln in das schlammige Ufer über mir einschlugen, da war es nicht meine zitternde Hand, die meine Entrüstung darüber einem zerschlissenen Notizbuch anvertraute, sondern die Hand meines mutigen fiktiven Helden, des Sportberichterstatters Jerry Westerby, für den es zum Alltag gehörte, beschossen zu werden. Ich dachte erst, ich sei da anders als andere, bis ich einen gefeierten Kriegsfotografen kennenlernte, der mir gestand, dass seine Riesenangst erst dann verschwand, wenn er durch den Sucher seiner Kamera schaute.
Ich persönlich wurde meine Riesenangst nie los. Aber ich weiß, was er meinte.
Falls Sie jemals das Glück haben, recht früh in Ihrer Karriere als Schriftsteller einen Erfolg zu landen, wie mir das mit Der Spion, der aus der Kälte kam gelang, dann wird es für den Rest Ihres Lebens ein Vorher und ein Nachher geben. Schauen Sie auf die Bücher zurück, die Sie geschrieben haben, bevor die Suchscheinwerfer Sie erfasst haben, dann lesen sie sich wie Bücher aus den Tagen der Unschuld, die Bücher danach jedoch wie die Bemühungen eines Mannes im Rampenlicht. »Allzu bemüht«, schreien die Kritiker dann. Ich fand nie, dass ich mich allzu sehr bemüht hätte. Ich dachte, ich sei es meinem Erfolg schuldig, das Beste zu geben, und im Großen und Ganzen tat ich das auch, ganz gleich, wie gut oder schlecht das Beste nun war.
Und ich liebe das Schreiben. Ich liebe zu tun, was ich gerade tue: wie jemand, der untergetaucht ist, früh an einem wolkenverhangenen Maimorgen an einem winzigen Schreibtisch zu sitzen und vor mich hin zu kritzeln, während der Bergregen am Fenster hinunterströmt und es keinen Grund gibt, mit dem Regenschirm zur Bahnstation hinunterzustapfen, denn die International New York Times trifft erst gegen Mittag ein.
Ich liebe es, unterwegs in Notizbücher zu schreiben, beim Wandern, in Eisenbahnen und Cafés, um dann nach Hause zu eilen und meine Beute durchzusehen. Bin ich in Hampstead Heath, dann ist mir eine bestimmte Bank unter einem ausladenden Baum auf der Heide die liebste, abseits der anderen Bäume, und dort schreibe ich auch wirklich gern. Und immer mit der Hand. Es mag etwas arrogant wirken, aber ich ziehe es vor, der jahrhundertealten Tradition des Schreibens mit Stift und Papier treu zu bleiben. Der verkümmerte grafische Künstler in mir hat sein Vergnügen daran, die Wörter zu zeichnen.
Am Schreiben liebe ich es vor allem, ungestört zu sein, deshalb trete ich nicht auf Literaturfestivals auf und halte mich so weit wie möglich von Interviews fern, auch wenn es anders scheinen mag. Es gibt Augenblicke, meist in der Nacht, da wünschte ich mir, ich hätte nie ein Interview gegeben. Erst erfindet man sich selbst, dann glaubt man an die eigene Erfindung. Dieser Vorgang ist mit Selbsterkenntnis nicht vereinbar.
Dass ich im richtigen Leben einen anderen Namen trage, schützt mich ein wenig bei meinen Recherchen. Ich kann ein Hotelzimmer buchen, ohne mir Sorgen darum machen zu müssen, ob jemand meinen Namen kennt. Und wenn nicht, muss ich mich auch nicht darum sorgen, warum nicht. Wenn ich jedoch gezwungen bin, mich denjenigen gegenüber zu offenbaren, an deren Erfahrungen ich teilhaben möchte, fallen die Reaktionen ganz unterschiedlich aus. Der eine traut mir nicht mehr über den Weg, der Nächste befördert mich zum Geheimdienstchef, und wenn ich beteuere, dass ich niemals über die niedrigste Lebensform in der Welt der Spionage hinausgekommen bin, erwidert er, dass ich ja wohl nichts anderes sagen könne, nicht wahr? Nur um mir gleich darauf Vertraulichkeiten aufzunötigen, an denen mir nicht gelegen ist, die ich nicht brauchen und auch nicht behalten kann, und das nur aufgrund der falschen Annahme, dass ich diese Vertraulichkeiten an, na, Sie wissen schon wen, weitergeben werde. Ich habe mich auch an anderer Stelle über dieses halb ernste, halb komische Dilemma ausgelassen.
Die Mehrheit jener armen Seelen aber, die ich im Laufe der letzten fünfzig Jahre mit meinen Fragen bombardiert habe – von Führungskräften der pharmazeutischen Industrie auf mittlerer Ebene bis hin zu Bankern, Söldnern und mancherlei Arten von Spionen –, waren nachsichtig mit mir und haben Großmut bewiesen. Die Großmütigsten unter ihnen waren die Kriegsberichterstatter und Auslandskorrespondenten, die den von ihnen profitierenden Schriftsteller unter ihre Fittiche nahmen, die ihn für mutig hielten, obwohl er es nicht war, und ihm erlaubten, sich ihnen anzuschließen.
Undenkbar, dass meine Streifzüge durch Südostasien und den Nahen Osten jemals ohne den Rat und die Gesellschaft von David Greenway möglich gewesen wären, dem hochdekorierten Südostasienkorrespondenten von Time Magazine, Washington Post und Boston Globe. Für einen schüchternen Anfänger hätte es keinen besseren Leitstern geben können. An einem verschneiten Vormittag im Jahr 1975 saß Greenway an unserem Frühstückstisch hier im Chalet und gönnte sich eine kurze Atempause von der Front, als sein Büro in Washington anrief und ihm mitteilte, dass das belagerte Phnom Penh bald den Roten Khmer in die Hände fallen würde. Von unserem Dorf aus führt keine Straße ins Tal, nur eine kleine Eisenbahn, die einen zu einer größeren Eisenbahn bringt, die einen zu einer noch größeren bringt, und so zum Flughafen Zürich. Im Handumdrehen hatte Greenway seine alpine Bekleidung aus- und den schäbigen Drillich des Kriegsberichterstatters angezogen und war in alte Wildlederschuhe geschlüpft; seiner Frau und seinen Töchtern gab er einen Abschiedskuss und stürmte den Hügel hinunter zur Bahnstation. Ich stürmte mit seinem Reisepass hinterher.
Wie allgemein bekannt, gehörte Greenway zu den letzten amerikanischen Journalisten, die vom Dach der belagerten US-Botschaft in Phnom Penh ausgeflogen wurden. Als ich 1981 an der Allenby-Brücke, die die West Bank mit Jordanien verbindet, an Ruhr erkrankte, schleppte mich Greenway durch die Masse der ungeduldigen Reisenden, die darauf warteten, abgefertigt zu werden, redete uns mit schierer Willenskraft durch die Kontrollen und brachte mich über die Brücke.
Jetzt, da ich einige der Episoden erneut durchlese, fällt mir auf, dass ich entweder aus Egoismus oder um einer pointierteren Story willen nicht erwähnt habe, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt noch im Raum befand.
Ich denke da an meine Unterhaltung mit dem russischen Physiker und politischen Gefangenen Andrei Sacharow und seiner Frau Jelena Bonner, die in einem Restaurant im damals noch so genannten Leningrad unter der Schirmherrschaft von Human Rights Watch stattfand; drei Mitglieder dieser Organisation saßen mit uns am Tisch und litten wie wir unter den kindischen Aufdringlichkeiten der Horde falscher KGB-Fotografen, die uns umringten und ihre altmodischen Kameras mit ihren Blitzlichtern auf uns richteten. Ich hoffe nur, dass auch andere Teilnehmer dieser Gesellschaft ihre eigenen Darstellungen jenes historischen Tags verfasst haben.
Ich denke an Nicholas Elliott, den langjährigen Freund und Kollegen des Doppelagenten Kim Philby. Mit einem Glas Brandy in der Hand stapfte Elliott durch das Wohnzimmer unseres Londoner Hauses, und mir fällt zu spät ein, dass meine Frau ebenfalls anwesend war, mir in einem Sessel gegenübersaß und ebenso fasziniert war wie ich.
Und während ich dies schreibe, fällt mir auch jener Nachmittag wieder ein, als Elliott mit seiner Frau Elizabeth zum Diner kam und wir einen gerngesehenen iranischen Gast hatten, der ein makelloses Englisch mit einem winzigen, ja eher vorteilhaften Sprachfehler sprach. Als unser iranischer Gast sich verabschiedete, drehte sich Elizabeth mit strahlenden Augen zu Nicholas um und sagte aufgeregt: »Hast du sein Stottern bemerkt, Liebling? Genau wie Kim!«
Das lange Kapitel über meinen Vater Ronnie kommt ans Ende des Buchs, nicht an den Anfang, denn sosehr er sich das auch wünschen würde, möchte ich doch nicht, dass er zu einer der Hauptattraktionen wird. Trotz der vielen Stunden, die ich mich in Gedanken mit ihm abgequält habe, bleibt er mir immer noch genauso ein Rätsel wie meine Mutter. Alle Geschichten sind nagelneu, mit wenigen Ausnahmen, auf die ich hinweise. Falls ich es notwendig fand, habe ich einen Namen geändert. Der Hauptakteur mag zwar schon verstorben sein, doch verstehen seine Erben und Rechtsnachfolger vielleicht die Pointe nicht. Ich habe versucht, einen ordentlichen Pfad durch mein Leben zu schlagen, wenn schon nicht chronologisch, dann zumindest thematisch, doch wie das Leben so spielt, verzweigte sich der Pfad in alle möglichen unvorhergesehenen Richtungen, so dass einzelne Geschichten zu dem wurden, was sie für mich immer waren: eigenständige Episoden, die sich selbst genug sind und in keinerlei mir erkennbare Richtung weisen; ich erzähle sie wegen der Bedeutung, die sie für mich gewonnen haben, weil sie mich erschrecken oder ängstigen, mich anrühren oder mitten in der Nacht wecken und zum Lachen bringen.
Mit fortschreitender Zeit haben einige der Begegnungen, die ich beschreibe, den Status von winzigen, in flagranti eingefangenen historischen Momenten angenommen, wie das wohl bei allen älteren Menschen der Fall sein dürfte. Wenn ich von den Begegnungen so als Ganzes lese, wie sie von Posse zu Tragödie wechseln und zurück, fällt mir auf, dass ich sie etwas zu unbekümmert finde, bin mir aber nicht sicher, warum. Vielleicht ist es mein Leben, das ich zu unbekümmert finde. Doch es ist zu spät, um daran noch etwas zu ändern.
So wie bei jedem anderen Menschen auch, gibt es viele Dinge im Leben, über die ich niemals schreiben werde. Ich hatte zwei ungeheuer loyale und hingebungsvolle Ehefrauen, beiden gebührt unendlicher Dank und so manche Entschuldigung. Ich war weder ein Mustergatte noch ein Traumvater, und ich bin auch nicht daran interessiert, mich als solche auszugeben. Die Liebe kam, nach vielen Fehltritten, erst spät zu mir. Meine moralische Erziehung verdanke ich meinen vier Söhnen. Über meine Arbeit beim britischen Geheimdienst, die ich zumeist in Deutschland geleistet habe, möchte ich dem, was andere ungenau an anderer Stelle berichtet haben, nichts hinzufügen. Ich bin durch Reste altmodischer Loyalität meinen früheren Diensten gegenüber ebenso gebunden wie durch Vereinbarungen, getroffen mit den Männern und Frauen, die mit mir zusammengearbeitet haben. Unsere Übereinkunft lautete, dass die Verschwiegenheit zeitlich unbegrenzt ist und auch unsere Kinder überdauern sollte. Die Arbeit, die wir leisteten, war weder gefährlich noch dramatisch, verlangte aber von uns, die sich dazu verpflichteten, schmerzhafte Gewissenserforschung. Ganz gleich, ob diese Personen heute noch leben oder nicht, die Vertraulichkeit gilt nach wie vor.
Spionieren wurde mir von Geburt an wohl auf ähnliche Weise aufgezwungen, nehme ich an, wie C. S. Forester das Meer oder Paul Scott Indien. Ich habe versucht, die geheime Welt, die ich einmal kannte, zur Bühne für die größere Welt zu machen, die uns allen vertraut ist. Erst stelle ich mir etwas vor, dann suche ich nach der darin enthaltenen Wirklichkeit. Dann geht es wieder zurück zur Vorstellungskraft und an den Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze.
1
Seien Sie nett zu Ihrem Geheimdienst
»Ich weiß, was Sie sind«, ruft Denis Healey. Mit ausgestreckter Hand kommt der ehemalige Verteidigungsminister der Labour Party bei einer privaten Gesellschaft auf mich zu. »Sie sind ein kommunistischer Spion, ja, das sind Sie, geben Sie’s zu.«
Also gebe ich es zu, ganz der nette Kerl, der in solchen Situationen alles zugeben würde. Alle lachen, mein leicht pikierter Gastgeber ebenfalls. Ich lache mit, denn ich bin ein netter Kerl und kann einstecken wie jeder andere auch, und Denis Healey ist vielleicht ein großes Tier in der Labour Party und ein ziemlicher Streithammel, wenn es um Politik geht, aber er ist außerdem ein bedeutender Gelehrter und Humanist, ich bewundere ihn, und er ist mir ein paar Drinks voraus.
»Cornwell, Sie Mistkerl«, brüllt ein MI6-Agent, ein ehemaliger Kollege von mir, quer durch den Raum, in dem sich eine ganze Gruppe von Washingtoner Insidern zu einem diplomatischen Empfang des britischen Botschafters versammelt. »Sie verfluchter Mistkerl.« Er hat nicht damit gerechnet, mir zu begegnen, doch nun nutzt er diese Gelegenheit, um mir zu sagen, was er davon hält, dass ich die Ehre des Dienstes – unseres verfluchten Geheimdienstes, verflucht noch mal! – beleidigt und Männer und Frauen zu Narren gemacht habe, die ihr Land lieben und sich nicht wehren können. Er steht vor mir in der gebeugten Haltung eines Mannes, der gleich zuschlagen wird, und wenn ihn diplomatische Hände nicht sanft gebremst hätten, dann wäre die Szene ein gefundenes Fressen für die Morgenzeitungen geworden.
Das Cocktailgeplauder nimmt langsam wieder Fahrt auf. Inzwischen habe ich allerdings noch herausgefunden, dass es sich bei dem Buch, das meinem ehemaligen Kollegen so unter die Haut ging, nicht um Der Spion, der aus der Kälte kam handelte, sondern um das nachfolgende Krieg im Spiegel, eine trostlose Geschichte über einen britisch-polnischen Agenten, der auf eine Mission nach Ostdeutschland geschickt und dort seinem Schicksal überlassen wird. Unglücklicherweise gehörte Ostdeutschland in den Tagen, als mein aufgebrachter Bekannter und ich zusammengearbeitet haben, zu seinem Gebiet. Ich würde ihm gerne erzählen, dass Allen Dulles, bis vor kurzem noch Direktor der CIA, erklärt hat, das Buch käme der Wirklichkeit erheblich näher als das vorangegangene, doch fürchte ich, dass es ihn nicht unbedingt beruhigen würde.
»Was, herzlos sind wir? Herzlos und inkompetent? Na, vielen Dank!«
Mein zorniger Exkollege befindet sich mit seiner Kritik in bester Gesellschaft. In den letzten fünfzig Jahren habe ich mir denselben Vorwurf immer wieder anhören müssen, wenn auch in weniger heftigen Worten, nicht bösartig gemeint und schon gar nicht als Teil einer Strategie, sondern eher im wiederkehrenden Tonfall verletzter Männer und Frauen, die von der Notwendigkeit ihrer Arbeit überzeugt sind.
»Warum hacken Sie auf uns herum? Sie wissen doch, wie wir in Wirklichkeit sind.« Oder auch gehässiger: »Jetzt, wo Sie einen Haufen Geld mit uns gemacht haben, könnten Sie uns ja mal eine Weile in Ruhe lassen.«
Und selten fehlte der mit Armesündermiene vorgebrachte Hinweis, dass der Geheimdienst ja nicht darauf reagieren und sich gegen Verleumdungen wehren könne; dass für seine Erfolge keine Lobeshymnen zu erwarten seien, dass nur seine Misserfolge ans Licht kämen.
»Wir sind ganz gewiss nicht so, wie unser Gastgeber hier uns beschreibt«, wendet sich Sir Maurice Oldfield beim Lunch mit aller Entschiedenheit an Sir Alec Guinness.
Oldfield ist ein ehemaliger Generaldirektor des Secret Service, der später von Margaret Thatcher fallengelassen wurde; zum Zeitpunkt unserer Begegnung ist er allerdings nichts weiter als ein Spion im Ruhestand.
»Ich wollte Sir Alec schon immer mal kennenlernen«, erklärte er mir in seinem einnehmenden nordenglischen Akzent, als ich ihn einlud. »Wir saßen uns einmal im Zug von Winchester gegenüber. Ich habe nicht den Mut aufgebracht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.«
Guinness wird meinen Geheimagenten George Smiley in der BBC-Fernsehbearbeitung von Dame, König, As, Spion spielen und möchte gerne einmal einen echten alten Spion treffen. Leider verläuft der Lunch nicht so glatt, wie ich gehofft hatte. Bei den Hors d’œuvres rühmt Oldfield den Ehrenkodex seines alten Geheimdienstes und deutet auf die denkbar freundlichste Weise an, dass der »junge Mann hier« dessen guten Namen besudelt hat. Guinness, ehemaliger Marineoffizier, der sich vom ersten Augenblick dieses Treffens mit Oldfield eher den oberen Rängen des Secret Service verpflichtet fühlt, kann nur weise den Kopf schütteln und ihm beipflichten. Bei der Seezunge geht Oldfield noch einen Schritt weiter:
»Der junge Mann hier und seinesgleichen«, verkündet er Guinness quer über den Tisch, während er mich wie Luft behandelt, »sie sind es, die es dem Service so schwer machen, Quellen anzuzapfen und anständige Leute zu rekrutieren. Die lesen seine Bücher und sind abgeschreckt. Kann man ja verstehen.« Woraufhin Guinness den Blick senkt und wieder missbilligend den Kopf schüttelt, indessen begleiche ich schon mal die Rechnung.
»Sie sollten dem Athenaeum Club beitreten, David«, sagt Oldfield freundlich und will wohl andeuten, dass der Athenaeum Club mich irgendwie zu einem besseren Menschen machen könnte. »Ich werde Sie vorschlagen. Also gut. Das würde Ihnen doch sicher gefallen?« Und zu Guinness gewandt, als wir drei im Eingang des Restaurants stehen: »Es war mir ein Vergnügen, Alec. Eine Ehre, wirklich. Wir hören voneinander, schon bald, da bin ich mir sicher.«
»Ganz sicher«, erwidert Guinness ergebenst, und die beiden alten Spione schütteln sich die Hand.
Guinness hat offenbar noch nicht genug von unserem entschwindenden Gast und sieht Oldfield liebevoll hinterher, wie er über den Bürgersteig davonstapft: ein kleiner, energischer Mann voller Entschiedenheit, der mit nach vorn gerecktem Regenschirm ausschreitet und in der Menge verschwindet.
»Wie wär’s noch mit einem letzten Cognac?«, schlägt Guinness vor; wir haben kaum unsere Plätze wieder eingenommen, als das Verhör schon beginnt: »Diese äußerst vulgären Manschettenknöpfe. Tragen alle unsere Spione so etwas?«
Nein, Alec, ich nehme an, Maurice mag einfach vulgäre Manschettenknöpfe.
»Und diese schrillen orangefarbenen Wildlederschuhe mit den Kreppsohlen. Zur Tarnung?«
Ich schätze, die trägt er nur, weil sie bequem sind, Alec. Kreppsohlen quietschen.
»Dann verraten Sie mir doch eins.« Guinness nimmt sich ein leeres Whiskeyglas. Er kippt es ein wenig und tippt mit seiner breiten Fingerspitze dagegen. »Ich habe schon Leute gesehen, die so machen« – er schaut versunken ins Glas und tippt weiter dagegen – »und so« – jetzt streicht er mit ungebrochener Hingabe mit dem Finger um den Glasrand herum. »Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so etwas tut« – er steckt den Finger ins Glas und fährt an der Innenseite entlang. »Glauben Sie, dass er nach Spuren von Gift sucht?«
Meint Sir Alec das ernst? Aber ja, das Kind im Mann meint es todernst. Nun, wenn er nach Giftspuren suchte, dann hat er das Gift allerdings schon vorher getrunken, deute ich an. Doch darauf geht Guinness gar nicht erst ein.
Es gehört zum Anekdotenschatz der Unterhaltungsbranche, dass Oldfields Wildlederschuhe, ob nun mit Kreppsohle oder ohne, und sein zusammengefalteter, nach vorn gereckter Regenschirm, mit dem er sich seinen Weg bahnt, wesentliche Elemente der Ausstattung von Guinness wurden, als er George Smiley darstellte, den alten Spion, der es eilig hat. Die Manschettenknöpfe habe ich nicht kontrolliert, aber wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dann fand unser Regisseur sie ein wenig zu protzig und überredete Guinness dazu, sie gegen etwas weniger Auffälliges einzutauschen.
Ein anderes Ergebnis unserer Mahlzeit war weniger erfreulich, wenn auch künstlerisch ergiebiger. Oldfields Abneigung gegen meine Arbeit – und wie ich fürchte, auch mich persönlich – grub sich tief in Guinness’ Schauspielerseele ein, und er war sich nicht zu schade, mich, wann immer ihm danach war, daran zu erinnern, indem er mir George Smileys persönliche Schuldgefühle vorhielt; er sah in ihnen wohl, wie er gern andeutete, meine eigenen.
* Mein Dank gilt hier Christopher Andrews ›Secret Service‹, William Heinemann, 1985.
In den letzten hundert und mehr Jahren haben unsere britischen Spione eine verzweifelte und manchmal urkomische Hassliebe zu ihren aufsässigen Romanautoren gehegt. Genau wie die Autoren hüten sie ihr Image und wünschen sich Ruhm, aber wehe, jemand mutet ihnen zu, Spott oder negative Kritik zu ertragen. In den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts schürten Spionageschriftsteller wie Erskine Childers, William Le Queux und E. Phillips Oppenheim einen derart antideutschen Hass, dass sie wohl durchaus zu Recht für sich beanspruchen können, bei der Geburt eines etablierten Geheimdienstes geholfen zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt lasen Gentlemen angeblich nicht die Post anderer Gentlemen; in Wirklichkeit taten genau das aber viele Gentlemen. Während des Ersten Weltkriegs tauchte der Schriftsteller Somerset Maugham als britischer Geheimagent auf, wenn er auch den meisten Darstellungen zufolge kein sehr guter war. Als Winston Churchill klagte, dass Maughams Agent Ashenden gegen den Official Secrets Act* verstoßen würde, verbrannte Maugham, über dem zudem noch das Damoklesschwert eines Skandals wegen seiner Homosexualität schwebte, vierzehn unveröffentlichte Kurzgeschichten und hielt die Veröffentlichung aller anderen bis 1928 zurück.
Compton Mackenzie, Schriftsteller, Biograph und schottischer Nationalist, war nicht so leicht einzuschüchtern. Nachdem er wegen einer Kriegsverletzung im Ersten Weltkrieg ausgemustert worden war, wechselte er zum MI6 und wurde zum fähigen Leiter der britischen Gegenspionage im neutralen Griechenland. Allerdings fand er seine Befehle und Vorgesetzten allzu oft absurd und nutzte sie, sich einen Spaß mit ihnen zu machen, wie Schriftsteller das nun mal gerne tun. 1932 wurde er nach dem Official Secrets Act für seine autobiographischen Greek Memories zu einer Geldstrafe von hundert Pfund verurteilt; in der Tat war das Buch gespickt mit ungeheuerlichen Indiskretionen. Statt etwas daraus zu lernen, nahm er ein Jahr später mit dem satirischen Roman Water on the Brain Rache. Ich habe mir erzählen lassen, dass es in Mackenzies Akte beim MI5 einen in riesigen Buchstaben getippten Brief gibt, der an den Director General adressiert und mit der traditionellen grünen Tinte des Geheimdienstchefs unterzeichnet ist:
* Diese Korrespondenzen begannen üblicherweise mit einem dreistelligen Zahlencode für die jeweilige MI6-Station, gefolgt von einer Zahl für den betreffenden Dienstangehörigen.
»Am schlimmsten aber ist«, schreibt der Chef an seine Waffenbrüder auf der anderen Seite des St. James’ Parks, »dass Mackenzie doch tatsächlich jene Symbole verraten hat, die in der Korrespondenz des Geheimdienstes* angewendet werden und zum Teil noch immer in Gebrauch sind.« Mackenzies Geist wird sich die Hände vor diebischer Freude reiben.
Der eindrucksvollste aller literarischen Überläufer des MI6 ist aber sicherlich Graham Greene, auch wenn ich bezweifle, ob er wirklich wusste, dass er fast wie Mackenzie vor Gericht gelandet wäre. Eine meiner schönsten Erinnerungen an die späten 50er Jahre dreht sich darum, wie ich einen Kaffee mit dem Anwalt des MI5 in der ausgezeichneten Kantine des Security Service trinke. Der Mann war ein gutmütiger Pfeifenraucher, mehr Familienanwalt denn Bürokrat, doch an jenem Vormittag wirkte er äußerst aufgewühlt. Ein Vorabexemplar von Unser Mann in Havanna war auf seinem Schreibtisch gelandet, und er hatte es schon zur Hälfte gelesen. Ich meinte, ich würde ihn darum beneiden, doch er seufzte nur und schüttelte den Kopf. Man werde diesen Greene, behauptete er, strafrechtlich verfolgen müssen. Er habe Informationen, die er als Beamter des MI6 während des Krieges erhalten habe, dazu verwendet, die Beziehungen zwischen einem Geheimdienstchef an einer britischen Botschaft und einem Außenagenten darzustellen. Dafür werde er ins Gefängnis wandern.
»Dabei ist es ein gutes Buch«, klagte er. »Ein verflixt gutes Buch. Das ist ja das Problem.«
Ich durchforstete die Zeitungen nach Meldungen von Greenes Verhaftung, doch er blieb auf freiem Fuß. Vielleicht hatten die Granden des MI5 beschlossen, dass es besser sei zu lachen, statt zu weinen. Für diese Nachsicht belohnte Greene sie zwanzig Jahre später mit Der menschliche Faktor, da werden sie einmal nicht als Trottel dargestellt, sondern als Mörder. Doch der MI6 muss ihm einen Schuss vor den Bug verpasst haben. Im Vorwort zu Der menschliche Faktor versichert Greene ausdrücklich, dass er nicht gegen den Official Secrets Act verstoßen habe. Wenn Sie eine neuere Ausgabe von Unser Mann in Havanna aufschlagen, finden Sie dort eine ähnliche Erklärung.
Doch die Geschichte legt nahe, dass uns unsere Sünden eines Tages vergeben werden. Mackenzie wurde am Ende zum Ritter geschlagen, Greene erhielt den Order of Merit.
»In Ihrem neuen Roman, Sir«, fragte mich ein eifriger amerikanischer Journalist, »taucht ein Mann auf, der über Ihre Hauptfigur sagt, er wäre kein Verräter geworden, hätte er schreiben können. Würden Sie mir bitte verraten, was aus Ihnen geworden wäre, hätten Sie nicht schreiben können?«
Während ich nach einer unverfänglichen Antwort auf diese gefährliche Frage suche, überlege ich, ob unsere Geheimdienste nicht eigentlich froh über ihre literarischen Deserteure sein sollten. Im Vergleich zu dem Radau, den wir vielleicht mit anderen Mitteln geschlagen hätten, ist die Schriftstellerei doch so harmlos, als würden wir mit Bauklötzen spielen. Wie sehr sich unsere armen überlasteten Spione wohl wünschen, dass Edward Snowden es vorgezogen hätte, einen Roman zu schreiben.
Was hätte ich also bei der Diplomatenparty meinem wutentbrannten Exkollegen antworten sollen, als er mich anstarrte, als wolle er mich gleich zu Boden schlagen? Es hätte sicherlich nichts gebracht, ihn darauf hinzuweisen, dass ich in einigen Büchern den britischen Geheimdienst als deutlich kompetentere Organisation dargestellt habe, als ich sie im wahren Leben kennengelernt hatte. Und wohl auch nicht, dass einer seiner höchsten Beamten sagte, DerSpion, der aus der Kälte kam sei »der einzige Einsatz eines verfluchten Doppelagenten, der jemals funktioniert hat«. Und auch nicht, dass ich mit der Beschreibung der nostalgischen Kriegsspielchen einer isolierten britischen Abteilung in diesem Roman, der ihn so aufgebracht hatte, vielleicht etwas Ambitionierteres im Sinn hatte als nur einen plumpen Angriff auf seine Dienststelle. Der Himmel stehe mir bei, wenn ich behaupten würde, dass es für einen Schriftsteller, der sich darum bemüht, die Seele eines Landes zu erforschen, überhaupt keinen Sinn ergäbe, sich einmal den Geheimdienst vorzunehmen. Der Blitz würde mich treffen, bevor ich zu Ende sprechen könnte.
Und wenn es darum geht, dass sein Dienst sich nicht wehren könne, nun, ich nehme mal an, dass es keinen Geheimdienst in der westlichen Welt gibt, der von seinen Medien mehr umsorgt wird als der unsere. ›Embedded‹ trifft es nur unzureichend. Unsere Selbstzensur, ob nun aus eigenem Antrieb oder durch eine vage, drakonische Gesetzgebung angespornt, die Fertigkeit, raffiniert auf unsere Medien Einfluss zu nehmen, und die Tatsache, dass die britische Öffentlichkeit eine umfassende, auf zweifelhafter Legitimität fußende Überwachung einfach so hinnimmt, erfüllen jeden Spion in der freien und unfreien Welt mit blankem Neid.
Es würde wohl auch nichts nützen, wenn ich auf die vielen ›abgesegneten‹ Memoiren ehemaliger Angehöriger des Geheimdienstes verweise, die den Dienst in der Form präsentieren, in der er gern bewundert werden möchte, oder auf die ›offiziellen Darstellungen‹, die einen Schleier der Vergebung über seine besonders abscheulichen Verbrechen breiten. Und wohl auch nicht, wenn ich auf die zahllosen zusammengestoppelten Artikel in unseren überregionalen Zeitungen aufmerksam mache, die nach erheblich angenehmeren Zusammentreffen entstanden sind als jenem Mittagessen, das ich mit Maurice Oldfield erlebt habe.
Und wenn ich meinem wütenden Bekannten nun sagte, dass ein Schriftsteller der Gesellschaft einen kleinen Dienst erweist? Gerade weil er Berufsspione als fehlbare Menschen darstellt, die so sind wie wir anderen auch. Vielleicht erfüllt er sogar, Gott bewahre, einen demokratischen Auftrag, wo doch in Großbritannien die Spionagedienste noch immer, auf Gedeih und Verderb, geistige Heimat unserer politischen, gesellschaftlichen und industriellen Elite sind.
Denn weiter, werter ehemaliger Kollege, reicht meine Illoyalität nicht. Und weiter, werter verschiedener Lord Healey, reicht mein Kommunismus nicht, was man, wenn ich so darüber nachdenke, von Ihnen in Ihrer Jugend nicht sagen kann.
Es ist schwierig, ein halbes Jahrhundert später die Atmosphäre des Misstrauens zu vermitteln, die in den Fluren der geheimen Macht in Whitehall während der späten 50er und frühen 60er herrschte. Als ich 1956 formell als junger Beamter in den MI5 aufgenommen wurde, war ich fünfundzwanzig. Noch jünger, so sagte man mir, hätte ich nicht sein dürfen. Five, wie wir den Dienst nannten, bildete sich etwas auf seine Reife ein. Leider bot kein noch so hohes Maß an Reife Schutz davor, solche Koryphäen wie Guy Burgess, Anthony Blunt und all die anderen traurigen Verräter jener Zeit anzuheuern, deren Namen im kollektiven britischen Gedächtnis nachhallen wie die halbvergessener Fußballspieler.
Ich war mit großen Erwartungen in den Dienst eingetreten. Meine bisherigen geheimen Heldentaten, so belanglos sie auch gewesen sein mochten, hatten meinen Hunger nach mehr geweckt. Meine Führungsoffiziere waren durchwegs höflich, tüchtig und aufmerksam gewesen. Sie hatten mein Gefühl angesprochen, für diese Aufgabe bestimmt zu sein, und mein Pflichtbewusstsein als gescheiterter Privatschüler neu geweckt. Als Nachrichtenoffizier in Österreich wurde ich ganz ehrfürchtig bei den undurchsichtigen Zivilisten, die in regelmäßigen Abständen in unserem langweiligen Feldlager in Graz auftauchten und ihm einen geheimnisvollen Glanz verliehen, der ihm ansonsten vollkommen abging. Erst als ich in die Zentrale kam, landete ich hart auf dem Boden der Tatsachen.
Eine vor dem Zerfall stehende 25000 Mitglieder starke britische kommunistische Partei auszuspionieren, die mühsam durch MI5-Spitzel zusammengehalten werden musste, entsprach so gar nicht meinen Vorstellungen. Ebenso wenig wie die Doppelmoral, mit der der Dienst seine eigenen Ansprüche nährte. MI5 war, im Guten wie im Bösen, der Sittenrichter über das Privatleben der Beamten und Wissenschaftler des Landes. Bei den damals erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen galten Homosexuelle und andere vermeintlich Perverse als erpressungsgefährdet, und deshalb schloss man sie von der Geheimdienstarbeit aus. Zugleich aber schien der Dienst kein Problem damit zu haben, die Augen vor den Homosexuellen in den eigenen Reihen zu verschließen, und der Generaldirektor lebte unter der Woche offen mit seinem Sekretär und an den Wochenenden mit seiner Frau zusammen; das Ganze ging sogar so weit, dass er den nachts Diensthabenden schriftlich dazu anwies, was er sagen sollte, falls die Gattin anrief und wissen wollte, wo ihr Mann war. Doch wehe der Schreibkraft in der Registratur, deren Rock man zu kurz oder zu eng fand, oder dem verheirateten Beamten, der ihr schöne Augen machte.
Während die oberen Ränge mit alternden Überlebenden der glorreichen Tage von 1939 bis 1945 besetzt waren, rekrutierten sich die mittleren Dienstgrade aus ehemaligen Polizisten und Verwaltungsbeamten aus dem schrumpfenden Kolonialreich. So erfahren diese auch sein mochten, wenn es darum ging, aufmüpfige Eingeborene zu bezwingen, die die Frechheit besaßen, ihr Land zurückzufordern, so wenig behagte es ihnen, das Mutterland zu beschützen, das sie kaum kannten. Die britische Arbeiterklasse kam ihnen so flatterhaft und unverständlich vor wie einst die aufständischen Derwische. Gewerkschaften waren in ihren Augen nichts weiter als kommunistische Tarnorganisationen.
Jungen Agentenjägern wie mir, die nach kräftigerer Kost verlangten, wurde befohlen, ihre Zeit nicht damit zu vergeuden, nach von Sowjets kontrollierten ›Illegalen‹ zu suchen, da es als unumstößliche Wahrheit galt, dass solche Spione nicht auf britischem Boden operierten. Wer das wusste und von wem, erfuhr ich nie. Vier Jahre waren genug. 1960 bat ich um meine Versetzung zum MI6, oder wie meine verärgerten Dienstherren sich ausdrückten, zu »diesen Arschlöchern auf der anderen Seite des Parks«.
Doch lassen sie mich zum Abschied vom MI5 einen Punkt ansprechen, für den ich dem Dienst nicht dankbar genug sein kann. Die strengste Anleitung zum Schreiben von Prosa, die ich je bekam, erteilte mir nicht irgendein Lehrer in der Schule oder Tutor an der Universität, schon gar nicht erhielt ich sie in den Schreibkursen. Die bekam ich bei den humanistisch gebildeten, diensthöheren Beamten im obersten Stock der Zentrale des MI5 in der Curzon Street in Mayfair. Sie schnappten sich meine Berichte mit hämischer Pedanterie, taten meine in der Luft hängenden Halbsätze und überflüssigen Adverbien verächtlich ab, und die Seitenränder meiner unsterblichen Prosa versahen sie mit Bemerkungen wie »redundant«, »weglassen«, »begründen«, »schlampig« oder »wollten Sie das wirklich sagen?«. Keiner der Lektoren, mit denen ich seitdem arbeitete, stellte jemals so hohe, so berechtigte Anforderungen.
Im Frühling 1961 beendete ich den Einführungskurs beim MI6, in dem ich Fertigkeiten erlernt habe, die ich niemals brauchte und schnell wieder vergaß. Bei der Abschlusszeremonie teilte uns der Ausbildungsleiter, ein kräftiger, in Tweed gekleideter Veteran mit rosigem Gesicht und Tränen in den Augen, mit, dass wir nach Hause gehen und auf weitere Befehle warten sollten. Es könne dauern. Der Grund war – und er hätte sich in seinen schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen können, das jemals sagen zu müssen –, ein langjähriger Beamter des Dienstes, der uneingeschränktes Vertrauen genossen hatte, war als sowjetischer Doppelagent enttarnt worden. Sein Name lautete George Blake.
Das Ausmaß von Blakes Verrat war gewaltig und ist es selbst nach heutigen Maßstäben: Er hatte buchstäblich Hunderte von britischen Agenten verraten – Blake selbst konnte nicht mehr überschlagen, wie viele; schon vor ihrem Beginn waren geheime Abhörmaßnahmen geplatzt, die für die nationale Sicherheit als wichtig erachtet wurden, wie der Spionagetunnel in Berlin, um nur ein Beispiel zu geben; dazu kam der komplette Ausfall des Einsatzpersonals des MI6, der sicheren Zufluchtsstätten, der Einsatzpläne und Außenstationen rund um den Globus. Blake, ein äußerst fähiger Agent auf beiden Seiten, war zudem auf Sinnsuche und hatte zum Zeitpunkt seiner Enttarnung (in dieser Reihenfolge) dem Christentum, dem Judentum und dem Kommunismus angehangen. Während seiner Haftzeit in Wormwood Scrubs, aus dem ihm später eine so spektakuläre Flucht gelang, erteilte er seinen Zellengenossen Einführungen in den Koran.
Zwei Jahre nach den verstörenden Nachrichten über George Blakes Verrat arbeitete ich als Zweiter Sekretär (Politik) an der britischen Botschaft in Bonn. Mein dortiger Standortleiter rief mich eines späten Abends in sein Büro und teilte mir mit, was jeder Engländer am folgenden Tag in der Zeitung lesen sollte: Kim Philby, der brillante ehemalige Kopf der Gegenspionage beim MI6, einst aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des Geheimdienstchefs, war ebenfalls russischer Spion, und zwar, wie wir erst nach und nach erfahren sollten, schon seit 1937.
An anderer Stelle in diesem Buch finden Sie einen Bericht von Nicholas Elliott, Philbys engem Freund, Vertrauten und Kollegen im Krieg wie im Frieden, über deren letzte Begegnung in Beirut, die schließlich zu einem Teilgeständnis Philbys führen sollte. Vielleicht fällt Ihnen dabei auf, dass Elliotts Bericht rätselhafterweise nicht die Spur von Zorn oder Entrüstung aufweist. Der Grund dafür ist ganz einfach. Spione sind keine Polizisten, und sie sind auch nicht die moralischen Realisten, für die sie sich gern halten. Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, für die eigenen Ziele Verräter zu gewinnen, dann können Sie sich schlecht darüber beklagen, wenn sich bei einem der Ihren herausstellt, dass er von jemand anderem akquiriert wurde, selbst wenn Sie ihn wie einen Bruder geliebt oder als Kollegen geschätzt und sämtliche Seiten der Geheimarbeit mit ihm geteilt haben. Diese Lektion hatte ich mir zu Herzen genommen, als ich Der Spion, der aus der Kälte kam schrieb. Auch später bei Dame, König, As, Spion leuchtete mir Kim Philbys trübes Licht den Weg.
Spionagetätigkeit und Schriftstellerei sind wie füreinander geschaffen. Beide erfordern sie ein waches Auge für menschliche Verfehlungen und die vielen Wege hin zum Verrat. Jene unter uns, die irgendwann einmal zum inneren Kreis der Geheimniskrämerei gehört haben, werden ihn nie wieder verlassen. Wenn wir die dort herrschenden Gewohnheiten nicht schon teilten, bevor wir eintraten, gingen sie uns hier in Fleisch und Blut über. Zum Beweis dafür brauchen wir nur an Graham Greene und die Anekdoten rings um sein selbstverschuldetes Versteckspiel mit dem FBI zu denken. Vielleicht sind sie von einem seiner ungnädigeren Biographen festgehalten worden; danach zu suchen lohnt nicht die Mühe.
Sein ganzes späteres Leben lang war Greene, der Schriftsteller und ehemalige Agent, davon überzeugt, auf der Schwarzen Liste des FBI zu stehen. Für diese Annahme hatte er gute Gründe, angesichts seiner zahlreichen Besuche in der Sowjetunion, seiner fortgesetzten und unverblümten Loyalität gegenüber seinem Freund und Agentenkollegen Kim Philby und seiner vergeblichen Bemühungen, Katholizismus und Kommunismus unter einen Hut zu bringen. Als die Berliner Mauer errichtet wurde, ließ sich Greene auf der falschen Seite ablichten und verkündete der Welt, er sei lieber hier als dort. Tatsächlich erreichten Greenes Aversion gegen die Vereinigten Staaten und seine Furcht vor den Konsequenzen seiner radikalen Äußerungen ein derartiges Ausmaß, dass er darauf bestand, alle Treffen mit seinem amerikanischen Verleger auf die kanadische Seite der Grenze zu verlegen.
Doch irgendwann kam der Tag, als er endlich Einsicht in seine FBI-Akte verlangen konnte. Sie enthielt nur einen Eintrag: Er hatte der politisch sprunghaften britischen Ballerina Margot Fonteyn beigestanden, als sie den zum Scheitern verurteilten Kampf für ihren gelähmten und treulosen Mann Roberto Arias führte.
Nicht die Spionage lehrte mich Verschwiegenheit. Ausflüchte und Täuschungsmanöver waren die wichtigsten Waffen meiner Kindheit. In der Jugend sind wir alle irgendwie Spione, aber ich hatte schon Erfahrung. Als mich die Welt der Geheimnisse holte, kam das für mich einer Heimkehr gleich. Warum das so war, hat seinen richtigen Platz erst in dem späteren Kapitel »Der Sohn des Vaters des Autors«.
2
Globkes Gesetze
Blödes Bonn, so nannten wir jungen britischen Diplomaten den Ort Anfang der 60er, nicht aus Gründen einer speziellen Respektlosigkeit gegenüber dem verschlafenen Städtchen, einst Residenz des Kölner Kurfürsten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und Geburtsort Ludwig van Beethovens, sondern eher aus Skepsis gegenüber den absurden Träumen unserer Gastgeber, den Sitz der Hauptstadt Deutschlands irgendwann einmal nach Berlin zu verlegen, Träume, die wir ihnen im sicheren Bewusstsein, dass dies niemals eintreten würde, gern gönnten.
1961 hatte die britische Botschaft, ein stilloser Gebäudeblock einer Fabrik entlang der Bundesstraße zwischen Bonn und Bad Godesberg, dreihundert Mitarbeiter, von denen allerdings die meisten zu Hause arbeiteten, nicht vor Ort. Bis heute habe ich keine Ahnung, was die anderen von uns Jungdiplomaten in dieser stickigen rheinischen Atmosphäre so trieben. Doch kam es während dieser drei Jahre in Bonn für mich zu derart maßgeblichen Veränderungen in meinem Leben, dass ich heute den Eindruck habe, Bonn war der Ort, an dem meine Vergangenheit zu Ende ging und meine Karriere als Schriftsteller begann.
Zwar war zu diesem Zeitpunkt mein erster Roman bereits in London von einem Verlag angenommen worden, doch seinen bescheidenen Auftritt hatte das Buch erst, nachdem ich bereits ein paar Monate in Bonn verbracht hatte. Ich weiß noch, dass ich an einem diesigen Sonntagnachmittag zum Flughafen Köln/Bonn fuhr und mir die britischen Zeitungen kaufte, um dann den Wagen in Bonn abzustellen, mich auf eine geschützte Parkbank zu setzen und die Besprechungen für mich allein zu lesen. Die Rezensenten waren gnädig mit mir, wenn auch nicht so enthusiastisch, wie ich gehofft hatte. Sie waren einverstanden mit George Smiley. Das war dann plötzlich auch schon alles.
Wahrscheinlich kommen alle Schriftsteller irgendwann im Laufe ihres Lebens an diesen Punkt: all die Wochen und Monate voller Verzweiflung und falscher Ansätze; das kostbare fertige Manuskript; der schon rituelle Enthusiasmus von Agent und Verleger; das Lektorat; die hohen Erwartungen; die Angst vor dem großen Tag; die Besprechungen, und plötzlich ist alles vorüber. Du hast das Buch vor einem Jahr geschrieben, warum also sitzt du jetzt hier herum, statt ein neues Buch zu schreiben?
Ehrlich gesagt, genau das tat ich.
Ich hatte einen Roman begonnen, der in einer Privatschule spielt. Als Hintergrund dienten mir Sherborne, wo ich Schüler, und Eton, wo ich Lehrer gewesen war. Es gibt einen Hinweis, dass ich die Arbeit an diesem Roman bereits aufgenommen hatte, als ich noch in Eton unterrichtete, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Da ich für gewöhnlich zu einer unchristlichen Zeit aufstand, bevor ich mich auf den Weg in die Botschaft machte, wurde ich binnen kurzem mit dem Text fertig und reichte ihn ein. Wieder eine Arbeit geschafft – aber beim nächsten Mal, hatte ich beschlossen, würde ich etwas mutiger werden. Ich wollte über die Welt vor meiner Haustür schreiben.
Nach einem Jahr en poste umfasste mein Aufgabenbereich ganz Westdeutschland, und ich hatte völlige Bewegungsfreiheit und überall ungehinderten Zugang. Als einer der Wanderprediger der Botschaft für Großbritanniens Eintritt in den Gemeinsamen Markt konnte ich mich selbst in die Rathäuser, zu den politischen Gesellschaften und in die Vorzimmer der Bürgermeister im ganzen Land einladen. Angesichts der Entschlossenheit des jungen Westdeutschlands, sich als offene, demokratische Gesellschaft zu zeigen, standen dem neugierigen, jungen Diplomaten alle Türen offen. Ich konnte den ganzen Tag auf der Diplomatengalerie des Bundestags sitzen und mit den Parlamentsreportern und -beratern zu Mittag essen. Ich konnte an die Türen der Ministerien klopfen, an Protestkundgebungen ebenso teilnehmen wie an abgehobenen Wochenendseminaren über Kultur und deutsche Seele; die ganze Zeit über versuchte ich, auszuloten, wo das alte Deutschland endete und das neue begann. 1961 war das nicht ganz einfach. Zumindest nicht für mich.
Ein Zitat des Bundeskanzlers Konrad Adenauer, gern als ›der Alte‹ apostrophiert, der das Amt von der Gründung der Bundesrepublik 1949 bis zum Jahr 1963 bekleidete, fasste mein Problem wunderbar zusammen: »Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat.« Es wird allgemein angenommen, dass der Satz sich indirekt auf Dr. Hans Josef Maria Globke bezieht, seine graue Eminenz in Fragen der nationalen Sicherheit – und nicht nur in dem Zusammenhang. Selbst nach Nazi-Maßstäben war Globkes Bilanz beeindruckend. Noch vor Hitlers Machtergreifung hatte er sich dadurch hervorgetan, dass er antisemitische Gesetze für das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern entwarf.
Zwei Jahre später war er unter seinem neuen Führer an der Formulierung der Nürnberger Gesetze beteiligt, die allen Juden die deutsche Staatsbürgerschaft entzog und sie aus Gründen der Identifikation zwang, die zusätzlichen Namen Sara oder Israel zu tragen. Nichtjuden, die mit Juden verheiratet waren, wurde befohlen, sich von ihren Partnern zu trennen. Während Globke unter Adolf Eichmann im Referat für Judenangelegenheiten arbeitete, saß er an der Ausarbeitung eines neuen Gesetzes »zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«, dem Startsignal für den Holocaust.
Gleichzeitig schaffte Globke es, aufgrund seines strengen Katholizismus, nehme ich an, sich die Rückendeckung rechtsgerichteter Widerstandsgruppen zu sichern; das ging so weit, dass er für höchste Ämter vorgesehen war, falls die Verschwörer Hitler erfolgreich losgeworden wären. Vielleicht konnte er deshalb nach Kriegsende den halbherzigen Versuchen der Alliierten entkommen, ihn vor Gericht zu stellen. Adenauer wollte Globke an seiner Seite haben. Die Briten traten Globke nicht in den Weg.
So kam es, dass 1951, gerade einmal sechs Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, Dr. Hans Globke eine Gesetzesinitiative zugunsten seiner früheren und gegenwärtigen Nazi-Kollegen durchbrachte, die heute unbegreiflich ist. Durch Globkes Neues Gesetz, wie ich es nennen möchte, erhielten Beamte des Hitlerregimes, deren Laufbahnen aufgrund von Umständen unterbrochen worden waren, die sich ihrer Kontrolle entzogen, die völlige Restitution von Gehalt, Gehaltsnachzahlung und Pensionsansprüchen, die sie genossen hätten, wenn der Zweite Weltkrieg entweder nicht stattgefunden oder Deutschland ihn gewonnen hätte. Kurz gesagt, sie hatten Anrecht auf jede Beförderung, die sie hätten erwarten können, wäre ihre Beamtenlaufbahn weitergegangen und nicht durch einen Sieg der Alliierten beeinträchtigt worden.
Die Wirkung zeigte sich unmittelbar. Die alte Nazi-Garde klammerte sich an die besten Posten. Die jüngere, weniger bescholtene Generation wurde zu einem Leben auf den unteren Sprossen der Leiter verdonnert.
Auftritt Dr. Johannes Ullrich, Gelehrter, Archivar, Liebhaber von Bach, gutem roten Burgunder und preußischer Militärgeschichte. Im April 1945, ein paar Tage bevor Berlins letzter Stadtkommandant sich den Russen bedingungslos ergab, tat Ullrich, was er in den zehn Jahren davor auch schon getan hatte: Er verfolgte fieberhaft seine Arbeit als Kurator und Archivar im Politischen Archiv im Auswärtigen Amt in der Wilhelmstraße. Da das Kaiserreich 1918 untergegangen war, war kein Dokument, das durch seine Hände ging, jünger als siebenundzwanzig Jahre.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.